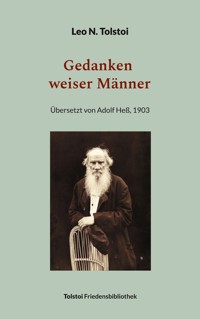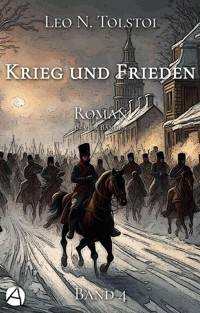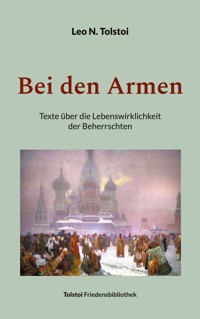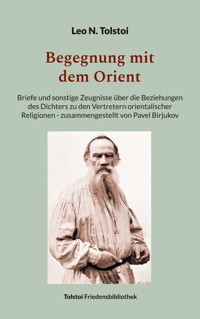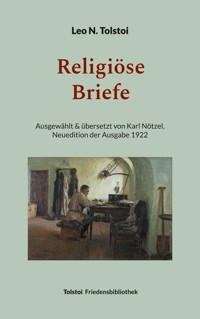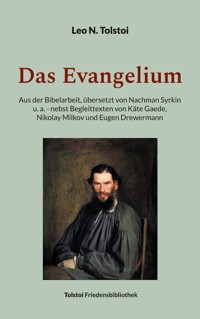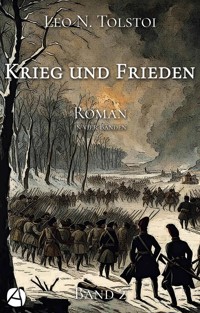
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Napoleon gegen Russland
- Sprache: Deutsch
Tolstois episches Meisterwerk verflechtet das Leben privater und öffentlicher Personen während der Zeit der napoleonischen Kriege und der französischen Invasion in Russland. Die Schicksale der Rostows und der Bolkonskys, von Pierre, Natascha und Andrej, sind eng mit der nationalen Geschichte verbunden, die sich parallel zu ihrem Leben abspielt. Bälle und Soireen wechseln sich ab mit Kriegsräten und den Machenschaften von Staatsmännern und Generälen, Szenen heftiger Kämpfe mit alltäglichen menschlichen Leidenschaften in einem Werk, dessen außergewöhnliche Vorstellungskraft nie übertroffen wurde. Die vielen kleinen und großen Charaktere scheinen zu handeln und sich zu bewegen, als wären sie durch Schicksalsfäden miteinander verbunden, während der Roman unerbittlich Ideen von freiem Willen, Schicksal und Vorsehung hinterfragt. Tolstois Darstellung der ehelichen Beziehungen und Szenen der Häuslichkeit ist ebenso wahrheitsgetreu und ergreifend wie die großen Themen, die ihnen zugrunde liegen. Dies ist der zweite Band von insgesamt vier Bänden des Meisterwerks von Leo N. Tolstoi in der Übersetzung von L. A. Hauff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LEO N. TOLSTOI
KRIEG UND FRIEDEN
Roman
in vier Bänden
BAND 2
In der Übersetzung
von
L. A. Hauff
KRIEG UND FRIEDEN wurde in der hier zugrundeliegenden Übersetzung zuerst veröffentlicht von O. Janke, Berlin 1893.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
BAND 2
ISBN 978-3-96130-623-7
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Krieg und Frieden. Band 2
Impressum
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
ApePoints sammeln
Zu guter Letzt
61
Am 3. März waren alle Zimmer des englischen Klubs von einer geräuschvollen Menge erfüllt. Die Mehrzahl der Anwesenden waren alte, ehrwürdige Leute mit breiten, selbstzufriedenen Gesichtern, dicken Fingern, entschiedenen Bewegungen und lauten Stimmen. Die Mitglieder dieser Sorte saßen an ihren bekannten Stellen und bewegten sich in gewohnten Kreisen. Der kleinere Teil der Anwesenden bestand aus zufälligen Gästen, meist jüngeren Leuten, darunter Denissow, Rostow und Dolochow, welcher wieder Offizier des Semenowschen Regiments geworden war. Auf den Gesichtern der Jugend, besonders des kriegerischen Teils derselben, lag der Ausdruck geringschätziger Ehrerbietigkeit gegen die Alten, welcher der alten Generation sagte: »Wir sind bereit, euch Ehre anzutun, aber erinnert euch, daß die Zukunft uns gehört.« Neswizki war anwesend als altes Mitglied des Klubs. Peter, welcher sich auf Befehl seiner Frau die Haare hatte schneiden lassen, die Brille abgelegt hatte und nach der neuesten Mode gekleidet war, ging mit kummervoller, weinerlicher Miene durch die Säle. Wie immer und überall umgab ihn eine Atmosphäre von Leuten, die sich vor seinem Reichtum beugten und die er mit seiner gewohnten Herablassung und Geringschätzigkeit behandelte. Seinem Alter nach gehörte er zur Jugend, sein Reichtum und seine Verbindungen aber wiesen ihn in die Kreise der alten Ehrengäste, und deshalb ging er von einem Kreis zum anderen.
Graf Rostow ging geschäftig durch die Zimmer und begrüßte die bedeutenden und unbedeutenden Persönlichkeiten, die er alle kannte. Sein Sohn stand am Fenster mit Dolochow, mit dem er kürzlich bekannt geworden war und den er sehr schätzte. Der alte Graf ging zu ihnen und drückte Dolochow die Hand.
Man hörte Glocken erklingen, die Vorsteher eilten hinaus, die Gäste sammelten sich im großen Saal beim Eingang.
Im Vorzimmer erschien Bagration ohne Mütze und Degen, in einer neuen Uniform mit russischen und ausländischen Orden. Er hatte sich augenscheinlich eben erst die Haare und den Bart schneiden lassen, was sein Aussehen unvorteilhaft veränderte, eine naive, feiertägliche Miene verlieh seinen starken, männlichen Zügen etwas Komisches. Er wußte nicht, wo er die Hände lassen sollte und schritt ungeschickt über das Parkett. Die Vorsteher empfingen ihn an der Tür, sprachen ihre Freude über den teuren Gast aus und führten ihn dem Saale zu. Graf Rostow kam aus einem Nebenzimmer mit anderen Vorstehern und trug eine große silberne Schüssel, die er dem Fürsten Bagration reichte. In der Schüssel lagen gedruckte Lobgedichte auf den Helden. Bagration blickte sich erschrocken und hilfesuchend um, dann griff er resigniert mit beiden Händen zu und sah den Grafen vorwurfsvoll an. Jemand nahm diensteifrig die Schüssel aus den Händen Bagrations, welcher sich schon darein ergeben zu haben schien, sie bis zum Abend mit sich herumzutragen. Der Dichter nahm die Gedichte und begann sie vorzulesen, doch bald wurde er von einem lauten Ruf, es sei serviert, unterbrochen. Die Tür öffnete sich und Graf Rostow warf dem Dichter einen bösen Blick zu, welcher eben deklamierte:
»Der Donner des Sieges erschalle,Freue dich, tapferes Rußland!«
Er verbeugte sich gegen Bagration. Alle standen auf, da sie das Diner für wichtiger hielten als die Gedichte, und Bagration wurde zu Tische geführt. Mit ihm setzten sich noch dreihundert wichtige und unwichtige Personen zu Tisch. Noch ehe man speiste, stellte Graf Rostow seinen Sohn dem Fürsten vor, der ihn erkannte und einige ungeschickte Worte sprach, wie immer an diesem Tag. Der alte Graf blickte sich stolz und stumm um, während Bagration mit seinem Sohne sprach. Nikolai saß mit Denissow und seinem neuen Bekannten Dolochow fast in der Mitte der Tafel, ihnen gegenüber hatte Peter Platz genommen, neben ihm Fürst Neswizki. Der alte Graf Rostow saß mit den übrigen Vorstehern Bagration gegenüber und bemühte sich, die Freude Moskaus zum Ausdruck zu bringen.
Seine Mühe war nicht vergebens gewesen, das Diner war prachtvoll, aber er vermochte doch nicht vor dem Ende ruhig zu sein. Er winkte dem Haushofmeister zu, erteilte den Dienern flüsternd Befehle und erwartete nicht ohne Aufregung jeden ihm bekannten Gang. Beim zweiten Gang knallten die Pfropfen und die Diener gossen Champagner ein.
»Es werden noch viele Toaste folgen, deshalb ist es Zeit, anzufangen«, flüsterte der Graf, nahm das Glas zur Hand und stand auf. Alle schwiegen. »Die Gesundheit des Herrn und Kaisers!« rief er und in seinen Augen glänzten Tränen des Entzückens. Die Nationalhymne: »Der Donner des Sieges erschalle«, fiel ein. Alle standen auf und schrien Hurra. Auch Bagration schrie mit derselben Stimme wie damals bei Schöngraben. Der junge Rostow überschrie alle dreihundert Stimmen. Er war dem Weinen nahe. »Hurra!« schrie er und warf sein geleertes Glas auf den Fußboden. Viele folgten seinem Beispiel und es dauerte lange, bis wieder Ruhe eintrat. Die Diener sammelten die Scherben und alle setzten sich. Dann folgte ein Toast auf Bagration und noch viele andere. Es wurden noch viele Gläser zerbrochen und noch viel geschrien. Bei dem Toast auf den alten Grafen Rostow nahm dieser sein Taschentuch und verbarg weinend sein Gesicht darin.
62
Peter aß und trank stark, wie immer, aber es mußte an diesem Tag eine große Veränderung mit ihm vorgegangen sein. Er schwieg beständig, zog die Stirn zusammen und blickte sich zerstreut um; von dem, was um ihn her vorging, schien er nichts zu hören und zu sehen und sich immer mit demselben peinlichen Gedanken zu beschäftigen.
Dieser ihn beständig quälende Gedanke war durch die Anspielung seiner Cousine in Moskau über den Verkehr Dolochows mit seiner Frau hervorgerufen worden, besonders aber durch einen anonymen Brief, den er an diesem Morgen erhalten hatte und in welchem im Ton gemeinen Spottes, der allen anonymen Briefen eigen ist, gesagt war, er sehe schlecht durch seine Brille, und die Liebschaft seiner Frau mit Dolochow sei nur für ihn allein ein Geheimnis. Peter glaubte weder an die Anspielung der Fürstin noch an den Brief, aber der Anblick Dolochows, der ihm gegenübersaß, war ihm peinlich. Sooft seine Blicke den schönen, dreisten Augen Dolochows begegneten, empfand Peter eine wilde Aufregung und er wandte sich sogleich ab. Er erinnerte sich an die Vergangenheit seiner Frau und an ihre Beziehungen zu Dolochow und glaubte jetzt deutlich zu sehen, daß das, was in dem Brief stand, die Wahrheit sein konnte und daß es auch ihm wahr erscheinen könnte, wenn es nicht seine Frau betroffen hätte. Peter erinnerte sich unwillkürlich auch daran, wie Dolochow nach seiner Rückkehr in Petersburg als Freund und Zechgenosse ihn besucht und eine Anleihe bei ihm gemacht hatte. Dann erinnerte er sich auch daran, wie Helene lächelnd ihr Mißvergnügen darüber ausgesprochen hatte, daß er Dolochow in sein Haus aufgenommen habe, und wie Dolochow in zynischem Tone die Schönheit seiner Frau gerühmt und bis zu seiner Ankunft in Moskau sich keinen Augenblick von ihnen getrennt hatte.
»Ja, er ist sehr hübsch«, dachte Peter, »und ich kenne ihn! Es würde ihm besonderes Vergnügen machen, meinen Namen zu beschimpfen, gerade deshalb, weil ich für ihn sorgte und ihm half.« Er erinnerte sich auch an Dolochows Gesichtsausdruck, wenn er in wilder Stimmung war, wie damals, als er den Polizeioffizier auf den Bären band, oder wenn er ohne alle Veranlassung jemand zum Duell herausforderte.
»Ja, er ist ein Raufbold«, dachte Peter. »Er ist imstande, mit Gleichgültigkeit einen Menschen zu morden, und freut sich, daß alle ihn fürchten«, dachte Peter, und wieder fühlte er, wie eine wilde Erregung sich in seinem Innern erhob. Dolochow, Denissow und Rostow schienen sehr heiter zu sein, sie sprachen lebhaft miteinander und blickten zuweilen spöttisch zu Peter herüber, dessen mächtige Gestalt und schweigsame Zerstreutheit aufzufallen begann. Rostow blickte Peter feindselig an, weil dieser in seinen Augen nichts weiter war als ein Geldsack, der Mann einer schönen Frau und ein altes Weib, und dann auch, weil Peter in seiner Zerstreutheit Rostow nicht erkannt und seine Verbeugung nicht erwidert hatte. Bei dem Toaste auf den Kaiser war Peter in Gedanken sitzengeblieben.
»Sie da!« rief ihm Rostow zu, »hören Sie nicht? Die Gesundheit des Kaisers!«
Peter erhob sich nervös, trank sein Glas aus, und nachdem sich alle wieder gesetzt hatten, wandte er sich mit seinem gutmütigen Lächeln an Rostow. »Ich habe Sie nicht erkannt«, sagte er.
Aber Rostow achtete nicht darauf und schrie: »Hurra!«
»Warum erneuerst du nicht die Bekanntschaft?« flüsterte ihm Dolochow zu.
»Er ist ein Dummkopf, ich will nichts von ihm wissen«, erwiderte Rostow.
»Die Männer schöner Frauen muß man hätscheln«, sagte Denissow.
Peter hörte nicht, was sie sagten, aber er begriff, daß es sich auf ihn bezog und wandte sich errötend ab.
»Nun, jetzt auf die Gesundheit der schönen Frauen!« sagte Dolochow, und mit ernster Miene, aber einen spöttischen Ausdruck in den Mundwinkeln, wandte er sich an Peter. »Auf die Gesundheit schöner Frauen, Petruschka, und ihrer Liebhaber!« sagte er.
Peter schlug die Augen nieder und trank sein Glas aus, ohne Dolochow zu antworten. Ein Diener, welcher ein Loblied auf Kutusow verteilte, legte vor Peter, als einen der vornehmsten Gäste, ein Blatt. Peter wollte es ergreifen, aber Dolochow bog sich herüber, nahm ihm das Blatt aus der Hand und begann zu lesen.
Peter blickte Dolochow an. Die wilde Aufregung, die ihn während des ganzen Diners gequält hatte, erhob sich wieder und überwältigte ihn. Er bog sich mit seinem ganzen Körper über den Tisch hinüber. »Wagen Sie nicht, das anzurühren!« rief er.
Dolochow blickte Peter mit vergnügten, boshaften Augen an, als ob er sagen wollte: »So gefällst du mir!« – »Ich gebe es nicht her!« sagte er kurz.
Bleich und mit zuckenden Lippen entriß ihm Peter das Blatt. »Sie ... Sie ... sind ein nichtswürdiger Mensch! Ich fordere Sie heraus!« rief er, schob den Stuhl zurück und stand vom Tische auf. In diesem Augenblick schien ihm, daß die so quälende Frage über die Schuld seiner Frau endgültig und unzweifelhaft in bejahendem Sinne entschieden war. Er verabscheute sie.
Ungeachtet der Bitte Denissows, sich nicht in diese Sache einzumischen, willigte Rostow ein, Dolochows Sekundant zu sein. Er besprach sich nach Tisch mit Neswizki, dem Sekundanten Besuchows, über die Bedingungen des Duells. Peter fuhr nach Hause, Rostow aber blieb mit Dolochow und Denissow bis zum späten Abend im Klub und hörte den Zigeunern, Musikanten und Sängern zu.
»Also auf morgen bei den Sperlingsbergen«, sagte Dolochow, als er sich von Rostow trennte.
»Und du bist ruhig?« fragte Rostow.
Dolochow blieb stehen.
»Siehst du«, sagte er, »ich werde dir mit zwei Worten das ganze Geheimnis des Duells offenbaren. Wenn du vorher dein Testament machst und zärtliche Briefe an die Eltern schreibst, wenn du daran denkst, daß du fallen könntest, so bist du ein Dummkopf und jedenfalls verloren. Aber wenn du mit dem festen Entschluß hingehst, den Gegner so schnell als möglich abzutun, dann geht alles gut! Ein Bärenjäger aus dem Kostromaschen sagte mir einmal: ›Wie sollte man den Bären nicht fürchten? Sobald man ihn aber sieht, ist auch die Angst weg, solange er nicht davongeht.‹ Nun, so ist's auch mit mir. Auf morgen, mein Lieber!«
Am andern Morgen um acht Uhr fuhr Peter mit Neswizki nach den Sperlingsbergen, wo sie Dolochow, Denissow und Rostow schon vorfanden. Peter sah aus wie ein Mensch, der an etwas ganz anderes als an das Bevorstehende denkt. Sein verschlafenes Gesicht war gelb, er schien die ganze Nacht nicht geschlafen zu haben und kniff die Augen zusammen, als ob ihm die Sonne zu hell scheine. Zwei Gedanken nahmen ihn ausschließlich in Anspruch, die Schuld seiner Frau, an der nach der schlaflosen Nacht nicht der geringste Zweifel übriggeblieben war, und die Unschuld Dolochows, der durchaus keine Ursache hatte, die Ehre eines ihm fremden Menschen zu hüten.
»Vielleicht hätte ich an seiner Stelle ebenso gehandelt«, dachte Peter. »Das ist sogar wahrscheinlich. Wozu nun dieses Duell, dieser Mord? Entweder töte ich ihn, oder er trifft mich in den Kopf, in den Ellenbogen, in das Knie! Ich möchte fort von hier, mich irgendwo vergraben!« Aber gerade in diesem Augenblick, wo ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, fragte er mit besonders ruhigem und zerstreuten Aussehen, das den anderen Achtung einflößte: »Ist alles bereit?«
In den Schnee gesteckte Säbel bezeichneten die Barrieren, bis zu welcher jeder vorgehen konnte. Als die Pistolen geladen waren, trat Neswizki auf Peter zu.
»Ich würde meine Pflicht schlecht erfüllen, Graf, sagte er mit schüchterner Stimme, »und Ihr Vertrauen und die Ehre, die Sie mir erwiesen, indem Sie mich zu Ihrem Sekundanten wählten, nicht rechtfertigen, wenn ich in diesem wichtigen Augenblick Ihnen nicht die ganze Wahrheit sagen würde. In bin der Meinung, daß die Sache keine Bedeutung hat und nicht wert ist, darum Blut zu vergießen. Sie hatten unrecht, Sie sind hitzig geworden ...«
»Ach ja, die Geschichte ist schrecklich dumm«, sagte Peter.
»Dann erlauben Sie mir, Ihr Bedauern auszusprechen, und ich bin überzeugt, daß unsere Gegner sogleich einwilligen werden, Ihre Entschuldigung anzunehmen«, sagte Neswizki, welcher wie die anderen Anwesenden und alle in ähnlichen Fällen nicht daran glaubte, daß es wirklich zum Duell kommen werde. »Sie wissen, Graf, es ist viel edler, einen Mißgriff einzugestehen, als die Sache zum Äußersten zu treiben. Von keiner Seite sind Beleidigungen gefallen, also erlauben Sie mir, darüber zu verhandeln!«
»Nein, was ist da zu reden?« fragte Peter. »Es ist ganz gleichgültig! Also, fertig?« fragte er. »Sagen Sie mir nur, wohin ich zu gehen und zu schießen habe.« Mit einem unnatürlich milden Lächeln nahm er die Pistole in die Hand, fragte, wie man abdrücke, da er noch niemals eine Pistole in der Hand gehabt hatte, was er nicht eingestehen wollte.
»Ach ja! Also so? Ich weiß! Ich hatte es nur vergessen.«
»Keine Entschuldigung, entschieden nicht«, sagte Dolochow zu Denissow, welcher seinerseits auch Versuche zur Versöhnung machte. Dann trat er auch auf die bestimmte Stelle.
Der Platz für das Duell war etwa achtzig Schritte vom Wege, auf welchem die Schlitten zurückblieben, gewählt worden. Auf einer kleinen Waldlichtung, welche mit halbaufgetautem Schnee bedeckt war, standen die Gegner etwa vierzig Schritt voneinander entfernt am Rande der Lichtung. Die Sekundanten maßen in dem feuchten, tiefen Schnee die Schritte ab, und Neswizki und Denissow steckten ihre Säbel zehn Schritte voneinander entfernt in den Schnee, um dadurch die Schranken anzudeuten. Das neblige Tauwetter dauerte fort, so daß auf vierzig Schritte nichts zu erkennen war. Nach drei Minuten waren sie fertig, zögerten aber immer noch, zu beginnen. Alle schwiegen.
63
»Nun, fangen wir an!« sagte Dolochow.
»Meinetwegen«, sagte Peter, immer mit demselben Lächeln.
Die Sache, welche so leicht begonnen hatte, war nicht mehr aufzuhalten, sie ging ihren Weg, unabhängig vom Willen der Menschen und das Schicksal mußte sich erfüllen. Denissow trat an die Barriere und rief: »Da die Gegner die Versöhnung zurückweisen, so können wir beginnen. Nehmen Sie die Pistolen und auf drei beginnen Sie vorzurücken!«
»Eins! – Zwei! – Drei!« rief Denissow laut und trat zur Seite. Beide schritten einander näher und näher. Die Gegner hatten das Recht, bis zur Schranke vorzugehen und zu schießen, sobald sie wollten. Dolochow ging langsam, ohne die Pistole zu erheben, und blickte mit seinen glänzenden blauen Augen das Gesicht seines Gegners an. Wie immer lag ein spöttischer Zug um seinen Mund.
Auf »drei« eilte Peter mit raschen Schritten vorwärts durch den tiefen Schnee. Er erhob die Pistole und streckte den rechten Arm aus, da er zu befürchten schien, sich mit dieser Pistole selbst zu verletzen, und blickte vor sich hin, dann wieder rasch nach Dolochow, zog den Finger ein, wie man ihn gelehrt hatte, und schoß. Er hatte einen so starken Schlag nicht erwartet und zuckte vor seinem eigenen Schuß zusammen; dann lächelte er selbst darüber und blieb stehen. Der dichte Rauch und Nebel verhinderten ihn, im ersten Augenblick etwas zu sehen, aber der zweite Schuß, den er erwartete, kam nicht. Er hörte nur die eiligen Schritte Dolochows, dessen Gestalt er durch den Rauch sah. Mit einer Hand hielt er seine Seite, die andere hielt die gesenkte Pistole. Sein Gesicht war bleich. Rostow eilte zu ihm und sprach einige Worte.
»Nein«, erwiderte Dolochow durch die Zähne, »nein, es ist noch nicht aus!« Dann machte er noch einige schwankende Schritte bis zum Säbel und fiel neben demselben in den Schnee. Seine linke Hand war blutig; er wischte sie an seinem Mantel ab und stützte sich darauf. Sein Gesicht war bleich und finster und zuckte.
Peter konnte kaum die Tränen zurückhalten, lief auf Dolochow zu und wollte schon den Zwischenraum zwischen beiden Barrieren überschreiten, als Dolochow ihm zuschrie: »An die Barriere!« Peter begriff, um was es sich handelte und blieb bei seinem Säbel stehen. Nur zehn Schritte trennten sie. Dolochow ließ den Kopf herabsinken und nahm gierig einen Mund voll Schnee, dann erhob er wieder den Kopf, richtete sich auf und verschlang den kalten Schnee. Seine Lippen zuckten, aber er lächelte noch immer; seine Augen glänzten vor Anstrengung und Wut, er erhob die Pistole und zielte.
»Seitwärts! Decken Sie sich mit der Pistole!« sagte Neswizki.
»Decken Sie sich!« rief sogar Denissow seinem Gegner zu. Mit einem Lächeln des Bedauerns und der Reue stand Peter mit seiner breiten Brust gerade vor Dolochow und blickte ihn kummervoll an. Denissow, Rostow und Neswizki warteten gespannt; zu gleicher Zeit vernahmen sie einen Schuß und einen Wutschrei Dolochows.
»Gefehlt!« rief Dolochow und fiel kraftlos mit dem Gesicht auf den Schnee. Peter faßte sich an die Stirn, wandte sich um und ging in den Wald durch den tiefen Schnee.
»Unsinnig! ... Unsinnig! ... Der Tod! ... Lüge! ...« rief er laut.
Neswizki holte ihn ein und führte ihn nach Hause, während Rostow und Denissow den verwundeten Dolochow fortbrachten. Schweigend, mit geschlossenen Augen lag Dolochow im Schlitten und gab auf alle Fragen keine Antwort. Als sie sich Moskau näherten, erhob er mit Mühe den Kopf und ergriff die Hand Rostows, der neben ihm saß. Rostow war erstaunt über den ganz veränderten, merkwürdig zärtlichen Gesichtsausdruck Dolochows.
»Nun, wie fühlst du dich?« fragte Rostow.
»Schlecht. Aber nicht darum handelt es sich, mein Freund! Wo sind wir? Das wird ihr Tod sein, sie wird es nicht ertragen! Sie wird es nicht überleben!«
»Wer?« fragte Rostow.
»Meine Mutter, mein angebeteter Engel, meine Mutter!« Und Dolochow brach in Tränen aus. Als er sich etwas beruhigt hatte, teilte er Rostow mit, daß er bei seiner Mutter wohne, und wenn sie ihn sterbend erblicken würde, so würde sie das nicht ertragen. Er bat Rostow, zu ihr zu fahren und sie vorzubereiten.
Rostow fuhr voraus, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und zu seinem großen Erstaunen erfuhr er, daß Dolochow, dieser Tollkopf und Raufbold, in Moskau mit seiner alten Mutter und einer verwachsenen Schwester zusammenwohnte und der zärtlichste Sohn und Bruder war.
64
Während der nächsten Zeit sah Peter selten seine Frau allein. Wie in Petersburg, so war auch in Moskau ihr Haus beständig von Gästen erfüllt. In der Nacht nach dem Duell betrat er, was häufig vorkam, nicht das Schlafzimmer und übernachtete in seinem großen Kabinett, demselben, in welchem Graf Besuchow gestorben war. Er legte sich auf einen Diwan und wollte einschlafen, um alles zu vergessen, aber vergebens. Er sah Helene vor sich, in der ersten Zeit nach der Hochzeit mit bloßen Schultern und leidenschaftlichen Blicken, und plötzlich erschien neben ihr das hübsche, freche, spöttische Gesicht Dolochows, wie er es beim Diner gesehen hatte, und dann wieder dasselbe Gesicht, bleich und schmerzverzerrt, wie damals, als es in den Schnee sank.
»Was ist geschehen?« fragte er sich. »Ich habe einen Liebhaber getötet! Ja, den Liebhaber meiner eigenen Frau! Ja, so war's! Warum? Wie bin ich dazu gekommen?« – »Weil du sie geheiratet hast,« erwiderte eine innere Stimme. »Aber wer ist schuld daran?« fragte er. »Du selbst, weil du sie geheiratet hast, ohne sie zu lieben, weil du sie und dich selbst betrogen hast!« Und er erinnerte sich, wie er beim Fürsten Wassil gesagt hatte: »Ich liebe Sie.« – »Davon kommt alles her.« Dann erinnerte er sich an den Honigmonat und errötete. Besonders lebhaft peinlich und beschämend war ihm die Erinnerung daran, wie er einmal, bald nach der Hochzeit, um Mittag im seidenen Schlafrock aus dem Schlafzimmer in das Kabinett trat, wo ihn sein Verwalter erwartete, welcher, sich höflich verbeugend, Peters Miene und seinen Schlafrock betrachtete und lächelte, als ob er seine Teilnahme für das Glück seines Herrn ehrerbietig ausdrücken wollte.
»Wie oft bin ich stolz gewesen auf ihre majestätische Schönheit, auf ihren feinen Takt«, dachte er, »und über ihre Unnahbarkeit. Das ist's, worauf ich stolz war! Anatol kam zu ihr, um Geld zu entlehnen, und küßte sie auf ihre nackten Schultern. Sie gab ihm kein Geld, ließ sich aber küssen. Ihr Vater suchte scherzend ihre Eifersucht zu erregen, aber sie sagte mit ruhigem Lächeln, sie sei nicht dumm genug, um eifersüchtig zu sein, er möge machen, was er wolle! Das sagte sie in meiner Gegenwart. Ich fragte sie einmal, ob sie sich nicht Mutter fühle, und sie antwortete mir mit geringschätzigem Lächeln, sie sei nicht so einfältig, um sich Kinder zu wünschen, und sie werde von mir keine Kinder haben.« Dann erinnerte er sich an ihre grobe Denkungsart, an ihre vulgären Ausdrücke. »Ja, ich habe sie nie geliebt!« wiederholte Peter. »Ich wußte, daß sie ein lasterhaftes Weib ist, wagte aber nicht, es mir einzugestehen.«
Peter war einer der Leute, welche ungeachtet ihrer inneren Charakterschwäche keinen Vertrauten für ihren Kummer suchen. Er bekämpfte allein seinen Kummer. In der Nacht rief er den Kammerdiener und befahl, einzupacken, um nach Petersburg zu reisen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er jetzt mit ihr sprechen sollte. Er beschloß, morgen abzufahren und ihr durch einen Brief seine Absicht mitzuteilen, sich auf immer von ihr zu trennen.
Als am Morgen der Kammerdiener ins Kabinett trat und Kaffee brachte, lag Peter mit einem aufgeschlagenen Buche in der Hand schlafend auf dem Diwan. Er erwachte und blickte sich lange erschrocken um, unfähig, zu begreifen, wo er sich befand.
»Die Gräfin läßt fragen, ob Eure Erlaucht zu Hause seien?« fragte der Kammerdiener.
Noch ehe Peter sich besann, welche Antwort er geben sollte, trat die Gräfin in einem Hauskleid von weißem Atlas, mit aufgelösten Haaren, ruhig und majestätisch ein. Auf ihrer Marmorstirn lag eine Falte des Zorns. Mit ihrer unerschütterlichen Ruhe wartete sie, bis der Kammerdiener das Zimmer verlassen hatte. Sie hatte von dem Duell gehört und war gekommen, darüber zu sprechen; mit verächtlichem Lächeln blickte sie ihn an.
»Was ist das wieder? Was sind das für Streiche, frage ich Sie?« begann sie in strengem Ton. »Mich?« fragte Peter.
»Was wollten Sie mit diesem Duell beweisen, frage ich Sie?«
Peter wandte sich schwerfällig auf dem Diwan um, öffnete den Mund, konnte aber nicht antworten.
»Wenn Sie nicht antworten, so werde ich es Ihnen sagen«, fuhr Helene fort. »Sie glauben alles, was Ihnen die Leute sagen! Man hat Ihnen gesagt« – Helene lächelte – »Dolochow sei mein Liebhaber, und Sie haben es geglaubt! Was haben Sie damit bewiesen? Daß Sie ein Dummkopf sind, wie schon alle wissen. Was wird die Folge sein? Ich werde in ganz Moskau lächerlich erscheinen, jeder wird sagen, Sie haben in der Trunkenheit einen Menschen zum Duell herausgefordert, auf den Sie ohne Grund eifersüchtig waren« – Helene sprach immer lauter und wurde immer heftiger – »und welcher in jeder Beziehung besser ist als Sie!«
»Hm! Hm!« brummte Peter mit finsterer Miene, ohne sie anzusehen und ohne ein Glied zu rühren.
»Und warum glaubten Sie, daß er mein Liebhaber sei? Weil ich seine Gesellschaft liebe? Wenn Sie klüger und angenehmer wären, so hätte ich die Ihrige vorgezogen!«
»Sprechen Sie nicht mit mir, ich bitte Sie!« erwiderte Peter mit heiserer Stimme.
»Warum soll ich nicht sprechen? Ich sage es offen heraus, es wird selten eine Frau geben, welche mit einem solchen Mann wie Sie sich keinen Liebhaber nimmt, und das habe ich nicht getan«, sagte sie.
Peter wollte etwas erwidern, sah sie mit schrecklichen Augen an, deren Ausdruck sie nicht verstand, und legte sich wieder nieder. Er empfand physischen Schmerz in diesem Augenblick, er fühlte einen Druck auf der Brust und konnte nicht atmen.
»Es ist das beste, wir trennen uns!« sagte er kurz.
»Trennen? Meinetwegen, aber nur, wenn Sie mir ein Vermögen geben!« erwiderte Helene. »Trennen! Damit wollen Sie mich schrecken?«
Peter sprang auf und stürzte schwankend auf sie zu. »Ich erwürge dich!« rief er. Er nahm vom Tisch eine Marmorplatte, und mit einer ihm selbst unbekannten Kraft machte er einen Schritt auf sie zu und schwang sie über ihr.
Helene schrie entsetzt auf und suchte zu entfliehen. Peter empfand Entzücken in der Wut, er warf die Platte weg und zerschlug sie. »Hinaus!« schrie er mit so schrecklicher Stimme, daß man im ganzen Hause mit Schrecken diesen Schrei vernahm. Gott weiß, was Peter in diesem Augenblick getan hätte, wenn Helene nicht geflohen wäre.
Nach einer Woche stellte Peter seiner Frau eine Vollmacht aus, alle seine Güter in Großrußland zu verwalten, was mehr als die Hälfte seines Vermögens war. Dann fuhr er allein nach Petersburg.
65
Zwei Monate waren vergangen, seitdem die Nachricht von der Schlacht bei Austerlitz und dem Fall des Fürsten Andree in Lysy Gory eingetroffen war, und ungeachtet aller Nachforschungen mit Hilfe der Gesandtschaft wurde seine Leiche nicht gefunden, und er befand sich auch nicht unter den Gefangenen. Das Schlimmste für die Verwandten war, daß immer noch die Möglichkeit vorhanden war, daß er von den Einwohnern auf dem Schlachtfeld aufgehoben worden sei und vielleicht genesend oder sterbend irgendwo allein unter Fremden liege, ohne die Kraft zu haben, Nachricht von sich zu geben. Die Zeitungen enthielten, wie immer, sehr kurze und unbestimmte Berichte darüber, daß die Russen nach einer glänzenden Schlacht sich zurückziehen mußten, und daß der Rückzug in vollkommener Ordnung ausgeführt worden sei. Der alte Fürst schloß aus diesem offiziellen Bericht, daß die Unsrigen geschlagen worden seien. Nach einer Woche kam auch ein Brief von Kutusow.
»Ihr Sohn ist vor meinen Augen«, schrieb Kutusow, »mit der Fahne in der Hand, vor dem Regiment gefallen, würdig seines Vaters und seines Vaterlandes. Leider haben wir bis jetzt nicht erfahren können, ob er am Leben sei oder nicht. Ich hoffe das erstere, weil er sonst unter den auf dem Schlachtfeld gebliebenen Offizieren verzeichnet sein würde, von welchen ich ein Verzeichnis durch Parlamentäre erhalten habe.«
Nachdem der alte Fürst diese Nachricht erhalten hatte, lebte er nach seiner gewohnten Lebensweise weiter. Er sprach mit niemand davon, war schweigsam und sah grimmig aus.
»Ach, Fürstin«, sagte er am nächsten Morgen, als Marie zur Lektion erschien.
Sie näherte sich ihm, sah ihm ins Gesicht und eine bange Ahnung befiel sie. »Papa! Andree?« rief sie.
»Habe Nachricht erhalten! Nicht unter den Gefangenen, nicht unter den Verwundeten!« rief er mit schriller Stimme. »Er ist gefallen!«
Marie fiel nicht in Ohnmacht. Sie vergaß ihre Angst vor dem Vater, näherte sich ihm, zog ihn an sich und küßte seinen hageren Hals.
»Väterchen«, sagte sie, »wenden Sie sich nicht ab von mir, wir wollen zusammen weinen.«
»Die Strolche!« schrie der Alte. »Richten die Armee zugrunde und die Menschen! Wofür! Geh, geh, sage es Lisa! Ich werde auch kommen.«
Die kleine Fürstin saß an einer Arbeit mit jenem Ausdruck ruhigen Glücks in ihren Zügen, welcher zukünftigen Müttern eigen ist.
»Was ist dir, Marie?« fragte sie, als sie Marie mit Tränen in den Augen eintreten sah.
»Nichts, ich bin nur so schwermütig wegen Andree.«
Mehrmals machte Marie einen Anfang, die kleine Fürstin vorzubereiten, wurde aber stets von Tränen unterbrochen. Die Tränen, deren Grund die junge Frau nicht kannte, beunruhigten sie, so wenig Beobachtungsgabe sie auch besaß. Sie blickte sich schweigend um, als ob sie etwas suchte. Vor Tisch trat der alte Fürst in ihr Zimmer, vor dem sie sich immer fürchtete, mit einem besonders aufgeregten, zornigen Gesicht; doch ohne ein Wort zu sprechen, verließ er das Zimmer wieder. Sie sah Marie an und brach plötzlich in Tränen aus.
»Habt ihr Nachricht von Andree?« fragte sie.
»Nein. Du weißt, daß noch keine Nachricht da sein kann. Aber Papa ist unruhig.«
»Nichts weiter?«
»Nein«, sagte Marie. Sie hielt es für besser, ihr nichts zu sagen, und überredete den Alten, die schreckliche Nachricht noch geheimzuhalten. Marie und der alte Fürst trugen und verbargen ihren Kummer, jedes nach eigener Weise. Der Alte wollte nicht mehr hoffen und entschied, Fürst Andree sei tot, und obgleich er einen Verwalter nach Österreich schickte, um nach Spuren seines Sohnes zu suchen, bestellte er doch zugleich in Moskau ein Denkmal, welches er in seinem Garten aufstellen wollte. Er sagte allen, sein Sohn sei gefallen, und bemühte sich, seine bisherige Lebensweise einzuhalten. Aber seine Kräfte verließen ihn; er ging weniger, aß weniger, schlief weniger und wurde mit jedem Tag schwächer.
Fürstin Marie hoffte noch, sie betete für ihren Bruder wie für einen Lebenden, und erwartete jeden Augenblick die Nachricht von seiner Rückkehr.
66
In jedem Lächeln, in jeder Bemerkung, sogar in jeder Bewegung lag ein Anflug von Trauer, die sich auf dieses Haus herabgesenkt hatte. Auch das Lächeln der kleinen Fürstin, welche sich der allgemeinen Stimmung anpaßte, obgleich sie deren Veranlassung nicht kannte, erinnerte jetzt an die allgemeine Trauer.
»Meine Liebe, ich fürchte, von dem heutigen Frühstück wird mir übel werden«, sagte sie zu Marie.
»Was ist dir? Du bist bleich geworden, meine Liebe, sehr bleich!« sagte Marie erschreckt.
»Soll man nicht zu Maria Bogdanowna senden?« sagte eine der Kammerzofen. Maria Bogdanowna war die Wartefrau aus der Kreisstadt, welche schon seit zwei Wochen in Lysy Gory wohnte.
»Ja, wirklich«, bestätigte Marie, »ich werde zu ihr gehen.«
»Ach, nein, nein!« rief die Fürstin, und auf ihrem Gesicht erschien kindliche Angst vor unvermeidlichem physischen Leiden. »Nein, ich habe mir nur den Magen verdorben. Wirklich, Mascha!«
Maria eilte in das Zimmer der Wartefrau. Diese kam ihr schon mit verständnisvoller, ruhiger Miene entgegen, indem sie die kleinen, vollen, weißen Hände rieb.
»Maria Bogdanowna, es scheint, es fängt an!« sagte Marie erschrocken.
»Nun, Gott sei Dank, Fürstin!« erwiderte sie, ohne sich zu übereilen.
»Aber warum ist der Arzt aus Moskau noch nicht gekommen?«
»Schadet nichts. Beruhigen Sie sich!« sagte Maria Bogdanowna. »Es wird auch ohne den Doktor alles gut werden.«
Marie saß allein in ihrem Zimmer und horchte auf jedes Geräusch. Zuweilen, wenn jemand vorüberging, öffnete sie die Tür. Bald hörte sie, wie etwas Schweres vorübergetragen wurde und blickte hinaus. Zwei Diener trugen einen ledernen Diwan, der im Kabinett des Fürsten Andree gestanden hatte, ins Schlafzimmer. Auf ihren Mienen lag feierliche Ruhe. Sie wagte nicht zu fragen, verschloß die Tür und betete. Nach dem allgemeinen Glauben, je weniger Leute von den Leiden einer Gebärenden wissen, um so leichter werden diese Leiden sein, bemühten sich alle, unbefangen auszusehen.
Im großen Mädchenzimmer herrschte Stille; im Dienerzimmer saßen alle schweigend und erwartend da. Der alte Fürst ging in seinem Kabinett auf und ab und sandte Tichon zu Maria Bogdanowna.
»Sage nur, der Fürst hat befohlen, zu fragen: – was? Und dann sage mir, was sie geantwortet hat.«
»Melde dem Fürsten, die Geburt habe begonnen«, sagte Maria Bogdanowna. Tichon ging und meldete es dem Fürsten.
»Gut«, sagte der Fürst und schloß die Tür hinter sich. Tichon hörte nicht das geringste Geräusch mehr im Kabinett. Er wartete einige Zeit, dann trat er ein, als ob er Kerzen anstecken wollte. Der Fürst lag ruhig auf dem Diwan. Tichon sah ihn an, wiegte den Kopf, trat schweigend näher und küßte den Fürsten auf die Schulter. Dann ging er, ohne die Kerzen angezündet zu haben und ohne zu sagen, warum er gekommen war. Das erhabenste Geheimnis der Welt nahm seinen Verlauf. Der Abend verging, die Nacht brach an, und das Gefühl der gespannten Erwartung vor dem unerreichbar Erhabenen wuchs beständig. Niemand schlief.
Es war eine jener stürmischen Märznächte, wo der Winter mit verzweifelter Wut um seine entschwindende Herrschaft zu kämpfen scheint. Auf die Landstraße waren Reiter mit Laternen ausgesandt worden, um den Doktor aus Moskau zu erwarten.
»Gott ist gnädig«, sagte die alte Amme Maries, welche mit einem Strickstrumpf bei der Tür saß, »es wird kein Doktor nötig sein.« Plötzlich riß ein Windstoß einen Fensterflügel auf, die Gardinen blähten sich auf und ein Strom von Kälte und Schnee stürmte ins Zimmer und löschte das Licht aus. Fürstin Marie fuhr auf, die Amme eilte ans Fenster, um es zu schließen.
»Mütterchen, da kommt jemand die Allee herauf«, sagte sie, »mit Laternen. Das muß der Doktor sein.«
»Ach, Gott sei Dank!« sagte Marie. »Ich muß ihm entgegengehen; er versteht nicht Russisch.« Marie warf einen Schal um und eilte hinaus. Im Vorzimmer sah sie durch das Fenster, daß ein Wagen vor der Hauptpforte stand. Sie ging auf die Treppe hinaus, auf dem Geländer standen Talgkerzen, welche im Wind flackernd zerschmolzen. Philipp, der Diener, stand mit ängstlichem Gesicht unten auf dem ersten Absatz der Treppe. Noch weiter unten hörte sie Schritte großer Pelzstiefel auf der Treppe und eine ihr bekannte Stimme sprach einige Worte.
»Gott sei Dank!« sagte die Stimme. »Und Batuschka?«
»Haben sich schlafen gelegt«, erwiderte der Haushofmeister Demjan.
Dann fragte die Stimme noch einiges, was Demjan beantwortete. Die Schritte der Pelzstiefel näherten sich schneller der noch unsichtbaren Wendung der Treppe.
»Ist das Andree?« dachte Marie. »Nein, das kann nicht sein, es wäre zu außerordentlich!« dachte sie.
In demselben Augenblick erschien auf dem Treppenabsatz, wo der Diener mit der Kerze stand, das Gesicht und die Gestalt des Fürsten Andree im Pelz, ganz mit Schnee bedeckt. Ja, das war er! Aber bleich und hager, mit veränderter, seltsam milder, aber sorgenvoller Miene. Er kam die Treppe herauf und umarmte die Schwester.
»Habt ihr meinen Brief nicht erhalten?« fragte er, und ohne eine Antwort abzuwarten, die er auch nicht erhalten hätte, weil die Fürstin nicht sprechen konnte, wandte er sich nach dem Doktor um, der ihm folgte, und ging mit raschen Schritten weiter die Treppe hinauf und wieder umarmte er die Schwester.
»Mascha! Meine Liebe!« rief er, warf den Pelz ab und ging nach dem Zimmer der Fürstin Lisa.
67
Die junge Frau lag auf dem Diwan mit einem weißen Häubchen auf dem Kopfe. Die Schmerzen hatten sie eben erst verlassen, die schwarzen Haare umgaben ihre glühenden, mit Schweiß bedeckten Wangen, der rote, entzückende Mund war geschlossen und sie lächelte freudig. Fürst Andree trat ins Zimmer und blieb vor dem Diwan stehen, auf dem sie lag. Ihre glänzenden Augen blickten mit kindlicher Angst und Erregung ihn an. Sie sah ihn, begriff aber nicht die Bedeutung seines Kommens.
Fürst Andree küßte sie auf die Stirn.
»Mein Seelchen!« sagte er, ein Wort, das er nie gesagt hatte, »Gott ist gnädig!...« Sie blickte ihn fragend und vorwurfsvoll an.
»Ich habe Hilfe von dir erwartet und nichts kam«, sagte ihr Blick. Sie wunderte sich nicht, daß er gekommen war, und begriff es auch nicht.
Die Schmerzen begannen wieder, und Maria Bogdanowna riet dem Fürsten, das Zimmer zu verlassen. Der Doktor trat ein. Fürst Andree ging mit Marie in ihr Zimmer. Sie sprachen flüsternd und immer wieder verstummte das Gespräch. Sie warteten und horchten.
»Gehe hinein, Andree«, sagte Marie.
Fürst Andree ging wieder zu seiner Frau und setzte sich wartend im Nebenzimmer nieder. Eine Frau kam aus ihrem Zimmer mit erschrecktem Gesicht und wurde verlegen, als sie ihn sah. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen und saß einige Zeit regungslos, dann vernahm er klägliches, hilfloses Stöhnen, stand auf, ging zur Tür und wollte sie öffnen, aber jemand hielt sie fest. »Man kann jetzt nicht eintreten«, hörte er sagen. Er ging im Zimmer auf und ab. Plötzlich ertönte ein schrecklicher Aufschrei im Nebenzimmer. Fürst Andree stürzte an die Tür. Der Schrei war verstummt. Man hörte das Weinen eines Kindes.
»Warum hat man ein Kind hierhergebracht?« dachte Fürst Andree im Augenblick. »Was für ein Kind? Warum? Oder ist das das Neugeborene?« Plötzlich begriff er die freudige Bedeutung dieses Weinens und brach selbst in Tränen aus. Die Tür öffnete sich, der Arzt kam in Hemdärmeln bleich und mit zitternder Kinnlade aus dem Zimmer. Fürst Andree wandte sich nach ihm um, aber der Arzt blickte ihn niedergeschlagen an und ging vorüber, ohne ein Wort zu sagen. Eine Frau stürzte heraus, und als sie Fürst Andree erblickte, blieb sie verwirrt bei der Tür stehen. Er trat in das Zimmer seiner Frau. Sie lag tot in derselben Lage, in der er sie vor fünf Minuten gesehen hatte, und derselbe Ausdruck wie zuvor lag auf diesem entzückenden, kindlichen Gesichtchen.
»Ich liebe euch alle und habe niemand Böses zugefügt, warum habt ihr mir das getan?« sagte das schöne, traurige Gesicht. In einer Ecke des Zimmers wimmerte etwas Kleines, Rotes in den weißen, zitternden Händen von Maria Bogdanowna.
Zwei Stunden später trat Fürst Andree mit leisen Schritten in das Kabinett seines Vaters. Der Alte wußte schon alles. Er stand bei der Tür, und sowie diese sich öffnete, umfaßte er mit zitternden Händen den Hals seines Sohnes und weinte wie ein Kind.
Nach drei Tagen ertönte der Sterbegesang für die junge Fürstin. Fürst Andree trat an den Sarg, um von ihr Abschied zu nehmen. Auch im Sarg schien ihre Miene, wenn auch mit geschlossenen Augen, zu sagen: »Ach, was habt ihr mir getan?« und Fürst Andree fühlte, wie sein Herz zerriß. Er fühlte sich belastet mit einer Schuld, die er nicht wieder gutmachen und nicht vergessen konnte. Er konnte nicht weinen. Auch der alte Fürst trat ein und küßte ihr wachsbleiches Händchen, das ruhig auf dem anderen lag. Auch ihm sagte ihre Miene: »Ach, warum habt ihr mir das getan?« Und der Alte wandte sich betrübt ab.
Nach fünf Tagen wurde der junge Fürst Nikolai Andrejewitsch getauft. Der Großvater und Taufpate fürchtete, ihn fallen zu lassen, und übergab ihn seiner Taufmutter, der Fürstin Marie. Fürst Andree saß voll Angst, daß das Kind nicht ertränkt werde, im anderen Zimmer und erwartete die Beendigung der Zeremonie. Freudig blickte er das Kind an, als die Wärterin es ihm brachte.
68
Rostows Teilnahme am Duell Dolochows mit Besuchow wurde durch die Bemühungen des alten Grafen vertuscht. Rostow wurde nicht degradiert, wie er erwartet hatte, sondern zum Adjutanten des Generalgouverneurs von Moskau ernannt. Deshalb konnte er nicht mit der ganzen Familie fortreisen und blieb den Sommer in seiner neuen Stellung in Moskau.
Dolochow genas, und Rostow befreundete sich sehr mit ihm. Dolochow lag krank bei seiner Mutter, die ihn leidenschaftlich und zärtlich liebte und ihre Liebe auch auf Rostow übertrug, mit dem sie oft über ihren Sohn sprach. Oft war Rostow über die Bemerkungen Dolochows im Gespräch erstaunt, die er nicht von ihm erwartet hatte.
Im Herbst kam Graf Rostow mit seiner Familie nach Moskau zurück. Mit Anfang des Winters kehrte auch Denissow nach dort zurück und wohnte bei Rostows. Der Anfang des Winters 1806, den Nikolai Rostow in Moskau zubrachte, war die glücklichste und heiterste Zeit für ihn und die ganze Familie. Nikolai führte viele junge Leute in sein Elternhaus ein. Wera war ein zwanzigjähriges schönes Mädchen, Sonja ein sechzehnjähriges mit allen Reizen einer sich entfaltenden Knospe, und Natalie ein Backfisch mit kindlichem Lachen.
Eine besondere Atmosphäre von Verliebtheit herrschte hier, wie in jedem Hause, wo sehr hübsche und junge Mädchen sind. Unter den jungen Leuten, die Rostow einführte, war einer der ersten Dolochow, der allen im Hause gefiel, mit Ausnahme von Natalie. Beinahe hätte sie sich seinetwegen mit ihrem Bruder gezankt. Sie behauptete, er sei ein böser Mensch, im Duell habe Peter recht gehabt, und Dolochow sei unangenehm und bösartig.
»Ich will nichts von ihm hören«, rief Natalie, »er ist böse und gefühllos. Da ist mir dein Denissow lieber! Ich weiß nicht, wie ich es dir ausdrücken soll.«
»Man muß verstehen, was dieser Dolochow für ein Herz hat, man muß ihn mit seiner Mutter sehen.«
»Davon weiß ich nichts, aber er mißfällt mir. Und weißt du, daß er sich in Sonja verliebt hat?«
»Unsinn!«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: