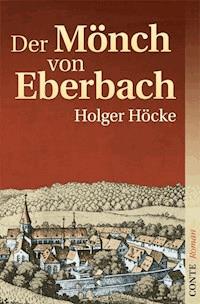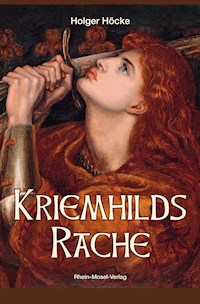Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kriemhild von Burgund, die Schwester der Könige Gunther, Gernot und Giselher – sie sucht in einer von Männern dominierten Welt voller Machtspiele und Intrigen ihren eigenen Weg. Nach einem furchtbaren Albtraum fasst die junge Prinzessin den Entschluss, niemals einen Mann zu heiraten. Doch als eines Tages Siegfried von Xanten in Worms erscheint, ist plötzlich alles anders. Aber Siegfried ist nicht nur ein strahlender Held, er hat auch seine düsteren Seiten. Was will Siegfried wirklich? Welche Geheimnisse hütet er? Und warum verhält er sich manchmal so sonderbar, ja geradezu verstörend? Während der junge König Giselher dem Mann aus Xanten wie einem Bruder zugetan ist, ruft dessen Aufenthalt in Worms zugleich Neider und Feinde auf den Plan. Allen voran den alten Heermeister Burgunds, Hagen von Tronje. Auch Gunther verfolgt seine eigenen Pläne ohne Rücksicht auf andere. Als er schließlich die schöne Brünhild von Island durch einen arglistigen Betrug zur Frau gewinnt, überstürzen sich die Ereignisse, und nichts ist mehr so, wie es einmal war ... Holger Höcke hat den Sagenstoff des Nibelungenliedes völlig neu erzählt und dabei mit vielen originellen Ideen gewürzt. Ein packender Roman im Spannungsfeld zwischen historischer Realität, Sage und Märchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2018 – e-book-Ausgabe RHEIN-MOSEL-VERLAG Zell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-865-4 Ausstattung: Stefanie Thur Titel: Mädchen mit roten Haaren, Franz Thöne, 1895
Holger Höcke
Kriemhild und ihre Brüder
Roman
Rhein-Mosel-Verlag
Ez wuohs in Burgonden ein vil edel magedîn,
daz in allen landen niht schœners mohte sîn,
Kriemhilt geheizen: si wart ein schœne wîp.
dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp.
Nibelungenlied
Prolog
Der Wind frischte auf, fuhr durch den dichten, dunklen Auenwald, ließ das rot und golden verfärbte Laub von Eschen und Erlen zittern und kräuselte das Wasser. Kühler Hauch des Frühherbstes nach einem langen Sommer, der das Land ausgedörrt hatte. Doch nicht nur der Sommer war schuld, dass Burgund versengt dalag, kraftlos und leer. Viel war geschehen, mehr als Menschen ertragen können, mehr als Könige ertragen können – geschweige denn Königinnen.
Über dem Strom lag an diesem Oktobermorgen noch ein zartes Gespinst von Nebel, der nun unter der Brise verwirbelt wurde und merkwürdige Formen bildete, Umrisse, die bald an Tiere erinnerten, bald an Menschen oder gar andere, seltsame Wesen … Sanft bog sich das hohe Schilfgras im Hauch und begann leise zu flüstern.
Im friedlich vor sich hin schwappenden Uferwasser stand ein Graureiher. Unbeweglich starrte er nach unten, auf der Suche nach kleinen Wassertieren. Hätten sich nicht seine lang gebogenen schwarzen Schopffedern leicht im Wind bewegt wie der Helmbusch eines Kriegers, so hätte man den grauweißen Vogel für ein Denkmal halten können. Wo er stand, hatte eben der Wind die letzten Nebelschwaden vertrieben, da erspähte er endlich seine Beute. Es war ein sehr junges silbriges Fischlein, das sich sorglos den langen, stelzigen Beinen näherte, nichts ahnend von seinem nahen Tod – da hob der Reiher aufmerksam den Kopf. Stolz bog er den Hals zurück, schaute sich um und richtete die schwarz umrandeten Augen dann wieder misstrauisch auf die Wasserfläche. Der Fisch war verschwunden. Schließlich öffnete er den Schnabel und stieß einen heiser-krächzenden Ruf aus. Irgendwo am anderen Ufer antwortete ihm ein Eisvogel mit einem hohen Pfeifen. Der Reiher breitete die Flügel gegen den auffrischenden Wind aus, schlug ein paar Mal, ging ein wenig in die Knie und erhob sich dann, um erneut heiser schnarrend davonzufliegen, Richtung Norden. Hastig folgte ihm der Eisvogel, ein kleiner blauer Blitz im diffusen Morgenlicht.
Mit einem Mal war es still am Rhein.
Zwei, drei Manneslängen von der Stelle entfernt, wo eben noch der Reiher gestanden hatte, erhob sich aus dem nassen Element und dem wirbligen grauen Nebel eine Gestalt. Zunächst schien sie noch selbst wie Schleier und Nebelgespinst, unförmig und wabernd, dann erkannte man einen mächtigen Rumpf und kräftige Arme, einen langen, filzigen, von Algen durchsetzten Bart und ebensolches Haupthaar, in dem es feingolden schimmerte wie von einer Krone. Aber anstatt vollends aus den Fluten zu steigen, verharrte die Gestalt bis zum Bauch im Wasser, weich und doch kraftvoll, sanft und doch majestätisch, uralt wie vom Anbeginn der Zeit und doch ewig jung und frisch. So stand die sonderbare Gestalt eine Weile da, mehr als mannsgroß, lauschend, breitete die Arme aus und ließ die Wassermassen durch die grüngrauen Finger hindurchströmen.
»Sie wird kommen. Ich habe Zeit, viel Zeit, anders als die Liebliche aus Worms.«
So wartete er lange, ließ sich vom stärker werdenden Wind Haar und Bart streicheln, wirbelte Sand vom Grund auf und trübte das Wasser, fuhr mit dem grauen Arm durch niedrig hängende Zweige einer Trauerweide … Geduldig wartete er – nennen wir ihn der Einfachheit halber den Alten vom Rhein – Stunde um Stunde.
Dann näherte sich von Süden her etwas auf dem Wasser.
War es ein Boot, ein Baumstamm? War es Mensch oder Fisch? In jedem Fall warf es in der Mitte des Stroms eine mächtige, wohl mannshohe Woge auf. Der Alte in den Uferwellen richtete sich auf und reckte nun die Linke zum Gruß hoch in den Himmel. Sogleich änderte die Woge die Richtung und hielt pfeilgerade auf ihn zu. Ein paar Wimpernschläge später sprang etwas mit mächtigem Schwall auf das Wesen am Ufer zu, ein gewaltiges Rauschen und Platschen, und schließlich hielt der Alte – ein nacktes Weib im Arm. Es hatte die Gestalt einer außerordentlich schönen Frau, die wie er selbst irgendwie alterslos erschien. Das helle Haar hing ihr bis auf die Lenden nieder. Genau wie er war sie von einer seltsamen Farbe, einer Mischung aus Grau und Grün, jedoch wesentlich heller und lieblicher, etwa wie zartes Laub im Frühling.
»Bei allen Nymphen, Nixen und Nöcken! Ungestüm wie immer, meine Schwester!«, rief der Flussgott.
»Da bin ich, großer Bruder! Du hast gerufen und ich komme.«
»Sag, welchen Weg hast du genommen?«
»Den direkten durch das Kalkgebirge, von der Quelle durch unterirdische Höhlen und Gänge, an Tropfsteinen und Gebirgen vorbei. Dünn habe ich mich gemacht, ganz dünn, so wie ein Rinnsal an manchen Stellen. Molche habe ich gesehen, Lurche, Fledermäuse. Zwerge und Alben. Und manch einer hat sich gewundert, dass die schöne Donau Richtung Bruder Rhein unterwegs ist. Ganz gespannt ist sie, deine Schwester.«
Munter sprang sie aus den Armen ihres Bruders hinunter ins Wasser und blickte ihn erwartungsvoll an. Erst da wurde sie gewahr, dass sein Blick finster war, die Stirn faltig.
»Dein Auge ist dunkel. Sag, was hat dich erzürnt?«
»Unglaubliches ist geschehen … Seit Menschengedenken habe ich …«
Der Alte brach ab. Von Ferne trug der Wind ein fremdes Geräusch herbei, Huftrappeln, das rasch lauter wurde. Die beiden verhielten sich still, duckten sich unter das tief hängende Ufergebüsch, tauchten ein in die Wellen und wurden eins mit dem Element. Hastig näherte sich ein Reiter, dessen Gewand und Satteldecke ihn als einen Krieger Burgunds auswiesen, vielleicht ein Kundschafter mit einer wichtigen Botschaft. Er war auf dem Weg Richtung Süden, sein Pferd schwitzend-nass. Als sich die beiden in mäßigem Trab – mehr war auf dem Uferweg wegen der Wurzeln nicht möglich – unserem Ort näherten, wieherte das Pferd schrill, hielt unvermittelt an und bäumte sich auf, den Blick starr auf die Stelle gerichtet, wo eben die beiden Gestalten verschwunden waren.
»Dumme Mähre, was hast du denn?!«, stieß der Reiter hervor, ein hagerer dunkelhaariger Mann in den Dreißigern mit Bartstoppeln. Beinahe wäre er bei dem abrupten Halt abgeworfen worden. Wie das Pferd roch auch er nach Schweiß und Anstrengung. Er erkannte, dass da irgendetwas sein musste, was das Tier erschreckt hatte. Mit mürrischem Gesicht stieg er ab und musterte die Gegend. Das Pferd sog zischend die Luft ein und legte die Ohren an.
»Blöde Mähre«, wiederholte er, »du bist doch so dumm wie dein Schweif. Hat dich ein Frosch erschreckt oder ein springender Fisch? Das fehlt mir gerade noch! Nervöses Biest!«
Er schüttelte missmutig den Kopf und beugte sich dann nieder, um sich Wasser ins Gesicht zu klatschen und ein paar Schlucke zu trinken. Auch sein Reittier soff durstig. Dann klopfte er dem Pferd besänftigend den Hals, stieg hastig auf und trieb das Tier zu größerer Eile an, Richtung Süden, Richtung Worms.
»Es hat sich nichts geändert«, sagte der Alte, während das aufgewühlte Wasser allmählich wieder aufklarte. »Sie hören und sehen nichts. Ihre Tiere sind schlauer als sie. Diese Holzköpfe.«
»Was wolltest du vorhin sagen?«, nahm die Schöne den verlorenen Faden wieder auf. »Deine Worte klangen geheimnisvoll.«
»Unheil gab es hier am Fluss. Unheil gibt es. Und Unheil wird es geben. Die Zeiten sind düster.« Er machte eine Pause und blickte zum Himmel, wo schwere schwarze Wolken aufgezogen waren, wie zur Untermalung seiner Worte. »Es wird Regen geben. Und Sturm …«
»Brüderlein, du machst mir Angst. Wo ist deine Heiterkeit, dein frohes Gemüt, in dem sich die Sonne und die Weingärten spiegeln? Das Lachen der Menschen an deinen Ufern? Das mächtige Brausen unten im Süden, am großen Fall? Die Ruhe des großen Sees?«
»Dahin. – Viel hat sich ereignet oben in der großen Stadt. Nimm dich in Acht, meine schöne Schwester.«
»Ich mich in Acht nehmen? Erzähle doch, erzähle von Beginn an.«
»Ach, Mädchen, schau, was die Liebe so alles anrichtet … Ich sehe dich an – und wenn du nicht meine Schwester wärst, würde ich dir selbst den Hof machen …«
»Du machst mich verlegen«, kam kichernd die Antwort. »Vergiss nicht, dass die Römer mich Danubius genannt haben. Sie dachten, ich sei männlich.«
»Ein großes Volk, dessen Zeit vorbei ist. Ein für alle Mal.«
»So ist es. Lange haben sie hier dem Ansturm der Germanen getrotzt, lange warst du selbst die Grenze, Brüderlein, und nun herrschen die Stämme des Nordens hier am rechten und linken Gestade.«
»Ach, und viel haben sie zerstört. Schon vor Jahren und Jahrzehnten. Viel habe ich schlucken müssen, wovon mir der Bauch schwer wurde. Was ist nicht alles in meinen Fluten versunken, was Menschenhand gemacht! Vom Ufer, von Brücken, von Booten, Flößen, Schiffen gefallen – ja, die Brücke selbst bei Mainz ist abgebrochen worden; auf meinem Grunde unten bei den Aalen träumen die Pfeiler und warten auf den Wiederaufbau. Seit Jahrhunderten schlucke ich, was die Menschen aus Versehen fallen lassen oder loswerden wollen. Und besonders in Kriegszeiten: Schiffe sind angegriffen worden, untergegangen, modern auf meinem Grund vor sich hin, ihre wertvolle Fracht für immer versunken, verborgen: Erz, Metall, Kohle, Holz, aber auch Waffen: Schwerter, Schilde und Bogen, Rüstungen. Auch Geschmeide, Münzen. Und Leichen …«
Der Alte machte eine Pause und schlug mit den riesigen Händen auf die Wasseroberfläche. »Doch was ich jetzt schlucken musste, ist … ist unglaublich.«
»Und warum sagst du mir das? Warum hast du mich gewarnt, Bruder? Was hat das alles zu bedeuten?«
»Wie ich schon sagte: Nimm dich in Acht. Leichen habe ich gesehen, noch mehr Leichen werden folgen. Und diesmal höchstwahrscheinlich an deinen Ufern, weit im Osten.«
»Und woher weißt du das alles?«
»Meinst du, mir entgeht etwas, was in meinem Gebiet vor sich geht? Menschen, ha! Aus dem Wasser kommen sie, aus Wasser bestehen sie, und zum Wasser treibt es sie immer wieder. So auch die eine, die Königstochter und Königsschwester. Sie redet viel vor sich hin, wenn sie allein ist. Trägt ihren Kummer zu mir, zum Wasser, zum Strom, immer wieder … Doch am Ende werden sie alle zu Erde. Ja, zu Erde und Asche werden sie, die Sterblichen, uns Göttern nicht gleich, vergänglich und schwach.«
Er machte eine lange Pause, und die Donau schaute betreten drein. Dann holte der Alte tief Luft, es klang wie ein dumpfes Gurgeln aus einer abgrundtiefen Kehle, und er erzählte.
Vom Grunde her schimmerte es golden.
1. Kapitel Falke und Adler
Kriemhild schrie.
Blut tropfte aus dem braun gesprenkelten Brustgefieder des Falken. Ihres Falken. Sein Blick, eben noch scharf, wie auf eine Beute gerichtet, wurde zusehends matter unter den Schnabelhieben der beiden schwarzen Adler. Die junge Frau konnte es nicht mehr ertragen, wollte es nicht wahrhaben, wollte die Augen schließen und musste doch wie unter einem Zwang hinschauen, wie die großen Raubvögel den kleineren in der Luft attackierten. Immer wieder waren sie auf ihn herabgestoßen. Mehrere Male hatte der Falke ausweichen können, bis der dunklere der beiden Adler, dessen rechtes Auge unter einem Federbüschel merkwürdig verdeckt lag, das Opfer mit einer Klaue am Hals zu packen bekam. Sofort schlug er seinen hakenartig gebogenen gelben Schnabel in den Nacken des Falken. Noch einmal konnte sich dieser mit einer seitlichen Drehung und hastigem Flügelschlagen losreißen und suchte in jäher Panik sein Heil im Steilflug. Die Wolke musste er erreichen, diese große, graue Wolke dort oben, dann wäre er gerettet. Haken schlagen, überraschende Seitbewegungen. Zickzack, schnell, hurtig …
Doch die Adler waren schneller. Mit mächtigen Schwingen holten sie aus und stiegen empor, einer nahte von rechts, der andere von links. Dann packten sie seine Flügel, jeder einen, rissen die hübschen Federn aus, die Kriemhild so oft gestreichelt hatte, und brachten den Jagdvogel zum Absturz. Am Boden zerfleischten sie ihn.
Kriemhild schrie – oder war es der Todesschrei ihres Vogels? Das Schreien hörte nicht auf. Als eine Hand ihr Gesicht berührte, fuhr sie hoch. Was? Wer?
»Kind, wach auf!«
Schräges Frühlingssonnenlicht fingerte grell durch die Ritzen am Rand der ledernen Abdeckung des Fensters in die Kemenate und warf bizarre Muster auf die Decke der Königstochter. Am Bett stand, noch im wollenen Nachtgewand, Ute, besorgt die Wange der Tochter streichelnd.
»Gott sei Dank, Mutter! Es war so … schrecklich.« Kriemhilds Atem ging stoßweise, als hätte sie selbst den Kampf zu führen gehabt.
»Ein Traum nur, sonst nichts. Das war das schwere Essen gestern und vielleicht ein Becher zu viel von dem Rotwein. Du wirst … Doch halt, wo ist …«
Mit dem Blick einer Mutter, die schon viele Erkrankungen ihres Kindes begleitet und erfolgreich kuriert hatte, erkannte Ute, dass Kriemhild leichenblass geworden war, fast grün, und holte mit raschem Griff den hölzernen Eimer unter dem Bett hervor. Gerade noch rechtzeitig konnte sich Kriemhild aufrichten, und ein Schwall übel riechender Reste ihres gestrigen Mahls ergoss sich in den Eimer. Als es vorbei war, sank sie in die Kissen zurück, und Ute rief nach einer Magd, um den Eimer entfernen zu lassen. Dann setzte sie sich auf die Bettkante. Kriemhild begann zu weinen.
»Was hast du geträumt?«
Fast hätte Kriemhild erneut aufgeschrien, so intensiv, so verstörend wirkte das Erlebte nach.
Ute stand noch einmal auf und nahm die Fensterabdeckung ab. »Siehst du, der Himmel ist blau. Ich glaube, es riecht nach Veilchen. Bis hier oben kann ich den Duft wahrnehmen.«
Vom Burghof her erklangen fröhliche Stimmen und das Knattern einer Fahne im Wind.
Aufmunternd nickte sie der Tochter zu und wischte ihr mit einem weichen Tuch den Mundwinkel ab. Dann erzählte Kriemhild, was sie geträumt hatte, einen Traum, der alles übertraf, was sie jemals bei Nacht fantasiert hatte. Es war, als wäre es wirklich passiert.
Die Mutter senkte das Kinn, damit Kriemhild nicht sehen konnte, dass sie betreten schluckte. Zugleich bemühte sie sich um eine heitere Miene. »Meine Kleine … meine Große«, begann sie, sich selbst berichtigend. »Solche bösen Träume nach deinem siebzehnten Geburtstagsfest. Du weißt doch, was man sagt: Träume sind Schäume.« Noch während sie sprach, ahnte die Königinmutter, dass sie Kriemhild nicht täuschen konnte. Draußen erklang der Ruf einer Krähe.
»Mutter, was bedeutet der Traum wirklich?«
»Nichts. Er bedeutet einfach … nichts.«
Kriemhild dachte nach. Sie schluckte bitteren Speichel, griff nach einem Becher und trank einen Schluck, benetzte ihre Stirn. Dann begann sie selbst, ihren Traum auszulegen. »Mutter, ich denke, der Falke ist ein Mann. Mein Mann. Und die beiden Adler sind zwei Männer, die den anderen …«
»Töten? Mein Gott!«
»Ja. Ja … ich bin sicher, das bedeutet es.«
Ute fuhr sich hektisch durch das hochgesteckte graue Haar. Zwei Haarnadeln fielen klappernd zu Boden, das noch immer volle Haar hing nun in Strähnen wirr herab. Noch einmal machte sie einen vergeblichen Versuch, die Tochter aufzumuntern. Sie wusste, dass Kriemhild sich nicht mit billigem Trost abspeisen lassen würde. »Dieser Traum wird nicht wahr«, sagte sie schließlich. »Wer sagt dir, dass du recht hast? Wer sagt denn, dass das wirklich Männer sind und keine Greifvögel? Dafür gibt es keinen Beweis. Nein, das liegt nicht nahe.«
In diesem Augenblick stand Kriemhild auf, strich ihr Nachtgewand glatt und rieb sich die Augen. Sie spielte mit einer Strähne ihres in der Farbe von hellem Kupfer schimmernden Haares, das sich am Ende etwa in Höhe des Bauchnabels leicht kringelte, und trat ans Fenster. Dann sprach sie. Sie sagte etwas, langsam, klar und kalt, ihre Stimme verriet, dass nichts in ihr vorging. Sie sagte es nicht zu ihrer Mutter. Sie redete zum Fenster hinaus, in den Himmel, in Richtung ihrer drei Brüder, in Richtung Burg und Stadt Worms.
»Du hast recht, Mutter: Dieser Traum wird nicht wahr. Denn ich werde niemals einen Mann heiraten.«
Von hinten fasste Ute sie an den Schultern, wollte ihr Halt geben.
»Nichts steht bereits fest, mein Kind. Bete zu Gott, und wenn er ihn – den Mann – in Schutz nimmt, dann wird er leben. Der Traum bleibt ein Traum, und ich …«
Kriemhild hob die Hand und drehte sich um. »Niemals«, wiederholte sie. »Bitte geh jetzt, Mutter, ich will mich ankleiden.«
»Tu das. Und vergiss den Traum! Du würdest einen großen Fehler begehen, indem du auf die Liebe verzichtest. Ich will, dass meine vier Kinder glücklich werden. Es wäre jetzt an der Zeit, dass auch Gunther sich eine Frau sucht. Zum Glück gehört die Liebe, für Gunther, Gernot und Giselher – und auch für dich. Die Zeiten sind friedlich, unser Reich steht fest und ist mit den Nachbarn in Freundschaft verbunden. Ein Albtraum war es, weiter nichts. Mach dich hübsch, du weißt, heute Abend kommt Besuch. Hoher Besuch aus dem Land der Sachsen. Ich bin gespannt, was Lüdeger, der Sachsenkönig will. Vielleicht wird er ja …«
Kriemhild machte eine energische Handbewegung. »Ich weiß, was du sagen willst. Noch einmal: Ich werde niemals einem Mann gehören.«
So kannte Ute ihre Tochter nicht. Betroffen verließ sie den Raum. Doch sie verschwieg etwas. Auch sie hatte in dieser Nacht geträumt. Auch ihr Traum war ein böser gewesen. Sie hatte ein Rudel Hirsche gesehen, angeführt von drei weißen Hirschen und einem schwarzen. Das Rudel war auf einen Abgrund zugerast – und Ute war aufgeschreckt, so wie ihre Tochter vor wenigen Minuten.
Sinnend, was all das zu bedeuten habe, suchte sie die Burgkapelle auf.
Während ihre Mutter vor dem Altar kniete und konzentriert mit zitternden Lippen mehrere Paternoster murmelte, hatte sich Kriemhild schon angezogen. Doch anders, als es einer Königstochter geziemte, trug sie kein elegantes Gewand, sondern hatte Männerkleidung angelegt. Durch eine kleine Pforte verließ sie die Burg und ging, vom Volk unerkannt, durch die Stadt den Weg zum Fluss hinunter. An ihrer Seite war ihr Hund Lothar, ein struppiger Mischling, dem das braune Fell lang über die Augen hing.
Der Fluss führte noch immer Hochwasser. Es hatte viel geregnet im April, und die Schneeschmelze unten in den Alpen hatte den Rhein anschwellen lassen. Ein paar Bäume, die sonst am Ufer standen, hatten nasse Füße. Kriemhild zog die Schuhe aus, krempelte die Hose hoch und watete bis zu den Knien ins Wasser. Ob ich ganz untertauchen soll, fragte sie sich. Das Wasser war noch sehr kalt. Sie wusch sich das Gesicht und genoss den Schmerz, den das frische Element auf der Haut verursachte.
»Nein«, sprach sie laut. »Gunther soll heiraten, wen auch immer. Gernot und Giselher auch. Gunther wird eine liebenswürdige Frau finden, die mir eine gute Schwägerin und wertvolle Freundin sein wird. Ich – nehme – niemals – einen – Mann!« Sie formte mit beiden Händen eine Schüssel, schöpfte Wasser und warf es nach oben, bis es wie ein Regen auf sie niederprasselte. Dann ließ sie sich in die Fluten sinken.
2. Kapitel Burgund und Sachsen
Gunther lachte.
Er lachte und ärgerte sich zugleich über sein asthmatisches Lachen mit dem hastig-hechelnden Ausatmen. Sein Vater hatte einmal behauptet, Gunther sei bei seinem Lachen kurz vor dem Ersticken. Gunther wusste, dass heute alle Blicke auf ihn gerichtet waren und dass er mit seinem roten Gesicht und seinem Nach-Luft-Schnappen eine ungünstige Figur machte. Gerade heute bei dem Festmahl mit solch einem hohen Gast, wo es besonders darauf ankam, dass er, der erste König von Burgund, sich souverän präsentierte. Unsicher schaute er hinüber zu Gernot. Dieser stützte den Kopf in die Hände und versuchte, seinem jüngeren Bruder mit schwerer Zunge etwas mitzuteilen. So war es immer, wenn es etwas zu feiern gab und viel getrunken wurde. So war es leider auch heute.
Im großen Saal in der Wormser Burg hatte Gunther die Tische heute in Form eines lang gezogenen Hufeisens aufstellen lassen. An der Kopfseite saßen Gunther und Gernot, in ihrer Mitte der Ehrengast des Abends: der Herrscher von Sachsen, König Lüdeger, ein Riese an Gestalt. Neben Gunther hatte Kriemhild Platz genommen, sodann ihre Mutter Ute, einen Platz weiter Hagen von Tronje, auf dem Stuhl daneben dessen Bruder Dankwart, der das Amt des Stallmeisters bekleidete. Auf Gernots Seite reihte sich Giselher an, der jüngste der drei Königsbrüder, dann folgte der Römer Cornelius, er war ein Kaufmann aus Mainz, der Spielmann Volker von Alzey, neben ihm der Kämmerer Hunold, dann der junge Ortwin von Metz. An den beiden Längsseiten saßen die Edlen von Burgund und ein halbes Dutzend Männer aus Lüdegers Gefolge.
Sämtliche Fackeln an den Wänden waren entzündet, auf den Tischen standen dicke Kerzen, und die vielen Lichtquellen warfen tanzende Schatten auf die Wände. Auch auf den Gesichtern der Menschen zuckten Licht und Schatten in wechselndem bizarrem Spiel. Dies zusammen mit dem Stimmengewirr sorgte dafür, dass Gunther sich unruhig fühlte. Eben hatte der Gast aus Sachsen einen Witz gemacht, er hatte ihn Gunther ins Ohr geraunt, etwas Obszönes, Gunther hatte nur die Hälfte verstanden, es war etwas Gereimtes, etwas von »Brüsten« und »Lüsten«; er lachte einfach drauflos, und neben Lüdeger grinste Gernot und brabbelte etwas vor sich hin. Sein Bart war nass von Bier und Zwiebelsuppe, Gernot trank immer Bier, während alle anderen an der Tafel sich einen Weißwein vom Mittelrhein munden ließen. Gunther hatte die kostbarsten Trinkgefäße aufgeboten, feinstes Glas aus dem Wormser Glasofen, das dem der Römer in nichts nachstand.
Der Sachsenkönig hob sein Glas und blickte aus seinen mit Ruß schwarz geschminkten Augen auffordernd in die Runde. Wohl zum zehnten Mal an diesem Abend wurde ein Prosit ausgesprochen, diesmal auf das Wohl der schönen Frauen. Wie bei den anderen Trinksprüchen zuvor verrenkte der Sachsenkönig ruckartig den Kopf, sodass die Zöpfe, die er in den Bart und ins Haar geflochten hatte, zur Seite flogen, und blickte nach rechts, wo Kriemhild saß. Diese tat, als bemerke sie nichts, und widmete sich ruhig dem zweiten Gang, einem zarten Schinken mit Meerrettich. Alle erhoben ihr Glas, reckten die Arme empor und riefen: »Auf die schönen Frauen!«
Bei Gernot klang es nuschelig und verwaschen. Er hatte einmal mehr zu viel. Gunther war verstimmt, gab dies doch ein denkbar schlechtes Bild für sein Land ab. Während der Sachsenherrscher nun ein Gespräch mit dem Römer anfing – er radebrechte sogar etwas auf Lateinisch –, bemerkte Gunther im Augenwinkel, dass Hagen aufstand und hinter seinem Rücken auf Gernot zuging. Schwer legte er ihm die Hand auf die Schulter, raunte ihm etwas zu und Gernot glotzte ihn blöd an. Er schüttelte heftig den Kopf, wollte mit einer Armbewegung einem Knecht winken und stieß dabei einen Krug um. Zum Glück war dieser bereits leer, er fiel jedoch scheppernd vom Tisch. Kurioserweise hüpfte er ein oder zweimal auf dem Boden, bevor er in Scherben ging. Auf einmal war es still im Saal. Dann schnippte Hagen mit den Fingern, und zwei Mägde fegten mit knirschendem Geräusch die Scherben weg.
»Hoffentlich kein schlechtes Omen, König Lüdeger«, sagte Hagen mit nachdenklicher Miene. Er stand nun unmittelbar hinter dem Sachsen und hakte die Daumen in seinen Gürtel ein.
»Ha!«, lachte der Sachsenherrscher und hob erneut sein Glas. »Du bist ein guter Krieger Hagen, aber auch ein Schwarzseher. Kein Wunder, alter Kämpfer, bist du doch auf einem Auge …«
»Was mein König sagen will, edle Burgunden«, unterbrach ihn ein sächsischer Edler, um mehr schlecht als recht seinen Herrn vor einem schlimmen Fauxpas zu retten, »ist, dass man manchmal ein Auge zudrücken muss, um sein Schicksal … ich meine, um sein Glück …«
»Richtig! Genau das wollte ich sagen. Scherben bringen Glück, das wollte ich sagen, König Gunther!«, rief Lüdeger und ließ seinen Wein im Glase kreisen. »Auf dass es unseren Ländern wohl ergehe: Auf Burgund!«
»… und auf Sachsen!«, ergänzte Gunther artig. Ein scharfer Geruch ging vom Sachsenkönig aus. Eine seltsame Mischung aus frischem Lederfett, das sein schwarzes Gewand ausströmte, nach Weinrülpser und Achselschweiß. Wieder wurden die Gläser gehoben und kräftige Züge getan. Einer trank nicht mit: Hagen hatte sich still auf seinen Platz gesetzt. Mit mürrischer Miene blickte er vor sich hin. Währenddessen trugen die Knechte und Mägde auf großen Silberplatten den nächsten Gang auf: Ein würziger Wildgeruch erfüllte den Raum und ließ die Gäste schnuppern.
»Erlauchte Gäste«, hob Rumold, der Küchenmeister, an, »Wildschweinbraten mit in Honig eingelegten Apfelscheiben und Rotkohl.«
Beifall erklang, und am lautesten applaudierte König Lüdeger mit seinen schaufelgroßen Händen. »Fürwahr, es gefällt mir, euer Burgund!«, lachte er. »Erlesene Speisen, vorzüglicher Wein, tapfere Krieger und«, erneut wandte er den Kopf nach rechts, »und ganz besonders …« – da wurde er von Königin Ute unterbrochen.
»Ja, es ist schön, unser Land, Lüdeger. Wir wollen hoffen, dass es so schön bleibt – und vor allem so friedlich.«
»Mutter, wie kannst du unserem Gast ins Wort fallen?«, wies sie Gunther zurecht. Und mit ähnlichen Sätzen wie seine Mutter an diesem Morgen erklärte er: »Burgund liegt in Frieden mit allen Nachbarn. Mit den Römern haben wir beste Handelsbeziehungen, Sachsen sitzt gerade bei uns am Tisch …«
»… und bald werden die burgundischen Edlen in Sachsen … zu Gast sein«, blökte Lüdeger dazwischen. Er wischte sich den Mund und grinste.
»… sehr gerne, König Lüdeger«, ging Gunther auf den Einwurf ein. Doch ihm war die Pause aufgefallen, die der Sachse im Satz gemacht hatte, ferner war es ihm, als hätte auf dem Wort ›Gast‹ eine besondere Betonung gelegen. Er blickte nach rechts und nahm wahr, dass Hagen ebenfalls aufgemerkt hatte. Dann sah er, dass der Platz von Gernot leer war.
»Mit den anderen germanischen Stämmen verbindet uns Freundschaft«, fuhr er fort.
»Vergesst die Hunnen nicht«, warf der Römer mit vollem Mund ein und hob wie zur Warnung sein Messer. Er war der Einzige, der am Tisch nicht die germanische Tracht trug, Hose, Leinenhemd und Wams, sondern nach römischem Brauch Tunika und eine kostbare Toga. »Sie sind die Macht, die neben den Persern uns Römern – und auch den germanischen Stämmen gleichermaßen – gefährlich werden kann. Die Hunnen hegen die größten Aufstiegsambitionen im unteren Donauraum. Der junge König Etzel gilt als eroberungslustig und grausam. Manch einer spricht schon vom Hammer des Ostens. Gut, dass unser Bündnis gilt.«
»Bündnis?«, nahm Lüdeger den Faden auf, es klang, als spucke er das Wort aus. »Nun, Römer, erlaube die Bemerkung«, der Sachsenkönig stieß ein raues Lachen aus und wies mit dem Zeigefinger auf sein Gegenüber, »ein Bündnis mit Rom ist heute nicht mehr viel wert. Seit die Westgoten euere ewige Stadt geplündert haben, ist die einstige Mittelmeermacht doch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nicht wahr?«
Lüdeger blickte herausfordernd in die Runde. »Nicht wahr?!«, wiederholte er lauter und schlug dem jungen Giselher auf die Schulter, der inzwischen den Platz Gernots eingenommen hatte.
»Sicher, sicher«, meinte der, blickte aber ziemlich unglücklich drein, genau wie der Römer, der sichtbar nach Worten rang.
Gunther merkte, dass er auf seinem Daumennagel kaute. Er war verstimmt über den dreisten Vorstoß des Sachsenkönigs und überlegte, wie er die gute Stimmung retten konnte, ohne einen seiner Gäste zu verletzen. Muss der Koloss aus Sachsen hier alle verärgern, dachte er, es fehlt nur noch, dass er mich angreift. Was genau will dieser Kerl mit seinen fettigen Zöpfen eigentlich bei uns?
Da stand Hagen auf und strich seine Kleidung glatt. Er hatte trotz der Wärme im Saal ein langes graues Wollgewand mit einem breiten Gürtel angelegt, an dem er links ein kurzes Messer trug. Sogleich besaß er die Aufmerksamkeit aller. »Wir wollen nicht weiter politisieren, werter Gast, werte Burgunden, bleiben wir doch bei dem anderen Thema, das der Sachsenkönig genannt hat: den schönen Frauen und der Liebe.«
»Genau!«, rief einer der sächsischen Gäste auf der rechten Seite und glotzte frech eine dralle Magd an, die ihm gerade Fleisch auftrug, auch andere zustimmende Rufe erklangen.
»Wir sind fast fertig mit unserem Wildschwein«, verkündete Hagen, »und wollen ein Lied hören – ein Lied über die schönen Frauen, vorgetragen von unserem Spielmann Volker.«
Hagen hat es gerettet, dachte Gunther und ärgerte sich, dass nicht ihm selbst dieser Gedanke gekommen war. Zugleich bemerkte er, dass Kriemhild und Ute leise ein angeregtes Gespräch führten. Die beiden sahen dabei nicht glücklich aus, insbesondere Kriemhild biss sich auf die Unterlippe und hatte die Augen zusammengekniffen. Schon heute Nachmittag beim gemeinsamen Ausritt der vier Geschwister durch die Gemarkungen südlich von Worms war sie schweigsam gewesen, mit ihren Gedanken ganz woanders, obwohl sie seit langem endlich wieder ihr Lieblingspferd reiten konnte, das sich von einer Fußverletzung erholt hatte. Nun, egal, so etwas gab es ja oft bei Frauen, Missmut, schlechte Laune …
»So soll es sein!«, pflichtete Gunther laut Hagen bei. »Sobald dieser Gang fertig ist, soll Volker uns ein Lied singen.« Der Angesprochene nickte und warf einen Blick hinter sich, wo seine kleine Harfe bereit stand.
Eine Weile lang aßen alle weiter – und schließlich kam auch Gernot zurück in den Saal. Sein Gesicht war blass wie ein Käse. Ein Knecht stützte ihn. Gernot nahm nun den Platz Giselhers ein, saß also nicht mehr direkt neben dem Sachsenkönig. Gut so, dachte Gunther. Wahrscheinlich hat er sich erleichtert, der alte Säufer. Seinen sauren Atem muss der Sachse nicht unbedingt riechen. Die Situation war schon peinlich genug. Wenn Gernot doch beim Saufen nur halb so viel Disziplin besäße wie beim Kämpfen mit seiner Axt.
Endlich erhob sich Volker, ergriff sein Instrument und räusperte sich. Es hatten noch nicht alle im Saal mitbekommen, dass sein Vortrag nun beginnen sollte, daher klatschte Gunther laut in die Hände. Doch nichts passierte. Erst als Volker in die Mitte der Tische trat, wurde es langsam ruhig. Doch Gunther bemerkte, dass der Sachse ihm erneut etwas ins Ohr raunte und ihn dabei verschmitzt anschaute. Mit einer Handbewegung wollte er ihn zur Ruhe bringen, Lüdeger ließ sich jedoch nicht beirren. »Lass uns die Plätze tauschen, Gunther«, wollte er flüstern, doch er hatte etwas zu laut gesprochen, sodass es die daneben Sitzenden verstehen konnten. Hagen hatte es gehört, auch Kriemhild und ihre Mutter, dass der Gast begehrte, neben Kriemhild zu sitzen.
Gunther begann zu schwitzen. Wie sollte er sich verhalten? »Es beginnt schon«, sagte er und wies mit einer schwachen Handbewegung in die Mitte des Saales.
Volker stimmte kurz die Saiten seines Instruments und strich sich über die braunen glatten Haare, die er schulterlang trug, dann über den wuchernden Schnurrbart, dessen Enden ihm oft in den Mundwinkeln hingen. Er war ein Mann um die dreißig, nicht nur in Musik, sondern auch im Kampf erprobt, wie alle burgundischen Edlen, die heute den Vorzug bekommen hatten, beim Gastmahl anwesend zu sein.
»Gern will ich das Thema aufnehmen, das unser hoher Gast genannt hat, liebe Landsleute, liebe Sachsen. Hört die Mär einer wundervollen Frau, einer Königin, die«, er senkte die Stimme, und alle hingen an seinen Lippen, »hoch oben im Norden lebt, in einem Land aus … ja, in einem Land aus Eis und Feuer. Und genauso ist sie auch selbst, denn zwei Gewalten sind in ihr: das Eis, denn ihr Herz ist noch kalt, noch kein Mann konnte die Liebe ihres Herzens gewinnen. Vielleicht einer, doch … wer weiß? Aber auch das Feuer steckt schon in ihr wie die Lava auf dem Grund des Vulkans, denn wenn sie einmal lieben wird, dann wird es sein wie Lodern und Brand, wie Glut und Flamme.«
Etwas störte Gunther. Wieder spürte er den Mund des Sachsenkönigs an seinem Ohr. Was hatte er eben gesagt? Hatte es nicht geklungen wie: »schöne Schwester«?
Während Volker weitersprach, jagten sich die Gedanken in Gunthers Kopf. War das der Grund, weshalb der Sachse nach Worms gekommen war?
Gunther legte einfach den Finger auf die Lippen und wies mit einer Kopfbewegung auf den Spielmann, der eben mit eindringlichem Ton zu singen anhob:
»Geformt aus Wasser, Eis und Lavablut,
ein düstres Land liegt in den Nordseewellen,
dort, wo die Erde Feuer spuckt und Glut,
wo Wasserstrahlen aus dem Boden schnellen.
Wo Welle brechend trifft auf schwarzen Sand,
wo scharfe Stürme harten Felsen beißen,
Island man dieses Eiland hat genannt,
nur wen’ge finden Mut, dorthin zu reisen.
Dort überm Abgrund, über wildem Schlund,
hoch über Meeres ungestümem Sausen
steht eine Burg auf festem Felsengrund:
der Isenstein trotzt Sturm und Wellenbrausen.
Kennt ihr die Königin, die dort regiert,
das Land beherrscht und alle seine Leute,
auf jenem Isenstein sie residiert
in altvergang’nen Zeiten und noch heute.
Ich frage, ob ihr diese Herrin kennt,
von ihr erzählt man Sagen und Geschichten,
Brünhild die Wunderschöne man sie nennt,
ihr kennt sie nicht? Ich will von ihr berichten.
Sie ist die Schönste in der Welt fürwahr:
die Augen wie zwei tiefe, grüne Seen,
die Haut wie Milch, wie Weizen hell das Haar,
kein Mann kann dieser Anmut widerstehen.
Und wenn ihr leuchtend’ Auge blickt vom Turm
hinab aufs Meer und auf die weiten Lande,
es heißt, dann beugen Wellen sich und Sturm
und knien nieder in dem Ufersande.
Um sie als süße Braut nach Haus zu bringen,
gar mancher kühne Mann wagte die Fahrt,
doch ihre Liebe keiner konnt’ erringen,
und schrecklich Schicksal keinem blieb erspart.
Sie waren blind vor Liebe, vor Begehren,
doch ahnten nichts von Brünhilds großer Kraft.
Sie wusste sich der Männer zu erwehren,
der Tod die Kühnen hat dahingerafft.
Nur einer, heißt es, Brünhild hat bezwungen,
doch was genau ist wirklich da passiert?
Siegfried von Xanten, Herr der Nibelungen –
hat er sie wohl berührt, sie gar verführt?
Doch plötzlich, so verkündet uns die Sage,
setzt’ Segel Siegfried und verlässt das Land,
und Brünhild lebt nun einsam alle Tage
hat niemals wieder einen Mann erkannt.«
Der Sänger hatte geendet. Viele Herzschläge lang war nichts zu hören. Sogar der unruhige Sachsenkönig, der während der ersten Strophen noch Gunther am Arm gepackt und ein paar anzügliche Bemerkungen gemacht hatte, war verstummt. Volker hatte es verstanden, sein Publikum in Bann zu ziehen. War es seine Stimme, sein betörendes Harfenspiel? Jedenfalls wollte keiner die Stille verletzen und als Erster wieder das Wort ergreifen.
Ich muss etwas sagen, dachte Gunther, der mit anhaltendem Schweigen ein unbehagliches Gefühl verspürte. Aller Augen wanderten zwischen ihm und dem Sänger hin und her. Hagen nickte ihm aufmunternd zu und riss die Augen weit auf. Da setzte Applaus ein, erst klatschten einige wenige, dann der ganze Saal.
»Fürwahr gut gesungen!«, rief da dröhnend Lüdeger. »Ein Lied nach meinem Geschmack. Die Schönheit dieser Brünhild muss erstaunlich sein. Wenn es sie denn wirklich gibt, die Kalte aus dem Norden. Für mich klingt das alles wie eine Mär aus der alten Welt: Kraftweiber, Walküren, ha! Und, werte Gastgeber, wenn ich mich hier so umschaue« – wieder wandte er den Kopf – »ich würde eine Frau aus Burgund vorziehen.«
Da stand einmal mehr Hagen auf und ergriff das Wort. Es war bezeichnend, dass er zunächst nicht auf den Einwurf Lüdegers einging. »Ein hervorragender Vortrag von unserem Sänger. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Und wenn nach dem Gesang eine Weile Stille herrscht, dann spricht das dafür, dass alle ergriffen waren von deinem Lied, Volker von Alzey. Wir danken dir dafür.«
Erneut brandete Applaus auf. Gunther fiel auf, dass Kriemhild wieder etwas freundlicher dreinschaute. Wie sicher Hagen redete, wie souverän. Mit tiefer, ruhiger Stimme, ohne Effekthascherei. Dieser Mann würde als Herrscher eines Landes eine hervorragende Figur machen, dachte er. Doch ich brauche ihn als Heermeister, wer weiß, was noch alles passiert …
Erneut wurden seine Gedanken von Lüdeger unterbrochen: »Schönheit und Kraft – beides zusammen in einer Frau, hm … Klingt gut, ist aber nicht so sehr nach unserem sächsischen Geschmack. Wir schätzen die … sanften Frauen, die unterwürfigen Frauen. Die Frau sei dem Manne untertan und soll nicht kämpfen Seite an Seite mit ihm – hahaha, geschweige denn gegen ihn, nicht wahr, Gunther?«
»Natürlich.«
»Die Muskelkraft ist halt Sache der Krieger, nicht wahr – was meinst du, Freund Hagen?«
In Hagens Gesicht hatte es bei dem Wort Freund gezuckt. Skeptisch schob er die Unterlippe vor, doch Lüdeger wartete die Antwort nicht ab, sondern wandte sich sogleich an Giselher: »Und du, junger König? Kaum sehe ich einen Bartflaum auf deiner Oberlippe und deinen Wangen! Doch eine Narbe hat er auch schon an der Backe, schau, schau.«
Lüdeger hob sein Glas, blickte hinein und winkte mit herrischer Bewegung eine Magd herbei. Als sie nachgefüllt hatte, trank er und fuhr fort: »Mal sehen, ob du ein guter Krieger wirst, junger Mann! Was denkst du, sollten die Weiber mit Männern kämpfen?«
Jetzt wurde es Gunther zu viel. »Lass den Jungen in Ruhe, Lüdeger!«, fuhr er seinen Nachbarn unwirsch an. »Mir scheint, du hast einige …«
»Lass nur, Bruder«, unterbrach ihn Giselher, der aufgesprungen war. Seine Wangen waren gerötet, seine Augen glänzten. »Gern will ich dir zeigen, Sachse, dass ich Kraft habe.« Er redete sich in Rage, sprach von Muskeln, Kraft und Kämpfen, sah nicht, dass Hagen und Gunther ihm warnende Blicke zuwarfen. »Wir haben hier in Burgund einen Wettkampf, bei dem sich zeigt, wer der bessere Mann ist, das Armdrücken …«
»Den haben wir auch in Sachsen«, schmunzelte Lüdeger. »Willst du es mit mir aufnehmen, Jüngling?« Er stand ruckartig auf, sodass sein Stuhl krachend umfiel. Gleichzeitig wurde die Tafel kurz angehoben, sodass mehrere Krüge und Kelche umfielen. Und wieder war Stille im Saal. Jedermann sah seine schaufelgroßen Hände und die breiten, muskulösen Arme, die stark behaart waren.
Ich muss etwas tun, dachte Gunther, was nur? Soll ich mich selbst anbieten? Lüdeger machte ein paar Bewegungen, wie um sich aufzuwärmen, da erhob sich Ute. Gunther bemerkte, dass der Platz neben ihr leer war. Offenbar hatte Kriemhild den Abtritt aufgesucht oder sich bereits zurückgezogen. Er konnte ihr es nicht verübeln.
»Erlaube, Herr Lüdeger«, hob die Königinmutter an, »ich denke, das ist ein ungleicher Kampf. Ein junger Mann gegen so einen Riesen, wie du es bist. Es kann doch jeder sehen, dass du über … gewaltige Kräfte verfügst.« Ute hatte die letzten drei Worte so betont, dass jeder die Ironie heraushören konnte.
»Ich nehme den Wettstreit an«, warf Giselher trotzig ein.
»Lass bleiben, mein Sohn«, sagte Ute sanft. »Jeder weiß, dass du Mut hast. Aber vielleicht kann einer deiner Brüder den Kampf annehmen? Du wirst später noch Gelegenheit haben, dich zu beweisen. Giselher wurde rot im Gesicht, seine Narbe auf der Wange glühte, er blickte abwechselnd zu seiner Mutter und zum Sachsen, der höhnisch grinste. Dann lief er eilends aus dem Saal.
Gunther schwitzte. Wenn er selbst sich zu diesem Armdrücken stellte, dann wäre das Ergebnis von vornherein klar.
Da sprang mit einem Satz Hagen über den Tisch in die Mitte. »Ich werde gegen dich antreten!«, verkündete er selbstbewusst. Er ließ seinen Gürtel fallen und warf das graue Obergewand ab.
Da unterbrach ihn sein Bruder Dankwart. »Lass mich ran, Hagen. Du bist mit Anfang fünfzig über die Mitte deines Lebens. Mein Blut ist wärmer als deins, meine Muskeln frischer …« Auch er sprang leichtfüßig über den Tisch und baute sich neben Hagen auf.
»Ich kann euch auch alle der Reihe nach bezwingen«, trumpfte der Sachse auf, immer noch überheblich grinsend. Ebenso feixten die Leute seiner Abordnung.
Gunther sprang ebenfalls auf und haute mit der Hand auf den Tisch. »Männer!«, rief er beschwichtigend. »Was brauchen wir solche Kämpfchen unter … Freunden? Wir haben uns gestärkt, und es ist nach dem köstlichen Mahl noch etwas anderes für unsere Gäste vorbereitet. Wir werden jetzt hinunter zum …«
»Erst das Armdrücken«, unterbrach Hagen, der Dankwart beiseite geschoben hatte. Er ballte die Hände zu Fäusten und drückte sie vor seiner Brust zusammen. Man sah seine kräftige Muskulatur an Armen, Schultern und der Brust, zugleich aber erkannte man an manchen Stellen gealterte, schon ein wenig schlaffe Haut. Doch Hagens Auftritt war Achtung gebietend. Obwohl er nicht so groß und breit war wie der Kontrahent und noch dazu wesentlich älter, war ihm keinerlei Unsicherheit, geschweige denn Furcht anzumerken.
»So soll es sein«, gab Gunther klein bei, der registrierte, dass Kriemhild immer noch fehlte.
Hagen zog sich einen Stuhl heran und nahm auf der Innenseite des Hufeisens gegenüber dem Sachsen Platz. Aller Augen folgten ihm.
»Gönnst du einem alten Mann ein Vorrecht?«, fragte Hagen lauernd.
Lüdeger grinste immer noch und ließ sein kräftiges Gebiss sehen. »Gewiss, was forderst du?«
»Lass uns die linken Hände nehmen – da kann ich deine Bewegungen mit meinem gesunden Auge besser verfolgen«, sagte Hagen und blickte seinen Gegner fest an.
»Wenn du meinst«, stimmte jener zu, und Gunther merkte seiner Stimme eine leichte Unsicherheit an. »Aber«, trumpfte er auf, »dann soll es auch um etwas gehen, Freund Hagen.«
»Selbstverständlich! Sagen wir, wenn du siegst, bekommst du ein Fass besten Rheinweins, und außerdem …«
»Nein. Ich will einen Kuss von Kriemhild!«
Gunther stöhnte auf und mit ihm einige Burgunden. »Ich bin sicher, Freund Lüdeger, ihr habt in Sachsen viele Mädchen, die stolz wären, deine Frau zu werden. Hörte ich nicht auch kürzlich, dass du im Reich deines Bruders in Dänemark bereits eine Braut hast? Auf jeden Fall …«
»Ich nehme die Herausforderung an«, verkündete Hagen mit lauter Stimme und strich sich ruhig die beiden Spitzen, zu denen sein schwarzer Kinnbart auslief. Sein Gegenüber tat es ihm höhnisch nach und nahm die beiden Bartzöpfe in die Hände. Gunther bemerkte, dass Hagen ihm einen beruhigenden Blick zuwarf. Wie hatte sich dieser Abend nur so entwickeln können? Gernot besoffen, Kriemhild verschwunden und Giselher ebenfalls. Wo steckte der beleidigte junge König eigentlich?
»Siege aber ich«, hielt Hagen dagegen, »was hast du zu bieten?«
»Das wird nicht geschehen«, lächelte der Sachse.
»Es muss ein Preis festgesetzt werden«, insistierte Gunther.
»Sollte ich unterliegen, bekommst du meinen Pokal. Ich habe ihn auf unserem Schiff mitgebracht. Er ist aus Silber und mit Edelsteinen besetzt. Nur ich trinke aus ihm.«
»Gut, so soll es sein«, stimmte Hagen zu.
»Noch etwas: Ich habe dir ein Vorrecht gewährt, Hagen, dann gewähre du auch, dass die Kraftprobe nach sächsischem Brauch vonstatten geht: Wir stellen zwei kleine brennende Kerzen rechts und links auf dem Tisch auf. Die Hand des Unterlegenen landet im Feuer.«
Hagen nickte und winkte einem Knecht: »Brennende Kerzen herbei!«
Als die Flammen an Ort und Stelle waren, blickten die beiden Kontrahenten einander an und stemmten die Ellbogen auf den Tisch. Sie legten die linken Hände ineinander und griffen fest zu. Lüdeger bewegte die Lippen. Er schien noch etwas zu sagen, doch niemand im Saal konnte es verstehen. Gunther war sicher, dass es eine Provokation war.
Plötzlich begann der Sachse mit aller Kraft zu drücken.
3. Kapitel Nacht und Flucht
Giselher rannte.
Sein Gesicht brannte, sein ganzer Kopf stand in Flammen. Doch nicht vom raschen Laufen, die Demütigung war es, die ihn schon im großen Festsaal hatte erröten lassen und nun nach Abkühlung verlangte. Jeder musste es bemerkt haben, Gunther, Gernot – nun, Gernot vielleicht nicht in seinem Rausch –, aber Kriemhild, die Mutter, Hagen, Ortwin, die anderen und – natürlich der verfluchte Sachse!
Der Junge hielt an. Wie blind war er gerannt, aus dem Saal, die Treppe hinunter in den Burghof, das Tor der Burg stand weit offen, die hölzerne Zugbrücke war heruntergelassen, natürlich, es war ja kein Feind in Sicht. Oder doch? Die beiden dort postierten Wächter staunten nicht schlecht, als der jüngste der drei königlichen Brüder an ihnen vorbeistürmte. Er war hastig hinausgeeilt wie der Sturmwind, durch die nächtliche Stadt – und nun war er außer Atem. Abkühlung, den heißen Kopf und den kochenden Mut kühlen, Windhauch, Wasser!
Giselher hielt an und schaute sich um. Einen Steinwurf Richtung Sonnenaufgang lag das Rheintor, ein festes Bollwerk aus Eichenholz und Eisen, zwei massive Torflügel, davor der Stadtgraben, den Gunther in den vergangenen beiden Jahren noch hatte vertiefen lassen, auch hier zur Sicherheit noch eine Zugbrücke. Es patrouillierten Wachtposten, jeweils vier an der Zahl, wie es für die drei Stadttore festgelegt war.
Giselher zwang sich zur Ruhe. Er schritt bedächtig, aber mit immer noch bebenden Händen und unsicheren Beinen auf das Tor zu.
»Herr«, sagte Gebhard, einer der Wächter, voller Erstaunen, »was ist mit dir?«
Der junge Mann ging wortlos an ihm vorüber, hob nur kurz grüßend die Hand und strebte schnellen Schritts auf den rechts neben dem Tor liegenden Pferdestall zu. Hier befanden sich sämtliche Pferde der zur Rheinseite hin stationierten Soldaten. Giselher öffnete die Tür und fand sich in einer Duftwolke aus Pisse und Pferdeäpfeln wieder. Er eilte auf einen Tränkbottich zu. Ohne zu zögern, steckte er den Kopf in das kalte Wasser, dann tauchte er die Arme ein. Die Kühle: wohltuend und frisch! Wenn ich Kraft hätte, dachte er, würde ich den Sachsen packen, an den Speckwülsten seines fetten Stiernackens, seinen blöden Quadratschädel untertauchen und festhalten, bis … ja, bis keine Luftblasen mehr kommen. Ich werde üben, mehr üben als bisher, werde laufen und Gewichte stemmen, schwimmen, Schwertkampf und Bogenschießen üben, Körper und Geist stählen, noch intensiver als zuvor. Ich muss ein Krieger werden, einer wie dieser sagenhafte Siegfried, von dem man so viel erzählt, der Unbesiegbare …
Hinter ihm war Gebhard eingetreten, eine Fackel in der Hand, und betrachtete fassungslos seinen König: »Alles in Ordnung?«
»Gewiss doch«, sagte Giselher trotzig, ohne sich umzudrehen. Aus dem bewegten Wasser im Bottich starrte ihm flackernd sein eigenes mürrisches Gesicht entgegen. »Lass mich einfach in Ruhe!« Er warf die langen Haare zurück, sodass die Tropfen nach hinten spritzten. Aus den Pferdeboxen war ein nervöses Schnauben und Hufscharren zu hören. Gebhard trat zu den Rössern und sprach beruhigend auf sie ein. Dieser Mann liebte die Tiere, er konnte mit ihnen umgehen.
»Öffne das Tor!«, befahl der junge König dem Wächter.
»Aber Gunther hat angeordnet …«
»Ich weiß, was Gunther angeordnet hat!«, fiel ihm Giselher unwirsch ins Wort.
»Ach so, du hast sicherlich am Rhein noch Vorbereitungen zu treffen, nicht wahr? Für das große Spektakel heut Nacht.«
»Ja … natürlich. So ist es«, sagte der junge König. Diese Begründung kam ihm gerade recht.
Zusammen mit dem Wächter ging er die paar Schritte zum Tor hinüber. Gebhard winkte seine drei Kameraden herbei, und zusammen hoben sie den schweren Sperrbalken herunter, dann ließen sie die Zugbrücke herab. Ohne zu grüßen ging Giselher über die Brücke hinunter zu den Auen. Kühl wehte der Nachtwind und wurde frischer, je näher er in Richtung Fluss kam. Sein Kopf war nun kalt und mit ihm sein Gemüt. Wenn ihn seine Mutter so sehen würde, hätte sie gleich eine Warnung vor Schnupfen und Husten ausgesprochen. Diese nörgelnde, besserwisserische Stimme. Noch immer wollte sie es nicht wahrhaben, dass er nun auf dem Weg zum Mann, zum Krieger war.
Der Sachse! Dieser arrogante, freche Ochse, was bildete der sich eigentlich ein? Lädt sich selbst ein – wie hatte es geheißen? Lüdeger, der Herrscher von Sachsen gibt sich die Ehre, Burgund seinen königlichen Besuch abzustatten. Die Ehre, pah! Und was hatte Gunther gesagt? Wir lassen ihn kommen, sein Reich im Norden ist stark, er ist im Bunde mit Dänemark, dort herrscht sein Bruder Lüdegast. Lüdeger und Lüdegast – ha, es müsste besser Lüge-Ger und Lüge-Gast heißen, sinnierte der junge König. Die beiden galten als grausam und eroberungslustig.
Bei einem umgestürzten Baumstamm im Ufergebüsch hielt er an und setzte sich. Hoffentlich kann ihm Hagen das Maul stopfen. Aber Hagen ist alt – und die Muskeln dieses Unholds sind prall und dick. Ich Esel, wie konnte ich mir diese Kraftprobe entgehen lassen? Kurz dachte Giselher nach, ob er zurückeilen sollte. Unsinn. Der Zweikampf musste längst vorbei sein. Hoffentlich war es nicht zum Eklat gekommen dort oben in der Burg.
Giselher bewunderte Hagen. Er war schon unter dem alten König Dankrat, dem Vater von Gunther, Gernot, Giselher und Kriemhild, Ratgeber, hervorragendster Kämpfer und Heerführer gewesen. Hagen hatte stets Mut und List bewiesen und diente Burgund wie kein zweiter. Burgund war sein Leben, er würde alles geben, um sein Land zu schützen vor jedwedem Angriff. Vor vielen Jahren hatte Hagen sein rechtes Auge verloren im Kampf gegen eine Bande Straßenräuber, die zwischen Worms und Mainz die Wege unsicher machten. Er hatte mit einer Schar burgundischer Krieger das Lager der Räuber umzingelt, es war zum Gefecht gekommen. Den Pfeil, den einer der Halunken aus dem Hinterhalt abfeuerte, konnte Hagens hastig hochgerissener Rundschild nicht mehr abfangen. Fast genau traf das Geschoss ihn in der Augenhöhle. Doch Hagen war danach nicht gebrochen. Fast hatte man den Eindruck, dass sein gesundes Auge nun doppelt scharf sah. Jeder, der den alten Kämpfer anblickte, gleich ob Freund oder Feind, hatte stets ein unbehagliches Gefühl, meinte, durchbohrt zu werden von diesem raubvogelscharfen Blick.
Ja, Giselher bewunderte und verehrte Hagen von Tronje. Sein Auftritt gefiel ihm. So wollte er auch einmal werden. Und gleichzeitig war er ihm unheimlich, ohne dass er genau erklären konnte, warum.
Giselher fuhr sich durch das nasse Haar und stützte das Kinn in beide Hände. Über seinem Kopf rauschten die Blätter. Fledermäuse torkelten im Zickzackflug durch die Nacht. Sie hatten ihr Quartier in einer alten, verfallenen Scheune am Rande der Stadt. Irgendwo im Gebüsch neben ihm huschte etwas weg. Es hatte einen langen Schwanz. Giselher ergriff einen Stock und hieb auf die Stelle ein, wo das Tier verschwunden war. Er stellte sich vor, der Stock sei ein Schwert, und die Pflanzen, auf die er eindrosch, seien sächsische Krieger. So saß er eine Weile.
Auf einmal spürte er noch etwas anderes in der Luft. War das Rauch? Schnuppernd richtete er sich auf. Ja, es war der rußige Geruch von Fackeln, weit weg noch. Und gleichzeitig nahm er von fern regelmäßiges Trommelschlagen wahr, zwei lange Schläge, dann drei kurze: bumm – bumm – bummbummbumm. Jetzt konnte er auch ein näselnd-quakendes Geräusch hören, es war eine Sackpfeife, und es gab nur einen, der sie so meisterhaft blies.
Giselher wusste Bescheid. Der Festzug zum Rhein hatte begonnen. Er musste hier vorbeikommen, genau hier, wo er saß, auf dem Weg zum Fluss, wo das große Spektakel in wenigen Minuten beginnen sollte. Je näher der Zug kam, desto besser konnte er einzelne Stimmen wahrnehmen und unterscheiden. Es schien ihm, als sei nichts mehr von der angespannten Stimmung, die vor einer halben Stunde noch geherrscht hatte, zu merken; was er hörte, klang fröhlich und ausgelassen. Giselher konnte Gunthers Stimme vernehmen, Gernots heiseren, immer noch leicht angetrunkenen Bass, das laute Organ des Sachsen weiter hinten, der Kriemhilds Namen nannte, Ortwin von Metz und Dankwart, die sich etwas zuriefen und dann lachten. Was war da passiert? Und Hagen? Wo war Hagen? War er unterlegen in der Kraftprobe und schämte sich nun? Der Sachse jedenfalls schien obenauf. Der Zug näherte sich dem Baumstamm, wo Giselher eben gesessen hatte, und er begann sich ins Unterholz zu ducken, wurde dann eins mit dem dichten Gebüsch dahinter. Zur Sicherheit zog er noch die Kapuze seines dunkelblauen Gewandes über den Kopf, möglichst weit ins Gesicht hinein. Jetzt konnte er beobachten.
Von hier war es nur noch einen Pfeilschuss weit zum Rhein, wo in wenigen Minuten das Schauspiel stattfinden sollte. Die Gruppe war zweigeteilt: Erst kamen die Burgunden und dahinter in einigem Abstand die Sachsen. Bald waren sie am Gebüsch, wo Giselher lag, vorüber. Doch eine Person blieb zurück. »Ich muss mich mal kurz erleichtern«, murmelte die Gestalt. Giselher stockte der Atem. Diese Stimme kannte er seit heute sehr genau und er würde sie nie wieder vergessen. Es war Lüdeger und er ging zielstrebig auf das Gebüsch zu. Was tun? Giselher überlegte fieberhaft. Blieb er liegen, riskierte er, vom Harnstrahl getroffen zu werden. Kam er hervor – nun, wer weiß, was dann geschah …
Der Sachse kam näher, öffnete grunzend die Hose und ließ einen knatternden Furz fahren. Dann rauschte Wasser. Giselher versuchte sich noch tiefer ins Gestrüpp zurückzuziehen, es blieb nicht aus, dass er die Zweige neben und über ihm zum Rascheln brachte.
»Verflucht, was ist das?«, zischte der Sachse und zog rasch seine Hose hoch.
Giselher sah ein, dass sein Versteck enttarnt war, und richtete sich auf. »Ich bin es«, sagte er und versuchte seiner Stimme Festigkeit zu geben, »König Giselher.«
»Sieh da, der junge Herr aus Burgund«, lachte der Sachse, und in seiner Stimme schwang Häme mit. »Fast hätte ich dich angepinkelt!«
Du hast mich bereits angepinkelt, dachte Giselher voller Ekel. Nicht jetzt, sondern vorhin im Saal.
»Lüdeger, wo bleibst du?«, erklang von Weitem eine Stimme mit sächsischem Akzent, »es geht gleich los!«
»Komm mit, Giselher! Was auch immer es ist, es geht gleich los!« Unvermittelt packte der Sachse Giselher an der Brust und hob ihn hoch, dass dem Jungen fast der Atem wegblieb. Was bildete sich dieser ›Ehrengast‹ eigentlich ein?
»Lass mich sofort runter!«, keuchte er halb wütend, halb verlegen.
»Gleich. Aber vielleicht kannst du im Gegenzug ein gutes Wort bei deiner Schwester für mich einlegen?«
»Hagen, Gunther!«, rief Giselher, dem es immer mulmiger zu Mute wurde, laut. Überhaupt, fiel ihm ein, Hagen! Vielleicht hatte Lüdeger ihn besiegt? Ja, so musste es sein, sonst wäre der Sachse nicht so übermütig. Sicher betrank sich Hagen nun auf der Burg, spülte seine Schande und Wut mit Branntwein herunter. Doch sogleich wurde Giselher eines Besseren belehrt: »Was geht da vor?«, rief eine Stimme. Giselher verrenkte den Kopf und versuchte am breiten Brustkorb Lüdegers vorbeizuschauen in Richtung der Menschengruppe, die das Flussufer erreicht hatte. Die Musik hatte inzwischen aufgehört, einige machten sich dort am Boden zu schaffen. Da löste sich eine Gestalt, die Giselher am breiten, o-beinigen Gang unzweifelhaft als Hagen von Tronje erkannte.
»Es ist der Junge!«, rief Lüdeger Hagen laut entgegen. »Hier hat er sich verkrochen!«
Dieser Hund! Giselher war so wütend, dass ihm regelrecht übel war. Hier hat er sich verkrochen, das klang nach: »diese feige Maus«. Sobald ihn Lüdeger losließ, lief Giselher los.
»Komm mit uns gen Norden!«, rief ihm der Sachse lachend nach, »wir machen einen richtigen Mann aus dir!«
Giselher rannte. Wohin? Egal!
Zurück in Richtung Stadt? Ja, gut so. Hinter ihm flammte etwas auf, dann zischte etwas wie eine riesige Schlange. Funken sprühten, das Spektakel begann, doch Giselher hatte keinen Blick mehr dafür. Diese Schande, diese Provokation – kein Zweifel, er musste sich vom höchsten Turm der Burg herunterstürzen und auf dem Pflaster des Burghofes den Schädel und alle Knochen zerschmettern. Mit dieser Scham konnte er nicht leben. Von ganz weit hinten hörte er eine helle Frauenstimme, und instinktiv wusste er, dass es die geliebte Schwester war, die nach ihm rief.
»Es ist der junge König«, rief ein Wächter am Rheintor, als Giselher sich mit rasselndem Atem der Stadt näherte. Die Zugbrücke war noch unten und die beiden eichenen Torflügel dahinter standen weit offen. Wer hier heute ein und aus ging, war ein Freund. Oder doch nicht?
Ich muss Kriemhild warnen vor diesem … diesem Monstrum, dachte Giselher. Aber sie ist klug, sie wird nicht auf die plumpen Werbungsversuche dieses widerwärtigen Kerls hereinfallen. Kriemhild war überhaupt recht sonderbar und reserviert heute. Wer weiß, was dahinter steckte?
Außer Atem ging er nun langsamer durch die Stadt hinauf zur Burg. In manchen Häusern erkannte er Licht, sicher waren einige Bürger wach geworden von dem Festzug, hatten kurz hinausgeschaut und sich ein Bild gemacht von den hohen Gästen aus Sachsen. Hohe Gäste, pah! Ein paar Menschen riefen ihm Grußworte zu, hier und da winkte einer. Giselhers Zorn verrauchte allmählich. Ja, er würde Kriemhild warnen, vor allem aber Gunther. Sofern das Hagen noch nicht getan hatte.
Doch zunächst gelüstete ihn nach einem gewaltigen Schluck. Im großen Saal ließ er sich einen Krug Wein geben und stieg dann im Dunkeln die steile Wendeltreppe des Bergfrieds hinauf. Den Weg kannte er im Schlaf. Oben angekommen, nahm er einen tiefen Zug. Angenehm strömte der Trunk durch die Gurgel in den Magen – und stieg sofort zu Kopf. Giselher lehnte sich an die Brüstung und blickte hinab.
Hier hatte er sich vor wenigen Augenblicken noch hinunterstürzen wollen? Er ärgerte sich über sein heißes Blut und tat noch einen großen Zug. Ich muss ruhiger werden, nahm er sich vor. Ruhig und besonnen wie Hagen von Tronje. Ich werde ein hervorragender Kämpfer und man wird den Namen Giselher in allen Landen der Germanen nennen bis hinunter zu den Goten nach Italien. Rasch spülte er den Rest des Weines die Kehle hinunter.
Doch was war das dort unten? Giselher spürte die einlullende Wirkung des starken Getränks, hatte Mühe, den Blick scharf zu stellen. An der Mauer der inneren Burg, dort, wo die Waffenkammer lag, lief eine Gestalt entlang, geduckt, eben kam sie an einer in der Wand angebrachten Fackel vorbei – und Giselher konnte den Mann erkennen.
Es war … kein Zweifel! Es war Lüdeger von Sachsen.
Doch was war mit seinen Haaren geschehen? Er trug nun keine Zöpfe mehr, sondern sein Haar fiel offen auf die Schultern. Das konnte nicht sein! Lüdeger befand sich unten am Rhein, bei den anderen!
Giselher schüttelte den Kopf und schloss die Augen. Eine Wahnvorstellung, hervorgerufen vom Wein, von der Erregung?
In diesem Augenblick erklang vom Fluss her ein lauter Knall, und eine Feuerwalze fraß sich durch aufgeschichtete Strohhaufen. Binnen weniger Lidschläge war das ganze Ufer fast taghell erleuchtet. Bis hier oben konnte er ein vielstimmig-frohlockendes »Aaaah!« hören.
Als Giselher wieder nach unten in den Hof schaute, war die Gestalt verschwunden.
4. Kapitel Kraft und Klugheit
Kriemhild stutzte.
Vor ein paar Minuten war sie in den Saal zurückgekommen. Sie hatte den Abtritt aufgesucht, weniger um sich zu erleichtern, als vielmehr, um ihr Gesicht mit kühlem Wasser zu netzen. Dieser Abend war ihr zuwider.
Zuwider waren ihr die Gäste aus Sachsen, allen voran dieser bezopfte Hüne mit dem rotzfrechen Maul. Und hatte die Mutter nicht gesagt, sie solle sich hübsch machen für diesen ungehobelten Klotz? Ihr edelstes Kleid hatte sie angelegt, das blaue mit den goldenen Borten. Außerdem war sie müde und spürte, dass ihre unreinen Tage unmittelbar bevorstanden. Als sie die Treppe zum Saal wieder hinaufstieg, war ihr Giselher entgegengestürmt. Verwundert hatte sie seinen Namen gerufen, doch der Bruder war an ihr vorbeigerannt. Er schien sie nicht einmal wahrzunehmen. Waren das nicht Tränen in seinen Augen? Seine Wangennarbe war feuerrot. Kein Wunder, dieser Heißsporn war sensibel und verletzlich.
Doch nun, wieder zurück im Festsaal, stutzte sie noch viel mehr. Die Kraftprobe, die sich abgezeichnet hatte, begann gerade. Wie sie das abstieß, diese Hahnenkämpfe zwischen Männern! Hagen und Lüdeger saßen sich gegenüber, die linken Hände fest ineinander verklammert; an den Unterarmen zeichneten sich die Muskeln deutlich ab, und die Adern traten hervor, als wollten sie platzen. Rechts und links neben den beiden Kämpfern glommen die Kerzenstumpen, unruhig flackerten die Flammen, lauerten gierig darauf, die dünne Haut am Handrücken eines der beiden Männer erbarmungslos zu verbrennen. Um den Tisch herum hatten sich alle – Burgunden und Sachsen – im Kreis versammelt, dicht bei dicht, jeder wollte einen guten Platz haben und das Ereignis genau beobachten.
Jeder wartete auf ein Zeichen zum Start, doch nichts geschah.
Lüdeger grinste einen Augenblick lang wie ein Wolf. Dann drückte er plötzlich los. Deutlich war zu erkennen, dass er sehr viel Gewalt in seinen Arm legte. Er war größer und verfügte somit über einen besseren Hebel als Hagen. Dieser schien den heftigen Angriff geahnt zu haben und hielt stand. Während er den Blick fest auf Lüdegers Gesicht gerichtet hatte, blickte jener nur auf die verklammerten Hände.
Unversehens war Kriemhild gepackt von diesem Schauspiel. Zwei Männer, die sie begehrten. Nicht nur Lüdeger hatte es heute allzu deutlich gezeigt, nein, auch der Heermeister Burgunds hatte, wie sie lange schon wusste, sein gesundes Auge auf sie geworfen, seit sich bei ihr vor ein paar Jahren die ersten weiblichen Rundungen gezeigt hatten. Irgendwann hatte er ihr sogar heimlich … Kriemhild verzog die Lippen, als sie daran dachte.
Nun, sie wusste nichts von der Liebe, noch nie hatte sie ein Mann geküsst, und der Traum der letzten Nacht hatte eine eindeutige Sprache gesprochen, doch halt: Was ging da am Tisch vor? Während es bislang ruhig war im Saal, begannen nun sämtliche Sachsen zu applaudieren, laut zu johlen, ihren König anzufeuern. Dieser hatte eben – man konnte es an seinem verzerrten Gesicht und dem Schweiß auf der Stirn ablesen – seine Bemühungen intensiviert und wollte Hagens Arm mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung stand, niederzwingen. Wieder zog er die Lippen auseinander und man sah seine großen, gesunden Raubtierzähne.
»Lü-de-ger, Lü-de-ger!«, skandierten seine Leute siegesgewiss und klatschten rhythmisch dazu.
Bei den Burgunden war es still geworden.
Es war offensichtlich, dass Hagen in harte Bedrängnis geriet. Noch fester schien er den linken Ellenbogen in den Tisch zu bohren, wie ein Fundament für einen Turm, der Wetter und Windsbraut standhalten soll. Er nahm nun auch Schulter und Oberkörper etwas auf die linke Seite zurück, wohl um damit für mehr Stabilität zu sorgen.
»Halte stand, Hagen!«, rief Dankwart, und sein Neffe Ortwin wiederholte den Ruf. Darauf feuerten alle Wormser ihren Mann an und brüllten die Gäste nieder. Auch Kriemhild ertappte sich erstaunt dabei, wie sie mit einfiel in den Ruf: »Hagen, Hagen, halte stand!«