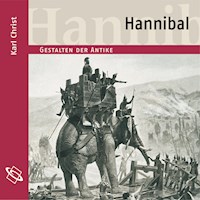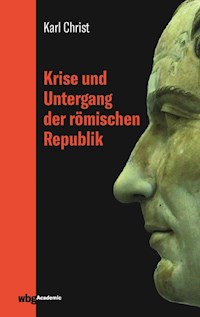
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: wbg Academic
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die große Monographie des bekannten Althistorikers Karl Christ über Krise und Untergang der römischen Republik ist seit Jahrzehnten DER Klassiker. Christ bietet mit großer erzählerischer Kraft eine Gesamtdarstellung der historischen Prozesse zwischen 200 und 30 v. Chr. vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen die Vorgänge in der Stadt Rom und in Italien: Triumph und Niedergang der römischen Nobilität, die Reformversuche der Gracchen, das Zeitalter der Bürgerkriege unter Marius und Sulla, Pompeius und Caesar, Antonius und Octavian bis zur Begründung des Prinzipats. Der gleichzeitige Aufstieg der römischen Republik zur Weltmacht des antiken Mittelmeerraumes hatte zur Folge, dass auch wichtige außeritalische Phänomene zu berücksichtigen sind: Der Zerfall der hellenistischen Staatenwelt und die Machtbildung Mithradates' VI. von Pontos werden ebenso behandelt wie der Kimbernzug oder die spätjüdische Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 885
Ähnliche
KARL CHRIST
KRISE UND UNTERGANGDER RÖMISCHEN REPUBLIK
Impressum
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliographie;detaillierte bibliographische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung inund Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Jubiläumsausgabe 2019
wbg Academic ist ein Imprint der wbg.© 2019 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt(unveränderter Nachdruck der 8. Auflage 2013)Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.Satz: Janß GmbH, PfungstadtUmschlagabbildung: Porträt von Julius Caesar, Kopie aus trajanischer Zeit.Archäologisches Nationalmuseum Neapel. Foto: Akg-images/Album/Prisma.Umschlaggestaltung: Harald Braun, Helmstedt
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27110-8
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-534-74482-4eBook (epub): 978-3-534-74483-1
IN MEMORIAMSUSANNE CHRIST(1959–1974)
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einleitung: Die Problematik des Untergangs der Römischen Republik
Die Römische Republik im Geschichtsbild der Neuzeit
Frühe und Späte Republik
Die Beurteilung der Späten Republik in der modernen Geschichtsschreibung
Die Problematik der Anwendung des Revolutionsbegriffs
Methoden und Perspektiven der neueren Forschung
1. Die römische Expansion im Westen zwischen 201 und 133 v. Chr.
Das Ende des 2. Punischen Krieges
Ausbau und Intensivierung der römischen Herrschaft in Italien
Die römische Expansion in Spanien
Numantia
Struktur und Entwicklung des barkidischen und des römischen Machtbereichs auf der Iberischen Halbinsel
2. Roms Eintritt in die hellenistische Welt
Die Entwicklung der hellenistischen Staatenwelt
Antiochos III. von Syrien und Philipp V. von Makedonien
Der 2. Makedonische Krieg
Die Politik des T. Quinctius Flamininus
Der Krieg gegen Antiochos III
Die römische Politik gegenüber Griechenland und Kleinasien
Der 3. Makedonische Krieg
Die Zerschlagung der makedonischen Monarchie
Die Zerstörung Korinths
Rom und das Pergamenische Reich
Der Aristonikosaufstand
Der Niedergang des Seleukidenreichs
Der Aufstand der Makkabäer
Zur Beurteilung der römischen Politik gegenüber den hellenistischen Mächten
3. Roms innere Entwicklung im 2. Jahrhundert v. Chr.
Die Veränderungen der Wirtschaftsstruktur
Agrarwirtschaft
Handwerk
Publicani
Sklaverei
Entwicklung der römischen Führungsschicht
M. Porcius Cato und P. Cornelius Scipio Aemilianus
Die Struktur der römischen Bundesgenossenschaft
Religionsgeschichtliche Entwicklungen
Die „Bacchanalienfrevel” von 186 v. Chr. als Krisensymptom
Anfänge römischer Literatur und Kunst
4. Die Reformversuche der Gracchen
Die Krise der römischen Agrarwirtschaft
Der Kreis der Reformer
Tiberius Gracchus
Die Absetzung des Volkstribuns Octavius
Scheitern und Folgen des ersten Reformansatzes
Die Reformen des C. Gracchus
Die Konkurrenzdemagogie des M. Livius Drusus
Der Untergang des C. Gracchus
Zur Struktur der römischen Politik
Die historische Bedeutung der Gracchen
5. Die römische Politik im Zeitalter des Marius und Sulla
Außenpolitische Aufgaben
Der Aufstieg des Marius
Der Kimbernzug
Die Heeresreform des Marius
Die Krise des Jahres 100 v. Chr
Jahre der Reaktion
Die Bundesgenossenfrage
Das Verhältnis zwischen Senat und Ritterschaft
Die Reformpolitik des M. Livius Drusus
Der Bundesgenossenkrieg
Die Neuordnung der römischen Bundesgenossenschaft in Italien
Der Reformansatz des P. Sulpicius Rufus
Sullas erster Marsch auf Rom
Das Regiment Cinnas
Der Krieg gegen Mithradates VI. von Pontos
Der Bürgerkrieg
Sullas Restauration
6. Der Zusammenbruch des sullanischen Systems und der Aufstieg des Pompeius
Die römische Innenpolitik nach Sulla
Der Aufstand des Sertorius
Die Seeräuberfrage
Der Spartacusaufstand
Die außerordentlichen Imperien des Pompeius
Die Catilinarische Verschwörung
Der 3. Mithradatische Krieg
Pompeius’ Neuordnung des Nahen Ostens
Die jüdische Frage
Die Rückkehr des Pompeius und die Bildung des 1. Triumvirats
7. Caesar
Caesars 1. Konsulat
Römische Innenpolitik im Schatten der Triumvirn
Der Partherkrieg des Crassus
Die römische Expansion in Gallien
Der Bürgerkrieg
Cato und Caesar
Caesars Diktatur
Die Opposition gegen Caesar
Die Iden des März
Zur Beurteilung Caesars
8. Zur Kultur- und Geistesgeschichte des 1. Jahrhunderts v. Chr.
Allgemeine Entwicklungstendenzen
Religiöse Überzeugungen der verschiedenen Gesellschaftsschichten
Die Römer und die Philosophie
Cicero als Vermittler griechischer Philosophie
Theaterdichtung
Satire
Catull
Lukrez
Römische Geschichtschreibung
Polybios und Poseidonios
Sallust
Rhetorik
Cicero
Rechtswissenschaft
Römisches Wissenschaftsverständnis M. Terentius Varro
Die Entfaltung der römischen Kunst
9. Octavians Aufstieg und die Begründung des Principats
Die Kompromißpolitik des Antonius nach Caesars Ermordung
Octavians Eintritt in die Politik
Die Bedeutung der Ideologie und die Rolle der Armee in den Auseinandersetzungen nach Caesars Tod
Ciceros Rückkehr in die Politik
Der Mutinensische Krieg
Das „2. Triumvirat“
Ciceros Untergang
Die Schlachten bei Philippi
Die Orientpolitik des Antonius
Kleopatra
Der Perusinische Krieg
Der Vertrag von Brundisium
Vergils 4. Ekloge
Der Vertrag von Misenum
Der Vertrag von Tarent
Antonius’ Partherkrieg
Octavians Kampf gegen Sextus Pompeius
Die Feldzüge in Illyrien und Octavians „italische“ Politik
Die Auseinandersetzung mit Antonius
Der Principat
Anhang
Zeittafel
Bibliographische Hinweise
Nachtrag (2000)
Verzeichnis der Abbildungen mit Quellenangaben
Register
VORWORT
Das allgemeine Interesse an den historischen Ubergangsepochen und Krisenzeiten ist seit den Tagen Jacob Burckhardts beträchtlich gewachsen. Umfang und Qualität der erhaltenen Geschichtsquellen wie Intensität und Dichte der neueren Forschung, aber auch Gegenwartsimpulse haben in gleicher Weise dazu beigetragen, daß Krise und Untergang der Römischen Republik im Mittelpunkt einer lebhaften wissenschaftlichen Diskussion stehen und zu immer neuen Analysen herausfordern. Dabei tritt freilich nicht nur eine irritierende Zersplitterung der Einzelforschung zutage, sondern auch der Trend, die Ereignisgeschichte selbst, den kohärenten Ablauf des historischen Prozesses in allen Bereichen, zu vernachlässigen und sogleich die Abstraktion, beispielsweise der Theorie der sogenannten Römischen Revolution, anzustreben.
Vielleicht ist es erlaubt, die Historiker, die so entschieden auf Abstraktion drängen, auf den elementaren Unterschied ihrer eigenen Situation — und derjenigen ihrer Leser — gegenüber jener des 19. Jahrhunderts aufmerksam zu machen. Die Ereignisgeschichte wurde seinerzeit „überwunden“ von Gelehrten, die sie auf dem Wissensstand ihrer Zeit beherrschten. Heute ist dagegen sehr häufig zu beobachten, daß lediglich Theoreme mit „Empirie“ aufgefüllt werden oder daß erst dann, wenn die voreilig fixierte, ungeprüft hingenommene und kritiklos weitergegebene Abstraktion in die Sackgasse führte, Ereignisse und Verhältnisse selbst näher untersucht werden. Dabei könnte gerade die ältere sowjetrussische Forschung lehren, wohin man gelangt, wenn Fakten vernachlässigt und historische Quellen nicht mehr berücksichtigt werden.
Hier wird bewußt ein anderer Weg gewählt. Das Fundament dieses Buches bildet eine neue Gesamtdarstellung des historischen Prozesses zwischen 200 und 30 v. Chr., in die Analysen der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und geistigen Entwicklung integriert sind. Erst alle diese Elemente zusammen erlauben es, Wechselwirkungen, Verlauf und Resultate der Epoche als Ganzes zu erfassen und umfassend zu bewerten. Daraus sind Abstraktionen und Reflexionen erwachsen, stimuliert gewiß auch durch Forschungsstand und Problematik der eigenen Zeit. Der Verfasser hat sich darüber hinaus bemüht, wenigstens an einzelnen Knotenpunkten der Gesamtentwicklung die Dimension der Wissenschaftsgeschichte zu berücksichtigen, charakteristische Wertungen der älteren Geschichtsschreibung aufzunehmen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten.
Neben der hier gewählten Methode, der Verbindung von Darstellung, Analyse, Reflexion und Wissenschaftsgeschichte, bedürfen auch die Perspektiven und Proportionen des Werks einer Erläuterung. Selbstverständlich stehen bei diesem Thema die Vorgänge in der Stadt Rom und in Italien im Mittelpunkt. Der in diesem Zeitraum sich vollziehende Aufstieg der Römischen Republik zur Weltmacht des antiken Mittelmeerraums hat indessen zur Folge, daß auch außeritalische Entwicklungen miteinzubeziehen waren: der Niedergang der hellenistischen Staatenwelt, die Machtbildung Mithradates’ VI. von Pontos, Kimbernzug und spätjüdische Geschichte beispielsweise mußten in diesem Rahmen zur Sprache kommen. Andererseits waren bei der Darstellung der Römischen Geschichte gewisse Disproportionen unvermeidlich. Die Überlieferung bietet nun einmal für ganze Jahrzehnte nur wenige verläßliche Nachrichten, während sie für andere Jahre derselben Epoche in besonders dichter Konzentration vorliegt. Da der Verfasser bestrebt war, die Überlieferung immer wieder selbst vorzuführen, wird dieser Befund wohl noch stärker fühlbar.
Schließlich sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß dieses Buch nicht an die Spezialforscher adressiert ist. Die viri eruditissimi werden hier nichts entdecken, was sie nicht ohnehin schon kennen. Die Darstellung wartet auch weder mit gewollt nonkonformistischen Wertungen noch mit dem Glasperlenspiel einer eigenen Begrifflichkeit auf. Sie möchte vielmehr in erster Linie den historisch allgemein Interessierten, nicht zuletzt den Studierenden, die erforderlichen Informationen vermitteln und zu einer neuen Vergegenwärtigung einer der wichtigsten Epochen der Römischen Geschichte anleiten.
Für die Synthese seiner Darstellung hat der Verfasser nicht nur viele Anregungen älterer und neuerer Forscher aufgenommen, sondern auch solche seiner Marburger Kollegen, Mitarbeiter und Hörer. Ihnen allen weiß er sich dankbar verbunden und empfindet es als wohl schönste Genugtuung eines Hochschullehrers, daß er gezwungen ist, mit den Arbeiten der eigenen Schüler zu konkurrieren. Wie die ersten Auflagen dieses Buches (1979, 1984, 1993) zeigten, dürfte dies gelungen sein. In den Neuauflagen wurde der Text jeweils durchgesehen, die bibliographischen Angaben zum Forschungsstand erneuert und erweitert. Letzteres gilt auch für diese Edition: Während die Gesamtkonzeption beibehalten werden konnte, ist besonderer Wert darauf gelegt worden, die wichtigsten Forschungen des letzten Jahrzehnts zu vermitteln. Der „Nachtrag (2000)“ folgt dabei der Disposition der „Bibliographischen Hinweise“ (S. 477ff.). Er beschränkt sich freilich notwendig auf die größeren Werke und wesentlichen Monographien; Aufsätze konnten nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden. Sie werden indessen durch die erwähnten neueren Handbücher und Hilfsmittel erschlossen.
Der Verfasser ist Frau A. Schneider, der früheren bewährten Sekretärin des Fachgebietes Alte Geschichte der Philipps-Universität, für ihre wertvolle Hilfe bei der Erstellung der Satzvorlage dankbar, Helmut Neuhaus für Entwurf und Ausführung der Kartenskizzen, B. Wichter für die kritische Durchsicht des Textteils, V Losemann für vielfältige Unterstützung, nicht zuletzt der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, die das Werk einst unter J. Bauer übernahm und nun die Aktualisierung ermöglichte.
Marburg/Lahn, Juni 1999
Karl Christ
Einleitung
DIE PROBLEMATIK DES UNTERGANGSDER RÖMISCHEN REPUBLIK
Die Römische Republik im Geschichtsbild der Neuzeit
Wenn in diesem Buch die Epoche vom Ende des Zweiten Punischen Krieges bis zur Begründung des augusteischen Principats als Krise und Untergang der Römischen Republik verstanden, dargestellt und erörtert wird, so erfordert dies eine nähere Begründung. Die Römische Republik hat selbst im Geschichtsbild der Neuzeit einen herausragenden Platz behauptet. Noch immer wird sie gesehen als jene historische Formation, in welcher der politische Wille aller freien Bürger in einer einzigartigen Weise organisiert war. Denn nach der Abschaffung der Monarchie und der Einschränkung der Adelsvormacht in den Ständekämpfen konsolidierte sich in dieser Republik eine staatliche Ordnung, die für lange Zeit ein Höchstmaß der Identifizierung aller freien Bürger mit ihrem Staat ermöglichte. Bürgertugenden, Bürgerrechte und Bürgersinn waren hier so exemplarisch verwirklicht, daß sie auf vielfältige Weise die Emanzipationsbestrebungen der Neuzeit beflügelten.
Zugleich schuf diese bescheidene mittelitalische Stadt in der Organisation ihrer Bundesgenossenschaft ein neuartiges politisches Herrschaftsmodell, das ihr erlaubte, schließlich ganz Italien ihrer Macht nicht nur zu unterwerfen, sondern fest in ihren Machtbereich zu integrieren. Die Punischen Kriege stellten die Stabilität der politischen Neuordnung Italiens unter Beweis; sie leiteten zugleich jenen scheinbar unaufhaltsamen Prozeß ein, in dem Rom den gesamten Mittelmeerraum zu der neuen historischen Formation des Imperium Romanum zusammenschloß, die sich dann unter dem Principat Jahrhunderte hindurch behauptet hat.
In diesem traditionellen Geschichtsbild dominiert offenkundig die Vorstellung der Einheit der Geschichte der Römischen Republik, der dann zumeist jene der römischen Kaiserzeit oder des Principats als anschließende, neue Einheit entgegengesetzt wird. Gewiß gliedert man diese Einheit der republikanischen Geschichte häufig in sich auf. So wird zum Beispiel aus einer primär verfassungsrechtlichen Sicht unterschieden zwischen einem „patrizischen Staat“ der Zeit zwischen ca. 500 und 287 v. Chr., der „klassischen Republik“ (287—133 v. Chr.) und dem „Zeitalter der Römischen Revolution“ (133—31 v. Chr.). Sicher lassen sich viele Gründe für eine solche Untergliederung ins Feld führen. Ein Vorzug dieser konventionellen Periodisierung liegt zum Beispiel darin, daß sie den Beginn der Reformen der Gracchen als Zäsur sehr stark betont, doch steht dem der ganz evidente Nachteil entgegen, daß sie längerfristige Entwicklungen zerschneiden muß, die für das Verständnis der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, aber auch der politischen Veränderungen grundlegend sind.
Sehen wir von dem äußerst problematischen Unterfangen einmal ab, die Schlußphase der Römischen Republik als „Römische Revolution“ zu verstehen, so besteht heute selbst zwischen marxistischen und sogenannten bürgerlichen Historikern wenigstens darin Einvernehmen, daß der Zeitraum des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr. eine teilweise kaum merkliche und nur graduelle, teilweise aber geradezu schubartige und durchgreifende Umgestaltung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen der Römischen Republik mit sich bringt. Diese Entwicklung dürfte dann plastisch hervortreten, wenn — naturgemäß sehr vereinfacht — wesentliche Erscheinungsformen der frühen und der späten Republik einander gegenübergestellt werden, wobei hier unter früher Republik die Verhältnisse bis in das 3., unter später Republik jene des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr. bezeichnet sind.
Frühe und Späte Republik
Gehen wir von der Wirtschaftsstruktur aus, so bleibt in der frühen Republik eine weitgehende agrarische Selbstversorgung, die Subsistenzwirtschaft, vorherrschend. Der Anteil der Sklaven an der Produktion ist gering, kennzeichnend vielmehr die sogenannte patriarchalische Form der Sklaverei, das heißt die Integration einzelner Sklaven in die Hauswirtschaft. Der Radius des Handels war in der Regel beschränkt, Ansätze der Geldwirtschaft treten erst seit dem Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. und zunächst in sehr rudimentären Formen auf. Ihre Intensivierung und volle Ausbildung erfolgt erst im Laufe des 3. Jahrhunderts v. Chr., und in der wiederholten Neuordnung des römischen Währungssystems finden gerade die Krisen der Punischen Kriege einen sehr bezeichnenden Niederschlag.
Die späte Republik weist in diesen Feldern dagegen völlig verschiedene Strukturen auf. Gewiß hält sich auch jetzt noch in vielen Landschaften Italiens der agrarische Kleinbetrieb, wohl in größerem Umfang, als dies die Analytiker gelegentlich zur Kenntnis nehmen, aber die systematische Restauration der alten Wirtschaftsordnung konnte, nach den weitflächigen Zerstörungshorizonten gerade des 2. Punischen Krieges in Italien und unter den veränderten Bedingungen des 2. Jahrhunderts v. Chr., nicht mehr gelingen. Einerseits nahm nun die Weidewirtschaft beträchtlich zu, andererseits dehnten sich die Zellen der „Villenwirtschaft“ immer weiter aus, damit eine durch Spezialisierung und Rationalisierung überlegene, marktbezogene Wirtschaftsform, in der sich die alte Führungsschicht deswegen besonders stark engagieren konnte, weil ihr dafür sowohl die notwendigen Kapitalien als auch die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung standen.
Denn erst jetzt kann man in einzelnen Regionen Siziliens, Unteritaliens und Etruriens von einer „Sklavenhalterwirtschaft“ in dem Sinne sprechen, daß auf den großen Weideflächen Dutzende, in den einzelnen Landgütern ebenfalls jeweils bis zu 2 oder 3 Dutzend Sklaven eingesetzt wurden. Tausende von Kriegsgefangenen und ein systematisch organisierter Sklavenmarkt erhöhten fortlaufend die Gesamtzahl der im Produktionsprozeß befindlichen Sklaven, wobei freilich im agrarischen Sektor, im Handwerk und bei den Haussklaven jeweils völlig verschiedenartige Arbeitsbedingungen bestanden.
Im Bereich der Wirtschaft kommen zur Zeit der späten Republik noch zwei weitere, neue Faktoren hinzu: Einmal verdichtete sich nun die Verflechtung der italischen Wirtschaft in jene des gesamtmediterranen Wirtschaftsraumes in zunehmendem Maße, zum andern wurde die Eigengesetzlichkeit der voll entwickelten Geldwirtschaft mit den Möglichkeiten der Kapitalkonzentration und des Zinswuchers rasch fühlbar. Neue, wirtschaftlich aktive Gruppen kristallisierten sich heraus, zugleich boten Kriegführung und Provinzialverwaltung den Angehörigen der römischen Führungsschicht die Möglichkeit zur Beschaffung jener beträchtlichen Geldmittel, ohne die eine politische Karriere in Rom jetzt in der Regel nicht mehr möglich war.
Auch für die Bereiche der äußeren Machtbildung, der äußeren Politik und der Organisation des römischen Imperiums ist ein starker Kontrast in den Erscheinungsformen der frühen und der späten Republik festzustellen. Bis zum 2. Punischen Krieg waren Italien und dessen unmittelbares Vorfeld mit dem römischen Machtbereich identisch. Dieser, in sich relativ geschlossene Raum konnte in den abgestuften Rechtsformen der römisch-italischen Bundesgenossenschaft organisiert und beherrscht werden. Römische und latinische Kolonien reproduzierten fort und fort die gesellschaftliche und wirtschaftliche Basis der bevorrechtigten cives Romani und ihrer latinischen Bundesgenossen, ihr Netz sicherte zugleich die Herrschaft der Römischen Republik militärisch und politisch ab.
Im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. hatte Rom nun den Preis für sein immer weiter ausgedehntes Engagement zu bezahlen. Die Interventionen in Spanien, Griechenland, Nordafrika und Kleinasien führten alle Versuche ad absurdum, die römische Beherrschung jener Räume lediglich mit den mehr indirekten Mitteln einer Hegemonie aufrechtzuerhalten. Rom mußte schließlich weite Territorien in die unmittelbare Provinzialverwaltung übernehmen, eine administrative und politische Aufgabe, die mit dem Instrumentarium eines immer noch aristokratisch geführten Stadtstaates nicht mehr zu lösen war. Der rasche Wechsel der Statthalter verhinderte kontinuierliche Planungen ebenso wie die Konsolidierung und Effizienz der Verwaltung, die in den Provinzen lange Zeit ganz offen lediglich die praedia, die Ausbeutungsobjekte des römischen Volkes, sprich seiner führenden Schicht, sah. Die Formen der italischen Bundesgenossenschaft ließen sich auf diese Räume erst recht nicht mehr übertragen, und da die römischen Bundesgenossen zwar immer noch in erheblichem Ausmaß an den Einsätzen, dagegen nicht mehr am Gewinn der römischen Expansion beteiligt waren, wurde die Bundesgenossenfrage zu einem neuen Problem der römischen Herrschaftsstruktur.
Die machtpolitisch vielleicht auf den ersten Blick so imponierende Ausweitung der römischen Herrschaft im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. darf zudem nicht den Blick dafür verstellen, welche Belastungen, Konsequenzen und Rückwirkungen sich hieraus für die alte staatstragende Schicht der freien römischen Vollbürger, das heißt der Kleinbauern und Handwerker, ergaben. Nicht die großen, massierten Feldzüge im hellenistischen Osten oder in Nordafrika, sondern die jähre-, ja jahrzehntelangen Einsätze in Spanien haben das italische Bauerntum paralysiert, waren doch schon allein die längere Abwesenheit, Krankheit oder schwerere Verwundung des Eigentümers eines Kleinbetriebes häufig identisch mit dem Ruin seines Besitzes. Gleichzeitig wurde auch hier die Führungsschicht korrumpiert. Nach den Erfahrungen unserer Zeit dürfte es einleuchten, daß eine Großmacht auch an den peripheren Problemen eines kolonialen Kriegsschauplatzes scheitern kann, in dem ihre militärische Überlegenheit nur bedingt zum Einsatz zu bringen ist und ihre skrupellose Kriegführung die tiefsten moralischen und psychologischen Reaktionen auf das Mutterland nach sich zieht, schließlich fundamentale Voraussetzungen des Selbstverständnisses der Großmacht in Frage stellt.
Kontinuität und Radien des militärischen Einsatzes zogen in der Zeit der späten Republik auch eine tiefgreifende Veränderung der Heeresverfassung nach sich, diese wiederum eine solche der gesamten politischen Struktur. Hatte sich die römische Armee bisher aus einer Bürgermiliz rekrutiert, die von meist alljährlich wechselnden Kommandeuren befehligt wurde, so forderten die militärischen Aufgaben des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr. längerfristig dienende Verbände, damit die Erweiterung der Rekrutierungsbasis in der römischen Gesellschaft, ebenso wie die Übertragung langfristiger Befehlsgewalt an militärische Experten oder an Politiker, von denen eine Mobilisierung der Verbündeten auf dem speziellen Kriegsschauplatz zu erhoffen war.
Wichtiger als die militärtechnischen Konsequenzen, die diese Veränderung nach sich zog, waren jedoch ihre sozialen und politischen Auswirkungen. Denn sie führten alsbald zur Überlagerung und Auflösung jener Klientelverhältnisse, die bislang Gesellschaft wie Politik der Römischen Republik entscheidend strukturiert hatten. Das wechselseitige Bindungsverhältnis zwischen den Angehörigen der römischen Führungsschicht, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen Macht, ihrer politischen Einflußmöglichkeiten, ihrer Kompetenz wie ihres Sozialprestiges in der Lage waren, in wirtschaftlichen, juristischen und sonstigen Notfällen eine wirksame Unterstützung zu gewähren oder dem Schwächeren zu seinem Recht zu verhelfen, und den von ihnen abhängigen Personengruppen war ursprünglich die bedeutsamste gesellschaftliche und politische Grundlinie innerhalb des römischen Staates gewesen. Da dieses Bindungsverhältnis auch auf die außeritalischen Gebiete der Republik übertragen wurde, kam es zunächst zu einer beträchtlichen Ausweitung des Einflusses einzelner Geschlechter der römischen Aristokratie, die durchaus bedenkliche Entwicklungsmöglichkeiten in sich barg und zumindest das System gleichrangiger rivalisierender Kräfte innerhalb der Führungsschicht allein schon durch ihre Dimensionen zu sprengen drohte.
Allein die entscheidende Veränderung vollzog sich an anderer Stelle und in anderen Zusammenhängen. Den Inhabern der großen Heereskommandos wuchsen in den längerfristig dienenden Verbänden „Heeresgefolgschaften“ zu. In der Praxis erhielt die Beziehung des Soldaten zu „seinem“ Feldherrn, der sich auch um seine Versorgung zu kümmern hatte, Vorrang gegenüber den traditionellen Bindungen an den alten Patron seiner Heimat, Vorrang erst recht gegenüber den abstrakten und unpersönlichen Bindungen an Senat und Volk, Staat und Republik. Der politische Einsatz — und Mißbrauch — der Heeresklientel mußte schon deshalb unumgänglich werden, weil diese existentiell begründet war. In dieser Heeresklientel zeichnete sich damit auch jener Machtfaktor ab, der über das Schicksal der Republik entscheiden sollte.
Der Kontrast zwischen früher und später Republik muß deshalb so stark betont werden, weil, rein äußerlich betrachtet, in Verfassungsnormen und Rechtskategorien die Kontinuität überwiegt. Noch immer lag die Souveränität dieser Republik theoretisch bei allen freien Bürgern, waren die Funktionen des Senats, die Kompetenzen der Volksversammlung, Namen und Aufgaben der Magistrate dieselben geblieben. Es zeigt sich hier, daß die lediglich formale verfassungsrechtliche Sicht die Entwicklungen der späten Republik ebenso schlecht in den Griff bekommt wie die rein personale.
Im ersten Fall ist die Feststellung zwar richtig, daß die Inadäquanz der Mittel des Stadtstaates für die Aufgaben des Imperium Romanum zur Krise führte, aber eine solche Betrachtung wirkt lediglich abstrakt und statisch. Sie kann nicht plausibel erklären, warum die Verfassung dieser Republik nicht der neuen Situation entsprechend weiterentwikkelt wurde, so wie das in früheren Jahrhunderten, als Folge der Ständekämpfe ebenso wie als Folge der römischen Herrschaft über ganz Italien, der Fall gewesen war.
Auch die überwiegend personale Betrachtungsweise stößt hier an Grenzen. Es ist wohl unbestreitbar, daß in keiner Phase der Geschichte der Römischen Republik einzelne Persönlichkeiten eine solch bedeutsame Rolle spielten wie gerade im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. Männer wie die Scipionen, Cato, die Gracchen, Marius, Sulla, Pompeius und Caesar — um nur die Namen der wichtigsten zu nennen — bestimmten wiederholt den Kurs der römischen Politik im Innern wie im Äußeren. Doch diese Namen bezeichnen zugleich auch die Grenzen der Macht einzelner Persönlichkeiten, denn es gehört zu den Merkmalen der Epoche, daß die Mehrzahl der führenden Politiker durch Gewalt endete, die Gracchen in Rom untergingen, Pompeius von einem ehemaligen Untergebenen ermordet wurde, Caesar ein Opfer auch seiner Freunde wie Cicero das der Proskriptionen des jungen Octavian, den er so sehr gefördert hatte, geworden ist.
Die hier sichtbar werdende Radikalisierung der Politik erfaßte indessen nicht nur die Spitzen der politischen und militärischen Gruppierungen, sondern Tausende, ja Zehntausende von Gegnern oder auch nur begüterten Bürgern, die gerade nicht zur eigenen Gruppe gehörten. In Fanatismus und Brutalität hielten sich Aristokraten und ihre Opponenten die Waage. Exzesse dieser Art aber wären auf die Dauer kaum denkbar, wenn es dabei lediglich um persönliche Ambitionen gegangen wäre. Gerade hier wird vielmehr erkennbar, daß die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft der späten Republik nicht allein auf persönliche Motive und auch nicht allein auf den Einfluß weniger großer Einzelpersönlichkeiten zurückgeführt werden kann.
Sollen die damit skizzierten Entwicklungen in einer angemessenen Weise zur Darstellung kommen, so ist es erforderlich, das alte Epochendatum 133 v. Chr. aufzugeben und weiter zurückzugreifen. Tatsächlich ist eine solche Tendenz nicht neu, sondern schon seit geraumer Zeit in nicht wenigen Werken zu beobachten, die sich um eine angemessene Einordnung des Geschehens wie um die Analyse des sozialen Wandels in der späten Republik bemühen. Es geht dabei nicht darum, um jeden Preis eine neue Periodisierung innerhalb der Römischen Geschichte durchzusetzen, sondern darum, jene Einheit insgesamt zu erfassen, die durch die Entwicklung selbst konstituiert wird.
Die Beurteilung der Späten Republik in der modernen Geschichtsschreibung
Beurteilungen und Darstellungen der späten Republik gehen in ihren Perspektiven und Wertungen weit auseinander. Es empfiehlt sich, hier wenigstens an die wichtigsten Positionen zu erinnern, um dem Gegenstand auch von dieser Seite her näherzukommen. Für Barthold Georg Niebuhr, der die Erforschung der Römischen Geschichte in der Neuzeit so entscheidend stimuliert hat, lag der Schwerpunkt seines Interesses auf der Ausbildung der frühen und klassischen Republik. Das 4. Jahrhundert v. Chr. und die Zeit des 1. Punischen Krieges waren für ihn gleichsam die heroischen Zeitalter der Republik, die folgende Entwicklungsphase in seiner Sicht lediglich „das Ende eines durchgeführten Lebens… von dem hannibalischen Kriege an treten nur noch Anstrengungen ein, um Krisen hervorzubringen, ein Jahrhundert nachher hört auch dieses auf“.
Ungeachtet dieses sehr distanzierten Verhältnisses, das auch für andere Gelehrte, welche die klassische Republik idealisierten, charakteristisch ist, war Niebuhr das Grundproblem der Geschichte der späten Republik durchaus bewußt: „Es ist eine der irrigsten Vorstellungen, daß man glaubt, eine Verfassung bleibe dieselbe wenn die äußeren Formen dieselben bleiben: wenn die Vertheilung des Eigenthums, die öffentliche Gesinnung, die Lebensweise sich ändern, so kann ohne Änderung der Formen die Verfassung ganz verschieden werden von dem was sie war, und dieselbe Form zu einer Zeit demokratisch, zu einer anderen aristokratisch sein. Diese innere Veränderung zeigt die neuere Geschichtsschreibung sehr wenig, sie ist aber gerade eines von den Dingen die man vorzugsweise in der Geschichte ergründen muß.“
Niebuhrs entschiedene Wertung hinderte ihn nicht daran, die Bedeutung jener Epochen, die ihm „als National- und politische Geschichte… traurig und unerfreulich“ erschienen, für die „Weltgeschichte“ durchaus anzuerkennen. Jene universalhistorische Konzeption, die später Ranke und Burckhardt vortrugen, war im Grunde schon bei Droysen vorgebildet, der das ganze Zeitalter des Hellenismus auf die Ausbildung des Christentums bezogen hatte und damit gerade die späthellenistische Zeit als die Phase der politischen und kulturellen Vorbereitung der Ausbreitung des Christentums in einen neuen Rang erhob. Denn in einer ähnlichen Weise wie hier wurde die Geschichte der späten Römischen Republik auch bei Ranke und Burckhardt vom vorgegebenen Ziel innerhalb eines universalhistorischen Rahmens bewertet. Zu den vier großen „Produktionen“ des Römischen Reiches zählte für Ranke nun einmal auch „die monarchische Verfassung“ Roms, eine neue Erhärtung des aristokratischen Stadtregiments war nach seinen welthistorischen Kriterien dagegen „unerwünscht“.
In die gleiche Richtung weisen die dezidierten Worte Jacob Burckhardts: „Es war ein Lebensinteresse der alten Welt, daß die infame Provinzialverwaltung des Senates aufhörte; es war ungleich wichtiger, daß der orbis terrarum nicht mehr von factiösen Intriganten ausgesogen wurde, als daß in Rom noch Republik gespielt werden konnte.“ Wer wie Burckhardt davon ausging, daß es Roms welthistorische Mission war, seine graecisierte Bildung den Völkern des Westens zu vermitteln und den großen Rahmen für die Ausbreitung des Christentums zu schaffen, zwang der historischen Entwicklung einen Fluchtpunkt auf, den die Handelnden selbst nicht ahnen konnten. Vor dieser Aporie steht freilich auch jede neuere universalhistorische Konzeption.
Das moderne Verständnis unserer Epoche wurde von Theodor Mommsen begründet, der den zweiten, 1855 erschienenen Band seiner ›Römischen Geschichte‹ unter das Signum der „Revolution“ gestellt hatte. Behandelte dieser Band die Ereignisse von der Schlacht bei Pydna (168 v. Chr.) bis zu Sullas Tod, so der folgende, in einer Apotheose Caesars gipfelnde, „die Begründung der Militärmonarchie“. In einem ganz neuen Stil war hier der historische Stoff mit geistigen wie mit politischen Energien aufgeladen und gleichsam dynamisiert, vor allem aber die große innere Krise, die nach Mommsen die römische Revolution eröffnete, konsequent „aus den ökonomischen und sozialen Verhältnissen“ abgeleitet. Mommsen brandmarkte dabei die Cliquenwirtschaft adliger „Nullitäten“ wie die Mißstände „einer noch unentwickelten, aber schon im Keime vom Wurmfraß ergriffenen Demokratie“, er führte den „Konflikt von Arbeit und Kapital“ ebenso ins Bewußtsein wie „das Meer von Jammer und Elend“ bei den römischen Sklaven. Haßte er in Gaius Gracchus einen „politischen Brandstifter“ und den „größten der politischen Verbrecher“, so geriet sein Caesarbild zur idealistischen Konstruktion. Auch bei ihm verzerrte die überspannte Dimension einer ganz persönlichen Caesarvorstellung die Konturen und Proportionen der späten Republik.
Gegenüber den mit Leidenschaft und in glänzendem Stil geschriebenen Bänden setzten sich weder Kritik noch Ehrenrettungen durch. Mochte Carl Peter die machiavellistische Politik der Römer in der Zeit vom Ende des 2. Punischen Krieges bis zu den Gracchen aus humanistischer Sicht wesentlich schärfer geißeln als Mommsen, Wilhelm Ihne sich für Pompeius und Cicero engagieren, Mommsens faszinierende Gestaltung beherrschte das Geschichtsbild der folgenden Generationen.
Vielleicht war Mommsens Wirkung auch mit deshalb so groß, weil seine Auffassung innerhalb der von ihm konzipierten Gesamtdarstellung der „Römischen Geschichte“ vorgetragen worden war, einer Darstellung, welche dann freilich an einem neuralgischen Punkt — 46 v. Chr. — abbrach. Die folgenden monographisch gestalteten Werke konnten damit schon a limine nicht rivalisieren. C. J. Neumanns ›Geschichte Roms während des Verfalles der Republik‹ (Breslau 1881) ist ein aus Pietätsgründen herausgegebenes Vorlesungsmanuskript, das ungeachtet der gründlichen Anlage und einzelner treffender Beobachtungen ohne größere Resonanz bleiben mußte.
Das zu Beginn unseres Jahrhunderts weit verbreitete und in mehrere Sprachen übersetzte mehrbändige Werk von Guglielmo Ferrero ›Grandezza e decadenza di Roma› (5 Bde. 1902—1907; deutsche Übersetzung: ›Größe und Niedergang Roms‹. 6 Bde. 1908—1910) empfahl sich zwar durch eine flüssige und anregende Darstellung von großem Elan, aber die oft sehr subjektiven Wertungen trugen ihm das Verdikt des wissenschaftlich Unseriösen ein, so daß es seit langem aus dem Blickfeld verschwunden ist.
Ein wissenschaftlich wie literarisch gleich imponierendes Werk legte 1939 Ronald Syme unter dem Titel ›The Roman Revolution‹ vor. Gegenstand des Buches ist jedoch lediglich die Umwandlung der römischen Gesellschaft und des römischen Staates in der Zeit zwischen dem 1. Triumvirat Caesars, Crassus’ und Pompeius’ im Jahre 60 v. Chr. und dem Tode des Augustus (14 n. Chr.). Der Principat des Augustus, der hier sehr kritisch analysiert wurde, vor allem mit Hilfe der personengeschichtlichen Forschung, jener angewandten Prosopographie im Stile der „Namier-School“, wurde als Konsolidierung eines revolutionären Prozesses verstanden, in dessen Verlauf die Parteigänger Caesars ebenso eine Verschiebung der politischen Macht erzielt hatten wie eine Verlagerung von Besitz und Eigentum.
Auch für Alfred Heuß, dem unsere Generation eine moderne, große Gesamtdarstellung der Geschichte Roms verdankt, ist das römische Revolutionszeitalter der „fesselndste Abschnitt der gesamten römischen Geschichte“ gewesen, den er wiederholt und ausführlich beschrieb. Heuß hat diese Epoche in besonderer Schärfe als dialektischen Prozeß im Sinne Hegels verstanden zwischen den Vorstößen von Revolutionären, die ihre Funktion kaum kennen, und den Gegenschlägen der Konservativen. Er hat die einzelnen Phasen dieses Prozesses herauszuarbeiten gesucht und insbesondere den konsequenten Zug zur Militarisierung der Revolution, der dann zur Militärdiktatur führte, erfaßt. Obwohl Heuß den Vorrang der innenpolitischen Problematik unterstrich, hat er doch auch die weltgeschichtliche Dimension der Epoche gesehen.
Die Problematik der Anwendung des Revolutionsbegriffs
Doch vor allem ist ihm die Anwendung des Revolutionsbegriffs des 19. und 20. Jahrhunderts auf dieses Zeitalter zum Problem geworden. War schon nach dem Erscheinen des Werks von Ronald Syme zweifelhaft, ob der moderne Revolutionsbegriff zur Erfassung der spezifischen politischen und sozio-ökonomischen Realität der späten Republik tauglich war, so stellte sich die Frage an anderer Stelle mit noch schärferer Brisanz und mit noch weiterreichenden Folgen. Denn auch von marxistischen Historikern, wie von S. L. Uttschenko und E. Schtajerman, wurden in zunehmendem Maße die Schwierigkeiten gesehen, die sich hier aus einer undifferenzierten Anwendung des marxistischen Revolutionsmodells ergaben. Das galt sowohl für die Bewertung der großen Sklavenaufstände als auch für die Einschätzung der Spätphase der Römischen Republik. Neben J. Vogt haben sich gerade sowjetrussische Forscher mit am entschiedensten von den älteren Auffassungen distanziert, die Sklavenkriege der Jahre 136—132, 104—100 in Sizilien, den Aristonikosaufstand in der Provinz Asien zwischen 133 und 129 v. Chr., andere, ungefähr gleichzeitige Erhebungen in Unteritalien und Griechenland und schließlich auch noch den Spartacusaufstand von 73—71 v. Chr. pauschal als eine Art universeller Revolution der antiken Sklaven und der armen Freien gegen die Sklavenhalter und damit als einen umfassend und bewußt geführten Klassenkampf zu interpretieren.
Obwohl das Resultat von Heuß’ theoretischen Erörterungen eindeutig negativ war, zeigt doch gerade er — wie auf marxistischer Seite S. L. Uttschenko — wie schwierig es ist, sich von der gewohnten und gängigen Begrifflichkeit zu trennen. Obwohl beide Forscher den Begriff der Revolution im Rahmen ihrer geschichtstheoretischen Konzeption eindringend präzisieren und die Hindernisse deutlich machen, die seiner Anwendung in diesem Zusammenhang entgegenstehen, wenden sie ihn nach wie vor an. Es soll hier nicht auf Einzelheiten und Widersprüche der seither in Gang gekommenen theoretischen Debatte eingegangen werden, die wesentlichen Fortschritte der modernen Forschung liegen auf anderen Feldern. Denn es muß mit Nachdruck gesagt werden, daß die wichtigsten Beiträge der modernen Geschichtswissenschaft zur Epoche der späten Republik nicht in neueren Gesamtdarstellungen, sondern in den großen wissenschaftlichen Monographien und Spezialuntersuchungen zu finden sind.
Methoden und Perspektiven der neueren Forschung
Den neuen Rang der Individualitäten in dieser Epoche hatte bereits Hegel betont. Seit dem monumentalen Werk von W. Drumann (Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Cicero, Caesar und ihre Zeitgenossen. 6 Bde. Berlin 1834—44. 2. Auflage bearbeitet von P. Groebe, 1899—1929), in dem Geschichte in Biographien aufgelöst und das dennoch als Materialsammlung unentbehrlich war, ist die personengeschichtliche Forschung aus verschiedenen, wissenschaftsgeschichtlich begründeten Impulsen vorangetrieben worden. In zahlreichen Einzelartikeln für Pauly-Wissowas monumentale ›Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft‹ und in seinen gediegenen Caesar-, Pompeius- und Cicero-Biographien hat vor allem Matthias Gelzer versucht, wissenschaftlich begründete und sorgfältig nuancierte Lebensbilder der führenden Politiker der späten Republik zu erarbeiten. Andere wertvolle Biographien aus der Feder von H. H. Scullard, A. E. Astin, J. van Ooteghem und vielen anderen traten hinzu und dokumentierten zugleich, daß es sich bei diesem literarischen Genos nicht allein um eine deutsche „Fehlentwicklung“ handelt.
Für die moderne prosopographische Forschung, die auch Fragestellungen der Soziologie aufgriff, ist die Einzelbiographie freilich nicht mehr als ein Mosaikstein für viel weitergehende Intentionen. Seit der bahnbrechenden Untersuchung von Matthias Gelzer über „die Nobilität der römischen Republik“ (Leipzig 1912) und der diffizilen Monographie von Friedrich Münzer über ›Römische Adelsparteien und Adelsfamilien‹ (Stuttgart 1920) haben für unsere Epoche insbesondere H. H. Scullard (Roman Politics 220—150 B. C. Oxford 1951) und E. Badian (Foreign Clientelae. Oxford 1958) versucht, die Strukturen, Formen und Normen gentilizischer Gruppenpolitik sowie die Bedeutung der clientela-Kategorie auch für den Bereich der äußeren Politik zu erfassen, T. P. Wiseman (New Men in the Roman Senate 139 B.C.-A.D. 14. London 1971) die wichtige Gruppe der sozialen „Aufsteiger“ zu ermitteln.
Stand zunächst die Führungsschicht im engeren Sinne, die Senatoren, im Zentrum des Forschungsinteresses, so wurden in den letzten Jahrzehnten nun auch die übrigen sozialen Gruppen eingehender untersucht. In dem vorzüglichen Standardwerk von C. Nicolet (L’ordre équestre à l’époque républicaine [312—43 av. J. C.] 2 Bde. Paris 1964, 1974) sind die Angehörigen des Ritterstandes erstmals systematisch erfaßt, in wichtigen Einzeluntersuchungen von P. A. Brunt und E. Badian in ihren wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten diskutiert worden. Auch Plebs, Freigelassene, Sklaven wurden detaillierter analysiert, vor allem aber veröffentlichte P. A. Brunt eine in der Tradition Julius Belochs stehende, neue, große Bevölkerungsgeschichte der späten Republik, die es endlich erlaubt, Bevölkerungsrelationen, Heeresstärken und Machtpotential dieser Zeit präzise zu erfassen (Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14, Oxford 1971).
Auf die Schlüsselstellung des römischen Heeres wurde schon hingewiesen. Seine Rekrutierungsbasis, Zusammensetzung und Entwicklung haben insbesondere E. Gabba (Esercito e Società nella tarda Republica Romana. Florenz 1973) und J. Harmand (L’armée et le soldat à Rome de 107 à 50 av. J. C. Paris 1967) präzisiert, daneben liegen gerade für diesen Sektor zahlreiche andere Spezialuntersuchungen vor.
Wichtiger wurden indessen die übergreifenden Arbeiten, wie der Versuch von Christian Meier, die Verfassungswirklichkeit der späten Republik mit dem Instrumentarium und den Kategorien der wissenschaftlichen Politik in den Griff zu bekommen, aus Wahlverhalten, Bindungswesen, „politischer Grammatik“ die gesellschaftliche und politische Struktur der Epoche zu erhellen (Res publica amissa. Wiesbaden 1966). Wirkte diese Monographie vor allem durch die Modernität ihrer Methode und ihrer Ansätze, so imponierte die breitangelegte Untersuchung von E. S. Gruen (The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley 1974) durch die geschlossene Systematik, mit der für den Zeitraum zwischen 78 und 49 v. Chr. politische Verbindungen, Wahlen, Rechtsprechung, soziale und politische Konflikte analysiert wurden.
Eine zunehmende Beachtung fanden in den letzten Jahrzehnten die wirtschaftlichen Probleme. Im Bereich der Agrargeschichte, dem Schlüssel zum Verständnis der römischen Wirtschaft überhaupt, hat die Habilitationsschrift von Max Weber (Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht. Stuttgart 1891) bis heute ihren kanonischen Rang bewahrt. Doch gerade auf diesem Felde sind die Wirtschaftsstruktur, die Verbreitung der Villen, die Ausbildung des Kolonats, die Wechselbeziehungen zwischen Armee und Land mit besonderer Energie bearbeitet worden. Italienische Gelehrte wie A. Burdese und G. Tibiletti trugen wesentliche neue Erkenntnisse zur Geschichte des ager publicus vor. In A. J. Toynbees Alterswerk (Hannibal’s Legacy. 2 Bde. London 1965) wie in E. M. Schtajermans Monographie (Die Blütezeit der Sklavenwirtschaft in der römischen Republik. Wiesbaden 1967) wurden konkrete Einzeluntersuchungen in einen größeren Zusammenhang gestellt.
Andere wichtige Forschungsaspekte müssen zunächst zurückgestellt werden, die Erörterung der außenpolitischen Fragen wie jene des sogenannten römischen Imperialismus, Beiträge der Provinzialgeschichte wie des großen Sektors der römischen Kulturgeschichte und andere mehr. Doch schon das hier skizzierte Spektrum neuerer Untersuchungsansätze und -resultate dürfte deutlich machen, wie lebendig und vielseitig die moderne Forschung diesen Zeitraum bearbeitet hat.
Der Verfasser hat sich in diesem Buch die Aufgabe gestellt, die Zeit der späten Republik unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Forschungsstandes in einer Synthese von Darstellung, problemgeschichtlicher Analyse und historischer Reflexion für einen weiteren Leserkreis zu behandeln. Es geht ihm darum, die Desintegration einer Gesellschaft, das Scheitern einer Republik, eine Epoche tiefgreifenden politischen wie wirtschaftlichen und kulturellen Wandels in möglichst weiten Dimensionen zu erfassen. Ob es sich um die Expansion einer Großmacht, die Dialektik zwischen sozialen Reformen und politischer Restauration als Machtfrage, den Konflikt zwischen Gruppen- und Gesamtinteresse handelt — den Ursachen von Krise und Untergang der Römischen Republik nachzugehen, bleibt die Leitfrage dieses Buches.
1. DIE RÖMISCHE EXPANSION IM WESTEN ZWISCHEN 201 UND 133 V. CHR.
Das Ende des 2. Punischen Krieges
Nach der Niederlage von Zama, der letzten großen Schlacht des 2. Punischen Krieges (202 v. Chr.), erloschen auf karthagischer Seite alle Hoffnungen, das Schicksal doch noch zu wenden. Der Friede, den Scipio jetzt diktierte, beließ der Stadt wenig mehr als die nackte Existenz. Karthago mußte seine gesamte Kriegsflotte bis auf 10 Schiffe abliefern und ebenso die Kriegselefanten. Es mußte sich überdies verpflichten, in Zukunft nur noch mit römischer Zustimmung Krieg zu führen — und gerade diese Bestimmung sollte sich angesichts der römischen Freundschaft mit dem Numiderkönig Massinissa und angesichts der chronischen Wirren im Hinterland von Karthago wie in Numidien als eine schwere Fessel erweisen, aber auch als eine erniedrigende Provokation. Denn eine weitere Bestimmung besagte, daß Karthago den gesamten ehemaligen Besitz des Massinissa und seiner Vorfahren wieder herauszugeben hatte, und es war evident, daß hier immer neuen Forderungen Tür und Tor geöffnet war.
Daß der de facto schon längst eingetretene Verlust des gesamten ehemaligen karthagischen Kolonialbesitzes nun auch juristisch besiegelt wurde, verstand sich von selbst. Vielleicht am einschneidendsten und auch für jeden einzelnen karthagischen Bürger am fühlbarsten aber wurde die ungeheure Kontribution, welche die Stadt in der Gesamthöhe von 10.000 Talenten Silber auf die Dauer eines halben Jahrhunderts belastete. Wenn Karthago noch 100 Geiseln zu stellen hatte, als römisches Faustpfand für die Einhaltung dieses Friedens, so entsprach dies freilich den Normen der Zeit.
Sieht man aufs Ganze, so brachte dieser Friede des Jahres 201 v. Chr. nicht nur das Ende aller karthagischen Großmachtpolitik, sondern er beschnitt für die Zukunft auch die Handlungsfreiheit der Stadt in Afrika und selbst in ihrer nächsten Umgebung. Der römische Favorit Massinissa aber wurde von Rom ganz bewußt deshalb zu einer relativ starken machtpolitischen Gegenposition aufgebaut, damit Karthago durch den konstanten Rivalen in Atem gehalten würde. Dabei war der Numiderkönig eine Natur, die zu Übergriffen nicht erst ermutigt zu werden brauchte. In gleicher Weise ist auch die Kontribution eine Bindung für Jahrzehnte gewesen, denn Rom war nicht bereit, dem in seinen Augen ewig potentiellen Gegner noch einmal eine wirklich freie Entfaltungsmöglichkeit zu gewähren. Zu tief saß der Haß gegen die Macht, die Rom so lange gedemütigt hatte. Schon von der Regelung des Jahres 201 v. Chr. her ist es deshalb nicht ohne innere Konsequenz, daß Karthago das Ende der Kontributionszahlungen im Jahre 151 v. Chr. nur um wenige Jahre überlebte.
In Rom konnte Scipio endlich „in dem berühmtesten Triumph von allen“, wie Livius schreibt, in die Stadt einziehen, nicht weniger als 123.000 Pfund Silber in den Staatsschatz einbringen und dazu noch seine Soldaten aus der Beute reich beschenken. Der in Italien schon seit Hannibals Abzug im Winter 203/202 v. Chr. ausgebrannte Krieg war damit offiziell beendet, das Land wie die Stadt Rom bedurften des Friedens dringender denn je. Denn in den 17 Kriegsjahren waren Zehntausende von Römern und Italikern erschlagen oder verwundet worden, weite Landstriche durch eine Kriegführung, die das Land aussog und den Gegner zugleich schädigen wollte, vernichtet, angeblich rund vierhundert Ortschaften zerstört. Es dürfte in Süd- und Mittelitalien kaum eine Familie gegeben haben, der dieser Krieg keine Wunden schlug und keine Verluste brachte.
Um diesen hohen Preis hatte die Römische Republik nicht nur über das militärische Genie Hannibal triumphiert, sondern auch über die alte Vormacht des südlichen und westlichen Mittelmeerraumes. Sie triumphierte zugleich jedoch auch über die großen italischen Rivalinnen. Capua, die reiche und blühende Stadt in der Campagna, die von Rom abgefallen war, wurde als politisches Gemeinwesen ausgelöscht. Soweit die Einwohner nicht ausgesiedelt wurden, durften sie lediglich als Pächter ihres ehemaligen Eigentums bleiben. In dem ager Campanus gewann Rom eine der fruchtbarsten italischen Landschaften zu direktem Besitz. In einer ganz ähnlichen Weise wurde Tarent niedergedrückt. Die wichtige Hafenstadt hat sich von den Zerstörungen und Plünderungen und der Versklavung eines Großteils ihrer Einwohner bei der Eroberung im Jahre 209 v. Chr. nicht mehr erholt. Auch ihr Landbesitz wurde konfisziert, ihre Funktion als Hafen von Brundisium, der latinischen Kolonie am Adriatischen Meer und am Ende der Via Appia, übernommen. Ein ähnliches Schicksal hatte auch Syrakus erlitten. Wichtiger aber als der territoriale und materielle Gewinn war im Falle dieser drei Großstädte die Tatsache, daß in ihnen Stadtstaaten derselben Größenordnung wie Rom selbst eliminiert waren.
Ausbau und Intensivierung der römischen Herrschaft in Italien
Der Zweite Punische Krieg leitete so direkt über in eine Phase des Ausbaus und der Intensivierung der römischen Herrschaft in Italien. Dieser Prozeß erfaßte dabei in stärkstem Maße die bisher nur wenig berührten Randzonen im äußersten Süden wie im äußersten Norden der Halbinsel. So wurden jetzt Lukanien und Bruttium, jene Landschaften, die bisher schon allein aus geographischen Gründen lediglich im Vorfeld der römischen Macht lagen, und die überdies bis zuletzt Hannibals réduit gebildet hatten, erheblich beschnitten. Zwischen Buxentum und Thourioi im Norden wie zwischen Hipponium und Scolacium im Süden durchzogen fortan geschlossene römische Landstreifen den Ausläufer der Apenninhalbinsel zwischen dem Tyrrhenischen und Jonischen Meer. Die alten Durchzugsgebiete der Gebirgsstämme waren damit aufgespalten und römisch durchsetzt.
In einer ähnlich systematischen Weise ging Rom gleichzeitig auch im Norden Italiens vor. Hatte man bisher in die Poebene vorgefühlt, so wurde sie erst jetzt ganz für Rom erschlossen. Freilich gingen hier die Kämpfe auch noch nach Karthagos Kapitulation für rund ein Jahrzehnt weiter. Denn die keltischen Stämme nördlich des Apennins und im Zentrum der Poebene wie die ligurischen Stämme westlich von ihnen und im Küstenstreifen der Riviera hatten sich eng mit den Karthagern eingelassen. Sie wurden auch noch immer von karthagischen Offizieren und Spezialisten unterstützt und hielten ihren Widerstand gegen Rom unbeirrt aufrecht. 191 v. Chr. hatte sich Rom auch hier durchgesetzt. Es begnügte sich nun nicht mehr mit der Wiederherstellung der alten Vorpostenkolonien Placentia und Cremona, vielmehr wurden im Laufe der achtziger Jahre des zweiten Jahrhunderts v. Chr. jetzt auch in Pisaurum, Parma und Mutina römische Kolonien, in Bononia, Aquileia und Luca solche latinischen Rechts angelegt. Schon im Jahre 187 v. Chr. aber ist in der Via Aemilia die große Fernverkehrsstraße am Nordfuß der Apenninen durchgezogen worden, die Placentia auf dem kürzesten Wege mit Ariminurn verband und dort an die alte Via Flaminia anschloß.
Skizze Nr. 1: Die römischen Fernstraßen
Durch die Impulse der Koloniegründungen, die zugleich starke wirtschaftliche Initiativen auslösten, und durch den Anschluß an das zentrale römische Verkehrsnetz leitete die Republik im oberitalischen Raum einen ungewöhnlich erfolgreichen Romanisierungsprozeß ein. Die Provinz Gallia Cisalpina ist in seinem Verlauf schließlich so vollständig mit den ganz anders strukturierten Landschaften südlich der Apenninen verbunden worden, daß sich jeder moderne Betrachter immer wieder die ursprüngliche Sonderstellung des keltischen Oberitaliens ins Bewußtsein rufen muß, so konsequent wurden die Gegensätze fortan abgetragen.
Der volle Einsatz römischer und latinischer Kräfte in diesem Raum zwang nun freilich auch zum Schutz der Flanken. Im Osten wurde im Jahre 181 v. Chr. die latinische Kolonie Aquileia am weitesten vorgeschoben und damit eine Handelsbasis geschaffen, die schon bald bis weit nach Kärnten hinein ausstrahlte und sich rasch zu einer der blühendsten Städte Italiens entwickelte. Eine vergleichbare Basis fehlte im Nordwesten, an der ligurischen Küste hinkte die römische Expansion nach. Einzig in Luna, nordwestlich von Pisa, wurde 177 v. Chr. eine Kolonie angelegt, und erst um die Mitte des 2. Jahrhunderts ist dann auch in der Via Postumia eine Straßenverbindung zwischen Placentia und Genua geschaffen worden.
An der ligurischen Küste verließ sich Rom auf die traditionelle Freundschaft mit Massilia. Dies galt selbst jetzt, da die Repubik über Besitzungen in Spanien verfügte, zu denen sie noch für lange Zeit keine eigene Landverbindung besaß. Auch am Fuß der Alpen blieb Rom stehen. Sie wurden erst 15 v. Chr. endgültig erobert.
Die römische Expansion in Spanien
In Spanien hatte Rom, nach Kriegsrecht, den alten Besitz der Barkiden übernommen und arrondiert. Doch diese spanischen Territorien dürfen weder im Hinblick auf ihre Ausdehnung noch im Hinblick auf die Intensität der römischen Herrschaft überschätzt werden. Flächenmäßig bildete das römisch beherrschte Gebiet zunächst lediglich einen mehr oder weniger tiefen Randstreifen im Osten und Süden der Iberischen Halbinsel. Im Süden hatte dieser sein Kerngebiet im Raume des Baetis, im modernen Andalusien. 197 v. Chr. wurde hier die Provinz Hispania ulterior eingerichtet. Das andere Zentrum des römischen Randsaumes lag im Nordosten der Halbinsel, im modernen Katalonien. Zu diesem nordöstlichen Zentrum, das in Tarraco seinen Mittelpunkt besaß, wurde ein weit nach Süden, bis über Cartagena hinaus vorspringender Küstenstreifen hinzugeschlagen, als, ebenfalls 197 v. Chr., die Provinz Hispania citerior organisiert worden ist.
Schon in der Übergangszeit einer improvisierten Kriegsverwaltung in die reguläre Provinzialadministration ließen die Römer die Maske des Befreiers vom punischen Joch fallen. Den spanischen Städten und Stämmen wurde rasch klar, daß sie nur den Herrn gewechselt hatten und daß der Alltag der römischen Herrschaft anders aussah als die großzügigen Gesten, mit denen sie einst Scipio für Rom eingenommen hatte. Der Betrieb der Bergwerke wurde sogleich intensiviert. Allein in den Gruben von Carthago nova arbeiteten nach Polybios’ Angaben im zweiten Jahrhundert v. Chr. an die 40.000 Sklaven. Der tägliche Gewinn wurde auf 25000 Denare eingeschätzt. Doch es gingen nicht nur diese Anlagen wie die großen punischen Güter in den Besitz des römischen Volkes über, sondern künftig wurden auch von der Mehrzahl der Siedlungen und Stämme regelmäßige Abgaben erhoben. Der Druck wurde so stark, daß schon bald die ersten Aufstände aufflammten, der Widerstand gegen Rom hielt Jahrzehnte hindurch an.
Die Kämpfe gegen Keltiberer und Lusitaner zogen sich, mit einigen Unterbrechungen, bis 133 v. Chr. hin. In dem klassischen Land des Guerillakrieges und angesichts des fanatischen Widerstandes der zahllosen kleinen Gebirgssiedlungen wie der wiederholten tiefen Einfälle lusitanischer Gruppen in das römische Hinterland konnte sich die römische Armee nur mühsam behaupten und nur langsam Erfolge erringen. Selten versagte die römische Kriegführung so erbärmlich wie hier. Das Schlimmste daran war nicht, daß die römischen Verbände mehr als einmal geschlagen wurden und empfindliche Verluste hinnehmen mußten, am beschämendsten war vielmehr die Art, wie die besiegten Statthalter und Feldherrn oder Senat und Volksversammlung darauf reagierten: mit Massakern und Verrat, Wortbruch und Täuschung.
Skizze Nr. 2: Spanien
Der Krieg in Spanien war in Rom schon früh verhaßt, 151 v. Chr. kam es zu dem Skandal, daß Wehrpflichtige den Dienst versagten. Dies kann deshalb nicht überraschen, weil die Kämpfe ungewöhnlich hohe Verluste forderten und den Truppen die größten Strapazen brachten. Denn im spanischen Hochland hatten die Legionäre im Sommer teilweise bis zu 40° Hitze auszuhalten, bald Wassermangel, bald Überschwemmungen zu ertragen und schließlich auch den Cierzo, den stürmischen Nordwestwind, dessen Stärke selbst auf Cato Eindruck machte. Wieder und wieder litt die Truppe infolge der Versorgungsschwierigkeiten bitterste Not und fristete ihr Leben nur noch mit den erjagten Kaninchen. Sah so der Alltag aus, so waren die Kämpfe selbst noch schwerer. Die Topomachia, der Krieg der landeskundigen Guerillas, brachte fort und fort Überfälle, Fallen und Hinterhalte, kaum je eine größere Schlacht, nie nennenswerte Beute.
Der Höhepunkt der Erfolge der Lusitaner ist mit dem Namen des Viriatus verbunden, der in dem Zeitraum zwischen 147 und 139 v. Chr. das Geschehen in Südspanien diktierte. In ihm war den aufständischen Gruppen ein Anführer erwachsen, der ihre Kriegszüge in umsichtiger Weise organisierte, die Eigenart der lusitanischen Bewaffnung und Kampfweise ebenso einzusetzen verstand wie die Bedingungen der Landesnatur, der sich als Meister in Überfällen und Scheinfluchten erwies und darüber wohl zum bedeutendsten Befehlshaber eines Guerillakrieges im Altertum überhaupt geworden ist. Der römische Statthalter Q. Servilius Caepio wußte sich gegen diesen Mann schließlich nicht anders zu helfen, als daß er ihn ermorden ließ. Für Portugal, dessen eigentlicher antiker Heros Viriatus ist, hat dieser große Guerillaführer in der Neuzeit eine ähnliche Bedeutung erlangt wie Arminius in Deutschland.
Numantia
Bei den Keltiberern konzentrierte sich das Geschehen zuletzt auf Numantia. In der Nähe dieser kleinen Stadt am Oberlauf des Duero hatten die Römer schon im Jahre 153 empfindliche Schlappen erlitten, danach blieb Numantia im Mittelpunkt der Kämpfe. Es kam zu Täuschungsmanövern der erfolglosen römischen Befehlshaber, zur Kapitulation eines eingeschlossenen römischen Heeres, römischem Vertragsbruch und jahrelanger, ergebnisloser Belagerung. Die Situation änderte sich erst, als Scipio Aemilianus mit der Liquidierung des Krieges in Spanien beauftragt wurde.
Da der römische Senat Scipio die Aushebung neuer Truppen ebenso versagte wie neue Geldmittel zur Finanzierung der Rüstungen, war Scipio ganz auf eigene Initiativen angewiesen. Er rief nicht weniger als 4000 Freiwillige auf, darunter eine cohors amicorum, eine Leibwache von 500 Vertrauten, um wenigstens über einen zuverlässigen Stab und über einen zuverlässigen Kern seines Heeres zu verfügen, denn die römische Spanienarmee war völlig verlottert. In Scipios Umgebung aber standen künftig Männer, deren Namen aus der Geschichte der späten Republik nicht hinwegzudenken sind, wie Gracchus, Marius, Memmius, Jugurtha und Lucilius.
Nach einer oft bewunderten Reorganisation des Heeres schloß Scipio Numantia noch im Jahre 134 v. Chr. hermetisch ein. In einem Umfang von immerhin rund 9 Kilometern wurde die in diesem Augenblick von etwa 10.000 Menschen bewohnte Siedlung mit ihren etwa 2000 Häusern systematisch abgeriegelt, und zwar nicht nur durch Graben und Palisade, sondern bald auch durch eine Mauer, die immerhin drei Meter hoch und vier Meter breit, mit Geschütztürmen bestückt und von insgesamt sieben Lagern aus bewacht und verteidigt war. Neun Monate lang wurde die Belagerung aufrechterhalten und während dieser Zeit nicht wenige Ausfallversuche abgeschlagen.
In Numantia kam es schließlich zur Hungersnot, die im Kannibalismus endete, und zuletzt, 133 v. Chr., zur Übergabe. Von den Bewohnern sparte Scipio fünfzig für seinen Triumph aus, den Rest ließ er versklaven, die Stadt dem Erdboden gleichmachen. Wenn in einem Teil der späteren Überlieferung davon gesprochen wird, daß sich die letzten Überlebenden Numantias selbst den Tod gegeben und sich mitsamt ihrer Habe verbrannt hätten, um Scipio keine Beute zu hinterlassen, so ist daran zumindest so viel richtig, daß dieser Kampf den Siegern materiell so gut wie nichts einbrachte.
Der Name Numantias aber wurde, über den Untergang der Siedlung hinaus, zum Symbol des keltiberischen Freiheitskampfes. Cervantes, de la Motte Fouqué und Schlegel huldigten ihrem Ruhm, auch deutsche Dramen erinnerten an ihr Los. Die wissenschaftliche Reverenz unseres Landes vor der unglücklichen keltiberischen Stadt aber ist mit dem Lebenswerk von Adolf Schulten identisch, der zu Beginn unseres Jahrhunderts mit seinen Grabungen in und bei Numantia begann. Grabungen, deren Resultate dann zwischen 1914 und 1931 in dem großen vierbändigen Numantia-Werk publiziert worden sind.
In Spanien, wie später in Gallien, war es ein Grundzug der römischen Siedlungspolitik, Städte nach Möglichkeit in den Ebenen anzulegen und die befestigten Höhensiedlungen aufzulösen. Auch in Spanien setzte früh eine systematische Urbanisierungspolitik ein. Schon im Jahre 205 v. Chr. hatte der ältere Scipio als erste römische Neugründung auf spanischem Boden nordwestlich von Sevilla und jenseits des Baetis Italica angelegt, wohl im Jahre 178 v. Chr. wurde am Oberlauf des Ebro das Städtchen Gracchuris geschaffen, damit die erste römische Gründung, die in hellenistischer Manier zu Ehren einer Persönlichkeit benannt war. 171 v. Chr. folgte die Anlage von Carteia, dem heutigen Algeciras, das sogar die bevorzugte Stellung einer latinischen Kolonie erhielt, weil es die illegitimen Kinder römischer Soldaten aufzunehmen hatte. 152 v. Chr. kam es dann zur Gründung von Corduba am Baetis durch Marcellus. Der Kulminationspunkt der systematischen Urbanisierung der neuen Provinzen liegt allerdings erst in der Zeit Caesars und Augustus’, als Kolonien und Municipien in größerer Zahl angelegt wurden, auch sie freilich noch immer weithin in den alten bevorzugten Siedlungsräumen, den Tälern des Baetis und des Ebro wie im Küstenstreifen.
Struktur und Entwicklung des barkidischen und des römischen Machtbereichs auf der Iberischen Halbinsel
Da die Iberische Halbinsel vor den römischen Interventionen von den Barkiden beherrscht worden war, empfiehlt sich ein Vergleich der Struktur und der Entwicklung der beiden Machtbereiche, um die Eigenart der römischen Politik klarer abzuheben. Die Barkiden, die Familie des Hamilkar Barkas, Hasdrubals und Hannibals, waren ausgegangen von der Übernahme der punktuellen Ansätze der älteren karthagischen und der phoenikischen Kolonisation, insbesondere im Süden und Südosten des Randsaumes der Halbinsel. Von dort aus hatten sie die Einheit einer großflächigen Territorialherrschaft in einer Sonderform der hellenistischen Monarchie aufzurichten versucht.
Auch Rom war von der Beherrschung des Küstenstreifens ausgegangen. Doch schon nach dem ersten Fußfassen der Scipionen im Nordosten der Halbinsel erwies sich der Raum von Tarraco als neuer und bleibender Schwerpunkt der römischen Infiltration. Früh zeichneten sich dann in den Brückenköpfen um Tarraco und im Baetistal wie in dem nur schwer eroberten Gebiet Lusitaniens die Zellen der späteren dreigeteilten Administration der Halbinsel unter dem Principat ab.
Eine systematische Neubesiedlung weiter Landstriche haben die Barkiden nicht versucht, und auch die römische Kolonisation erlebte, wie gesagt, ihre wichtigste Phase erst unter Caesar und Augustus. Dennoch wirkte sich die ständige Anwesenheit eines starken römisch-italischen Heeres als Voraussetzung für die spätere Romanisierung weit nachhaltiger aus als die Anwesenheit der barkidischen Söldner. Eine kulturelle Prägekraft haben diese Verbände nie besessen.
Da auch die Römer nicht auf die Gestellung von Geiseln verzichteten, die Abgaben des tributum gewiß nicht geringer waren als jene, die einst die Barkiden erhoben hatten, erwies sich die römische Verwaltung fraglos als sehr viel drückender als die karthagische. Dies ergab sich nicht zuletzt durch den ständigen Wechsel der römischen Magistrate, der in der Regel enge persönliche Beziehungen nicht gestattete. Die Erfahrungen der Iberer und Lusitaner mit den römischen Statthaltern machen begreiflich, warum die Administration des Principats für die Provinzen erträglicher war als jene durch die Organe der Römischen Republik.
Für Karthago und die Barkiden wie für Rom war Spanien zunächst lediglich ein Kolonialgebiet im Sinne des 19. Jahrhunderts. Ein Raum, dessen Bodenschätze ausgebeutet und dessen Handel übernommen wurde und der schließlich, insbesondere für Rom, als Rekrutierungsbasis iberischer Hilfstruppen diente, die man dank der Zersplitterung der Stämme schon bald in anderen Teilen der Halbinsel einsetzen konnte. Indessen führte sich auch hier die kurzsichtige Politik einer möglichst scharfen Ausbeutung unter möglichst geringem eigenem Einsatz bald selbst ad absurdum. Der humanere und klügere Kurs eines Ti. Gracchus und Marcellus war gar nicht mehr zu umgehen, als sich die römischen Machtmittel erschöpften. Die kolonisatorische Leistung der Römischen Republik war in Spanien denkbar bescheiden. Allein die Zähigkeit im Festhalten der einmal besetzten Gebiete schuf die Voraussetzungen für die Blüte der lateinischen Kultur unter dem Principat.
Die Folgen der römischen Politik und Kriegführung sind im Spanien des zweiten Jahrhunderts v. Chr. auf den ersten Blick nicht so augenfällig wie in anderen Teilen des Mittelmeerraums. In Spanien wurde kein weitgespanntes Handelsimperium zerschlagen wie im Falle Karthagos, hier wurden auch nicht die Relikte einer Hochkultur überwältigt und schließlich in den eigenen Machtbereich eingeschmolzen wie in Griechenland, Kleinasien, Syrien oder Ägypten, sondern eine Vielzahl freier Stämme unterworfen und niedergehalten, wobei der materielle Gewinn in der Regel äußerst bescheiden war. Die Rückwirkungen der römischen Expansion auf das italische Mutterland waren indessen hier nicht weniger verhängnisvoll als im hellenistischen Osten. Die Heere der alten staatstragenden Schicht des freien Kleinbauerntums bluteten hier — und nicht im Osten — aus.
2. ROMS EINTRITT IN DIE HELLENISTISCHE WELT
Die Entwicklung der hellenistischen Staatenwelt
Die Geschichte der hellenistischen Staatenwelt läßt sich in ihrer ersten Epoche, im Zeitraum zwischen 323 und 280 v. Chr. als ein dramatischer Prozeß mit vielen jähen Wendungen definieren, in welchem die großen Generale Alexanders, wie Perdikkas, Antipater, Antigonos, Demetrios, Lysimachos und Seleukos, versuchten, von der Basis ihrer Befehlsgewalt oder später ihrer Territorien aus, ihre Herrschaft auf das Gesamtreich oder doch auf möglichst große Teile des alten Alexander-Reiches auszudehnen. Mit der Schlacht von Kuropedion, dem Untergang des Lysimachos 281 v. Chr. und der Ermordung des Siegers Seleukos schon ein Jahr darauf kam diese letztlich auf eine Wiederherstellung der Reichseinheit zielende Politik zu ihrem Ende. Es ist sehr sinnfällig, daß in Lysimachos und Seleukos zugleich die beiden letzten Generale und Könige der Alexandergeneration ausgeschieden waren, für deren Leben jene faszinierende Aufrichtung des von Makedonien bis Indien reichenden Weltreichs die stärksten Eindrücke hinterlassen hatte.
Jetzt, nach dem Tode der Diadochen, trat eine neue Generation hervor, die in anderen Kategorien dachte und die mit ihren ererbten Teilstaaten stärker verwurzelt war als mit der Tradition jener Universalmonarchie, deren überwältigende Dimensionen sie selbst im allgemeinen nicht erfahren hatte. Je stärker die Teilstaaten zusammenwuchsen, desto klarer mußte sich ein gewisses Einpendeln in deren gegenseitigem Kräfteverhältnis ergeben, das heißt, es mußte zu jenem Gleichgewicht der Kräfte kommen, unter dem man gewöhnlich die Situation in der hellenistischen Staatenwelt zwischen 280 und 221 v. Chr. zusammenfaßt.
Betrachten wir kurz die Hauptlinien des Kräftefeldes, so zeigt gerade der Staat, der stets als besonders homogen und auch als eine in sich weithin geschlossene geographische Einheit bewertet wird, das Reich der Ptolemäer mit seinem Kern in Ägypten, auch noch im 3. Jahrhundert v. Chr. sehr expansive Ambitionen. Denn obwohl die Verwurzelung der persönlichen Herrschaft in einem hellenistischen Territorium gerade beim ersten Ptolemäer, gemäß der in diesem Raum ganz elementaren Vitalität der bodenständigen Traditionen, am frühesten eingesetzt hatte und auch am stärksten ausgeprägt worden war, begnügten sich die Ptolemäer keineswegs mit der Verteidigung ihrer Basis, sondern sie stießen selbst im Ägäischen Meer weithin vor.
Dabei hatten sie ihre Hand nicht nur auf Palästina und den syrisch-phoenikischen Küstenstreifen gelegt, sondern ebenso auf Cypern und auf die Südküste Kleinasiens, ja selbst der Westsaum der kleinasiatischen Küste war lange Zeit in ptolemäischer Hand, und durch das Protektorat über den Nesiotenbund dehnte sich dieser ptolemäische Einfluß auch noch bis auf die Kykladen im Ägäischen Meer aus. Die Errichtung dieses ganz eindeutig nach maritimen Kriterien angelegten Reiches um das östliche Mittelmeerbecken mußte nun freilich gerade von seiten der stärksten Landmacht, den Seleukiden, die heftigsten Reaktionen provozieren, und in der Tat sind vor allem die Kämpfe um Syrien während des ganzen 3. Jahrhunderts v. Chr. praktisch kaum abgerissen.
Um diese Zeit umfaßten die Herrschaftsansprüche der Seleukiden immer noch den immensen Raum von der Ägäis bis nach Baktrien, aber gerade die Dimensionen ihres Aufgabenbereiches waren letztlich dafür bestimmend, daß aus diesem Reichskörper nun an fast allen Grenzen Stück um Stück herausgeschnitten oder abgetrennt wurde. Dies galt für den äußersten Osten, für Baktrien ebenso wie für den äußersten Westen, für Kleinasien, aber bereits auch für die Landschaften östlich des Kaspischen Meeres an der langen Nordfront des seleukidischen Reiches, wo in den Parthern eben jetzt ein neuer historischer Faktor auftrat.
Ein iranisches Reitervolk, die zum Verbände der Daher zählenden Parner waren hier eingefallen und hatten den Namen der Satrapie Parthien übernommen, sich also Parther benannt. Im Jahre 247 v. Chr. beginnt die parthische Ära und damit die Konsolidierung des von Arschak-Arsakes begründeten Staates, der nicht wenige Elemente des achämenidischen Reiches in sich aufnahm, so daß sich hier die vitalen Kräfte eines Reitervolkes mit national-iranischen Komponenten verbanden. Die starken Expansionsbestrebungen dieses parthischen Reiches vor allem in südlicher, südwestlicher und westlicher Richtung traten zwar noch nicht sofort zutage, aber auf weite Sicht war in ihm den Seleukiden der gefährlichste Gegner erwachsen, und rund 100 Jahre nach dem Beginn der parthischen Ära (141 v. Chr.) ging bereits Babylonien an die Parther verloren.
Um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. war der Rückgang der seleukidischen Macht indessen vor allem in Kleinasien festzustellen. Dort war es den Seleukiden nicht nur nicht gelungen, die kleinen Königreiche Bithynien und Pontos an der Südküste des Schwarzen Meeres zu beseitigen, sie hatten es zudem hinnehmen müssen, daß sich seit ca. 260 v. Chr. dazuhin auch noch ein Großkappadokisches Reich, vor allem südlich und östlich des Halys etabliert hatte. Sie hatten sich weiterhin seit Beginn der 70er Jahre mit den Kelten, den Galatern, herumzuschlagen, die trotz aller Abwehrerfolge und trotz der fast legendären Elefantenschlacht von 275 v. Chr. als ein chronischer Unruhefaktor inmitten der Halbinsel blieben und sie hatten sich zu allem Überfluß hin von 242 bis 228 v. Chr. das praktisch selbständige Königtum des Antiochos Hierax über den seleukidischen Restbesitz in Kleinasien gefallen zu lassen.
Vor diesem Hintergrund gelangten nun neue politische Mächte zu einer gewissen Bedeutung, vornehmlich Rhodos und Pergamon. Der Reichtum der Roseninsel, ihre wachsende wirtschaftliche Bedeutung als freie griechische Polis und ihre relativ ansehnliche Flotte schufen dieser Stadt vor der umstrittenen Südwestecke Kleinasiens auch eine ungewöhnliche politische Bedeutung, die trotz einer im Laufe der Zeit erworbenen terra ferma auf dem lykischen und karischen Festland weit größer war, als ihre Fläche vermuten läßt.
Das später zu so großer Bedeutung gelangte Königreich Pergamon verdankt seine Entwicklung dagegen ganz der Initiative der Dynastie der Attaliden und einer allerdings ganz außergewöhnlichen Starthilfe. Denn in der Festung Pergamon hatte einst Philhetairos sowohl für Lysimachos als auch nachher für Seleukos große Geldmittel verwahrt, und er hatte deshalb von allem Anfang an in der Verwaltung des Platzes praktisch frei schalten und walten können. Die Nachfolger des Philhetairos, Eumenes und Attalos, konnten diesem Herrschaftskern dann Schicht um Schicht hinzufügen, und dies nicht zuletzt deshalb, weil sie sich für die benachbarten Landschaften in den Kämpfen mit den Galatern als Führer einer äußerst wirksamen Streitmacht erwiesen. Um 230 v. Chr. nahm Attalos I. gleichfalls den Königstitel an und demonstrierte damit auch äußerlich die de facto schon vorher errungene Souveränität. Doch damit war nun für das Pergamenische Reich auch eine ganz entschiedene Frontstellung gegenüber den Seleukiden gegeben, die sich noch vertiefen mußte, als Attalos gegen das Territorium des Antiochos Hierax vorging.