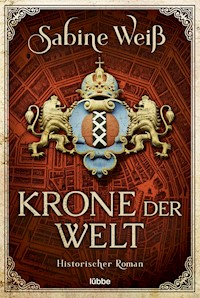
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Historischer Roman über den Ausbau Amsterdams zur Weltmetropole, über Liebe und Hass und den Drang, die Welt zu einem besseren Ort zu machen
Vincent will als Architekt prächtige Stadthäuser bauen. Ruben sehnt sich nach Abenteuern auf hoher See. Betje ist eine begnadete Köchin. Zusammen sind die Geschwister in Amsterdam gestrandet, einem Ort der märchenhaften Möglichkeiten. Doch es ist auch die Zeit der großen Auseinandersetzungen. Katholiken und Calvinisten streiten um den rechten Glauben, Engländer und Spanier um den Einfluss auf das Land am Meer, Kaufleute um die wirtschaftliche Macht. Können sich die Geschwister in dieser schwierigen Situation behaupten?
Folgen Sie Sabine Weiß’ Helden ins spannende 16. Jahrhundert, und erleben Sie Amsterdam, wie Sie es noch nie gesehen haben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 977
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitate
Personenverzeichnis
Prolog
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Teil 2
22
23
24
25
26
27
28
29
Teil 3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Teil 4
65
66
67
68
69
70
71
Epilog
Karte: Die Niederlande um 1600
Glossar
Anmerkung und Dank
Über das Buch
Ein großer Historischer Roman über den Ausbau Amsterdams zur Weltmetropole, über Liebe und Hass und den Drang, die Welt zu einem besseren Ort zu machen
Vincent will als Architekt prächtige Stadthäuser bauen. Ruben sehnt sich nach Abenteuern auf hoher See. Betje ist eine begnadete Köchin. Zusammen sind die Geschwister in Amsterdam gestrandet, einem Ort der märchenhaften Möglichkeiten. Doch es ist auch die Zeit der großen Auseinandersetzungen. Katholiken und Calvinisten streiten um den rechten Glauben, Engländer und Spanier um den Einfluss auf das Land am Meer, Kaufleute um die wirtschaftliche Macht. Können sich die Geschwister in dieser schwierigen Situation behaupten?
Folgen Sie Sabine Weiß’ Helden ins spannende 16. Jahrhundert, und erleben Sie Amsterdam, wie Sie es noch nie gesehen haben!
Über die Autorin
Sabine Weiß, Jahrgang 1968, arbeitet nach ihrem Germanistik- und Geschichtsstudium als Journalistin. 2007 veröffentlichte sie ihren ersten Historischen Roman, der zu einem großen Erfolg wurde und dem viele weitere folgten. Im Sommer 2017 erscheint ihr erster Kriminalroman, »Schwarze Brandung«. Unabhängig davon, ob sie gerade einen Krimi oder einen Historischen Roman schreibt: Sabine Weiß liebt es, im Camper auf den Spuren ihrer Figuren zu reisen und direkt an den Schauplätzen zu recherchieren. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nordheide bei Hamburg.
Sabine Weiß
KRONE DER WELT
Historischer Roman
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Dr. Stefanie HeinenKarte: Markus Weber, Guter Punkt, MünchenUmschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, MünchenUnter Verwendung von Motiven von © shutterstock: Pres Panayotov | Konstantin Litvinov |Marzolino | Filipchuk Maksym | leoks | Olena Zaskochenko und Wikimendia Commons (gemeinfrei)E-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9430-6
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Der Mensch ist das Maß aller Dinge.
Protagoras, ca. 490 v. Christus
Das Schöpferische überlebt, alles andere ist des Todes.
Virgil Solis, Walther Ryff
Personenverzeichnis
AMSTERDAM
Wim Aardzoon, Zimmermann und Festungsbauer aus Antwerpen
Vincent, sein Sohn, Architekt
Ruben, ebenfalls sein Sohn, Seemann
Betje, seine Tochter, Köchin
Federigo Giambelli*, italienischer Ingenieur und Sprengstoffexperte
Nathan Sanders, Gehilfe des niederländischen Gesandten in England und später des Politikers Johan van Oldenbarnevelt
Sandrine Kuipers, Malerin und Kupferstecherin
Lysbeth Kuipers, ihre Schwester
Kaufleute und Regenten
Dircks Jansz de Graeff*
Jacob de Graeff*
Cornelis Hooft*
Dirck van Os*
Reinier Pauw*
Jan Poppen*
Architekten und Baufachleute
Joost Jansz Bilhamer*
Cornelis Bloemaert*
Cornelis Danckerts*
Hendrick de Keyser*
Frans Hendricks Oetgens*
Henk Jakobsz Staets*
Politiker und Gelehrte
Petrus Plancius*
Hugo Grotius*
Joost de Hondt*
Seeleute
Piet Heyn*
Jan Molenaar*
S’GRAVENHAGE
Moritz, Graf von Nassau-Dillenburg*, Sohn von Wilhelm von Oranien
Friedrich-Heinrich*, Sohn von Wilhelm von Oranien,
Louise de Coligny*, Witwe von Wilhelm von Oranien
Johan van Oldenbarnevelt*, niederländischer Staatsmann
Katholisches Lager
Aldo van Vleet, Kaufmann in Amsterdam, mit seiner Frau Hannah
Aletta, seine Tochter
Pijke, sein Sohn
König Philipp II.*
Infanta Isabella Clara Eugenia von Spanien*
Alessandro Farnese*, Feldherr und Statthalter der Spanischen Niederlande
Lazarus van de Hedecop, holländischer Landadeliger
* historische Persönlichkeiten
Prolog
Amsterdam, Februar 1617
Kristallklar floss die Februarsonne in die Gracht. Sie war ein Fingerzeig aus Licht, der die Schönheit des neuen Stadtviertels enthüllte. An dem sanften Bogen, den die Kanalstraße formte, standen die Grachtenhäuser Spalier. In der glatten Oberfläche der Amstel schienen die Häuser sich wie in einem Spiegel zu bewundern. Mit ihren kunstvoll gestalteten Fassaden und den hellen Ziergiebeln, die sich wie blitzsaubere Häubchen in den schneeschweren Himmel reckten, war jedes Gebäude einzigartig.
Auch die Menschen hatten sich herausgeputzt. Familien spazierten nach dem sonntäglichen Kirchenbesuch am Grachtengürtel entlang. Die Eltern vorweg, mit gestärkten Halskrausen, auf denen ihr Kopf wie auf einem Tablett thronte. Die Kinder tobten hinterher, warfen von der Kanalkante aus mit Steinen auf die Eisschollen, die von den Mauern in den Fluss hineinkrochen, nur milde ermahnt von ihren Vätern.
Der Duft von Sonntagsbraten und Torffeuer stieg dem Architekten in die Nase, als er die Hausreihe passierte. Aus einem offenen Fenster drang das Trillern eines Singvogels; in seinem Käfig schien er den Frühling herbeizusehnen. Wie ruhig Amsterdam sonntags war, wenn das Donnern der Rammen, das den Takt dieser Stadt vorgab, verstummt war, wenn kein Baulärm durch die Gassen dröhnte und kein Höker lautstark seine Waren anpries! Indes: Friedlich war es in Amsterdam derzeit nicht. Besorgt dachte der Architekt an die Diskussionen, die nach dem Gottesdienstbesuch geführt worden waren. Reichte es nicht, dass in den Ländern um sie herum Zwietracht herrschte und der Waffenstillstand mit ihrem Erzfeind Spanien brüchig war? Musste auch innerhalb der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen gestritten werden?
Auf den ersten Blick schien die Frage, um die der Streit entbrannt war, eine Spitzfindigkeit von Geistlichen zu sein. Genau betrachtet ging es aber um jedermanns Seelenheil und um die Rechtmäßigkeit von Reichtum und Elend. Freundschaften und Geschäftsbeziehungen drohten in diesem Streit zermahlen zu werden. Selbst in seiner Familie waren die Gespräche beim Sonntagsmahl hitzig geworden. Doch das war nicht das Einzige, was ihn aus dem Haus getrieben hatte. Entschlossen verbannte er die Gedanken, die in ihm aufstiegen.
»Mijnheer Aardzoon?«
Der Architekt war so vertieft gewesen, dass er erst jetzt den Poorter bemerkte, der ihn grüßte. Wie er trug der Mann einen breitkrempigen Hut mit Feder, einen modischen Spitzenkragen und Spitzenmanschetten unter dem Samtumhang. Seine schwarze Kleidung sollte Bescheidenheit signalisieren und verriet doch durch die Kostbarkeit der Stoffe seinen Reichtum, genau wie die Goldspitzen an seinen Seidenstrümpfen. Kurz plauderten sie über die Predigt und das günstige Winterwetter. Noch war der Warenverkehr nicht durch Eis und Schnee in Mitleidenschaft gezogen worden. Sogar das Holz für Aardzoons wichtigste Baustelle war früher als erwartet im Hafen angelandet worden. Ehe der Gedanke an das Risiko, das er einging, seine Stimmung weiter trüben konnte, wünschten sie einander einen gesegneten Sonntag.
Bald hatte der Architekt die wenigen Baulücken in der Keizersgracht erreicht. Seine Stiefel sanken knisternd in das frostige Erdreich ein, das noch kein Pfahlgerüst verdichtet hatte. Gebannt hielt er inne. Der Anblick war atemberaubend, ein einziges, grandioses Versprechen. Amsterdam wuchs und wuchs. Als er in die Stadt gekommen war, hatte diese sich wie ein schmaler Kegel vom IJ aus, einer Bucht im Südwesten der Zuidersee, ins Land geschoben. Nur einige wenige Kanäle hatte es zwischen dem Meeresarm und dem Fluss Amstel gegeben. Vielleicht dreißigtausend Menschen hatten damals in Amsterdam gewohnt, heute waren es dreimal so viele – und die Stadt dehnte sich weiter aus. Inzwischen legten sich die Grachten wie schützende Arme um Häuser und Bewohner. Lebensadern aus Holz und Stein, die Amsterdam mit dem Rest der Welt verbanden.
Für einen Augenblick erfüllte ihn Stolz. Baumeister wie er rangen dem sumpfigen Boden das neue Land ab oder schufen künstliche Inseln. Der Ausbau der Stadt war noch lange nicht abgeschlossen, die Vollkommenheit des Stadtbilds nicht erreicht. Eines Tages aber würde der Grachtengürtel einen perfekten Halbkreis am IJ-Ufer bilden. Als Baumeister strebte er nach Harmonie, er konnte nicht anders. Wenn er nur nicht so unter dem Hässlichen, dem Falschen litte!
Auf den fremden Baustellen sah er keine Schönheit, sondern nur Fehler: nachlässig zusammengestoppelte Holzgerüste, schlecht behauene Steine, schnell hochgezogene Mauern, Krummholz, das man ungenügend gewässert hatte. Auf seinem Baugrund hingegen war alles, wie es sich gehörte. Die Holzstämme lagen säuberlich gestapelt, genau wie die Bauteile für Kran und Stellage. Auch für den Marmor, den er in Carrara bestellt hatte und der demnächst eintreffen würde, gab es Platz. Mit treuen Helfern wie Gerrit an seiner Seite würde das bisher größte Unterfangen seiner Laufbahn gelingen. Allerdings war sein Baustellenwächter allein – und das, obwohl der Diebstahl von Baumaterialien in Amsterdam an der Tagesordnung war.
Gerrit wärmte sich vor der Bauhütte an einem Lagerfeuer. »Mijnheer Aardzoon, was treibt Euch denn heute hierher?«, fragte der alte Mann und erhob sich trocken hustend von seinem Schemel.
Der Architekt zog sich die Lederhandschuhe aus und reichte ihm die Hand. »Bleib am Feuer, Gerrit, ich will dich an deinem freien Tag nicht lange stören«, sagte er. »Ein Kunde bat mich, ihn hier zu einer Begehung des Baugrunds zu treffen.«
»Am heiligen Sonntag?«
»Nur ein kurzer Spaziergang, eine kleine Plauderei«, versicherte Aardzoon. Natürlich war er Gerrit keine Rechenschaft schuldig, aber in diesem Land gab man aufeinander acht – und das war ja auch gut so. Seine wahren Beweggründe für dieses Treffen hatte er selbst seiner Familie verschwiegen: Es drängte ihn, Mijnheer van Noort an die offene Rechnung zu erinnern. Noch nie war er für einen Bau so weit in Vorleistung gegangen. Auch deshalb hing sein Haussegen schief. Dennoch war er überzeugt, dass sich die Investition lohnte. Mit dem Bau des imposanten Doppelhauses würde er endgültig in die Riege der besten Architekten der Stadt vorstoßen. »Bist du allein? Wo ist dein Enkel?«, fragte er.
»Jan holt uns gerade ein paar Scheiben Schweinsbraten vom Garbräter, der muss heute ein bisschen weiter laufen als alltags.«
Nicht jeder nahm es in Amsterdam mit der Sonntagsruhe genau, was durchaus Vorteile hatte, wie Aardzoon fand. Jüdische Läden hatten ebenso geöffnet wie Gaststätten oder die Läden derjenigen, die keiner Religion angehörten – und das waren etliche. Gedogen, das war die Maxime vieler Amsterdamer: Etwas war verboten, aber man duldete es, drückte ein Auge zu, manchmal auch zwei. Für Aardzoon war diese Toleranz anfangs ungewohnt gewesen, für Strenggläubige war sie unerträglich. Auch daran hatte sich der Streit entzündet.
Gerrit riss ihn aus seinen Gedanken. Der Alte schlurfte ans Feuer zurück und hielt die Hände, um die er Lumpen gewickelt hatte, vor die Flammen. »Geht einem durch Mark und Bein, die feuchte Kälte. Hab nichts gegen Eis und Schnee, Gott bewahre, aber diese Feuchtigkeit! An Tagen wie diesen spürt man, dass wir Amsterdam dem Wasser abgerungen haben. Wenn der Mensch nicht wäre, wäre die halbe Stadt überspült, weil das Land so tief liegt, das darf man nicht vergessen.« Mit einem erstickten Stöhnen massierte er sich die Knöchel. »Gleich fängt’s an zu grieseln. Ich spür den Schneeregen schon in den Knochen. Irgendwann wachsen mir noch Schwimmhäute.«
Die Mundwinkel des Baumeisters hoben sich zu einem Lächeln. »Das wäre sicher auch nicht übel. Irgendein findiger Ingenieur würde eine Einsatzmöglichkeit für dich finden. Oder dich für seine Wunderkammer ausstopfen.«
Gerrit kicherte. »Wie den Basilisken, den ein Schiff aus Batavia mitgebracht hat.«
»Du solltest nicht alles glauben, was auf den Straßen Amsterdams geredet wird.«
»Und doch ist’s wahr, Mijnhe…« Erneuter Husten machte Gerrits Worten ein Ende.
Das klingt gar nicht gut, dachte der Architekt besorgt. Er kannte den Alten schon seit seiner Jugend und brachte es nicht übers Herz, Gerrit gegen einen jüngeren Wächter auszutauschen. »Du weißt, dass du ins Oudemanhuis oder in eines der Hofjes ziehen könntest. Ich würde dich unterstützen«, sagte er beiläufig.
Gerrit straffte sich empört. »Was soll ich bei den Greisen? Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen, das wisst Ihr doch, Mijnheer!«
Der Architekt hatte nichts anderes erwartet. Er holte ein Fläschchen aus seinem pelzgefütterten Mantel und reichte es dem Alten. »Ich habe dir etwas Gutes mitgebracht.«
Gerrit zog den Korken ab und sog den leichten Wacholderduft ein. »Ah, wat lekker«, sagte er voller Vorfreude. »Besten Dank, der Allmächtige möge es Euch vergelten.«
Es zischte leise, als die ersten Eisregentropfen in die Flammen fielen. Aardzoon zog sich mit Gerrit unter das Vordach der Hütte zurück. Aus der Ferne waren Rufe zu hören. Die Oude Kerk läutete das stündliche Glockenkonzert der Amsterdamer Kirchen ein. Wo blieb sein Auftraggeber? Er hatte nicht ewig Zeit.
»Werden die Bauarbeiten nächste Woche beginnen?«, wollte Gerrit wissen.
»Wenn das Wetter mitspielt, schon. Das Erdreich ist nicht sehr tief gefroren, sodass das Fundament gelegt werden kann.«
»Op staal oder op kleef?«
»Weder noch. Wir fundieren op stuit. Das Material für Mast und Ramme liegt schon bereit.«
Skeptisch blickte Gerrit ihn an.
»Für diese Konstruktion sind weniger Pfosten nötig, und wir brauchen kein Rost«, hob Aardzoon zu einer Erklärung an. »Stattdessen rammen wir die Pfähle zu Paaren in den Grund und verbinden sie mit einem harten Querholz.« Obgleich er nichts dagegen hatte, ein wenig zu fachsimpeln, war er jetzt entschieden unruhig geworden. Auftraggeber hin oder her – was bildete van Noort sich ein, ihn am Sonntag hierherzubitten und ihn dann stehenzulassen!
Gerrit holte zwei Holzbecher aus der Hütte. »Trinkt Ihr einen Schluck Jenever mit mir, Mijnheer?«, fragte er.
Der Architekt lehnte ab. »Beim nächsten Mal. Ich werde in der Schutterij erwartet.«
Dem Alten schien es recht zu sein, nicht teilen zu müssen. Er prostete ihm zu. »Bin froh, dass Ihr ein Auge auf die Stadt habt. Die Schützengilden sind Schutz und Schirm Amsterdams. Ehrenwerte Männer, auf die man sich verlassen kann.« Bekümmert schüttelte er den Kopf. »Sind schlimme Zeiten, Mijnheer. Wir zerfleischen uns von innen heraus, dabei warten unsere Feinde nur darauf, dass wir uns schwächen, damit sie wieder zuschlagen können. Vorhin war Richtung Damrak ein Geschrei. Gott sei Dank kam niemand hierher. Plünderer oder Diebe hätten es aber auch mit mir zu tun bekommen!« Kämpferisch wies er auf den Bottich mit dem schweren Eisenhammer, der neben seinem Schemel stand. »Ich schlage sofort Alarm, darauf könnt Ihr Euch verlassen.«
»Ich bin froh, dass ich in dir und deinem Enkel so zuverlässige Helfer habe. Wo bleibt Jan denn wohl?«
»Keine Sorge. Der Bursche schäkert sicher wieder mit der Ofenmagd.«
Der Nacken des Architekten versteifte, und er rollte kurz mit den Schultern. In seinen Ärger über die Verspätung seines Auftraggebers mischte sich ein ungutes Gefühl. Gab es einen Grund dafür, dass er versetzt worden war? Es wurde Zeit, dass er zur Schützendoele kam – auch, um Neuigkeiten aus der Stadt zu erfahren.
Tief zog Aardzoon die Krempe seines Hutes ins Gesicht, als er sich auf den Weg machte. Ein wenig kleckerte der Eisregen noch, dann hörte er auf. Die Aussicht auf körperliche Betätigung und gute Gespräche trieb ihn an. Im Gegensatz zu manchem reichen Poorter dachte er nicht daran, einen Vertreter für den Wachtdienst anzuheuern. Für ihn war es eine Ehre, einer der Amsterdamer Schützenkompanien anzugehören. Zumal sich die Bürgerkompanie des Bezirks IX., deren Mitglied er war, demnächst porträtieren lassen wollte. Sie waren sich nur noch nicht einig, welcher der vielen ausgezeichneten Kunstmaler, die in Amsterdam lebten, dieses Schützenstück ins Werk setzen sollte.
Er überquerte Koningsplein und Herengracht mit ihren imposanten Stadtpalästen. Gleich darauf hatte er die Voetboogdoelen an der Koningsgracht, wie man den Singel neuerdings nannte, erreicht. Alle drei Schützenhäuser lagen zentral im alten Stadtzentrum. Das Versammlungshaus der Armbruster befand sich an der Ecke vom Heiligeweg. An die Voetboogdoelen grenzte das städtische Waffenlager, an dessen Bau Aardzoon einst mitgearbeitet hatte, daneben befand sich in einem breiten Giebelhaus die Schützendiele der Langbogner. Die Hakenbüchsen-Schützen übten sich am Kloveniersburgwal.
Kaum hatte er die Tür des Schützenhauses aufgestoßen, hörte er das Klirren der Gläser, Gelächter und Gesang. Auch hier nahm man es mit der Sonntagsruhe nicht genau; kein Wunder, dass ein englischer Besucher erst kürzlich ein Schützenhaus für eine Taverne gehalten hatte.
Das Gebäude war lang und schmal. Im Hinterhof befand sich ein Schießplatz. Einige Männer übten sich im Umgang mit den Armbrüsten, die meisten aber saßen tafelnd und zechend im Festsaal. Vom Wein gerötete Gesichter, geöffnete Wämser, Bäuche, die gemütlich über den Hosenbund hingen. Kein Vergleich mit den schneidigen Kerlen, die sie von den Schützengemälden an der Wand aus zu mustern schienen.
Lautstark wurde der Architekt begrüßt. Nur Antonie und Bertold ignorierten ihn wie üblich. Aardzoon hatte es längst aufgegeben, sich über die Verachtung zu ärgern, die sie ihm entgegenbrachten.
»Aardzoon, endlich ein würdiger Gegner! Einer der besten Schützen und Ringer meiner Kompanie – nach mir, versteht sich!«, rief Abraham Boom, der Spross eines alten Patriziergeschlechts und Hauptmann der Bürgergarde. Er lachte laut und schlug Aardzoon mit der Hand auf die Schulter. Was er sagte, war nicht gelogen. Sie waren etwa gleich alt, beide von hochgewachsener Statur und ausgezeichnete Kämpfer.
Den Architekten drängte es, die Spannung loszuwerden, die sich in seinem Körper aufgebaut hatte, gleichzeitig wollte er wissen, was auf den Straßen der Stadt los war.
»Erst der Wettstreit, dann das Geplauder!«, unterband Abraham Boom seine Fragen.
Die Männer gingen in den großen Saal, wo andere bereits ihre Armbrüste ölten, kämpften oder auf Zielscheiben schossen. Einige Zeit lang rangen sie miteinander und maßen sich mit ihren Arbalesten im Schießen. Zwei Schüsse pro Minute konnte man mit den Armbrüsten abgeben, wenn man geschickt war – die Kunst war lediglich, bei dieser Schnelligkeit auch das Ziel zu treffen.
Anschließend setzten sie sich zu den anderen an die Tafel. Einige Mitglieder der Kompanie waren bereits bezecht. Aardzoon ließ sich von dem Schankweib ein Vaasje Bier bringen. Dann endlich berichtete Abraham Boom, was los war. Offenbar hatte es morgens erneut eine Zusammenrottung von Randalierern gegeben, die gegen Andersgläubige Stimmung gemacht hatten. Die Wache hatten die Menge jedoch schnell zerstreuen können.
»Wenn Ihr mich fragt, müssten die Stadtregenten sich deutlich gegen diese Aufrührer aussprechen«, meinte Aardzoon.
»Euch fragt aber niemand«, mischte Bertold sich ein. »Oder seid Ihr neuerdings auch noch Diplomat oder gar Regent?«
Weder der Architekt noch Abraham Boom reagierten auf diesen Einwurf. »Das ist ja das Problem: Bei den Regenten herrscht ebenfalls keine Einigkeit. Jeder denkt nur an sein eigenes Seelenheil, an sein eigenes Fortkommen. Mit einer Parteinahme könnte man ja Kunden oder Geschäftspartner verprellen«, sagte Abraham Boom bitter.
In diesem Augenblick wandte sich Antonie zu ihnen. Er war ein dicklicher, eitler Mann von etwa dreißig Jahren, dessen Augen unergründlich funkelten. »Manchmal gereicht es einem auch zum Vorteil, wenn man einen Geschäftspartner verliert«, sagte er und schob die Zunge über die Schneidezähne. »Wenn ich beispielsweise an diesen van Noort denke …«
Aardzoon schwieg. Er wollte diesen Streit um keinen Preis neu entfachen.
Antonie suchte seinen Blick. Seine nächsten Worte ließen den Baumeister erstarren. »Habt Ihr es denn nicht gehört? Pleite soll van Noort sein. Schiffbruch in der Batavischen See. Alle Waren weg, wie so oft – der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen.«
Der Architekt versteifte sich. War das der Grund, warum Mijnheer van Noort nicht zum vereinbarten Treffen erschienen war?
Ehe er nachfragen konnte, flog die Tür auf. Eine Magd stürzte in die Schützendiele. Ihr Gesicht war tränennass, die Kleidung zerrissen. Der Kapitän der Armbrustgilde sprang auf. Auch Aardzoon ging ihr entgegen.
»Was ist los?«, fragte Abraham Boom.
»Bitte, Mijnheers …«, brachte sie keuchend hervor. »Ihr müsst helfen. Das Haus … meines Herrn am anderen Ende der … Koningsgracht wird angegriffen.« Sie rang um Atem. »Die Unruhestifter denken … bei uns findet ein geheimer Gottesdienst statt. Sie wollen meinen Herrn und … alle, die im Haus sind, töten!«
»Woher willst du das wissen?«, fragte Aardzoon.
»Das rufen sie die ganze Zeit. Außerdem haben sie Knüppel, Messer und andere Waffen!«
»Wer ist dein Herr?«
»Mijnheer Bisschop.«
»Rem Egbertsz Bisschop, der Bruder des remonstrantischen Predigers?«
»Ebender, Mijnheer. Ich flehe Euch an, so helft!« Die Magd sah in die Runde.
Noch immer rührte sich keiner der Männer. Alle starrten betreten auf die Weinflecken auf dem Tischlaken, auf die abgenagten Knochen, die Brotkrümel und die leeren Weinkrüge. Offenbar wollte sich niemand in die religiösen Streitigkeiten einmischen, die die Ursache für den Aufruhr zu sein schienen.
»Es ist Sonntag und noch keine Zeit für die Nachtwache. Habt Ihr den Schout Willem van der Droes benachrichtigt?«, fragte Abraham Boom.
»Ja, den Schout, die Büttel, und den Bürgermeister auch.«
»Welchen?«, mischte Antonie sich ein, dessen Vater ebenfalls zum Bürgermeisterquartett Amsterdams gehörte.
»Mijnheer Pauw.«
Mit dieser Antwort war das Interesse des jungen Mannes erloschen. Er wandte sich ab. Die junge Magd sprach weiter: »Angeblich ist er auf dem Weg. Aber lange halten die Eingeschlossenen in dem Haus nicht mehr aus. Wer weiß, was der Mob ihnen antut …« Noch immer machte niemand Anstalten aufzubrechen. Die Magd sah sie flehend an. »Bitte, Ihr Herren, tut doch etwas!
Aardzoon machte die Lethargie seiner Mitstreiter wütend. »Wir können doch bei diesem Unrecht nicht zusehen! Was, wenn es als Nächstes einen von Euch träfe!«, rief er in die Runde.
»Oder Euch«, meinte Antonie.
Das kalte Blitzen in den Augen seines Widersachers ließ Aardzoon erschaudern. »Was meint Ihr damit?«, fragte er scharf.
Sein Gegenüber lächelte und enthüllte dabei seine gelben Schneidezähne. »Beruhigt Euch, Mijnheer, das war nur so dahergesagt.«
Der joviale Ton ließ den Architekten erst recht misstrauisch werden. Was führte der Mann im Schilde? Doch diese Frage würde warten müssen. Aardzoon legte seine rot-weiße Schärpe um und packte seine Waffe. »Wir müssen helfen! Wer begleitet mich?«
»Es ist eine reiche Nachbarschaft. Etliche Mitglieder der Vroedschap wohnen in Bisschops Nähe. Sie werden nicht zulassen, dass bei ihnen randaliert wird«, sagte der Leutnant.
»Gott hat vorherbestimmt, was geschieht. Er wird es zum Besten richten«, meinte der Fähnrich.
Fassungslos schüttelte Aardzoon den Kopf. Er würde nicht zusehen, wenn Unrecht geschah – auch wenn er selbst dabei in Gefahr geriete. »Darauf können wir uns nicht verlassen. Wir sind es, die das Schicksal ändern können.« Er sah sich um. Immerhin begleitete Abraham Boom ihn. Der Hauptmann legte seinen Kürass an und schnappte sich den Sponton, denn die kurze Pike zeigte seinen Rang an. Zwei weitere Männer schlossen sich ihnen an.
Sie entschieden sich, den kürzeren Weg über den Rokin zu nehmen. Auf dem Dam herrschte viel Betrieb, aber die Spaziergänger machten den Schützen mit ihren Armbrüsten Platz. Schon ein wenig erschöpft bogen sie schließlich in die Koningsgracht ein. An den Kanalmauern dümpelten Schiffe und Ruderboote, Fässer warteten darauf, verladen zu werden. Aardzoons Herz klopfte noch ein wenig schneller, als er ihr Ziel entdeckte. Es war schlimmer, als er es erwartet hatte. Hunderte Menschen drängten sich vor dem Haus des Kaufmanns. Wie entfesselt brüllten sie, warfen mit Steinen die Scheiben ein. Auch andere Häuser waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Offenbar hatten die Unruhestifter die Tür von Bisschops Heim inzwischen aufgebrochen. Plünderer zerrte Möbelstücke auf die Straße. Bücher wurden zerfetzt, Gemälde zerschnitten. Schon jetzt trieb Hausrat im Fluss. Andere Aufrührer besoffen sich mit geraubtem Wein, fraßen gestohlene Spezereien oder versuchten, mithilfe der Überreste der zerbrochenen Tür Feuer an das Haus zu legen. Aus den oberen Fenstern drangen Hilferufe. Aardzoon sah, dass etliche junge Männer bereits an der Fassade emporkletterten, während andere versuchten, über das Dach einzudringen. Es war höchste Zeit einzugreifen. Abraham Boom hatte ebenfalls die Lage sondiert und rief erste Befehle.
In diesem Augenblick stürzte ein Jugendlicher zu Aardzoon; es war Jan. Warum bewachte der Junge nicht die Baustelle? »Endlich finde ich Euch, Mijnheer! Ich war in der Schützendiele … habe Euch da knapp … verpasst …«, brachte Jan stockend heraus. »Die Plünderer … die Baustelle … mein Großvater …«
Scharf durchfuhr es den Architekten. Er packte den jungen Mann an den Schultern. »Nun rede schon – was ist passiert?«
Mit brennenden Augen blickte der Junge ihn an. »Auch bei Eurer Baustelle … Plünderer … Alles kurz und klein schlagen wollen sie. Feuer wollen sie legen …«
Aardzoon war für einen Augenblick wie erstarrt. Die Worte trafen ihn wie ein Schlag. Eine uralte Angst drohte von ihm Besitz zu ergreifen. Nicht schon wieder! »Godverdomme!«, stieß er leise aus. Er atmete tief durch. Sein gesamtes Erspartes hatte er in diese Baustelle investiert. Wenn Antonie recht hatte und van Noort bankrott war, würde er auf dem Schaden sitzen bleiben. Er könnte alles verlieren.
»Grootvader …«, begann Jan von Neuem.
Aardzoon drängte die Angst zurück. »Was ist mit Gerrit?«
Der Junge sah ihn mit aufgerissenen Augen an. »Er hat Alarm geschlagen, aber sie … Ich wollte ihn nicht allein … Er hat mir befohlen, zu Euch …«
Aardzoon wog seine Waffe in der Hand. Er wurde hier gebraucht, aber genauso auf der Baustelle. Schon einmal hatte er erlebt, wozu Menschen fähig waren. Es war grauenvoll gewesen.
Entschlossen stürzte er los.
Teil 1
1585 bis 1588
1
Antwerpen, August 1585
Es krachte, jemand schrie. Sofort sprang Vincent Aardzoon auf. Was ging da draußen vor sich? Die plötzliche Bewegung und der Hunger ließen den Jungen schwindeln. Er blinzelte, rieb sich über das Gesicht – nichts half. Beim Hinausgehen musste er sich an den Wänden abstützen. Vor der Tür umfing ihn die Hitze wie ein nasses Handtuch. Der Gestank des Hafenschlicks verstärkte seine Übelkeit, weshalb es ihm schwerfiel durchzuatmen. Das Donnern der Kanonen und Musketen ließ ihn zusammenzucken. Obgleich der Geschützlärm sie seit über einem Jahr begleitete, war es unmöglich, sich daran zu gewöhnen.
Als er sich gefangen hatte, erkannte Vincent, dass die Jungen erbittert mit Knüppeln aufeinander eindroschen. Auf der Stirn seines Bruders Ruben wölbte sich bereits eine rote Beule, und in seinen Augen brannte heiße Wut. Beim nächsten Schlag brach Rubens Ast entzwei. Er wollte dem Nachbarsjungen den Stumpen entgegenschleudern, doch Vincent sprang dazwischen.
»Genug!«, rief er. Mit seinen elf Jahren überragte Vincent die Jüngeren um Haupteslänge, wovon sich allerdings weder sein Bruder noch Kees, der Sohn des Pfefferhändlers, beeindrucken ließ. Beide starrten ihn hitzig an.
»Lass uns kämpfen! Wir müssen uns verteidigen können, wenn die Spanier kommen!«, fauchte Ruben. Er holte von Neuem aus, aber Vincent stoppte den Angriff.
»Die Spanier werden hier nicht einfallen, das wird der Magistrat zu verhindern wissen«, versuchte Vincent, seinen Bruder zu beruhigen. »Außerdem: Was willst du ausrichten, wenn ihr euch vorher zu Klump schlagt?«
Ruben wollte etwas entgegnen, tänzelte aber nur von einem Fuß auf den anderen. Unwillkürlich musste Vincent lachen. »Mund zu, oder willst du Fliegen fangen?«
Kurz sah es aus, als wollte Ruben sich gekränkt auf ihn stürzen, doch dann murmelte er: »Wenn überhaupt, dann Mücken.« Mit einem entschlossenen Hieb schlug er ein Tier tot, das sich auf seinen Hals gesetzt hatte. Verdenken konnte Vincent es ihm nicht, die Mücken waren in diesem Jahr eine echte Plage.
Vincent räusperte sich. Seine Kehle war staubtrocken. Er pickte einen Kiesel auf, wischte ihn an seinen Beinlingen ab und steckte ihn in den Mund. Der Stein würde seinen Sinnen vorgaukeln, dass es etwas zu essen und zu trinken gab, das hatte Vater ihnen erklärt. »Wo is’ Betje?«, fragte er nuschelnd.
Sein Bruder verstand ihn trotzdem: »Betje spielt mit Sara.«
Vincent schob den Kiesel mit der Zunge in die Backentasche. »Du solltest doch auf sie aufpassen!«
»Und warum hast du das nicht gemacht? Du bist der große Bruder!«, gab Ruben trotzig zurück.
»Ich habe gelernt. Das solltest du auch tun!«
»Ach ja? Wir haben doch kaum Unterricht. Die Lehrer sind alle geldgierig, krank oder tot!«
»Gerade deshalb, du Hohlkopf.«
Ruben schoss wütend auf ihn zu. »Sag das noch mal!«
Kees ging dazwischen. »Die beiden haben hier herumgequengelt.«
»Betje und Sara? Und da habt ihr sie weggejagt?«, fragte Vincent fassungslos. Er spuckt den Stein in hohem Bogen in den Straßengraben. Ohne ein weiteres Wort lief er zur nächsten Ecke, von wo aus er die Hafenkante und die auf den Platz mündenden Gassen einsehen konnte. Ihre Schwester war mager und schwach; am Morgen war sie kaum aus dem Bett gekommen. Was, wenn Betje auf der Straße zusammenbrach? Oft waren in den letzten Wochen in unbelebten Ecken und Winkeln der Stadt entkräftete Gestalten oder gar Tote gefunden worden.
Was Vincent sah, verstärkte seine Beklemmung noch. Antwerpen war ein Totenhaus. Kein Hund bewachte mehr Kaufmannshöfe oder Werkstätten. Keine Katze jagte in Abwassergräben nach Mäusen. Nicht einmal Möwen kreisten noch zwischen den Giebeln. Vieh hatte man schon seit Monaten nicht mehr durch die Stadt getrieben. Am Schelde-Kai, an dem sonst dickbauchige Koggen oder Galeonen lagen, dümpelten nur ein paar Segler. Reglos stand der Kran auf dem Kranenhoofd. Im gleißenden Licht des Augusttags wirkte der Fluss, die mit Abstand wichtigste Handelsroute der Stadt, brackig.
Eilig suchte Vincent die Umgebung ab. Bei einem verlassenen Hafenschuppen entdeckte er die Mädchen endlich. Sie hockten am Ufersaum und hantierten mit einem zerbrochenen Krug, Steinen und einem morschen Holzbrett. Vater würde sie schelten – nicht besser als Bettler sahen sie aus! Offenbar hatten sie Sand mit Flusswasser vermischt, denn ihre Kleider und Hände waren verdreckt. Betje wirkte bleich, selbst ihre dicken blonden Haare hingen schlaff herunter. Gerade führte sie etwas zum Mund.
Vincent beschleunigte den Schritt. Was aß sie? Im Näherkommen erkannte er, dass die Mädchen aus Stroh, zermahlenen Eicheln und Matsch eine Art Fladen geformt hatten. Er schlug seiner Schwester den Dreck aus der Hand.
»Die schöne Waffel!«, beschwerte sich Betje weinerlich.
»Das ist doch keine Waffel! Das darfst du nicht essen. Du kannst krank davon werden!«, schimpfte Vincent. Betjes Unterlippe bebte. Ihre Freundin senkte beschämt den Blick. »Wie viel habt ihr davon schon gegessen?«, forschte Vincent nach.
»Wir haben eine Waffel geteilt. Sie hat geschmeckt, oder nicht, Sara? Mutter hat immer so leckere Waffeln gemacht«, meinte Betje.
Vincents Hals wurde so eng, dass er kaum Luft bekam. Was würde er dafür geben, dass seine Mutter wieder da wäre und für sie Waffeln backen würde! Ihr Tod war für sie alle wie eine offene Wunde. Er schluckte heftig. Auf einmal tat Betje ihm leid. Mit einem sauberen Zipfel ihres Kleids wischte er ihr den Dreck ab; auch Sara reinigte er das Gesicht. »Ihr dürft diesen Unrat nicht essen, hört ihr«, sagte er sanfter. »Nachher sollen wieder Notrationen am Stadhuis verteilt werden, dann gibt es etwas Richtiges.«
»Aber das ist noch so lange hin! Außerdem ist es nie genug«, schmollte Betje.
Wie recht sie hatte, ihre letzte, halbwegs vernünftige Mahlzeit war Tage her. Trotzdem durften sie kein Risiko eingehen.
Noch vor dem Haus musste Betje sich übergeben. Vincent trug sie in die Schlafkammer. Er half ihr, die besudelte Kleidung auszuziehen; der Anblick ihres abgemagerten Körpers schnürte ihm aufs Neue den Hals zu. Sofort rollte sie sich auf dem Bett zusammen. Da weder Ruben noch ihr Vater da waren, wachte Vincent über sie. Er holte sein Skizzenbuch von einem Regal, einem der wenigen Möbelstücke, die ihnen geblieben waren. Früher war ihr Haus so gemütlich gewesen, warm und voller Lachen. Es hatte Gemälde und Blumensträuße gegeben, weiche Wolldecken und Felle, und stets hatte etwas Gutes auf dem Herd geköchelt. In seiner freien Zeit hatte sein Vater feine Möbel nach den Entwürfen seines früheren Dienstherrn Hans Vredeman de Vries gezimmert. Gemeinsam hatten sie gespielt oder Seifenblasen bestaunt, die Vincent geschickt blasen konnte und denen seine Geschwister fröhlich nachgejagt waren. Heute aber waren die Räume leer, und der Herd war kalt. Seit keine Holzlieferungen mehr in Antwerpen eintrafen, hatte ihr Vater kaum Geld verdient. Die Arztbesuche und die Beerdigung der Mutter hatten ihre Ersparnisse vollends aufgezehrt. Was sie nicht verkauft hatten, hatten sie verfeuern müssen.
Kurz wanderte Vincents Blick zu dem Porträt der Mutter, das sorgfältig gerahmt neben der Bibel stand. Sein Vater hatte die Zeichnung an einem schönen Tag im letzten Sommer angefertigt. Nur flüchtig beschrieben die Striche die Gesichtszüge – und doch vermittelten sie einen Eindruck ihres Wesens. Traurig setzte Vincent sich an das Bett seiner Schwester. Er würde an seiner Skizze der Festungsruine arbeiten. Die Antwerpener Bürger hatten die Zitadelle vor acht Jahren als verhasstes Symbol des spanischen Königs zerstört. Mit seinem Freund David hatte Vincent lange vor der Ruine gesessen und gezeichnet. Ob David mit seinem Entwurf schon fertig war?
Erst einige Striche hatte Vincent auf das Papier geworfen, als sein Vater zurückkehrte. Vincent lief zur Stube, aber sein Vater schien ihn, wie so oft, gar nicht wahrzunehmen. Wim Aardzoon war kein Mann großer Worte. Entweder er arbeitete, oder er widmete sich seinen religiösen Verpflichtungen.
Ehe Vincent ihn ansprechen konnte, strebte sein Vater zur Anrichte, küsste das Bild seiner Frau, nahm die Bibel heraus und ließ sich auf die Knie sinken. Mit gesenktem Haupt las er vor: »›Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen …‹«
Wenn Vincent sich recht erinnerte, war es ein Abschnitt aus dem Buch der Propheten, über den bei einem der letzten Gottesdienste gepredigt worden war. Es ging darum, dass man auch in Zeiten der Not auf Gott vertrauen sollte.
»›… und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen, denn der Herr hat’s gesagt.‹«
Das Verhalten seines Vaters verunsicherte Vincent. Wim Aardzoon war ein Mann wie ein Baum, standfest und stark. Er konnte mit masthohen Balken hantieren, als wären sie Speere, schwang Beile wie andere Säbel und legte Fundamente für trutzige Festungen – jetzt aber wirkte er wie ein Häufchen Elend. Dabei hätte Vincent bis zu dieser unglückseligen Belagerung und dem Tod der Mutter nicht geglaubt, dass seinen Vater je etwas erschüttern könnte. Wims Schultern zuckten. Weinte er etwa?
»Vater?«, fragte Vincent erschrocken.
Seine heisere Stimme riss den Vater aus der Versenkung. Wim kam auf die Füße und legte die Bibel zurück auf das Regal. »Ich habe dich gar nicht bemerkt«, murmelte er. Ganz grau wirkte er. Die hellen Strähnen in seinem pfefferfarbenen Haar schienen täglich mehr zu werden, die Augen waren rot gerändert. Er ließ sich auf den Hocker sinken und wog das Haupt in den Händen. Plötzlich riss er den Oberkörper hoch und knallte den Hinterkopf gegen die Wand.
Vincent zuckte zusammen. Das musste doch wehgetan haben! Sein Vater verzog jedoch kaum das Gesicht. »Frings hat unsere Schulden verkauft. Wir werden das Haus schon morgen verlassen müssen«, stieß er hervor.
Vincent hatte das Gefühl, ihm würde der Boden unter den Füßen weggezogen. Mijnheer Frings war ihr Nachbar. Er trieb schwunghaften Handel mit englischen Tuchen und hatte schon öfter versucht, Wim Aardzoon zum Verkauf zu bewegen. Er wollte ihr kleines Fachwerkhaus abreißen lassen, um an der Stelle eine Lagerhalle zu bauen. Dass er es wagte, sich auf diese Art und Weise den Baugrund zu verschaffen …
Vincent verbarg das Skizzenbuch hinter seinem Rücken; in diesem Zustand wäre Vater ganz sicher nicht mit seiner Zeichnung zufrieden. Außerdem hatten seine Worte ihm eine Heidenangst eingejagt. »Was wird dann aus uns? Wo sollen wir hin?«, fragte er.
Sein Vater starrte auf seine Finger, die aufgesprungen und rau von der Arbeit waren. »Jemand wird uns schon aufnehmen. Wir sind in Gottes Hand, hast du das vergessen? Die Belagerung kann nicht mehr lange dauern. Angeblich liegen in der Scheldemündung an die zwanzig Schiffe, die zu unserer Rettung ausgesandt sind, voll beladen mit Waffen und Korn.«
Hoffnung keimte in Vincent. »Was für Schiffe? Wer hat diese Schiffe ent…«
»Hast du gelernt?«, unterbrach Wim ihn schroff.
Vincent senkte das Haupt. »Natürlich, Vater.«
Wim beugte sich vor und klopfte Vincent mit dem Zeigefinger hart gegen die Stirn. »Sei schlauer als ich, und lerne, lerne, lerne! Deine Mutter hat es gewusst: Was du hier drin hast, kann dir niemand nehmen. Der spanische König mag uns einsperren, er mag uns an Leib und Seele bedrohen, mag uns zu Bettlern und Hungerleidern machen, aber er wird uns nicht unterkriegen.«
Unzählige Male hatten seine Eltern erzählt, wie sie sich kennengelernt hatten: Wim war von seinem Dienstherrn zu einer Druckerei geschickt worden, um ein Buch abzuholen. Die Schriften berühmter Baumeister und Ingenieure, die dort auslagen, hatten Wim fasziniert, die gelehrte Verkäuferin hatte ihn verzaubert. Immer wieder hatte Wim anschließend einen Vorwand gesucht, um in die Druckerei zurückzukehren.
Vincent wusste genau, wie wichtig seinem Vater die Ausbildung seiner Kinder war. Schreiben und Lesen, Mathematik, Latein und Zeichnen – an der Schulbildung hatte Wim Aardzoon zuallerletzt gespart. Vincent wurde an der Lateinschule von Diakon Godlef unterrichtet, wo sie gerade Ciceros Redekunst und die mathematischen Regeln des Euklid durchnahmen, doch seit Kurzem musste der Geistliche sich wichtigeren Pflichten widmen.
Wim bemerkte das Skizzenbuch in Vincents Hand. »Du hast gezeichnet?«
»Ich habe versucht, die Skizze zu verbessern. Aber die Ruine und die Stadtmauer sehen nicht so aus wie in echt.«
»Zeig her.«
Kritisch betrachtete sein Vater die Zeichnung. »Du verlierst dich in Details, statt das große Ganze zu sehen. Hier, die wulstige Rinde des Baumes oder der Riss in der Mauer – hübsch, aber unnütz. Die Perspektive stimmt beinahe, die Festungsmauern stehen allerdings ein wenig schief. Siehst du, hier und hier.« Jetzt, wo Wim mit dem Finger darauf wies, sah Vincent es auch. »Wenn ich so bauen würde, wie du gezeichnet hast, würde jedes Haus zusammenstürzen. Gott hat die Welt geordnet mit Maß, Zahl und Gewicht. Alles ist auf geometrische Formen zurückzuführen, hast du das vergessen?«
»Nein, Vater.«
»Ausgangspunkt ist der Kreis«, führte Wim aus. »Gott hat die Welt in einem Zirkelrund geschaffen. Mithilfe der Winkel ergeben sich daraus alle Formen. In dieser Mauer steckt ein Rechteck, in der Ruine der Zitadelle sind Quadrate und Dreiecke verborgen. Fange immer mit den Grundformen an, dann kann nichts schiefgehen. Danach darfst du die Perspektive nicht vergessen – die Mauern wirken in der Ferne kleiner.«
Sofort machte Vincent sich daran, die Fehler auszubessern.
Sein Vater redete unterdessen weiter. »Für einen Baumeister gelten die Grundregeln der klassischen Architektur, was Maße und Schönheit angeht. Der römische Gelehrte Vitruv hat sie festgelegt. Er fordert für die Architektur, dass sie solide ist, nützlich und schön. Schönheit strahlt ein Gebäude jedoch nur aus, wenn die einzelnen Teile in harmonischen Größenverhältnissen zueinander stehen. Für jedes Gebäude gelten zudem besondere Anforderungen. Bei einer Festung geht es vorrangig um Angriff und Verteidigung.«
Vincent sah seinen Vater an. Der Vortrag schien ihn von seinem Kummer abzulenken. Das war gut. »An Kirchen oder an einem Rathaus wird meist nicht mehr gebaut, wenn sie einmal fertig sind. Warum müssen dann Festungsmauern immer wieder erneuert werden, auch wenn sie nicht zerstört wurden?«, sprach er einen Gedanken aus, der ihn schon länger beschäftigte.
»Wenn es neue, stärkere Waffen gibt, müssen auch die Festungen verbessert werden. Bei den Rundtürmen und eckigen Festungstürmen gibt es viele tote Winkel, in denen sich Soldaten verstecken können. Das kann man sich heute nicht mehr leisten. Doppelkartaunen, Scharfmetzen oder Basilisken zerschießen mit ihren Eisenkugeln einen einfachen Schutzwall im Nu. Zudem können Schützen mit ihren Arkebusen oder Musketen aus dem Hinterhalt erheblichen Schaden anrichten.«
Vincent überlegte. »In der Antwerpener Festung sind Dreiecke versteckt.«
»Gut beobachtet. In einer keilförmigen Bastion wie der unseren sind die toten Winkel am kleinsten.«
»Deshalb habt Ihr also die Antwerpener Stadtmauer erneuert.«
Sein Vater stieß einen Laut aus, der Vincent an dessen kollerndes Lachen erinnerte; viel zu lange hatte er es schon nicht mehr gehört. »Nicht ich allein, bei Weitem nicht. Die Mijnheers Vredeman de Vries und Hans van Schille haben die neuen Fortifikationen zwischen Zitadelle, Schelde-Ufer und Inlandswegen entworfen. Ich hatte ein Buch mit den Entwürfen van Schilles. Ein Jammer, dass ich es verkaufen musste, sonst hättest du …«
Die Glocken unterbrachen ihn. Wims Gesicht verdüsterte sich wieder. »Es ist Zeit. Hol deine Geschwister, wir müssen los.« Leiser setzte er hinzu: »Er hat uns wahrlich zu Bettlern gemacht.«
Betje war auf der Pritsche eingeschlafen und ließ sich nur schwer wecken. Ruben hingegen fand Vincent vor dem Haus, wo er und Kees versuchten, eine Möwe mit Steinen abzuwerfen; diese Vögel schmeckten nicht besonders gut, waren aber besser als nichts. Vincent fürchtete sich davor, seinen Geschwistern erzählen zu müssen, dass sie demnächst auch noch ihr Heim verlieren würden.
Wim nahm Betje an die Hand und schritt weit aus. Vincent glaubte nicht, dass seine Schwester dieses Tempo lange durchhalten würde, zumal es noch immer sehr heiß war. Schon blieb Betje so weit zurück, dass ihr Vater sie beinahe hinter sich herziehen musste.
»Vater, ich bitt Euch … nicht so schnell … Ich kann nicht mehr«, stieß Betje schließlich hervor.
Wim hockte sich neben seine Tochter. Er betrachtete sie, als habe er sie seit Wochen nicht gesehen. Besorgt befühlte er ihre Stirn. »Mir gefällt das auch nicht, aber du weißt doch: Wenn wir nicht rechtzeitig ankommen, gehen wir leer aus.«
Obgleich sie mit ihren acht Jahren schon zu alt dafür war, hob Wim sie hoch und setzte sie auf seine Hüfte. Schlaff hing das Mädchen auf seinem Arm.
Die engen Gassen mit den schmalen, hohen Häusern stanken nach Unrat. Menschenleer war der Platz, selbst den Handel der so geschäftstüchtigen Hansekaufleute hatte die Blockade zum Erliegen gebracht; das imposante Hansekontor an der Suikerrui wirkte verlassen.
Ruben war vorausgeeilt. Nun stand er an der Straßenecke, rief ihnen etwas zu und gestikulierte aufgeregt. »Da ist ein beladener Karren vor dem Haus von Mijnheer Gamel! Sicher ist Getreide geliefert worden. Endlich gibt es wieder Brot. Haben die Geusen es doch geschafft, die Blockade zu durchbrechen! Diese Teufelskerle!«
»Untersteh dich, derart zu fluchen!«, schalt Wim seinen Sohn, doch sein Gesicht hellte sich auf. Für sie alle waren die Wassergeusen Helden. Sollten die Kaperfahrer, die auf See für die Freiheit der Niederländer kämpften und jetzt das eingeschlossene Antwerpen unterstützten, die Blockade durchbrochen haben, gäbe es Hoffnung. Schließlich war Mijnheer Gamel ein mildtätiger Kaufmann. Er hatte ihnen früher immer Mehl und andere Nahrungsmittel geliefert und in den vergangenen Monaten nicht nur sie anschreiben lassen.
Bald sah auch Vincent den Karren. Erst auf den zweiten Blick erkannte er, dass die Gestalten zerlumpt waren und es sich bei der Ladung nicht um Warenballen handelte, sondern um in Laken eingewickelte Körper. Ein knochiger Arm löste sich aus dem Leichentuch und hing auf das Pflaster hinunter; grob schob der Knecht ihn wieder auf die Pritsche zurück. Schrecken hatte Rubens Augen geweitet.
Wim legte seine große Hand über Betjes Gesicht, damit ihr der Anblick erspart blieb.
Vincent versuchte, sich die Bestürzung nicht anmerken zu lassen. War der Kaufmann gestorben? Aber warum hatte ihn dann der Armenkarren abgeholt? Ein Gefühl tiefer Hilflosigkeit erfüllte ihn. Täglich starb jemand, den sie kannten. Ihre geliebte Mutter, gute Freunde, Nachbarn. Bald würde es auch sie erwischen. Und das, obwohl sie so inbrünstig für eine Rettung beteten. Es war, als habe Gott sie vergessen.
Der Anblick des Stadhuis riss Vincent wenig später aus seinen düsteren Gedanken; an diesem eindrucksvollen Gebäude konnte er sich nie sattsehen. Nichts an der filigranen Fassade erinnerte noch daran, dass das Rathaus erst vor wenigen Jahren durch die Spanier niedergebrannt und anschließend wieder aufgebaut worden war. Die Pracht des Gebäudes stand allerdings in einem krassen Gegensatz zu den verhärmten, elenden Gestalten, die sich davor versammelt hatten. Spannung lag in der Luft. Als wäre es nicht schlimm genug, dass sie belagert wurden, waren sich die Antwerpener auch noch untereinander spinnefeind. Immer wieder brachen Streitigkeiten aus, deren Anlass Vincent nur erahnen konnte. Die meisten hatten wohl mit der komplizierten Frage zu tun, was der wahre Glaube sei.
Wim Aardzoon schlug einen Bogen um die Streithähne. Die Menschen machten ihm Platz, was nicht nur an seiner Statur lag; viele kannten ihn und zeugten ihm Respekt.
Dann jedoch traten ihnen ein paar junge Männer in den Weg. »Genug vorgedrängelt! Wir haben schon länger gewartet«, sagte ein Kerl scharf. Es war Sjako, ein hagerer Zimmermann, den Vincent schon manches Mal am Hafen gesehen hatte.
»Ich drängle nicht vor, sondern will nur in friedlicherer Umgebung warten«, wies Wim die Anschuldigung zurück.
Sjako verschränkte die Arme vor der Brust. »Ihr sollt Euch hinten anstellen, wie es sich für einen Mann Eures Ranges gehört.«
Wims Kiefer mahlten, und die scharfen Furchen in seinem Gesicht wurden tiefer. »Was meint Ihr damit?«
Sjako grinste. »Wenn Ihr kein Haus besitzt, dürft Ihr Euch nicht mehr Bürger dieser Stadt nennen. Niemand wird Euch noch Aufträge geben. Kaum besser als ein Bettler seid Ihr …«
Vincent hielt ob dieser Frechheit die Luft an. Woher wusste Sjako, dass sie ihr Haus verlieren würden? Überhaupt: Dass dieser Kerl es wagte, sich über ihr hartes Schicksal zu freuen! Die Belagerung und die Krankheit der Mutter waren doch der Grund für ihre Geldnot.
Vincent und Ruben schoben sich neben ihren Vater, trotz ihrer Jugend bereit, ihm beizustehen.
Wim löste Betjes Arme von seinem Hals und hob sie zu Vincent hinüber. Dieser drückte seine kleine Schwester an sich. Wie leicht Betje war und wie heiß ihr Gesicht! Sorge durchfuhr ihn. Sie hatten ja bei ihrer Mutter erlebt, wie anfällig ein geschwächter Körper war.
»Wenn ich mich recht entsinne, steht es auch mit Euren Geschäften nicht zum Besten, vor allem, seit Ihr den letzten Auftrag eines gewissen Poorters vermasselt habt«, sagte Wim verächtlich.
»Vermasselt? Ich habe nichts vermasselt!«, zischte Sjako.
»Wie würdet Ihr es denn nennen, wenn ein Haus eine Elle absackt und einzustürzen droht?«
Einige Umstehende lachten. Sjakos Kumpane schoben streitlustig ihre Ärmel hoch. Das Elend brachte nicht das Beste aus den Menschen zum Vorschein, das wusste Vincent. Nicht nur, dass die Kaufleute Wucherpreise für die wenigen Lebensmittel forderten, die in die Stadt gelangten. Es grassierten auch Verbrechen. Anfangs waren bei Einbrüchen nur Wertgegenstände gestohlen worden. Inzwischen riss man alten Mütterchen den letzten Brotkanten aus der Hand oder tötete sogar, um eines der wenigen Hühner zu stehlen, die die Belagerung bislang überlebt hatten. Dieses Verhalten erschien Vincent absurd. Sollten sie nicht zusammenhalten? Steckten sie nicht alle in derselben Falle?
Sjako schoss auf Wim zu. Dessen Finger zuckten. Vincent fürchtete, dass sein Vater den Konkurrenten angreifen könnte, obwohl sie hoffnungslos in der Unterzahl waren. Doch dann wandte Wim sich ab, offenbar unwillig, sich auf einen Kampf einzulassen.
Im gleichen Augenblick drängte sich eine auffällige Gestalt durch die Menge zu ihnen. Es war Messere Federigo Giambelli. Der italienische Mechaniker war von zarter Statur, aber hitzigem Temperament. Wie so oft trug er kurze gelbe Pumphosen mit ausgeprägter Schamkapsel, Seidenstrümpfe und ein ausgepolstertes Wams. An seinem Schwertgehänge waren ein Degen und ein Dolch befestigt. Oft kam es seiner auffälligen Kleidung wegen zu Diskussionen mit strengeren Glaubensbrüdern, die eine schlichte schwarze Tracht für angemessen hielten. Seine Freundschaft zu Wim Aardzoon schien jedoch unverbrüchlich zu sein, weil Wim Giambelli vor einigen Jahren das Leben gerettet hatte.
Unter Giambellis buschigem grauen Haarschopf funkelten Knopfaugen. »Was ist los, amico? Was wollen diese Herumtreiber von dir?«, fragte er.
»Herumtreiber?« Sjako und seine Kumpane kamen drohend näher. »Ein Fremder wie Ihr hat hier gar nichts zu melden!«
»Nichts zu melden?! Sag das mal deinem Bürgermeister und deinen Räten, figlio di puttana!«
»Was bedeutet das? Wagt Ihr es etwa, mich zu schmähen?« Sjako wurde knallrot und versetzte Messere Giambelli einen heftigen Stoß vor die Brust. Der Italiener taumelte zurück. Als Nächstes zog Sjako einen Dolch. Ein Aufschrei ging durch die Menge.
Vincent sog erschrocken die Luft ein, als sein Vater zwischen die Männer hechtete. Er war doch unbewaffnet!
Sjako tänzelte an ihm vorbei und stach mit seinem Dolch in Messere Giambellis Richtung. Gleichzeitig bildeten seine Männer einen Kreis um sie und drängten sie enger zusammen.
»Jetzt vergeht Euch das lose Maul, was?«, rief Sjako.
Der Italiener wich zurück. Sjako sprang auf Giambelli zu, doch ehe die Klinge seinen Freund treffen konnte, machte Wim einen Ausfallschritt. Der Angreifer stolperte und fiel. Einige Zuschauer johlten. Wim trat dem Angreifer den Dolch aus der Hand und hob ihn auf. Sjakos Kumpane waren offensichtlich unschlüssig, ob sie ihm zu Hilfe kommen sollten. Giambelli jedoch lachte triumphierend.
In diesem Augenblick wurde die Pforte am Seitenflügel des Rathauses geöffnet. Bewegung kam in die Menge. Menschen wurden zwischen sie und die Streithähne geschoben, wodurch es Wim gelang, sie außer Reichweite zu bringen.
»Was ist denn in diesen Kerl gefahren? Hat der Hunger ihm das Hirn verdreht?« Messere Giambelli tupfte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
»Ich war beteiligt, als Sjako von der Zimmermannsgilde gerügt wurde, weil er dem Papst gehuldigt und den reformierten Glauben geschmäht hat. Danach hat er kaum noch Aufträge bekommen. Mir tat’s leid, ehrlich. Hätte sich auf Intarsien verlegen sollten, bei diesen Fummelarbeiten ist er richtig gut. Aber so hat er gegen mich ein paarmal bei Auftragsvergaben den Kürzeren gezogen.«
»Wen wundert’s – du bist der Beste, amico!«
»Nicht mehr lange.«
Besorgt legte Messere Giambelli die Hand auf Wims Schulter. »Was ist? Du wirkst so … wie soll ich sagen … bedrückt.«
Es fiel Wim sichtlich schwer, die nächsten Worte auszusprechen. »Dieser Halunke hat die Wahrheit gesagt. Meine Schulden wurden überschrieben. Wir werden aus dem Haus geworfen.«
Sein Freund stieß einen heftigen Fluch aus. »Diese unbarmherzigen Pfennigfuchser!«, schimpfte er und setzte kopfschüttelnd hinzu: »Ihr könnt bei mir wohnen.«
Vincent fragte sich, ob sein Bruder mitbekommen hatte, worüber die Männer gesprochen hatten, aber Ruben war mal wieder verschwunden. Als er sich reckte, entdeckte er ihn – sein Bruder schlängelte sich geschickt zwischen den Leuten hindurch, beinahe war er schon in der ersten Reihe.
Wachen traten vor die Pforte. Die Menschen schoben sich ihnen entgegen, riefen und bettelten, die Hände flehend ausgestreckt. Schon wurden die ersten Notleidenden umgerissen und stürzten; auch Vincent konnte sich mit seiner Last kaum auf den Füßen halten.
Durch eine Lücke sah Vincent, dass die Büttel einen Sack aus der Kornkammer holten. Empörtes Heulen wurde laut. »Ist das alles? Gebt uns mehr Getreide, wir flehen euch an. Wir gehen elendig zugrunde!«, schrie eine Frau neben ihnen, die ihren leblosen Säugling vor die Brust gebunden hatte.
Ein Büttel kletterte auf einen Vorsprung. Es fiel ihm schwer, die Schreie zu übertönen: »Nur ruhig, ihr Leute! Bald hat das Hungern ein Ende. Unser verehrter Bürgermeister wird binnen Tagen das Ende der Belagerung verkünden. Die Waffen werden schweigen. Die Kämpfe werden demnächst eingestellt!«
Vincent bemerkte, wie sein Vater und Messere Giambelli überraschte Blicke tauschten.
»Brot oder Frieden! Brot oder Frieden!«, skandierte die Menge.
Tumulte brachen aus, als das Getreide verteilt wurde. Alle riefen durcheinander, versuchten, die anderen wegzuschieben, sich einen Vorteil zu verschaffen.
»Bitte, ich habe vier Kinder …«
»Meine Frau ist krank, wir brauchen Essen …«
»Bei der Güte Christi …«
Ruben hatte den Beutel von seinem Gürtel gelöst und wartete ungeduldig auf sie, denn sie bekamen ihren Anteil pro Kopf. Als der Vorrat verteilt war, wurden die Tumulte rabiater. Gerangel setzte ein, als ein Hungernder dem anderen etwas aus der Schale zu stehlen versuchte. Auch ihrem Vater wurde der Beutel weggerissen. Wim fuhr herum. So wütend hatte Vincent ihn noch nie gesehen. Mit einem einzigen Faustschlag warf er den Dieb zu Boden und holte sich ihren Kornbeutel zurück.
»Wartet am Rande des Platzes auf uns!«, befahl Wim und gab Ruben den Beutel. Was hatte er vor?
Die Geschwister konnten gerade noch Abstand zwischen sich und die Prügelnden bringen, ehe sie selbst Schläge abbekamen, denn die Wachen trieben die Menschen brutal auseinander. Im Schutz einer Mauer setzte Vincent seine Schwester ab. Sofort knickten ihre Knie ein. Betjes Augenlider flatterten, ihr Mund stand offen.
Ihr Vater und Giambelli befragten in einiger Entfernung Dirck van Os, den Anführer der Stadtmiliz. Der Mann schien nur ausweichend zu antworten. Eine abgemagerte Dame versperrte Vincent kurzzeitig den Blick. Sie versuchte offenbar, ein feines Kleid gegen Korn zu tauschen. Eine andere verschwand mit einem Kerl in einem finsteren Winkel; wie eine Dirne sah sie nicht aus, wohl aber verzweifelt. Verlegen sah Vincent weg.
Endlich kamen Wim und Messere Giambelli zurück. Sie strebten aber nicht ihrem Haus entgegen, sondern der Kirche. Die Kinder eilten hinterher. Auf dem Weg diskutierten die Männer heftig. Vincent schnappte nur Gesprächsfetzen auf; anscheinend war der Antwerpener Bürgermeister kurz davor, einen Vertrag mit dem Prinzen von Parma zu schließen, der im Auftrag des spanischen Königs die Stadt belagerte. Vincent brannte darauf, mehr erfahren.
Vor der Tür wurde Messere Giambelli von der Gattin des Zuckersieders aufgehalten; sie jedoch gingen hinein. Der Tempel wirkte kahl, wie so oft, wenn aus katholischen Kirchen die papistischen Altäre und Heiligenbilder entfernt worden waren. Ihr Glaubensvater Calvin hatte sie gelehrt, ihr Gotteshaus nicht mehr Kirche, sondern Tempel zu nennen, was manchem Gläubigen schwerfiel. An einer Wand hing eine Tafel mit den zehn Geboten. In dem schlichten, weiten Raum war es angenehm kühl, dennoch war die Stimmung hitzig. Weitere Gemeindemitglieder, wie Kees’ Vater, hatten sich eingefunden. Sie diskutierten aufgewühlt, der Zuckersieder mit Mevrouw Dhaen, der Witwe des Seidenwebers, aber auch einfache Arbeiter mischten sich ein. Einzelne Frauen brachen in Tränen aus, weil sie fürchteten, ihre Ehre, ihre Heimat oder gar ihr Leben zu verlieren.
»Italiener, Spanier – die sollen verschwinden! Warum glauben die überhaupt, über uns herrschen zu dürfen?!«, schimpfte Ruben. »Und wann essen wir endlich?!« Er presste das Säckchen an seine Brust.
Vincent setzte Betje behutsam ab; sie sollte schnellstmöglich etwas in den Magen bekommen und dann wieder ins Bett. Gerade als er seinem Bruder die komplizierten Zusammenhänge erklären wollte, kehrte Ruhe ein. Der Dominee und die Diakone waren in die Kirche getreten. Sogar Ruben nahm Haltung an, denn Ysebrandus Frisius und Gaspar van der Heyden waren ebenso gelehrte wie strenge Kirchherren. Sein Lehrmeister begrüßte Vincent flüchtig. Diakon Godlef war ein kleiner, kugeliger Mann, dessen Gleichmut kein Schülerstreich erschüttern konnte. Die letzten Wochen hatten jedoch nicht nur seiner Figur zugesetzt.
Nach dem Gottesdienst berieten die Erwachsenen lange. Vincent liebäugelte immer wieder mit dem Gedanken, sich einfach mit seinen Geschwistern hinauszustehlen; er wollte aber nicht den Unwillen der Geistlichen erregen. Schließlich strebten die Erwachsenen auseinander.
Als Wim Aardzoon sich seinen Kindern zuwandte und Messere Giambelli ihm folgte, hielt Gaspar von der Heyden die Männer auf. Nun konnte Vincent seine Worte verstehen: »Tut, was Ihr könnt, um uns zu retten. Ihr habt es gehört: Jeder von uns wird alles daransetzen, Eure Mission zu unterstützen.« Er berührte die Ellbogen der Männer. »Ihr seht an mir, was der Glaube und ein starker Wille vermögen. Ein einfacher Schuhmacher war ich, und ich habe mich selbst zum Pfarrer ausgebildet, um Gottes Segen weiterzugeben.«
»Eure Leistung in Ehren, aber wenn wir nicht zwei Schiffe …«, begann Wim.
Gebieterisch hob der Geistliche die Hand. »Die Schiffe werden sich finden. Der Herr wird für die Seinen sorgen. Macht Euch an die Arbeit, die Zeit drängt.«
Wim Aardzoon schien ihre Mahlzeit vergessen zu haben. Noch immer ging er nicht nach Hause. Ratlos und aufgeregt nahm Vincent seine Schwester huckepack und folgte ihm. Messere Giambelli redete auf Wim ein.
Unvermittelt nahm der Vater Vincent das Mädchen wieder ab. »Lauft los, und ruft einige Freunde zusammen. Wir treffen uns beim nächsten Glockenschlag in Federigos Werkstatt.« Er nannte ihnen Namen und die Häuser, in denen sie Bescheid geben sollten.
Ruben zögerte. »Und das Essen?«, fragte er mit Blick auf das Getreidesäckchen.
Ihr Vater nahm ihm den Beutel ab. »Wenn ihr wieder da seid, bereiten wir gemeinsam die Mahlzeit.«
Messere Giambellis Fachwerkhaus befand sich am Ende einer Sackgasse am Hafen, der angebaute Werkstattschuppen grenzte direkt an einen Fleet. Vincent war außer Atem, als er nach seinen Botengängen am Hafenrand ankam, und die Neugier darauf, was er heute in der Werkstatt zu sehen bekommen würde, verdrängte beinahe den nagenden Hunger. Er hatte seinen Vater ab und zu begleitet, wenn dieser mit Giambelli zusammengearbeitet hatte. Die Wände der Werkstatt waren mit Konstruktionszeichnungen und Berechnungen gepflastert, und immer, wenn sich die Gelegenheit bot, hatte Vincent den Mechaniker dazu befragt. Federigo sei ein genialer Tüftler, hatte sein Vater einmal gesagt, habe aber zwei linke Hände, weshalb sie sich perfekt ergänzten. Das war nur die halbe Wahrheit, denn sein Vater war nicht nur ein guter Handwerker. Vincent wusste, dass er ebenfalls ein Buch mit Konstruktionszeichnungen und Briefen besaß. Das Notizbuch war mit einem Lederband umschnürt und wurde wie ein Schatz gehütet.
Auf Regalen standen Flaschen, Tontöpfe und Glaskolben, daneben mehrere Waagen und Kessel. Alle Instrumente, die Giambelli besaß, waren ausgesprochen schön, das war Vincent schon früher aufgefallen. Ein Holzgerüst, das wie ein Wagenrad mit seltsamen Speichen aussah, nahm den Großteil der Werkstatt ein. Vater hatte die einzelnen Teile und zuletzt die Verstrebungen gedrechselt. An den Rändern hingen Gewichte.
Fasziniert untersuchte Vincent die Konstruktion. »Wozu sind diese Gewichte da? Werden sie dafür sorgen, dass sich die Maschine bewegt?«, fragte er, obgleich der Mechaniker gerade in einer Kiste kramte.
Messere Giambelli richtete sich auf und warf eine Kupferkanne hinter sich. Überhaupt sah es im Haus des Mechanikers wüst aus. Anscheinend hatte diese Unordnung damit zu tun, dass Messere Giambellis Frau, eine Dame aus einer angesehenen Antwerpener Familie, sich außerhalb der Stadtgrenzen in Sicherheit gebracht hatte.
Ungeduldig wuchtete der Mechaniker die Kiste hoch. Als er sie kurzerhand auskippte, flogen seltsame Gerätschaften durcheinander. Er pickte einige metallene Teile heraus, darunter Rädchen mit kleinen Zähnen. »Da ist es ja – wusste ich es doch!«, sagte er erfreut und wandte sich dann Vincent zu. »Hattest du etwas gefragt?«
»Ich wollte wissen, was der Nutzen dieser Gewichte …«
»Die Gewichte werden dafür sorgen, dass das Perpetuum mobile sich bewegen und Arbeiten verrichten wird, ohne dass der Mensch etwas dazu beitragen muss. Nicht mehr lange, und …«
In diesem Augenblick trat Wim hinzu. »Wir müssen diese Maschine sofort abbauen, um Platz zu schaffen. Andere Dinge sind jetzt wichtiger!«
»Wichtiger? Wie kannst du das sagen!«, protestierte Messere Giambelli. »Das Perpetuum mobile könnte eines Tages all unsere Probleme lösen! Es könnte Kriegsmaschinen antreiben, die Waffenherstellung beschleunigen …«
Wim wandte sich an Vincent. »Betje habe ich in die Schlafkammer gelegt. Du und Ruben, ihr bereitet den Getreidebrei, damit wir etwas in den Magen bekommen, ehe die anderen hier sind.«
Die Jungen gingen in die Kochnische. Um den Herd anzufeuern, mussten sie in Ermangelung von Brennholz einen alten Stuhl zerschlagen, was Ruben mit Begeisterung übernahm; dann warfen sie das Getreide in den Topf und füllten ihn mit Wasser. Während sie darauf warteten, dass Blasen auf der Wasseroberfläche auftauchten, sagte Vincent: »Du hast gefragt, warum Spanier und Italiener glauben, über uns bestimmen zu können …«
»Ich weiß schon, warum«, ging Ruben dazwischen. »Ich bin doch nicht blöd.«
Unbeirrt fuhr Vincent fort: »Das Haus der burgundischen Herzöge von Valois, hat vor etwa zweihundert Jahren die siebzehn niederländischen Provinzen durch Heiraten und Verträge vereinigt. Als irgendein Herzog – wer war es noch gleich? –, ach ja, Karl der Kühne, starb, fielen die Niederlande dem Haus Habsburg zu.«
»Du brauchst gar nicht so geschwollen daherreden, nur weil du schon ein paar Jahre länger zur Schule gehst!«
Vincent ließ sich nicht provozieren und rührte gewissenhaft weiter. »Alessandro Farnese, der Prinz von Parma, ein Neffe des spanischen Königs Philipp II., soll jetzt die gesamten Niederlande unterwerfen, das weißt du also auch?«
»Klar, Farnese ist ein Nachfolger dieser Mörder, die für die Spanische Furie verantwortlich waren«, stieß Ruben verächtlich hervor.
Die Spanische Furie. Der Gedanke daran ließ die Brüder verstummen. Vincent erinnerte sich nicht daran, er war zu klein gewesen, aber ihre Eltern hatten oft von den grausigen Ereignissen berichtet, die sich vor neun Jahren zugetragen hatten. Im Jahr 1576 hatten König Philipps Truppen wegen des Staatsbankrotts keinen Sold erhalten und Städte und Landstriche geplündert. Am schlimmsten hatten sie in Antwerpen gewütet. Sie hatten geraubt, geschändet, gebrandschatzt und gemordet. Achttausend Menschenleben waren damals ausgelöscht worden, hieß es. Ihre Eltern hatten sich nur retten können, weil ein Nachbar, der jüdische Diamantenschleifer Elim, sie in sein Kellergewölbe gelassen hatte. Sogar Katholiken waren über die Brutalität ihrer Glaubensbrüder erschrocken. Als Folge der Spanischen Furie hatten sich fast alle niederländischen Provinzen zum Freiheitskampf gegen den spanischen Herrscher entschlossen. Schließlich hatten die acht Provinzen Brabant, Geldern, Flandern, Holland, Zeeland, Friesland, Mechelen und Utrecht König Philipp II. abgesetzt und sich in der Plakkaat van Verlatinghe für unabhängig erklärt; erst im letzten Jahr hatte ihr Lehrmeister sie die Namen und Daten auswendig lernen lassen. Ein Statthalter sollte über die Provinzen herrschen, doch nach dem Verrat des Herzogs von Anjou, des Bruders des französischen Königs, war dieser Posten umstritten.
»Weißt du, was ich nicht begreife? Was will König Philipp mit Antwerpen, wenn wir verhungern?«, riss Ruben Vincent aus seinen Gedanken.
Eine samtige Stimme gab ihm die Antwort. Ihr Vater sprach; sie hatten nicht bemerkt, dass er in der Nähe der Küche war. »Lass dir nicht einreden, dass es hier um den Glauben geht, mein Sohn. Es geht nur um Geld – der spanische König ist mal wieder bankrott, seine Schatztruhe ist leer. Antwerpen war bis zur Belagerung das Warenhaus der Welt. Die reichste Stadt mit der größten Handelsbörse. Wichtiger als Venedig, Brügge oder Brüssel. Hier gibt es portugiesische Gewürze, schwedisches Kupfer, Seide, Diamanten und lehrreiche Drucke. Im letzten Jahr wurden noch an die neunzigtausend Einwohner gezählt. Wer könnte König Philipp die Taschen füllen, wenn nicht die Antwerpener?«
Vincent wunderte sich über die ausführliche Antwort seines Vaters. »Aber warum zerstört er unsere Stadt, wenn er sie doch ausbeuten will?«, fragte er, während er erleichtert feststellte, dass das Wasser kochte und das Getreide langsam aufquoll; sein Hunger war unerträglich geworden.
»König Philipp schafft sich eine Machtbasis. Ihm haben wir ja auch den Tod unseres Statthalters zu verdanken. Gott habe Wilhelm von Oranien selig«, sagte Wim bitter.




























