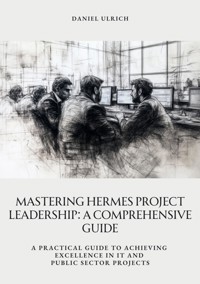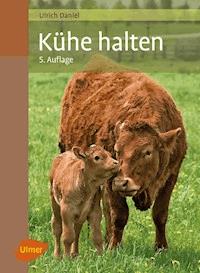
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Alles rund um die richtige Haltung von Kühen: Das Buch vermittelt anschaulich und gut lesbar die theoretischen Grundlagen der Rinderhaltung. Viele praktische Hinweise machen das Buch zu einem idealen Ratgeber für den angehenden Rinderhalter und jeden, der über die Haltung von Kühen nachdenkt. Folgende Bereiche zum Thema Rinder werden umfassend angesprochen: Tierpsychologie, Anatomie und Physiologie, Züchtung, Ernährung, Haltungsansprüche, Jungviehaufzucht, Milchverarbeitung und die gesetzlichen Vorschriften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ulrich Daniel
Kühe halten
5. Auflage
58 Farbfotos
36 Zeichnungen
20 Tabellen
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Vorwort
Die Kuh und der Mensch
Vom Auerochs zum Haustier
Etwas über die Seele der Kuh
Der Umgang mit der Kuh
Voraussetzungen für die Haltung einer Kuh
Die Kuh und ihr Körper
Bau und Funktion des Körpers
Das Euter
Die Verdauungsorgane
Pansen
Verdauungsstörungen des Pansens
Netzmagen
Blättermagen
Labmagen
Sonderausstattung beim säugenden
Kalb Aufbau und Funktion des Darmbereiches
Gesundheit und Krankheit
Auch die Kuh braucht Körperpflege
Die Kuh und die Züchtung
Einiges über Rinderrassen
Rassen im Porträt
Welche Rasse halten?
Leistungsvermögen und seine
Beeinflussung Genomische Selektion
Kreuzungszucht
Die Kuh und ihre Ernährung
Pansenphysiologische Grundlagen
Energiebewertung
Zusammensetzung der Futter-
mittel Nährstoff- und Energiegehalt der
Futtermittel Bedarfsnormen für Milchkühe
Rationsberechnung
Grundsätze der Milchviehfütterung
Die Futtermittel
Einige Rationstypen
Futtervoranschlag
Fütterungstechnik
Futtermittel, die gefährlich werden können
Die Kuh und ihre Umwelt
Die Kuh auf der Weide
Die Wohnung der Kuh
Stallsysteme
Mist wird immer gemacht
Die Kuh und ihr Nachwuchs
Das Sexualleben der Kuh
Ein Kalb wird geboren
Die Aufzucht der Jungtiere
Die Kuh und ihre Produkte
Melken – die tägliche Arbeit
Milch – ein empfindliches Produkt
Was macht man mit der Milch?
Die Kuh und die Verwaltung
Gesetzliche Vorschriften
Tierzuchtorganisationen und Beratungsdienste
Serviceseiten
Literatur
Adressen
Bildquellen
Impressum
Vorwort
Zur fünften Auflage
Die Kuhhaltung, wie sie sich der Normalbürger immer noch vorstellt, hat sich in den letzten zwanzig Jahren grundlegend gewandelt. Kleine Herden, die friedlich am Waldesrand grasen, gibt es immer weniger. Stattdessen ist der Vollerwerbs-Kuhhalter durch die Marktverhältnisse gezwungen, seinen Bestand in Größenordnungen zu betreiben, die man sich noch vor dreißig Jahren bestenfalls in Neuseeland vorstellen konnte. Der Anstieg der Bestandsgrößen geht parallel einher mit einem Rückgang der Anzahl der Betriebe.
Früher hatte jeder Dorfbewohner zumindest landwirtschaftliche Grundkenntnisse. Geht der Kontakt zwischen Landwirt und Verbraucher verloren, schwinden auch die Kenntnisse des Normalbürgers über Landwirtschaft, selbst auf dem Lande.
Die gedankliche Konzentration der Fachautoren auf den Großbetrieb führt auch dazu, dass es Literatur für den kleineren Betrieb so gut wie nicht mehr gibt. Diese Lücke sollte das vorliegende Buch unter anderem schließen. Die Grundlagen gelten jedoch für alle Kühe, ob sie in einem Bestand mit hundert oder in einem mit zwei Kühen stehen und ebenso, ob der Betrieb ökologisch oder integriert wirtschaftet.
Gleichzeitig gibt es auch außerhalb der Landwirtschaft Menschen, die sich für Rindvieh interessieren. Um diesem Publikum diese sympathischen und nützlichen Tiere näherzubringen, wurde versucht, möglichst umfassende Informationen unterhaltsam und lesbar darzustellen – von der Tierpsychologie über Körperbau und -funktionen bis zur praktischen Fütterung, zur Grünlandpflege und zur Milchverarbeitung. Neben der Vermittlung von Kenntnissen auf diesem Gebiet soll auch die Achtung vor dem Beruf des Landwirts gestärkt werden.
Ulrich Daniel
Euskirchen
Die Kuh und der Mensch
Ohne Kuh hätten die alten Germanen keine Götter gehabt, oder hätten sich anderswoher welche besorgen müssen, denn in der Edda steht, eine Kuh habe die Götter aus salzigen Eisblöcken hervorgeleckt. So durfte denn auch eine Kuh den Wagen der Erdgöttin Nerthus ziehen.
Die Entstehung der germanischen Götterwelt, wie man sie aus dem Sagenbuch kennt, muss also relativ spät erfolgt sein, denn das Rind taucht als Haustier in Norddeutschland und Südskandinavien erst gegen Ende des 4. Jahrtausends vor Christus auf. Die ältesten Funde von Rindern stammen aus dem Ost-Irak, vom Fuße der kurdischen Berge.
Vom Auerochs zum Haustier
Die Radiokarbonmethode weist auf die erste Hälfte des 7. Jahrtausends. In Ägypten taucht das Rind in der vordynastischen Zeit um 5000v.Chr. auf. Als Stammvater wird allgemein der Ur oder Auerochs betrachtet. Andere Vorfahren lassen sich nicht nachweisen. Er kam überall in den Baum- und Waldgebieten Europas, Asiens und Nordafrikas vor.
Info
Mit 175 bis 200cm Schulterhöhe bei den Bullen und 150 bis 170cm bei den Kühen waren Auerochsen für den Steinzeitmenschen eine schöne Portion Fleisch – wenn man sie erlegen konnte. Mit Steinspeer und Pfeil und Bogen erforderte es schon eine Portion List und Mut, solch ein schnaubendes, blitzschnelles Ungetüm zu jagen.
Was mag den Menschen dazu bewogen haben, sich ein solches Untier als Haustier auszusuchen, früher sogar als Schaf und Ziege? Vielleicht gibt uns der Wagen der Göttin Nerthus Auskunft: man brauchte es zur Arbeit. Jäger und Sammler aber brauchen keine Arbeitstiere. Also müssen es Ackerbauern gewesen sein, die sich dieser schweren Aufgabe unterzogen, vielleicht weil einer den Hakenpflug erfunden hatte und keiner ihn ziehen wollte.
Es muss aber auch eine gut organisierte Gesellschaft gewesen sein, die etwas Futterbau betrieb, denn die großen Futtermengen, die diese Tiere benötigten, wuchsen nicht am Wegrand. Immerhin waren die Auerochsen um einen Kopf größer als unsere heutigen Hausrinder, und die fressen schon 75kg Gras am Tag. Während die Urrinder sich unter der Obhut des Menschen schnell weiterentwickelten, ging die Zeit des Auerochsen allmählich zu Ende. Die Jagd und die Umgestaltung der Umwelt mit zunehmender Besiedlung nahmen ihm nach und nach den Lebensraum.
Info
In Frankreich verschwand der letzte Auerochse im 13. Jahrhundert. In Niederbayern wird von ihm noch im 15. Jahrhundert berichtet. Die letzte Urkuh starb 1627 in Polen.
Entwicklung des Urrindes zum Hausrind
Noch war das Rind von seiner heutigen Hauptaufgabe, der Milchproduktion, weit entfernt. Noch molk man lieber Schafe, Ziegen, Kamele, Rentiere und sogar Stuten. Die Kuh war Trag-, Zug- und Fleischtier. Ihre Entwicklung vollzog sich jedoch relativ schnell. Schon der Auerochs zeigte genetisch starke Variabilität und kam in den verschiedenen Gegenden in unterschiedlichen Schlägen vor, die zum Ausgangsmaterial der lokalen Rassen wurden.
In der Hand des Menschen, in kleinen Herden, kam es viel öfter zu Verwandtschaftspaarungen, zu Inzucht und damit zu einer Konzentration bestimmter Erbanlagen. Dann paarte man Tiere, die sich in bestimmten Merkmalen ähnelten. So entstanden, sicher auch durch einige Mutationen, die unterschiedlichsten Rassen.
Schon aus dem alten Rom sind mehrere Rinderrassen belegt. Es gab dort übrigens eine entwickelte Milchwirtschaft, aber nur in der Nähe der Städte, denn Kühlung war kaum möglich. Weiter entfernt von den Ballungsgebieten wurde Käse gemacht. Das weiß man unter anderem daher, dass Kaiser Diocletian (284–305n.Chr.) eine Höchstpreisverordnung für Käse erließ.
Bis zum frühen Mittelalter ging es der Kuh gut. Es gab relativ wenige Menschen und viel extensiv genutztes Weideland. Aber dann, so um das 13. Jahrhundert, wuchs die Bevölkerung, es wurde mehr Getreide benötigt, Weideland wurde umgebrochen und das Vieh auf das schlechteste Land verdrängt. Ackerfutterbau kannte man nicht, und so musste das Vieh auf Hutungen, Brachflächen oder sogar in den Wäldern sein Futter suchen.
Die Folge war, dass das Rind immer mehr degenerierte. Hatten die Kühe in der Jungsteinzeit noch eine Höhe bis zu 138cm, so betrug sie gegen Ende des Mittelalters nur noch 95–105cm. Eine ausgewachsene Kuh wog gerade 100–200kg. Eine kräftige Kuh wiegt heute um die 650kg.
Anpassungen
Nur in Gebieten mit Böden, die für den Ackerbau nicht geeignet waren und trotzdem guten Futterwuchs boten, bildeten sich Rassen mit hohen Produktionseigenschaften. Dazu gehörten die Küstengebiete Hollands und Deutschlands, einige Mittelgebirgslagen und der Alpenraum.
In den anderen Gebieten bildeten sich Landrassen heraus, die sich an die schlechten Produktionsbedingungen angepasst hatten. Besonders der Winter war für die Tiere ein harter Prüfstein. Viele waren im
In Frankreich verschwand der letzte Auerochse im 13. Jahrhundert. In Niederbayern wird von ihm noch im 15. Jahrhundert berichtet. Die letzte Urkuh starb 1627 in Polen.
Neues Bewusstsein
Landrassen werden wegen ihrer genetischen Reserven heute wieder geschätzt. Man versucht, die Rassen zu erhalten, von denen es noch genügend Vertreter gibt.
Frühjahr so schwach, dass sie am Schwanz aus dem Stall auf die Weide gezogen werden mussten; man sprach dabei von „Schwanzvieh“. So war es kein Wunder, dass auf diese Weise eine Selektion auf Genügsamkeit erfolgte. Das Wäldervieh im Schwarzwald ist vielleicht ein Beispiel für das Ergebnis einer solchen Auslese. Die meisten Landrassen aber sind seit etwa 1920 inzwischen weitgehend verschwunden.
Im 18. Jahrhundert verbesserte sich die Situation. Seit Karl dem Großen hatte man Dreifelderwirtschaft betrieben: Wintergetreide, Sommergetreide und Brache folgten regelmäßig aufeinander. Auf die Brache wurde vor dem Pflügen zu Wintergetreide Mist gefahren – wenn es welchen gab, und das war oft genug nicht der Fall. Auf der Brache durfte das Vieh weiden, nämlich das bisschen Unkraut, das dort wuchs.
Nun wurde die „verbesserte Dreifelderwirtschaft“ eingeführt. Statt der Brache wurde Rotklee eingeschaltet, ein Stickstoffsammler und ein hervorragendes Viehfutter. Jetzt zeigten die Rassen aus den Grünlandgebieten, was sie konnten. Die Landrassen konnten leistungsmäßig nicht mithalten und wurden nach und nach verdrängt. Im Norden setzten sich Schwarzbunte und Rotbunte, in Süddeutschland Simmentaler (Fleckvieh) und das Braunvieh durch.
Etwas über die Seele der Kuh
Das Rind, das wir heute im Stall haben, ist von den Urrindern in seinem Wesen meilenweit entfernt. Das ursprüngliche Temperament ahnt man, wenn man südländische Kampfrinder sieht. Unsere Milchrinder sind dagegen phlegmatische, friedliche Zeitgenossen. Bösartige Bullen werden seit sehr langer Zeit von der Zucht ausgeschlossen, sodass eine ständige Selektion auf Umgänglichkeit erfolgt. Dennoch ist einiges von der Verhaltensweise der Wildrinder übrig geblieben und wir können für Umgang und Haltung sehr viel daraus ableiten.
Die Kuh als Individuum
Die Lautäußerungen haben sich wahrscheinlich am wenigsten verändert. Zwei normale Laute werden unterschieden: einzelnes, hohes Muhen und tiefes, lautes Muhen aus voller Brust. Letzteres ist Fern- und Orientierungsruf. Zwischendurch gibt es auch schnell hintereinander folgendes Muhen, fast als ob ein Esel schreit. Schmerzäußerungen gehen vom tonlosen Stöhnen bis zum Brüllen vor Schmerz, etwa bei Schwergeburten.
Die Bewegungen sind in der Regel gemessen, sodass der Unkundige sich fragt, ob diese schwerfälligen Wesen – schon Homer spricht vom schwer wandelnden Hornvieh – überhaupt ihre Umwelt mit Interesse betrachten. Das zeigt sich aber schon, wenn man an einer Weide entlanggeht, zu der selten Menschen kommen. Dann steht die ganze Herde am Zaun und begleitet einen neugierig bis in den letzten Winkel. Auch Freude ist dem Rindvieh nicht unbekannt. Besonders beim Weideauftrieb veranlasst die neu gewonnene Freiheit selbst alte Kuhdamen zu den albernsten Bocksprüngen. Und wenn ein ausgerücktes Tier diese Aktionen in Nachbars Vorgarten ausführt, ist ein Telefongespräch mit der Haftpflichtversicherung angebracht.
Der liebliche Wechsel von Wald und Grünland in den Mittelgebirgen ist durch die Rindviehhaltung entstanden. Verschwindet das Vieh, entwickelt sich eine Buschlandschaft.
Das Hauptinteresse aber liegt bei einem Pflanzenfresser auf dem Gebiet der Nahrungsaufnahme. Dabei wird das Futter mit dem feinen Geruchssinn geprüft. Es gibt Lieblingsgerüche und solche, die die Kuh überhaupt nicht mag.
Info
Anisgeruch scheint für Rinder das zu sein, was für Kinder der Ketchup ist, denn damit kann man alles genießbar machen. Die Mineralfutterhersteller würzen ihre Mischungen, die die Kuh sonst sicher nicht aufnähme, mit Anisöl. Höchstens das enthaltene Salz könnte sie auch noch einigermaßen locken.
Großen Abscheu hat die Kuh vor tierischen Fetten. Das Fett braucht nicht im Futter selbst zu sein. Es genügt schon, wenn das Futter in Behältern transportiert wird, in denen sich vorher beispielsweise Hähnchenmastfutter befand.
Auch Giftpflanzen identifiziert die Kuh mit der Nase. Viele solcher Pflanzen sind im konservierten Zustand zwar nicht mehr gefährlich, aber Heu mit Duwock (Sumpfschachtelhalm) braucht man ihr gar nicht anzubieten.
Andererseits beobachtet man auch seltsame Fressgewohnheiten. Eine Jacke oder ein Hemd in erreichbarer Nähe einer Kuh wird mit ziemlicher Sicherheit ihr Opfer. Sie versucht, solche Gegenstände langsam herunterzukauen, und in vielen Fällen kostet es ihr Leben. Vor allem herumliegende große Plastiktüten werden oft gefressen und verschließen dann den Pansenausgang. Nur eine Operation kann dann noch helfen.
Aufstehen und Hinlegen
Der Ablauf beim Aufstehen ist folgendermaßen: Die Kuh stützt sich erst auf die „Knie“, richtet sich dann hinten auf und schließlich vorn.
Jede andere Aufstehensweise ist anormal und oft Anzeichen einer Gesundheitsstörung, entweder einer Klauenerkrankung oder auch einer unterschwelligen Gebärparese (s. Kapitel „Milchfieber“).
Das Hinlegen läuft ähnlich ab: Erst geht sie vorn auf die „Knie“, dann lässt sie sich hinten nieder. Die letzte Phase geschieht oft recht schwerfällig – sie lässt sich einfach fallen.
In engen Liegeboxen kann das zu Prellungen und Blutergüssen an Rippen oder Hüftknochen führen.
Die Fressaktivität beginnt auf der Weide schon kurz nach Mitternacht. An langen, tiefen Schlaf ist da natürlich nicht zu denken. Vielmehr beschränkt sich die geistige Erholung der Kuh zumeist auf gelegentliches Dösen. Dann steht sie auf, biegt ihren Rücken durch, setzt meist Kot oder Harn ab und ist für ihr Tagwerk bereit.
Zwei gute Freundinnen.
Die Kuh als Herdentier
Auch Kühe begrüßen sich. Dabei wird der Mensch der Einfachheit halber auch als „Rindvieh“ behandelt. Die Kuh grüßt mit ausgestrecktem Hals und tief gehaltenem Kopf. Das ist Demuts- und Freundschaftsgeste zugleich. Weil ihr empfindliches Riechorgan dabei ganz vorn ist, ist diese Haltung auch für die Geruchsidentifikation gut geeignet.
Erweist sich der Mensch als fremd, werden erst einmal schleunigst einige Schritte rückwärts gemacht. Der unmittelbare Fluchtradius ist gut ein Meter. Das stellt man beim Einfangen fest. Nur gute Freunde, und das können auch Menschen sein, dürfen diese Distanz unterschreiten. Von einem Kuhhalter, der einer Kuh auf der Weide um den Hals fassen oder ihr ohne weiteres einen Zaum anlegen kann, kann man sagen, dass seine Kühe Familienanschluss haben. Solche Nähe geht dann oft in soziale Körperpflege über, wie man sie ja auch von Pferden kennt. Eine Kuh leckt dann der anderen das Fell. Auch der Mensch wird in solche rauzungigen Freundschaftsbeweise einbezogen. Oft ist aber auch das Verlangen nach Salz der selbstsüchtige Grund für das Belecken.
In der großen Gruppe wird das alte Herdenverhalten der Wildrinder wieder sichtbar. Alles, was sich als Aussichtspunkt eignet, wird erklettert. Ist irgendwo ein größerer Erdhügel auf der Weide von einem Bagger zusammengeschoben, etwa um für ein Fahrsilo auszuschachten, steht garantiert kurze Zeit später eine Kuh darauf.
Gut zu wissen
Fahrsilos müssen gut eingezäunt werden, sonst turnen irgendwann zum maßlosen Entsetzen des Eigentümers einige Rindviecher darauf herum.
Die Herde hat eine fest ausgeklügelte Hierarchie. Läuft ein Bulle mit der Herde, ist er in der Regel der Chef. Bei Bullengruppen, etwa in Mastställen oder bei Weidebullenmast, übernimmt nach einigen Rangeleien einer das Amt des Herdenführers. Dieser ist es dann, der als einziger in der Gruppe ein mächtiges Imponiergehabe an den Tag legt.
Wichtig
Wer als Fremder eine Weide mit Bullen betritt, ist in Lebensgefahr. Auch der ständige Betreuer der Herde sollte sich nicht allzu sicher sein. Und ob im Ernstfall der oft gehörte Ratschlag hilft, still stehen zu bleiben – ich weiß nicht, ob der Bulle die Regel kennt!
Scheidet dieser aus, etwa, weil der Bauer den „bösen Bullen“ zum Schlachten verkauft, hat nach einigen Tagen ein anderer seine Nachfolge angetreten. Der Bulle als Leiter einer Kuhherde sorgt für Ordnung, vor allem hält er das Revier sauber. Nach dem Umzug auf eine neue Koppel ist er zunächst noch zurückhaltend. Die hastige Bewegung eines Spaziergängers lässt ihn noch zusammenschrecken. Dann aber beginnt er, am Zaun entlangzugehen und durch gelegentliches Muhen zu verkünden, dass im Revier ein neuer Boss das Sagen hat. Am nächsten oder übernächsten Tag kann ihn der Spaziergänger nicht mehr erschrecken. Der Bulle stellt sich seitwärts zu ihm, um ihm zu zeigen, wie groß und lang er ist.
Dasselbe Verhalten zeigen Kühe und Bullen zueinander, wenn die Rangordnung nicht klar ist. Wenn jetzt der Pilzsammler die Weide betritt, wird er sie auch schnell wieder verlassen.
Die Abwehr von Eindringlingen richtet sich offenbar auch nach deren Größe. Weibliches Jungvieh wird wohl nie einen Menschen angreifen, sondern ihn nur umtanzen. Ein kleiner Hund aber, der sich darüber freut, dass diese großen Tiere vor ihm davonlaufen, sieht sich plötzlich eingekreist wie früher der Wolf von den Wildrindern. Wie auf Kommando gehen plötzlich alle Tiere mit gesenkten Hörnern auf ihn los, und er kann froh sein, wenn er unbeschädigt wieder bei Frauchen landet.
Auch unterhalb der Chefetage gibt es keine klassenlose Gesellschaft – meist ist ja kein Bulle bei der Herde. Jedes Tier hat ein festes Rangverhältnis zu den anderen. Die Rangordnung ist aber nicht gleichmäßig von 1 bis n, sondern viel komplizierter. Frieda kann über Emma dominieren, Emma über Dora; gleichzeitig kann aber Frieda der Dora aus dem Wege gehen. Diese Rangordnungsverhältnisse äußern sich besonders beim Fressen. Das kann so weit gehen, dass in Laufställen mit wenigen Fressplätzen ranghohe Tiere sich einfach quer vor die Krippe legen und die anderen warten können, bis Madame geruhen, wieder etwas spazieren zu gehen.
Störungen der Rangordnung führen meist zu Kampfhandlungen. Ein neues Tier in der Herde wird mit Drohgebärden an den letzten Platz verwiesen. Kommen mehrere neue Tiere hinzu oder geraten zwei Herden durcheinander, sind die Neulinge selbstbewusster. Sie versuchen sofort, sich einen höheren Rangplatz zu erkämpfen. Es entbrennt ein Horngefecht, das oft mit Schmarren und abgedrehten Hörnern endet. Enthornte Herden sind durchweg viel friedlicher.
Die Wildrinderherde zog ohne Standrevier langsam von Ort zu Ort, um den Grasvorräten zu folgen. Dieses Nomadenblut steckt auch in unseren Rindern. Ausgebrochene Tiere kehren nicht brav wie das treue Pferd des Sheriffs im Film nach Hause zurück, sondern entfernen sich friedlich grasend immer weiter von ihrer zugewiesenen Heimat. Das geht so weit, dass Tiere in den Wäldern verschwinden und nur zufällig aufgegriffen werden. Sie sind dann „Fundsache“ und es ist gut, wenn sie unverwechselbar gekennzeichnet sind.
Info
Die Gefahr des Ausbrechens von Rindern ist besonders hoch bei Wasser- und Futtermangel. Es gibt aber auch ausgesprochene Durchgänger, die sich den Teufel um Elektrozaun oder Stacheldraht scheren.
Aus dem bisher Gesagten ist wohl deutlich geworden, wie sehr die Kuh ein Sozialwesen ist. Bei Einzelhaltung sollte man dies berücksichtigen und ihr nach Möglichkeit Gesellschaft verschaffen. Das kann ein Pony, ein Schaf oder auch ein Jungrind sein. Letztere haben aber oft ihre Kindheit nicht vergessen und fangen an, an den Kühen zu saugen. Solch ein Melkkonkurrent ist unangenehm. Um dem abzuhelfen, gibt es für die Jungrinder, die diese Angewohnheit haben, Halfter oder Nasenklammern mit Dornen, die die Kuh am Euter pieksen und sie zum Ausweichen veranlassen.
Die Kuh als Mutter
Einen Großteil des Mutterverhaltens kann man heute nur noch bei Fleischrinderrassen beobachten, bei denen die Kälber saugen dürfen, weil die Kühe nicht gemolken werden. In der Natur sondert sich die Kuh kurz vor der Geburt von der Herde ab und sucht sich ein geschütztes Plätzchen. Die Geburt dauert, wie bei allen Wiederkäuern, sehr lange.
Nach der Geburt, die meist im Liegen erfolgt, steht die Kuh auf und beginnt, das Kalb abzulecken. Dabei wird der Körper des Kalbes kräftig massiert und die Atmung angeregt. Nach einer halben Stunde versucht das Kalb aufzustehen, und wenn es ihm gelungen ist, wandert es mit unsicheren, staksigen Schritten an der Kuh entlang und sucht in allen Körpernischen nach der Nahrungsquelle. Spätestens eine Stunde nach der Geburt hat es das Euter gefunden und versorgt sich mit der lebenswichtigen Kolostralmilch (s. Kapitel Milch).
Alle diese Tatsachen sollte man bei der mutterlosen Aufzucht, die ja die Regel ist, berücksichtigen und die Natur nachahmen. Beim Trinken steht das Kalb mit dem Hinterteil zum Kopf der Mutter. Sie beriecht es und identifiziert das Kalb als ihr eigenes. Sind mehrere Kühe da, die Milch geben, gehen die Kälber auch schon einmal an die Milch von Frau Nachbarin. Dabei gehen sie dann gewöhnlich von hinten an die Kuh heran.
Es ist wie beim Menschen, wenn es etwas Gutes gibt, kehrt auch der große Sohn zur Mutter zurück.
Vorstellung des neuen Herdenmitglieds
Wenn das Kalb seine ersten Mahlzeiten hinter sich hat, gesellt sich die Kuh wieder zur Herde. Alle anderen Kühe umstehen dann das Neugeborene und bestaunen das Wunder. Der Vorgang erinnert stark an die erste Ausfahrt eines Babys, wenn die Mutter einige ihr bekannte Frauen trifft.
In den ersten Tagen geht das Kalb etwa achtmal täglich an das Euter. Dabei ist es nicht zimperlich, sondern boxt zwischendurch kräftig ins Euter, um den Milchfluss anzuregen. Dieses Boxen geschieht auch beim Tränken aus dem Eimer. Mit der Zeit geht die Zahl der Milchmahlzeiten zurück. Nach einem halben Jahr sind es meist nur noch zwei. Wenn die Mutter wieder hochtragend ist, versiegt die Milch, und die Kindheit des Kalbes geht zu Ende.
Man könnte meinen, die moderne Haustierhaltung habe nichts mehr mit Wildrinderherden zu tun. Aber wenn man bedenkt, wie viele Verhaltensweisen auch des Menschen noch dieselben sind wie in der Urmenschengruppe, erkennt man, dass zu einer artgerechten Tierhaltung auch die Berücksichtigung der natürlichen, ursprünglichen Ansprüche an Umwelt und Ernährung gehören.
Der Umgang mit der Kuh
Nachdem klar ist, dass die Kuh ein Herdentier ist, hat derjenige die meisten Chancen, Sympathie bei ihr zu erwerben, der in ihren Augen Herdenmitglied ist. Das bedeutet häufigen Kontakt, auch wenn es einmal nichts bei den Tieren zu tun gibt.
Es ist nur natürlich, dass man vor einem Zwölfzentnertier einen gewissen Respekt hat. Richtig umgehen mit dem Tier kann erst, wer die Angst verloren hat. Das kommt aber erst nach häufigem Umgang mit Kühen, und deshalb sollte man ruhig in seiner Freizeit bei einem Bauern in der Nachbarschaft im Stall mithelfen. Dann verliert man auch die Scheu, dicht an ein sehr großes Tier heranzugehen. Nicht umsonst gehen Boxer bei einem schlagkräftigen Gegner in den Nahkampf. Wer nicht weit ausholen kann, kann auch nicht wirksam schlagen.
Gut zu wissen
Befindet sich ein Bulle zwischen der Herde, kann man vor einem Betreten der Weide grundsätzlich nur warnen (s. Kapitel „Das Sexualleben der Kuh“).
Verständlich ist die Sorge, ob Kinder nicht gefährdet sind, wenn sie mit Kühen umgehen. Sie sollten sich verhalten, als wären sie für die Kuh ein fremdes Kalb, das heißt, sie sollten ohne Hast auf ein bis zwei Meter an die Kuh herangehen und die Kuh auf sich zukommen lassen. Eine Handvoll Grünfutter ist dabei die Grundlage zur Freundschaft.
Allerdings kommen oft dann später die Tiere, besonders Jungtiere, in beängstigendem Galopp, um den Bekannten zu begrüßen und nachzusehen, was er Gutes mitgebracht hat.
Im Freien
Es gibt wohl nichts Wilderes als Jungvieh, welches ohne menschlichen Besuch den Sommer über auf einer abgelegenen Weide zugebracht hat. Will man davon eines einfangen, so ist der Effekt mindestens mit einem 5-km-Jogging vergleichbar. Ich habe dabei bei einigen Leuten die blanke Mordlust in den Augen gesehen. Ein stieriges Rind auf der Weide einzufangen, war auf meinem Lehrbetrieb ein Unternehmen für drei Männer, und bei allen dreien mit einem Beinahe-Herzinfarkt verbunden.
Gut zu wissen
Die gleiche Aktion bei einem befreundeten Landwirt in Nordschweden wird allein und ohne Hilfe absolviert. Das Geheimnis besteht darin, dass Letzterer jeden Tag, ob Sonne, ob Regen, seine Jungtiere auf der Weide besucht und ihnen etwas Getreideschrot im Eimer mitnimmt. Sie umdrängen ihn wie Kinder die heimkehrende Mutter. Auch Fremden gegenüber sind solche Tiere zutraulich.
Scheue Tiere, besonders solche, die den Menschen als knüppelschwingendes Wesen kennengelernt haben, zögern nicht, bei der Flucht, besonders in Zaunecken, über den Stacheldraht zu springen. Elegant geschieht das nicht und bei Kühen führt es fast regelmäßig zu üblen Euterverletzungen.
Manchmal bricht beim Rindvieh eine Massenhysterie aus, die sich in wilder Flucht äußert. Was bei den riesigen amerikanischen Wildwestherden als Stampede bezeichnet wird, kann in den kleinen europäischen Herden als sogenanntes „Birsen“ beobachtet werden. Sicher gibt es viele lokale Bezeichnungen dafür. Zum Teil wird es als Flucht vor dem Summen der Dasselfliege oder der Rinderbremse gedeutet. Jedenfalls ist eine Flucht oft durch das Summen eines stimmhaften -SSS- auszulösen. Es genügt, wenn jemand dieses Geräusch beim Einfangen von Rindern von sich gibt, um die ganze Gesellschaft mit erhobenem Schwanz davonstieben zu lassen.
Gut zu wissen
Beim Einfangen von Rindvieh sollte man sich betont langsam bewegen. Die Arme werden ausgebreitet, damit man wie ein ernstzunehmendes Hindernis aussieht. Das Tier wird ruhig, zusammen mit seinen Herdengenossen, wenn vorhanden, in eine Ecke getrieben, die man als Fangecke ausgestattet hat. Eventuell kann man ein Fahrzeug als dritte Seite an den Zaun setzen.
Zum kurzzeitigen Führen genügt ein Strickhalfter.
Angriffe hat man eigentlich nur zu fürchten, wenn eine Kuh mit Kalb bei Fuß und wenig Menschenkontakt auf der Weide läuft. Aber so ein Angriff wird in der Regel deutlich angekündigt.
Hat man das Tier schließlich am Halfter, so ist bei einem ungewöhnten Tier noch lange nicht alles gewonnen. Es prüft erst einmal, wer stärker und schneller ist. Die einzige Kopfhaltung, bei der es seine gewaltige Kraft nicht zur Entfaltung bringen kann, ist seitlich nach unten. Durch einige Ehrenrunden auf der Stelle kann man das Tier von der Sinnlosigkeit von Fluchtversuchen überzeugen. Gelingt es ihm, den Kopf in den Nacken zu bekommen, hält man es kaum noch.
Sind Tiere das Gehen am Halfter wirklich gewohnt, gehen sie meist wie ein Hund an der Leine. Selbst der stolze Bulle macht beim Führen wenig Umstände, nur sollte man ihn mit einer Führstange im Nasenring – dies ist Vorschrift! – auf Distanz halten. Seine freundschaftlichen Rippenstöße halten menschliche Rippen nicht immer aus, und ist noch eine Wand auf der anderen Seite, dann kann sich der menschliche Körperquerschnitt in lebensgefährlicher Weise verringern.
Info
Soll der Bulle vorübergehend irgendwo angebunden werden, so reicht ein Strick im Nasenring dafür in keiner Weise aus. Sein Freiheitsdrang kann stärker sein als die Schmerzen in der Nase. Man muss schon einen festen Bullenhalfter verwenden.
Bei Behandlungen benutzt man eine Nasenzange.
An der Nase sind natürlich auch weibliche Tiere empfindlich. Will man ein Tier festhalten, fasst man mit Daumen und Zeigefinger in die Nasenlöcher und hält mit der anderen Hand das äußere Horn fest. Der Kopf des Tieres muss dabei möglichst weit unten bleiben. Vom Augenverdrehen des Tieres sollte man sich dabei nicht beeindrucken lassen. Für längeres Halten, etwa bei tierärztlichen Behandlungen, gibt es sogenannte Nasenzangen. Da Kälber zu kleine Nasenlöcher haben, fasst man sie mit dem Daumen über den Unterkiefer ins Maul, dort, wo sie keine Zähne haben.
Im Stall
Auch im Stall heißt die Devise: Ruhe. Betritt man aber leise den Stall, so kann es geschehen, dass die Tiere bei der Annäherung erschrecken und einem schmerzhaft beibringen, sie das nächste Mal gefälligst vorher anzusprechen. Eine Kuh braucht zum Ausschlagen viel weniger Platz als ein Pferd. Ich habe einmal gesehen, wie eine Kuh einen Zinkeimer durch einen Schlag mit dem Hinterbein in ein flaches Oval verwandelt hat, und das Besondere gegenüber einem Pferd ist, dass Kühe auch nach der Seite schlagen können. In der Regel schlagen Kühe nicht, wenn sie nicht erschrecken und immer gut behandelt werden. Dennoch sollte man etwas vorsichtig sein.
Keinen Spaß verstehen Kühe, wenn ihnen etwas Kleines, Schnelles, etwa ein Ferkel oder ein Dackel unter dem Bauch herläuft. Dann bricht die pure Panik aus, und das kleine Tier ist in höchster Gefahr.
Will man zwischen die Kühe gelangen, etwa zum Melken, Putzen oder zum Einstreuen, sollte man in ruhigem Tonfall mit ihnen sprechen. Gehen sie nicht zur Seite, sind Knüppel oder Mistgabeln nicht das geeignete Treibmittel. Kräftige Schläge mit der flachen Hand überschreiten nicht ihre Schmerzschwelle, tun aber meist ihre Wirkung. Da ihnen der Herrgott aber nichts von Eile einprogrammiert hat, muss man manchmal auch etwas deutlicher werden.
Gut zu wissen
Das Hormon Oxytocin, das beim Melken die Milch fließen lässt, versiegt bei der Kuh beim geringsten Stress schlagartig, und die Kanne wird nur halb voll.
Wenn sie sich endlich herumbewegt haben, kommen sie oft genug auch wieder zurück und dann tut man gut daran, seine Füße in Acht zu nehmen, denn 600kg geteilt durch vier ergeben 150kg auf einem großen Zeh. Wer das nur einmal mitgemacht hat, vergisst es nie. Mir passierte es mitten im Auktionsring beim Vorführen. Das Fehlen einer geeigneten Waffe rettete der Kuh das Leben.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass ein gutes Betriebsklima im Kuhstall wichtig ist. Vor allem Milchkühe reagieren empfindlich auf unsanfte Behandlung.
Besonders wichtig ist Ruhe beim Anmelken von jungen Färsen. Ihnen ist das Melken etwas Neues, das Euter schmerzt noch, sie schlagen nach allem, was ihnen da am Euter herumspielt. Ist der Melker das Opfer, ist er leicht geneigt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Folge davon ist, dass das Melken lange Zeit zum Kampf mit unsicherem Ausgang wird. Das Einzige, was relativ sicher zum Erfolg führt, ist von Anfang an eine Schafsgeduld des Melkers.
Eine besondere Situation ist die Brunst. Die Kuh wird unruhig und fällt einem oft mit ihrem Gebrüll auf die Nerven. Eine Besonderheit ist, dass brünstige Tiere versuchen, auf andere aufzuspringen. Dabei sind sie nicht wählerisch in der Objektwahl.
Bespringen
Der Tierpsychologe spricht hierbei vom „Torbogenreflex“. Alles, was auch nur im entferntesten nach „Kuh von hinten“ aussieht, wird besprungen. Das kann auch ein sich bückender Mensch sein oder der sich gerade über einen Zaunpfahl beugt, um das Tor aufzumachen. Wenn er nicht schnell ist, kann dies recht unangenehm werden.
Voraussetzungen für die Haltung einer Kuh
Wer auf die Idee kommt, eine Kuh oder auch mehrere Kühe zu halten, sollte sich einiges gut überlegen. Nicht umsonst haben Bauern, die noch etwas anderes als Milch in ausreichender Menge produzieren können, die Kühe abgeschafft.
Futter
Eine Kuh braucht jeden Tag über einen Zentner Gras oder eine entsprechende Menge anderer Futtermittel. Für die Ernährung einer Kuh muss man für Sommer- und Winterfutter je nach Ertragsleistung und Düngung zwischen 0,5 und 1 ha Weide rechnen. In den Höhenlagen der Mittelgebirge benötigt man eher 1 ha, in den Niederlanden, wo sehr intensive Grünlandwirtschaft betrieben wird, genügen sogar weniger als 0,5 ha. Man kann Futter selbst anbauen oder auch zukaufen. Aber für den Sommer sollte man doch eine Weide haben.
An reiner Weidefläche braucht man im Mai und Juni 0,15 ha je Kuh, im Juli und August 0,25 und im September und Oktober 0,5 ha. Hat man nicht so viel zur Verfügung, muss man etwas anderes zufüttern.
Info
Tiere mit Weidegang sind gesünder, und der Arbeitsaufwand ist geringer als bei Sommerstallfütterung.
Nährstoffbedarf
Nährstoffbedarf und -leistung werden heute in Megajoule Nettoenergie-Laktation (MJ NEL) berechnet. Eine Kuh braucht pro Jahr rund 23000 NJ NEL, davon 11000 im Sommer, 12000 im Winter. Damit kann man Futterlieferung und Bedarf gegeneinander aufrechnen.
Früher verwendete man die Stärkeeinheit (StE) als Maßeinheit, die den Netto-Energiegehalt aller Futtermittel auf den von reiner, verdaulicher Stärke umrechnete. 1000 StE waren eine Kilo-Stärkeeinheit (KstE).
Tab. 1 Nährstofferträge verschiedener Futterpflanzen
Futterfläche
MJ NEL je ha und Jahr
Weide
25000–50000
Futterrüben
60000–80000
Mais
60000–80000
Rübenblatt (siliert)
20000–25000
Feldgras 5 Schnitte
40000–60000
Bei Futterzukauf braucht man den Nährstoffgehalt je dt. Er ist aus der Tabelle oben (Nährstoffgehalte einiger wichtiger Futtermittel) zu ersehen. Wie später noch zu behandeln ist, würde es die Kuh sehr übel nehmen, wenn sie ausschließlich Mais oder ausschließlich Rüben bekäme. Es geht also nicht, einfach die Futterpflanze mit dem höchsten Nährstoffertrag auszusuchen, sondern eine Kombination, abgestimmt auf die Fütterungsansprüche der Kuh, ist nötig.
Stroh
Neben Futter braucht man bei den meisten Stallsystemen auch Stroh als Einstreu. Am meisten Stroh ist im eingestreuten Laufstall nötig, in dem die Kuh wie ein Rennpferd frei in einer Box herumläuft. Dies ist für sie die schönste und gesündeste Aufstallung.
Für den Halter bedeutet das aber jeden Tag etwa 12kg Stroh, also einen Ballen pro Kuh und Tag. Streut man weniger, entwickelt sich der Laufstall schnell zum Schlammbad, denn der Kot der Rinder ist sehr wasserhaltig, und außerdem scheidet die Kuh etwa 20 Liter Harn pro Tag aus.
Im Anbindestall ist die Einstreumenge bis auf 2kg, je nach System, zu reduzieren. Man sollte hierbei aber nicht zu spitz rechnen, denn die Kuh frisst auch noch eine erhebliche Menge der Einstreu, wenn ihr das Futter zu saftig ist.
Bei ausschließlichem Weidegang im Sommer braucht man also je nach Stallsystem bei 200 Stalltagen von Mitte Oktober bis Anfang Mai zwischen sechs und 25 dt Stroh je Kuh und Jahr.
Gebäude
Aus dem oben Gesagten lässt sich erkennen, dass man zum Halten von Rindvieh nicht nur einen Stall, sondern auch eine Menge Lagerraum braucht. Bei Lagerung unter Dach muss man noch etwa 25% Arbeitsraum hinzurechnen, denn man muss sich ja beim Bewegen des Lagerguts auch bewegen können.
Info
Die seit einiger Zeit gebräuchlichen Rundballen können kurzzeitig ohne Abdeckung im Freien lagern, da der Regen nicht tief in sie eindringt.
Futterlager
Durch Einsäuern (Silieren) konserviertes Futter kann man im Freien lagern, Heu hat man besser unter Dach, Stroh kann auch draußen gestapelt werden. Kleinere Haufen aus Pressballen deckt man aber besser mit einer Plane ab, weil die Verluste sonst zu groß sind.
Tab. 2 Raumbedarf für verschiedene Futtermittel
Futtermittel
1 dt umfasst
1m3 wiegt (kg)
Heu (Kleinballen)
0,63
160
Heu (Rundballen)
0,50–1,00
100–200
Stroh (Kleinballen)
1,33
75
Stroh (Rundballen)
0,80–1,25
80–120
Stroh (Quadrantballen)
0,55–0,60
170–200
Rüben
0,14
600
Grassilage 80% Wasser
0,13
800