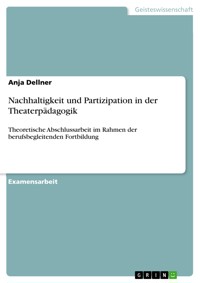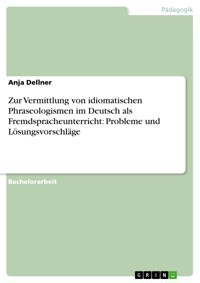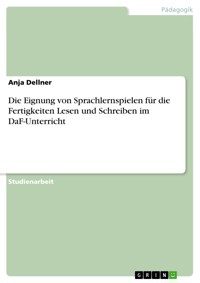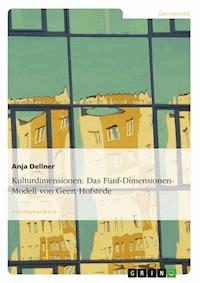
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Deutsch als Fremdsprache, DaF, Note: 1,3, Technische Universität Dresden (Germanistik), Veranstaltung: Seminar "Interkulturell Landeskunde", Sprache: Deutsch, Abstract: Geert Hofstede hat sich dem Problem der interkulturellen Missverständnisse angenommen und auf der Basis einer Langzeitstudie ein Modell entwickelt, welches die Besonderheiten von und Unterschiede zwischen Nationalkulturen im Vergleich verdeutlicht. Dabei unterteilte Hofstede Nationalkulturen in fünf Eckpfeiler, auch Dimensionen genannt, welche je nach Nation unterschiedlich ausgeprägt sind und in seiner Studie zueinander in Relation gesetzt werden. Thema und Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, die Grundzüge des Hofstede’schen Modells der fünf Dimensionen von Nationalkulturen in seinen Grundzügen darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Technische Universität Dresden
Institut für Germanistik
Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache
WS 2008/2009
Zusammenfassung des Fünf-Dimensionen-Modells von Geert Hofstede
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung.2
2. Geert Hofstede – eine Kurzbiographie.4
3. Hofstedes Kulturbegriff 5
4. Hofstedes Modell der 5 Dimensionen von Nationalkulturen..7
4.1. Machtdistanz.8
4.2. Individualismus vs. Kollektivismus.9
4.3 Maskulinität vs. Femininität 10
4.4 Unsicherheitsvermeidung.12
4.5 Langzeit- vs. Kurzzeitorientierung.13
5. Kritik.16
6. Fazit 17
Literaturverzeichnis.18
1.Einleitung
Ob in der Geschäftswelt, als Reisender, als Fremdsprachenlerner oder –lehrer heutzutage treffen wir häufiger auf Menschen fremder Kulturen als das vor 50 oder gar 100 Jahren noch der Fall war. Selbst wenn die sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten vielfach durch Englisch als Lingua Franca überwindbar sind, bergen Zusammentreffen mit Menschen aus uns unbekannten Kulturen viele Gefahren für Missverständnisse. Diese wiederum führen nicht selten zu Unverständnis, Konflikten, ja sogar politischem Desaster, wie z.B. im Jahr 2005 beim dänischen Karikaturenskandal der Zeitung Jyllands Posten, als sich ein in Dänemark lebender fundamentalistischer Imam aus Ägypten durch Karikaturen, die Mohammed zum Thema hatten, in seinem Glauben angegriffen und verspottet fühlte. Die daraufhin alarmierte muslimische Welt reagierte nicht nur mit Entrüstung und Boykott, sondern in Teilen sogar mit gewalttätigen Angriffen, in deren Zuge 140 Menschen starben und mehrere Hundert verletzt wurden.[1]
Glimpflichere Reaktionen, wie z.B. Ablehnung und heimlicher Groll sind jedoch die häufigeren Ergebnisse von interkulturellen Missverständnissen. Warum sonst gäbe es die in der Mehrzahl negativ belasteten Stereotypen wie z.B. vom obrigkeitshörigen Chinesen, vom oberflächigen Amerikaner oder vom humorlosen, überpünktlichen Deutschen?
Grund für derlei Missverständnisse sind kulturell verschiedene, zumeist verborgene Wertvorstellungen, die menschliches Handeln und Denken beeinflussen, behauptet der niederländische Anthropologe und Kulturwissenschaftler Geert Hofstede. Er hat sich diesem Problem angenommen und auf der Basis einer Langzeitstudie ein Modell entwickelt, welches die Besonderheiten von und Unterschiede zwischen Nationalkulturen im Vergleich verdeutlicht. Dabei unterteilte Hofstede Nationalkulturen in fünf Eckpfeiler, auch Dimensionen genannt, welche je nach Nation unterschiedlich ausgeprägt sind und in seiner Studie zueinander in Relation gesetzt werden.[2]
Thema und Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, die Grundzüge des Hofstede’schen Modells der fünf Dimensionen von Nationalkulturen in seinen Grundzügen darzustellen. Im Anschluss daran soll die Anwendbarkeit dieses Modells in der Praxis kurz diskutiert werden.
2. Geert Hofstede – eine Kurzbiographie
Geert Hofstede wurde am 2. Oktober 1928 im niederländischen Haarlem geboren. Er studierte Maschinenbau an der Delft Technical University und erwarb dort seinen Master of Engineering. Daraufhin arbeitete er mehrere Jahre als Ingenieur sowie im Management in der niederländischen Industrie. In dieser Zeit studierte er erneut und promovierte anschließend an der Universität von Groeningen in Sozialpsychologie. Er gründete die Abteilung für Personalforschung bei IBM Europe und übernahm deren Leitung. Später übernahm er einige Professuren in verschiedenen Ländern und war neben weiteren Tätigkeiten auch Mitbegründer und erster Vorsitzender des IRIC (Institute for Research on Intercultural Cooperation) in den Niederlanden. Seine Publikationen gehören zu den einflussreichsten im Bereich der Sozialwissenschaften, im bes. der interkulturellen Kommunikation der letzten Jahrzehnte.[3]
3. Hofstedes Kulturbegriff
Um Geert Hofstedes 5-Dimensionen-Modell, welches im nachfolgenden Kapitel vorgestellt werden soll, besser verstehen und einordnen zu können, soll zuerst sein Verständnis von Kultur erläutert werden.
Menschen denken, fühlen und verhalten sich unterschiedlich, aber diesem Variationsreichtum liegt eine Struktur zugrunde, die Hofstede mit der „software of the mind“[4] bzw. dem „mental program“[5] eines Menschen vergleicht. Diese mentale Programmierung wird ihm durch sein soziales Umfeld aufgeprägt und beginnt mit der frühkindlichen Erziehung in der Familie, verläuft über Freundschaften, Arbeitsplatz und ganz allgemein dem sozialen Milieu, in dem sich der Mensch bewegt. Diese Prägung des Geistes teilt der Einzelne mit den Mitgliedern seiner Peer-Group. Sie soll hier als seine Kultur verstanden werden.[6] Kultur ist „die kollektive Programmierung des Geistes, welche die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von anderen Menschen einer anderen Gruppe oder Kategorie unterscheidet.“[7]
Im Gegensatz zu einem sehr eng gefassten Kulturbegriff, in dem Kultur als die Verfeinerung des Geistes und deren Früchte, der Kunst, Literatur und Bildung verstanden wird, operiert Hofstede also, wie die meisten zeitgenössischen Sozial- und Kulturwissenschaftler mit einem sehr viel weiter gefassten Verständnis von Kultur. Dabei weißt er auch darauf hin, dass diese kollektive Programmierung zwar seit dem frühen Kindesalter erlernt, aber nie determinierend sei, sondern jeder Mensch, wenngleich das nicht einfach ist, im Grunde dazu fähig sei, von seiner Kultur abzuweichen.[8]
Nun sind es aber eher Gesellschaften und nicht Nationalstaaten, die eine gemeinsame Kultur teilen. Warum sich Geert Hofstede trotzdem für den Vergleich von Nationalkulturen entschieden hat, liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, dass eine Vielzahl von statistischen Erhebungen auf Staatenebene und kaum auf Gesellschaftsebene gesammelt werden. Es handelt sich also um einen ganz praktischen Grund, der durch die weitgehend homogene Leitkultur von lang existierenden Nationen gerechtfertigt würde, so Hofstede. Desweiteren unterstützen statistische Daten, die einen Vergleich zwischen Nationalstaaten ermöglichen, das Anliegen des Wissenschaftlers, die Kooperation zwischen Nationen zu fördern.[9]
In der hier vorliegenden Arbeit sollen demnach die Begriffe „Nation“, „Land“, „Staat“, „Gesellschaft“ und „Kultur“, wenngleich sie Unterschiede in ihren Definitionen aufweisen, synonym gebraucht werden.
4. Hofstedes Modell der 5 Dimensionen von Nationalkulturen
Zwischen 1967 und 1973 analysierte Geert Hofstede eine aus empirischen Studien gewonnene immense Datenmenge über die Wertvorstellungen von Menschen aus 74 Ländern dieser Welt. Diese Menschen waren Angestellte des multinationalen Konzerns IBM. Nach Wiederholung der Studie, sowie Auswertung von Studien anderer multinationaler Organisationen und Institutionen traten durch die Staatsangehörigkeit bedingte Unterschiede in den Antworten deutlich hervor. Mit den gleichen Problemen konfrontiert, gehen demnach Menschen aus verschiedenen Nationen unterschiedlich um. Die vier Grundproblembereiche, die Hofstede bei der Auswertung der Fragebögen feststellte, betreffen alle Kulturen gleichermaßen. Es handelt sich dabei um fundamentale Fragestellungen, die an alle Kulturen gestellt werden und auf die jede Kultur eine Antwort finden muss und findet.[10] Diese vier Grundproblembereiche gingen als vier Dimensionen in sein erstes 4-Dimensionen-Modell ein. Es handelt sich dabei um
· Machtdistanz
· Individualismus vs. Kollektivismus
· Maskulinität vs. Femininität
· Unsicherheitsvermeidung
Aufgrund einer Studie des kanadischen Psychologen Michael Harris Bond wurde dem Modell später noch eine fünfte Dimension, die der
· Kurzzeitorientierung vs. Langzeitorientierung
hinzugefügt.[11] Jede dieser vier Dimensionen stellt einen „Aspekt einer Kultur dar, der in Relation zu einer anderen Kultur gemessen werden kann“.[12]
Im Folgenden sollen ausgewählte Phänomene der vier Dimensionen und der später hinzugefügten fünften vorgestellt werden. Aufgrund der Begrenztheit dieser wissenschaftlichen Arbeit erhebt die Autorin keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
4.1. Machtdistanz
Überall auf der Welt gibt es Ungleichheiten. Manche Menschen sind intelligenter als andere, manche sind stärker, andere wiederum schwächer, dafür aber wohlhabender oder, wenn es das Schicksal will, sind sie ärmer als andere. Die Dimension der Machtdistanz verweist auf den unterschiedlichen Umgang mit Ungleichheiten innerhalb von Kulturen. Sie ist „das Ausmaß, bis zu welchem die weniger mächtigen Mitglieder von Institutionen [wie Familie oder Schule] bzw. Organisationen eines Landes erwarten und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist.“[13] (Erläuterung der Verfasserin) Die Wertevorstellungen der weniger mächtigen Mitglieder sind für diese Dimension demnach ausschlaggebend.
In Kulturen mit niedriger Machtdistanz ist man bestrebt, die Ungleichheit zwischen den Menschen so gering, wie möglich zu halten. Der Gebrauch von Macht sollte hier gerechtfertigt sein und unterliegt dem Gesetz. In Ländern mit sehr gering ausgeprägter Machtdistanz behandeln Eltern ihre Kinder wie ihresgleichen, ältere Menschen werden weder gefürchtet noch besonders respektiert und das Bildungswesen stellt die Schüler bzw. die Studenten in den Mittelpunkt. In diesen Ländern gilt Hierarchie als konstruiert, nicht als gott- oder schicksalsgegeben. Angestellte erwarten, in Entscheidungen mit einbezogen zu werden. Regierungen sind pluralistisch, basieren auf einem Mehrheitswahlsystem und werden friedlich abgelöst. Es gibt verhältnismäßig wenig Korruption, Skandale beenden politische Karrieren. In Ländern mit geringer Machtdistanz ist das Gesamteinkommen eher gleichmäßig verteilt.[14]
Im Gegensatz dazu wird in Kulturen mit hoher Machtdistanz Ungleichheit zwischen den Menschen erwartet und ist sogar erwünscht. Macht geht hier vor Recht und ihre Ausübung muss weder legitimiert sein, noch in irgendeiner Weise gerechtfertigt werden. Eltern erziehen ihre Kinder zum Gehorsam, ältere Menschen werden respektiert und gefürchtet, das Bildungssystem ist lehrerzentriert ausgerichtet. In diesen Ländern bedeutet Hierarchie eine naturgegebene Ungleichheit zwischen gesellschaftlichen Schichten. Angestellte erwarten, Anweisungen zu erhalten. Regierungen sind autokratisch oder oligarchisch, basieren auf Amtsberufungen und werden durch Revolution gestürzt. Die Korruption ist verhältnismäßig hoch, Skandale werden gewöhnlich vertuscht. In Ländern mit hohem Machtdistanzindex (MDI) ist das Gesamteinkommen sehr ungleich verteilt.[15]
Diese, wie auch die folgenden Angaben müssen als extreme Eckpunkte auf einer breiten Skala voller Zwischenwerte verstanden werden. Zu den Ländern mit niedrigem MDI zählen in Europa z.B. solche, in denen die Muttersprache eine germanische ist, u.a. Dänemark, Deutschland, Vereinigtes Königreich. Der MDI ist wesentlich höher in Ländern, in denen die Muttersprache eine romanische ist, u.a. Frankreich, Spanien, Italien, Rumänien.[16]
4.2. Individualismus vs. Kollektivismus
Begreift sich ein Mensch eher als Einzelperson, sind ihm Unabhängigkeit und Privatsphäre heilig oder identifiziert er sich über seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sind für ihn Loyalität zur und Harmonie innerhalb der Gruppe von größter Bedeutung? Die Dimension des Individualismus vs. Kollektivismus weißt auf „den Grad zu welchem Menschen einer Gesellschaft in Gruppen integriert sind“[17] hin.
In Ländern mit einem niedrigen Individualismusindex (IDV) sind die Menschen von Geburt an in starke, geschlossene Gruppen integriert. Dies ist zumeist die Großfamilie, die im Austausch für lebenslangen Schutz von ihren Mitgliedern unangefochtene Loyalität verlangt. In diesen Ländern herrscht ein starkes Wir-Bewusstsein, das Privatleben wird von der Gruppe dominiert und die Wahrung von Harmonie ist oberstes Gebot. Andere Menschen werden als eigengruppen- oder fremdgruppenzugehörig klassifiziert. Meinungen sind in diesen Kulturen durch Gruppenzugehörigkeit vorherbestimmt, der Gebrauch des Wortes „ich“ wird vermieden und das Durchbrechen von Normen führt zu Schamgefühlen. Zu lernen, wie man etwas macht, ist hier Ziel von Bildung und Erziehung. In Ländern mit niedrigem IDV genießen zwischenmenschliche Beziehungen Priorität gegenüber Tätigkeiten und Arbeitsaufgaben.[18]
Den Gegenpol zu kollektivistisch geprägten Kulturen bilden die Länder mit hohem IDV. Hier sind die Bindungen zwischen den Individuen eher locker und man erwartet von jedem, dass er für sich selbst und seine unmittelbare Familie, die sogenannte Kernfamilie, sorgt. In diesen Ländern überwiegt das Ich-Bewusstsein gegenüber dem Wir-Bewusstsein, die Wahrung der Privatsphäre hat einen hohen Stellenwert. Zu sagen, was man denkt, ist gesund und gehört hier zu den charakteristischen Eigenschaften eines ehrlichen Menschen. Andere Menschen werden als Individuen wahrgenommen. In Ländern mit hohem IDV wird erwartet, dass jeder eine persönliche Meinung hat. Die Verwendung des Wortes „ich“ ist unverzichtbar, Normverstöße führen zu Schuldgefühlen und das Ziel von Erziehung und Bildung ist, zu lernen, wie man lernt. In individualistischen Gesellschaften genießen Tätigkeiten und Arbeitsaufgaben Priorität gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen.[19]
Einen vergleichsweise niedrigen IDV haben asiatische, slawische und arabische Länder. In Großbritannien, den USA und Australien, also Ländern mit englischer Muttersprache ist der IDV sehr hoch.[20]
4.3 Maskulinität vs. Femininität
„Ein Junge weint nicht!“ Dieses viele Generationen überdauernde Sprichwort ist bekanntermaßen keine Feststellung, sondern ein Verbot, welches auf die Geschlechterrolle, die ein Junge bzw. Mann in einer Gesellschaft ausfüllen soll, verweist.
Egal welches biologische Geschlecht wir haben, alle Menschen lernen von Kindesbeinen an, was es in ihrer Kultur bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein. Da diese Vorstellungen vom typisch Weiblichen und typisch Männlichen, die auch als Geschlechterrollen bezeichnet werden, nicht angeboren, sondern erlernt sind, variieren sie von Gesellschaft zu Gesellschaft in dem Maße ihrer Ausprägung. Mit der von Hofstede’schen Dimension Maskulinität vs. Femininität wird „die Verteilung von Werten zwischen den Geschlechtern“[21] in einer Gesellschaft ins Licht gerückt. Bei Dominanz der dabei traditionell Frauen zugeschriebenen Eigenschaften „Bescheidenheit und Fürsorglichkeit“ spricht Hofstede von „femininen“ Nationen, überwiegen die traditionell Männern zugeschriebenen Eigenschaften „Durchsetzungsvermögen und Konkurrenzdenken“ und weichen männliche und weibliche Vorstellungen stark voneinander ab, handelt es sich um „maskuline“ Nationen.[22]
In feminin geprägten Gesellschaften sind Geschlechterrollen nicht sehr distinkt voneinander, beiden Geschlechtern werden sowohl „harte“ als auch „weiche“ Eigenschaften zugeschrieben. Bescheidenheit und Fürsorglichkeit erwartet man von Frauen als auch von Männern, in der Familie sind Vater und Mutter für Fakten und Gefühle zuständig, Mädchen und Jungen dürfen weinen, sollten aber nicht kämpfen. In diesen Gesellschaften entscheiden die Mütter, wie viele Kinder sie haben wollen, ein Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit wird angestrebt und in politischen Ämtern findet man viele Frauen. In der Religion liegt die Betonung auf Nächstenliebe. Schwachen gegenüber zeigt man viel Mitgefühl. Über Sex wird hier offen gesprochen. Er bietet zwei Menschen eine Möglichkeit, sich zu verbinden.[23]
In maskulinen Gesellschaften hingegen liegen die Geschlechterrollen und die damit verbundenen Erwartungen an Männer und Frauen weit auseinander. Männer sollten und Frauen können durchsetzungsfähig und ehrgeizig sein, in der Familie ist der Vater für Fakten und die Mutter für Gefühle zuständig, Mädchen ist es erlaubt zu weinen, aber nicht zu kämpfen, Jungen hingegen dürfen kämpfen, sollten aber nicht weinen. In diesen Ländern entscheiden die Väter über die Anzahl der Kinder, Arbeit kommt stets vor der Familie und in politischen Ämtern findet man wenige Frauen. In der Religion liegt die Betonung auf dem Glauben an Gott. Den „Starken“ begegnet man mit Bewunderung. Offen über Sex zu sprechen, ist hier ein Tabu. Beim Sex steht die Leistung im Mittelpunkt.[24]
Länder mit hohen Maskulinitätswerten sind z.B. Japan, Italien und Länder, in denen die Muttersprache deutsch ist. Niedrige Werte für Maskulinität erzielten nordeuropäische Staaten und die Niederlande.[25]
4.4 Unsicherheitsvermeidung
“Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?” – Ein Kinderspiel mit einem signifikanten Titel, welcher erahnen lässt, was es für uns Deutsche bedeutete und größtenteils noch immer bedeutet, mit Neuem und Unbekannten konfrontiert zu werden.
Wie Menschen auf ungewisse Situationen reagieren, hängt viel von der Kultur ab, in der sie aufgewachsen sind und die sie „programmiert“ hat. Die Dimension der Unsicherheitsvermeidung „behandelt die gesellschaftliche Toleranz für Mehrdeutigkeit“[26]. Der Unsicherheitsvermeidungsindex (UVI) zeigt an, ob sich Menschen einer Kultur in unstrukturierten und unbekannten Situationen wohl oder unwohl fühlen.[27]
Unsicherheit vermeidende Kulturen sehen in solchen Situationen eine Bedrohung und versuchen sie durch strenge Verhaltensregeln und Gesetze zu minimieren. Man sehnt sich nach Klarheit, Struktur und Regeln, selbst wenn diese nicht funktionieren. Was anders ist, ist gefährlich - Menschen und Ideen, die vom Bekannten abweichen werden nicht toleriert. Lehrer sollten hier allwissend sein, man wechselt selbst ungeliebte Jobs selten oder nie. In der Politik gelten Bürger als inkompetent gegenüber den Autoritäten. Das Interesse an Politik ist in der Bevölkerung gering. In Religion, Philosophie und Wissenschaft sucht man nach der ultimativen Wahrheit und glaubt an große Theorien. In solchen Kulturen ist das Auftreten von Stress, Angstgefühlen, Neurotizismus keine Seltenheit und es ist gesellschaftlich akzeptiert, Aggressionen und Angst bei geeigneten Gelegenheiten herauszulassen. Ein höherer UVI geht mit der subjektiven Empfindung einher, dass es einem emotional und gesundheitlich schlecht geht.[28]
Das Gegenstück bilden Kulturen, die Unsicherheit akzeptieren und jeden Tag nehmen, wie er kommt. Sie neigen zu weniger Regeln und Gesetzen, Menschen fühlen sich in mehrdeutigen und chaotischen Situationen wohl. Was anders ist, ist seltsam und macht neugierig - Menschen und Ideen, die vom Bekannten abweichen, werden toleriert. Lehrer werden nicht als wandelnde Lexika angesehen und dürfen auch mal „Ich weiß nicht“ sagen. Jobwechsel stellen kein Problem dar. In der Politik fühlen sich Bürger kompetent gegenüber Autoritäten und werden auch als solches angesehen. Das Interesse an Politik ist in der Bevölkerung groß. In Religion, Philosophie und Wissenschaft glaubt man an Relativismus und erlaubt unterschiedlichen Strömungen nebeneinander zu existieren. Menschen aus Ländern mit geringer Unsicherheitsvermeidung erscheinen phlegmatischer und kontemplativer, Stress und Angstgefühle treten selten auf. Hier erwartet man nicht, dass Gefühle offen gezeigt werden. Ein niedriger UVI geht mit dem Gefühl einher, dass es einem emotional und gesundheitlich gut geht.[29]
Ein hoher UVI ergab sich für lateinamerikanische, romanische und Mittelmeerländer. Mittlere Punktwerte haben deutschsprachige Länder. Anglophone und nordische Länder liegen am unteren Ende der Skala.[30]
4.5 Langzeit- vs. Kurzzeitorientierung
Legen Geschäftsführer auf ein erfolgreiches Unternehmen, was auch in 10 Jahren noch Gewinne erzielt, wert oder interessieren sie sich nur für den schnellen Profit eines Quartals oder eines Jahres? Die Finanzkrise, die 2008 von den USA ausgehend sich überall auf der Welt ausbreitete, verweist auf die fünfte von Hofstedes untersuchten Dimensionen von Nationalkulturen – Langzeit- vs. Kurzzeitorientierung.
Beharrlichkeit und Sparsamkeit, Werte die auf einen zukünftigen Erfolg ausgerichtet sind, werden mit Langzeitorientierung verbunden. Respekt vor Tradition, die Wahrung des „Gesichts“ und die Erfüllung sozialer Pflichten sind Tugenden, die auf Vergangenheit und Gegenwart verweisen und stehen für Kurzzeitorientierung. Diese Dimension basiert in vielerlei Hinsicht auf den Lehren des Konfuzius, ist aber auch auf Länder, in denen seine Lehren nicht bekannt sind, anwendbar.[31]
Kulturen, die auf größere Zeiträume orientieren, haben keine universellen Richtlinien zu, was gut und was böse ist. „Gut und böse“ hängen von den Umständen ab. Auch ihre Traditionen zeichnen sich durch Anpassungsfähigkeit an gegebene Umstände aus. Die wichtigsten Ereignisse im Leben eines Menschen liegen in der Zukunft, Bedürfnisbefriedigung wird häufig auf später verschoben, die Ehe ist eine pragmatische Vereinbarung in der Aufgaben geteilt werden. Kinder werden hier zur Sparsamkeit erzogen. Das was man tut, sollte auf Tugenden basieren. Schüler und Studenten sind gut im Lösen strukturierter, mathematischer Aufgaben und in der Geschäftswelt orientiert man sich nach zukünftigen Marktpositionen. Die Sparquote ist in Ländern mit Langzeitorientierung groß, Mittel für Investitionen stehen immer zur Verfügung.[32]
In Gesellschaften, die auf kurze Zeiträume orientieren, überwiegt der Glaube an universelle Richtlinien zu, was gut und was böse ist. Ihre Traditionen sind den Menschen heilig und unantastbar. Die wichtigsten Ereignisse im Leben eines Menschen fanden in der Vergangenheit statt oder ereignen sich in der Gegenwart. Man erwartet unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, die Ehe ist eine moralische Vereinbarung und das Familienleben wird von Normen bestimmt. Kinder werden zu Toleranz und Respekt erzogen. Was man denkt und ausspricht, sollte wahr sein. Schüler und Studenten sind gut im Lösen von unstrukturierten Problemen und in der Geschäftswelt orientiert man sich nach kurzfristigen Erfolgen. Konsum und Ausgabefreudigkeit sind in diesen Ländern hoch.[33]
Als Beispiele für Länder mit hoher Langzeitorientierung sind ostasiatische Staaten, wie China, Taiwan, Japan und Vietnam zu nennen. Niedrige Wertepunkte ergaben sich für englischsprachige Länder, Nigeria, Tschechien und Pakistan.[34]
Für jede der fünf Dimensionen konnten alle Länderergebnisse durch konzeptionell gebundene externe Daten validiert werden. So entsprechen bspw. die Daten feminin ausgerichteter Nationen dem Prozentsatz des Nationaleinkommens, welcher für Entwicklungshilfe ausgegeben wurde. Individualismus korrelierte mit einem hohen Bruttosozialprodukt.[35]
5. Kritik
Geert Hofstede wurde oft mit dem Vorwurf konfrontiert, sein Modell und seine Studie aus dem Jahre 1970 wären veraltet. Er selbst kontert diesen Vorwurf mit der Feststellung, dass sich die Wertvorstellungen einer Kultur nur sehr langsam, in mehreren hundert Jahren verändern würden. Technologischer Fortschritt mag Kulturen beeinflussen, sie wandelten sich aber nicht autonom, sondern in Abhängigkeit zueinander. Dadurch, das haben empirische Studien ergeben, ändern sich ihre relativen Positionen innerhalb des 5-Dimensionen-Modells kaum. Die Unterschiede zwischen ihnen blieben, so Hofstede, also bestehen. Technologischer Fortschritt und andere äußere Einflusse hätten demnach nur einen geringen Einfluss auf gesellschaftliche Wertvorstellungen. [36]
Doch ist es tatsächlich möglich, dass die Wiedervereinigung Deutschlands und die politische und ökonomische Systemänderung in den gesamten Ostblockstaaten vor 20 Jahren keinen Einfluss auf die Wertvorstellungen der dort lebenden Menschen hatten? Für die Autorin ist das kaum vorstellbar. Warum wird in der Literatur nicht darauf hingewiesen, dass es sich bei den deutschen Ergebnissen der Studie um westdeutsche und nicht um gesamtdeutsche Ergebnisse handelt? Wie hätte wohl die DDR in der Studie abgeschnitten? Gab es gesellschaftliche Umstrukturierungen in anderen Ländern der Studie, die möglicherweise nicht berücksichtigt werden konnten? Diese Fragen bedürften einer Klärung. Nach fundamentalen politisch-ökonomischen Systemänderungen in einem Land müsste meines Erachtens Geert Hofstedes Studie, um ihre Aktualität zu bewahren, genau dort wiederholt werden.
Desweiteren wurde dem Modell Ungenauigkeit vorgeworfen, da die ihm vorangegangenen Studien nur bestimmte Gruppen von Menschen, die der Arbeitnehmer multinationaler Konzerne bzw. nationaler Institutionen und die der Studenten berücksichtigen. Durch das Auslassen von Hausfrauen und –männern, Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern und Selbständigen in sog. Ein-Mann-Betrieben fehlen den Ergebnissen signifikante Angaben. Um ein noch realistischeres Bild zu erhalten, sollte die Studie meiner Ansicht nach auch hier nach Möglichkeit erweitert werden.
6. Fazit
Geert Hofstede hat ein sehr wirksames Modell entwickelt, welches in seinen fünf Dimensionen die Besonderheiten von Nationalkulturen im Vergleich verdeutlichen kann. Nach der Gewinnung neuerer Daten eines erweiterten Befragtenkreis könnte dieses Modell kombiniert mit allen bisher gesammelten, relevanten Untersuchungsergebnissen als Instrument eingesetzt werden, welches eine grobe Orientierung für die Deutung von Verhaltensweisen von Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft gibt. Während der Vorbereitung und Durchführung interkultureller Begegnungen, z.B. beim Studentenaustausch, beim (beruflichen) Auslandsaufenthalt, im Fremdsprachenunterricht, bei international operierenden Firmen und in der Politik wäre der Einsatz dieses Instruments denkbar. Es wäre damit möglich, die Wahrscheinlichkeit von bestimmten Reaktionen vorauszusagen, einzuordnen und zu verstehen. Und genau da läge und liegt auch momentan der kritische Punkt der Studie, denn ihre statistischen Befunde spiegeln kulturelle, nicht individuelle Ebenen wieder. Jeder Mensch hat sich durch seine Persönlichkeit individuelle Handlungsmuster erschaffen. Deshalb bleibt nur zu betonen, wie wichtig es ist, Hofstedes Ergebnisse nicht als absolut hinzunehmen und zur Stereotypisierung von Einzelpersonen heranzuziehen, sondern sie bestenfalls als Tendenzen innerhalb einer Gruppe von Menschen zu interpretieren, die einen Anhaltspunkt für interkulturelle Begegnungen bieten können.
Literaturverzeichnis
Bücher:
Hofstede, Geert: Lokales Denken, Globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. 3., vollständig überarbeitete Auflage. München 2006.
Hofstede, Gert Jan und Geert Hofstede: Cultures and Organizations: Software of the Mind. 2., überarbeitete Auflage. McGraw-Hill Professional. New York 2005.Onlinefassung: http://books.google.de/books?id=tLbt4eCcltcC&printsec=frontcover#PPA9,M1
[Stand 2009-02-28]
Internet:
Hofstede, Geert: Summary of my ideas about organizational cultures. o.J. Online in Internet: http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/page4.htm [Stand 2009-02-26].
Hofstede, Geert: Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context.In: Online Readings in Psychology and Culture, Unit 2, Chapter 14. o.J. Online in Internet: http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm[Stand 2009-03-08].
o.V.: Das Gesicht Mohammeds. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. 06.03.2009. Online in Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gesicht_Mohammeds
[Stand 2009-03-08].
o.V.: 5-D model.In: itim focus: strategy, culture, change. 2008. Online in Internet: http://www.itimfocus.org/index.php/frontpage/page/concepts/5d/more
[Stand 2009-02-28].
o.V.: About… In: itim international: Geert Hofstede Cultural Dimensions Resources. o.J. Online in Internet: http://www.geert-hofstede.com/geert_hofstede_resources.shtml [Stand 2009-02-28].
[1] Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gesicht_Mohammeds
[2] Vgl. http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/page4.htm,
http://www.itimfocus.org/index.php/frontpage/page/concepts/5d/more
[3] Vgl. Hofstede, Geert: Lokales Denken, Globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management. 3., vollständig überarbeitete Auflage. München 2006. S. 525f.
[4] Hofstede, Gert Jan und Geert Hofstede: Cultures and Organizations: Software of the Mind. 2., überarbeitete Auflage. McGraw-Hill Professional, 2005. S.2
[5] ebd.
[6] Vgl. Hofstede, New York 2005. S.3f
[7] ebd. S.4
[8] Vgl. ebd. S.3
[9] Vgl. Hofstede, New York 2005. S.18f
[10] Vgl.“EMPIRICAL APPROACHES AND THE HOFSTEDE DIMENSIONS”
http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm,
ttp://www.itimfocus.org/index.php/frontpage/page/concepts/5d/more,
http://www.geert-hofstede.com/geert_hofstede_resources.shtml
[11] Vgl. .“EMPIRICAL APPROACHES AND THE HOFSTEDE DIMENSIONS”
http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[12] ebd. „A dimension is an aspect of a culture that can be measured relative to other cultures.”
[13] Hofstede, München 2006. S.59
[14] Vgl. Hofstede, München 2006. S.66ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[15] Vgl .ebd.
[16] Vgl. ebd. S.88, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[17] http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm „…the degree to which people in a society are integrated into groups”
[18] Vgl. Hofstede, München 2006. S.102ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[19] Vgl. ebd.
[20] Vgl. Hofstede, München 2006. S.105
[21] http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm “the distribution of values between the genders”
[22] Vgl. http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[23] Vgl. Hofstede, München 2006. S.176ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[24] Vgl. Hofstede, München 2006. S.176ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[25] Vgl. Hofstede, München 2006. S.166f.
[26] http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[27] Vgl. Hofstede, München 2006. S.233, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[28] Vgl. Hofstede, München 2006. S.244ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[29] Vgl. ebd.
[30] Vgl. Hofstede, München 2006. S.234f.
[31] Vgl. Hofstede, München 2006. S.292f., http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[32] Vgl. Hofstede, München 2006. S.295ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
[33] Vgl. Hofstede, München 2006. S.295ff, http://www.ac.wwu.edu/%7Eculture/hofstede.htm
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: