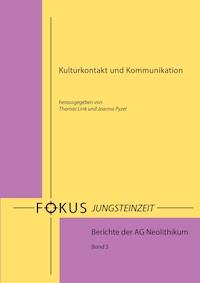
Kulturkontakt und Kommunikation E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fokus Jungsteinzeit
- Sprache: Deutsch
Bericht über die Sitzung der AG Neolithikum am 16. und 17. April 2012 im Rahmen der 20. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. in Brandenburg an der Havel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Thomas Link und Joanna Pyzel
Kulturkontakt und Kommunikation – Bericht über die Sitzung der AG Neolithikum am 16. und 17. April 2012 im Rahmen der 20. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Brandenburg an der Havel
Hauke Dibbern
Zur Nutzungsdauer neolithischer Monumente im südjütischen Raum. Untersuchungen an Grabenwerk und Megalithgräbern in der Region Albersdorf (Dithmarschen)
Franziska Hage
Das trichterbecherzeitliche Gräberfeld von Borgstedt: Frühe radiometrische Daten für ein nicht-megalithisches, hölzernes Langbett und einen späteren Dolmen
Stephen Shennan, Kevan Edinborough und Tim Kerig
Demographische Modellbildung als ein Schlüssel zu Kulturkontakt und Kommunikation: Fallbeispiel Neolithisierung Zentral- und Nordwest-Europas
Florian Klimscha
Macht und Fernbeziehungen im 5. Jahrtausend
Raiko Krauß
Nordwestanatolien, Balkan und Karpatenbecken im diachronen Vergleich – Kulturkontakt und Kommunikation vom 6.–4. Jt. v.Chr.
Luise Lorenz
Die „Einen“ und die „Anderen“? – Rekonstruktion von Kommunikationsstrukturen auf der Grundlage der Verbreitung von Trichterbechern und Kugelamphoren in Megalithgräbern an Ostsee, Warnow und Peene
Robin Peters
Zwischen Wachstum und Krise. Die Pfyner Kultur am Bodensee
Heiner Schwarzberg
– A Common Thread? On Neolithic Culture Contacts and Long Distance Communication
Laura Thielen
Kulturkontakt und Motivation am Beispiel des Neolithisierungsprozess in der südlichen Mecklenburger Bucht
Renata Zych
Intercultural relations in the Neolithic Period in the Vistula and San basins.
Kulturkontakt und Kommunikation – Bericht über die Sitzung der AG Neolithikum am 16. und 17. April 2012 im Rahmen der 20. Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Brandenburg an der Havel
Thomas Link und Joanna Pyzel
Kontakte zwischen verschiedenen Regionen waren schon immer ein Lieblingsthema der Archäologie. In der kulturhistorischen Forschungstradition liegt der Schwerpunkt vor allem auf den Verbindungen zwischen „archäologischen Kulturen“, was sich in der Praxis vor allem als Suche nach Importstücken und gegenseitigen Einflüssen in der materiellen Kultur äußert. Nach wie vor sind Importe ein wichtiges und beliebtes Thema – weil sie oft recht einfach zu erkennen und nicht selten spektakulär sind (und wohl auch, weil sie manchmal schlicht eine schnelle Publikation für relativ wenig Arbeit ermöglichen). Viel seltener aber wird die Frage gestellt, welche Strukturen und Prozesse sich hinter Importen und überregionalen typologischen Ähnlichkeiten wirklich verbergen und welche Erkenntnisse über die zugrunde liegende(n) Gesellschaft(en) sich daraus ableiten lassen.
Die Paradigmen des Diffusionismus spielen in der modernen Archäologie nur mehr eine untergeordnete Rolle. Stattdessen verbinden sich viele neuere Ansätze unter dem Schlagwort der social archaeology. Interaktionen zwischen Menschen können vielfältige Motivationen und ganz unterschiedlichen Charakter haben. Sowohl Individuen als auch Gruppen treten in Beziehung und Wechselwirkung miteinander. Diese Interaktionen können ebenso gesellschaftsintern als auch nach außen gerichtet, gruppenübergreifend und überregional sein. Für die Archäologie ergibt sich daraus eine Reihe interessanter Fragestellungen: Welche Hintergründe und Auswirkungen sozialer oder ökonomischer Art lassen sich für spezifische Kontaktsituationen nachvollziehen bzw. vermuten? In welcher räumlichen Dimension spielen sie sich ab? Welche zeitliche Dynamik entwickelt sich dabei? Welche Personen bzw. Personenkreise treten miteinander in Kontakt? Welche Motivationen verfolgen sie, und wer profitiert in welcher Weise? Und, als zentrale quellenkritische Fragestellung: Welche Formen des Kontakts können wir mit unseren Forschungsmethoden und unserem Quellenmaterial überhaupt erkennen?
Bereits 2006 tagte die AG Neolithikum zum Thema „Mobilität, Migration und Kommunikation“1. Der Fokus der meisten Beiträge lag dabei auf Mobilität und Migration. Das Thema „Kontakte“ umfasst jedoch verschiedenste Formen der Interaktion, die mit Wanderungsbewegungen einhergehen können, aber nicht notwendigerweise müssen. Ziel der Tagung im Jahr 2012 war es daher, den Aspekt der Kommunikation stärker in den Vordergrund zu rücken.
13 Vorträge lieferten Fallbeispiele zum Thema „Kulturkontakt und Kommunikation“ aus verschiedenen Regionen, von der Ägäis über den Balkanraum bis ins nördliche Mitteleuropa. Der Nachmittag des zweiten Sitzungstages war aktuellen Forschungen zum Neolithikum jenseits des engeren Tagungsthemas vorbehalten2.
Thomas Link und Joanna Pyzel (Hrsg.)
Kulturkontakt und Kommunikation
Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG Neolithikum 5 (Kerpen-Loogh 2017) 7–11
Den Auftakt bildeten zwei Vorträge aus dem Projekt „The Cultural Evolution of Neolithic Europe (EUROEVOL)“, die im vorliegenden Band in einem Artikel vereint sind. Tim Kerig, Kevan Edinborough und Stephen Shennan (London) stellten zunächst die theoretischen und methodischen Grundlagen des evolutionären Ansatzes dar. Der Begriff der „kulturellen Evolution“ bezieht sich auf den Prozess und die Mechanismen der Weitergabe von Kultur als Information, die strukturell analog zur Vererbung in der Biologie konzeptualisiert werden. In der konkreten Anwendung des theoretischen Konzepts auf archäologische Fallbeispiele messen die Autoren zunächst der Rekonstruktion populationsdynamischer Prozesse besondere Bedeutung zu, da die Bevölkerungsdichte als entscheidender Faktor für den Informationsfluss anzusehen sei. Von ihr hänge in entscheidendem Maße die Wandlungsrate ab, bedingt durch die analog zur biologischen Vererbung auch in der kulturellen Transmission auftretenden Variationen. Hohe Population beschleunige tendenziell die Geschwindigkeit der kulturellen Evolution, wogegen bei Unterschreitung eines gewissen Schwellenwertes der Informationsaustausch nicht mehr aufrechterhalten werden könne.
Im zweiten Vortrag stellten Kevan Edinborough, Tim Kerig und Stephen Shennan das Potential demographischer Modellbildung (als Grundlage evolutionärer Modelle) anhand von radiometrischen Daten im konkreten Anwendungsbeispiel des mittel- und nordwesteuropäischen Neolithikums zur Diskussion. Die kumulierte Häufigkeit kalibrierter 14C-Daten in verschiedenen Zeitscheiben wird dabei als proxy für die Populationsdichte aufgefasst. Neben zeitlichen Schwankungen sind regionale Konzentrationen in der Häufigkeit der radiometrischen Daten zu beobachten, die die Vortragenden als Hinweise auf potentielle „Entwicklungszentren“ und ihre Verlagerung im Laufe der Zeit interpretieren.
Die folgenden Vorträge waren zu chronologischen und geographischen Themenblöcken zusammengefasst. Mit insgesamt vier Beiträgen nahm bei der diesjährigen AG-Sitzung das südosteuropäische Neolithikum vergleichsweise breiten Raum ein. Die kulturellen Verbindungen zwischen Anatolien, dem Balkanraum und dem Karpatenbecken im 6.–4. Jahrtausend unterzog Raiko Krauß (Tübingen) einer diachronen Betrachtung. Im Zuge der Neolithisierung gelangten zahlreiche anatolische Elemente nach Südosteuropa, denen aber durchaus auch autochthone Entwicklungen gegenüber zu stellen seien, wie etwa bemalte Keramik, Steinstatuetten oder Masken. Das Karpatenbecken stelle einen tendenziell retardierenden Randbereich des balkanischen Neolithikums dar, und auch in Richtung der nordpontischen Steppen löse sich das balkanische „Paket“ schnell auf. Mit einer Korrespondenzanalyse der Grabinventare von Varna zeigte Krauß abschließend, dass die symbolischen Bestattungen die jüngsten Befunde des Gräberfelds darstellen und dieses am Ende seiner Belegung randlich abgrenzen.
Martin Furholt (Kiel) griff einen jüngst von Agathe Reingruber formulierten Gedanken zur Neolithisierung der Ägäis auf und stellte der Diskussion um Migration, Diffusion oder autochthone Genese ein Netzwerkmodell gegenüber. Mit Hilfe der Netzwerkanalyse untersuchte er Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen Westanatolien und Griechenland auf quantitativer Basis. Insbesondere die Verzierungsmerkmale der Keramik reflektieren offenbar verschiedene sich gegenseitig überlagernde und durchdringende Netzwerke. Hierbei seien sowohl territoriale Einheiten abgrenzbar, als auch überregionale Verbindungen zu erkennen. Fassbar seien auch zeitliche Veränderungen, wobei am Beginn der neolithischen Entwicklung eine stärker ausgeprägte Regionalität bestünde, die sich in der Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. auflöse. Als Grund hierfür sieht Furholt die Entstehung bzw. Verstärkung überregionaler Kommunikationsstrukturen und die zunehmende Herausbildung von Zentren innerhalb der Netzwerke.
Kulturkontakte im mittel- und südosteuropäischen Neolithikum beleuchtete Heiner Schwarzberg (München) anhand der anthropomorphen Gefäße, insbesondere der Gesichtsgefäße. Deutlich zeigte sich dabei einerseits ein sehr weitgespanntes Kommunikationssystem, andererseits treten anhand spezifischer, regional abgrenzbarer Merkmale und Symbole verschiedene regionale Subsysteme in Erscheinung. So entwickelten sich offenbar im Bereich des Karpatenbeckens und der Linienbandkeramik Symbolsysteme mit relativ eigenständigen Zügen, die sich stilistisch deutlich vom Balkanraum (Vinča-Kultur) absetzen.
Florian Klimscha (Berlin) betrachtete Beile bzw. Äxte aus dem 5. Jahrtausend v. Chr. auf ihre Aussagekraft hinsichtlich kultureller Kontakte und sozialer Strukturen. Beile bzw. Äxte aus Kupfer, Flint oder Felsgestein sowie extrem lange Silexklingen („Superblades“) spiegelten ein System von soziokulturellen Werten und Vorstellungen, das ganz Südosteuropa umspanne. Interne räumliche Differenzierungen würden aber z. B. durch die unterschiedlichen Schwerpunkte in der Verbreitung von Kupferschwergeräten einerseits und Flintbeilen andererseits fassbar. Strukturell vergleichbare Symbolsysteme existierten auch in West- und Nordeuropa, wo jedoch Jadeit- bzw. Flintbeile als tragende Objekte in Erscheinung träten. Auch zwischen diesen verschiedenen Netzwerken auf europäischer Ebene seien Austausch, Kommunikation und wechselseitige Beeinflussung zu beobachten.
Die Linienbandkeramik war Gegenstand von lediglich zwei Vorträgen. Robin Peters (Köln) schilderte ein Modell der diachronen Entwicklung in Form demographisch-kultureller Zyklen. Der Vorstellung einer linearen Evolution stellte er ein an die sozio-ökologische Resilience-Theorie angelehntes Modell zyklisch wiederkehrender Muster gegenüber. Dabei würden die aufeinander folgenden Phasen des Wachstums, der Konservierung, der Störung und Neubildung sowie schließlich der Reorganisation stets aufs Neue durchlaufen. Die Intensität der kulturellen Kontakte bzw. der Grad der Regionalisierung sei im Laufe der Zyklen ebenfalls Schwankungen unterworfen, wobei eine zentrale Annahme des Modells darin besteht, dass eine geringere Bevölkerungsdichte zu einer Intensivierung der externen Kommunikation führe. Insbesondere diesen Zusammenhang versucht Peters anhand zweier Fallbeispiele, der Linienbandkeramik im Rheinland und der Pfyner Kultur am Bodensee, nachzuvollziehen.
Überraschende Ergebnisse der Strontium-Isotopenanalysen an den Menschenknochen von Herxheim präsentierte Rouven Turck (Heidelberg/Zürich). Es zeigte sich, dass ein unerwartet hoher Anteil der in der Grubenanlage bestatteten bzw. deponierten Individuen nicht aus den Lösslandschaften in unmittelbarer Umgebung stammt, sondern aus Mittelgebirgen. Dies hat zwangsläufig weitreichende Implikationen für die Interpretation der Herxheimer Anlage und wirft zuallererst die Frage auf, um wen es sich bei den Ortsfremden handelt – diskutiert wurden zum einen Mesolithiker, zum anderen Angehörige der linienbandkeramischen Kulturgemeinschaft, die spezialisierte Tätigkeiten in den Mittelgebirgen ausführten, sowie schließlich bislang archäologisch völlig unbekannte Gruppen.
Eine Reihe von Vorträgen widmete sich dem Neolithikum des nördlichen Mitteleuropa von den Küsten bis zum nördlichen Randbereich der Mittelgebirgszone. Kurzfristig ausfallen mussten leider die Beiträge von Renata Zych (Rzeszów) zu „Intercultural Relations in the Neolithic in the Vistula and San basins“ sowie von Luise Lorenz (Kiel) über „Rekonstruktion von Kommunikationsräumen der Trichterbecher- und der Kugelamphorenkultur aus nordostdeutschen Megalithgrabinventaren“. Beide liegen jedoch im vorliegenden Band in Druckfassung vor.
Mit der Neolithisierung in der Mecklenburger Bucht setzte sich Laura Thielen (Hamburg) auseinander. Kontakte der mesolithischen zu den südlich benachbarten neolithischen Kulturen bestanden bereits lange zuvor, was sich z. B. in den Importen von Felsgesteingeräten als Prestigegütern äußere. Zur Adaption der neuen Wirtschaftsweise sei es dagegen erst schrittweise in der Folge von Umwelt- und Landschaftsveränderungen, einer Gefährdung der nahrungswirtschaftlichen Versorgung und zunehmendem Wettbewerb zwischen den einzelnen Gruppen gekommen. Spezifische Aspekte des neolithischen Paktes seien gezielt aufgegriffen und an die eigenen Anforderungen angepasst worden. Den zugrunde liegenden Mechanismus beschreibt Thielen als imitation of the fittest. Auch hierbei spielten neben wirtschaftlichen Strategien aber gesellschaftliche Umstrukturierungen eine zentrale Rolle. Den Prozess der Neolithisierung fasst Thielen daher als „interdependentes Wirkungsgefüge“ ökonomischer und sozialer Interessen auf.
Björn Schlenker, Marcus Stecher, Sarah Karimnia, Kurt W. Alt und Susanne Friederich (Halle/Mainz) berichteten über aktuelle Ausgrabungen im Erdwerk von Salzmünde. Im Mittelpunkt standen dabei die Bestattungen und hier insbesondere die „Scherbenpackungsgräber“, bei denen die bestatteten Individuen mit kompakten Lagen aus Brandlehm und Scherben von bis zu 150 Gefäßeinheiten abgedeckt wurden. Eine Deutung der Salzmünder Bestattungssitten ist nach wie vor schwierig und soll Gegenstand eines geplanten Forschungsprojekts sein.
Zu Beginn des zweiten Sitzungstages präsentierte Manfred Woidich (Berlin) einige Ergebnisse seiner Dissertation zur westlichen Kugelamphorenkultur. Auf der Basis multivariater Statistik und räumlicher Analysen erarbeitete er eine neue zeitliche und regionale Gliederung. Sehr deutlich wurde die enge Verflechtung mit benachbarten Kulturgruppen bis hin zur Bildung von „Hybridstilen“. Abschließend widmete Woidich sich der Frage der Entstehung der Kugelamphorenkultur, die er in der Zeit vor 3100 v. Chr. in Kujawien verortet.
Sara Schiesberg (Köln) diskutierte Ansätze zur Interpretation von Megalithgräbern als Markierungen von Territorien oder Wegen anhand der zwei Beispielregionen Rügen und Uelzen. Mittels räumlicher Statistik konnte sie zeigen, dass sich die Großsteingräber untereinander „anziehen“, wogegen sich Gräber und Siedlungen eher „abstoßen“. Die Anordnung der Gräber in der Landschaft sei außerdem tendenziell linear, eine Anordnung entlang von Wegen also plausibel. Ferner beobachtete Schiesberg abweichende Verteilungsmuster auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (kleinräumige Clusterbildung der Gräber vs. regelmäßige Verteilung der Cluster im großräumigen Maßstab).
Der letzte Vortrag zum Thema „Kulturkontakt und Kommunikation“ führte wieder in den süddeutschen Raum. Martin Nadler betrachtete eine Gruppe urnenfelder- und hallstattzeitlicher Gräber aus dem Regnitztal, deren „Zeichensteine“ bislang als regionale Besonderheit Frankens gedeutet worden waren. Entgegen dieser Deutung konnte Nadler plausibel machen, dass es sich um jung- bzw. spätneolithische Steinplatten in sekundärer Verwendung handelt. Die so neu erschlossene Denkmälergruppe ordnete er durch die Betrachtung verschiedener charakteristischer Merkmale als Teil eines weit verbreiteten Motivkanons des 4. und 3. Jahrtausends zwischen Alpen und Mitteldeutschland ein.
Am Nachmittag des zweiten Sitzungstages wurden in sechs Vorträgen aktuelle Forschungen zum Neolithikum außerhalb des Themas „Kulturkontakt und Kommunikation“ präsentiert. Thorsten Schunke (Halle) stellte eine Siedlung der Stichbandkeramik und der Rössener Kultur aus dem Bereich des Erdwerks von Salzmünde vor. Die außergewöhnlich gut erhaltenen Hausgrundrisse zeigten eine deutliche Kontinuität der Hausstandorte und legten in einem Fall sogar die bewusste Bezugnahme eines Rössen-zeitlichen Grundrisses auf einen älteren stichbandkeramischen nahe. Anhand dieses Befundes stellte Schunke die Frage zur Diskussion, wie lange neolithische Häuser genutzt wurden.
Oliver Rück (Halle) stellte die trichterbecherzeitliche Kreisgrabenanlage von Belleben 1 vor, die im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung“ ausgegraben wird. Eine auffällige Befundgattung deutete Rück als schrägstehende Pfosten, die sich vermutlich zu linearen Strukturen verbinden ließen. Für die Deutung der Anlage verspricht vor allem die Auswertung der Fundverteilungen wichtige Erkenntnisse. So verwies Rück etwa auf eine ungleichmäßige Verteilung von Knochen und Keramik im Graben und auf die Streuung von anpassenden Scherben über bis zu 60 m Entfernung.
Ebenfalls ein Teilprojekt des DFG-Schwerpunktprogramms „Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung“ ist die Untersuchung von Franziska Hage (Kiel) in der trichterbecherzeitlichen Kleinregion Büdelsdorf/Borgstedt (Schleswig-Holstein). Hier liegen ein Grabenwerk sowie verschiedene, mitunter räumlich auf dieses bezogene nichtmegalithische und megalithische Grabbauten vor. Besonders auffällige Befunde sind Miniaturdolmen, die in ihrem Aufbau Großsteingräbern gleichen.
Ein trichterbecherzeitliches Grabenwerk bei Albersdorf-Dieksknöll präsentierte Hauke Dibbern (Kiel). In den Gräben fanden sich verschiedene Deponierungen, der Innenraum des Erdwerks war dagegen weitgehend fundleer. Dibbern ging daher davon aus, dass sich die Aktivitäten primär auf die Grabenbereiche selbst konzentrierten. Dabei sei von mehreren, jeweils nur kurzen Nutzungsphasen auszugehen.
Einen Brunnen aus dem trichterbecherzeitlichen Siedlungsplatz Oldenburg-Dannau LA 77 (Schleswig-Holstein) stellte Jan Piet Brozio (Kiel) vor. Die Siedlung befand sich während des Neolithikums auf einer Insel im Brackwasser, der Brunnen sicherte offenbar die Süßwasserversorgung. Die Feuchterhaltung lässt bei fortschreitendem Auswertungsstand interessante Einblicke in die Wirtschaftsweise erwarten.
Den Abschluss der Tagung bildete ein Vortrag von Niels Bleicher (Zürich) über die Rettungsgrabung im Bereich des Parkhaus Opéra in Zürich. Mit einer Fläche von 3000 m2handelt sich um die größte Pfahlbaugrabung seit derjenigen in Zürich-Mozartstraße. Eindrucksvoll illustrierte Bleicher die besonderen Herausforderungen der vollständig unterirdisch ausgeführten Arbeiten und legte die Strategien dar, die in Anbetracht des immensen Zeitdrucks zur Optimierung des wissenschaftlichen Informationsgewinns verfolgt wurden. Ein Ausblick auf die bisher bereits angelaufenen Auswertungen ließ erahnen, welche wichtigen Erkenntnisse von der Aufarbeitung des Fundplatzes zukünftig noch zu erwarten sind.
Im vorliegenden Band werden zehn der Tagungsbeiträge veröffentlicht, von denen acht dem Tagungsthema „Kulturkontakt und Kommunikation“ gewidmet sind und zwei sich mit „aktuellen Forschungen zum Neolithikum“ befassen. Nicht zur Publikation eingereicht wurden die Beiträge von M. Furholt, R. Turck, B. Schlenker u. a., M. Woidich, S. Schiesberg, M. Nadler, T. Schunke, O. Rück, J. P. Brozio und N. Bleicher.
Anmerkungen
1 A. Krenn-Leeb/H.-J. Beier/E. Claßen/F. Falkenstein/S. Schwenzer (Hrsg.), Varia neolithica V. Mobilität, Migration und Kommunikation in Europa während des Neolithikums und der Bronzezeit. Beiträge der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften Neolithikum und Bronzezeit während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten, 6.–8. Juni 2006. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 53 (Langenweißbach 2009).
2 Die Abstracts der Vorträge können auf der Homepage der AG Neolithikum (www.ag-neolithikum.de) heruntergeladen werden.
Dr. Thomas Link
Landesamt für Denkmalpflege
im Regierungspräsidium Stuttgart
Ref. 82 - Denkmalfachliche Vermittlung
Redaktion Archäologie
Berliner Str.aße 12
73728 Esslingen am Neckar
Dr. Joanna Pyzel
Uniwersytet Gdański
Instytut Archeologii i Etnologii
ul. Bielańska 5
PL-80-851 Gdańsk
Homepage der AG Neolithikum:
www.ag-neolithikum.de
Gemeinsame Mailadresse der Sprecher:
Zur Nutzungsdauer neolithischer Monumente im südjütischen Raum. Untersuchungen an Grabenwerk und Megalithgräbern in der Region Albersdorf (Dithmarschen)
Hauke Dibbern
Innerhalb der letzten drei Jahre haben im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Schwerpunktprogramms 1400 „Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung“ an mehreren neolithischen Monumenten in und um Albersdorf verschiedene Grabungen stattgefunden. Das Gebiet ist reich an trichterbecherzeitlichen Fundstellen, darunter das Grabenwerk Albersdorf-Dieksknöll sowie eine Reihe monumentaler Grabanlagen unterschiedlichen Typs.
Albersdorf liegt im südwestlichen Teil Schleswig-Holsteins, etwa 20 km von der heutigen Nordseeküste entfernt (Abb. 1). Die Kleinregion ist Teil der Dithmarscher Geest, eines Altmoränengebiets, das in seinen Grundzügen durch Gletschervorstöße im Zuge der Saalekaltzeit geformt wurde. Das Weichselglazial erreichte den Westen der jütischen Halbinsel zwar nicht mehr direkt, sorgte jedoch durch periglaziale Erosionsprozesse nochmals für eine deutliche Überprägung der Morphologie, was sich in einem vergleichsweise stark relieffierten Landschaftsbild äußert (vgl. Meynen/ Schmidthüsen 1962).
Auf den über den Niederungen gelegenen Geländeformationen der Albersdorfer Kleinregion befinden sich etliche neolithische und bronzezeitliche Fundstellen. Die monumentalen Grabanlagen der Trichterbecherkultur machen dabei mit mindestens fünf Langbetten und weiteren fünf in Rundhügeln angelegten Megalithgräbern einen großen Anteil aus. Das Grabenwerk auf dem „Dieksknöll“ liegt südwestlich der Ortschaft Albersdorf an der Spitze eines Geländerückens, der auf drei Seiten von Niederungen eingeschlossen wird und somit räumlich von den Arealen mit trichterbecherzeitlichen Gräbern abgesetzt ist (Abb. 2).
Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse sind das Resultat archäologischer Untersuchungen an zwei monumentalen Grabanlagen – dem Langbett LA 56 und dem in einem Rundhügel befindlichen Megalithgrab LA 5 („Brutkamp“) – sowie am Grabenwerk auf dem Dieksknöll (Albersdorf LA 68). Die Basis für die Untersuchung der jeweiligen Nutzungsdauer aller drei Fundplätze bilden in erster Linie radiometrische Datierungen. Bislang wurden 33 Proben organischer Makroreste, zumeist kurzlebiges Material, datiert (vgl. Abb. 3). In einigen Fällen konnten bei ausreichender Probenmenge auch Mehrfachmessungen an ein und derselben Probe durchgeführt werden, was zu einer entsprechenden Präzisierung des Datierungsergebnisses führte. Die absolutchronologische Einordnung des Grabenwerks fußt auf der Datierung von neun Einzelbefunden der Grabenwerkseinhegung. Acht davon repräsentieren separate Verfüllschichten innerhalb zweier Grabensegmente und einer zwischen den Grabenköpfen befindlichen Grube, eines stammt aus dem Palisadengräbchen, das die Grabeneinfassung auf der Innenseite begleitet. Das Megalithgrab Albersdorf-Brutkamp (LA 5) ist über Daten aus insgesamt sechs Befunden aus dem Bereich der Hügelaufschüttung und einer Steinstandgrube zeitlich zu verorten. Aus dem Langbett LA 56 sind neun Befunde absolut datiert, einerseits stammen die Proben aus verschiedenen Hügelaufschüttungen, andererseits aus Befunden aus dem Bereich der zentralen Kammer sowie einer vorgelagerten Ausräumzone.
Hauke Dibbern
Kulturkontakt und Kommunikation
Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG Neolithikum 5. Kerpen-Loogh 2017, 13−22
Abb. 1 Lage der Kleinregion Albersdorf.
Charakteristische Leitfunde, die der typochronologischen Zuordnung der radiometrischen Daten dienen könnten, liegen leider nicht in allen Fällen vor. Was das Grabenwerk angeht, bereitet in dieser Hinsicht das insgesamt sehr geringe Fundaufkommen Probleme. Die Gräber liefern in Relation zu den gegrabenen Flächen deutlich mehr an Material. Hier führt jedoch, was die Keramik angeht, der hohe Zerscherbungsgrad dazu, dass nur ein geringer Teil der Gesamtfunde zu typochronologisch zuweisbaren Gefäßen rekonstruiert werden kann. Hinzu kommen teilweise komplizierte Depositionsprozesse, die zu Verlagerungen von älteren Formen in jüngere Schichtzusammenhänge führen können (s. u.). Unter den Silexartefakten existieren wiederum nur wenige Formen, die als feinchronologische Marker herangezogen werden können.
Eine 4-phasige absolutchronologische Sequenz für das Grabenwerk Albersdorf-Dieksknöll, basierend auf sechs 14C-Daten, wurde bereits an anderer Stelle vorgelegt (Dibbern 2012a). Durch drei neue Datierungen ist mittlerweile eine weitere Verfeinerung des Phasenmodells möglich, was leichte Modifikationen des bisherigen Bilds der Nutzungsgeschichte der Anlage nach sich zieht. Es handelt sich bei dem etwa 2,5 ha umfassenden, annähernd ovalen Grabenwerk um ein typisches causewayed enclosure, das von einer einzelnen Grabenreihe und einer Palisade umschlossen wird (vgl. Arnold 1997). In den untersuchten Grabensegmenten lassen sich wiederholte Aushebungen und Wiederverfüllungen erkennen, wie sie erstmals in dieser Deutlichkeit in Sarup (Andersen 1997) festgestellt wurden und mittlerweile von vielen anderen Grabenwerken Europas bekannt sind. Die unterschiedlichen Verfüllungen repräsentieren dabei punktuelle Ereignisse, die z. T. mit der rituellen Deponierung u. a. von zerschlagenen Gefäßen einhergehen. Ferner sind stark holzkohlehaltige Schichten zu beobachten, die einerseits in die Gräben gelangten Brandschutt, andererseits – und zwar alle untersuchten Grabensegmente nach oben hin abschließend – Feuerereignisse in den Gräben selbst repräsentieren.
Das älteste Datum aus dem Albersdorfer Grabenwerkskomplex liegt zwischen ca. 3660–3640 cal BC1 und stammt aus einer Brandschicht innerhalb eines der Grabensegmente. Damit liegt es früher als fast alle bislang bekannten Anlagen im südskandinavischen Raum. Nur aus zwei Grabenwerken, dem absolut datierten Starup-Langelandsvej (Lützau Pedersen/Witte 2012, 84) und dem typochronologisch anhand von Keramik datierten Aalstrup (Madsen 2007) liegen Belege für einen vergleichbar frühen Beginn vor. Dass die zuunterst liegenden Grabenverfüllungen des Albersdorfer Grabenwerks bislang noch gar nicht absolut datiert sind, spricht sogar für eine noch frühere Bauzeit der Anlage. Übereinstimmend mit den stratigraphischen Positionen weiterer Verfüllschichten werden auch die aus ihnen stammenden absoluten Datierungen jünger. Den Abschluss bildet ein Datum aus der obersten Brandschicht der zwischen zwei Grabenköpfen gelegenen Grube, das bei ca. 2580–2470 cal BC liegt. Die Gesamtdauer der Nutzung des Grabenwerks erstreckt sich demnach über etwa 1100–1200 Jahre von der frühen Trichterbecherkultur bis deutlich in das Jungneolithikum hinein. Hierin ist ein auffallender Gegensatz zu den bislang bekannten Grabenwerken im südskandinavischen Raum zu sehen, für welche – zumeist basierend auf typochronologischen Analysen – in der Regel primäre Nutzungszeiträume von nur einigen hundert Jahren angenommen werden (Andersen 1997, 274). Eine Ausnahme scheint hier die Anlage von Ballegaard in Nordostjütland zu sein, in deren Gräben sich neben trichterbecherzeitlicher Keramik auch Material der Einzelgrabkultur und des Spätneolithikums fand (Wincentz 1994).
Abb. 2 Trichterbecherzeitliche Monumente in der Kleinregion Albersdorf.
Erstaunlich am Albersdorfer Grabenwerk sind zudem die großen zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Aktivitätsphasen von jeweils mehreren Generationen. Liegen in den frühen Phasen bereits Jahrzehnte zwischen den Einzelereignissen, ist über die Zeit hinweg nochmals eine signifikante Abnahme der Aktivitätsfrequenz zu beobachten. Etwa um 3400 cal BC zeichnet sich ein deutlicher Bruch ab: Von diesem Zeitpunkt an liegen die Abstände zwischen den Eingriffen in die Gräben gleichbleibend bei etwa 220–250 Jahren. Der rituelle Charakter der nachweisbaren Handlungen, bestehend aus Wiederaushebung, Deponierung und Wiederverfüllung, bleibt dagegen offenbar vollkommen gleich.
Abb. 3 Liste der bislang datierten 14C-Proben der im Rahmen des SPP1400 untersuchten Fundplätze in Albersdorf.
Auch was die Nutzung monumentaler Grabbauten angeht, offenbaren sich im Albersdorfer Raum lang andauernde Traditionen. Das etwa 1 km vom Grabenwerk auf dem Dieksknöll entfernte Langbett LA 56 wurde 2011 untersucht, wobei am südwestlichen Ende des Hügels ein Querprofil angelegt wurde, in dem sich verschiedene Aufschüttungen zeigten (Dibbern 2012b). Die stratigraphische Sequenz beginnt mit einem ersten aus Soden aufgebauten Hügel, der von mehreren sandig-humosen Aufschüttungen überlagert wird (Abb. 4). Drei aus dem Profil vorliegende 14C-Daten belegen einen geringen zeitlichen Abstand zwischen den unterschiedlichen Hügelschüttungen. Folglich müssen diese als mehrere Konstruktionshorizonte eines einmaligen Bauprozesses interpretiert werden, welcher spätestens in der ersten Hälfte des 37. Jh. v. Chr. stattfand. Im Zentrum des Langhügels konnten die Reste einer vermutlich polygonalen Grabkammer dokumentiert werden, deren Boden aus einem Rollsteinpflaster bestand, dass von einer Schüttung verbrannten Flints überlagert wurde. Aus zwei Fundamentgruben von Kammerorthostaten stammen Daten, die zwischen etwa 3660–3540 cal BC liegen. Die Differenz zwischen dem Alter der Aufschüttungen des Langhügels und dem der Kammer ist dahingehend zu interpretieren, dass die Grabanlage zunächst als nichtmegalithisches Langbett angelegt wurde, während die Umwandlung in ein Megalithgrab erst mindestens einige Jahrzehnte später stattfand. Die sich anschließende Belegungszeit lässt sich sowohl anhand von Funden als auch über drei weitere absolute Datierungen gut erfassen (vgl. Abb. 3). Mit ersten Bestattungen im Anschluss an den Bau des Dolmens sind zwei Datierungen an ein und derselben Holzkohle aus dem Bodenpflaster in Zusammenhang zu bringen. Die Einzelmessungen liegen bei ca. 3630–3520 bzw. 3620–3380 cal BC, wobei die Kombinationskalibration eine größte Wahrscheinlichkeit (54,1 %) zwischen 3630–3580 cal BC ergibt. Die typochronologische Auswertung der Keramik ist zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, bei den vor der Kammer in einem flächigen Fundfächer verteilten Fragmenten scheint es sich aber größtenteils eher um mittel- als um frühneolithische Gefäße zu handeln. Dies deckt sich mit einem Datum zwischen 3330–3090 cal BC aus dem die Hauptmasse der Scherben enthaltenden Schichtzusammenhang. In diesem Zeitraum wurde die Kammer offenbar zumindest einmal bereinigt. Für eine Nachbestattung in einem glockenbecherzeitlichen Kontext könnte der Fund eines Bernsteinknopfes mit V-förmiger Durchlochung aus der Kammer sprechen. Eine Eingrabung im Kammerbereich enthielt übereinstimmend Holzkohle mit einem AMS-Datum von ca. 2550–2410 cal BC. Entsprechende Bernsteinknöpfe kommen jedoch etwa in Nordjütland ebenfalls vergesellschaftet mit Silexdolchen des frühen Spätneolithikums vor (Wincentz Rasmussen 1990). Mehrere Dolche vom Typ I nach Lomborg (1973) stammen auch aus dem Langbett LA 56, zwei davon wurden unmittelbar über dem Kammerpflaster geborgen2. Auch im Spätneolithikum werden demnach nochmals sekundäre Bestattungen in der trichterbecherzeitlichen Anlage vorgenommen. Insgesamt ergibt sich eine hohe Übereinstimmung zwischen typochronologisch relevanten Funden und den 14C-Datierungen aus den entsprechenden Schichtverbänden. Die gesamte Zeitspanne, in der das Langbett für Bestattungen genutzt wird, beträgt demnach gut 1500 Jahre. Trichterbecherzeitliche Nutzungsphasen liegen im Früh- und Mittelneolithikum vor und werden über eine dezidierte Fundanalyse noch näher einzugrenzen sein. Darüber hinaus wird die Anlage im Spätneolithikum (SN I) und möglicherweise bereits im Kontext des Jungneolithikums (JN I) erneut zu Bestattungszwecken genutzt.
Abb. 4 Albersdorf LA 56: Querprofil des Langhügels. Die Basis der Schichtabfolge bilden Sodenpackungen, welche wiederum von mehreren sandig-humosen Aufschüttungen überdeckt werden.
Für das Megalithgrab „Brutkamp“ ist im Gegensatz zum Langbett LA 56 von einer etwas jüngeren Entstehungszeit auszugehen. Die Anlage besteht aus einer polygonalen Kammer mit einem etwa 18 t schweren Deckstein und einem aus ehemals zwei Jochen bestehenden Zugang auf der südöstlichen Seite. Eingebettet ist der Dolmen in einen Rundhügel, der von einem Steinkranz begrenzt wird. Untersucht wurde eine 13,5 m2 große Fläche vor dem Kammerzugang (Dibbern/Hage 2010). Die stratigraphische Sequenz des Hügels besteht im Wesentlichen aus drei anthropogen aufgebrachten Schichten, zwei sandig-humosen Aufschüttungen sowie einer kompakten Steinpackung, die beide Schichten voneinander trennt. Für die chronologische Entwicklung, die sich in der stratigraphischen Abfolge verbirgt, stehen neben mehreren AMS-Daten eine Reihe typochronologisch datierbarer Funde zur Verfügung. Die Bauzeit des Grabes lässt sich mithilfe einer Probe aus einer der Fundamentgruben des Steinkranzes ermitteln, die ein Alter zwischen ca. 3630–3530 cal BC ergab. Aus der unteren Hügelschüttung selbst liegen zwei deutlich voneinander abweichende Daten von einerseits 3520–3380 cal BC und andererseits 3330–3100 cal BC vor. Bei der Beurteilung dieser Datierungen muss berücksichtigt werden, dass der Grabungsschnitt im Bereich einer Zone lag, die durch wiederholte Eingriffe in die Hügelsubstanz im Zusammenhang mit Kammerbereinigungen geprägt ist. Dies spiegelt sich ebenfalls in der Verteilung von Keramikfragmenten wider, unter denen sich Formen des FN II–MN I/II sicher nachweisen lassen. Sowohl die aufliegende Steinpackung als auch die anschließende zweite sandige Hügelschüttung stellen demgegenüber Befunde einer spätneolithischen Sekundärnutzung dar. Neben wiederum typologisch in das SN I gehörigen Silexdolchen belegen diesen Zeitansatz übereinstimmend zwei Datierungen von ca. 2200–2050 bzw. 2190–2040 cal BC. Aus den spätneolithischen Überhügelungen stammt darüber hinaus trichterbecherzeitliche Keramik sowie größere Mengen verbrannten Flints, die offensichtlich aus der Kammer stammen (Abb. 5). Dies spricht für eine tiefgreifende Kammerbereinigung im Spätneolithikum und liefert somit einen indirekten Nachweis, dass auch in diesem Zeitabschnitt die Grabkammer nochmals als Bestattungsort gewählt wurde.
Abb. 5 Albersdorf„Brutkamp“: 3- dimensionale Darstellung des untersuchten Areals. Kartiert ist die räumliche Verteilung des im Zuge von Ausräumereignissen aus der Kammer nach außen verlagerten verbrannten Flints (Punktgröße nach Gewicht je Quadrant und Abtrag).
Vergleicht man die Nutzungszeiträume, die sich für die vorgestellten Anlagen über absolute und relativchronologische Datierungen rekonstruieren lassen, fällt als übergreifendes Muster zunächst eine allgemein lange Laufzeit von deutlich über 1000 Jahren auf. Bei den Gräbern lässt sich dabei jeweils eine primäre – trichterbecherzeitliche – von einer sekundären Belegungsphase differenzieren (Abb. 6). Erstere umfasst sowohl am Langbett LA 56 als auch am „Brutkamp“ neben dem entwickelten Frühneolithikum auch noch Teile des Mittelneolithikums, worauf sich in beiden Fällen ein Hiatus von mindestens 500 Jahren anschließt. Die Gräber unterliegen also offensichtlich einem Bedeutungsverlust im späten Mittelneolithikum. Mit den ursprünglichen Vorstellungen, die hinter der Errichtung und Nutzung monumentaler Kollektivgräber stecken, haben die jung- und spätneolithischen Sekundärbestattungen vermutlich nur noch wenig zu tun. Die Nutzung des Grabenwerks Albersdorf-Dieksknöll, das etwa zur gleichen Zeit wie das Langbett LA 56 entstand, verläuft im Gegensatz dazu äußerst kontinuierlich. Auch wenn gerade in den jüngeren Phasen des Grabenwerks große Abstände zwischen den Einzelaktivitäten liegen, geriet der Zweck der Anlage bis weit in das Jungneolithikum hinein offenbar zu keiner Zeit in Vergessenheit. Die Feuerereignisse in Gräben und Gruben könnten als ein bewusst herbeigeführtes Ende der Grabenwerkstradition und der mit der Anlage in Verbindung stehenden Riten aufgefasst werden. Auffällig ist der Umstand, dass parallel bzw. mit geringem zeitlichem Versatz zu der Aufgabe des Grabenwerks eine neue Welle von Bestattungen in den trichterbecherzeitlichen Kollektivgräbern beginnt. Um die möglichen Ursachen zu klären, die hinter dem Abbruch der Grabenwerkssitte einerseits und dem erneut aufkeimenden Interesse an den jahrhundertelang ungenutzten Grabmonumenten andererseits stehen wird die Auswertung paläoökologischer Daten und ein Vergleich mit weiteren entsprechend gut untersuchten Kleinregionen nötig sein.
Abb. 6 Summenkalibration der auswertbaren 14C-Daten aller drei besprochenen Fundplätze (Programm: OxCal v4.1.7).
Anmerkungen
1 Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle im Folgenden angegebenen Datierungsergebnisse auf den 1-Sigma Bereich.
2 Funde von Silexdolchen in Megalithgräbern sind ein weit verbreitetes Phänomen (Siemann 2003) und lassen sich auch in Albersdorf noch an mindestens einem weiteren Grab belegen (vgl. Aner 1951).
Literatur
Andersen 1997
N. H. Andersen, The Sarup enclosures. The Funnel Beaker Culture of the Sarup site including two causewayed camps compared to the contemporary settlements in the area and other European enclosures. Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter (Aarhus 1997).
Aner 1951
E. Aner, Die Steinkammern von Hörst, Albersdorf und Wittenborn. Offa 9, 1951, 2–11.
Arnold 1997
V. Arnold, Das jungsteinzeitliche Erd- und Grabenwerk auf dem Dieksknöll bei Albersdorf. Erste Untersuchungsergebnisse. In: V. Arnold (Hrsg.), Wall und Graben. Befestigungen von der Steinzeit bis ins Mittelalter in Schleswig-Holstein (Schleswig 1995) 14–25.
Dibbern 2012a
H. Dibbern, Das Albersdorfer Grabenwerk – eine mehrphasige Anlage mit ritueller Funktion. In: M. Hinz/J. Müller (Hrsg.), Siedlung, Grabenwerk, Großsteingrab. Studien zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt der Trichterbechergruppen im nördlichen Mitteleuropa. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 2, 271–295 (Bonn 2012).
Dibbern 2012b
H. Dibbern, Dem Fortschritt geopfert – Das Langbett LA 56 bei Albersdorf. Arch. Nachr. Schleswig-Holstein 2012, 32–34.
Dibbern/Hage 2010
H. Dibbern/F. Hage, Erdwerk und Megalithgräber in der Region Albersdorf. Vorbericht zu den Grabungskampagnen am Dieksknöll und am Brutkamp. Arch. Nachr. Schleswig-Holstein 2010, 34–37.
Lomborg 1973
E. Lomborg, Die Flintdolche Dänemarks. Studien über Chronologie und Kulturbeziehungen des südskandinavischen Spätneolithikums. Nordiske Fortidsminder B 1 (Kopenhagen 1973).
Lützau Pedersen/Witte 2012
S. Lützau Pedersen/F. Witte, Langelandsvej i Starup – en ceremoniel samlingsplads fra bondestenalderen. Langs Fjord og Dam 2012, 77–88.
Madsen 2007
T. Madsen, Aalstrup – a settlement site and causewayed enclosure at Horsens Fjord. www.archaeoinfo.dk (2007, letzter Zugriff 30.12.2013).
Meynen/Schmidthüsen 1962
E. Meynen /J. Schmidthüsen, Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, Band 2 (Bonn 1962).
Siemann 2003
C. Siemann, Flintdolche Norddeutschlands in ihrem grabrituellen Umfeld. Universitätsforsch. Prähist. Arch. 97 (Bonn 2003).
Wincentz 1993
L. Wincentz, Ballegaard. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1993, 176.
Wincentz Rasmussen 1990
L. Wincentz Rasmussen, Dolkproduktion og - distribution i senneolitikum. Hikuin 16, 1990, 31–42.
Hauke Dibbern
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian
Albrechts-Universität Kiel
Johanna-Mestorf-Strasse 2-6
24098 Kiel
Zusammenfassung
Der südwestlichste Randbereich der jütischen Halbinsel (Dithmarschen) zählt im Gegensatz z. B. zu Ostholstein nicht zu den Gebieten größter Fundplatzdichte im Verbreitungsraum der Trichterbecherkultur. Umso wichtiger ist der Umstand zu bewerten, dass in der Region Albersdorf eine Vielzahl trichterbecherzeitlicher Monumente vorhanden ist. Hierdurch ergibt sich eine Möglichkeit, auch in diesem – in dieser Hinsicht vergleichsweise fundarmen – Raum Forschungen zu kulturellen Entwicklungen während des nordischen Neolithikums zu betreiben und seine Stellung innerhalb des Trichterbecherkulturraums zu untersuchen. Im vorliegenden Beitrag sollen, gestützt auf 14C-Daten und typochronologisch datierbare Funde, die Laufzeiten des Grabenwerks Albersdorf-Dieksknöll sowie zweier monumentaler Gräber vorgestellt und miteinander verglichen werden um hieraus Erkenntnisse hinsichtlich ihrer Bedeutung für die ansässigen Gruppen über den Zeitraum des Neolithikums hinweg zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Grabenwerke, Megalithgräber, nichtmegalithische Langbetten, Trichterbecherkultur, absolute Chronologie
Summary
Within the distribution area of the Funnel Beaker Culture (TRB) the southwestern periphery of the Jutland Peninsula (Dithmarschen) is not a zone of high site density i. e. compared to Eastern Holstein. In that regard, it is even more remarkable that in the Albersdorf region a large number of early and middle neolithic monuments exist. In a region which is otherwise rather poor in archaeological records on TRB legacy this fact offers the possibility to conduct investigations on cultural developments in Nordic Neolithic and to classify its position within the TRB cultural area. Based on radiocarbon data as well as on typo-chronologically dated finds, the paper presents a comparative analysis of usage periods of a causewayed enclosure on the one hand and two monumental tombs on the other hand. As a result conclusions on the meaning of the monuments for the local population over the Neolithic period can be drawn.
Keywords
causewayed enclosures, megalithic tombs, earthern longbarrows, Funnel Beaker Culture, absolute chronology
Das trichterbecherzeitliche Gräberfeld von Borgstedt: Frühe radiometrische Daten für ein nicht-megalithisches, hölzernes Langbett und einen späteren Dolmen
Franziska Hage
Einleitung
In der Region um Büdelsdorf/Borgstedt finden sich zahlreiche Spuren einer trichterbecherzeitlichen Besiedlung, welche die Landschaft bis heute prägen und von der intensiven Nutzung dieses Areals zeugen (Abb. 1). In einem Umkreis der Ortschaft Büdelsdorf von ca. 10 km finden sich noch heute über 100 Megalithgräber, zahlreiche kleinere Siedlungen und das bekannte Grabenwerk Büdelsdorf LA 1. Dieses liegt auf einem natürlich geschützten Geländesporn am nördlichen Steilufer der Eider in der Gemeinde Büdelsdorf. Verkehrsgeografisch stellt diese Position einen wichtigen Knotenpunkt zwischen der wichtigsten Ost-West-Verbindung innerhalb Schleswig-Holsteins entlang der Eider und der Haupt-Nord-Südverbindung von Skandinavien bis weit in den Süden dar und unterstreicht die Bedeutung des Fundplatzes. Die ca. 4,5 ha große Grabenanlage wurde zu 20 % in mehreren Notgrabungskampagnen zwischen 1968 bis 1974 ergraben. Hierbei kamen ein beeindruckendes mehrreihiges Grabensystem mit begleitenden Palisaden sowie zahlreiche Spuren einer Siedlung und umfangreiches Fundmaterial zum Vorschein (Hage 2016). Doch wo befindet sich das zugehörige Gräberfeld? Eine Frage, welche man sich bereits während der Grabungen immer wieder stellte. Nur 800 m Luftlinie nördlich des Grabenwerks stieß man auf eine Gruppe von zwölf Grabanlagen, bestehend aus elf Langbetten und einem Rundhügel (Hage 2012, 227–246; Hage 2011, 39–42; Bauch 1988, 430–474; Bauch 1996, 386). Deren Ausrichtung zum Grabenwerk hin erweckt den Eindruck, es könnte ein Zusammenhang mit der Anlage Büdelsdorf LA 1 bestehen.
Architektur der Grabanlagen
Erste Ausgrabungen des Gräberfelds fanden bereits 1973 statt. Dabei wurde die Mitte eines Rundhügels freigelegt. Es zeigte sich, dass es sich um die Reste eines erweiterten Dolmens handelte. Bis auf eine Störung in Form einer Bestattung der Einzelgrabkultur war der Kammerboden noch intakt. Bereits zu dieser Zeit waren die Grabanlagen der Gruppe durch den Ackerbau und Steinsucher kaum noch zu erkennen und lediglich auf Luftfotos zu lokalisieren. Als das Gelände Mitte der 1980er bebaut werden sollte, fanden erneut Ausgrabungen an neun der elf Grabanlagen statt, bei denen auch eine bis dahin unbekannte zwölfte Anlage (LA 69) in zu vermutender Form eines Langbettes zu Tage kam (Abb. 2). Zwei mutmaßliche Langbetten (LA 23 und LA 24) zwischen LA 26 und LA 22 sind bis auf Oberflächenaufsammlungen, welche unter anderem geglühten Flint aber auch einige Keramikscherben zu Tage brachten, bis heute unerforscht und noch erhalten. Alle anderen Anlagen wurden komplett ausgegraben und damit vollständig zerstört.
Architektonisch weisen die Anlagen ein sehr heterogenes Bild auf. Schon die Ausmaße schwanken erheblich. Das Langbett LA 27 ist mit über 200 m Länge und 22 m Breite das mit Abstand größte der Gräbergruppe. Die übrigen Langbetten schwanken in der Länge zwischen 40 und 120 m und in der Breite zwischen 7 und 22 m. Bei dem Rundhügel LA 28 konnte ein Durchmesser von 12,5 m ermittelt werden. Nicht nur die Dimensionen der Grabanlagen variieren, sondern auch der Baustil. Nur bei dem Rundhügel LA 28 und dem Langbett LA 26 war der für die trichterbecherzeitlichen Anlagen typische Steinkranz als Einhegung vorhanden. Vier Langbetten sind durch eine umlaufende Reihe von Gruben eingefasst (LA 27; 29; 31; 32). Innerhalb dieser nur für kurze Zeit geöffneten Gruben fanden sich mehrere Keramikdeponierungen. Auffällig ist, dass die Anlagen, welche von Gruben eingegrenzt werden, sich im Süden befinden und mit Ausnahme von LA 29 auch die größten der Gruppe darstellen. Dagegen weisen die Anlagen im Norden (LA 26 und LA 22) sowie LA 30 als Randbegrenzung Pfostenstellungen auf. Im Falle von LA 22 handelt es sich sogar um Doppelpfosten. Bei diesen Anlagen scheint es auch keine Überhügelungen geben zu haben.
Thomas Link und Joanna Pyzel (Hrsg.)
Kulturkontakt und Kommunikation
Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG Neolithikum 5 (Kerpen-Loogh 2017) 23–31
Abb. 1 Kartierung der neolithischen Siedlungsstellen und Grabanlagen um Büdelsdorf/Borgstedt. ©LVermGeo SH
Abb. 2





























