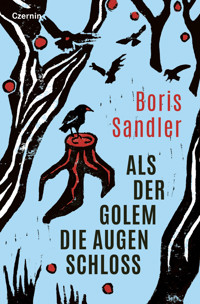14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reisetasche voller Magie Der international renommierte Schriftsteller Boris Sandler entführt mit seinen Erzählungen in eine vielfach vergessene Welt, deren Drehscheibe hierzulande einst Wien war: in jene der jiddischen Sprache und Kultur. Geschickt versteht er es in seinen Erzählungen, Reales und Fiktives zu verweben, Skurriles und Wehmütiges dazu zu packen, die Wärme jüdischer Familien mit der Kälte der politischen Ereignisse im Umfeld des Zweiten Weltkrieges zu mischen und sowohl dem – vom Autor selbst erlebten – sowjetischen Alltag unter Stalin als auch den Schicksalen von jüdischen Emigrant*innen in Israel und den USA nachzuspüren. Alle Protagonist*innen bringen einen Koffer voller kurioser Erinnerungen und Magie mit: Da fährt ein ungeborenes Kind in einem Soldatenzug zur Front, um sich seinen künftigen Vater auszusuchen. Da lässt sich ein jüdischer Lausbub von einem Dieb das faszinierende Handwerk erklären. Da werden Nasen bei Nacht selbstständig, Diamanten wachsen in Kartoffelschalen und Spiegelbilder führen ein Eigenleben. Das Glück ist oft zum Greifen nah, und wird doch nicht erkannt. Auch Erinnerungen machen glücklich, heißt es. Was aber tun, wenn man sich immer nur an einen Tag zurückerinnern kann? Die einst dominierende Sprache der österreichischen Jüdinnen und Juden in deutscher Übersetzung Vielschichtige Verarbeitung von Migration und Trauma
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 Verlag Anton Pustet
Bergstraße 12, 5020 Salzburg
Sämtliche Rechte vorbehalten.
Lektorat: Markus Weiglein
Grafik und Produktion: Nadine Kaschnig-Löbel
Coverbild: Michael Gleizer
eISBN 978-3-7025-8092-6
auch als gedrucktes Buch erhältlich:
ISBN 978-3-7025-1052-7
www.pustet.at
Boris Sandler
Kuriositätenaus der Reisetasche
Aus dem Jiddischenvon Andrea Fiedermutz
Inhalt
Vorbemerkungen der Übersetzerin
Diamanten und Kartoffeln: Boris Sandlers Kuriositäten aus der Reisetasche
Das Rad des Schicksals
Erzählungen:
Rund um die Nase
Der Künstler und der Schochet
Zu den Klängen von Jazz
Die Vollmondnacht
Ein Dorfjude
Gedenktag im Amnesie-Städtchen
Kuriositäten aus der Reisetasche
Modi verstehen oder Eva nicht vergessen
Kleine Wichte
Der „Schwarze Teller“
Roter Cadillac
Wohin ist Bumbumtschik verschwunden?
Der lange Weg nach Hause
Durch Schickses zum Mann geworden
Das Gespenst des Dorfes Piatranescht
Das Leben ist ein Spiel
„Regime-Subjekt“ Grischa Marantz
Der Prinz wird zur rechten Zeit kommen
Solfeggio-Übungen
Verspätetes Echo aus der Kobyljanska-Straße
Taubenzüchter Falik oder die Geschichte meines Taubenschlags
Anmerkungen
Vorbemerkungen der Übersetzerin
Boris Sandler gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren des Jiddischen. Geboren in Belz, dem einst so bedeutenden jüdischen Zentrum mit einer stark jiddisch geprägten Kultur, ist sein bessarabisches Jiddisch bis heute reich, saftig und unverkennbar, sein Stil erinnert zeitweise an Scholem Alejchem. Geschickt versteht er es, Reales und Fiktives zu verweben, Skurriles und Wehmütiges dazu zu packen und die Wärme der jüdischen Familien mit der Kälte der politischen Ereignisse zu mischen – auf diese Weise lässt er die Leserinnen und Leser sowohl den sowjetischen Alltag nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als auch die Schicksale von jüdischen Einwanderinnen und Einwanderern in Israel und den USA bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erleben.
Alle schleppen ihren eigenen Koffer voller Erinnerungen mit, und da und dort ist Magie im Spiel: Da werden Nasen bei Nacht selbstständig, Diamanten wachsen in Kartoffelschalen und Spiegelbilder führen ein Eigenleben. Dabei sind jüdische Emigration und Trauma durch Krieg, Holocaust, Pogrome und Totalitarismus wiederkehrende Themen in Sandlers Werken. Wir folgen auch in diesem Buch verschiedenen Schilderungen von Kindern, die Sandler stets besonders wichtig sind: angefangen beim ungeborenen Kind, das in einem Soldatenzug an die Front mitfährt, um sich einen künftigen Vater auszusuchen, bis zu einem Lausbub, der eine jüdische Hochzeit aufmischt, und einem weiteren, der sich von einem professionellen Dieb das Handwerk erklären lassen will.
Wie es Professor Krutikov ausdrückt, der das Vorwort zum vorliegenden Erzählband verfasste: Jeder Leser, jede Leserin wird Boris Sandlers Prosa auf seine/ihre eigene Weise lesen und interpretieren, und jeder Mensch wird dabei etwas Kostbares und Kurioses für sich entdecken.
Das vorliegende Buch gliedert sich in 21 Erzählungen und schließt mit einem Endnotenapparat, der Begrifflichkeiten aus der jiddischen Sprachwelt erklärt und mit weiterführender Information für alle Interessierte aufwartet.
Auch zu Österreich hat der international tätige Autor einen Bezug: Nicht nur war Wien im frühen 20. Jahrhundert eine Drehscheibe der jiddischen Kultur und sind viele seiner moldawischen Freunde aus Kindheit und Jugend inzwischen in Wien wohnhaft – auch seine Übersetzerin stammt aus Österreich.
2021 hielt Boris Sandler an der Universität Wien einen gefeierten Gastvortrag auf Jiddisch und gab seiner Hoffnung Ausdruck, Wien möge erneut ein Mittelpunkt der jiddischen Kultur werden. Umso erfreulicher ist es daher, dass es wiederum ein österreichischer Verlag ist, der Sandlers Erzählband auf Deutsch veröffentlicht und die Leser*innen mit der prall gepackten Reisetasche an Geschichten auf eine fesselnde Reise schickt.
Andrea FiedermutzWien, im Frühjahr 2022
Diamanten und Kartoffeln: Boris Sandlers Kuriositäten aus der Reisetasche
Vorwort von Michail Krutikov, Professor für Literatur an der University of Michigan, Ann Arbor
Der englische Philosoph Jeremy Bentham hat einmal gesagt, die Wirklichkeit sei die beste Widerspiegelung von einem selbst. Dies hat Boris Sandler wie ein Epigraph vor eine der Geschichten in diesem Erzählband gestellt. Benthams Worte können wie ein Schlüssel zum ganzen Buch dienen, vielleicht überhaupt zu Sandlers gesamtem Werk.
Der junge Held aus der genannten Erzählung Das Leben ist ein Spiel beschäftigt sich mit dem Kinderspiel, verschiedene Figuren aus Plastilin zu formen. Dieses Spiel gleicht auf schöpferischer Ebene einem Schriftsteller, der eine neue Wirklichkeit aus seiner eigenen Vorstellungskraft erschafft.
Dieser schöpferische Prozess hat zwei Komponenten: das Subjekt, das heißt, das schöpferische „Ich“ des Autors, und das Objekt, die ausgedachte Wirklichkeit. In Sandlers Werk sind beide gleich wichtig und interessant. Meistens schreibt er in der ersten Person. Das heißt natürlich nicht, dass sein erzählendes „Ich“ tatsächlich er selber höchstpersönlich ist. Der Leser möge sich dies nicht durch den familiär-natürlichen Ton suggerieren lassen. Es handelt sich hier nicht um autobiographische Erinnerungen, sondern um erfundene Fakten, welche durch den professionellen Autor kunstvoll zusammengebaut wurden. Natürlich schöpft er auch aus seinem eigenen Leben und seinen Erfahrungen, doch die Resultate seiner Arbeit sind doch Produkte seiner literarischen Fantasie.
Der Hauptheld, der wie ein Rückgrat den Großteil der Erzählungen in dem Buch verbindet, ist tatsächlich das „Ich“ des Erzählers. Wir begegnen ihm in verschiedenen Begleitumständen und Umgebungen, als Kind in seiner Familie und seiner bessarabischen Heimatstadt in den 1950er Jahren, als jungem Mann in verschiedenen Teilen der Sowjetunion und als einem „russischen“ Emigranten in Amerika.
Für einen heutigen Forscher, der sich mit der sowjetisch-jüdischen „Identität“ beschäftigt, liefert Sandlers Werk eine reiche Fülle nützlicher Informationen. Vor allem aber sind seine Bücher literarische Kunstwerke. Die jiddische Literatur verfügt über eine reiche Tradition vom Spiel mit erzählenden Stimmen und Personen, begonnen bei Scholem Jankev Abramowitschs Kunstfigur Mendele Mojcher Sforim. Sandler steht fest verwurzelt in der Tradition dieser „Klassiker“. Sein jungenhafter Erzähler ist ein Nachfolger von Scholem Alejchems Motl, der kindliche Naivität und scharfsinniges Gespür für wichtige Details mit der ironischen Sichtweise eines erfahrenen Menschen kombiniert.
Da gibt es zum Beispiel eine Episode in der Erzählung Der Schwarze Teller. Die gesamte Geschichte wird um das einfache sowjetische Radiogerät gebaut, das sich praktisch in fast jeder Wohnung der damaligen UdSSR befand. Der „Schwarze Teller“ wird zu einer Persönlichkeit mit einem eigenständigen Charakter: „Er war ein Teil unserer Familie und sprach wie alle anderen Mitglieder ständig allein und hörte nicht zu, was man zu ihm sagte. … Jeder im Haus hatte zum ‚Schwarzen Teller‘ seine eigene Beziehung.“ Der fromme Großvater, der „all die Jahre vor dem Krieg in einem kleinen Schtetl gelebt hatte“, behauptete, dass die schwarze Sache „trejf“ [unrein, also nicht koscher; Anm. d. Übers.] sei und keine Weisheit brächte, weil sie „von der Regierung komme“.
Die Mutter wiederum liebte es, sich musikalische Programme anzuhören, besonders das Konzert laut Ihren Bestellungen. Eines Tages nahm sie all ihren Mut zusammen und schrieb einen Brief an die Moskauer Radiostation mit der Bitte, man möge im Radio ein jiddisches Lied spielen.
Und da geschah wirklich ein „Wunder“: Im Moskauer Radiosender wurde das Lied Itzik hat schon Hochzeit gehalten gespielt! Das rüttelte die gesamte jüdische Gemeinde der Stadt wach: „Man wusste natürlich sehr wohl, dass in unserem Land nichts ‚einfach so‘ vorkam, vor allem, wenn es mit Juden zu tun hatte.“
Die Stadtväter zerbrachen sich die Köpfe über die Bedeutung dieses Signals, das der Staat durch das Spielen von Itzik in der Moskauer Radiostation hinaussandte, während die einfachen Juden die Mutter baten, sie möge doch noch weitere jiddische Lieder bestellen. Hier fügt Sandler ein kleines Detail an, das wirklich eine seiner „Kuriositäten aus der Reisetasche“ darstellt: „Einer ließ sogar durch unsere Nachbarin einen Zettel schicken, auf dem er die Mutter bat, sie möge doch im Radio das hebräische Gebet ‚Avinu malkeinu‘ bestellen. Mündlich fügte seine Vermittlerin noch hinzu, dass er, wenn nötig, bereit sei, in bar zu zahlen.“
Bis zu diesem humoristischen Höhepunkt liest sich die Erzählung wie eine Fortsetzung von Scholem Alejchems Kasrilevker Geschichten, aber in diesem Moment macht Sandler eine Kehrtwendung und wir stehen auf einmal der sowjetischen Obrigkeit gegenüber: Zwei Wochen später wurde die Mutter ins Personalbüro ihrer Firma vorgeladen. Dort saß ein höflicher Mann in Zivil. Er riet ihr, keine jiddischen Lieder mehr zu bestellen, denn „es gäbe da Leute, die ihre aufrichtige nationale Gesinnung für schlechte Zwecke ausnützen könnten …“
Nach der Begegnung mit dem KGB-Offizier war die Mutter so erschrocken, dass sie jahrelang niemandem darüber ein Wort erzählte. Erst in Israel, nachdem sie dort schon fünfzehn Jahre gelebt hatte, erzählte sie dem Autor von diesem Gespräch. So groß war die Angst, die der sowjetische Staat in die Seelen seiner Bürger hatte einsickern lassen!
Die Titelerzählung Kuriositäten aus der Reisetasche hat eine Metaphorik, welche die Grundlage von Sandlers schöpferischer Methode zeigt. Die Geschichte spielt im Borough Park in Brooklyn. Die Heldin ist eine arme, fromme „Aguna“, eine verheiratete, von ihrem Mann verlassene Frau mit zwölf Töchtern. Ein Wunder ereignet sich und im letzten verbliebenen Kartoffelsack findet sich eine Überraschung: „Aus der Schale sprießen glänzende Keime heraus, hart wie Steine!“ Es zeigt sich, dass es sich dabei um Diamanten handelt. Stilistisch liegt diese Erzählung eher in der Tradition von J. L. Peretz als in jener von Scholem Alejchem. Das Bild von Diamanten in Kartoffelschalen lässt sich symbolisch erklären wie ein Hinweis auf den kabbalistischen Begriff der göttlichen Funken, die im groben Körper versteckt sind.
Die Welt, von welcher der Verfasser berichtet, ist nicht nur wegen der Shoah verschwunden, sondern auch wegen anderer schlimmer Tragödien. Sandler erzählt von der Nachkriegswelt im sowjetischen Moldawien, wo sich das kleinstädtische Gestern mit dem sowjetischen Heute arrangiert hat. Sein Hauptinteresse gilt nicht so sehr der Vergangenheit selbst, sondern dem Sich-Einfühlen und Schildern des Phänomens der menschlichen Erinnerung.
Der Leser mag natürlich frei entscheiden, wie Sandlers Prosa zu lesen und zu interpretieren ist. Jeder kann hier etwas für sich finden: eine kuriose Geschichte, einen elegant-geschliffenen Stil, kluge Ironie, lebendige Figuren, scharfsinnige Beobachtungen, historische Genauigkeit, wie auch eine ganz eigene metaphorische Poetik.
Das Rad des Schicksals
Boris Sandler
Die Mutterwelt liegt auf dem Geburtsstuhl,
die Pforten weit geöffnet …
Ich gehe zum Tor zurück, aus dem ich vor vielen Jahren
auf eine lange Wanderung hinausgetrieben wurde,
weil ich das wissen wollte, das zu wissen nicht erlaubt ist.
Ein Schnitt – und ich bin frei, nur ein Tropfen Blut,
und wieder bin ich verbunden mit deinem endlosen Weg.
Ich gehe zurück – der Weg ist nicht zu erkennen,
die Zeit – ein böser Wurm, der das grüne Blatt der Jugend
zerstört, in ein Gerippe verwandelt.
Die künftigen Generationen sollen lernen,
wo mein Herz gewesen ist, meine Leber und die Nieren …
Die Autopsie erschreckt mich nicht,
ich werde sie zwingen, meinem Gesang zu lauschen,
den ich für meine Geliebte gesungen habe …
Ich gehe zurück, und mir läuft meine Kindheit entgegen,
barfuß, verschwitzt, atemlos –
das Gesicht verstaubt, die Knie aufgeschlagen,
Hauptsache, das Spiel ist nicht verloren.
Die Kameraden aus dem Belzer Zigania-Viertel –
die erste Nachkriegsgeneration,
die Funken der Glutnester,
die in den Ghettos nach der Shoa zurückgeblieben sind.
Der Tag neigt sich dem Ende zu, mit ihm – die Spielerei;
Meine Kindheit bleibt
unter Klettenblättern versteckt …
Ich höre nur das Rufen der Mutter:
„Komm heim, es ist schon spät, komm heim!“
Ich stehe schon an der Türschwelle,
die Worte der Mutter fallen wie ein Echo
herab zu den Füßen, und auf meiner blassen Stirn
fühle ich ihren heißen Atem wie damals,
als sie mich noch stillte.
Löse den Knoten des Lebens –
probiert habe ich vielerlei,
und kaum etwas verstanden.
Der Weg ist zu Ende –
und wieder beginne ich von Neuem.
Rund um die Nase
Die Nase ist ein Schicksal.Die Geschichte eines menschlichen Lebens.
Meine Lebensgeschichte begann, wie bei jedem Menschen, noch vor dem ersten Schrei – in jenem einzigen Paradies, das wir nach dem „Nasenstüber“1 verlieren. Dort blieben meine schönsten und hellsten Tage zurück, die nur ein Engel erleben kann, und dort hat man mir meine schönen weißen Flügel abgeschnitten. Sie blieben zusammen mit hunderten, nein, tausenden anderen Flügeln liegen – ein ganzer Berg von Flügeln, denn in den ersten Nachkriegsjahren wurden viele Jungen geboren.
An den Berg abgeschnittener Engelsflügel erinnere ich mich nicht, eben wegen des gemeinen Nasenstübers. Ich hatte doch nicht den Verstand jenes listigen Jungen, der eine Nase aus Lehm unter die zwei eisernen Finger des Engels hielt.2 Deshalb hat mein Gedächtnis gelitten. Trotzdem sah ich den Berg Flügeln nicht nur einmal in meinen Kinderträumen, besonders wenn mir träumte, ich würde fliegen3, sondern ebenso, wenn mir der Flederwisch4 in die Hände fiel, mit dem die Großmutter den verzierten rosa Lampenschirm abstaubte und der Großvater vor Pessach die letzten Krumen Chametz zusammenfegte5. Wenn ich den armseligen abgehackten Flügel betrachtete, fühlte ich, wie es mich unter den Schulterblättern zu beißen begann und in meiner Nase kribbelte.
Als ich das erste Mal den Namen meiner Mutter – Genedl – hörte, verstand ich, von wo ich herausgekommen und wo ich angekommen war, denn in ihrem Namen klang deutlich das hebräische Wort „Gan Eden“ für „Paradies“ mit. Da fehlten kein Laut und kein Buchstabe. Damals habe ich angefangen, die Umwelt mit dem Ohr, wie man sagt, zu erkennen. Verschiedene Klänge und Wörter vermischten sich in meinem Kopf wie in einer sich drehenden Spieluhr und sprangen durch den Mund nach draußen. Nicht jeder verstand mein Kauderwelsch, aber die Großmutter, die es zwar ebenfalls nicht verstand, pflegte nach einer Pause immer zu sagen: „Noch so ein kleiner Knirps, und schon so klug!“
Wie sich schnell herausstellte, war an meinem Sprachfehler meine verstopfte Nase schuld. Zu diesem Urteil kam der Kinderarzt – Doktor Karasik. Er selber war ein korpulenter Mann mit einem großen Kopf, großen Händen und einer Bassstimme. Sein Gesicht sah ich nicht, weil ich geblendet wurde durch den runden Spiegel mit dem schwarzen Loch in der Mitte, den er auf seiner Stirn trug wie mein Großvater das schwarze, lederne Tefillin-Kästchen6 zum Morgengebet. Außerdem fuhr mir der Doktor mit einem kalten metallenen Ding in meine Nase, dass ich dachte, meine Nasenlöcher würde es jeden Moment zerreißen.
Es hieß, er würde mich untersuchen, und tatsächlich verkündete er nach der Untersuchung mit seiner sonoren Bassstimme: „A-de-no-ide7!“
Da meine Ohren durch die ständig verstopfte Nase ebenfalls verschlagen waren, drehte sich das Wort in meinem „Hirnkästchen“ um und kam aus meinem Mund auf meine eigene Art und Weise als „A-nud-ne-jid8!“ heraus.
Meine Mutter, die mich zum Doktor gebracht hatte, war in dem Moment fassungslos. Doktor Karasik hingegen grinste und reichte mir ein Papiertaschentuch. „Junge“, trompetete seine Stimme, „schnäuz dir mal ordentlich die Nase, dann wird dir besser werden!“
Damit wurde mir klar, dass meine Nase nicht nur direkt mit dem verbunden ist, was ich höre, sondern auch mit dem, was ich um mich sehe.
Mit fünf bekam ich zum Namenstag ein Buch. Zu jener Zeit war ein Buch ein schönes Geschenk. Natürlich wäre ich glücklicher über ein Spielzeug gewesen, Ich konnte doch noch nicht lesen, aber das Buch hatte schöne Farbbilder. Ich betrachtete sie und malte mir dazu im Kopf eine Geschichte aus. Es war die Geschichte vom Zwerg Nase9 und schon nach dem zweiten oder dritten Mal, da sie mir meine Mutter vorgelesen hatte, konnte ich sie Wort für Wort auswendig. Natürlich pflegte mir die Mutter jedes Mal am Ende des Vorlesens zu sagen: „Siehst du, was geschieht, wenn man einen alten Menschen mit einem Gebrechen auslacht?!“
Das kümmerte mich aber nicht – ich hätte die böse alte Hexe wahrscheinlich ebenso verspottet. Damals verstand ich vielleicht zum ersten Mal in meinem jungen Leben, dass eine Nase sowohl Leid als auch Freude bringen kann: Leid durch ihre Hässlichkeit, die die Öffentlichkeit sieht und darüber lacht, und Freude, weil sie seltene Gerüche schmecken kann, wie zum Beispiel das Zauberkraut Niesmitlust, das die Schönheit zurückbringt. Ich wunderte mich schon gar nicht mehr, wenn ich jedes Mal nach dem Niesen den Wunsch „Gesundheit!“ hörte – ich wusste ja jetzt, woher das kam und dass man es nicht mir, sondern meiner Nase wünschte.
Die Nase wurde mir ganz besonders wichtig. Neugierig schnupperte sie an allem und sprang mir aus jedem Gesicht in die Augen. Nachdem ich das Paradies verloren hatte, atmete ich mit meiner Nase alle Gerüche um mich herum ein, wo immer ich mich befand. Zunächst war das mein Heim, das mit den Gerüchen meiner Familie gefüllt war. Der meines Großvaters kam aus seinem gelehrten schwarzgrauen Bart. In den Abendstunden zitterte er sacht über den vergilbten Seiten seiner Bücher, als wollte er die Traurigkeit und den Kummer des Tages von sich abschütteln. Sein Bart war durchdrungen vom Geruch des Todes aus dem Schlachthaus, in dem er den ganzen Tag Hühner schlachtete; und vom üblen Geruch des gelben Puders mit dem wilden Namen „Xeroform“, welches er auf das Geschlechtsteil des erst gerade beschnittenen männlichen Säuglings zu schütten pflegte, um das Blut zu stillen. Seine lange scharfe Nase trug auf ihrer Spitze nicht nur ein Paar runder Brillen, sondern auch das bisschen Jüdischkeit, das in der vergifteten Luft der 1950er Jahre schon kaum mehr zu spüren war.
Die Großmutter verbreitete im ganzen Haus ihren Geruch. Er war überall, in jedem Winkel, denn es war im ganzen Haus kein Ort, in den die Großmutter ihre Nase nicht hineinsteckte. Donnerstags, an jenem Tag, an dem sie für gewöhnlich Brot backte, welches dann genau eine Woche reichte, sah ihre Nasenspitze wie mit Mehl gepudert aus. Ihre Kochschürze roch nach allen Zutaten ihrer Speisen und ein erfahrener Gourmet hätte dadurch wohl viel über die Geheimnisse der „echten“ bessarabischen10 Gerichte erfahren können. Oft steckte ich meine Nase in die Schürzenfalten meiner Großmutter und suchte dort Trost und Schutz vor meinen strengen Eltern. Beide kehrten erst spätabends zurück und brachten in unser Heim fremde Gerüche von ihrer Arbeit mit.
Meine Nase, die im Sommer von unzähligen Sommersprossen bedeckt war, zeigte einstweilen noch keine deutlichen Zeichen von Wuchs und Form. Sie wurde zu meinem Wegweiser in die Häuser unserer Nachbarn, in denen meine Freunde wohnten. Es fehlte nicht an Jungen in unserer Kovelischer Straße; Mädchen gab es hingegen nur wenige. An den Türrahmen der jüdischen Häuser sah man keine Mesusen11. Der Schrecken überlebter Kriegsjahre und antisemitischer Gesetze der Sowjets aus der Nachkriegszeit zitterte noch über ihnen. Anstatt Mesusen schien es, als hingen an den Türrahmen auf der rechten Seite die Nasen der jüdischen Hausbesitzer wie Schilder, wie Visitenkarten, mit Nägeln aus Furcht angeheftet. Durch diese deutlichen Hinweise konnte man schnell verstehen, wer hier wo wohnte.
Die fleischige Nase mit den breiten Nasenflügeln wechselte ständig ihre Farbe – gerade war sie dunkelrot und geschwollen, als ob eine Faust in sie hineingefahren wäre; und da, im Gegenteil, blass-ohnmächtig, als ob man jeden Tropfen Blut von ihr abgezapft hätte. Die beschwipste Nase gehörte unserem Nachbarn Lejb dem Argentinier. Den Beinamen hatte er erhalten, weil er vor dem Krieg einige Zeit in Argentinien gelebt und dort sein Glück in den weiten Feldern der Pampas gesucht hatte. Lejb der Argentinier arbeitete als Fuhrmann und seine drei Söhne waren meine Freunde.
Ein Haus weiter wohnte Hersch der Schuhmacher. Das war leicht zu erkennen anhand der Mesuse-Nase auf seiner Tür, ähnlich dem Absatz eines Frauenschuhs. Die Nachbarinnen erzählten sich, dass er eine Geliebte hatte, „eine junge Schickse12 mit einer Stupsnase“. Wenn er auf der Straße ging, unter dem Arm seine Ledertasche mit seinem Werkzeug geklemmt, spie er nach jedem Schritt aus, einmal auf die Seite, dann auf die andere. Er spie auf die Tuscheleien und auf seine Umgebung. Hersch der Schuhmacher hatte zwei Söhne, ich spielte aber nicht mit ihnen, weil sie nicht normal waren, „zurückgeblieben“, wie man über sie sagte.
Gleich uns gegenüber wohnte mein bester Freund Jaschke. Wann immer ich zu ihm kam, warf ich einen Blick auf die Nase seines Vaters, eine Knollennase mit einigen rötlichen gekrausten Haaren. Entweder geschah es tatsächlich oder kam es mir nur so vor, aber in der kurzen Zeit, in der ich an der Türschwelle stand, strömte aus diesen Nasenlöchern der Duft eines billigen Eau de Cologne, genauso wie man es in dem Friseurladen roch, in dem Jaschkes Vater arbeitete und wohin mich die Mutter zum Haareschneiden brachte.
Um die Nase eines anderen Nachbarn, Aarn des Glasers, zu sehen, musste man nicht erst zur Tür hingehen. Sie schien glänzend von den Fenstern, die der Onkel Aarn verglaste. Die anderen Kinder spielten nicht gern mit seinem Sohn Miron, denn wann immer er sich ihnen anschloss, endete es ständig mit Streit und Auseinandersetzungen.
Jenseits des Bretterzauns von Aarns Hof stand das Häuschen seines Nachbarn Wasije. Er war kein Jude, hatte aber eine jüdische Frau, eine Kellnerin. An seinem Türrahmen hing keine Nase, sondern ein Hufeisen, welches Wasije, der ein richtiger Hufschmied war, selber gehämmert und mit vier eisernen Nägeln angebracht hatte. Er hatte keine Söhne, nur zwei Mädchen – die einzigen in unserer Straße. Also beteiligten sie sich an allen Jungenspielen – Krieg, Fußball, Räuber-Kosaken, Verstecken und Fangen – und schlugen sich auch mit uns.
Das Haus von Mika dem Schankwirt war das größte in unserer Straße. Es war nicht wie die anderen Häuser mit Schindeln gedeckt, sondern mit rot gefärbtem Blech. Hinter seinem Rücken ätzten die Nachbarn über sein rotes Dach: „So will er wahrscheinlich zeigen, dass er dem Regime treu ergeben ist!“ Vielleicht sagten sie das aus Neid, schließlich war es ja trotz allem ein eisernes Dach. Deswegen sah die Nase an seiner Tür vielleicht aus wie ein Stinkefinger, als ob sie den gemeinen Lästermäulern sagen wollte: „Schaut nur her und zerplatzt!“ Letzten Endes halfen ihm aber weder der Stinkefinger noch das rote Dach. Eines Tages kam ein schwarzer Wagen der Marke Woronok13 mit getönten Fenstern zu seinem schönen Haus gefahren und nahm den Hausherrn mit. Was war geschehen? Er war doch, Gott behüte, kein amerikanischer Spion! Er verkaufte in seiner Schenke illegalen Alkohol, den man ihm von der staatlichen Brennerei lieferte. Mikas Haus wurde konfisziert, und das Erste, was der neue Besitzer, ein Offizier der Armee, tat, war, von Mikas Türrahmen die schadenfrohe Nase herunterzureißen. Man erzählt sich, dass er dabei auf Russisch gesagt habe: „Hast unser russisches Volk schon genug besoffen gemacht!“
Onkel Jefim war ein Maler – nicht einfach ein Anstreicher, sondern ein richtiger Maler. Die Wände der Häuser, die man ihn beauftragte zu malen, pflegte er in wahre Kunstwerke zu verwandeln. Damals wusste man in unserer Stadt noch nichts vom Luxus einer Spaliertapete, stattdessen waren „Trafarets“ – Wandschablonen – in Mode. Onkel Jefim fertigte sie selber an, schnitt sie aus Kartonpapier aus und übertrug dann mit einem Bürstchen das Muster auf die Wand. Von einem einzigen Bild stellte er einige Schablonen her und stempelte sie mit verschiedenen Farben auf die Mauer. Am Ende ergaben die Wände von unten bis zur Decke hinauf ein buntes Bild. Ich beobachtete mit meinen eigenen Augen, wie er das vollbrachte, als meine Mutter ihn bat, die Wände des Schlafzimmers „aufzufrischen“.
Von außen mit einem Trafaret bedeckt waren auch die Wände des Häuschens, in dem Onkel Jefim mit seiner Frau und einem Jungen namens Motele wohnte, den seine Mutter „Matwej“ nannte. Auf ihnen pflegte er alle seine ausgeschnittenen Motive auszuprobieren, die er danach in den Wohnungen seiner Kunden als Schablone benutzte. Er war so vertieft in seine schöpferische Arbeit, dass sogar die zwei Fenster und die Außentür mit der Mesuse-Nase auf der rechten Seite mit Schablonenmustern bedeckt waren. Ausgerechnet auf seiner Höckernase hatte sich auch ein gelbes Blümchen abgedruckt. Die Witzbolde unserer Straße hatten genug, worüber sie lachen konnten: „Wenn auf seiner Nase schon Blumen wachsen, was wächst dann unter seinem Bauchnabel?!“
Ich könnte natürlich auch von anderen begüterten Nasen in unserer Kovelischer Straße erzählen; alle hatten sie ihr eigenes Aussehen und eine besondere Geschichte. Die Nase eines Menschen ist doch, wie gesagt, nicht von seinem Schicksal zu trennen. Einmal geschah es tatsächlich, dass die Nase sich einen Schabbat machen wollte. Wir wissen gut, wie die Geschichte geendet hat14.
Jener Nachbar, von dem ich jetzt gleich erzählen will, hatte einen Zinken von Nase, eine richtige „Njonje“, und so war auch sein Name. Er wohnte zeitweilig bei seinen Eltern und im Gefängnis. Njonje war ein Dieb und sein schönes Handwerk garantierte, dass bei keinem Nachbarn unserer Straße nur eine einzige Nadel verloren ging. Alle Hausbesitzer der Kovelischer Straße waren der Meinung, dass man wohl der niederträchtigste Schurke sein musste, um dort zu stehlen, wo man wohnt. Njonje war offensichtlich kein niederträchtiger Schurke, denn er hielt sich strikt an diese Regel. Es war für mich kein Geheimnis, was andere Nachbarn bei ihrer Arbeit taten – der Fuhrmann Lejb oder der Schuhmacher Hersch, der Friseur und der Schmied, gar nicht zu reden vom Maler Jefim. Ich ging sogar einmal mit meinem Vater in die Schenke zu unserem Nachbarn, Onkel Mika, als ich Lust auf ein Glas Sprudelwasser bekam. Er bediente uns sehr freundlich und wollte, man stelle sich vor, vom Vater kein Geld für das Glas nehmen. Keiner wusste, dass er auch ein Dieb war, obwohl man von den Nachbarn mit den spitzen Zungen auch hören konnte, dass man „so einen Palast mit einem Blechdach nicht mit einem ehrlichen Einkommen hinstellen könne“. Njonje verheimlichte vor niemandem sein Handwerk – alle wussten, womit er sich beschäftigte. Nur ich konnte mir nicht vorstellen, was es heißt, ein Dieb zu sein. Wen immer ich auch in unserem Haushalt fragte – er gab mir keine klare Antwort darauf.
Meine Neugierde war, wie es scheint, stärker als mein Verstand. An einem sonnigen Tag saß Njonje der Dieb gerade auf der kleinen Veranda vor seinem Elternhaus und rauchte eine Zigarette, als mich meine Nase zu ihm hinführte. Njonje selber schwieg und bemerkte mich offensichtlich nicht, denn sein Blick, der durch den dichten bitteren Rauch seiner Zigarette drang, die in einem Mundwinkel eingeklemmt war, ging irgendwohin himmelwärts; seine Nase aber, einmal in der Mitte gebrochen und etwas zu einer Seite gedreht, traf auf mein Näschen. „Wer bist du?“, fragte seine und meine antwortete. „Das heißt, du bist der Enkel des Schochets15?“, fragte seine wie zur Bestätigung, und weiter: „Was willst du denn?“
Jetzt musste ich mich schon selber einmischen und antworten. „Onkel Njonje, können Sie mir erklären“, stammelte ich, „wie ein Dieb arbeitet?“
Sein Blick riss sich vom Himmel los und heftete sich auf mich. Er zog an der Zigarette und zwei Rauchwolken bliesen aus seiner Nase. „Das willst du wirklich wissen?“, wunderte er sich mit heiserer Stimme. Für eine Weile saß er still da. Ich dachte, dass er bei der Nase in seinem Gesicht um Rat anfragte. Schließlich stand er hastig auf und wies mir mit der Hand, ich solle ihm folgen. Wir gingen bis zum Ende der Kovelischer Straße und bogen in die Kischinever Straße ein. Es sah wahrscheinlich seltsam aus: Njonje der Dieb ging voran, die Hände in den Hosentaschen, mit seiner gewohnten Zigarette im Mund und ich, der Enkel des Schochets, lief ihm wie ein Hündchen nach. Das passte irgendwie nicht zusammen. Ich drehte mich immer wieder um, ob uns ja keine der Nachbarinnen sah, denn das hätte man sofort meiner Großmutter erzählt. Zum Glück war es ein heißer Tag und nur die Katzen ließen sich schläfrig die Sonne auf ihre Bäuche brennen und streckten sich auf den Verandageländern aus.
Wir kamen zum Lebensmittelgeschäft in der Kischinever Straße, in dem ich öfters mit der Großmutter gewesen war. Vor dem Hineingehen blieb Njonje stehen, drehte sich zu mir um, wandte mir den Kopf zu und warf mir von oben herab einige kurze Sätze zu, so wie man einem Hündchen Knochen zuwirft. „Bleib bei der Tür stehen. Schau zu und schweig. Halt den Mund und misch dich nicht ein. Verstanden?“
Mit einem Mal fühlte ich, dass ich an einer großen Sache beteiligt war, das heißt: an Njonjes Arbeit.
Im Geschäft herrschte reger Betrieb, besonders in der Wurstabteilung. Es war scheinbar gerade frische Ware angeliefert worden, denn zu der Verkäuferin auf der anderen Seite des Ladentisches flogen schon die üblichen Fragen – was und wieviel es kostete und ob wohl für alle genug da sei? Die Leute stellten sich schnell in einer Schlange an. Auch die Kunden, die zuvor bei anderen Lebensmitteln gewartet hatten, drängten nun zur Wurstabteilung. Sie standen dicht aneinander gedrängt, traten an der Stelle, schnupperten hoffnungsvoll mit ihren Nasen und sogen die Luft ein, durch die schon das appetitliche Aroma frischer Würste zog, vermischt mit dem Lärm der aufgeregten Menge: „Wenn es nur für alle reicht, wenn nur …“
Ich stand abseits in einer Ecke, wie Njonje mir befohlen hatte, und wandte kein Auge von ihm ab. Aber plötzlich entschwand er meinem Blick. Ich sah gerade noch, wie er sich zwischen einige Frauen quetschte. Ausgerechnet da verstellte mir eine dicke Person die ganze Aussicht, stand da wie ein Schrank und rührte sich nicht mehr vom Ort. Ich blieb mit der Nase vor dem breiten Hinterteil stehen und der einzige Gedanke, der mir in den Kopf kam, war, dass diese Person, Gott behüte, hoffentlich nicht furzte, sonst wäre ich wohl in einer misslichen Lage.
Und plötzlich war ein kurzer Aufschrei zu hören: „Dieb!“
Der „Schrank“ machte eine Bewegung nach vorne und die Aussicht öffnete sich wieder vor mir. Mein Blick erfasste eine einzigartige Situation: Njonje stand gebückt, den Kopf von sich gestreckt, und dieselbe Person, die mich eine Minute zuvor in der Ecke fast erdrückt hatte, hielt Njonjes Nase zwischen zwei Fingern eingeklemmt wie mit einer Zange …
Auf dem Rückweg ging ich schon neben Njonje. Er verbarg seine Nase hinter der Handfläche und zwischen seinen Fingern rann das Blut hervor.
„Das kommt halt mal vor“, näselte er, „bei jeder Arbeit kann mal ein Arbeitsunfall passieren.“
Als ich an die zwölf, dreizehn Jahre alt war, hörte ich meine Mutter zur Großmutter über mich sagen: „Seine Nase dehnt sich aus.“ Es klang wie ein Lob, dass auch mein Verstand sich vergrößert habe. Nicht nur einmal hörte ich bei uns zu Hause und auf der Straße, dass man über jemanden, der seine Mesuse-Nase gern losgeworden wäre, sagte: „Der Jude steht ihm sowieso ins Gesicht geschrieben!“
Die jüdische Nase wurde zum Spiegel der Abstammung, zum Ausweis eines Volkes von Vorzeiten an. Die Römer und später die Griechen führten als erste ihr eigenes Muster von Nase und Profil ein – offensichtlich, um sich von den anderen Völkern abzuheben, die sie erobert und versklavt hatten. Seit damals wurde die Nase zum Erkennungsmerkmal dessen, „was du bist“ und was dein Platz unter den Menschen war. Die Normen der „Nasen-Standards“ nahmen auch in den oberen Rängen der Machthaber eine wichtige Rolle ein. Es gab Zeiten, da wurde es lebensgefährlich, nicht das „richtige Profil“ zu haben.
In unserer Straße war auch noch anderes zu hören: „Er hat sein Gesicht schon zur Gänze verloren, nur an der Nase erkennt man ihn noch!“ Oder: „Er hält seine Nase in den Wind!“
Als Kind konnte ich mir keinen Reim darauf machen, was die Erwachsenen wohl mit solch einem seltsamen Gerede meinten. Wie konnte man denn ein Gesicht verlieren, das war doch kein Handschuh?! Dabei wird seine Nase ein Verräter? Meine kindliche Fantasie malte mir eine Nase wie einen Kleiderbügel aus, auf dem das Gesicht hing. Da kam ein starker Windstoß, riss das Gesicht vom Nasenbügel herunter und trug es mit sich fort.
Noch am gleichen Tag, an dem ich Zeuge von Njonjes „Arbeitsunfall“ geworden war, konnte ich mich nicht zurückhalten und erzählte alles der Großmutter. Ich kann nicht behaupten, dass sie sich begeistert darüber zeigte, dass ich unserem Nachbarn in das Geschäft gefolgt war; trotzdem wischte sie sich die Hände an ihrer Schürze ab und sagte: „Ein Schlimasl16 fällt auf den Rücken und schlägt sich die Nase grün und blau!“ Ich brauchte Jahre, bis ich ihr Sprichwort verstehen konnte.
Einen tiefen Eindruck machte auch folgendes Kinderbuch auf mich: Das goldene Schlüsselchen oder die Abenteuer des Burattino17. Zu jener Zeit konnte ich schon allein lesen und musste nicht mehr warten, bis die Mutter mir vorlas. Die Geschichte stammte vom russischen Schriftsteller Alexej Tolstoj und mehr als eine Generation sowjetischer Kinder wurden von den fröhlichen und manchmal gefährlichen Streichen gefesselt, die der hölzerne Junge mit der langen spitzen Nase, ähnlich wie meine, ausheckte. Faktisch war Burattinos Nase natürlich aus Carlo Calodis italienischer Geschichte Pinocchio gewachsen; davon erfuhr ich erst viel später, aber das ist nicht der Punkt. In meiner Kindheit war ich davon fasziniert, wie man aus einem einfachen Holzscheit ein lebendiges Geschöpf aushacken und schnitzen konnte. Das war doch ein Wunder!
Glücklich über diese Entdeckung, erzählte ich darüber meinem Großvater. Der kramte gerade in der purpurroten Samttasche, welche meine Mutter kunstvoll mit hellgelber Seide bestickt hatte und in dem sich die Gebetsriemen und der Gebetsschal befanden. Er war offensichtlich nicht besonders beeindruckt von meiner Faszination und warf nicht einmal einen Blick zu meiner Seite, sondern brummte nur in seinen Bart: „Durch Götzen entstehen Probleme, keine Wunder …“
Als er wieder von der Synagoge zurück war, rief mich der Großvater zu sich und setzte unser Gespräch übergangslos fort: „Es war einmal ein Mann mit Namen Terach. Er fertigte allerlei Götzen aus Holz an, solche wie dein Burechtine18, und verkaufte sie auf dem Markt. Davon lebten er und seine Familie. Dieser Terach hatte einen Sohn namens Abraham, ein kluger Junge, ein schlauer Kerl. Einmal schickte ihn der Vater auf den Markt, um die Götzenstatuen zu verkaufen. Was tat Abraham? Jedes Mal, wenn jemand einen Götzen bei ihm kaufte, fing er an, den Kunden zu schimpfen: ‚Ach und weh, habt Ihr keinen Verstand, Euch vor einem Götzen zu verbeugen, den mein Vater gerade erst mit der Axt aus einem Stück Holz geschlagen hat?‘ Da gab man dann Abraham gleich die Statue wieder und verlangte das Geld zurück. Als er am Abend ohne einen Groschen und mit einem vollen Sack Götzen nach Hause kam, wurde der Vater zornig: ‚Du kannst kein Händler sein, geh, verehre die Götter. Bring ihnen Opfergaben!‘ Was tat Abraham? Er nahm einen langen Stock und zerschlug damit alle Götzen, nur einen, den größten, ließ er über und legte ihm den Stock in die Hand. Als der alte Terach kam und sah, dass die Statuen überall auf dem Boden mit zerbrochenen Köpfen, Händen und Füßen herumlagen, wurde ihm schwarz vor Augen. Er fing an zu schreien: ‚Was ist da geschehen? Wer hat alle meine Götter zerbrochen?‘ Da antwortete ihm Abraham: ‚Vater, ich werde dir die Wahrheit sagen. Eine Frau brachte eine Schüssel Mehl als Opfergabe und ich war zu faul, jedem Gott seinen Anteil hinzutragen. So stellte ich sie in die Mitte des Raumes und sagte den Göttern, sie sollen gehen und sich davon nehmen, es soll ihnen wohl bekommen. Da begannen sie aber zu streiten und schimpfen, einer mit dem anderen, wer den größeren Anteil bekommen sollte, bis schließlich der größte von ihnen den Stock ergriff und sie alle zerbrach.‘ Da wurde Terach noch zorniger und schrie: ‚Das ist eine Lüge, du Nichtsnutz! Wie können denn die hölzernen Götter so etwas vollbringen?‘ ‚Aber ja‘, antwortete ihm Abraham, ‚wenn sie so etwas nicht vollbringen können, sind sie dann überhaupt Götter?‘“
Zufrieden endete der Großvater seine Geschichte und sah mich über seine Brillengläser an. Immer, wenn er mich auf diese Art anstarrte, dachte ich, dass mich sowohl seine Augen als auch seine Brille und seine Nasenspitze ansahen. Es war unmöglich, sich von diesem dreifachen Blick loszureißen.
„Hast du etwas davon verstanden?“, klang es aus seinem Bart.
In diesem Moment sah der Bart des Großvaters in meinen Augen genauso lang und böse aus, wie jener des Puppentheater-Besitzers Karabas-Barabas.
„Burattino ist ein guter Junge, obwohl er aus einem Holzscheit gemacht ist“, nahm ich mich der Ungerechtigkeit gegen meinen neuen Freund an, „er ist ein Abenteurer. Er hat seine Freunde von dem Faschisten Karabas-Barabas befreit.“
Fast hätte ich zu weinen begonnen, aber da nahm mich der Großvater fest in seine Arme. Meine Nase drückte gegen seinen Rock und atmete das gelbe Xeroform-Pulver ein, worauf sie bald mit einem kräftigen Niesen reagierte. „Eine gute Gesundheit wünsch ich dir!“, hörte ich die weiche Stimme des Großvaters.
Mein Verdruss war zusammen mit dem Niesen verflogen.
Dank meines Großvaters sah ich mir verschiedene Nasen in der Synagoge an, wohin er mich manchmal mitnahm. Ich hielt es natürlich nicht lange am Platz aus und pflegte mich leise zwischen den Betenden herumzudrücken. Das waren meistens alte Leute, welche ihre Köpfe gebückt unter ihren Gebetsschals verbargen, sich vor- und zurückwiegten19 und zitterten, als hätten sie Angst vor jemandem, der über ihnen hing und sie mit schrecklichen Gesetzen bedrohte. Ich sah keine Gesichter, nur die Nasen lugten wie aus einer dunklen Ecke hervor. Ähnlich wie Gespenster, die etwas in einer Sprache brummen, die nur sie verstanden – entweder ein Gebet zur Rettung oder ein Gebet gegen all das Böse und Schlechte; original jüdische Nasen, die von den Feinden Israels in allen Zeiten so gerne verspottet wurden. Von den Nasen, die mich damals in der Synagoge umgaben, fand so manche in späteren Jahren Eingang in meine eigenen Geschichten. Eine dieser Nasen ist es wert, hier erwähnt zu werden – sie fand ihren Platz auf den Seiten meiner ersten Novelle Treppe zum Wunder20. Ich erinnere mich, dass ich den Atem der besagten Nase in meinem Nacken spürte.
Ich drehe den Kopf und sehe vor mir ein kleines zerknittertes Gesicht ohne Bart. Ein Paar rötlich geäderte, tränende Augen sehen mich an. Einige rötliche Härchen kräuseln sich komisch auf der fleischigen Nase, die Oberlippe wird von der Unterlippe verdeckt, die so weit hervorsteht, dass mich einen Moment lang ein komischer Gedanke beherrscht: Was kann man denn zum Beispiel mit so einem Mund tun, wenn es stark regnet?
Das kleine Gesicht beugt sich herab und wispert mir leise ins Ohr: „Wer bist du denn?“
Ich weise mit dem Kopf in Richtung des Großvaters.
„Das heißt, du bist der Enkel des Schochets.“ Und der Alte gibt mir einen leichten Kniff in die Backe. Dann sucht er in seiner Tasche, zieht von dort eine kleine grüne Flasche heraus und schüttet sich daraus ein wenig schwarzes Pulver auf die Handfläche. Das Gesicht voller Falten verknittert sich noch mehr, die rötlich geäderten Augen werden komplett rot und die Lippen lassen ein „Mmmä!“ heraus.
Ich stehe und wende keinen Blick von dem Alten und der schüttet inzwischen noch einmal aus seinem Fläschchen ein wenig Pulver heraus und hält es mir unter die Nase. „Da, probier auch einmal von der guten Sache!“
Ich dachte nicht lange nach, steckte meine Nase in seine vorgehaltene Handfläche und nahm mit aller Kraft einen tiefen Zug. Aber was hatte ich da in mich eingesogen? Was war das? Ein Pulver? Oder kleine schwarze Ameisen, die in meiner Nase herumliefen und anfingen, mich wild zu beißen? Tränen schossen mir in die Augen, mein Mund verkrümmte sich und ich begann ordentlich zu niesen …
Auf dem Rückweg nach Hause hielt mich der Großvater an der Hand, denn nur er konnte den Weg sehen. Vor meinen Augen stand eine finstere Wand und ich musste immer noch unaufhörlich niesen.
„Wie oft muss man dir noch sagen“, schimpfte mich der Großvater, „dass du deine Nase nicht dorthin hineinstecken sollst, wohin man nicht darf!“
Manchmal denke ich, dass sich die Welt aber ausgerechnet auf jenen Nasen hält, die keine Furcht haben, sich dorthin hineinzustecken und hineinzukriechen, wo es verboten ist. Solche Nasen hatten sicher die „Gerechten“21.
Viele Dinge um uns herum erinnern an die Nase und die Nase selber ruft auch die Erinnerung an Dinge wach. Da brennt sie wie ein Lämpchen und von einem Schlag auf die Nase wird einem schwarz vor den Augen. Sie wächst in den Beeten wie eine grüne Gurke und vor Scham wird sie rot wie eine Tomate; sie ist lang und spitz wie eine Karotte und knollig wie eine Kartoffel. Es kümmert sie nicht, wenn sie mit schwarzen Pünktchen wie mit Mohn besprenkelt ist oder mit roten Trauben. Wie ein Chamäleon kann sie ihre Farbe ändern und ist nicht beleidigt, wenn man sie nicht bei ihrem eigentlichen Namen nennt, sondern mit Beinamen: Knollennase, Schnapsnase, Kartoffelnase, Adlernase, Habichtnase, Stupsnase, Gurke, Zinken, Lange Nase, Höckernase usw.
In zahllosen Sprichwörtern und Redewendungen findet sich die Nase:
„Du musst ein guter Kerzenmacher sein, wenn du Gott eine wächserne Nase drehen willst.“
„Es fehlt ihm zwei Finger über der Nase.“
„Hart Schnäuzen macht blutige Nasen.“
„Gemach in die Kohlen geblasen, so fährt dir kein Staub in die Nasen.“
„Mach dir einen Knopf in die Nase.“
„Man muss weiter sehen, als die Nase reicht.“
„Nicht jede Nase riecht den Braten.“
Man kann auf die Nase fallen, blass um die Nase sein, der Nase nachgehen, die Nase in die Dinge stecken, die einen nichts angehen, die Nase rümpfen, die Nase voll haben, die Nase vorn haben, direkt vor der Nase sein, eine Nase drehen, eins auf die Nase bekommen, sich an die eigene Nase fassen, jemandem auf der Nase herumtanzen, jemandem die Tür vor der Nase zuschlagen, jemandem eine lange Nase machen, jemandem etwas unter die Nase reiben, jemandem etwas vor der Nase wegschnappen, jemanden an der Nase herumführen, jemanden vor die Nase gesetzt bekommen – und noch vieles mehr.
Im Volksmund kann die Nase auch Vermittlerin zwischen dem Teufel und dem Innersten eines Menschen sein; die finsteren Mächte beginnen dort zu herrschen. Man sagt doch über einen Schurken: „Der Teufel ist ihm bei der Nase hinein!“
Ein anderer Ort, an den mich mein Vater das erste Mal hingebracht hatte, war das „Kischinever Bad“. So wurde es aus zweierlei Gründen genannt: Es lag in der Kischinever Straße; und seine Besucher – Männer wie Frauen – wohnten zum Großteil in der Nachbarschaft.
Im „Kischinever Bad“ konnte man Freitagmorgen alle unsere Nachbarn sehen. Ich erkannte sie nicht gleich, weil sie mir nackt alle gleich vorkamen; ich konnte mich aber an ihre Nasen erinnern. Und obwohl sie sauber glänzten, wie eine blankgeriebene Mesuse vor Pessach, konnte ich jede Nase mit Namen abrufen.
Eine Nase nahm neben der anderen auf der steinernen Bank Platz, jede neben ihrer Wasserschüssel, und während die Hände die dampfenden Körper einseiften, flogen die Witze zwischen ihnen hin und her. Graue Seifenblasen rannen von den Achseln über Brust und Bauch und kamen zwischen den Schenkeln wieder zusammen, wie um zu verdecken, was man im Bad ohne Scham herzeigte. Als Kind machte ich damals die Entdeckung, an was ich als Erwachsener nicht einmal zu denken wagte. Nämlich: Die Nase und jener Körperteil, der bei den Männern „unter dem Bauchnabel“ hervorsteht, sind sich sehr ähnlich. Ausgerechnet in jenem Moment, als ich deswegen mit meinem kindlich-naiven Verstand nachdachte, war durch das Summen und das Geräusch von fließendem Wasser und dem Klirren der ausgeleerten Schüsseln die helle Stimme von Rafoel dem Blechschmied zu hören. Man sagte über ihn, dass er auf seinem Gebiet kein großer Meister war; dafür hatte er aber jede Menge Geschichten auf Lager. Ich weiß nicht, wie das an anderen Orten war, aber im Bad öffneten sich bei ihm alle Quellen. Er selber sagte einmal, dass sich vor allem im Bad sein Talent „entfalte“.
„Juden! Freunde!“, schrie er, und es schien, dass jeder Ton zu der verschwitzten Decke hinaufflog, dort anstieß und mit einem lauten Klirren auf dem Zementboden landete. „Hört euch diese Geschichte an!“ Rafoel rieb sich mit der Hand über sein Gesicht, als wollte er damit die Hektik der vergangenen Woche abwischen, die jetzt in der heißen Luft zerschmolz. Seine Vogelnase fuhr über die nackte Menge und er begann, nun schon leiser, wie aus der Ferne zu erzählen: „Es war noch vor dem Krieg, da tauchte in unserem Schtetl ein Bursche auf. Es hieß, der Sadigurer Rebbe22 habe ihn in die Welt hinausgeschickt mit der Mission, seine Tora zu verkünden. Fürs erste fand man ihm ein Plätzchen im Bethaus der Schuster und dort schlief er. Wenn ein junger Mann in ein Schtetl kommt, fängt man bald an, ihm eine Heiratspartie zu suchen. Zu diesem Jungen passte genau Pessije die Waise. Wie sagt man – ein Pärchen wie von Gott gewollt. Das Häuschen, in dem ihre Eltern gewohnt hatten, stand genau gegenüber dem Schuster-Bethaus, sodass er sein abgewetztes Gebetsschal-Täschchen und das Paar langer Unterhosen mit einem Hemd zum Wechseln nicht weit tragen musste. Ist das nicht wunderbar? Das Schtetl hat sich eine Mitzwe23 verdient. Die Sache ging aber nicht gut aus. Einen knappen Monat nach der Chupe24 wurde der kleine Rebbe krank, nebbech25, lag einige Tage mit Fieber – und aus war’s mit ihm. Und so wurde aus Pessije dem Waisenkind auch noch eine Witwe. Jetzt erst fängt die eigentliche Geschichte an …“
Die zuhörenden Männer hatten sich schon Rafoel gegenüber versammelt, hielten die leeren Schüsseln in der Hand, als ob sie bereits auf das Baden vergessen hätten; ihre nackten roten Schultern rieben aneinander und sie hörten dem Erzähler aufmerksam zu.
„Die junge Pessije verzehrte sich vor Sehnsucht, nebbech, sie wollte ein Kind. Kinder kommen aber nicht nur vom Wollen. Da braucht es noch was, stimmt’s?“
Rafoel winkte listig in die Menge und zog sie mit seiner Frage an.
Und als es bald wieder lebendiger wurde, gab er ein Handzeichen und fuhr fort: „Ich sehe schon, ihr wärt nicht verloren gewesen, aber was sollte die junge Witwe tun? Wie man bei uns im Schtetl zu sagen pflegte: Wenn der Allmächtige einschläft, wacht der Teufel auf. Eines Nachts wälzt sich Pessije, nebbech, auf ihrem Lager, sehnt sich nach Lust und Leidenschaft, da hört sie neben sich, genau dort, wie sich etwas rührt. Der schwache Mondschein leuchtet kaum durch das kleine Fenster herein. Sie wendet den Kopf – Gott behüte, man soll von solchen Entdeckungen nichts wissen müssen, nicht einmal im Traum! Neben ihr liegt die Nase ihres kleinen Rebbes …“
Rafoel machte eine Pause, tauchte seine Hände in die Schüssel mit Wasser und spritzte sich mit den Fingern an.
Ein Besserwisser aus der Menge fragte, wie um den Erzähler Lügen zu strafen: „Wie konnte sie denn wissen, dass es ausgerechnet die Nase ihres Mannes war?“
Die Menge bewegte sich, wiederholte: „Ja genau … wer weiß …“
Rafoel war nicht überrascht. Er gab wieder ein Zeichen mit der Hand, das bedeuten sollte: Ihn würde keiner als Lügner festnageln können!
„Hört weiter, Freunde, Juden!“, sagte er ruhig, „die Nase des kleinen Rebbes hatte ein deutliches Zeichen auf der rechten Seite – ein schwarzes Muttermal in der Größe einer Bohne. Als sie die Nase ihres Mannes erblickte, fiel die Witwe vor Schreck fast vom Bett herunter. Die Nase begann sich aber an sie zu schmiegen, an ihrer Wange, ihrem Hals zu reiben, kroch unter die Decke, mit einem Wort, Pessije hatte die Augen zugemacht und ihr Witwenstübchen füllte sich mit Vergnügen und Liebe. Und so erschien die Nase jede Nacht, bis Pessije die Witwe schwanger war …“
Rafoel verstummte. Seine eigene Nase, ähnlich dem Schnabel eines großen Vogels, betrachtete jetzt stolz die Männermenge. Bei einigen von ihnen wanderten die Schüsseln nun näher zum Bauch, um etwas vor dem bösen Blick zu verbergen …
Ein ständiger Begleiter wurde die Nase im Volksglauben, von der Literatur ganz zu schweigen, in der die Nase zu einer eigenen Persönlichkeit mutiert ist. Sie ist nicht einfach eine Gestalt zum Lachen. Sie verbindet die „innerste Welt“ des Menschen mit der Außenwelt, anders hätte der „Nasenstüber“ des Engels keinen Sinn gehabt. Und umgekehrt atmet die Nase das Leben um sie herum ein, mit all seinen Gerüchen, seit dem ersten Atem, den der Allmächtige den Menschen genau durch die Nase eingehaucht hat. Wenn die Zeit kommt, gibt der Mensch dem allmächtigen Gott die Schuld wieder zurück – mit dem letzten Atem, um alles zu vergessen, was mit ihm hier geschehen ist.
In einer alten Legende steht geschrieben, dass in 120 Jahren, wenn die Seele in das Paradies zurückkehrt, ihre erste Station genau beim hohen Flügelberg ist. Sie muss ihre eigenen Flügel heraussuchen, die sie dort gelassen hatte, bevor sie aus Gottes Welt hinausgetrieben wurde.
Lassen wir uns aber noch Zeit, bis wir wieder zu Engeln werden.
Der Künstler und der Schochet
1
Das kleine Fenster erinnerte aus der Entfernung an das berühmte Bild Das Schwarze Quadrat des Malers Kasimir Malewitsch26. Die Schwärze ließ es tief und geheimnisvoll erscheinen, wie es nur eine Finsternis vermag. Es zog einen an einem sonnigen Tag an, so wie ein helles Feuer einen Verirrten in einer dunklen Nacht anlockt.
Das viereckige Fensterchen war in einer Holzhütte eingelassen, die bis unter das Dach gekalkt war. Genau genommen war es kein Schuppen, sondern ein Schächthaus27, das zwischen einigen Lehmhütten in einem Hof stand.
Auf der rechten Seite hing an einem Nagel ein Pappschild, auf dem mit großen geschnörkelten russischen Buchstaben die Preise für die Arbeit standen:
„Huhn – 10 Kopeken28
Ente – 15 Kopeken
Gans – 20 Kopeken
Truthahn – 25 Kopeken“
Den ganzen Tag über pflegten jüdische Hausfrauen direkt vom Markt mit schweren Körben in beiden Händen zum Schächthaus zu kommen. Da wurde dann aus einem Korb ein Huhn mit zusammengebundenen Füßen herausgezogen und zum kleinen Fenster getragen. Dann erschienen aus der schwarzen Tiefe, wie aus einer Höhle, zwei breite Hände mit ausgespreizten dünnen Fingern, dem offenen Maul eines wilden Tieres ähnlich; das Huhn, das sich zu wehren versuchte, wurde gepackt und verschwand augenblicklich im Inneren der Hütte.
Der Schochet Schmuel verstand sein Handwerk gut: Zuerst wurden dem Opfer die Flügel gebrochen und während er es an den Füßen nach oben hielt, packte er es mit der zweiten Hand am Kopf, der sich noch bewegte und hilflos gackerte, in seiner Sprache um Mitleid flehte, bis es in gurgelnde Laute überging. Schmuel ergriff es inzwischen rasch mit zwei Fingern am Schnabel und bog diesen zu der Hand mit den Flügeln. Der Hals des Huhns dehnte sich durch die Bewegungen des Schochets. Er zupfte noch einige Federn von der Stelle, wo er nach den Gesetzen der Schächter mit einem einzigen Schnitt tief durchschneiden musste, dann griff er zum Schächtmesser, das bis jetzt auf dem Tisch neben dem blechernen Trog gelegen war, über dem die Schlachtung stattfand.
Nach vollendeter Arbeit wischte Schmuel die blutige Klinge an den Federn ab, legte das Schächtmesser zurück an seinen Platz und hängte das geschlachtete Huhn an den zusammengebundenen Füßen an einem Haken über der Wanne auf, damit das Blut abrinnen konnte.
Ein heller Zeitstrahl, ein verirrter Bote aus einer anderen Zeit, guckte durch das kleine Fenster in das Schächthaus herein. In einer Ecke stieß er auf ein blasses Gesicht. Ein Junge von elf, zwölf Jahren hatte sich dort versteckt. Auf einer Seite des auf seinen knochigen Knien liegenden Heftes zeichnete er mit einem Bleistift das aufgehängte Huhn.
Borech-Schloime Soutines Sohn Chaim29 hält man in Smilawitschy30 für sonderbar. Stundenlang kann man ihn dabei beobachten, wie er sich mit seinem Heft unter dem Arm auf dem Markt herumtreibt. Seine Augen wandern herum und fangen die herbstliche Farbenpracht ganzer Berge von Blumen und Kraut ein, von goldenen Zwiebeln, frischen Pilzen, die auf Tischen zu Haufen aufgestapelt oder schon getrocknet an langen dünnen Schnüren aufgefädelt sind; von gelben Kürbissen und roten Tomaten, die wie mit blutrotem Saft dick gefüllt sind. Tatsächlich heißt diese Sorte hier „Ochsenherz“. Die Händler werden nicht müde, ihre Waren unaufhörlich anzupreisen – Fässer und Fässchen sind wie Soldaten in einer Reihe aufgestellt; die Tonwaren, Töpfe und Gefäße ziehen mit ihren geschwungenen Formen und ihrem brennend roten Aussehen die Blicke auf sich. Auch die unterschiedlichen Gesichter der Bäuerinnen und der jüdischen Händlerinnen treten hervor – und da und dort tauchen auch schmaläugige tatarische Augen auf.
Chaims Blick ist gierig und hungrig. Mit seinen Augen verschlingt er die Gesichter und schluckt den Speichel hinunter. In seinem Bauch knurrt es, er hat heute nur ein Stück Brot gehabt; vielleicht ist in der Tasche noch ein Rest Krümel geblieben. Sein Vater, ein geübter Flickschneider, hat ihm die Hosen seines älteren Bruders umgenäht, aber die Taschen so belassen, wie sie waren. Er hat noch Witze nach Art der Schneider gemacht: „In großen Taschen verlieren sich die Löcher.“
Eine junge Bäuerin entdeckt den Jungen und ihr Gesicht mit der Stupsnase wird vor Freude noch runder. Chaim kennt sie schon, sie handelt mit gesäuertem eingelegtem Obst und Gemüse. Vor Kurzem hat sie geheiratet und ihr Mann ist nach Wilna gefahren, um Geld für ein neues Häuschen zu verdienen. Chaim hat sie schon zweimal gezeichnet, damit sie ihrem Mann die Bilder schicken konnte. Jetzt bittet sie ihn, er soll wieder ein Bild von ihr anfertigen, eines mit dem Bauch, der Mann soll sehen, dass sie schwanger ist.
„Ein Söhnchen, das ihm einmal helfen wird“, ruft sie und streichelt ihren hervorstehenden Bauch, „oder ein Mädchen, das mir zur Hand gehen kann.“
Chaim blättert sein Heft auf und fischt einen Bleistift aus seiner Brusttasche – auf die Hosentasche des Vaters verlässt er sich nicht – und beginnt rasch auf dem weißen Papier zu zeichnen. Es dauert nicht lange und er reißt die fertige Zeichnung aus dem Heft und reicht sie der Händlerin. Die betrachtet ihr Porträt eine Weile mit schief gelegtem Kopf, schenkt ihm eine saure Gurke und sagt zufrieden: „Schön ist er geworden, der Bauch …“
Chaim liebt es, Gesichter zu zeichnen. Es ist ihm nicht wichtig, ob es ein jüdisches oder ein christliches Gesicht ist. Sie sind lebendig und verändern sich jeden Augenblick, sogar durch einen Windhauch. Wenn er sie schnell mit der schwarzen Spitze seines Stiftes zeichnet und sie auf dem Papierbogen bleiben, manchmal fünf, sechs auf einer Seite, kommt es ihm vor, als hätte er den Windhauch bei seinen Flügeln ergriffen. Einen Unterschied gibt es: Die Juden zeigen sich verärgert, wenden das Gesicht von ihm ab, schimpfen: „Du Schejgetz31, hat dir dein Vater nicht beigebracht, dass man kein Abbild eines Menschen machen darf!“
Sein Vater hat ihn deswegen schon einige Male verprügelt. Im Grunde genommen hat Borech-Schloime nichts dagegen, dass sein Sohn zeichnet, auch wenn er keinen Verdienst davon hat. Andererseits hätte dieser auch kein großes Einkommen, wenn er das Schneiderhandwerk erlernen würde. Chaims Mutter Sore hat ihrem Mann geraten, dass, wenn ihr Sohn, der Schlimasl, schon so vom Zeichnen angezogen ist, es vielleicht eine gute Idee wäre, ihn nach Minsk zu schicken und dort zum Fotografen ausbilden zu lassen – das wäre ja auch kein schlechter Beruf.
Chaim beeilte sich. Sein Ziel war der Fleischer am anderen Ende des Marktes. Während er noch krachend in die saure Gurke biss, erreichte er Berls Geschäft. Der Geruch frischen Fleisches stieg einem in die Nase. Chaim atmete ihn tief ein, als ob er von dem Duft alleine satt werden könnte.
Berl der Fleischer war ein beleibter Jude mit kurzen fleischigen Händen und Wurstfingern. Er war dabei, den Rumpf eines Kalbes auf dem breiten Hackklotz zu zerteilen. Auf einem Brett, das an der hinteren Wand angebracht war, hingen auf Haken größere und kleinere gehackte Stücke von Brust und Rücken. Vorne auf dem Tisch waren auf der hölzernen, glatt abgehobelten Oberfläche ausgelegt: zurechtgeschnittene Streifen Fleisch, Milz und Leber, eine Zunge, bedeckt mit trübem Schaum, und eine Schüssel mit Innereien. Warmer Dampf stieg noch von ihnen auf.
Berl drehte seinen großen Kopf, der aussah, als steckte er tief zwischen den Schultern. Er hatte keinen Schnurrbart, sein roter schütterer Kinnbart ließ ihn den ortsansässigen Tataren ähneln. Auf seiner Oberlippe prangte eine dicke dunkle Warze. Jetzt rührte sie sich und ein heiseres Knurren war zu hören, wie aus dem aufgeblähten Bauch des Fleischers heraus: „Es hängt dort … im Stall.“
Chaim schlüpfte durch die Hintertür, lief über einen kleinen schmutzigen Hof und öffnete die Tür zum Stall. Das Quietschen der verrosteten Türangeln, zusammen mit dem Bild, das sich ihm darbot, vereinigten sich in seinem Gehirn und riefen gleichzeitig ein Gefühl von Schauer und Unruhe bei ihm hervor. Einige Tage davor hatte Berl der Fleischer ihn gebeten, dem alten Schild über seiner Fleischerei einen neuen Anstrich zu verpassen. Als es um das Entgelt ging, hatte Chaim den Fleischer verschämt gebeten, dass jener ihn nur einen Blick auf ein eben erst geschächtetes Kalb werfen lassen solle. Der Fleischer hatte den Jungen mit großen Augen angeglotzt: „Das ist alles?“, hatte Berl in der ihm eigenen Art gebrummt und kurz angebunden hinzugefügt, „komm am Sonntag.“
Das geschlachtete Kälbchen, das mit einem groben Strick um die beiden Hinterfüße an einer Stange unter dem Dach hing, erinnerte an einen umgedrehten zerzausten Pelz. Die Vorderfüße waren breit gespreizt, als ob sie Raum gewinnen wollten in einer letzten Anstrengung, sich zu retten. Das Tier war bereits ausgenommen – Chaim hatte die Gedärme schon vorher auf dem Tisch der Fleischerei liegen sehen und das Blut sickerte in roten Rinnsalen aus der durchschnittenen Kehle, rann über die Backen und das blasse Maul und fiel in dicken Tropfen in die untergestellte Schüssel. Ein Fliegenschwarm besetzte hartnäckig den blutigen Rumpf, ohne Furcht, von dort vertrieben zu werden.
Chaim fühlte sein eigenes Blut an seinen Schläfen pochen. Er gab sich einen leichten Ruck und fuhr, ohne den Blick vom Kalb abzuwenden, wieder mit der Hand in seine Brusttasche. Dort war noch ein Stift versteckt – ein roter, den er für einen speziellen Fall aufbewahrte. Heute war es endlich so weit … Er erinnerte sich, wie der Rabbi im Cheder32 einmal „Ki ha-dam hu ha-nefesch“33 gesagt hatte und es übersetzte: „Das Blut ist die Seele. Solange noch Blut tropft, hat die lebendige Seele den Körper noch nicht verlassen.“
Er muss sie sehen, die letzten lebenden Augenblicke der Seele, die noch in dem Blut zappelt. Oj, wenn er jetzt nur richtige Ölfarben gehabt hätte, hätte er vielleicht die sterbende Seele des Kälbchens auf Leinwand übertragen und sie derart verewigen können …
Jahre später malte der Maler Chaim Soutine im fernen Paris mit demselben jungenhaften Eigensinn immer noch blutige Torsos und Teile von Rindern und Hühnern. Vielleicht hielt sein Herz immer noch einfältig daran fest, dass man eine Seele retten könne, solange das Blut tropft. „Naturmort“ bedeutet doch: „Stillleben“.
2
Schmuel der Schächter tauchte Anfang der 1950er Jahre in Belz34 auf. Sein Gesicht, das man durch das kleine Fenster sah, wirkte wie mit dem dichten schwarzen, sorgfältig in Form gebrachten Bart verwachsen. Auf dem Kopf trug er eine dunkelblaue Schirmmütze, wie sie in jenen Jahren sehr verbreitet war, ähnlich denen der sowjetischen Machthaber. Die platte Nase ließ ihn nicht sofort als Juden erkennen; er ähnelte schon eher einem Kosaken oder den russischen Bauern, die in einem Dörfchen hinter der Stadt wohnten. Die neugierigen Frauen, die sich nicht zu schade waren, ihre Nasen durch das kleine Fenster zu stecken, konnten sehen, dass der Schochet eine dunkle Schürze umgebunden hatte und an den Armen bis zu den Ellbogen hinauf schwarze Ärmelschoner trug, damit das Hemd nicht mit Blut vollgespritzt wurde. Vielleicht durch das Paar Ärmelschoner bekam Schmuel der Fleischhauer einen Namen unter den Frauen als „großer Pedant“.
Der Bart ließ den Schochet älter aussehen, aber die großen blauen Augen offenbarten die Wahrheit, dass er erst in seinen Dreißigern stand. Über sein Privatleben wusste man wenig, weil er nicht direkt in der Stadt wohnte, sondern weit entfernt vom Zentrum, beinahe „am Ende der Welt“. Man war sich nicht sicher, ob er eine Familie hatte oder nicht. Es wurde sogar behauptet, dass er mit einer Christin zusammenwohne. Wenn man etwas nicht sicher weiß, fängt man an, sich etwas auszudenken. Klar und sicher war, dass Schmuel keiner der „Hiesigen“ war, sondern einer von den „Angekommenen“, den „Eingewanderten“. Mehr noch: Er war nicht einfach ein Jude, sondern ein Litwak35. Sein Akzent im Jiddischen war nicht zu überhören.
In der Synagoge sah man Schmuel den Schochet selten, außer am Schabbat. Man erklärte das damit, dass er zu weit weg wohne. Ins Schächthaus pflegte er dreimal in der Woche zu kommen: sonntags, dienstags und donnerstags. An den übrigen Tagen war das kleine Fenster von innen verschlossen. Vor den Feiertagen freilich herrschte in dem kleinen Hof, in dem das Schächthaus stand, jeden Tag lebendiges Treiben, besonders vor Rosch ha-Schana36 und an Erev Jom Kippur37 nach dem Kapores-Schlagen38. Die Frauen und die Hühner lieferten sich einen Wettstreit, wer lauter kreischen konnte. Der öde Hof schien wieder belebt zu werden. Vor dem Krieg hatten in den jetzigen Ruinen einige jüdische Familien gelebt. Einige der Hausfrauen fanden sich, während sie darauf warteten, an die Reihe zu kommen, einen Platz auf den Lehmziegeln, erinnerten sich an die Bewohner, nebbech, und deren grauenhaftes Ende gleich am ersten Kriegstag. „Jene Tage, nicht für uns gedacht“, wie jede Geschichte zu beginnen pflegte, ließen sich nicht vergessen, besonders nicht an den „Ehrfurchtsvollen Tagen“39 zwischen Rosch ha-Schana und Jom Kippur. Jede der jüdischen Frauen hatte ihre ganz eigene Geschichte, wie sie am Leben geblieben war. In dem kleinen Hof, in dem alle paar Minuten ein Kapores-Huhn geschlachtet wurde, tropfte das Blut von ihren Worten.
Plötzlich drang ein gellender Schrei durch den Lärm und das geschäftige Treiben: „Mörder!“