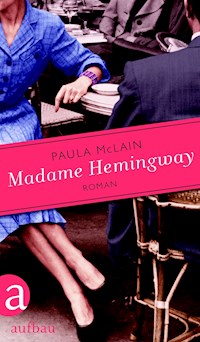8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Frau, die den Himmel bezwang. Aufgewachsen als Tochter eines Lords im afrikanischen Busch, interessiert sich die junge Beryl nicht für Seidenkleider und Etikette. Dafür ist sie stark und mutig wie ein Kipsigis-Junge und hat von ihrem Vater alles über Rassepferde gelernt. Doch im britischen Protektorat – dem späteren Kenia – der vorigen Jahrhundertwende ist kein Platz für solch ein ungezähmtes Mädchen. Bis sie in Karen Blixen eine Seelenverwandte findet – und in deren Geliebtem, dem Flieger und Großwildjäger Denys Finch Hutton, das Abenteuer ihres Lebens. Die Autorin des internationalen Bestsellers „Madame Hemingway“ erzählt in diesem großen Afrika-Epos die wahre Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham, die als erste Frau den Atlantik überquerte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Frau, die den Himmel bezwang
Aufgewachsen als Tochter eines Lords im afrikanischen Busch, interessiert sich die junge Beryl nicht für Seidenkleider und Etikette. Dafür ist sie stark und mutig wie ein Kipsigis-Junge und hat von ihrem Vater alles über Rassepferde gelernt. Doch im britischen Protektorat – dem späteren Kenia – der vorigen Jahrhundertwende ist kein Platz für solch ein ungezähmtes Mädchen. Bis sie in Karen Blixen eine Seelenverwandte findet – und in deren Geliebtem, dem Flieger und Großwildjäger Denys Finch Hutton, das Abenteuer ihres Lebens.
Die Autorin des internationalen Bestsellers »Madame Hemingway« erzählt in diesem großen Afrika-Epos die wahre Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham, die als erste Frau den Atlantik überquerte.
Paula McLain
Lady Africa
Roman
Aus dem Amerikanischen von Yasemin Dinçer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Prolog
4.September 1936Abingdon, England
TEIL EINS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
TEIL ZWEI
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
TEIL DREI
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Epilog
4.September 1936
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Eine Anmerkung zu den Quellen
Anhang
Zu Beryl Markhams Leben nach ihrem Rekordflug
Zur Kolonialgeschichte Kenias
Zum Wahrheitsgehalt der Figuren
Die beiden Motti sowie die im Roman zitierten Gedichte sind entnommen aus:
Über Paula McLain
Impressum
Leseprobe aus: Paula McLain Madame Hemingway
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für meine Familie – in Liebe und unendlicher Dankbarkeit – und für Letti Ann Christoffersen, die meine Lady D war
Ich lernte beobachten, lernte auch, mich anderen Händen anzuvertrauen. Und ich lernte es, auf Wanderschaft zu gehen. Ich lernte, was jedes träumende Kind wissen muss – dass kein Horizont zu weit ist, um bis zu ihm und über ihn hinaus vorzustoßen. Diese Dinge lernte ich sofort. Die meisten jedoch fielen mir schwerer.
Beryl Markham
Wir müssen das Leben prägen, solange es in unserer Macht steht.
Karen Blixen
Prolog
4.September 1936Abingdon, England
Die Vega Gull ist pfauenblau mit silbernen Flügeln, prächtiger als jeder Vogel, den ich je gesehen habe, und ich darf sie fliegen. Getauft auf den Namen Messenger, wurde sie mit großer Sorgfalt und Geschicklichkeit entworfen und gebaut, um das scheinbar Unmögliche zu vollbringen: einen Ozean in einem einzigen mutigen Satz zu überqueren, dreitausendsechshundert Meilen aus schwarzem, stürmischem Wellengang und absolutem Nichts – mit mir am Steuer.
Ich besteige sie in der Abenddämmerung. Seit Tagen haben sich über dem Flugplatz Unwetter zusammengebraut, und dem restlichen Licht fehlt jede Kraft. Der Regen trommelt auf die Flügel der Gull ein, von der Seite kommen starke Windböen, aber man erklärt mir, mit besserem Wetter könne ich diesen Monat nicht mehr rechnen. Das Wetter bereitet mir allerdings weniger Sorgen als mein Gewicht. Die Gull ist mit einem besonderen Fahrwerk ausgestattet, um das zusätzliche Öl und Benzin tragen zu können. Die Tanks wurden unter den Tragflächen und im Cockpit angebracht, wo sie eng um meinen Sitz herum eine Wand bilden. Mit zwei Fingern kann ich ihre Benzinhähne erreichen, um während des Fluges den Tank zu wechseln. Ich wurde angewiesen, einen Tank völlig leerlaufen zu lassen und zu verschließen, bevor ich den nächsten öffne, damit sich keine Luftblasen bilden. Der Motor mag dann für ein paar Augenblicke aussetzen, wird aber wieder anspringen. Ich werde mich darauf verlassen müssen. So wie auch auf eine ganze Menge anderer Dinge.
Auf dem Rollfeld breiten sich überall Pfützen aus wie kleine Seen, deren Oberflächen weiß schäumen. Unter tief hängenden Wolken bläst unaufhörlich ein heftiger Gegenwind. Ein paar Journalisten und Freunde haben sich versammelt, um meinem Start beizuwohnen, aber die Stimmung ist unbestreitbar düster. Wer von ihnen die Waghalsigkeit meines Vorhabens wirklich einschätzen kann, hat versucht mich davon abzubringen: Nicht heute. Nicht dieses Jahr. Der Rekord wird immer noch zu brechen sein, wenn das Wetter sich gebessert hat. Aber ich bin schon zu weit gekommen, um jetzt noch umzukehren. Ich verstaue meinen kleinen Proviantkorb, stecke die Brandyflasche in eine Seitentasche meines Fliegeroveralls und zwänge mich ins Cockpit wie in eine zweite Haut. Jim Mollison, bisher der einzige Pilot, der dieses spezielle Meisterstück versucht und überlebt hat, hat mir seine Armbanduhr geliehen. Außerdem habe ich eine Flugkarte dabei, auf der meine Route über den Atlantik von Abingdon nach New York aufgezeichnet ist, jeder Zentimeter eiskalten Wassers, über den ich hinwegfliegen werde, jedoch weder die Leere noch die Einsamkeit oder die Angst, die damit verbunden sind. Dabei sind diese Empfindungen genauso real, und ich werde durch sie hindurchfliegen müssen. Mitten durch die Übelkeit erregenden Turbulenzen und Luftlöcher, denn man kann die Dinge, die einem Angst einjagen, nicht einfach umfliegen. Man kann nicht vor sich selbst davonlaufen, und das ist auch besser so. Manchmal glaube ich, wir wachsen und verändern uns nur durch Herausforderungen – eine Startbahn von einer knappen Meile Länge und achthundertsechzig Kilo Treibstoff. Schwarze Wolkengeschwader drängen aus allen vier Himmelsrichtungen heran, während das Licht von Minute zu Minute schwindet. Wenn ich das hier überstanden habe, werde ich unweigerlich nicht mehr dieselbe sein.
Ich bringe mich in Stellung und gebe dann Vollgas, rase vorbei an den Zuschauern mit ihren Kameras und an der Reihe von Markierungen bis zu der einzelnen roten Fahne, nach der es kein Zurück mehr gibt. Als Startbahn steht mir nur eine Meile zur Verfügung, kein Zentimeter mehr. Und natürlich ist es möglich, dass die Gull es nicht schafft. Nach aller Planung und Sorgfalt, Arbeit und Aufbietung von Mut bleibt die überwältigende Möglichkeit bestehen, dass sie am Boden kleben bleibt, mehr Elefant als Schmetterling, und ich scheitere, noch bevor ich angefangen habe. Aber nicht, ehe ich nicht mein Bestes gegeben habe.
Nach fünfhundert Fuß hebt sich ihr Heck schwerfällig. Ich dränge sie schneller voran, nehme den Zug der Schwerkraft wahr, das unmögliche Gewicht des Flugzeugs, und spüre mehr als dass ich sehe, wie sich die rote Fahne nähert. Dann erwachen endlich das Seiten- und Höhenruder zum Leben, ihre Nase schwingt nach oben, und sie verlässt die Erde pfeilgerade. Also doch ein Schmetterling. Wir steigen hinauf in den sich verdunkelnden Himmel und den Regen über dem grün-grau karierten Swindon. Vor mir liegt die Irische See, all das finstre Wasser, das nur darauf wartet, nach meinem Herzen zu langen und es zum Stillstand zu bringen. Das verwaschene Funkeln von Cork. Die sich auftürmende Schwärze von Labrador. Das stetige Schluchzen des Motors, der ausführt, wofür er konstruiert wurde.
Mit federnder Nase schiebe ich mich durch den spritzenden Regen in den Steigflug, mitten hinein in das Unwetter, das mich erschaudern lässt. In meinen Händen stecken alle Instinkte, die zum Fliegen nötig sind, ebenso wie die praktische Erfahrung, und dann ist da noch eine geheimnisvollere und grundlegendere Sache: Ich bin und war schon immer dafür bestimmt, dies zu tun, meinen Namen mit diesem Propeller und diesen lackierten Flügeln in den Himmel zu sticken, in sechsunddreißig Stunden vollkommener Dunkelheit.
Die Idee zu diesem Rekordversuch kam vor zwei Jahren auf, in der lauten, zedernholzgetäfelten Bar des White Rhino in London. Auf meinem Teller befanden sich mit Pfeffer besprenkelte Tournedos vom Rind neben blanchierten Spargelstengeln, so schmal wie mein kleiner Finger, und all unsere Gläser waren mit dunklem Rotwein gefüllt. Da knallte JC Carberry eine Mutprobe auf den Tisch wie einen abschließenden Gang: Noch niemand ist von dieser Seite aus über den Atlantik geflogen, in der schwierigen Richtung, weder Mann noch Frau. Was meinst du, Beryl?
Damals hatte Mollison noch nicht zu seinem Sprung übers Wasser angesetzt, und niemand konnte sich das Flugzeug vorstellen, das dazu in der Lage wäre, aber JC hatte mehr Geld, als er je ausgeben konnte, und den Elan eines Magellan oder Peary. Und da waren sie: der grenzenlose Ozean, Tausende Meilen eiskalter unberührter Luft, eindeutiges Neuland, aber noch kein Flugzeug. Möchtest du es riskieren?
JCs Augen leuchteten wie Achate. Ich betrachtete ihr Glitzern und dachte, dass seine wunderschöne Frau Maia bei uns sein sollte, in weiße Seide gehüllt und das Haar perfekt onduliert, aber sie war vor Jahren bei einer einfachen Flugstunde in der Nähe von Nairobi ums Leben gekommen, an einem windstillen, ungetrübten Tag. Ihr Absturz war die erste Flugzeugtragödie, die uns direkt traf, sollte jedoch nicht die letzte bleiben. Viele andere gute Geister grüßten aus der Vergangenheit, ein Blinzeln des Lichts, das den Rand unserer Weingläser umspielte und uns daran erinnerte, wie waghalsig und wie glorreich sie gewesen waren. Mich musste man eigentlich nicht daran erinnern. Ich hatte jene Geister nicht für einen Moment vergessen, und als mein Blick den JCs traf, fühlte ich mich aus irgendeinem Grund bereit, sie noch näher an mich heranzuholen. Ja, sagte ich, und dann wiederholte ich es noch einmal.
Es dauert nicht lang, bis die letzten Überreste des Lichts von den ausgefransten Rändern des Himmels fortgespült werden und nur noch der Regen und der Benzingeruch zurückbleiben. Ich fliege zweitausend Fuß über dem Meeresspiegel und werde nahezu zwei Tage lang auf dieser Höhe bleiben. Dichte Wolken haben den Mond und die Sterne verschluckt – die Dunkelheit ist so vollständig, dass mir keine Wahl bleibt, als nach den Instrumenten zu fliegen und die Müdigkeit davonzublinzeln, um prüfend auf die schwach beleuchteten Skalen zu blicken. Da ich keine Funkverbindung habe, wirken das Geräusch und die Kraft meines Motors und des Windes, der mir mit vierzig Knoten um die Nase weht, beruhigend. Auch das Gluckern und Schwappen des Benzins in den Tanks ist tröstlich, bis der Motor vier Stunden nach Abflug plötzlich stockt. Er stottert und pfeift und geht dann aus. Stille. Die Nadel meines Höhenmessers bewegt sich mit erschreckender Geschwindigkeit spiralförmig abwärts. Ihr Anblick versetzt mich in eine Art Trancezustand, aber meine Hände wissen, was zu tun ist, noch während in meinem Geist dumpfes Schweigen herrscht. Ich muss lediglich nach dem Benzinhahn greifen und den Tank wechseln. Die Maschine wird wieder anspringen. Ganz sicher. Ich versuche, die Hand ruhig zu halten, während ich nach dem silbernen Hebel taste. Als ich ihn betätige, klickt er zwar beruhigend, doch der Motor rührt sich nicht. Die Gull verliert weiter an Höhe, sinkt auf tausendeinhundert Fuß, dann achthundert. Tiefer. Die Wolken um mich herum teilen sich kurz, und ich sehe das furchterregende Glitzern von Wasser und Gischt. Die Wellen greifen nach oben, während der unergründliche Himmel mich hinabdrückt. Ich betätige den Schalter erneut, gebe mir Mühe, weder zu zittern noch in Panik zu geraten. Ich habe mich so gut wie möglich auf alles vorbereitet, aber ist irgendjemand je wirklich vorbereitet auf den Tod? War Maia es, als sie den Boden auf sich zufliegen sah? War Denys es, an jenem schrecklichen Tag über Voi?
Ein Blitz, so hell wie Weihnachtsbeleuchtung, knistert neben meinem linken Flügel und lädt die Luft elektrisch auf – und auf einmal scheint es mir, als sei all dies bereits geschehen, vielleicht sogar schon viele Male. Vielleicht bin ich schon immer hier gewesen und mir selbst kopfüber entgegengestürzt. Unter mir peitscht das herzlose Wasser, bereit, mich zu empfangen, aber meine Gedanken kreisen um Kenia. Mein Rift Valley – Longonot und der zerklüftete Rand des Menengai. Der Nakurusee mit seiner pink schimmernden Hülle aus Flamingos, die hohen und niedrigeren Steilabfälle der Escarpments, Kekopey und Molo, Njoro und der glänzende Rasen des Muthaiga Club. Ich scheine auf dem Weg dorthin zu sein, auch wenn ich weiß, dass das unmöglich ist – als durchschnitte der Propeller die Jahre, brächte mich zurück und gleichzeitig endlos weit nach vorn, ließe mich frei.
Oh, denke ich, während ich durch die Dunkelheit nach unten rase, allem anderen gegenüber blind. Irgendwie habe ich wohl den Weg nach Hause eingeschlagen.
TEIL EINS
1.
Als Kenia noch nicht Kenia war, bereits Millionen Jahre alt und dennoch auf gewisse Weise neu, bezeichnete dieser Name nur den prachtvollsten unserer Berge. Man konnte ihn von unserer Farm in Njoro im britisch-ostafrikanischen Protektorat aus sehen, wie er sich klar am Ende einer sich weit erstreckenden goldenen Ebene abzeichnete, seine Spitze mit einer Glasur aus Eis überzogen, die niemals vollständig schmolz. Durch den blau schimmernden Mau-Wald hinter uns zogen sich Nebelfäden. Vor uns fiel das Rongai Valley in die Ferne ab, an einer Seite begrenzt vom seltsamen, hohen Menengai-Krater, den die Einheimischen den Berg Gottes nannten, an der anderen von der entfernten Aberdare Range, einer Kette abgerundeter blaugrauer Berge, die sich in der Abenddämmerung dunstig lila verfärbten, ehe sie sich im Nachthimmel auflösten.
Als wir im Jahr 1904 dort ankamen, bestand die Farm aus nicht mehr als sechshundert Hektar unberührten Buschlands und drei verwitterten Hütten. »Das hier?«, fragte meine Mutter, während die Luft um sie herum surrte und flirrte, als wäre sie lebendig. »Für das hier hast du alles verkauft?«
»Andere Farmer haben an Orten mit noch schwierigeren Bedingungen Erfolg, Clara«, antwortete mein Vater.
»Du bist aber kein Farmer, Charles!«, fauchte sie ihn an, bevor sie in Tränen ausbrach.
Tatsächlich war er ein Mann der Pferde. Er kannte sich aus mit Hindernisrennen und Fuchsjagden und den friedlichen Landstraßen und Hecken Rutlands. Doch er hatte Flugblätter gelesen, auf denen billiges Land der britischen Krone angeboten wurde, woraufhin eine Idee von ihm Besitz ergriffen hatte, die ihn nicht mehr loslassen wollte. So verließen wir mein Geburtshaus Westfield House und reisten siebentausend Meilen weit, vorbei an Tunis, Tripolis und Suez, die Wellen wie riesige graue Berge, die den Himmel verschluckten. Dann durch Kilindini Harbour in den Hafen von Mombasa, in dem es nach scharfen Gewürzen und trocknendem Fisch roch, und von dort weiter mit dem Zug, der sich, die Fenster mit rotem Staub bedeckt, bis nach Nairobi schlängelte. Ich starrte alles mit großen Augen an, so vollkommen hingerissen, wie ich es wohl noch nie zuvor gewesen war. Was dieser Ort auch sein mochte, er war mit nichts zu vergleichen.
Wir lebten uns ein und schufteten, um es uns wohnlich zu machen, kämpften gegen die Wildnis an, während die Wildnis mit aller Macht zurückdrängte. Unser Land hatte keine sichtbaren Grenzen oder Zäune, und unseren Hütten fehlten richtige Türen. Colobus-Affen mit seidig gestreiftem Fell kletterten durch das Sackleinen, das unsere Fenster bedeckte. Sanitäre Anlagen waren undenkbar. Wer dem Ruf der Natur gehorchen musste, trat hinaus in die Nacht, wo sich alles Mögliche über einen hermachen wollte, und ließ pfeifend, um die Angst zu vertreiben, sein Hinterteil über ein Plumpsklo hängen.
Lady und Lord Delamere waren unsere nächsten weißen Nachbarn, einen sieben Meilen langen Ritt durchs Buschland von uns entfernt. Sie waren Baron und Baronin, doch ihre Titel bewahrten sie nicht davor, in den typischen Lehm-rondavels mit Strohdach zu schlafen. Lady D hatte stets einen geladenen Revolver unter ihrem Kopfkissen und riet meiner Mutter, es ihr nachzutun – die sich jedoch weigerte. Sie wollte weder auf Schlangen noch auf ihr Abendessen schießen. Sie wollte Wasser nicht meilenweit heranschleppen müssen, um ein halbwegs ordentliches Bad zu nehmen, und auch nicht mehrere Monate am Stück ohne Besuch leben. Es gab keine Gesellschaft. Es war unmöglich, sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Das Leben war einfach zu hart.
Nach zwei Jahren buchte meine Mutter die Überfahrt zurück nach England. Mein älterer Bruder Dickie würde mit ihr gehen, da er schon immer anfällig gewesen war und Afrika kaum länger überstehen würde. Ich war noch nicht einmal fünf Jahre alt, als sie mit Überseekoffern, Taschentüchern und Reiseschuhen ausgestattet den Zug bestiegen, der zweimal in der Woche nach Nairobi fuhr. Die weiße Feder am Hut meiner Mutter zitterte, als sie mich küsste und mir sagte, ich solle mich nicht unterkriegen lassen. Sie wisse, dass sie sich nicht um mich zu sorgen brauche, weil ich so ein großes, starkes Mädchen sei. Zur Belohnung würde sie mir eine Schachtel mit Lakritz und Birnendrops aus einem Geschäft in Piccadilly schicken, die ich mit niemandem würde teilen müssen.
Ich sah zu, wie sich der Zug entlang der starren schwarzen Linie der Gleise entfernte, ohne wirklich zu glauben, dass sie tatsächlich fortgehen konnte. Selbst als der letzte bebende Waggon von den fernen gelben Hügeln verschluckt war und mein Vater sich zu mir umdrehte, bereit, zur Farm und zu seiner Arbeit zurückzukehren, selbst da noch dachte ich, das Ganze sei ein Irrtum, irgendein furchtbares Missverständnis, das sich jeden Augenblick aufklären werde. Mutter und Dickie würden an der nächsten Station aussteigen oder in Nairobi umkehren und am kommenden Tag zurück sein. Als das nicht eintraf, wartete ich dennoch weiter, lauschte auf das ferne Grollen des Zuges und hatte stets mit einem Auge den Horizont im Blick, das Herz voller Erwartung.
Wir hörten monatelang nichts von meiner Mutter, erhielten nicht einmal ein hastiges Telegramm, bis schließlich die Süßigkeiten ankamen. Die Schachtel war schwer, und auf ihr stand ausschließlich mein Name – Beryl Clutterbuck – in der verschnörkelten Schrift meiner Mutter. Allein der Anblick ihrer Handschrift, diese vertrauten Schrägen und Schleifen, ließ mich sofort in Tränen ausbrechen. Ich wusste, was dieses Geschenk bedeutete, und konnte mir nicht länger etwas vormachen. Ich hielt die Schachtel fest umschlungen und verschwand damit in einer versteckten Ecke, wo ich zitternd so viele der zuckerumhüllten Dinger in mich hineinstopfte, wie ich konnte, bevor ich mich in einen Eimer aus dem Stall übergab.
Später brachte ich zwar den Tee, den mein Vater mir gekocht hatte, nicht herunter, wagte es aber endlich, meine größte Angst auszusprechen: »Mutter und Dickie kommen nicht zurück, oder?«
Er sah mich gequält an. »Ich weiß es nicht.«
»Vielleicht wartet sie darauf, dass wir zu ihr kommen.«
Er schwieg lange, bevor er zugab, dass das möglich war. »Hier ist jetzt unser Zuhause«, sagte er dann. »Und ich bin noch nicht bereit, es aufzugeben. Du etwa?«
Mein Vater ließ mir die Wahl, aber es war keine leichte. Er fragte nicht: Bleibst du hier bei mir? Diese Entscheidung war vor Monaten gefallen. Er wollte wissen, ob ich dieses Leben genauso lieben konnte wie er. Ob ich diesem Ort mein Herz schenken konnte, selbst wenn sie nie zurückkehrte und ich von jetzt an keine Mutter mehr hätte, vielleicht für immer.
Wie sollte ich ihm darauf antworten? Überall um uns herum erinnerten mich die halbleeren Schränke an all die Dinge, die sich einst darin befunden hatten, nun aber fort waren – vier Teetassen aus Porzellan mit goldbemaltem Rand, ein Kartenspiel, eine Kette aus klickend aneinanderstoßenden Bernsteinperlen, die meine Mutter geliebt hatte. Ihre Abwesenheit tönte immer noch so laut und lastete so schwer auf mir, dass es mir weh tat und ich mich ganz leer und verloren fühlte. Ich wusste nicht, wie ich meine Mutter vergessen sollte, und mein Vater wusste genauso wenig, wie er mich trösten könnte. Er zog mich – langgliedrig und ein bisschen schmutzig, wie ich es wohl stets war – auf seinen Schoß, und wir saßen eine Weile still da. Vom Waldrand schallten die Warnschreie einer Gruppe Schliefer herüber. Einer unserer Windhunde spitzte ein glattes Ohr und nahm dann sein gemütliches Nickerchen vor dem Feuer wieder auf. Schließlich seufzte mein Vater. Er fasste mich unter den Armen, streifte meine trocknenden Tränen mit einem raschen Kuss und stellte mich dann auf meine eigenen Füße.
2.
Miwanzo ist das Suaheliwort für Anfänge. Aber manchmal muss erst alles enden und jedes Licht zischend erlöschen, und man muss den Boden unter den Füßen verlieren, ehe wirklich etwas Neues beginnen kann. Das Verschwinden meiner Mutter war ein solches Ereignis für mich, auch wenn ich es nicht sofort bemerkte. Lange Zeit war ich bloß verwirrt und verletzt und furchtbar traurig. Waren meine Eltern immer noch verheiratet? Liebte oder vermisste meine Mutter uns? Wie hatte sie mich zurücklassen können? Ich wollte mit diesen Fragen nicht zu meinem Vater gehen. Er war im Vergleich zu anderen Vätern nicht allzu einfühlsam, und ich wusste nicht, wie ich solche intimen und verletzten Gefühle mit ihm teilen sollte.
Dann geschah etwas. Im und hinter dem Mau-Wald auf unserem Land lebten mehrere Kipsigis-Familien in Hütten aus Lehm und Flechtwerk, die von hohen Dornenhecken umgrenzte bomas bildeten. Auf irgendeine Weise erkannten sie, was ich brauchte, ohne dass ich darum bitten musste. Sie sammelten mich kurzerhand auf und banden mir feierlich eine Kaurimuschel um die Taille. Sie sollte die geschlossene Kaurimuschel zwischen meinen Beinen symbolisieren und böse Geister abwehren. Das taten sie bei jedem neugeborenen Kip-Mädchen. Ich war zwar die weiße Tochter ihres weißen bwanas, aber etwas Unnatürliches hatte sich zugetragen, das wieder in Ordnung gebracht werden musste. Keine afrikanische Mutter hätte je auch nur daran gedacht, ihr Kind im Stich zu lassen. Ich war schließlich gesund, nicht etwa verkrüppelt oder schwach. Also machten sie jenen ersten Anfang ungeschehen und schenkten mir einen neuen als Lakwet, was »sehr kleines Mädchen« bedeutet und von nun an mein Name bei den Kipsigis war.
Ich war klein, hatte X-Beine und schwer zu bändigendes weißblondes Haar, aber mein neuer Name und Rang trugen bald dazu bei, dass ich zäher wurde. Von den unzähligen Malen, die ich unseren Hügel in Richtung Kip-Dorf hinunter- und wieder herauflief, verwandelten sich meine Fußsohlen schnell in Leder. Abschnitte unseres Landes, in die ich mich bisher noch nie vorgewagt hatte, wurden mir so vertraut wie die Zebrafelle auf meinem Bett. Wenn das Tageslicht schwand, kletterte ich unter die Felle und beobachtete, wie der Hausdiener barfuß und lautlos in mein Zimmer trat, um die Sturmlaterne anzuzünden. Manchmal ließ das plötzliche Aufflackern und Zischen Glattechsen in ein Versteck in den Hüttenwänden huschen, was sich anhörte, als würden Stöckchen über Stroh streifen. Dann folgte die Wachablösung, bei der die Insekten des Tages – Hornissen und Mauerbienen – sich in Lehmnester in den abgerundeten Wänden meines Zimmers verkrochen und die Grillen erwachten, um in einem Rhythmus zu zirpen, der nur ihnen allein bekannt war. So wartete ich eine Stunde oder länger, beobachtete, wie sich Schatten über die Möbel in meinem Zimmer schlängelten, die aus Petroleumkisten gebaut waren und alle gleich aussahen, bis die Schatten sie abrundeten und verwandelten. Ich lauschte, bis ich die Stimme meines Vaters nicht mehr vernehmen konnte, und schlüpfte dann aus einem offenen Fenster hinaus in die tintenschwarze Nacht, um mich zu meinem Freund Kibii am niedrigen Feuer in seiner Hütte zu gesellen.
Kibiis Mutter und die anderen Frauen tranken einen trüben Tee aus Baumrinde und Nesseln und spannen ihre Geschichten darüber, wie alles entstanden war. Dort lernte ich den größten Teil meines Suahelis, immer begieriger nach neuen Geschichten … darüber, wie die Hyäne zu ihrem hinkenden Gang und das Chamäleon zu seiner Geduld gekommen war. Wie der Wind und der Regen einst Männer gewesen waren, bis sie bei einer wichtigen Aufgabe versagten und in den Himmel verbannt wurden. Die Frauen selbst waren runzlig und zahnlos oder so glatt wie poliertes Ebenholz, muskulös, zäh und langgliedrig unter ihren blassen shukas. Ich liebte sie und ihre Geschichten, aber noch lieber wollte ich mich Kibii und den anderen totos anschließen, die zu Kriegern wurden, jungen morani.
Die Rolle der Mädchen im Dorf war rein häuslich. Ich hatte jedoch eine andere Position – eine seltene, frei von den traditionellen Rollen, die Kibiis Familienkreis und auch meinen eigenen bestimmten. Zumindest fürs Erste erlaubten die Kip-Ältesten mir, mit Kibii gemeinsam zu trainieren: einen Speer zu werfen, Warzenschweine zu jagen und die List von arap Maina, Kibiis Vater, zu studieren, der der erste Krieger des Dorfes war und mein Ideal von Stärke und Furchtlosigkeit verkörperte. Man brachte mir bei, einen Bogen zu fertigen und Ringeltauben, Seidenschwänze und leuchtende Blaustare abzuschießen, eine Peitsche aus Nashornleder knallen zu lassen und ein knorriges Wurfholz mit tödlicher Treffsicherheit zu handhaben. Ich wurde so groß wie Kibii, dann noch größer und rannte mit staubbedeckten Füßen genauso schnell wie er durch das hohe goldene Gras.
Kibii und ich liefen oft gemeinsam hinaus in die Dunkelheit, hinweg über das frisch gesichelte Gras, das die Grenze unserer Farm markierte, und durch die feuchten höheren Gräser, die uns bis zu den Hüften nass machten, vorbei am Green Hill und tief hinein ins Innere des Waldes. Dort streiften nachts Leoparden umher. Ich hatte zugesehen, wie mein Vater einen mit einer Ziege anlockte, während wir uns zur Sicherheit oben auf dem Wassertank zusammenkauerten. Die Ziege begann zu zittern, als sie die Raubkatze roch, und mein Vater visierte diese mit seinem Gewehr an und hoffte, sie nicht zu verfehlen. Überall lauerte Gefahr, aber wir kannten alle Geräusche der Nacht und ihre Botschaften, die Zikaden und Riedfrösche, die fetten, Ratten ähnelnden Schliefer, die tatsächlich entfernte Verwandte der Elefanten waren. Manchmal hörten wir die Elefanten selbst in der Ferne durch den Busch krachen, wenngleich sie sich vor dem Geruch der Pferde fürchteten und selten zu nahe kamen. Schlangen vibrierten in ihren Löchern. Schlangen konnten sich auch von Bäumen herunterschwingen und die Luft wie ein Seil durchschneiden oder nur ganz leise mit ihrem glatten Bauch über die feinporigen Äste des Mahagonibaumes reiben.
Jahrelang erlebte ich mit Kibii diese perfekten Nächte und langen, trägen Nachmittage, die zum Jagen und Reiten gemacht waren, und irgendwie – mit Hilfe von Macheten, Seilen, Füßen und menschlichem Schweiß – verwandelte sich die Wildnis im Laufe der Zeit in richtige Felder. Mein Vater pflanzte Mais und Weizen an, und alles gedieh. Mit dem Geld, das er damit verdiente, kaufte er zwei ausgediente Dampfmaschinen. Am Boden festgeschraubt, wurden sie zum pulsierenden Herzen unserer Getreidemühle, und Green Hills wurde zur wichtigsten Pulsader in Njoro. Bald konnte man, wenn man von unserem Hügel aus über die Terrassenfelder und den mannshohen Mais hinwegblickte, eine Kette aus flachen Ochsenwagen sehen, die Getreide zu unserer Mühle brachten. Die Mühle lief ohne Unterlass, und die Zahl unserer Arbeiter verdoppelte und verdreifachte sich, darunter Männer der Kikuyu, Kavirondo, Nandi und Kipsigis sowie Holländer, die ihre Peitschen knallen ließen, um die Ochsen anzutreiben. Die Blechschuppen wurden abgerissen und ein Stall aufgebaut, und dann noch weitere, deren neu entstandene Boxen sich mit frischem Heu und den besten Vollblütern Afrikas füllten, wie mein Vater mir sagte, oder auch der ganzen Welt.
Manchmal dachte ich im Bett vor dem Einschlafen immer noch an Mutter und Dickie, während ich die Laute der Nacht aus allen Richtungen hereindringen hörte, ein unablässiges Brodeln. Sie schickten keine Briefe, zumindest nicht an mich, weshalb es schwer war, mir ihr Leben vorzustellen. Unser altes Haus war verkauft worden. Wo auch immer sie sich letzten Endes niedergelassen hatten, die Sterne und Bäume wären dort ganz anders als die, die wir in Njoro hatten. Auch der Regen würde anders sein, und die Wärme und Farbe der Sonne am Nachmittag. An allen Nachmittagen all der Monate, die wir getrennt voneinander waren.
Ich hatte immer größere Mühe, mich an das Gesicht meiner Mutter zu erinnern, oder an Dinge, die sie zu mir gesagt hatte, Tage, die wir gemeinsam verlebt hatten. Vor mir lagen aber noch viele Tage. Sie erstreckten sich weiter, als ich blicken oder hoffen konnte, so wie die Ebene sich bis zur zerbrochenen Schüssel des Menengai oder bis zum schroffen blauen Gipfel des Mount Kenya ausdehnte. Es war sicherer, nach vorn zu sehen – meine Mutter in einen hinteren Winkel meiner Erinnerung zu verbannen, wo sie mich nicht mehr verletzen konnte, oder mir vorzustellen, wenn ich doch einmal an sie dachte, dass ihr Fortgehen notwendig gewesen war. Eine Art Schmieden oder Schleifen meines Geistes, meine erste wesentliche Prüfung als Lakwet.
Eins stand fest: Ich gehörte auf die Farm und ins Buschland. Ich war Teil der Dornbäume und des hoch aufragenden Steilhangs, der zerbeult aussehenden Hügel mit ihrer dichten Vegetation, der tiefen Täler dazwischen und der hohen getreideartigen Gräser. Hier war ich zum Leben erwacht, als wäre mir eine zweite Geburt geschenkt worden, eine wahrhaftigere. Dies war meine Heimat, und auch wenn mir eines Tages alles durch die Finger rinnen würde wie roter Staub, war es für die Dauer meiner Kindheit ein Himmel, der perfekt auf mich zugeschnitten war. Ein Ort, den ich in- und auswendig kannte. Der eine Platz auf der Welt, für den ich geschaffen war.
3.
Das Läuten der Stallglocke zerbrach die Stille. Die trägen Hähne und staubgrauen Gänse erwachten ebenso wie die Hausdiener und Stallburschen, Gärtner und Hirten. Ich besaß meine eigene Hütte aus Lehmflechtwerk, ein wenig abseits von der meines Vaters, die ich mir mit meinem so hässlichen wie treuen Mischlingshund Buller teilte. Er jaulte beim Erklingen der Glocke, streckte sich an seinem Platz am Fuß meines Bettes, wand dann seinen kantigen Schädel unter meinem Arm hindurch und drückte ihn mir in die Seite, so dass ich seine kalte Schnauze und die runzligen halbmondförmigen Narben auf seinem Kopf spürte. Ein dickes Knäuel befand sich an der Stelle, wo sein rechtes Ohr gewesen war, bis eines Nachts ein Leopard in meine Hütte gekrochen war und versucht hatte, ihn in die Dunkelheit hinauszuzerren. Buller hatte dem Leoparden die Kehle aufgerissen und war von ihrem vermischten Blut bedeckt nach Hause gehumpelt, wobei er aussah wie ein Held, aber auch wie halb tot. Mein Vater und ich hatten ihn wieder gesund gepflegt, und wenn er auch nie eine ausgesprochene Schönheit gewesen war, war er fortan zusätzlich ergraut und nahezu taub. Wir liebten ihn jedoch umso mehr, da der Leopard nicht einmal ansatzweise seinen Mut gebrochen hatte.
Auf dem Hof wartete Kibii in der kühlen Morgenluft auf mich. Ich war elf Jahre alt, er ein wenig jünger, und wir waren beide zu Rädchen im gut geölten Getriebe der Farm geworden. Andere weiße Kinder aus der Nachbarschaft gingen in Nairobi, manche sogar in England zur Schule, aber mein Vater erwähnte nie, dass ich etwas in der Art tun sollte. Der Stall war mein Klassenzimmer. Kurz nach Tagesanbruch war die Zeit für den morgendlichen Galopp der Pferde. Den ließ ich mir auf keinen Fall entgehen, und Kibii ebenso wenig. Als ich mich nun dem Stall näherte, sprang er hoch in die Luft, als wären seine Beine Sprungfedern. Ich hatte diese Art Sprung jahrelang geübt und kam genauso hoch wie Kibii, aber um ihn im Wettbewerb zu besiegen, das wusste ich, tat ich am besten so wenig wie möglich. Dann würde Kibii nämlich springen und springen und sich selbst übertreffen und schließlich müde werden. Erst in diesem Moment würde ich loslegen und ihn in den Schatten stellen.
»Wenn ich ein Moran werde«, sagte Kibii, »dann trinke ich Stierblut und Sauermilch statt Nesseln wie eine Frau, und dann werde ich so schnell sein wie eine Antilope.«
»Ich könnte auch ein großer Krieger sein«, erwiderte ich.
Kibii hatte ein offenes, hübsches Gesicht, und seine Zähne blitzten nun auf, da er lachte, als hätte er noch nie im Leben etwas Lustigeres gehört. Als wir noch jünger waren, hatte er mich gern an seiner Welt teilhaben lassen, vielleicht weil er spürte, dass es lediglich ein Spiel war. Ich war schließlich ein Mädchen, noch dazu ein weißes. Aber in letzter Zeit hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass er mich skeptisch und missbilligend betrachtete, als wartete er darauf, dass ich endlich den Versuch aufgab, mit ihm zu konkurrieren, und einsah, dass wir bald sehr unterschiedliche Wege einschlagen würden. Ich hatte jedoch nicht die Absicht, dies zu tun.
»Mit dem richtigen Training könnte ich es«, beharrte ich. »Ich könnte es heimlich tun.«
»Was für einen Ruhm würdest du damit gewinnen? Wer wüsste dann, dass es deine Taten sind?«
»Ich wüsste es.«
Er lachte erneut und wandte sich in Richtung Stalltür. »Wen reiten wir heute?«
»Daddy und ich brechen zu Delamere auf, um uns eine Zuchtstute anzusehen.«
»Ich werde jagen gehen«, erklärte er. »Dann sehen wir ja, wer mit der besseren Geschichte zurückkehrt.«
Als Wee MacGregor und Balmy, das Reitpferd meines Vaters, gesattelt und bereit waren, brachen wir in Richtung der Morgensonne auf. Eine Weile trübte Kibiis Herausforderung noch meine Gedanken, aber mit fortschreitender Zeit und Entfernung geriet sie in Vergessenheit. Um uns herum wurde Staub aufgewirbelt und kroch unter unsere locker gebundenen Taschentücher in unsere Nasen und Münder. Fein und schlickig, ockerrot wie das Fell eines Fuchses, umgab er uns ständig, genau wie die Sandflöhe, die wie rote Pfefferkörnchen waren, sich an allem festklammerten und nicht mehr losließen. Man durfte nicht an die Sandflöhe denken, da man nichts gegen sie tun konnte. Man durfte auch nicht an die beißenden Termiten denken, die sich in bedrohlichen Streifen über die Ebenen bewegten, oder an die Vipern oder die Sonne, die manchmal so hell pulsierte, als wollte sie einen erdrücken oder bei lebendigem Leibe auffressen. Man durfte es nicht, weil diese Dinge zu diesem Land gehörten und es zu dem machten, was es war.
Nach drei Meilen kamen wir an eine kleine Senke, deren roter Schlamm getrocknet war und ein rissiges Muster ausgedörrter Venen gebildet hatte. Über die Senke führte eine Lehmbrücke, die ohne unter sie hindurchfließendes Wasser nutzlos wirkte und aussah wie das Rückgrat irgendeines riesigen Tieres, das an dieser Stelle gestorben war. Wir hatten auf das Wasser für unsere Pferde gezählt. Vielleicht würde es ein Stückchen weiter welches geben, vielleicht aber auch nicht. Um uns beide von dem Problem abzulenken, begann mein Vater, über Delameres Stute zu sprechen. Er hatte sie noch nicht gesehen, aber das hielt ihn nicht davon ab, große Hoffnungen für unsere Pferdezucht in sie zu setzen. Er hatte stets das nächste Fohlen im Blick, und wie dieses unser Leben verändern könnte – und weil er so dachte, tat ich es auch.
»Sie ist zwar eine Abessinier-Stute, aber Delamere meint, sie sei schnell und vernünftig.«
Mein Vater war vor allem an Vollblütern interessiert, aber manchmal konnte man auch an gewöhnlicheren Orten ein Juwel finden, und das wusste er.
»Was für eine Farbe hat ihr Fell?«, wollte ich wissen. Das war stets meine erste Frage.
»Sie ist ein blassgoldener Palomino, mit weißer Mähne und weißem Schweif. Ihr Name ist Coquette.«
»Coquette«, wiederholte ich, und mir gefielen die scharfen Kanten des Wortes, ohne zu wissen, was es bedeutete. »Das klingt passend.«
»Meinst du?«, lachte er. »Wir werden es wohl sehen.«
Lord Delamere war für mich und für jeden, der ihn gut kannte, einfach nur D. Er war einer der ersten wichtigen Siedler der Kolonie und verfügte über ein unbeirrbares Gespür dafür, welches Stück Land am fruchtbarsten sein würde. Er schien den gesamten Kontinent übernehmen und für sich arbeiten lassen zu wollen. Niemand war ehrgeiziger oder eigensinniger oder unverblümter als D, wenn es um die Dinge ging, die er liebte (Land, die Massai, Freiheit, Geld). Er hatte die Ambition, was auch immer er berührte oder ausprobierte, in einen Erfolg zu verwandeln. Waren die Risiken hoch und die Chancen gering, nun, umso besser.
Er konnte gut Geschichten erzählen, wobei er so wild gestikulierte, dass ihm sein langes rotes Haar immer wieder in die Stirn fiel. Als junger Mann war er mit einem übellaunigen Kamel als einzigem Begleiter zweitausend Meilen durch die Somali-Wüste gelaufen und hatte sich schließlich hier im Hochland wiedergefunden. Er verliebte sich sofort in diesen Ort. Als er anschließend nach England zurückkehrte, um das für seine Ansiedlung notwendige Kapital zu organisieren, traf er dort Florence, die temperamentvolle Tochter des Earl of Enniskillen, und heiratete sie. »Sie hatte keine Ahnung, dass ich sie eines Tages an den Haaren hierher zurückschleifen würde«, sagte er dazu gern.
»Als ob du mich irgendwohin schleifen könntest«, antwortete Lady D dann oft in scherzhaftem Ton. »Wir wissen beide, dass es für gewöhnlich andersherum läuft.«
Nachdem unsere müden Pferde endlich ihr verdientes Wasser bekommen hatten, führten die Delameres uns hinaus zu der kleinen Koppel, wo Coquette gemeinsam mit ein paar anderen Zuchtstuten und einer Handvoll Fohlen weidete. Sie war mit Abstand die Hübscheste, gedrungen und flachsblond, mit gebogenem Hals und kräftiger Brust. Ihre Beine verjüngten sich zu wohlgeformten Fesseln und Hufen. Während wir sie betrachteten, warf sie ihren Kopf zurück und blickte uns direkt an, als warnte sie uns davor, sie für weniger als perfekt zu halten.
»Sie ist wunderschön«, flüsterte ich.
»Ja, und das weiß sie auch«, erwiderte D vergnügt. Er war stämmig gebaut und schien ständig zu schwitzen, was seiner guten Laune aber generell keinen Abbruch tat. Mit einem blauen Baumwolltaschentuch wischte er sich über die Schläfen, während mein Vater durch die Zaunlatten kletterte, um die Stute aus der Nähe zu begutachten.
Ich habe nur selten gesehen, dass ein Pferd sich vor meinem Vater erschreckte oder vor ihm ausriss, und auch Coquette bildete keine Ausnahme. Sie schien augenblicklich zu spüren, dass er die Situation und sie selbst unter Kontrolle hatte, auch wenn sie ihm noch nicht gehörte. Sie wackelte einmal mit den Ohren und blies ihn aus ihren samtenen Nüstern an, hielt jedoch still, während er sie untersuchte, ihr mit den Händen über Schädel und Maul strich, dann langsamer über ihren Widerrist und ihren Rücken, auf der Suche nach irgendeiner Beule oder Unregelmäßigkeit. Auf ihrer Lende und ihrer Kruppe wurde er noch langsamer und ließ seine Finger ihre Arbeit tun. Er befühlte jedes ihrer anmutigen Hinterbeine, die Unterschenkel und Knie, Sprunggelenke und Röhren wie ein Blinder. Ich wartete darauf, dass er sich aufrichtete oder dass sein Gesicht sich verdüsterte, aber die Untersuchung ging schweigend weiter, und in mir wuchs die Hoffnung. Als er fertig war und sich vor sie stellte, um ihr über die runden Wangen zu streichen, hielt ich die Spannung kaum noch aus. Wenn er ihr jetzt nicht verfallen war, nachdem sie seine eingehende Prüfung bestanden hatte, würde es mir das Herz brechen.
»Wieso willst du dich von ihr trennen?«, fragte er D, ohne den Blick von Coquette abzuwenden.
»Weil sie Geld bringt, natürlich«, antwortete D mit einem leichten Schnauben.
»Du weißt doch, wie er ist«, fügte Lady D hinzu. »Seine neuste Besessenheit sticht die alte jedes Mal aus. Jetzt dreht sich alles um Weizen, und die meisten Pferde werden gehen müssen.«
Bitte, bitte, sag ja, flehte ich stumm.
»Weizen also?«, wiederholte mein Vater, bevor er sich von Coquette abwandte, wieder auf den Zaun zuschritt und an Lady D gerichtet hinzufügte: »Ich könnte wohl nicht zufällig etwas Kühles zu trinken bekommen?«
Ich wollte mich gegen die Knie der Stute werfen, eine Handvoll ihrer buttrigen Mähne ergreifen, mich auf ihren Rücken schwingen und allein mit ihr fort in die Berge reiten – oder sie mit nach Hause nehmen, sie in eine versteckte Box sperren und mit Zähnen und Klauen verteidigen. Sie hatte mein Herz bereits erobert, und meinen Vater hatte sie auch für sich gewonnen, das wusste ich, doch er verhielt sich niemals spontan. Er verbarg seine Gefühle stets hinter einer undurchdringlichen Wand, was ihn zu einem wunderbaren Verhandlungsführer machte. Er und D würden nun den Rest des Tages damit beschäftigt sein, die Bedingungen auszuhandeln, ohne irgendetwas direkt auszusprechen, jeder sorgfältig darauf bedacht, dem anderen nicht zu zeigen, was ein Sieg oder eine Niederlage für ihn bedeuten würde. Ich fand das Ganze unerträglich, aber es blieb nichts anderes zu tun, als zum Haus zurückzukehren, wo die Männer sich mit Rye Whiskey und Limonade an den Tisch setzten und anfingen zu reden, ohne zu reden, und zu verhandeln, ohne zu verhandeln. Ich warf mich auf den Teppich vor dem Kamin und schmollte.
Die Delameres hatten auf der Equator Ranch zwar mehr Land und mindestens so viele Arbeiter wie wir auf Green Hills, dennoch hatte D an ihrem eigenen Wohnbereich, der aus zwei großen Lehm-Rondavels mit einem Boden aus gestampfter Erde, schiefen Fenstern und Leinenvorhängen als Türen bestand, kaum Verbesserungen vorgenommen. Allerdings hatte Lady D die Hütten mit allerlei hübschen Dingen gefüllt, die schon seit Jahrhunderten im Besitz ihrer Familie waren, wie sie mir erzählt hatte: einem schweren Himmelbett aus Mahagoni mit einer üppig bestickten Tagesdecke, goldgerahmten Bildern, einem langen Mahagonitisch mit acht passenden Stühlen und einem handgebundenen Atlas, in den ich mich bei jedem meiner Besuche gern vertiefte. An jenem Tag war ich jedoch zu unruhig, um Landkarten zu betrachten, und konnte lediglich auf dem Teppich liegen, meine staubigen Absätze gegeneinanderschlagen, mir immer wieder auf die Lippe beißen und mir wünschen, die Männer mögen sich beeilen.
Schließlich kam Lady D und setzte sich zu mir, wobei sie ihren weißen Baumwollrock vor sich ausbreitete und sich, auf die Hände gestützt, entspannt zurücklehnte. Sie war nie penibel oder zimperlich, und das gefiel mir an ihr. »Ich habe leckere Kekse da, wenn du möchtest.«
»Ich habe keinen Hunger«, sagte ich. Was eine glatte Lüge war.
»Dein Haar ist jedes Mal wilder, wenn ich dich sehe.« Sie schob mir sanft den Teller mit den Keksen herüber. »Dabei hat es so eine schöne Farbe. Tatsächlich ist sie der von Coquettes Mähne ganz ähnlich.«
Damit hatte sie mich gewonnen. »Findest du?«
Sie nickte. »Hättest du etwas dagegen, wenn ich es ein wenig bürste?«
Verstimmt, wie ich war, hatte ich keine allzu große Lust, still dazusitzen, während jemand sich mit meinen Haaren beschäftigte, aber ich ließ sie gewähren. Sie hatte eine Bürste mit silbernem Griff und wunderbar weichen weißen Borsten, über die ich immer wieder gern mit dem Finger strich. In unserem Haus befanden sich keinerlei weibliche Utensilien mehr, weder Seide noch Satin, Parfüm, Schmuck oder Puderquasten. Die Bürste war exotisch. Während Lady D zugange war und dabei leise summte, stürzte ich mich auf die Kekse. Bald war auf dem Teller nichts übrig außer ein paar buttrigen Krümeln.
»Woher hast du diese üble Narbe?«, fragte sie mich.
Ich blickte auf den ausgefransten Saum meiner kurzen Hose, unter dem der schlimmste Teil einer langen, schartigen Verletzung zum Vorschein kam, die sich meinen halben Oberschenkel hinaufschlängelte. Sie sah wirklich ziemlich böse aus. »Vom Kämpfen mit den Totos.«
»Mit Totos oder mit Buschschweinen?«
»Ich habe einen der Kip-Jungs verprügelt und ihn über meine Schulter zu Boden geworfen. Das hat ihn so blamiert, dass er mir im Wald aufgelauert hat und mit dem Messer seines Vaters auf mich losgegangen ist.«
»Was?« Sie fuhr erschrocken auf.
»Daraufhin musste ich ihn verfolgen, nicht wahr?« Ich konnte den Stolz in meiner Stimme nicht ganz unterdrücken. »Er sieht jetzt viel schlimmer aus als ich.«
Lady D seufzte in mein Haar. Ich wusste, dass sie besorgt war, aber sie sagte nichts weiter, also gab ich mich ganz dem Ziehen der Bürste und der Art, wie sie über meine Kopfhaut strich, hin. Es fühlte sich so gut an, dass ich halb vor mich hin dämmerte, als die Männer endlich aufstanden und sich die Hände schüttelten. Ich sprang mit einem Satz auf die Beine und fiel Lady D dabei beinahe in den Schoß. »Gehört sie jetzt uns?«, fragte ich drängend.
»Clutt feilscht wie eine Hyäne«, erwiderte D. »Beißt sich fest und will einfach nicht mehr loslassen. Er hat mir diese Stute beinahe unter dem Hintern weggestohlen.« Er lachte, und mein Vater stimmte ein und klopfte ihm auf die Schulter.
»Sieht Beryl nicht hübsch aus?«, fragte Lady D. Sie stellte sich hinter mich und legte mir eine Hand auf den Kopf. »Ich fragte mich schon, ob ich hinter einem ihrer Ohren wohl ein Meisennest finden würde.«
Mein Vater lief rot an und räusperte sich. »Ich fürchte, als Kindermädchen tauge ich nicht viel.«
»Das solltest du auch nicht«, bellte D zu seiner Verteidigung. »Dem Mädchen geht es prächtig. Sieh sie dir doch nur an, Florence. Sie ist stark wie ein Maultier.«
»Ach, ja. Wir wollen natürlich alle ein Maultier als Tochter, nicht wahr?«
Der gesamte Wortwechsel verlief freundlich, dennoch hinterließ er bei mir ein seltsames, verwirrendes Gefühl. Als wir eine Stunde später zum Ritt nach Hause aufbrachen, nachdem das Finanzielle und die Einzelheiten von Coquettes Übergabe geklärt waren, merkte ich, dass auch mein Vater verunsichert war. Wir ritten schweigend unter der rasch sinkenden roten Sonne. In der Ferne wirbelte ein Staubteufel wie ein Derwisch herum, raste in eine Gruppe Flammenbäume hinein und scheuchte eine große Schar Geier auf. Einer flog über uns davon, und sein Schatten, der langsam über uns hinwegkroch, ließ mich erschaudern.
»Ich gebe zu, dass mir das alles manchmal über den Kopf wächst«, sagte mein Vater, als der Geier verschwunden war.
Ich konnte mir anhand der Besorgnis, die Lady D angesichts meiner Narbe und meiner generellen Verfassung gezeigt hatte, denken, wovon er sprach. Ich wusste, dass er mit »das alles« mich meinte, seine Tochter.
»Ich finde, wir kommen bestens zurecht«, entgegnete ich und beugte mich vor, um Wee MacGregor den Hals zu tätscheln. »Ich will nicht, dass sich irgendetwas ändert.«
Er sagte nichts, während die Sonne am Horizont verschwand. So nah am Äquator gab es so gut wie keine Dämmerung. Der Tag verwandelte sich innerhalb von Minuten in Nacht, aber diese Minuten waren bezaubernd. Um uns herum erstreckte sich das gelbe Gras, so weit das Auge reichte, und wogte wie das Meer, tauchte manchmal in Erdferkelhöhlen und Buschschweinlöcher hinab oder stieg hinauf bis zu den unebenen Spitzen der Termitenhügel, ohne je wirklich abzureißen. Die Illusion, das Buschland würde niemals enden, war mächtig – die Vorstellung, wir könnten jahrelang so weiterreiten, getragen von den Gräsern und dem Gefühl der Ferne, weiter bis in alle Ewigkeit.
4.
Coquette war vom Tag ihrer Ankunft an der Liebling der Farm. Da wir keine anderen Pferde von solch goldener Farbe hatten, wollten alle Totos ihr nahe sein und sie anfassen. Sie schien zu leuchten und Glück zu bringen, und ein paar Monate lang lief alles reibungslos. Sie gewöhnte sich ein, während mein Vater grübelte und Pläne schmiedete, welcher Hengst sie decken sollte, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Zucht ist die wichtigste Angelegenheit für jemanden, der mit Pferden arbeitet. Noch bevor ich lesen konnte, wusste ich, dass jedes Vollblutpferd sich auf drei arabische und orientalische Hengste aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert zurückführen ließ, die mit einer Handvoll ausgewählter Stuten gepaart wurden. Die lange Abstammungslinie wurde im Zuchtbuch englischer Vollblüter peinlich genau festgehalten. Beim Abendessen schlugen wir das Buch auf, um es zu Rate zu ziehen, zusammen mit dem dicken schwarzen Hauptbuch, in dem wir unsere eigene Zucht aufzeichneten – das alte und neue Testament unserer Bibel.
Nach wochenlangen Diskussionen wurde entschieden, dass Referee Coquette decken sollte, wenn diese rossig war. Er war ein heller Araberfuchs und mit einem Meter sechzig kompakt gebaut, hatte gute Hufe, weit geöffnete Schultern und vollkommen gerade Beine. Sein Schritt war so gleichmäßig, dass er jede Distanz mühelos zu durchmessen schien. Wir redeten viel über das neue Fohlen, das elf Monate nach der erfolgreichen Paarung erscheinen und die Schnelligkeit seines Vaters sowie das glänzende Fell und die anmutigen Bewegungen seiner Mutter besitzen würde. Es war für mich vollkommen real. Unsere Gespräche hatten es bereits zum Leben erweckt.
An einem langen, stickigen Nachmittag saß ich mit Kibii unter der Akazie am Rand unseres großen Hofs und überlegte mir Namen für das Fohlen, von denen ich einige laut aussprach. Außerhalb des bläulichen Schattenrings war die Erde wie gehämmertes Metall und auch genauso schmerzhaft wie heißes Metall oder glühende Kohlen, wenn man es wagte, darauf zu laufen. Wir hatten den Morgen mit Reiten verbracht und danach so viel Zaumzeug eingefettet, bis unsere Finger sich verkrampft hatten. Nun waren wir erschöpft, aber zugleich unruhig und aufgestachelt von der Hitze.
»Was hältst du von Jupiter oder Apollo?«, schlug ich vor.
»Er sollte Schakal heißen. Der Name passt besser zu einem Hengstfohlen.«
»Schakale sind nichts Besonderes.«
»Schakale sind schlau.«
Bevor ich ihn berichtigen konnte, kam eine Rauchsäule in unser Blickfeld getuckert. Es war der laute Zug aus Nairobi, ein Dutzend plumpe Eisenbahnwagen, die so hart auf den Gleisen aufschlugen, dass man jederzeit damit rechnete, einer von ihnen könnte abfliegen oder in Stücke brechen. Kibii drehte sich, um über den Hügel zu blicken. »Erwartet dein Vater ein Pferd?«
Ich glaubte nicht, dass mein Vater irgendetwas erwartete, dennoch beobachteten wir, wie er aus dem Stall geeilt kam, sich das Haar glattstrich und das Hemd in die Hose steckte. Er blickte mit vor der Sonne zusammengekniffenen Augen den Hügel hinab, bewegte sich dann rasch auf unseren neuen Ford-Wagen zu und kurbelte den launenhaften Motor an. Kibii und ich fragten nicht erst, ob wir mitkommen durften, sondern trabten einfach hinüber und kletterten auf den Rücksitz.
»Heute nicht«, sagte mein Vater, wobei er kaum den Blick von seiner Aufgabe hob. »Es wird nicht genug Platz für alle sein.«
Alle? »Also bekommen wir Besuch?«
Ohne zu antworten, setzte er sich hinters Steuer und fuhr davon, wobei er uns in eine rosarote Staubwolke hüllte. Keine Stunde später hörten wir, wie der Wagen den Hügel wieder herauftuckerte, und erhaschten kurze Blicke auf etwas Weißes. Ein Kleid. Ein Hut mit Schleifen und bis zu den Ellbogen reichende Handschuhe. Im Wagen saß eine Frau, und zwar eine sehr schöne, mit aufgetürmtem glänzenden Haar in der Farbe von Rabenfedern und einem schicken, spitzenbesetzten Sonnenschirm, der nicht aussah, als hätte er schon einen einzigen Tag im Busch überstanden.
»Beryl, das ist Mrs. Orchardson«, sagte mein Vater, nachdem sie ausgestiegen waren. Zwei große Koffer ragten hinter ihnen auf dem Wagen auf. Sie war nicht nur zum Tee gekommen.
»Ich bin so froh, dich endlich kennenzulernen«, sagte Mrs. Orchardson, wobei sie mich rasch von oben bis unten musterte. Endlich? Mein Mund klappte auf und blieb wohl eine ganze Weile so stehen.
Als wir das Haupthaus betraten, sah Mrs. Orchardson sich ausgiebig um, die Hände locker auf die Hüften gestützt. Mein Vater hatte es zwar schlicht gestaltet, aber das Haus war stabil und eine große Verbesserung im Vergleich zu der Hütte, die wir einst bewohnt hatten. Mrs. Orchardson hatte so etwas jedoch noch nie gesehen. Sie schritt durch den Raum. Vor allen Fenstern hingen Spinnweben, und die Kaminplatten waren mit einer dicken Rußschicht bedeckt. Das Wachstuch auf unserem Tisch war seit Jahren nicht ausgetauscht worden, nicht seit meine Mutter fort war. Der schmale Holzkohle-Kühlschrank, in dem wir Butter und Sahne aufbewahrten, roch ranzig, wie der Schlamm auf dem Grund eines Teiches. Wir hatten uns daran gewöhnt, wie an alles andere auch. An den Wänden hingen von Jagdabenteuern mitgebrachte Trophäen: Leoparden- und Löwenfelle, lange gewundene Kudu-Hörner, ein Straußenei, so groß und schwer wie ein menschlicher Schädel. Nirgendwo war irgendetwas Feines oder Vornehmes zu sehen – aber wir hatten es auch ganz gut ohne solche Dinge ausgehalten.
»Mrs. Orchardson hat sich einverstanden erklärt, unsere Haushälterin zu sein«, erklärte mein Vater, während sie sich die Handschuhe abzupfte. »Sie wird hier im Haupthaus schlafen. Wir haben reichlich Platz.«
»Oh«, machte ich, als hätte man mir einen Schlag gegen die Luftröhre versetzt. Es gab einen Raum, den man als Schlafzimmer nutzen konnte, aber er war gefüllt mit Sätteln und Zaumzeug, Petroleum, Konservendosen und allem möglichen Kram, den wir nicht sehen oder mit dem wir uns nicht befassen wollten. Dieser Raum war der Beweis dafür, dass wir gar keine Haushälterin benötigten. Und wo sollten nun Gäste übernachten, nachdem diese Frau, die kein Gast war, gekommen war, um alles auf den Kopf zu stellen?
»Warum gehst du nicht hinaus zu den Ställen, während wir hier alles regeln?«, fragte mein Vater in einem Tonfall, der keine Widerrede zuließ.
»Wie schön«, sagte Mrs. Orchardson. »Dann bereite ich schon einmal den Tee zu.«
Schäumend vor Wut lief ich über den Hof. Die Welt schrumpfte für mich auf die plötzliche Tatsache zusammen, die Mrs. Orchardson darstellte, und was sie wohl tun oder sein wollte. Als ich wiederkam, hatte sie sich umgezogen und trug nun einen einfachen Rock und eine Hemdbluse mit einer sauberen weißen Schürze darüber. Sie hatte die Ärmel bis zu den Ellbogen aufgerollt. Während sie die Tasse meines Vaters aus dem dampfenden Kessel in ihrer Hand auffüllte, fiel ihr eine seidige Haarsträhne in die Stirn. Mein Vater hatte sich auf unseren einzigen bequemen Stuhl gesetzt und die Füße auf einen niedrigen Tisch gelegt. Er sah sie voller Vertrautheit an.
Ich musste bei ihrem Anblick blinzeln. Ich war keine Stunde fort gewesen, doch sie hatte dem Raum bereits ihren Stempel aufgedrückt. Der Teekessel gehörte ihr. Sie hatte das Wachstuch abgeschrubbt. Die Spinnweben waren verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Nichts würde erst großartig überredet oder gezähmt werden müssen. Nichts schien bereit, sich ihr zu widersetzen.
Mein Vater sagte, ich solle sie Mrs. O nennen. Im Laufe der nächsten Tage packte sie ihre Überseekoffer aus und füllte sie mit Dingen aus dem Haus – verstaubte Jagdbeute, einzelne Kinkerlitzchen oder Kleidungsstücke, die meine Mutter zurückgelassen hatte. Es war alles Teil ihres Plans, ein »strenges Regiment« zu führen – zwei ihrer Lieblingswörter. Sie mochte Ordnung und Seife und einen in handliche Portionen aufgeteilten Tagesablauf. Morgens war die Zeit zum Lernen.
»Ich muss raus zu den Pferden«, erklärte ich ihr, überzeugt davon, mein Vater würde sich auf meine Seite stellen.
»Sie werden vorerst auch ohne dich auskommen, meinst du nicht?«, fragte sie nüchtern, während mein Vater ein trockenes, kehliges Räuspern hervorwürgte und rasch das Haus verließ.
Innerhalb einer Woche hatte sie meinen Vater davon überzeugt, dass ich Schuhe tragen müsse. Noch ein paar Wochen später war ich in Kleid und Haarschleifen gefesselt, statt eine Shuka zu tragen, und durfte nicht mehr mit den Händen essen. Ich sollte auch keine Schlangen, Maulwürfe oder Vögel mit meinem rungu töten oder all meine Mahlzeiten bei Kibii und seiner Familie einnehmen. Ich sollte keine Warzenschweine oder Leoparden mit Arap Maina jagen, sondern eine ordentliche Schulbildung erhalten und die englische Hochsprache erlernen.
»Ich habe dir zu lange freien Lauf gelassen, und das weißt du auch«, sagte mein Vater, als ich ihn bat, in Ruhe gelassen zu werden. »Es ist alles nur zu deinem Besten.«
Er hatte mir tatsächlich freien Lauf gelassen, aber das war wunderbar gewesen. Diese neuen Beschränkungen summierten sich zu einem konventionellen Leben, das wir nie auch nur im Entferntesten geführt hatten.
»Bitte …« Ich hörte das Jammern in meiner Stimme und hielt inne. Ich war nie ein Kind gewesen, das bettelte oder sich beschwerte, und mein Vater würde ohnehin nicht nachgeben. Wenn ich wirklich etwas gegen Mrs. O ausrichten wollte, musste ich allein auf eine Lösung kommen. Ich würde ihr zeigen, dass ich kein Spinnennetz in einer Ecke war, etwas, das man abwischen oder zurechtbiegen konnte, sondern eine ernstzunehmende Rivalin. Ich würde ihre Vorlieben und Gewohnheiten studieren und ihr auf Schritt und Tritt folgen, bis ich über sie Bescheid wüsste und verstände, wie ich sie schlagen konnte, und was genau ich tun musste, um mein schönes Leben zurückzubekommen.
5.
Der Tag, an dem Coquette fohlen sollte, rückte immer näher. Sie war rund geworden wie eine Tonne, und das neue Leben drückte von innen gegen ihren Leib, diese langen Glieder, die bereits versuchten, sich auszustrecken und ihren Weg zu finden. Die Mühen der Schöpfung hatten ihr goldenes Fell stumpf werden lassen. Sie wirkte müde und lustlos und tat kaum mehr, als an den Luzerne-Bündeln zu knabbern, die ich ihr brachte.
Für mich konnte das Fohlen gar nicht schnell genug kommen. Allein der Gedanke daran ließ mich die langen Stunden Lateinunterricht in zwickenden Schuhen überstehen. Eines Nachts weckte mich eine Bewegung Bullers neben mir aus dem Tiefschlaf. Die Stallburschen waren von ihren Nachtlagern aufgestanden. Auch mein Vater war auf den Beinen. Ich erkannte den gedämpften Klang seiner Stimme und zog mich rasch an, in Gedanken allein bei Coquette. Sie war zwanzig Tage zu früh, was normalerweise ein schwaches oder kränkliches Fohlen bedeutete, aber es musste nicht so sein. Mein Vater würde wissen, was zu tun war.
Draußen auf dem Hof drang das Licht mehrerer Sturmlaternen durch Spalte in der Stalltür. Hoch über mir wirbelten milchige Sternenstreifen, die liegende Mondsichel strahlte hell und klar. Das Brodeln der nächtlichen Insekten kam aus dem Wald und von überall her, aber im Stall war es ruhig. Viel zu ruhig, das wusste ich, lange bevor ich Coquettes Box erreicht hatte, aber ich kannte den Grund dafür nicht, bis ich meinen Vater aufstehen sah. Er schritt auf mich zu und hielt mich zurück. »Das willst du nicht sehen, Beryl. Geh wieder schlafen.«
»Was ist passiert?« Mein Hals war wie zugeschnürt.
»Totgeboren«, erwiderte er leise.
Mein Herz setzte einen Schlag aus, all meine Hoffnungen waren augenblicklich zunichtegemacht. Apollo würde nicht auf wackligen Beinen stehen wie eine Giraffe. Er würde niemals den Wald oder das hohe Escarpment sehen oder an den Bahngleisen entlanggaloppieren, während ich mich über seinen glänzenden Nacken beugte. Er würde Green Hills nicht einmal einen Tag lang kennenlernen. Mein Vater hatte mich jedoch nie vor den harten Lektionen des Farmlebens abgeschirmt. Ich schluckte meine Tränen hinunter, schüttelte seine Arme ab und drängte mich nach vorn.
In der schattigen Box hatte Coquette sich in einer Ecke niedergelegt. Hinter ihr auf dem Boden war das Heu plattgedrückt, wo zwei Stallburschen knieten, die irgendwie versuchten, alles sauberzumachen. Das winzige Fohlen, zum Teil noch von seiner glitschigen Fruchtblase umhüllt, war da und zugleich auch nicht. Seine Augen und die Hälfte seines Gesichts fehlten. Wo das Fleisch aufgefressen war, blieb nur eine zerklüftete Schwärze zurück. Sein Bauch war weit geöffnet, seine Innereien verschlungen – was nur eins bedeuten konnte: Die riesigen Siafu-Ameisen waren gekommen. Sie waren schwarze Krieger mit großen Leibern, die rasch und entsetzlich fraßen, wie ein einziger Körper.
»Sie hat so leise gefohlt, dass niemand etwas mitbekommen hat«, sagte mein Vater, der sich neben mich stellte und mir einen Arm um die Schulter legte. »Das Fohlen war vielleicht bereits tot, ich weiß es nicht.«
»Arme Coquette«, sagte ich, drehte mich um und drückte meine Stirn in seine Brust.
»Sie ist robust, sie wird es überstehen«, meinte er.
Aber wie sollte sie das tun? Ihr Fohlen war fort. Die Ameisen hatten nichts anderes angerührt – sie hatten sich ausschließlich auf dieses zarte und hilflose Ding gestürzt und waren dann in die Nacht hinaus verschwunden. Warum?, dachte ich wieder und wieder, als ob es tatsächlich jemanden gäbe, der mir antworten könnte.
Am nächsten Morgen konnte ich noch nicht einmal den Gedanken an Unterricht ertragen und floh aus dem Haus, vorbei an den Pferdekoppeln zu einem schmalen Pfad, der sich steil den Hügel hinunterschlängelte. Als ich das Kip-Dorf erreicht hatte, brannten meine Lungen und meine nackten Beine waren übersät mit Striemen von den Dornbüschen und dem Elefantengras, aber ich fühlte mich schon besser, nur weil ich dort war. Das war schon immer so gewesen, auch als ich noch zu klein war, um den Riegel am Zaun zu öffnen. Die Dornbüsche, die den Zaun zusammenhielten, waren so hoch wie die Schultern großer Ochsen und schützten alles vor den Gefahren des Buschlands: die niedrigen Hütten, die wertvollen Ochsen, die zottigen meckernden Ziegen, die rußgeschwärzten Kochtöpfe über züngelnden Flammen und die Kinder.
An diesem Tag spielten ein paar Totos ein Trainingsspiel mit Pfeil und Bogen, bei dem sie sich in den festgetretenen Staub knieten und jeweils versuchten, dem Ziel aus zusammengebundenen Blättern am nächsten zu kommen. Kibii kniete in ihrer Mitte, und obwohl er mir einen kurzen neugierigen Blick aus seinen schwarzen Augen zuwarf, unterbrach er das Spiel nicht, während ich mich in der Nähe hinhockte. Die meisten Totos konnten ein festes Ziel ausgezeichnet treffen. Die Pfeile waren aus Zweigen geschnitzt und hatten Widerhaken an den Spitzen, die festsaßen, wenn sie ihr Ziel erreicht hatten, wie sie es sollten. Während ich ihnen zusah, wünschte ich mir, wie schon so oft zuvor, ich wäre als Kip geboren worden. Nicht als eins der Mädchen, die endlos kochen und sich um Körbe, Wasser, Lebensmittel und Babys kümmern mussten. Die Frauen erledigten alles Tragen und Hacken, Weben und Pflügen. Sie versorgten auch die Tiere, während die Krieger jagten oder sich auf die Jagd vorbereiteten, sich die Glieder mit geschmolzenem Fett einrieben und sich mit den Pinzetten, die sie in Beuteln um den Hals bei sich trugen, Härchen von der Brust zupften. Diese Totos, die hier auf dem Boden knieten, würden eines Tages nicht auf Blätter zielen, sondern auf Buschschweine, Steinantilopen und Löwen. Konnte es etwas Aufregenderes geben?
Als alle die erste Aufgabe erfüllt hatten, nahm einer der älteren Totos ein anderes Zielobjekt zur Hand, das ebenfalls aus Blättern bestand, aber in eine runde Kalebassenform gerollt war, und warf es in die Luft. Die Pfeile flogen, manche erreichten ihr Ziel, die meisten jedoch nicht. Diejenigen, die es am weitesten verfehlten, mussten sich dem Spott der anderen aussetzen, dennoch gab keiner auf. Wieder und wieder warf der Junge die Kalebasse in die Luft, und die Totos schossen ihre Pfeile ab, bis alle es geschafft hatten. Erst dann war das Spiel beendet.
Nachdem Kibii endlich zu mir herübergetrabt war und sich hingesetzt hatte, erzählte ich ihm, was mit dem Fohlen geschehen war. Er hielt noch immer seinen Bogen und ein paar schmale Pfeile in der Hand. Einen davon steckte er mit der Spitze in die feste Erde und sagte: »Die Siafu sind eine Plage.«