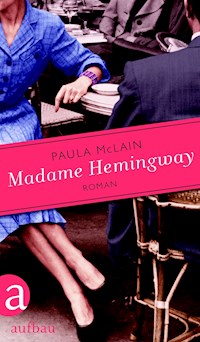9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn die Sterne verlöschen.
Anna Hart weiß selbst, dass sie vor ihrem Unglück davonläuft. Eigentlich ist sie Ermittlerin, Expertin darin, verschwundene Kinder zu finden. Doch nun ist ihrem eigenen Kind etwas passiert, und sie zieht sich an den Ort zurück, in dem sie aufgewachsen ist und glücklich war – zumindest für einige Zeit, als ihr Adoptivvater sich fürsorglich um sie kümmerte. Doch kaum ist sie angekommen, erfährt sie, dass ein junges Mädchen vermisst wird. Und sie weiß sofort, dass sie helfen – und sich den Gespenstern ihrer eigenen Vergangenheit stellen muss ...
„Paula McLain hat ein Meisterwerk von Roman geschrieben, das den Leser garantiert die ganze Nacht wachhalten wird. Ein literarischer Thriller - mit einer unvergesslichen Heldin und Wendungen, die einen bis ans Ende überraschen. Ein unkonventioneller Blick auf die langen Schatten, die Traumata werfen. Ein Buch voller Trauer und großer Schönheit.“ Kristin Hannah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Wenn die Sterne verlöschen …
Anna Hart weiß selbst, dass sie vor ihrem Unglück davonläuft. Eigentlich ist sie Ermittlerin, Expertin darin, verschwundene Kinder zu finden. Doch nun ist ihrem eigenen Kind etwas passiert, und sie zieht sich an den Ort zurück, in dem sie aufgewachsen ist und glücklich war – zumindest für einige Zeit, als ihr Adoptivvater sich fürsorglich um sie kümmerte. Doch kaum ist sie angekommen, erfährt sie, dass ein junges Mädchen vermisst wird. Und sie weiß sofort, dass sie helfen – und sich den Gespenstern ihrer eigenen Vergangenheit stellen muss.
»Paula McLain hat ein Meisterwerk von Roman geschrieben, das den Leser garantiert die ganze Nacht wachhalten wird. Ein literarischer Thriller – mit einer unvergesslichen Heldin und Wendungen, die einen bis ans Ende überraschen. Ein unkonventioneller Blick auf die langen Schatten, die Traumata werfen. Ein Buch voller Trauer und großer Schönheit.« Kristin Hannah
Über Paula McLain
Paula McLain studierte an der University of Michigan Kreatives Schreiben und lebte in den Künstlerkolonien Yaddo und MacDowell. Nach zwei Gedichtsammlungen und einem ersten Roman gelang ihr mit dem in 35 Sprachen übersetzten Roman »Madame Hemingway« ein internationaler Bestseller. Paula McLain lebt mit ihrer Familie in Cleveland.
Im Aufbau Verlag sind ebenfalls ihre Romane »Lady Africa« und »Hemingway und ich« lieferbar.
Yasemin Dinçer, geboren 1983, studierte Literaturübersetzen und hat u. a. Werke von Paula McLain, Shirley Hazzard und David Harvey ins Deutsche übertragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Paula McLain
Nacht ohne Sterne
Roman
Aus dem Amerikanischen von Yasemin Dinçer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1: Zeichen und Schwaden
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Kapitel 2: Geheime Dinge
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Kapitel 3: Zeit und die Jungfrau
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Dreiundfünfzig
Kapitel 4: Der gebogene Hain
Vierundfünfzig
Fünfundfünfzig
Sechsundfünfzig
Siebenundfünfzig
Achtundfünfzig
Neunundfünfzig
Sechzig
Einundsechzig
Zweiundsechzig
Dreiundsechzig
Vierundsechzig
Fünfundsechzig
Sechsundsechzig
Siebenundsechzig
Achtundsechzig
Neunundsechzig
Siebzig
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Impressum
Für Lori Keene, die da ist, seit ich diesen Traum zu träumen begann
Hier ist die Welt.Schöne und schreckliche Dinge werden geschehen.Hab keine Angst.
Frederick Buechner
Prolog
Die Mutter, die sich das Kleid vom Leib riss, als die Polizei vor ihrer Tür stand, um ihr die Nachricht zu überbringen, und die dann nur mit ihren Schuhen an den Füßen die Straße hinunterrannte, während ihre Nachbarinnen und Nachbarn, selbst jene, die sie gut kannten, sich hinter ihren Türen und Fenstern versteckten, aus Furcht vor ihrem Leid.
Die Mutter, die die Handtasche ihrer Tochter umklammert hielt, während der Krankenwagen davonraste. Die Handtasche pink und weiß, in der Form eines Pudels und blutverschmiert.
Die Mutter, die begann, für die Detectives und für den Priester ihrer Gemeinde zu kochen, während diese noch versuchten, ihr zu erklären, was geschehen war, ihre rauen Hände, mit denen sie einen Berg Zwiebeln hackte und in siedend heißem Wasser Teller wusch. Niemand konnte sie dazu bringen, sich zu setzen. Sich zu setzen bedeutete, es wissen zu müssen. Es zu akzeptieren.
Die Mutter, die nach der Identifizierung des Leichnams ihres Kindes die Leichenhalle verließ und direkt vor eine Straßenbahn lief, von dem Schlag sechs Meter nach hinten geschleudert wurde und mit schwarzen Lippen und rauchenden Fingerspitzen, durch die der Strom geschossen war, liegen blieb. Aber sie hatte überlebt.
Die Mutter, die einst eine berühmte Schauspielerin gewesen war, nun jedoch auf Neuigkeiten wartete, wie Gletscher am fernen Ende der Erdkugel warten, eingefroren und still, nur halb lebendig.
Die Mutter, die ich an jenem Tag im Juli war, auf die Knie gesunken, als der Rettungssanitäter versuchte, mit Worten, Sätzen oder meinem Namen zu mir durchzudringen. Ich ließ den Körper meines Kindes nicht los. »Detective Hart«, sagte der Sanitäter immer wieder, während mein Verstand nach Luft rang, in die Tiefe stürzte. Als ob diese Person überhaupt noch existieren könnte.
1 Zeichen und Schwaden
Eins
Die Nacht fühlt sich zerfetzt an, als ich durch den Dunst aus der Stadt hinausfahre, ein zerfallender Septemberhimmel. Potrero Hill ist ein toter Strandabschnitt hinter mir, ganz San Francisco wirkt ohnmächtig oder nichtsahnend. Über der Wolkendecke steigt eine gespenstische gelbe Kugel auf. Es ist der Mond, gigantisch und prall, in der Farbe von Limonade. Ich kann den Blick nicht von ihm abwenden, wie er höher und höher rollt, so hell glühend wie eine Wunde. Oder wie eine Tür, die von Schmerz grell erleuchtet wird.
Niemand kommt, um mich zu retten. Niemand kann irgendjemanden retten, auch wenn ich einst etwas anderes glaubte. Ich habe an alle möglichen Dinge geglaubt, aber heute begreife ich, dass der einzige Weg nach vorn darin besteht, mit nichts anzufangen. Ich habe mich selbst und niemanden sonst. Ich habe die Straße und den sich schlängelnden Nebel. Ich habe diesen gequälten Mond.
***
Ich fahre, bis ich keine vertrauten Wahrzeichen mehr sehen kann und aufhöre, im Rückspiegel nachzuschauen, ob mir jemand folgt.
Die Travelodge in Santa Rosa liegt versteckt hinter dem Parkplatz eines Großmarkts, dessen gesamte Fläche leer und grell angestrahlt ist wie ein nächtliches, menschenleeres Schwimmbad. Als ich die Glocke läute, macht die Nachtportierin in einem Hinterzimmer ein Geräusch, ehe sie fröhlich hervorkommt und sich die Hände an ihrem hellen Baumwollkleid abwischt.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt sie, die harmloseste aller Fragen.
»Gut.«
Sie hält mir das Registrierungsformular und einen lila Kugelschreiber hin, dabei entfaltet sich das gekräuselte Fleisch unter ihrem Arm wie ein Flügel. Ich spüre, wie sie mein Gesicht und mein Haar betrachtet. Sie beobachtet meine Hände und liest verkehrt herum: »Anna Louise Hart. Das ist aber ein schöner Name.«
»Was?«
»Finden Sie nicht, Baby?« In ihrer Stimme hört man die Karibik, ein satter, warmer Klang, der den Eindruck erweckt, sie nenne alle Menschen »Baby«.
Es kostet mich alle Mühe, angesichts ihrer Freundlichkeit nicht zusammenzuzucken und stattdessen im grünlichen Schein der Neonröhre stehen zu bleiben und mein Autokennzeichen aufzuschreiben. Und mit ihr zu sprechen, als wären wir einfach nur zwei beliebige Personen an einem beliebigen Ort, die sich vollkommen sorglos miteinander unterhalten.
Endlich gibt sie mir meinen Schlüssel, und ich gehe auf mein Zimmer, wo ich erleichtert die Tür hinter mir schließe. Im Zimmer befinden sich ein Bett, eine Lampe und einer jener merkwürdig platzierten Sessel, auf denen niemals irgendjemand sitzt. Die schlechte Beleuchtung verwandelt alles in triste Rechtecke, den geschmacklosen Teppich, die nach Plastik aussehende Tagesdecke und die Vorhänge, an denen einzelne Haken fehlen.
Ich stelle meine Reisetasche mitten aufs Bett, nehme meine Glock 19 heraus und schiebe sie unter das steife Kissen. Sie in der Nähe zu wissen gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, als wäre sie eine alte Freundin. Dann schnappe ich mir einen Satz Wechselkleidung und stelle die Dusche an. Während ich mich ausziehe, vermeide ich bewusst jeden Blick in den Spiegel, außer, um meine Brüste zu betrachten, die so hart wie Steine geworden sind. Die rechte fühlt sich heiß an, die Brustwarze ist umgeben von einer ungleichmäßigen roten Schwellung. Ich drehe das Wasser in der Dusche auf die heißeste Stufe und stelle mich darunter, lasse mich beinahe bei lebendigem Leib verbrennen, ohne jede Linderung.
Nachdem ich tropfend herausgestiegen bin, halte ich einen Waschlappen unter den Hahn, ehe ich ihn durchnässt in die Mikrowelle stecke, bis er raucht. Die Hitze fühlt sich vulkanisch an, als ich den Lappen fest gegen meinen Körper presse, und ich versenge mir die Hände, während ich mich, noch immer nackt, über die Toilettenschüssel beuge. Die lose Haut um meine Taille fühlt sich unter meinen Armen so gummiartig und weich an wie eine Rettungsinsel, aus der die Luft entwichen ist.
Ich laufe mit nassem Haar zum Vierundzwanzig-Stunden-Drugstore, kaufe elastischen Verband und eine Milchpumpe, verschließbare Plastikbeutel und eine Ein-Liter-Flasche mexikanisches Bier. Es gibt nur eine Handpumpe, unangenehm und zeitaufwendig. Zurück in meinem Zimmer wirft der schwere, veraltete Fernseher schräge Schatten auf die kahle Wand. Ich pumpe zu einer spanischen Seifenoper mit ausgeschaltetem Ton, in dem Versuch, mich von dem schmerzenden Saugen abzulenken. Die Schauspielerinnen und Schauspieler machen übertriebene Gesten und Gesichtsausdrücke, gestehen einander irgendwelche Dinge, während ich zuerst die eine, dann die andere Brust bearbeite, den Behälter dabei zweimal fülle und die Milch in die Beutel gieße, die ich mit 21.09.93 beschrifte.
Eigentlich sollte ich alles im Klo hinunterspülen, aber ich kann mich nicht dazu überwinden. Stattdessen halte ich die Beutel für einen langen Augenblick hoch und lasse ihre Bedeutung auf mich wirken, ehe ich sie in das Gefrierfach des kleinen Kühlschranks lege und die Tür schließe. Ich denke nur ganz kurz an die Putzfrau, die sie dort finden wird, oder vielleicht auch irgendein straßenmüder Trucker, der auf der Suche nach Eis angewidert zurückschreckt. Die Milch erzählt eine ganze elende Geschichte, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein Fremder in der Lage wäre, deren Plot korrekt zu erraten. Mir fällt es ja selbst schwer, ihn zu verstehen, dabei bin ich darin die Hauptfigur. Ich schreibe diese Geschichte.
***
Kurz vor Morgengrauen wache ich fiebrig auf und schlucke zu viele Ibuprofen auf einmal, die mir mit einem brennenden Gefühl im Hals stecken bleiben. Am unteren Bildschirmrand des Fernsehers läuft ein Eilmeldungs-Banner entlang. SIEBENUNDVIERZIG BESTÄTIGTE TODESOPFER IN BIG BAYOU, ALABAMA. TÖDLICHSTER UNFALL IN DER GESCHICHTE DES AMTRAK. Irgendwann inmitten der Nacht ist ein Schlepper auf dem Mobile River im schweren Nebel vom Kurs abgekommen und hat einen Frachtkahn in die Big Bayou Canot Bridge gefahren, wodurch ein Gleis auf der Brücke um neunzig Zentimeter verschoben wurde. Acht Minuten später krachte der auf dem Weg von Los Angeles nach Miami pünktlich nach Zeitplan fahrende Amtrak-Zug Sunset Limited mit hundertfünfzehn Stundenkilometern gegen die entstandene Unebenheit, wodurch die ersten drei Wagen in den Fluss stürzten, die Brücke in der Mitte zusammenbrach und der Dieseltank aufgerissen wurde. Amtrak wirft dem Schiffsführer Fahrlässigkeit vor. Mehrere Besatzungsmitglieder werden vermisst, die Bergungsarbeiten dauern noch an. Präsident Clinton soll im Verlauf des Tages die Unfallstelle besuchen.
Ich schalte das Gerät aus und wünsche mir, der radiergummiartige rote Knopf auf der Fernbedienung könnte auch gleich alles andere ausschalten, innerlich wie äußerlich. Chaos und Verzweiflung und sinnlosen Tod. Züge, die auf Unebenheiten und Abgründe zurasen, während ihre Passagiere ahnungslos schlafen. Schiffsführer, die auf dem falschen Fluss unterwegs sind, genau im falschen Augenblick.
Acht Minuten, möchte ich schreien. Aber wer würde mich hören?
Zwei
Einmal ermittelte ich in einem Vermisstenfall, in dem es um einen Jungen ging, den wir später zerstückelt unter der Veranda seiner Großmutter in Noe Valley fanden. Als wir bei ihr vorfuhren, saß die Großmutter auf einer knarrenden, abblätternden Hollywoodschaukel direkt über seinem Leichnam. Danach bekam ich ihr Gesicht monatelang nicht mehr aus dem Kopf, die gepuderten Hautfalten um ihren Mund, der mattrosa Lippenstift, der etwas über ihre Oberlippe hinausgezogen war. Die Ruhe in ihren wässrig blauen Augen.
Ihr Enkel, Jeremiah Price, war vier Jahre alt gewesen. Sie hatte ihn zuerst vergiftet, damit er sich nicht an die Schmerzen erinnern würde. »Erinnern« war ihr Wort, das erste Wort in der Geschichte, die sie sich selbst erzählte über das, was sie tun zu müssen glaubte. Die Geschichte hatte jedoch keinen Kern, für niemanden außer ihr. Als sie ihr Geständnis ablegte, stellten wir ihr immer wieder dieselbe Frage: Warum haben Sie ihn umgebracht? Sie konnte uns darauf nie eine Antwort geben.
***
Auf dem billigen, verschrammten Nachttisch in meinem schwach beleuchteten Zimmer im Travelodge steht ein Wählscheibentelefon, daneben eine Anleitung für ausgehende Anrufe und die Gebühren für Ferngespräche. Brendan hebt beim zweiten Klingeln ab, die Stimme langsam und schwer, als dränge sie durch Beton. Ich habe ihn geweckt. »Wo bist du?«
»Santa Rosa. Ich bin nicht weit gekommen.«
»Du solltest etwas schlafen. Du klingst fürchterlich.«
»Ja.« Ich blicke hinunter auf meine nackten Beine auf der Tagesdecke, deren billiger Stoff sich an meinen Schenkeln so kratzig anfühlt wie ein Scheuerschwamm. Mein T-Shirt ist feucht und zerknittert und klebt mir verschwitzt im Nacken. Ich habe mir die Brüste mit mehreren Rollen Verband abgebunden, und trotz all der Ibuprofen durchzieht mich bei jedem Herzschlag ein stechender Schmerz, eine dilettantische Art von Ortung durch ein Echolot. »Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das hier ist furchtbar. Wieso bestrafst du mich?«
»Das will ich nicht, es ist nur …« Es folgt eine lange, schwere Pause, während er seine Worte mit Bedacht wählt. »Du musst ein paar Dinge für dich klären.«
»Wie soll ich das denn bitte schön tun?«
»Ich kann dir nicht helfen.« Er klingt ausgelaugt und bis zum Zerreißen gespannt. Ich kann ihn mir im Licht der Morgendämmerung auf der Kante unseres Bettes vorstellen, den Oberkörper über das Telefon gebeugt, eine Hand in seinem dichten, dunklen Haar. »Ich habe es versucht, und ich bin müde, verstehst du?«
»Lass mich einfach nach Hause kommen. Wir kriegen das wieder hin.«
»Wie denn?«, fragt er mit belegter Stimme. »Manche Dinge lassen sich nicht wieder hinkriegen, Anna. Nehmen wir uns einfach beide etwas Zeit. Es muss ja nicht für immer so bleiben.«
Irgendetwas in seinem Tonfall lässt mich jedoch aufhorchen. Als hätte er die Verbindung längst gekappt und traute sich nur noch nicht, es zuzugeben. Weil er nicht weiß, was ich sonst tun würde. »Über wie viel Zeit reden wir? Eine Woche oder einen Monat? Ein Jahr?«
»Ich weiß es nicht.« Sein Seufzen verhallt. »Ich muss über eine Menge Dinge nachdenken.«
Neben mir auf dem Bett sieht meine eigene Hand wächsern und steif aus, wie etwas, das zu einer Schaufensterpuppe in einem Einkaufszentrum gehört. Ich wende den Blick von ihr ab und fixiere einen Punkt an der Wand. »Weißt du noch, als wir gerade frisch verheiratet waren? Die Reise, die wir damals unternahmen?«
Er schweigt für eine Minute und antwortet dann: »Ich erinnere mich.«
»Wir haben in der Wüste unter diesem riesigen Kaktus geschlafen, in dem all die Vögel lebten. Du hast gemeint, es wäre ihr Wohngebäude.«
Eine weitere Pause. »Ja.« Er ist sich nicht sicher, wo das hier hinführt, ist sich nicht sicher, ob ich nicht vollkommen den Verstand verloren habe.
Ich bin mir ja nicht einmal selbst sicher. »Das war einer unserer besten Tage. Ich war damals wirklich glücklich.«
»Ja.« Durch das Telefon höre ich seinen Atem schneller gehen. »Allerdings habe ich diese Frau nun schon lange nicht mehr gesehen, Anna. Du bist nicht für uns da gewesen, und das weißt du auch.«
»Ich kann mich bessern. Lass es mich versuchen.«
Schweigen breitet sich durch den Hörer aus, sammelt sich um mich herum, während ich auf seine Antwort warte. Schließlich sagt er: »Ich vertraue dir nicht. Ich kann es nicht.« Die Klarheit in seiner Stimme ist niederschmetternd. Die Entschlossenheit. Er ist wochenlang so wütend gewesen, aber das hier ist noch schlimmer. Er hat eine Entscheidung getroffen, die ich nicht anfechten kann, da ich ihm jeden Grund gegeben habe, sich genau so zu fühlen. »Pass auf dich auf, okay?«
Ich spüre, wie ich vor einem dunklen Abgrund taumele. In früheren Augenblicken unserer Ehe hätte er mir ein Seil zugeworfen. »Brendan, bitte, ich kann nicht alles verlieren.«
»Es tut mir leid«, sagt er und legt auf, ehe ich noch ein Wort hinzufügen kann.
***
Nahezu zweihundert Menschen erschienen zu der Beerdigung, viele von ihnen in Uniform. Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde und auch wohlmeinende Fremde, die den Artikel im Chronicle gelesen hatten und sich dachten: Gott sei Dank hat es nicht uns erwischt.
Ich hatte mich in ein Kleid gezwängt, ohne es spüren zu können, war von dem Lorazepam so high, dass es auch aus Messern hätte bestehen können. Durch meine riesige schwarze Sonnenbrille las ich Lippen, während Brendan wieder und wieder Danke sagte. Zurück im Haus stellte ich mich in eine Ecke der Küche, abgewandt von den aggressiv platzierten Blumen und Kondolenzschreiben, von den ergriffenen Gesichtern rund um den Tisch voller Aufläufe und Käseplatten. Mein Vorgesetzter Frank Leary trat zu mir, in den Händen einen Teller mit Essen, das er nicht einmal vorgab zu wollen.
»Was kann ich sagen, Anna? Was kann irgendjemand über etwas so Schreckliches sagen?«
Normalerweise war sein Tonfall barsch und nicht so sanft. Ich wünschte, ich könnte ihn an Ort und Stelle einfrieren lassen, ihn und alle anderen, wie beim Stopptanz auf Kindergeburtstagen, und dann einfach verschwinden. Stattdessen nickte ich bloß. »Danke.«
»Du solltest dir so viel Trauerzeit nehmen, wie du brauchst. Mach dir keine Sorgen, okay?«
Die Wand schien näher zu rücken, während er sprach. »Eigentlich dachte ich, ich komme nächste Woche wieder. Ich muss mich auf irgendetwas anderes konzentrieren.«
»Anna, das meinst du doch nicht ernst. Es ist zu früh. Du solltest jetzt nur an deine Familie denken und dich um dich selbst kümmern.«
»Du verstehst mich nicht, Frank.« Ich spürte, wie sich meine Stimme um die Worte anspannte, und versuchte, langsamer zu sprechen, um weniger verzweifelt zu klingen. »Ich werde hier wahnsinnig, wenn ich nichts zu tun habe. Bitte!«
Er zog die Augenbrauen hoch und schien mich gerade korrigieren zu wollen, als mein Ehemann sich zu uns stellte. Frank straffte ein wenig die Schultern und streckte seine Hand aus. »Brendan. Harter Tag. Es tut mir so leid, Mann. Lass mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann.«
»Danke, Frank.« Brendans graue Strickkrawatte hing lose um den offenen Kragen seines Hemdes, aber nichts an seinem Körper wirkte auch nur annähernd entspannt, während er zwischen Frank und mir stand und von einem zum anderen blickte, als versuchte er, ein Gefühl in der Luft zu lesen. »Also, was ist hier los?«
»Nichts«, log ich rasch. »Wir können später darüber reden.«
»Ich habe dich gehört.« Er blinzelte hektisch, und sein Gesicht lief pink an. »Du kannst doch nicht ernsthaft jetzt schon wieder arbeiten wollen.«
»Hör zu«, sagte Frank und trat einen Schritt vor, »ich habe gerade genau das Gleiche gesagt. Ich bin auf deiner Seite.«
»Wer ist auf meiner Seite?« Die Wand hinter mir drückte glatt und kühl gegen meine Handfläche, dennoch fühlte ich mich plötzlich eingesperrt. Gefangen. »Ich versuche nur, das hier irgendwie durchzustehen, okay? Wenn ich mich nicht ablenken kann –« Ich brachte den Satz nicht zu Ende.
»Das glaube ich einfach nicht!« Brendan presste die Lippen aufeinander. »Was ist mit uns? Wie wäre es damit, dich einmal auf deine Familie zu konzentrieren? Steht uns das etwa nicht zu? Ganz besonders nach dem, was passiert ist?«
Es war, als hätte er mich geschlagen. Mein Körper versteifte sich. »So meine ich das nicht.« Ich konnte hören, wie hölzern meine Antwort klang, wie defensiv.
»O doch.«
Frank und ich sahen zu, wie er auf dem Absatz kehrtmachte und sich dann mit gesenktem Kopf durch das Zimmer voller Menschen drängte.
»Du solltest ihm hinterhergehen. Er trauert nun einmal. Die Menschen sagen alle möglichen Dinge, wenn sie leiden.«
»Die Menschen, Frank? Was ist mit meinem Leid?« Aus meiner Brust schien alle Luft gewichen zu sein, sie fühlte sich an wie versiegelt. »Du gibst mir auch die Schuld, nicht wahr? Sag es doch einfach.«
Drei
Als ich in Santa Rosa aufbreche, ist die Luft so warm wie Badewasser, und die Sonne glitzert aufreizend. Sogar der verwahrloste Parkplatz des Motels ist ein Garten aus einem halben Dutzend Seidenbäumen mit fedrigen fuchsiafarbenen Dragqueen-Blüten. Überall sind Vögel – auf den Zweigen, im wolkenlosen Himmel, in dem verfallenen neonroten Drive-Through-Kiosk von Jack in the Box, von wo aus mich drei flaumige Küken aus einem mit Strohhalmverpackungen durchzogenen Nest anstarren, die Hälse so pink und so weit aufgerissen, dass allein schon der Anblick wehtut.
Ich bestelle einen großen Kaffee und ein Eiersandwich, das ich nicht essen kann, ehe ich auf die Route 116 abbiege, die mich durch das Russian River Valley bis zur Küste führen wird. Der Ort dort heißt Jenner, mehr Postkarte als tatsächliches Dorf. Weit unterhalb sieht der Goat Rock vor dem atemberaubenden Blau des Pazifiks aus wie der plumpe Spielzeugball eines Riesen, jene Art von Zaubertrick, die Nordkalifornien im Schlaf zu beherrschen scheint.
In fünfunddreißig Jahren habe ich nie den Bundesstaat verlassen oder irgendwo südlicher als Oakland gelebt, dennoch haut mich die Schönheit noch immer um. Dumme, mühelose, lächerliche Schönheit, die einfach kein Ende nimmt – die Achterbahn des Pacific Coast Highway, das Meer wie ein wilder Farbwirbel.
Ich fahre rechts ran und parke auf einem kleinen Oval aus Schotter, überquere beide Fahrspuren, um mich auf einen kahlen Flecken Erde über verheddertem Unterholz und schwarzen gezackten Felsen zu stellen. Ein Abgrund gähnt unter mir – schwindelerregend. Der Wind stürzt sich auf mich und gräbt sich unter all meine Kleidungsschichten, so dass ich mich zitternd mit den Armen umschlingen muss. Dann ist mein Gesicht plötzlich nass, zum ersten Mal seit Wochen kommen mir die Tränen. Nicht über das, was ich getan oder nicht getan habe. Nicht über das, was ich verloren habe und nie wieder zurückbekommen werde, sondern, weil mir klar wird, dass es nur einen Ort gibt, an den ich von hier aus gehen kann, nur eine Straße auf der Karte, die mir jetzt noch etwas bedeutet. Der Weg zurück nach Hause.
Siebzehn Jahre lang bin ich Mendocino ferngeblieben, habe den Ort in meinem Inneren weggeschlossen als etwas, das zu kostbar ist, um es auch nur zu betrachten. In diesem Augenblick auf der Klippe erscheint es mir jedoch wie das Einzige, das mich noch am Leben hält, das Einzige, was jemals mir gehört hat.
Denkt man einmal darüber nach, haben die meisten von uns kaum eine Wahl, wenn es darum geht, was wir werden oder wen wir lieben oder welcher Ort auf der Erde uns auserwählt hat und zu unserem Zuhause wird.
Wir können uns lediglich auf den Weg machen, wenn dieser Ort uns ruft, und hoffen, dass wir dort noch immer hereingelassen werden.
***
Bis ich ein paar Stunden später Albion erreiche, hat der Küstennebel die Sonne verdeckt. Er wirbelt vor meinen tiefen Scheinwerfern, lässt alles vor mir verschwinden und wieder auftauchen: die sich windende Küstenstraße und die Tannen und dann endlich das Dorf, das wie ein Ort aus einer düsteren Sage erscheint – viktorianische Häuser schweben weiß über der Landspitze; der alles umgebende Dunst zittert und löst sich auf.
Mich überkommt ein beklemmendes Gefühl, während jede gewundene Kurve mich der Vergangenheit näherbringt. Die Umrisse der Bäume scheinen nachzuhallen. Ebenso die Straßenschilder und die lange feuchte Brücke. Ich bin schon beinahe auf Höhe der Ampel, ehe ich sie wahrnehme, und muss Gas geben, um noch bei Gelb auf die Little Lake Road abzubiegen. Dann habe ich das Steilufer erreicht.
Als ich links auf die Lansing Street abbiege, habe ich das Gefühl, seitlich durch die Zeit geschoben zu werden. Auf dem Dach der Masonic Hall zeichnet sich vor dem durchscheinenden Himmel die Holzstatue von Zeit und die Jungfrau scharf und weiß ab, das bekannteste Wahrzeichen des Ortes. Eine bärtige ältere Figur mit Flügeln und einer Sense, die das Haar eines vor ihr stehenden Mädchens flicht. Deren Kopf ist über ein auf einer abgebrochenen Säule liegendes Buch gebeugt, in einer Hand hält sie einen Akazienzweig, in der anderen eine Urne, und vor ihren Füßen steht ein Stundenglas – jedes der Objekte ein mysteriöses Symbol in einem größeren Rätsel. Die gesamte Schnitzerei wie ein für alle sichtbares Geheimnis.
Als ich zehn war, kurz nach meinem Umzug nach Mendocino, fragte ich Hap einmal, was die Figuren zu bedeuten hätten. Er lächelte und erzählte mir stattdessen ihre Geschichte. Wie ein junger Mühlenarbeiter und Zimmermann namens Erick Albertson sie Mitte des 19. Jahrhunderts nachts in seiner Hütte am Strand aus einem einzigen Stück Mammutbaum geschnitzt hatte. Während dieser Zeit wurde er zum ersten Meister von Mendocinos Freimaurerorden ernannt, aber er hörte nie auf, an seinem Meisterstück zu arbeiten. Insgesamt benötigte er sieben Jahre dafür, und dann, kurz nachdem die Schnitzerei 1866 aufgestellt wurde, starb er bei einem seltsamen Unfall, den die Geschichtsbücher nicht ausreichend erklären konnten.
Hap war bereits seit Jahrzehnten Mitglied des Freimaurerordens, sogar noch länger, als er Förster war. Ich nahm an, er würde alles wissen, alles, was es zu wissen gab. Aber als ich ihn fragte, wie Albertsons Tod mit den Figuren und deren Bedeutung verknüpft war, sah er mich von der Seite an.
»Albertsons Tod hat nichts mit dir zu tun. Außerdem ist das vor so langer Zeit geschehen. Die Symbole ergäben keinen Sinn, selbst wenn ich sie dir erklären würde. Sie erzählen eine Geschichte, die nur die Freimaurer kennen, die sie jedoch niemals niedergeschrieben haben, sondern nur mündlich weitergeben, wenn sie ihren dritten Grad erreichen.«
Ich wurde noch neugieriger: »Was ist der dritte Grad?«
»Bis dorthin gehst du mir gerade auf die Nerven«, sagte er scherzhaft und ließ mich stehen.
***
Ich parke und setze eine Baseballkappe und eine Sonnenbrille auf, ehe ich hinaus auf die kühle, nebelfeuchte Straße trete. Es ist zwar schwer vorstellbar, dass mich irgendjemand im Dorf als erwachsene Frau wiedererkennen sollte, allerdings werden die Zeitungen aus San Francisco hier oben viel gelesen, und meine Fälle haben mich ab und an in den Chronicle gebracht. Der Unfall im Übrigen auch.
In Mendosa’s Market versuche ich mit gesenktem Kopf, nur das Nötigste einzukaufen, Dosengemüse und Trockenwaren, Sachen, die sich leicht zubereiten lassen. Ein Teil von mir fühlt sich jedoch gefangen in der sich drehenden Rolle eines alten Films. Ich bin gerade erst hier gewesen, so scheint es, genau hier neben dem beleuchteten Kühlregal voller Milch, als Hap nach einer kalten Flasche griff und sie aufmachte, direkt daraus trank und mir zuzwinkerte, ehe er sie mir reichte. Dann schob er den Wagen weiter, lenkte ihn mit den Ellbogen und beugte sich dabei über den Korb. Trödelte, als hätten wir alle Zeit der Welt.
Aber die hat niemand.
Als ich meinen Einkauf beendet habe, zahle ich bar und lade die Taschen in den Kofferraum meines Broncos, dann mache ich mich die Straße hinunter auf den Weg zum Good Life Café. Als ich noch hier lebte, trug es irgendeinen anderen Namen, ich kann mich jedoch nicht mehr an ihn erinnern, und er tut auch nichts zur Sache. Der Klang, die Form und der Geruch des Cafés stimmen exakt mit meiner Erinnerung überein. Ich bestelle Kaffee und eine Schüssel Suppe und setze mich ans Fenster mit Blick auf die Straße, beruhigt durch die Geräusche um mich herum, das Klappern der Teller im Spülbecken, die frischen Bohnen in der Kaffeemühle, das freundliche Geplauder. Dann höre ich hinter mir zwei Männer streiten.
»Du glaubst diesen ganzen Scheiß doch nicht etwa, oder?«, blafft der eine den anderen an. »Hellseherin und was noch alles? Du weißt doch, wie viel Geld die Familie hat. Sie will einfach was davon abbekommen. Verdammt, ich kann’s ihr nicht mal verübeln.«
»Aber wenn sie nun wirklich etwas weiß, und niemand geht dem nach?«, erwidert der andere scharf. »Das Mädchen könnte gerade irgendwo verbluten.«
»Wahrscheinlich ist sie längst tot.«
»Was hast du für ein Problem? Sie ist ein Mensch. Ein Kind.«
»Das Kind von jemand Berühmtem.«
»Das hat doch nichts damit zu tun. Was ist, wenn die Hellseherin die Wahrheit sagt? Hast du noch nie etwas gesehen oder gehört, für das du keine Erklärung hattest?«
»Nee. Kann ich nicht behaupten.«
»Dann passt du nicht richtig auf.«
***
Die beiden Männer zu belauschen löst bei mir ein schwereloses, haltloses Gefühl aus. Ich bezahle für meinen Kaffee und meine Suppe, gebe acht, nicht in ihre Richtung zu blicken, und gehe hinüber zum Schwarzen Brett an der entgegengesetzten Wand. Es war immer ein fester Bestandteil von Haps und meiner Morgenroutine. Er lehnte sich nach hinten statt nach vorn, um die Pinnwand zu überfliegen, in der Hand einen schweren weißen Becher, der Blick umherschweifend auf der Suche nach etwas, das ihm noch nicht entgegengesprungen war.
»Was denkst du, wie viel du über einen Ort dieser Größe wissen kannst?«, fragte er mich einmal, ziemlich zu Beginn. Ich hatte bislang immer in größeren, schmuddeligeren Städten in ganz Mendocino County gelebt. Im Vergleich zu ihnen wirkte das Dorf mit seinen nur fünfzehn Straßen, die sogar Namen trugen, wie aus dem Ei gepellt. In meiner Vorstellung war es ein Puppenhaus, das man wie einen Koffer aufklappen und hineinsehen konnte, Zimmer für Zimmer. »Alles.«
»Menschen, die du jeden Tag siehst? Häuser, an denen du tausend Mal vorbeikommst, ohne einen Gedanken an sie zu verschwenden?«
»Wahrscheinlich.«
»Denk nach, Anna. Wodurch entsteht ein toter Winkel?«
Er meinte beim Autofahren. »Wenn jemand direkt hinter deiner Schulter ist, zu nah, um ihn zu sehen.«
»Das gilt auch allgemein für Menschen. Alle, die direkt vor deiner Nase sind, verschwinden. Das ist die Gefahrenzone, in deiner unmittelbaren Nähe. Wer auch immer die Person ist, der du am meisten vertraust.«
Ich hörte ihm zu, hörte gut zu. Solange ich denken konnte, hatten die Leute mir erzählt, ich solle ihnen vertrauen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen und vollkommen Fremde, sie alle sagten in irgendeiner Form das Gleiche: dass ich weniger auf der Hut sein und mich öffnen solle. Die Welt aber hatte mir das Gegenteil vermittelt, und nun tat es auch Hap. »Was ist also das Geheimnis?«
»Es gibt kein Geheimnis, behalte nur die Augen offen. Behalte sie immer offen, aber ganz besonders, wenn du glaubst, du könntest nicht überrascht werden. So lernst du, aufmerksam zu sein und auf deine eigene Stimme zu hören.«
»Was ist mit anderen Menschen?«
»Entweder verdienen sie sich dein Vertrauen oder nicht.«
Damit meinte er auch sich selbst und seine Frau Eden. Ein anderes zehnjähriges Mädchen mit anderen Erfahrungen hätte es vielleicht nervös gemacht, so etwas zu hören, aber ich war erleichtert. Er vertraute mir noch nicht, und ich vertraute ihm nicht. Endlich einmal jemand, der nicht so tat, als wäre irgendetwas hiervon einfach. Endlich einmal jemand, der sich entschieden hatte, die Wahrheit zu sagen.
***
Der Name des Cafés mag sich geändert haben, das Schwarze Brett jedoch nicht. Ich durchkämme langsam die Botschaften, leuchtende Zettel aus buntem Papier, auf denen Gitarrenstunden, Handlesen und Gartenerde angeboten werden. Jemand sucht nach einem Künstlermodell. Jemand anderes ist auf der Suche nach kostenlosem Feuerholz. Ich nehme mir Zeit, die Mitteilungen einzeln zu lesen, bis ich bei dem vermissten Mädchen angelangt bin, bei ihrem verschwundenen lieblichen Gesicht unter den Worten: WER HAT MICH GESEHEN?
Cameron Curtis
Alter: 15
Zuletzt gesehen am: 21.09.
Rotes Flanellhemd, schwarze Jeans
1,63 m, 48 Kilo
Langes schwarzes Haar, dunkelbraune Augen
Hinweise: 724–555–9641
Hohe Belohnung
Der 21. September war gestern, jener Tag, an dem Brendan schließlich die Nase voll hatte und mich aufforderte zu gehen. Das Timing bringt mich ins Wanken, während ich einen weiteren Blick auf das Mädchen werfe, ihre düsteren, ernsten Augen, ihr Haar, das sich bis zu ihrer Taille ergießt. Alles an ihr ist zu schön, um irgendwo lange in Sicherheit zu sein. Irgendetwas in der Krümmung ihres Mundes sagt mir, dass ihr bereits fürchterlich falsche Dinge zugestoßen waren, noch bevor sie verschwand. Ich habe schon zu viele von ihrer Sorte gesehen, um etwas anderes zu glauben. Aber das hier ist nicht San Francisco, wo Flyer mit verschwundenen Teenagern an jeden Fahrkartenautomaten geklebt werden, ein so üblicher Anblick, dass man irgendwann durch sie hindurchsieht. In einem kleinen Ort wie Mendocino ist jeder Gewaltakt persönlich. Alle hier werden es spüren. Alle werden davon betroffen sein.
Ich starre das Mädchen noch einen Augenblick länger an, dann greife ich nach der Nummer eines Cottage, das zu vermieten ist, direkt unter der Vermisstenmeldung. Das Haus liegt sieben Meilen außerhalb der Stadt und kostet vierhundert Dollar im Monat. Ich rufe den Besitzer Kirk an, der mir erklärt, es gebe dort keinen Fernsehempfang, keinen Telefonanschluss und keine Zentralheizung.
»Man könnte sagen, es ist bis aufs Nötigste reduziert«, fügt er hinzu. »Aber ein netter Rückzugsort, wenn man es gern ruhig mag.«
»Das tue ich.«
Vier
Als ich Mendocino zum ersten Mal sah, wirkte es auf mich nicht wie ein echter Ort. Die sauberen Straßen waren gesäumt von Lebkuchenhäusern, die meisten von ihnen weiß gestrichen, mit aufwendigen Zierleisten und Palisadenzäunen. Das ganze Dorf erstreckte sich über die raue halbrunde Steilküste über dem Pazifik, klein genug, um es mit einem Blick zu erfassen. Es gab ein Lebensmittelgeschäft, eine Handvoll hübsche Lädchen, zwei Friedhöfe und eine Grundschule.
»Was ist das?«, fragte ich Hap und wies auf einen viereckigen Holzturm, der an einem der benachbarten Häuser befestigt war. Meine Sozialarbeiterin Mrs. Stephens hatte sich gerade verabschiedet, und wir standen in Haps und Edens Vorgarten in der Covelo Street.
»Das sind Tanks«, antwortete Eden. »Wassertürme.« Ihr Körper war sanft und rund und roch nach Puder, während Hap groß und kräftig gebaut war, mit breiten Schultern und einem gezwirbelten Schnurrbart. Wenn er wie ein Cowboy aussah, dann wirkte sie wie eine Großmutter, obwohl sie gar keine war. Die beiden hatten schon häufig Kinder in Pflege genommen, jedoch nie eigene bekommen.
Ihr Haus war wunderschön, ein großes viktorianisches Gebäude, das für mich wie ein Schiff aussah. Das obere Stockwerk war breiter als das Erdgeschoss und hatte gerundete Vorderfenster mit Blick auf die Landzunge, eine wilde Fläche voller goldener Gräser und vom Wind verdrehter Zypressen. Während wir dort draußen beisammenstanden und uns und dieses neue Arrangement beschnupperten, ging die Sonne über ihrem Garten unter.
Ich war gerade erst aus Fort Bragg gekommen, aus einem kleinen, traurigen Schuhkarton von einem Haus neben dem Militärstützpunkt. Auch von dort aus hatte man das Meer sehen können, aber nicht so wie hier. Nichts, was ich je gesehen hatte, war hiermit vergleichbar. Die Sonne glitt in den Pazifik, als würde sie langsam schmelzen, eine Kugel aus sich ausdehnendem orange-pinkfarbenem Toffee, das aus der Mitte heraus zu pulsieren schien wie ein klopfendes Herz. Ich konnte den Blick nicht davon abwenden.
Dann, gerade als die Sonne komplett verschwand, blitzte es plötzlich grün auf.
»Das bringt Glück«, sagte Eden.
Ich hatte aufgehört, an Glück zu glauben, aber irgendetwas geschah in diesem Augenblick tatsächlich. Mendocino hatte bereits begonnen, mich an sich zu ziehen, wie durch Schwerkraft.
***
Kirks Wegbeschreibung folgend fahre ich über die Little Lake Road aus dem Dorf. Nach fünf Meilen verwandelt sich die Straße von Asphalt in Sand und Schotter. Tannen, Kiefern und Fichten scheinen sich um mich zu verdichten, drängen aus allen Richtungen herbei. Märchenbäume mit schwarzen Spitzen, die aus dem Nichts Schatten stricken und den Tag in Nacht verwandeln – als hätten sie alles Licht gestohlen und hielten es nun irgendwo versteckt. Gott, wie sehr ich sie vermisst habe!
Nach weiteren zwei Meilen biege ich scharf nach links auf einen Weg ab, der mit einer roten Flagge und einem maroden Holzschild gekennzeichnet ist, auf dem steht: KEIN ZUTRITT. Der Waldweg wird immer schmaler, während er sich ein paar hundert Meter einen steilen Hügel hinunterwindet. Dann sehe ich die Auffahrt und die Umrisse des Zedernholz-Cottage, die zwischen einer dicht stehenden Gruppe hochgewachsener Kiefern aufblitzen. Es sieht aus wie der Wohnort eines Eremiten, wie eine Insel in den Bäumen, eine Höhle, in der man verschwinden kann. Es ist perfekt.
***
Kirk wartet auf der Veranda auf mich. Er wirkt wie Mitte sechzig, hat steife Schultern und militärisch kurz geschorene graue Haarstoppel. Sein Gesicht ist kantig, und sein Blick wirkt abweisend, selbst als er lächelt und mir mit dem Schlüssel in der Hand kurz zuwinkt. »War schwer zu finden?«
»Nicht besonders.« Die Veranda sieht ordentlich aus, auf einer Seite liegt Klafterholz bis zum Fensterbrett gestapelt. »Ist das eine Hütte für Fallensteller gewesen?«
»Irgendwann mal, wahrscheinlich. Gehörte der Familie meiner Frau. Jetzt vermiete ich sie, wenn ich kann.« Ich spüre, wie er mich mustert, sich fragt, was wohl meine Geschichte sein mag. »Die meisten Leute wollen mehr, einen Ort für ein romantisches Wochenende. Solche Sachen.«
Ich nicke nur und stapfe nach ihm hinein. Der Hauptraum ist düster, mit dunklem Holz verkleidet, und riecht nach Mäusen, ein leicht süßlicher und fauliger Geruch. In einer Ecke steht ein runder Holzofen, vom Gebrauch geschwärzt. Rosenfarbene Vorhänge umrahmen die Fenster der winzigen Küche, in der eine winzige Spüle steht, daneben ein Kühlschrank, der besser in ein Studentenwohnheimzimmer passen würde. An einem Metallhaken hängt ein einzelnes verschlissenes Handtuch.
»Wie Sie sehen, haben Sie hier alles, was Sie brauchen«, sagt Kirk.
Wenn er nur wüsste, wie wenig ich tatsächlich brauche. Wie viel.
Vom Wohnzimmer geht ein schwach beleuchtetes Badezimmer ab, in dem sich eine winzige Dusche mit einer billigen Milchglastür befindet. Das einzige Schlafzimmer scheint ein Anbau zu sein. Beim Eintreten gibt die Türschwelle nach wie ein Schwamm, aber das Zimmer selbst fühlt sich stabil genug an. Darin stehen ein Doppelbett mit Metallrahmen und ein einfacher Schreibtisch plus Lampe. Ein Panoramafenster auf der Südseite blickt hinaus in den dichten Wald, der sich vor dem schwindenden Licht scharf abzeichnet. Das Abendlicht, nannte Eden diese Zeit des Tages, was seltsam war, da es doch eigentlich um die Dunkelheit ging.
»Nachts kann es ziemlich kalt werden«, erklärt Kirk. »Wenn Sie hier sind, würde ich ein Feuer brennen lassen. Sie können so viel Holz benutzen, wie Sie wollen, solange Sie neues hacken. Dieses Heizgerät benötigt Propan.« Er zeigt achselzuckend auf das Gerät an der Wand. »Was Sie verbrauchen, füllen Sie in der Stadt nach.«
»In Ordnung«, versichere ich ihm, um nur endlich allein zu sein.
Aber es kommt noch mehr. Die Wasserhähne der Dusche seien kompliziert, der heiße und der kalte seien nämlich vertauscht. Dem Ofenrohr müsse man ab und an gut zureden. Kirk zeigt mir auch, wie ich den Generator verwende, wenn der Strom ausfällt, was manchmal passiere, wie er mich warnt.
»Die Holzarbeiter durchtrennen die Leitungen. Ich glaube, die sind öfter betrunken als nüchtern. So wie die über die Straßen hier brettern, würde ich mich vor denen in Acht nehmen. Und schließen Sie auch nachts alles ab. Eine Frau ganz allein, ich meine …« Seine Stimme wird leiser und verstummt, als hätte er gerade selbst registriert, wie er eine unsichtbare Grenze zum Bereich des Persönlichen überschritten hat.
»Ich komme schon zurecht.« Ärger hat sich in meinen Tonfall gemischt.
Kirk hustet verlegen. »Klar werden Sie das.«
***
Nachdem er endlich gegangen ist, tickt die Hütte vor Stille. Ich packe meine paar Sachen aus und trete dann hinaus auf die Veranda, in die kühle Abenddämmerung mit ihrem lilafarbenen Licht. Die Lücken zwischen den Bäumen haben sich zusammengezogen. Ich atme die Stille ein und erlaube mir für einen gefährlichen Augenblick, an das Leben zu denken, das ich gerade so schwungvoll hinter mir gelassen habe, allerdings nicht freiwillig, an Brendan und unsere chaotische Küche, mit überall verstreuten Spielsachen und in der Spüle ausgekippter Babywanne. Unsere Namen Seite an Seite auf dem Briefkasten, wie ein Talisman, der seinen Zweck nicht erfüllt hat. Wir hatten sieben gemeinsame Jahre – nicht annähernd genug –, aber er hatte recht, als er sagte, ich sei nicht für ihn da gewesen. Ich war es nicht.
Ich halte in den zerklüfteten Lücken zwischen den Baumwipfeln über mir Ausschau nach dem Mond, kann ihn jedoch nicht finden. Eine Eule sendet in der Ferne in einem zitternden Rhythmus ihre Rufe aus. Noch weiter entfernt beginnt ein Hund zu jaulen, es klingt wie ein Klagelaut. Oder ist das ein Kojote? Die Temperatur ist gefallen. Ich schaudere in Flanellhemd und Jacke und frage mich, wie kalt es wohl bis zum Morgen werden wird und ob das verschwundene Mädchen eine Decke oder ein Feuer hat, wo auch immer sie sein mag.
Das Mädchen.
Ich habe keine Ahnung, wo der Gedanke herkam, aber ich versuche, ihn sogleich beiseitezuschieben. Hinter mir raucht noch immer meine gesamte Welt wegen Mädchen wie Cameron Curtis. Die Vermissten und die Verletzten, ihre Geschichten locken mich an wie schrille leise Sirenengesänge. In den letzten paar Jahren habe ich für Project Searchlight gearbeitet, eine Initiative in der Bay Area, die sich auf Sexualverbrechen und Verbrechen an Kindern konzentriert, die von Fremden gekidnappt und ermordet oder von ihren eigenen Familienmitgliedern entführt und eingesperrt oder von Zuhältern ins Visier genommen und verkauft werden.
Es ist der härteste Job, den ich je hatte, aber auch der wichtigste, selbst wenn Brendan mir niemals vergeben kann. Außerdem bin ich gut darin. Im Laufe der Zeit habe ich eine Art Radar für Opfer entwickelt, und Cameron Curtis ist mir zutiefst vertraut, fast so, als würden ihre Geschichte und ihre Verletzlichkeit in Neonbuchstaben über ihrem Kopf aufblinken. Und nicht nur für mich. Wie auch immer die Buchstaben dort hingelangt sind, ich weiß, dass auch Gewalttäter sie sehen können, grell leuchtend und unmissverständlich.
Ich denke an die Familie des Mädchens, die vor Angst und Sorge den Verstand verliert. Ich denke daran, wie einsam und verloren Cameron sich womöglich schon seit Jahren gefühlt hat, wie verzweifelt gar – abgekoppelt von allen anderen. Dass Traurigkeit und Scham mehr sind als Gefühle: Sie sind eine Krankheit, ein schrecklicher Krebs, der um die Welt geht und auf verborgene, zyklische und vielleicht niemals endende Weise Leben raubt.
Als das Jaulen erneut ertönt, zucke ich zusammen. Es ist definitiv ein Kojote. Mehr als alle anderen Tiere in diesen Wäldern klingen sie beinahe menschlich – frierend, einsam und hungrig. Ängstlich gar. Unaufhörlich heulend.
Fünf
In dieser Nacht schwebe ich körperlos über einem halbmondförmigen weißen Strand, während irgendjemand stolpernd durch verworrenen Seetang und Schatten rennt. Aber sie kann nirgendwo hin. Natürlich ist es ein Mädchen. Sie rutscht aus und fällt auf die Knie, steht auf und fällt wieder hin, kriecht auf den Händen rückwärts, schreit und schüttelt sich. Und dann wird sie plötzlich ruhig. Wird so ruhig wie ein Tier, das weiß, dass die Verfolgungsjagd nun beendet ist.
Ich wache erschrocken auf, mein Herz donnert, und meine Haut ist klebrig vom Schweiß. Ich muss wieder Fieber bekommen haben, denke ich, und werfe die kratzigen Decken von mir. Unter meinem dicken Pullover sind meine Brüste noch immer verbunden, aber die Schwellung hat kein bisschen abgenommen. Der Schmerz ist dumpf, jedoch konstant, ein pochender Ankerpunkt.
Die Dunkelheit um mich herum ist eiskalt und scheint zusammenzufließen. Ich habe vergessen, wie es sich anfühlt, im Wald zu übernachten, vollkommen isoliert, ohne Straßenlärm, Nachbarn oder Licht. Ich schlüpfe in ein zweites Paar Socken und trete hinaus in das Hauptzimmer, wo mir die blinkende Mikrowelle mitteilt, dass es noch nicht einmal vier Uhr morgens ist. Ich habe vielleicht fünf Stunden geschlafen. Oder bewusstlos verbracht, das trifft es wohl eher.
Ich nehme ein paar Ibuprofen und noch eine Schlaftablette, die ich mit Whiskey hinunterspüle, in der Hoffnung, den Albtraum so aus dem Kopf zu bekommen. Ich kann nur annehmen, dass das Mädchen Cameron Curtis war und mein Unterbewusstsein eine Version ihres Verschwindens fabriziert hat, gefangen in jenem Drama, das mich schon immer beschäftigt hat, bereits lange bevor ich Polizistin wurde. Als würden Hilferufe, die unendlich in der Atmosphäre widerhallen, lauter werden und haften bleiben, sobald sie meinen Weg kreuzen. Als würden sie irgendwie zu mir gehören, und ich hätte dabei nichts zu sagen, hätte keine andere Wahl, als zu versuchen, ihnen zu antworten.
***
Das Erste, was ich am nächsten Morgen nach dem Aufwachen sehe, sind die halb leere Schnapsflasche neben dem Sofa auf dem Fußboden und meine zusammengeknüllten Socken auf dem Couchtisch. Wenn Hap hier wäre, wäre er besorgt, mich so viel trinken zu sehen. Er wäre außerdem längst angezogen, hätte sich das Gesicht gewaschen und Kaffee aufgesetzt. Er liebte die Morgen genauso wie die späten Abende. Manchmal fragte ich mich, ob er überhaupt jemals schlief, aber es war tröstlich, zu wissen, dass er jederzeit da war, wenn ich ihn brauchte, wach und bereit. Ich wünschte, das wäre noch immer so.
Ich ziehe mehrere Schichten übereinander und spüre den obersten Knopf meiner Jeans in das weiche Fleisch um meine Taille sinken, während meine Fingerspitzen die gekräuselte Haut streifen, die sich wie eine frische Narbe anfühlt. Ich binde mir das Haar zurück, ohne in den Spiegel zu schauen, dann fülle ich meine Thermoskanne mit Kaffee, ehe ich die Tür zur Hütte hinter mir verriegele und mich auf den Weg in Richtung Dorf mache.
Als ich die Küstenstraße erreiche, biege ich jedoch nördlich in Richtung Caspar und Jug Handle Creek ab, einer von Haps Lieblingsorten für Tageswanderungen. Als ich elf war, schlossen Hap und viele der Ranger, mit denen er zusammenarbeitete, sich den örtlichen Aktivistinnen und Aktivisten an, um die Steilküsten vor der Abholzung und Umwandlung in Bauland zu schützen – und sie hatten Erfolg. Ein Erbe, auf das die gesamte Gegend stolz ist. Hap war erst zwanzig gewesen, als er begann, für die US-Forstverwaltung zu arbeiten, wo er kurz, nachdem ich zu ihnen gezogen war, zum Revierförster befördert wurde, der mehr als ein Dutzend Ranger und zwanzigtausend Hektar bundeseigenes Land beaufsichtigte.
Seine Aufgabe war groß und manchmal gefährlich. In seinen Geschichten wimmelte es nur so von Jagdunfällen und Wanderern in Not, von Teenagern, die blau und leblos aus versteckten Gruben gezogen wurden. Er wusste, was ein aggressiver Schwarzbär einem Menschen antun konnte und was Menschen sich gegenseitig antun konnten, draußen in dieser Grenzenlosigkeit.
In den acht Jahren, in denen ich bei den Straters in Mendocino lebte, wurde ich zu Haps Schülerin und Helferin, zu seinem Schatten. Zuerst verstand ich nicht, weshalb er so viel Zeit mit mir verbringen wollte oder warum er und Eden mich überhaupt aufgenommen hatten. Ich war bereits durch ein halbes Dutzend Häuser gereicht worden, ohne irgendwo Fuß zu fassen. Wieso sollte es diesmal anders sein? Ich brauchte Zeit und mehrere Anläufe, bis ich glaubte, dass Hap und Eden tatsächlich so waren, wie sie nach außen wirkten: einfach anständige Leute, die freundlich sein wollten, weil sie es konnten. Ich stellte sie auf die Probe und reizte sie, versuchte, sie dazu zu bringen, mich wegzuschicken wie alle anderen. Einmal rannte ich davon und schlief im Wald, um zu schauen, ob Hap mich suchen kommen würde. Als er es tat, dachte ich, er wäre wütend und hätte nun die Nase voll von meinem Unsinn, aber so war es nicht. Er blickte mich bloß an, wie ich feucht und schmutzig vor ihm saß, zitternd von meiner auf dem Waldboden verbrachten Nacht.
Während er mit mir zu seinem Geländewagen zurücklief, sagte er: »Wenn du allein hier draußen bleiben willst, müssen wir dir ein paar Dinge beibringen, damit du auch für dich selbst sorgen kannst.«
»Ich kann schon lange für mich selbst sorgen«, erwiderte ich, automatisch abwehrend.
»Das Leben ist für dich bislang schwer gewesen. Das weiß ich. Du musstest hart sein, um es durchzustehen, aber Härte ist nicht dasselbe wie Stärke, Anna.«
Es war, als hätte er das Licht einer Lampe direkt in meine Augen gerichtet, in eine Spalte meines Herzens, die ich besser versteckt zu haben glaubte. »Wie meinst du das?«
Wir hatten den Wagen erreicht und stiegen ein. Er richtete sich hinter dem Lenkrad ein und schien es nicht eilig zu haben, meine Frage zu beantworten. Endlich wandte er sich zu mir um und sagte: »Linda hat uns erzählt, was mit deiner Mom passiert ist, Liebes.«
Linda war Mrs. Stephens, meine Sozialarbeiterin. Nun konnte ich nur noch so tun, als wäre mir egal, was er wusste oder nicht wusste, was er von mir dachte oder nicht dachte. »Und?«
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für ein Kind in deinem Alter gewesen sein muss. Ehrlich. Es bricht mir das Herz.«
Alle Gedanken in meinem Kopf lösten sich mit einem Knall in Luft auf. Ich rutschte automatisch in Richtung Türgriff.
Hap bemerkte es und wurde ganz still. Nur seine Augen schienen sich zu bewegen, und sie sahen alles. »Ich werde dich nicht aufhalten, wenn du weglaufen willst, aber falls du uns eine Chance geben und bleiben könntest, kann ich dir Dinge beibringen, die dir später vielleicht helfen werden. Dinge, die mir geholfen haben. Über das Leben im Wald.«
Ich hielt den Blick starr auf die Windschutzscheibe gerichtet, auf die Staubschicht über dem Rand der Scheibenwischer, und zuckte mit den Achseln, um ihm zu signalisieren, dass er nicht meine volle Aufmerksamkeit hatte.
»Die Natur verlangt unseren Respekt, Anna. Sie hat ganz sicher eine brutale Seite, aber wenn du ihre Sprache lernst, kannst du in ihr auch Frieden und Trost finden. Die beste Art von Medizin, die ich kenne.«
»Mir geht es gut, so wie ich bin.« Ich blickte ihn an, forderte ihn trotzig auf, mir zu widersprechen.
»Selbstverständlich. Aber wie wäre es nur mit einer einzigen Lektion, bevor wir nach Hause fahren? Ich kann dir zeigen, wie man den geographischen Norden bestimmt. Ist ganz einfach.«
Ich wollte Ja sagen, aber das Wort brachte ich schon seit Langem nicht mehr hervor, es war wie eine Murmel mitten in meinem Hals stecken geblieben und hatte sich dort festgesetzt. Stattdessen zog ich meine Hand von der Tür zurück und legte sie in den Schoß.
»Oder wir machen das ein andermal«, sagte er. »Läuft uns ja nicht weg. Fahren wir nach Hause.«
An jenem Abend gab er mir vor dem Schlafengehen ein in Stoff eingeschlagenes Buch mit dem Titel Überleben in der Wildnis für Anfänger. Ich steckte es in eine Schublade meines Nachttisches, zog es aber wieder hervor, sobald er das Zimmer verlassen hatte, und überflog die Titel der einzelnen Kapitel: »Zeichen geben«, »Nahrung«, »Schutz«, »Knoten binden«. Ich blieb bis nach Mitternacht wach und verschlang den Inhalt. Es gab Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man die Essbarkeit von Pflanzen und Käfern testete, Fallen stellte, einen Unterschlupf baute, Fische mit den Händen fing. Es gab Fachausdrücke für Karten und Kompasse zu lernen, und ich las über Orientierung nach Sicht und die Berücksichtigung des Geländes, über das Entfachen von Feuer, persönliche Sicherheit, Wundversorgung, Anpassungsfähigkeit, die Bewältigung von Stress, Unterkühlung und Angst.
Ich verstand nicht, weshalb mich diese Szenarien anzogen, zumindest damals noch nicht, aber sie sprachen mich auf tiefster Ebene an. Hap war ein weiser Mann. Er schien von Anfang an erraten zu haben, dass er auf genau diese Weise mit mir kommunizieren musste, von Überlebendem zu Überlebender.
***
Ich fahre auf den kleinen Parkplatz am Anfang des Wanderwegs, verschnüre meine schweren Stiefel doppelt, ziehe den Reißverschluss meines Anoraks bis zum Kinn hoch und laufe los. Ich lasse den Hauptstartpunkt links liegen, um einer weniger bekannten Route zu folgen, die zum Rundweg über die Landzunge führt. Nach einer halben Meile erreiche ich einen dichten Zypressenhain und ducke mich durch eine schmale Lücke zwischen den Bäumen, wobei ich eine Hand vor mein Gesicht halte, um die Spinnweben einzufangen, von denen ich weiß, dass sie da sind, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Meine Fingerspitzen sind klebrig von den Fäden, während ich mich immer tiefer hineindrücke, und auf einmal wird auch die Zeit klebrig. Ich bin zehn oder elf Jahre alt und bekomme den geheimen Weg in den Hain zum ersten Mal gezeigt.
»Krummholz« ist der Begriff für diese Art von Vegetation; an dieses deutsche Wort erinnere ich mich aus einer von Haps Lektionen. Über mehrere Jahrzehnte hat das raue Wetter die Bäume zu grotesken Formen verbogen. Der salzreiche Nordwind lässt die Zweigspitzen absterben, zwingt sie, sich zu neigen und zu verdrehen, in Richtung Boden zu schießen statt gen Himmel. Sie sind ein lebendiges Schaubild für die Anpassung, die Intelligenz und die Widerstandsfähigkeit der Natur. Sie dürften eigentlich nicht in der Lage sein, auf diese Weise zu wachsen, und doch tun sie es.
In dem Hain verspüre ich eine plötzliche schmerzhafte Sehnsucht nach Hap. Nach all der Schönheit, die er mir zeigte, und auch all der Hässlichkeit. Danach, wie er eine Schicht der Welt nach der anderen entfernte und darauf vertraute, dass ich alles aufnähme. Hier fühle ich mich ihm näher und auch den Antworten, nach denen ich suche, um mich selbst wieder zusammenzufügen wie ein zerbrochenes und verstreutes Puzzle.
Ich schließe die Augen und versuche, alles zum Stillstand zu bringen – das spärliche, wie durch ein Sieb fallende Licht und den schweren Geruch des Mooses. Aber sobald ich so dastehe, blitzt ein Gedanke auf wie auf einer dunklen Kinoleinwand. Ein aufscheinendes Nachbild, kurz und düster. Dies ist der perfekte Ort, um eine Leiche zu vergraben.
Cameron Curtis steigt so rasch an die Oberfläche meiner Gedanken wie Hitze. Wie das Blut, das in meinen Händen prickelt, als ich sie zu Fäusten balle. Die großen braunen Augen, die schwierige Dinge gesehen haben. Der stur hoffnungsvolle Zug um ihren Mund und ihr langes dunkles Haar. Es scheint nicht mehr wichtig zu sein, dass ich gegenüber anderen wie ihr versagt habe – und dabei auch gegenüber mir selbst. Dass es vermutlich bereits zu spät ist. Denn sie ist hier.
Ich stolpere fast, als ich mich zurück durch die Lücke und auf die Landzunge dränge, immer schneller entlang des menschenleeren Wanderwegs laufe, bis zum Rand der Klippe, wo der Wind so stark ist, dass er mich beinahe umbläst. Unter mir besetzen vier Kormorane einen zerklüfteten schwarzen Felsen, die Hälse an ihre Körper gezogen wie Haken. Die Brandung schießt um sie nach vorn und wirft Schaum auf. Weiter draußen sind schwarze Wellen und grüne Wellen zu sehen. Ein Fischerboot rollt auf die Spitze eines Wellenkamms und stürzt dann hinab, wie durch eine Falltür.
Ich möchte, dass Cameron Curtis genauso verschwindet und meinem Bewusstsein für immer fernbleibt. Aber nicht einmal das Boot ist verschwunden. Klein und weiß springt es wieder aus dem Wellental hervor, klammert sich oben fest. Meine Ohren klirren vor Kälte, dennoch setze ich mich und umfasse meine Knie fest mit den Armen. Das Haar weht mir über die Augen und in den Mund, es schmeckt nach Salzwasser. Alles scheint in einem Strudel umherzuwirbeln, vor und zurück gerissen, furchtbar und wunderschön. Und ich bin hier inmitten von allem und versuche, mich daran zu erinnern, wie man Unvorstellbares überlebt, wie man die Wildheit, das Chaos und die Angst aushält.
Sechs
Etwa eine Stunde später mache ich mich auf den Weg zurück zu meinem Wagen, durchgefroren bis auf die Knochen, aber ruhiger im Kopf. Als ich den Parkplatz erreiche, bleibe ich vor Schreck stehen. Zwei gestreifte Absperrbänder der Polizei blockieren den Eingang zum Park. Etliche uniformierte Polizistinnen und Polizisten mit Spürhunden und Walkie-Talkies haben sich vor dem Schwarzen Brett der Forstverwaltung versammelt. Es handelt sich um einen Suchtrupp für Cameron Curtis.
Ich ziehe die Kapuze meines Anoraks fester und mache mich auf den Weg zu meinem Bronco. Ich bin noch drei Schritte entfernt und habe den Schlüssel bereits in der Hand, als ich meinen Namen höre. Aber das muss ich mir einbilden. Niemand hier kennt mich, nicht mehr. Ich werde schneller und habe die Tür erreicht, als sich mir eine Hand auf den Rücken legt.
»Hey.«
Ich wirbele herum, die Hände automatisch vor dem Körper, bereit für eine Konfrontation. Nichts jedoch kann mich auf das Gesicht vorbereiten, in das ich nun blicke – so vertraut, auch noch nach all den Jahren. Es ist, als würde man durch einen Schwindelanfall schwimmen oder in einer Zeitmaschine aufwachen.
»Anna Hart. Ich glaube es nicht.«
Ich kann ihn bloß anstarren. Graue Augen, mittlerweile von Falten umringt, aber noch mit demselben Leuchten, sein kantiger Kiefer und die feine gerade Nase, die Fransen seines unbändigen rotgoldenen Haars, die unter seiner Kappe hervorsprießen. Er ist ein Phantom, eine Erinnerung, ein Freund aus längst vergangenen Zeiten. »Will Flood.«
Ich umarme ihn und stoße mit dem Ellbogen gegen seine Schulter, weiche zurück und trete ihm dabei auf den Fuß.
»Autsch!« Er lacht. »Was zum Teufel machst du hier?«
Mir fällt so schnell nichts ein, was ich ihm antworten könnte. Als ich Will zum letzten Mal sah, war ich achtzehn, er zweiundzwanzig, und er trug noch ganz neu seine Uniform im Büro des Sheriffs, das sein Vater jahrzehntelang ohne Unterbrechung geleitet hatte. Damals hatte Will große Träume gehabt, hatte oft von San Francisco, Los Angeles, Denver, Seattle gesprochen, Hauptsache raus aus dem langen Schatten von Ellis Flood.
»Was ist hier los?«, frage ich, als wäre es nicht offensichtlich.
»Vermisstes Mädchen. Mittlerweile seit zwei Tagen. Ist mitten in der Nacht von zu Hause verschwunden, keine Einbruchspuren.«
»Eine Ausreißerin?«
»Glaube nicht. Ihre Mom ist Emily Hague.«
»Emily Hague, die Schauspielerin?« Ich kann es kaum glauben. Ein Filmstar in Mendocino?
»Was für ein Zufall, dass es gerade mich trifft. Die Familie will alles aus der Presse heraushalten. Der Dad wollte mir unter der Hand zehntausend Dollar zustecken, damit ich die Suche beschleunige. Als ob das funktionieren würde. Er wedelt mit ein bisschen Geld, und ich zaubere das Mädchen aus dem Hut hervor.«
»Ich hoffe doch, du hast es angenommen.«
Sein Lachen kommt schnell. »Hör mal, trink doch später was mit mir.«
»Ich kann nicht.«
»Und ob du kannst. Um acht im Patterson’s, oder ich komm dich holen.«
Ich verspüre einen weiteren Schwindelanfall und wünschte, ich könnte einfach mit einem Wimpernschlag verschwinden. Weit entfernt und unsichtbar sein. Aber hier handelt es sich um Will. »Ich werde es versuchen.«
»Du wirst da sein.« Dann schreitet er davon, auf sein versammeltes Team zu, dem er bereits im Gehen Anweisungen erteilt.
***
Ich steige in meinen Bronco und starte den Motor, während der Suchtrupp sich auf den Hauptweg stürzt. Ich kenne diesen auswendig, ebenso wie die harte Arbeit, die nun vor ihnen liegt. Sie werden aus den einzelnen Quadratmeilen ein Raster bilden, und jede von ihnen nach zerknickter Vegetation oder Kleidungsfetzen absuchen, nach allem, was dort fehl am Platz wirkt. Ein paar der Hunde sind Rettungshunde, die Camerons Geruch von einem Sweatshirt oder einem Kopfkissenbezug aufgenommen haben, von irgendetwas, das sie häufig benutzt hat. Andere sind Leichenspürhunde, die darauf trainiert sind, Spuren von menschlicher Verwesung ausfindig zu machen, ein Geruchsbild, das vom Boden aufsteigt oder in der Luft hängt.
In einem Fall wie diesem, wenn jemand einfach verschwunden ist, besteht zumindest am Anfang eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit, dass diese Person unversehrt wiederauftaucht. Es ist möglich, dass Cameron sich irgendwo im Wald verirrt hat oder dass sie selbst beschlossen hat, abzuhauen.
Zu verschwinden ist kein Verbrechen, aber hier scheint es eine vielsagende Leerstelle zu geben, ein vertrautes dunkles Schimmern, das Fragen aufwirft. Vielleicht ist sie gezwungen worden, wegzulaufen, oder sie ist sogar in das Leid verstrickt, das ihr widerfahren ist. Ich erinnere mich an eine alte Gruselgeschichte, in der es genau darum geht. In ihr stiehlt der Teufel Seelen, indem er ganz offen um sie bittet. Er ist kein Dieb, sondern ein meisterhafter Manipulator. Die wahre Gefahr, so lautet in etwa die Moral der Geschichte, liegt nicht im Teufel selbst, sondern in der eigenen Unkenntnis darüber, dass man die Möglichkeit hat, ihn abzuweisen.
Das ist für mich der traurigste Teil, den ich immer wieder erlebt habe: dass manche Opfer nicht einmal ein geflüstertes Nein in sich tragen. Weil sie nicht daran glauben, dass sie ihr Leben selbst retten können.
Sieben
A