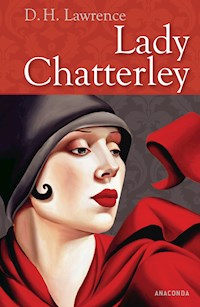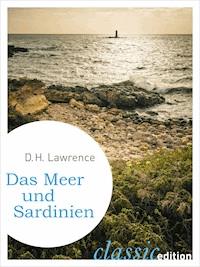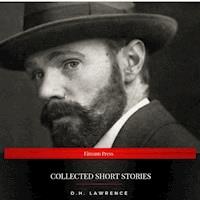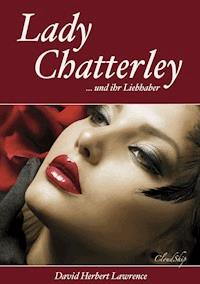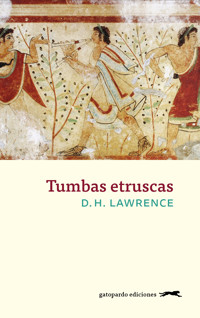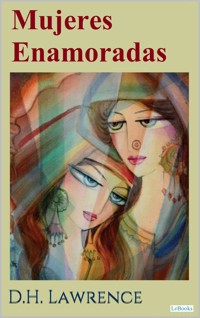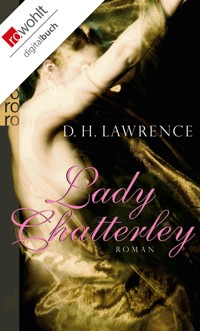
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichte einer alle Fesseln der Konvention sprengenden Leidenschaft ist ein klassisches erotisches Meisterwerk und einer der großartigsten Romane des 20. Jahrhunderts. England 1920: Freiheit und Selbsterfüllung gibt es für Lady Constance Reid nicht mehr, seit sie mit ihrem kriegsversehrten Ehemann Sir Clifford Chatterley nach Wragby Hall gezogen ist. Die Dorfbewohner meiden sie, die gesellschaftlichen Zwänge engen sie ein, und auch die Zuneigung zwischen ihr und Clifford, der die Tage zurückgezogen mit dem Schreiben von Geschichten verbringt, schwindet von Tag zu Tag. Als sie eine Pflegerin einstellt, die sich um Clifford kümmert, entflieht Constance den schweren Gemäuern immer öfter und genießt ihre wiedererlangte Freiheit. Dabei lernt sie den eigensinnigen Wildhüter Oliver Mellors kennen. Constance beginnt eine Affäre mit ihm, die alle Standesunterschiede aufhebt. Eine Liebe voller Sinnlichkeit, verbotener Lust und entfesselter Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
D. H. Lawrence
Lady Chatterley
Roman
ERSTES KAPITEL
Unser Zeitalter ist seinem Wesen nach tragisch, also weigern wir uns, es tragisch zu nehmen. Die Katastrophe ist hereingebrochen, wir stehen zwischen den Trümmern, wir fangen an, neue kleine Gewohnheiten zu bilden, neue kleine Hoffnungen zu hegen. Es ist ein hartes Stück Arbeit: Kein ebener Weg führt in die Zukunft; wir umgehen die Hindernisse jedoch oder klettern über sie hinweg. Wir müssen leben – einerlei, wie viele Himmel eingestürzt sind.
Ungefähr in dieser Situation befand sich Constance Chatterley. Der Krieg hatte das Dach über ihrem Kopf zusammenbrechen lassen, und sie hatte einsehen müssen, daß Leben: Lernen heißt! Sie heiratete Clifford Chatterley 1917, als er für vier Wochen auf Urlaub nach Hause kam. Ihre Flitterwochen dauerten einen Monat. Dann ging er wieder nach Flandern und wurde sechs Monate später mehr oder weniger zerstückelt zu Schiff nach England zurückgebracht. Constance, seine Frau, war damals dreiundzwanzig Jahre alt, er neunundzwanzig.
Sein Lebenswille war erstaunlich. Er starb nicht, und die Stücke schienen wieder zusammenzuwachsen. Zwei Jahre verbrachte er unter den Händen der Ärzte. Dann wurde er für geheilt erklärt und durfte ins Leben zurückkehren – die untere Hälfte seines Körpers, von den Hüften abwärts, für immer gelähmt.
Das war 1920.Die beiden – Clifford und Constance – kehrten in sein Elternhaus zurück, nach Wragby Hall, dem «Familiensitz». Sein Vater war gestorben. Clifford war jetzt Baronet– Sir Clifford–, und Constance war Lady Chatterley. Mit einem ziemlich unzureichenden Einkommen fingen sie an, auf dem ziemlich ungeselligen Landsitz der Chatterleys einen Haushalt und ein Eheleben zu führen. Clifford hatte eine Schwester, aber sie war fortgezogen. Sonst gab es keine näheren Verwandten. Der ältere Bruder war im Krieg gefallen. Verkrüppelt für immer, gewiß, niemals Kinder haben zu können – so kehrte Clifford heim in die rauchigen Midlands, um den Namen der Chatterleys lebendig zu halten, so lange er es vermochte.
Er war eigentlich nicht niedergeschlagen. Er konnte in einem Rollstuhl fahren, und er hatte einen Krankensessel mit einem kleinen Motor, so daß er sich langsam durch den Garten steuern konnte in den schönen, melancholischen Park hinaus, auf den er so stolz war, wenn er auch tat, als mache er sich nichts aus ihm.
Er hatte so gelitten, daß seine Fähigkeit zu leiden bis zu einem gewissen Grad erstorben war. Er wirkte sonderbar heiter, fast unbekümmert, könnte man sagen; sein Gesicht zeigte eine gesunde, kräftige Farbe, und die blaßblauen Augen funkelten herausfordernd. Seine Schultern waren breit und stark, seine Hände kräftig. Er trug teure Anzüge und elegante Krawatten aus der Bond Street. In seinem Gesicht aber lag der lauernde, leere Ausdruck des Krüppels.
Er war dem Tod so knapp entronnen, daß das, was ihm vom Leben übrigblieb, unsäglich kostbar für ihn war. Der begierige Glanz seiner Augen ließ erkennen, wie stolz er darauf war, nach der gewaltigen Erschütterung noch am Leben zu sein. Aber er war so schwer verwundet worden, daß etwas in ihm erstorben, ein Teil seiner Empfindungen verschüttet war. Eine fühllose Leere war geblieben.
Constance, seine Frau, war ein rosiges, ländlich aussehendes Mädchen mit weichem braunem Haar und von kräftigem Wuchs, ihre gemächlichen Bewegungen verrieten ungewöhnliche Energie. Sie hatte große, nachdenkliche Augen und eine sanfte, dunkle Stimme, und es schien, als sei sie gerade aus ihrem Heimatdorf gekommen. Das war aber durchaus nicht der Fall. Ihr Vater, der alte Sir Malcolm Reid, war ein vormals wohlbekanntes Mitglied der Königlichen Akademie. Ihre Mutter hatte in der Glanzzeit der Präraphaeliten zu den kultivierten Fabiern gehört. Constance und ihre Schwester Hilda genossen unter Künstlern und gebildeten Sozialisten eine – wie man sagen könnte – ästhetisch unkonventionelle Erziehung. Sie waren nach Paris, Florenz und Rom mitgenommen worden, um Kunst zu atmen, und man hatte sie auch in andere Bereiche geführt, nach Den Haag und Berlin, zu großen sozialistischen Versammlungen, wo Redner in allen Zungen der zivilisierten Welt sprachen und niemand sich Zwang antat.
Die beiden Mädchen ließen sich daher von frühauf weder durch die Kunst noch durch politische Ideen einschüchtern. Sie waren diese Atmosphäre gewohnt. Sie waren kosmopolitisch und zugleich provinziell, und so eignete ihnen jener kosmopolitische Provinzialismus der Kunst, der Hand in Hand mit reinen sozialen Idealen geht.
Mit fünfzehn Jahren wurden sie nach Dresden geschickt, unter anderem wegen der Musik. Das war eine schöne Zeit für sie. Unbekümmert bewegten sie sich unter den Studenten, diskutierten mit den Männern philosophische, soziologische und künstlerische Fragen; sie standen den Männern dabei nicht nach, übertrafen sie vielleicht sogar, denn sie waren Frauen. Und sie durchstreiften die Wälder mit stämmigen jungen Burschen, die auf Gitarren Lieder klimperten, tweng-tweng! Sie sangen Wandervogellieder, und sie waren frei. Frei! Das war das große Wort. Hinaus in die weite Welt, hinaus in die Wälder des Morgens mit den fröhlichen und starkkehligen Jünglingen, frei, zu tun, was das Herz begehrte und – was die Hauptsache war – zu sagen, was sie wollten! Am wichtigsten war das Gespräch, der leidenschaftliche Gedankenaustausch. Liebe war nur eine nebensächliche Begleiterscheinung.
Mit achtzehn ungefähr hatten Hilda und Constance ihre ersten tastenden Liebeleien gehabt. Den jungen Männern, mit denen sie so leidenschaftlich diskutierten, so fröhlich sangen und in solcher Freiheit unter den Bäumen kampierten, ging es natürlich um ein Liebesverhältnis. Die Mädchen zögerten, doch wurde so viel über die Sache geredet, daß sie wohl wichtig sein mußte. Und die Männer waren so demütig, so voll Verlangen. Warum sollte ein Mädchen da nicht großmütig sein und sich selber zum Geschenk machen?
So hatten sie sich denn zum Geschenk gemacht, jede dem Jüngling, mit dem sie die subtilsten und intimsten Gespräche führte. Die Gespräche, die Diskussionen – das war das Große; Zärtlichkeit und körperliche Vereinigung waren eher ein Atavismus, ein Rückfall ins Primitive. Man war hinterher weniger verliebt in den Jungen, neigte sogar ein wenig dazu, ihn zu hassen – als hätte er die Grenzen der privatesten Sphäre, der inneren Freiheit mißachtet, denn: man war ein Mädchen, und die ganze Würde und Bedeutung, die man im Leben gewann, hing daher vom Erringen einer absoluten, einer vollkommenen, einer reinen und edlen Freiheit ab. Was anders bedeutete das Leben eines Mädchens, als die alten, niedrigen Bindungen abzuschütteln?
Und wie sehr man sie auch mit Gefühlen aufladen mochte, diese geschlechtlichen Dinge gehörten zu den urältesten, niedrigsten Bindungen und Abhängigkeiten. Die Dichter, die sie verherrlichten, waren zumeist Männer. Frauen hatten immer gewußt, daß es etwas Besseres gab, etwas Höheres. Und jetzt wußten sie es entschiedener denn je. Die herrliche, reine Freiheit einer Frau war unendlich wunderbarer als jede geschlechtliche Liebe. Es war ein Jammer, daß die Männer in dieser Hinsicht so weit hinter den Frauen herhinkten. Gierig wie Hunde waren sie auf das Sexuelle aus.
Und eine Frau hatte nachzugeben. Ein Mann war in seinen Begierden wie ein Kind. Die Frau mußte ihm gewähren, wonach ihn gelüstete, sollte er nicht unausstehlich werden wie ein Kind, im Trotz davonlaufen und zerstören, was doch eine sonst so erfreuliche Beziehung war. Aber eine Frau konnte sich einem Mann hingeben, ohne zugleich auch ihr inneres, freies Wesen hinzugeben. Das schienen die Dichter und alle, die über den Sexus schwatzten, nicht genügend bedacht zu haben. Eine Frau konnte einen Mann nehmen, ohne sich selber wirklich herzugeben. Sicherlich konnte sie ihn nehmen, ohne sich seiner Macht auszuliefern. Eher noch konnte sie das Geschlechtliche dazu benutzen, ihn in ihre Macht zu bekommen. Denn sie brauchte sich im geschlechtlichen Zusammensein nur zurückhalten und ihn sich ausgeben zu lassen, ohne selbst zum Höhepunkt zu gelangen: und dann konnte sie die Vereinigung hinausziehen und ihren Orgasmus und ihren Höhepunkt erreichen, während er nur ihr Werkzeug war.
Beide Schwestern hatten ihre Erfahrung in der Liebe hinter sich, als der Krieg ausbrach und sie überstürzt heimgerufen wurden. Keine von beiden verliebte sich je in einen jungen Mann, wenn sie ihm nicht im Wort sehr nahegekommen war – das heißt, wenn das Verlangen nach dem Gespräch nicht aus der Tiefe kam. Der wunderbare, tiefe, unfaßliche Schauer, mit einem wahrhaft klugen jungen Mann ein leidenschaftliches Gespräch zu führen, stundenlang, Tag für Tag den Faden wieder aufzunehmen, durch Monate hin… davon hatten sie nie etwas gewußt, bis es ihnen geschah. Die paradiesische Verheißung: Du sollst Männer haben zum Gespräch! war nie ausgesprochen worden. Sie erfüllte sich, noch ehe sie wußten, was diese Verheißung bedeutete.
Und wenn die aus diesen lebhaften und seelenerleuchtenden Diskussionen erwachsene Intimität das Geschlechtliche mehr oder weniger unumgänglich machte – nun gut. Es bezeichnete das Ende eines Kapitels. Und es hatte auch seinen eigenen Reiz: ein eigentümliches vibrierendes Erbeben innen im Körper, ein letztes Aufbäumen der Selbstbehauptung, wie ein letztes Wort, erregend und jener Reihe von Sternchen vergleichbar, die zuweilen den Schluß eines Kapitels bezeichnen und eine neue Wendung im Thema.
Als die Mädchen in den Sommerferien des Jahres 1913 nach Hause kamen – Hilda war zwanzig und Connie achtzehn–, war dem Vater klar, daß sie ihre Erfahrungen in der Liebe gemacht hatten.
L’amour avait passé par là, wie irgend jemand gesagt hat. Doch war er selbst ein Mann der Erfahrungen, und so ließ er dem Leben seinen Lauf. Die Mutter hingegen, in den letzten Monaten ihres Lebens nervenkrank und siech, wollte nichts weiter, als daß ihre Töchter «frei» seien und «sich selbst erfüllten». Sie hatte nie die Kraft gehabt, ganz sie selbst zu sein; das war ihr versagt geblieben. Mochte der Himmel wissen, warum, denn sie war eine Frau mit eigenem Einkommen und eigenen Möglichkeiten. Sie gab ihrem Mann die Schuld. In Wahrheit jedoch hatte sich ihrem Geist oder ihrer Seele irgendein altes Autoritätserlebnis eingeprägt, das sie nicht auslöschen konnte. Mit Sir Malcolm hatte es nichts zu tun; er überließ seiner nervös feindseligen, überspannten Frau ihren Hühnerhof und ging seine eigenen Wege.
So waren die Mädchen also «frei» und kehrten zurück nach Dresden zu ihrer Musik, zur Universität und zu den jungen Männern. Sie liebten ihre jeweiligen jungen Männer, und ihre jeweiligen jungen Männer liebten sie mit der Leidenschaft geistiger Anziehung. All die wundervollen Dinge, die die jungen Männer dachten und aussprachen und niederschrieben, dachten und sprachen und schrieben sie für die jungen Mädchen. Connies junger Mann war musikalisch, der Hildas technisch interessiert. Aber eigentlich lebten sie nur für ihre jungen Mädchen, nämlich seelisch und in ihren geistigen Höhenflügen. In anderer Hinsicht waren sie abgewiesen worden, obwohl sie es nicht merkten.
Auch ihnen sah man an, daß sie die Liebe erfahren hatten – das heißt die physische Liebe. Sonderbar, welch eine feine, doch unverkennbare Wandlung sie im Körper des Mannes und auch in dem der Frau bewirkt: das Mädchen gewinnt einen zarteren Schmelz, unmerklich rundet und glättet sich seine junge Eckigkeit, und der Ausdruck des Gesichts wirkt begehrlich oder triumphierend. Der Mann wird ruhiger, mehr in sich gekehrt, die Konturen seiner Schultern und Schenkel werden unbestimmter, zögernder.
Im ersten geschlechtlichen Erschauern des Körpers erlagen die Schwestern beinah der seltsamen männlichen Gewalt. Aber sie fingen sich schnell wieder, nahmen die sexuelle Erregung als Nervenkitzel und blieben frei. Die Männer dagegen trugen den Mädchen aus Dankbarkeit für die geschlechtliche Erfahrung ihre Seele entgegen. Und hinterher sahen sie aus, als hätten sie einen Shilling verloren und dafür ein Sixpencestück gefunden. Connies junger Mann konnte ein wenig verdrießlich werden und der Hildas ein wenig höhnisch. Aber so sind die Männer! Undankbar und nie zufrieden. Wenn du sie abweist, hassen sie dich, weil du nicht willst, und wenn du einwilligst, hassen sie dich auch – aus irgendeinem anderen Grund. Oder einfach aus dem einen Grund, daß sie mißmutige Kinder sind und niemals zufriedengestellt werden können, was immer sie auch bekommen – die Frau mag tun, was sie will.
Wie auch immer – der Krieg brach aus, und Hilda und Connie wurden eilig heimgerufen, nachdem sie schon im Mai zu Hause gewesen waren, zur Beerdigung ihrer Mutter. Noch vor Weihnachten 1914 waren die beiden jungen Deutschen tot; darauf weinten die Schwestern und liebten die jungen Männer leidenschaftlich, aber im Grunde vergaßen sie sie. Sie existierten nicht mehr.
Die beiden Schwestern lebten im Haus ihres Vaters – genaugenommen in dem ihrer Mutter – in Kensington und gesellten sich zu jener Gruppe junger Cambridge-Studenten, deren Kennzeichen «Freiheit», Flanellhosen, am Hals offene Flanellhemden, eine wohlerzogene Anarchie der Gefühle, flüsternde Stimme und eine überempfindsame Attitüde waren. Hilda indessen heiratete plötzlich einen zehn Jahre älteren Mann, der schon seit längerem zu dieser Cambridge-Gruppe gehörte – ein Mann mit stattlichem Vermögen und einem angenehmen, in der Familie weitergereichten Posten bei der Regierung; außerdem schrieb er philosophische Essays. Sie bewohnte mit ihm ein ziemlich kleines Haus in Westminster und bewegte sich in jenen achtbaren Kreisen höherer Regierungsbeamter, die zwar nicht zur Creme gehören, aber doch die eigentliche Intelligenzschicht im Volk bilden – oder doch bilden möchten: Leute, die wissen, worüber sie reden – oder reden, als wüßten sie es.
Connie leistete eine harmlose Art Kriegsdienst und verkehrte weiter mit den flanellbehosten, unduldsamen Cambridgern, die sich gelinde über alles und jedes mokierten. Ihr «Freund» war ein gewisser Clifford Chatterley, ein junger Mann von zweiundzwanzig Jahren, der von Bonn, wo er Kohlenbergbau studiert hatte, nach Hause geeilt war. Vorher war er zwei Jahre in Cambridge gewesen. Jetzt hatte man ihn zum Leutnant in einem schneidigen Regiment ernannt, und in Uniform stand es ihm noch besser, sich über alles lustig zu machen.
Clifford Chatterley gehörte einer höheren Gesellschaftsklasse an als Connie. Connie entstammte wohlhabenden intellektuellen Kreisen, er gehörte zur Aristokratie. Nicht zur höchsten, aber immerhin. Sein Vater war ein Baronet, und seine Mutter Tochter eines Viscount.
Clifford jedoch, wiewohl von besserer Abkunft als Connie und zur «Gesellschaft» gehörig, war in seiner Art viel provinzieller und unsicherer. Er fühlte sich nur wohl in der kleinen «großen Welt» – das heißt, in der Gesellschaft des Landadels–, aber auf die Vertreter jener anderen Welt, die unübersehbaren Scharen der mittleren und niederen Klassen und der Ausländer, reagierte er scheu und reizbar. Um die Wahrheit zu sagen: er fürchtete sich ein wenig vor der mittelständischen und proletarischen Menschheit und vor allen Ausländern, die nicht seiner eigenen Gesellschaftsschicht angehörten. Er war einem lähmenden Gefühl der Wehrlosigkeit ausgeliefert, obwohl er allen Schutz der Privilegierten genoß. Es klingt befremdlich, ist aber wohl eine Erscheinung unserer Zeit.
Deshalb mußte das eigentümlich zärtliche Selbstvertrauen eines Mädchens wie Constance Reid ihn faszinieren. Sie fand sich in dieser chaotischen Umwelt viel besser zurecht als er.
Dennoch war auch er ein Rebell – er rebellierte sogar gegen seine eigene Klasse. Vielleicht ist das Wort «Rebell» übertrieben, reichlich übertrieben. Er war nur angesteckt von der allgemeinen Auflehnung der Jungen gegen Konvention und jegliche Art Autorität. Väter waren lächerlich, vornehmlich sein eigener, starrköpfiger. Und Regierungen waren lächerlich, besonders die englische mit ihrem ewigen «Abwarten, abwarten». Und Armeen waren lächerlich, schon gar die alten Tröpfe, die Generale, und in erster Linie der rotgesichtige Kitchener. Sogar der Krieg war lächerlich, obgleich ihm doch eine Menge Menschen zum Opfer fielen.
Ja, wirklich, alles war ein wenig lächerlich – oder sogar sehr lächerlich: besonders alles, was mit Autorität zusammenhing – in der Armee oder der Regierung oder auf den Universitäten–, war in hohem Maße lächerlich. Und sofern die herrschende Schicht sich anmaßte, herrschen zu wollen, war auch sie lächerlich. Sir Geoffrey, Cliffords Vater, war über alle Maßen lächerlich, wie er seine Bäume zerhackte, die Arbeiter aus seiner Zeche holte, um sie in den Krieg zu hetzen, patriotisch und selber in Sicherheit; und außerdem, er gab mehr Geld für sein Vaterland hin, als er besaß.
Als Miss Chatterley– Emma – aus Mittelengland nach London kam, um als Pflegerin zu arbeiten, machte sie sich im stillen lustig über Sir Geoffrey und seinen entschlossenen Patriotismus. Herbert, der ältere Bruder und Erbe, lachte aus vollem Halse, obgleich es seine Bäume waren, die fielen, um als Stützpfosten für die Schützengräben verwandt zu werden. Clifford jedoch lächelte nur ein wenig unbehaglich. Alles war lächerlich, ganz recht. Aber wenn es einem zu nahe rückte und man selber lächerlich wurde…? Wenigstens gab es noch in einer anderen Gesellschaftsschicht Menschen – wie Connie–, die irgend etwas ernst nahmen. Die an irgend etwas glaubten.
Sie nahmen die Tommies sehr ernst und die Drohung der allgemeinen Wehrpflicht und den Mangel an Zucker und Süßigkeiten für die Kinder. Bei all diesen Dingen machten die Behörden natürlich lächerliche Fehler. Aber Clifford konnte es nicht mehr erschüttern. Für ihn waren die Behörden ab ovo lächerlich, nicht nur wegen der Toffees oder Tommies.
Und die Behörden kamen sich selber lächerlich vor und benahmen sich reichlich lächerlich, und eine Zeitlang ging es zu wie in einem Narrenhaus. Bis die Dinge drüben sich zuspitzten und Lloyd George auftrat, um die Situation hüben zu retten. Und dann ging alles zu weit, um noch lächerlich zu sein; die versnobten jungen Leute lachten nicht mehr.
1916 fiel Herbert Chatterley, und so wurde Clifford der Erbe. Sogar das erschreckte ihn. Aber seine Bedeutung als Sohn Sir Geoffreys und Kind Wragbys saß ihm so sehr in Fleisch und Blut, daß er sich ihr nicht entziehen konnte. Und dabei wußte er, daß auch dies lächerlich war in den Augen der ungeheuren brodelnden Welt. Jetzt war er Erbe und für Wragby verantwortlich. War das nicht entsetzlich? Und gleichzeitig herrlich und außerdem vielleicht gänzlich absurd?
Sir Geoffrey empfand es keineswegs als absurd. Er war blaß und angespannt, in sich zurückgezogen und hartnäckig entschlossen, sein Land und seine eigene Position zu erhalten – ob nun unter Lloyd George oder sonst wem. Er wußte so wenig von dem England, das das wahre England war, lebte so abgeschieden von ihm, war dermaßen beschränkt, daß er sogar von Horatio Bottomley etwas hielt. Sir Geoffrey stand für England und Lloyd George, wie seine Vorfahren für England und St.Georg gestanden hatten: und nie erfuhr er, daß es da einen Unterschied gab. So fällte Sir Geoffrey also seine Bäume und stand für Lloyd George und England, für England und Lloyd George.
Und er wollte, daß Clifford heirate und einen Erben zeuge. Clifford hielt seinen Vater für einen hoffnungslosen Anachronismus. Aber worin war er ihm auch nur eine Spur voraus, als in der erschrockenen Erkenntnis, wie lächerlich alles war und wie unübertrefflich lächerlich seine eigene Stellung? Denn wohl oder übel nahm er seine Baronetwürde und Wragby bitter ernst.
Der Krieg hatte nichts Frisch-Fröhliches mehr… erloschen. Zu viel Tod und Entsetzen. Ein Mann brauchte Trost und Hilfe. Ein Mann brauchte einen Anker in einer sicheren Welt. Ein Mann brauchte eine Frau.
Die Chatterleys, zwei Brüder und eine Schwester, hatten trotz all ihrer Beziehungen merkwürdig isoliert und eingekapselt auf Wragby gehaust. Ein Gefühl, abgesondert zu sein, knüpfte die Familienbande enger – ein Gefühl der Schwäche ihrer Stellung, ein Gefühl der Wehrlosigkeit trotz oder gerade wegen des Titels und des Grundbesitzes. Zwischen ihnen und den industriellen Midlands, wo sie ihr Leben zubrachten, bestand keine Beziehung. Und das schwerblütige, starrköpfige, verschlossene Wesen Sir Geoffreys, ihres Vaters, über den sie sich lustig machten, obwohl sie in allem, was ihn anging, empfindlich waren, trennte sie von ihrer eigenen Kaste.
Die drei hatten sich geschworen, daß sie immer zusammenbleiben würden. Aber nun war Herbert tot, und Sir Geoffrey wünschte, daß Clifford heirate. Sir Geoffrey redete kaum davon – er sprach sehr wenig. Aber es war schwer für Clifford, sich seiner stillen, düsteren Beharrlichkeit zu widersetzen.
Emma aber sagte: Nein! Sie war zehn Jahre älter als Clifford, und seine Heirat kam für sie einer Fahnenflucht gleich, einem Verrät an allem, dem sich die jüngeren Familienmitglieder verschrieben hatten.
Clifford heiratete Connie aber trotzdem und verbrachte seinen Honigmond mit ihr. Man schrieb das furchtbare Jahr 1917, und sie waren einander nahe wie zwei Menschen, die auf einem sinkenden Schiff stehen. Er war noch ohne Liebeserfahrung, als er heiratete, und das Sexuelle galt ihm nicht viel. Sie waren einander auch ohne das so nah, er und sie. Und Connie schwelgte in dieser Intimität jenseits alles Geschlechtlichen, jenseits der «Befriedigung» eines Mannes. Clifford jedenfalls war nicht gerade erpicht auf seine «Befriedigung», wie so viele Männer es zu sein schienen. Nein, ihre Intimität war viel tiefer, persönlicher als das. Das Geschlechtliche war nur eine Nebensache, ein Nebenumstand, einer der kuriosen, abgenutzten organischen Vorgänge, die sich in ihrer Plumpheit beharrlich erhielten, doch keineswegs notwendig waren. Trotzdem aber wollte Connie Kinder haben – sei es auch nur, um sich gegen ihre Schwägerin Emma zu behaupten.
Doch Anfang 1918 wurde Clifford zusammengeschossen nach Hause transportiert, und mit den Kindern war es aus. Und Sir Geoffrey starb vor Verdruß.
ZWEITES KAPITEL
Im Herbst 1920 hielten Connie und Clifford ihren Einzug auf Wragby. Miss Chatterley, noch immer verärgert über den Treubruch ihres Bruders, war abgereist und hatte sich in einer kleinen Wohnung in London einquartiert.
Wragby war ein langgestrecktes, niedriges altes braunes Backsteingebäude, das um die Mitte des 18.Jahrhunderts begonnen und immer mehr erweitert worden war, bis es schließlich ohne jeden eigenen Charakter einem Kaninchenbau glich. Es stand auf einer Anhöhe in einem sehr schönen alten Eichenpark – aber ach, ziemlich nah war der Schlot der Tevershall-Grube mit seinen Dampf- und Rauchwolken zu sehen, und in feuchter, dunstiger Ferne des Hügels das struppige, verstreute Dorf Tevershall – ein Dorf, das fast vor den Toren des Parks anfing und sich in lähmender, hoffnungsloser Häßlichkeit über eine lange, schauerliche Meile hinzog: Häuser, ganze Reihen erbärmlicher kleiner, schmutziger Backsteinhäuser mit schwarzen Schieferdächern, spitzwinklig und von einer eigensinnigen, trostlosen Düsterkeit.
Connie war an Kensington gewöhnt oder an die schottischen Berge oder an die Hochebenen von Sussex: das war ihr England. Mit dem Gleichmut der Jugend nahm sie nach einem flüchtigen Blick die schreckliche, seelenlose Häßlichkeit des kohle- und eisenproduzierenden Mittelenglands hin und ließ es bei dem bewenden, was es war: unglaubhaft und des Nachdenkens nicht wert. In den ziemlich trübseligen Zimmern auf Wragby hörte sie das Rasseln der Kohlensiebe an der Grube, das Ächzen der Förderwelle, das Scheppern rangierender Loren und das heisere kleine Pfeifen der Stollenlokomotiven. Die Tevershall-Halden brannten, brannten schon seit Jahren, und es würde Hunderttausende kosten, sie zu löschen. So ließ man sie brennen. Und wenn der Wind, wie oft, aufs Haus stand, dann war es voll vom Gestank, den dieser schweflige Brand der Erdexkremente verbreitete. Doch selbst an windstillen Tagen roch die Luft immer nach irgend etwas Unterirdischem: nach Schwefel, Kohle, Eisen oder einer Säure. Sogar auf den Christrosen setzten sich hartnäckig die Rußflocken fest – unfaßbar, wie schwarzes Manna aus Himmeln der Verdammnis.
Nun ja, so war es eben: dem Verderben anheimgegeben wie alles übrige. Es war schon grauenvoll, aber warum sich dagegen auflehnen? Man konnte es doch nicht ändern. Es ging immer so weiter. Das Leben und alles andere auch. An der niedrighängenden dunklen Wolkendecke brannten und zitterten des Nachts rote Kleckse, verfärbten sich, dehnten sich aus und zogen sich wieder zusammen, wie schmerzende Brandmale. Das waren die Hochöfen. Anfangs lösten sie in Connie einen faszinierenden Schauder aus; ihr war, als lebe sie unter der Erde. Dann gewöhnte sie sich daran. Und morgens regnete es.
Clifford behauptete, Wragby sei ihm lieber als London. Das Land habe einen grimmigen eigenen Willen und die Bevölkerung noch Mark in den Knochen. Connie hätte gern gewußt, was sie sonst noch hatte – Augen und eine Seele jedenfalls nicht. Die Menschen hier waren ausgemergelt, konturlos und öde wie der Landstrich, und ebenso unfreundlich. Nur lag in ihrem tiefkehligen, schlurfenden Dialekt und dem Hämmern ihrer groben Nagelstiefel, wenn sie von der Arbeit kamen und in Trupps über den Asphalt nach Hause trotteten, etwas Furchterregendes und fast Geheimnisvolles.
Es hatte keinen Willkomm für den jungen Landjunker gegeben, keinen festlichen Empfang, keine Abordnung, keine einzige Blume. Nur eine naßkalte Autofahrt einen dunklen, feuchten Weg hinauf, der sich unter düsteren Bäumen dem Parkhang entgegengrub, wo graue, nasse Schafe grasten, zur Hügelkuppe hinauf, wo das Haus seine dunkelbraune Fassade hinbreitete und die Haushälterin und ihr Mann wie unsichere Bewohner der Erdoberfläche warteten, um einen Willkommensgruß zu stammeln.
Zwischen Wragby Hall und Tevershall gab es nicht den geringsten Verkehr. Niemand griff grüßend an die Mütze, niemand machte einen Knicks. Die Grubenarbeiter glotzten nur; die Geschäftsleute nahmen vor Connie die Mütze ab, als sei sie eine Bekannte, und Clifford nickten sie verlegen zu: das war alles. Eine unüberbrückbare Kluft und eine stumme Ablehnung auf beiden Seiten. Anfangs litt Connie unter der ständig vom Dorf her sickernden Ablehnung. Dann verhärtete sie sich dagegen und empfand sie wie eine Art Anregungsmittel, wie etwas, gegen das sie anleben mußte. Nicht, daß sie und Clifford unbeliebt gewesen wären; sie gehörten nur einer vollkommen anderen Spezies von Menschen an als die Bergleute. Eine unüberbrückbare Kluft, eine unbeschreibbare Spaltung, wie es sie südlich des Trent gar nicht gibt. In den Midlands und im industriellen Norden aber – da bestand eine unüberbrückbare Kluft, über die es keinen Weg zur Verständigung gab. Bleib, wo du bist, und ich bleib, wo ich bin! Merkwürdiges Verleugnen des gemeinsamen Pulsschlags der Menschheit.
Theoretisch hatte das Dorf gar nichts gegen Clifford und Connie einzuwenden. In der Praxis aber galt auf beiden Seiten ein «Laß mich in Ruhe».
Der Pfarrer war ein netter Mann von ungefähr sechzig Jahren, durchdrungen von seiner Aufgabe, jedoch durch das verbissene «Laß mich in Ruhe» des Dorfes zu einem Niemand reduziert. Die Frauen der Grubenarbeiter waren nahezu alle Methodistinnen. Die Grubenarbeiter waren gar nichts. Allein der Umstand, daß der Geistliche eine Amtstracht trug, reichte aus, um die Tatsache zu verdunkeln, daß er ein Mensch war wie andere. Nein, er war «Mester Ashby», so etwas wie ein automatisches Predigt- und Gebetunternehmen.
Dies sture, instinktive «Wir halten uns nicht für weniger, auch wenn Sie Lady Chatterley sind!» verwirrte Connie und war ihr anfangs gänzlich unbegreiflich. Die sonderbare, mißtrauische, falsche Liebenswürdigkeit, mit der die Bergmannsfrauen auf ihre Annäherungsversuche reagierten; der merkwürdig kränkende Beigeschmack von diesem «Meine Güte! Jetzt bin ich wer, wo Lady Chatterley mit mir gesprochen hat! Aber sie soll sich nicht einbilden, daß ich weniger bin als sie!», das sie immer in den fast kriecherischen Stimmen der Frauen mitschwingen hörte, war ihr unfaßlich. Dagegen war nicht anzukommen. Es wich hoffnungslos und verletzend von allem ab, was sie kannte.
Clifford ließ die Leute in Ruhe, und sie lernte, es ihm gleichzutun: sie ging an ihnen vorbei, ohne sie anzusehen, und sie starrten zu ihr herüber, als wäre sie eine wandelnde Wachspuppe. Wenn Clifford mit ihnen zu tun hatte, behandelte er sie hochmütig und geringschätzig; man konnte es sich nicht länger leisten, freundlich zu sein. Allerdings verhielt er sich jedem gegenüber ziemlich anmaßend und von oben herab, der nicht zu seiner Klasse gehörte. Er behauptete sich ohne den geringsten Versuch einzulenken. Weder mochten ihn die Leute noch mochten sie ihn nicht; er gehörte einfach dazu, wie die Bergwerkshalde und Wragby selbst.
In Wirklichkeit jedoch war Clifford äußerst scheu und befangen, seit er gelähmt war. Er haßte es, irgend jemanden um sich zu haben außer seiner Dienerschaft. Denn er mußte in einem Rollstuhl sitzen oder in einer Art Krankensessel. Nichtsdestoweniger war er von seinen teuren Schneidern immer noch so sorgfältig gekleidet wie eh und je, und wie früher trug er erlesene Krawatten aus der Bond Street, und oberhalb sah er so elegant und imponierend aus wie immer. Er hatte nie zu den modernen «damenhaften» jungen Männern gehört: vielmehr hatte er etwas Bukolisches mit seinem geröteten Gesicht und den breiten Schultern. Aber seine sehr stille, zögernde Stimme und die Augen, kühn und erschrocken, sicher und unsicher zugleich, enthüllten seine eigentliche Natur. Die Art, wie er sich gab, war oftmals beleidigend hochmütig und dann wieder bescheiden und zurückhaltend, fast furchtsam.
Connie und er waren auf eine distanzierte, moderne Weise miteinander verbunden. Er war so sehr verwundet in seinem Innern – die ungeheure Erschütterung, verstümmelt zu sein–, daß er nicht mehr ungezwungen und lässig sein konnte. Er war ein versehrtes Wesen. Und deshalb hielt Connie leidenschaftlich zu ihm.
Trotzdem befremdete es sie, wie wenig Beziehung er eigentlich zu seinen Mitmenschen hatte. Die Grubenarbeiter waren doch in gewisser Weise seine Leute, aber er sah eher Objekte als Menschen in ihnen, eher Teile der Grube als Teile seines Lebens, eher grobschlächtige Erscheinungen als mit ihm existierende menschliche Wesen. Er hatte in mancher Hinsicht Angst vor ihnen; er konnte es nicht ertragen, daß sie ihn sahen, nun, da er gelähmt war. Und ihr merkwürdiges, ungeschlachtes Leben kam ihm ebenso unnatürlich vor wie das von Igeln. Er zeigte einen Anflug von Interesse – aber nur wie jemand, der durch ein Mikroskop hinunter- oder durch ein Teleskop hinaufsieht. Er hatte keine Fühlung mit ihnen. Er hatte mit niemandem Fühlung, außer – aus Tradition – mit Wragby und – durch das enge Band der Familiensolidarität – mit Emma. Darüber hinaus berührte ihn eigentlich nichts. Auch Connie fühlte, daß sie ihn nicht wirklich berührte. Vielleicht war nicht einmal etwas da, was zu berühren gewesen wäre. Eine Negierung jeden menschlichen Kontakts.
Doch er war vollkommen abhängig von ihr, er brauchte sie in jedem Augenblick. So groß und kräftig er auch war – er war hilflos. Er konnte sich in einem Rollstuhl voranbewegen, und er besaß eine Art Krankensessel mit einem Motor, in dem er langsam durch den Park tuckern konnte. Aber wurde er allein gelassen, so war er verloren. Er brauchte Connies Anwesenheit, damit sie ihm das Gefühl gab, daß er überhaupt noch existiere.
Und er war ehrgeizig. Er hatte angefangen, Geschichten zu schreiben – seltsame, sehr eigenwillige Geschichten über Menschen, die er kannte. Kluge, ziemlich boshafte und auf rätselhafte Weise doch bedeutungslose Geschichten. Sein Beobachtungsvermögen war ungewöhnlich und skurril. Aber die Teilnahme fehlte, der wirkliche Kontakt. Es war, als ob das Ganze in einem Vakuum stattfände. Und da das Leben sich heute weitgehend auf einer künstlich beleuchteten Bühne abspielt, standen die Geschichten in einem seltsam wahren Bezug zum modernen Leben und zur modernen Psychologie.
Clifford war geradezu krankhaft empfindlich, wenn es um diese Geschichten ging. Er erwartete, daß jeder sie gut fände, hervorragend, non plus ultra. Sie erschienen in den modernsten Zeitschriften und wurden, wie das so üblich ist, bald gepriesen, bald verrissen. Aber für Clifford glich jeder Verriß einer Marter, einem Messer, das sich in ihn bohrte. Es war, als habe er sein ganzes Sein in diese Geschichten gelegt. Connie half ihm, so gut sie es vermochte. Am Anfang fand sie es höchst aufregend. Er besprach alles mit ihr, wieder und wieder, eindringlich, gründlich, und sie mußte darauf eingehen, so gut sie nur konnte. Ihr war, als müßten ihre Seele und ihr Leib und ihr Geschlecht sich regen und in diese Geschichten eingehen. Das bewegte sie und nahm sie ganz gefangen.
Ihr gemeinsames physisches Leben war kaum der Rede wert. Sie mußte das Haus führen. Aber die Haushälterin hatte schon seit vielen Jahren Sir Geoffrey gedient, und die vertrocknete, ältliche, über alle Maßen korrekte Person – man konnte sie kaum als Stubenmädchen bezeichnen, schon gar nicht als Frau–, die bei Tisch aufwartete, war seit nunmehr vierzig Jahre im Hause. Sogar die Hausmädchen waren nicht mehr jung! Es war gräßlich! Was sollte man anders mit einem solchen Haus machen, als es seinem Zustand überlassen? All die endlosen Räume, die niemand je benutzte, all die mittelenglischen Tagesriten, die mechanische Sauberkeit, die mechanische Ordnung! Clifford hatte auf einer neuen Köchin bestanden, nämlich auf der erfahrenen Frau, die ihm in seiner Wohnung in London gedient hatte. Im übrigen schien mechanische Anarchie im Haus zu herrschen. Alles lief in tadelloser Ordnung ab, in peinlicher Reinlichkeit, in peinlicher Pünktlichkeit, sogar in peinlicher Redlichkeit. Und doch war es für Connie wie eine methodische Anarchie. Keine Gefühlswärme hielt es organisch zusammen. Das Haus war ebenso trübselig wie eine unbegangene Straße.
Was sollte sie anderes tun, als alles so lassen, wie es war? Und so ließ sie alles, wie es war. Manchmal kam Miss Chatterley, mit ihrem aristokratischen, hageren Gesicht, und stellte triumphierend fest, daß sich nichts geändert hatte. Sie würde Connie nie verzeihen, daß sie sie aus dem engen geistigen Bund mit dem Bruder vertrieben hatte. Ihr, Emma, kam es eigentlich zu, ihm bei diesen Geschichten, diesen Büchern zu helfen – den Chatterley-Geschichten, etwas ganz Neuem in der Welt, das sie, die Chatterleys, hervorgebracht hatten. Es gab keinen Maßstab für sie. Es gab keinen organischen Bezug zu früheren Gedanken- und Ausdrucksformen. Es gab nur dies eine, dies Neue in der Welt: die Chatterley-Bücher, etwas durch und durch Individuelles.
Als Connies Vater Wragby einen flüchtigen Besuch abstattete, sagte er im Vertrauen zu seiner Tochter: «Cliffords Schreibereien sind ja ganz nett, aber es steckt nichts dahinter. Sie werden keinen Bestand haben!…» Connie sah den stämmigen schottischen Ritter an, der sich sein Leben so gut eingerichtet hatte, und ihre Augen, ihre großen, noch immer verwunderten Augen trübten sich. Nichts dahinter! Was meinte er damit – nichts dahinter? Wenn die Rezensenten es lobten und Cliffords Name fast berühmt war und es sogar Geld einbrachte…, was konnte der Vater dann meinen, wenn er sagte, bei Cliffords Schreibereien stecke nichts dahinter? Was sollte denn sonst noch sein?
Denn Connie hatte sich auf den Standpunkt der Jungen gestellt: was der Augenblick gab, war alles. Und die Augenblicke folgten aufeinander, ohne notwendig zueinander zu gehören.
Ihr zweiter Winter auf Wragby ging ins Land, als der Vater zu ihr sagte: «Ich hoffe, Connie, du paßt auf, daß die Umstände hier dich nicht zur demi-vierge machen.»
«Zur demi-vierge», wiederholte Connie ungewiß. «Wieso? Wieso nicht?»
«Es sei denn, du magst das, natürlich», setzte der Vater hastig hinzu. Clifford sagte er dasselbe, als die beiden Männer unter sich waren: «Ich fürchte, es paßt nicht ganz zu Connie, eine demi-vierge zu sein.»
«Eine Halb-Jungfrau!» Clifford übersetzte sich den Ausdruck, um sicherzugehen. Einen Augenblick lang überlegte er, dann wurde er dunkelrot. Er war zornig und gekränkt.
«In welcher Hinsicht paßt es nicht zu ihr?» fragte er förmlich.
«Sie wird mager… eckig. Das steht ihr nicht. Sie ist nicht so ein Hering, so eine halbe Portion, sie ist eine feine schottische Forelle.»
«Ohne die Flecken natürlich», sagte Clifford.
Er wollte später mit Connie über die Sache mit der demi-vierge sprechen, über ihren halbjungfräulichen Zustand. Aber er konnte es nicht über sich bringen. Er war ihr zu nahe und doch nicht nahe genug. Er war so sehr eins mit ihr, in seinem Geist und in ihrem; aber körperlich existierten sie nicht füreinander, und keiner von ihnen konnte es ertragen, wenn das corpus delicti erwähnt wurde. Sie waren so intim miteinander und doch ganz ohne Kontakt.
Connie jedoch erriet, daß ihr Vater etwas gesagt hatte und daß Clifford etwas in seinen Gedanken bewegte. Sie wußte, es war ihm einerlei, ob sie demi-vierge war oder demi-monde, solange er es nicht mit absoluter Sicherheit wußte oder darauf hingewiesen wurde. Was das Auge nicht sieht und der Kopf nicht weiß, das existiert nicht.
Connie und Clifford wohnten nun seit fast zwei Jahren auf Wragby, führten ihr verschwommenes Leben und gingen auf in Clifford und seiner Arbeit. Beider Interessen hatten nie aufgehört, in seinem Werk zusammenzufließen. Sie sprachen miteinander und kämpften sich durch die Wehen der Gestaltung und glaubten, daß etwas geschähe, etwas Wirkliches geschähe, etwas Wirkliches in der Leere.
Und insofern war es ein Leben in der Leere. Im übrigen war es Nichtdasein. Wragby war da, die Diener… aber sie waren nur Phantome, existierten nicht wirklich. Connie machte Spaziergänge durch den Park und durch die Wälder, die an den Park grenzten, und genoß die Einsamkeit und das Geheimnis, stieß die braunen Blätter des Herbstes fort und pflückte die Schlüsselblumen des Frühlings. Aber alles war ein Traum; oder richtiger, es war wie das Scheinbild der Wirklichkeit. Die Eichenblätter waren für sie Eichenblätter, die in einem Spiegel rascheln, sie selber eine Gestalt, über die irgend jemand gelesen hatte, sie pflückte Schlüsselblumen, die nur Schatten waren oder Erinnerungen oder Worte. Nichts hatte Substanz – weder sie noch irgend etwas… keine Fühlung, keine Nähe. Nur dies Leben mit Clifford, dies endlose Spinnen von Geweben aus Worten und kleinen Einzelheiten des Bewußtseins – diese Geschichten, von denen Sir Malcolm gesagt hatte, daß nichts dahinterstecke und daß sie keinen Bestand haben würden. Warum sollte etwas dahinterstecken, warum sollten sie Bestand haben? Der Tag hat genug an seiner Mühsal. Der Augenblick hat genug am Schein der Wirklichkeit.
Clifford hatte ziemlich viele Freunde – eigentlich nur Bekannte – und lud sie nach Wragby ein. Er bat alle möglichen Leute zu sich, Rezensenten und Schriftsteller– Leute, die dazu dienen konnten, seine Bücher zu rühmen. Und sie fühlten sich geschmeichelt, daß sie eingeladen wurden, nach Wragby zu kommen, und sie rühmten. Connie durchschaute das alles sehr wohl. Aber warum nicht? Es gehörte zu den vergänglichen Bildern im Spiegel. Was war denn dabei? Sie war diesen Leuten – größtenteils Männern – eine gute Gastgeberin. Sie war auch Cliffords gelegentlich auftauchenden aristokratischen Verwandten eine gute Gastgeberin. Sie war ein zärtliches, rotwangiges, ländliches Mädchen, das zu Sommersprossen neigte, sie hatte große blaue Augen und braune Locken und eine weiche Stimme und ziemlich starke weibliche Hüften und wurde aus all diesen Gründen für ein wenig altmodisch und zu «fraulich» gehalten. Sie war nicht «so ein kleiner Hering», war nicht wie ein Junge. Kurz, sie war zu weiblich, um wirklich «modern» zu sein.
Und so waren die Männer, besonders alle, die nicht mehr ganz jung waren, ausgesprochen reizend zu ihr. Aber da sie wußte, welche Qual es für den armen Clifford bedeutete, wenn er auch nur das leiseste Anzeichen eines Flirts verspürte, der von ihr ausging, ermutigte sie niemanden. Sie war still und zerstreut, sie hatte keinen Kontakt mit ihnen und wollte auch keinen haben. Clifford war über die Maßen stolz auf sich.
Seine Verwandten waren sehr freundlich zu ihr. Sie wußte, daß diese Freundlichkeit einem Mangel an Furcht entsprang und daß diese Menschen keine Achtung empfanden, wenn man sie nicht ein wenig einschüchterte. Aber auch mit ihnen hatte sie keinen Kontakt. Sie ließ ihnen ihre freundliche Geringschätzigkeit, ließ ihnen das Gefühl, daß es nicht nötig sei, auf der Lauer zu liegen. Es gab kein Band zwischen ihnen.
Die Zeit ging dahin. Was auch immer geschah – es geschah nichts, weil sie so angenehm jenseits allen Kontaktes war. Sie und Clifford lebten in gemeinsamen Gedanken und in seinen Büchern. Sie unterhielt sich… es waren immer Menschen im Haus. Die Zeit lief ab wie eine Uhr: halb acht und nicht mehr halb sieben.
DRITTES KAPITEL
Allmählich wurde sich Connie einer zunehmenden Unrast bewußt. Ihre Beziehungslosigkeit war die Quelle einer Unruhe, die sich wie ein Wahnsinn ihrer bemächtigte. Es zuckte in ihren Gliedern, wenn sie nicht wollte, daß es in ihnen zuckte; es riß sie hoch, wenn sie nicht wollte, daß es sie hochriß, sondern wenn sie lieber still dagesessen hätte. Es durchschauerte ihren Leib, ihren Schoß, bis sie meinte, ins Wasser springen zu müssen und zu schwimmen, um diesem «Es» zu entkommen. Eine wahnwitzige Ruhelosigkeit. Ihr Herz schlug wild, ohne Grund. Und sie wurde dünner.
Es war nur die Ruhelosigkeit. Sie rannte dann in den Park hinaus, ließ Clifford allein, warf sich flach ins Farnkraut. Weg vom Haus… sie mußte weg vom Haus und von allen. Der Wald war ihre einzige Zuflucht, ihre Freistatt.
Doch er war keine wirkliche Zuflucht für sie, keine Freistatt, denn sie hatte keine Beziehung zu ihm. Er war nur ein Ort, wo sie sicher war vor allem andern. Nie rührte sie wirklich an die Seele des Waldes… wenn er überhaupt etwas so Unsinniges besaß.
Undeutlich wußte sie, daß sie allmählich verfiel. Undeutlich wußte sie, daß sie ohne jede Bindung war, daß sie jede Beziehung zur wirklichen, lebendigen Welt verloren hatte. Nur Clifford und seine Bücher, die keinen Bestand hatten… hinter denen nichts steckte! Leere zu Leere. Undeutlich wußte sie das. Aber es war, als schlüge sie mit dem Kopf gegen eine Wand.
Der Vater warnte sie wieder: «Warum legst du dir keinen jungen Mann zu, Connie? Das ist das einzig Richtige für dich.»
In diesem Winter kam Michaelis auf ein paar Tage zu Besuch. Er war ein junger Ire, der mit seinen Stücken in Amerika ein beträchtliches Vermögen eingeheimst hatte. Eine Zeitlang war er von der smarten Londoner Gesellschaft überschwenglich gefeiert worden, denn er verfaßte smarte Gesellschaftsstücke. Dann ging der smarten Gesellschaft nach und nach auf, daß sie von einem lausigen Dubliner Gassenjungen lächerlich gemacht worden war, und der Wind drehte sich. Michaelis wurde zum Inbegriff all dessen, was schmutzig und plebejisch war. Er wurde als anti-englisch entlarvt, und in den Augen der Gesellschaftsklasse, die diese Entdeckung machte, war das schlimmer als das niederträchtigste Verbrechen. Er wurde verurteilt und seine Leiche in die Mülltonne geworfen.
Dessenungeachtet hatte Michaelis seine Apartment-Wohnung in Mayfair und erging sich auf der Bond Street – jeder Zoll ein Gentleman: man kann nämlich auch die besten Schneider nicht dazu kriegen, von der Gesellschaft boykottierte Kunden zu ignorieren, wenn diese Kunden zahlen.
Clifford lud den jungen, dreißigjährigen Mann in einem Augenblick ein, der für die weitere Karriere dieses jungen Mannes wenig Gutes verhieß. Doch das hinderte Clifford nicht. Michaelis hatte vermutlich Zugang zu ein paar Millionen Menschen; er war ein hoffnungsloser Außenseiter und würde es zweifellos zu schätzen wissen, zu diesem Zeitpunkt nach Wragby eingeladen zu werden, da die übrige große Welt ihn schnitt. Er würde dankbar sein und Clifford aus Dankbarkeit drüben in Amerika ohne Zweifel «gut» tun. Ruhm! Man erwirbt sich eine Menge Ruhm – was immer das sein mag–, wenn man in der richtigen Weise über sich reden läßt, besonders «dort drüben». Clifford war im Kommen. Und es war beachtlich, was für einen sicheren Propaganda-Instinkt er hatte. Michaelis porträtierte ihn schließlich aufs nobelste in einem Stück, und Clifford wurde so etwas wie ein volkstümlicher Held. Bis dann der Rückschlag kam, als er merkte, daß er lächerlich gemacht worden war.
Connie wunderte sich ein bißchen über Cliffords blinden, anmaßenden Trieb, bekannt zu werden: bekannt zu werden in der unermeßlichen, amorphen Welt, die er selbst gar nicht kannte und die ihm Unbehagen und Angst einflößte; bekannt zu werden als ein Schriftsteller, als ein erstklassiger moderner Schriftsteller. Connie wußte vom alten, erfolgreichen, kernigen, verschmitzten Sir Malcolm, daß Künstler Reklame für sich machen und sich mühen, ihre Ware an den Mann zu bringen. Aber ihr Vater bediente sich dabei schon ausgetretener Wege– Wege, die auch von den anderen Mitgliedern der Königlichen Akademie begangen wurden, wenn sie ihre Bilder verkaufen wollten. Clifford dagegen entdeckte neue Wege der Propaganda – die verschiedensten. Er lud alle möglichen Leute zu sich nach Wragby ein, ohne daß er sich eigentlich etwas dabei vergeben hätte. Er war entschlossen, sich rasch ein Monument an Reputation zu errichten, und verwendete jedes verfügbare Steinchen zum Bau.
Michaelis kam pünktlich an, in einem sehr respektablen Wagen, mit Chauffeur und Diener. Er war ganz Bond Street! Aber bei seinem Anblick wich in Cliffords ländlichem Gemüt irgend etwas zurück. Er war nicht so recht… nicht so recht… also, er war überhaupt nicht… nun, das, worauf er mit seinem Äußeren abzielte. Für Clifford war das entscheidend und genug. Doch er war sehr höflich zu dem Mann, zu seinem erstaunlichen Erfolg. Die Hundsgöttin Erfolg – so nennt man sie – strich knurrend und schützend um die Beine des halb ergebenen, halb auftrumpfenden Michaelis und schüchterte Clifford vollkommen ein: denn er wollte sich der Hundsgöttin Erfolg liebend gern selber anbieten, wenn sie ihn nur nähme.
Michaelis war offensichtlich kein Engländer, trotz all der Schneider, Friseure, Hut- und Schuhmacher des besten Londoner Viertels. Nein, nein, er war offensichtlich kein Engländer: sein abgeflachtes, blasses Gesicht und seine Haltung und sein Groll waren von der falschen Art! Zwar verfügte er über Groll und Mißgunst – wie jeder echte englische Gentleman sehen konnte, der sich aber schämen würde, so etwas in seinem Betragen laut werden zu lassen! Der arme Michaelis hatte viele Fußtritte bekommen und sah sogar jetzt noch ein bißchen aus wie ein Hund, der mit eingeklemmtem Schwanz umherläuft. Er hatte sich mit seinen Stücken durch schieren Instinkt und schiere Frechheit einen Weg auf die Bühne und an die Rampe gebahnt. Er hatte die Leute für sich eingenommen. Und er hatte gedacht, die Zeit der Fußtritte sei vorüber. Doch sie war nicht vorüber, leider… Sie würde es nie sein. Denn er forderte in gewisser Weise dazu heraus, getreten zu werden. Er verzehrte sich danach, dort zu sein, wohin er nicht gehörte: in der englischen Oberschicht. Und was für einen Spaß es ihnen machte, ihn zu treten! Und wie er sie haßte!
Und trotz alldem reiste er mit seinem Diener und seinem sehr respektablen Wagen, dieser Dubliner Bastard!
Irgend etwas war an ihm, das Connie gefiel. Er machte sich nichts vor, er hatte keine Illusionen über sich. Er unterhielt sich mit Clifford vernünftig, bündig, praktisch über alles, was Clifford wissen wollte. Er machte sich nicht breit, ließ sich nicht gehen. Er wußte, man hatte ihn nach Wragby eingeladen, weil er ausgenutzt werden sollte, und wie ein alter, gewiegter, nahezu indifferenter Geschäftsmann – oder wie ein großer Geschäftsmann – ließ er sich fragen und antwortete mit so wenig Gefühlsaufwand wie möglich.
«Geld!» sagte er. «Geld ist eine Art Instinkt. Geld zu machen ist eine Art Naturveranlagung im Menschen. Es ist nichts, wozu man selber etwas beiträgt. Kein Trick, den man anwendet. Es ist eine Art permanenter Zufall der eigenen Natur. Wenn man einmal angefangen hat, bleibt man dabei, Geld zu machen; bis zu einem bestimmten Punkt, nehme ich an.»
«Aber man muß eben anfangen», sagte Clifford.
«Natürlich. Man muß hineinkommen. Man kann nichts machen, wenn man draußen bleibt. Man muß sich den Zugang erzwingen. Wenn man das einmal geschafft hat, geht es immer so weiter.»
«Aber hätten Sie auch anders, außer durch Stücke, Geld verdienen können?» fragte Clifford.
«Oh, wahrscheinlich nein! Ich mag ein guter Schriftsteller sein, ich mag ein schlechter sein – auf jeden Fall aber bin ich Schriftsteller, Bühnenschriftsteller. Das steht außer Frage.»
«Und Sie glauben, daß Sie eben ein Verfasser populärer Stücke sein müssen?» fragte Connie.
«Genau das!» rief er und wandte sich ihr in einer jähen Wendung zu. «Es steckt nichts dahinter! Es ist nichts dran an der Popularität. Und wenn wir davon sprechen, auch nicht am Publikum. Im Grunde ist in meinen Stücken nichts, was sie populär machen könnte. Das ist es nicht. Sie sind eben, wie das Wetter – so, wie es sein muß – für den Augenblick jedenfalls.»
Er wandte Connie seine langsamen großen Augen zu, die in unauslotbarer Ernüchterung ertrunken waren, und sie zitterte ein wenig. Er schien so alt, so unermeßlich alt, schien aus lauter Schichten von Desillusionen zu bestehen, die sich in ihm, Generation auf Generation, übereinandergelagert hatten wie geologische Strata. Und zugleich war er hilflos wie ein Kind. Ein Ausgestoßener in gewissem Sinn; aber mit dem verzweifelten Mut seines Ratten-Daseins.
«Jedenfalls ist es großartig, was Sie in Ihrem Leben schon alles erreicht haben», sagte Clifford nachdenklich.
«Ich bin dreißig… ja, ich bin dreißig!» antwortete Michaelis scharf und jäh, und er lachte dabei auf eine sonderbare Weise: hohl, triumphierend und bitter.
«Und Sie sind allein?» fragte Connie.
«Wie meinen Sie das? Ob ich allein lebe? Ich habe meinen Diener. Er ist Grieche – so sagt er wenigstens – und ziemlich unzulänglich. Aber ich behalte ihn. Und ich will heiraten. O ja, ich muß heiraten.»
«Das klingt, als wollten Sie sich die Mandeln kappen lassen», lachte Connie. «Kostet es denn so viel Überwindung?»
Er sah sie bewundernd an. «Ach, wissen Sie, Lady Chatterley, in gewisser Hinsicht ja. Ich glaube… verzeihen Sie… ich glaube, ich bin nicht imstande, eine Engländerin zu heiraten, nicht einmal eine Irin…»
«Versuchen Sie es mit einer Amerikanerin», warf Clifford ein.
«Oh, die Amerikanerinnen!» Er lachte hohl. «Nein, ich habe meinen Diener gebeten, mir eine Türkin zu beschaffen oder so etwas… eine, die dem Orientalischen näher kommt.»
Connie war ehrlich erstaunt über dies merkwürdige, melancholische Produkt sensationellen Erfolgs. Es hieß, daß er allein aus Amerika ein Einkommen von fünfzigtausend Dollar bezöge. Zuweilen sah er sehr gut aus: wenn er seitlich nach unten sah und das Licht auf ihn fiel, hatte er die stille, ewige Schönheit einer elfenbeingeschnitzten Negermaske, mit seinen sehr großen Augen und den breiten, seltsam gewölbten Brauen und dem reglos zusammengepreßten Mund – diese flüchtige, doch deutlich sichtbare Reglosigkeit, eine Reglosigkeit, eine Zeitlosigkeit, wie Buddha sie anstrebt und wie Neger sie manchmal an sich haben, ohne sie je anzustreben; etwas sehr, sehr Altes, ein Sichfügen in die Rasse. Äonen des Sichfügens ins Rassenschicksal statt unseres individuellen Widerstandes. Und dann ein Hindurchschwimmen – wie Ratten, die einen dunklen Fluß durchqueren. Connie fühlte eine jähe seltsame Welle der Zuneigung für ihn – eine Welle, in der sich Mitleid und Widerwille mischten und die sich fast zu Liebe steigerte. Der Außenseiter! Der Außenseiter! Und sie nannten ihn einen Proleten! Wieviel gewöhnlicher und anmaßender sah Clifford aus! Wieviel törichter!
Michaelis wußte sofort, daß er Eindruck auf sie gemacht hatte. Er wandte ihr seine großen nußbraunen, leicht vorstehenden Augen zu und sah sie gänzlich unbeteiligt an. Er taxierte sie – sie und das Ausmaß des Eindrucks, den er gemacht hatte. Es gab kein Mittel dagegen, daß er unter Engländern der ewige Außenseiter blieb, nicht einmal Liebe half. Aber Frauen vernarrten sich zuweilen in ihn… auch Engländerinnen.
Er wußte sofort, woran er mit Clifford war. Sie waren zwei einander fremde Hunde, denen danach zumute war, sich anzuknurren, die statt dessen notgedrungen mit dem Schwanz wedelten. Aber bei der Frau war er nicht ganz so sicher.
Das Frühstück wurde ihnen in die Schlafzimmer gebracht; Clifford erschien niemals vor dem Lunch, und das Eßzimmer war ein wenig trübselig. Nach dem Morgenkaffee wußte Michaelis, die rastlose, unstete Seele, nicht, was er tun sollte. Es war ein schöner Novembertag… schön für Wragby. Er sah auf den melancholischen Park hinaus. Mein Gott, was für ein Ort!
Er schickte ein Mädchen mit der Frage, ob er Lady Chatterley irgendwie zu Diensten sein könne, er habe nämlich vor, nach Sheffield zu fahren. Er bekam zur Antwort, ob er Lust hätte, zu Lady Chatterley hinauf ins Wohnzimmer zu kommen.
Connie hatte ein eigenes Wohnzimmer auf der dritten Etage, dem obersten Stockwerk im Mittelteil des Hauses. Cliffords Zimmer lagen natürlich im Parterre. Michaelis fühlte sich geschmeichelt, in Lady Chatterleys Salon hinaufgebeten zu werden. Achtlos folgte er dem Mädchen… er nahm niemals Notiz von den Dingen um ihn, hatte niemals Kontakt mit seiner Umgebung. Zerstreut ließ er in ihrem Zimmer den Blick über die schönen deutschen Reproduktionen von Renoir und Cézanne gleiten.
«Sie haben es sehr hübsch hier oben», sagte er, lächelte dabei auf seine sonderbare Art – als schmerze es ihn zu lächeln – und entblößte die Zähne. «Sie haben gut daran getan, sich hier oben einzurichten.»
«Ja, ich finde auch», erwiderte sie.
Ihr Zimmer war der einzige heitere, moderne Raum im Haus, der einzige Ort auf Wragby, wo ihre Persönlichkeit überhaupt zur Geltung kam. Clifford hatte es nie gesehen, und sie bat sehr wenig Menschen herauf.
Michaelis und sie saßen am Feuer einander gegenüber und unterhielten sich. Sie fragte nach ihm, nach seiner Mutter, seinem Vater, seinen Geschwistern… Andere Menschen waren immer so etwas wie ein Wunder für sie, und wenn ihre Zuneigung einmal erwacht war, vergaß sie jeglichen Standesdünkel. Michaelis sprach vorbehaltlos von sich selbst, ganz vorbehaltlos, ohne Künstelei, legte einfach seine verbitterte, gleichgültige Straßenköter-Seele bloß, und dann glomm ein Funke rachsüchtigen Stolzes auf seinen Erfolg auf.
«Warum sind Sie eigentlich solch ein einsamer Vogel?» fragte Connie ihn; und wieder sah er sie an, mit seinem großen, forschenden nußbraunen Blick.
«Manche Vögel sind eben so», entgegnete er. Und dann, mit einem Anflug vertraulicher Ironie: «Aber sagen Sie, wie steht es mit Ihnen selbst? Sind Sie denn nicht auch ein einsamer Vogel?» Connie war ein wenig bestürzt und dachte ein paar Augenblicke darüber nach. Dann sagte sie: «Nur in gewisser Weise. Nicht ganz und gar, wie Sie!»
«Bin ich ganz und gar ein einsamer Vogel?» fragte er und grinste dabei auf seine merkwürdige Art, wie wenn er Zahnschmerzen habe; er grinste so verzerrt, und seine Augen blieben unverändert melancholisch oder gelassen oder desillusioniert oder ängstlich.
«Nein?» fragte sie ein wenig atemlos und sah ihn an. «Finden Sie nicht, daß Sie es sind?»
Sie spürte ein reißendes Verlangen von ihm zu ihr hinüberfluten, das ihr fast den Boden unter den Füßen wegriß.
«Oh, Sie haben ganz recht!» sagte er und wandte den Kopf ab, drehte ihn zur Seite und sah nach unten und hatte wieder die seltsame Unbeweglichkeit einer alten Rasse, die es in unserer Zeit kaum noch gibt. Und dies nahm Connie vollends die Kraft, ihn objektiv zu betrachten.
Er hob die Augen zu ihr auf, richtete seinen vollen Blick auf sie, der alles erfaßte, alles aufnahm. Und zugleich schrie das Kind, das in der Nacht weint, aus seiner Brust zu ihr – so stark, daß es sie im innersten Schoß traf.
«Es ist schrecklich nett von Ihnen, daß Sie sich Gedanken über mich machen», sagte er lakonisch.
«Warum sollte ich mir nicht Gedanken über Sie machen?» ereiferte sie sich und hatte kaum genügend Atem, es auszusprechen.
Er stieß sein verzerrtes, schnelles, zischendes Lachen aus.
«Oh, aber auf diese Art!… Darf ich einen Augenblick Ihre Hand haben?» fragte er unvermittelt und heftete mit nahezu hypnotischer Kraft seine Augen auf sie, und ein Verlangen ging von ihm aus, das sie direkt in den Schoß traf.
Sie starrte ihn an, betäubt und gebannt, und er kam zu ihr und kniete neben ihr nieder und nahm ihre beiden Füße fest in seine beiden Hände und vergrub das Gesicht in ihrem Schoß und verharrte reglos. Sie war völlig empfindungslos und betäubt, sah erstaunt auf die sehr sanfte Wölbung seines Nackens nieder, fühlte, wie sein Gesicht sich an sie preßte. Sie konnte nicht anders, sie mußte trotz all ihrer brennenden Bestürzung die Hand auf die schutzlose Wölbung seines Nackens legen, zärtlich und voll Mitleid, und er zitterte, und ein tiefer Schauer durchrann ihn.
Dann sah er sie an, mit diesem furchtbaren Verlangen in den großen, glühenden Augen. Sie war vollkommen unfähig, sich ihm zu widersetzen. Aus ihrer Brust flutete die Antwort ungeheurer Sehnsucht zu ihm hin. Sie mußte ihm alles geben, alles.
Er war ein seltsamer und sehr sanfter Liebhaber, war sehr sanft mit der Frau, zitterte unbeherrscht und war doch ganz unbeteiligt, nahm alles wahr, nahm jeden Laut draußen wahr.
Für sie bedeutete es nichts, außer, daß sie sich ihm hingab. Und schließlich hörte er auf zu zittern und lag ganz still, ganz still. Mit tauben, mitleidigen Fingern strich sie über seinen Kopf, der auf ihrer Brust lag.
Als er sich erhob, küßte er ihr beide Hände, dann beide Füße in den wildledernen Slippern und ging schweigend zur anderen Ecke des Zimmers hinüber; den Rücken ihr zugekehrt, blieb er dort stehen. Minutenlanges Schweigen. Dann drehte er sich um und kam wieder zu ihr; sie saß jetzt an ihrem alten Platz am Feuer.
«Vermutlich werden Sie mich jetzt hassen», sagte er ruhig, entschieden. Sie warf ihm einen schnellen Blick zu.
«Warum sollte ich?» fragte sie.
«Die meisten tun es», erwiderte er; aber faßte sich schnell: «Ich meine… man denkt, daß es so ist bei Frauen.»
«Dies ist doch wohl nicht so recht der Augenblick, Sie zu hassen», sagte sie verstimmt.
«Ich weiß, ich weiß! So sollte es sein! Sie sind wahnsinnig gut zu mir…» Er jammerte erbarmungswürdig.
Sie fragte sich, warum er in so jämmerlicher Verfassung war. «Wollen Sie sich nicht wieder setzen?» fragte sie. Er sah zur Tür.
«Sir Clifford», fing er an, «wird er… wird er nicht…»
Sie schwieg einen Augenblick und dachte nach. «Vielleicht», sagte sie dann und sah zu ihm auf. «Ich will, daß Clifford nichts erfährt – auch nicht einen Verdacht bekommt. Es würde ihn so sehr verletzen. Aber ich glaube nicht, daß es unrecht war, oder doch?»
«Unrecht! Guter Gott, nein! Sie sind nur so unendlich gut zu mir… ich kann es kaum ertragen.»
Er wandte sich ab, und sie sah, daß er im nächsten Augenblick anfangen würde zu schluchzen.
«Aber wir brauchen es Clifford nicht wissen zu lassen, nicht?» flehte sie. «Es würde ihn so verletzen! Und wenn er es niemals erfährt, niemals Verdacht schöpft, verletzt es niemanden.»
«Von mir», sagte er grimmig, «von mir wird er nichts erfahren. Sie können ganz ruhig sein. Mich selbst verraten! Hahaha!» Er lachte hohl und zynisch bei dieser Vorstellung. Verwundert sah sie ihn an. «Darf ich Ihre Hand küssen und gehen? Ich denke, ich werde nach Sheffield fahren und dort den Lunch nehmen, wenn ich darf, und zum Tee zurück sein. Kann ich irgend etwas für Sie tun? Und kann ich sicher sein, daß Sie mich nicht hassen – und nicht hassen werden?» Mit einem verzweifelten Ton brach er ab.
«Nein, ich hasse Sie nicht», sagte sie. «Ich glaube, Sie sind nett.»
«Ah!» rief er ungestüm. «Wie gut, daß Sie mir das sagen und nicht, daß Sie mich lieben! Es bedeutet so viel mehr… Bis zum Nachmittag also. Ich habe bis dahin eine Menge zu bedenken.» Er küßte ihr demütig die Hand und ging.
«Ich glaube nicht, daß ich diesen jungen Mann ertragen kann», sagte Clifford beim Lunch.
«Warum nicht?» fragte Connie.
«Er ist so ein Ehrgeizling unter seinem schönen Anstrich… wartet nur darauf, uns auszustechen.»
«Ich glaube, man hat ihn ziemlich schlecht behandelt», entgegnete Connie.
«Wundert dich das? Und glaubst du etwa, er setzt seine goldenen Stunden daran, Werke der Güte zu vollbringen?»
«Ich finde, er hat einen gewissen Großmut.»
«Gegen wen?»
«Ich weiß nicht genau.»
«Natürlich nicht. Ich fürchte, du hältst Skrupellosigkeit für Großmut!»
Connie schwieg. Hatte er recht? Es war gut möglich. Doch die Skrupellosigkeit von Michaelis hatte einen gewissen Reiz für sie. Er legte weite Strecken zurück, wo Clifford nur ein paar schüchterne Schritte machte. Auf seine Weise hatte er die Welt bezwungen – und das war es, was Clifford wollte. Mittel und Wege…? Waren die von Michaelis verächtlicher als die Cliffords? War die Art, wie der arme Außenseiter sich seinen Pfad getrampelt und gehauen hatte – nur auf sich selbst gestellt und auf Hintertüren angewiesen–, nichtswürdiger als Cliffords Methode, der sich durch Selbstpropaganda zum Ruhm aufschwingen wollte? Die Hundsgöttin Erfolg wurde von Tausenden hechelnder Hunde mit triefenden Mäulern verfolgt. Wer sie als erster einholte war der wahre Hund unter den Hunden, wenn man nach dem Erfolg gehen will. Michaelis konnte also den Kopf hoch tragen.
Das Merkwürdige war: er tat es nicht. Zur Teestunde kam er zurück, mit einem Arm voll Veilchen und Lilien und der gewohnten Arme-Sünder-Miene. Connie überlegte sich zuweilen, ob das vielleicht so etwas wie eine Maske sei, um jeglichen Widerstand von vornherein zu entwaffnen – so aufgesetzt wirkte dies Gesicht. Oder war er tatsächlich so ein armer Hund?
Diesen Arme-Hunde-Ausdruck eines selbstzerstörerischen Wesens behielt er den ganzen Abend bei, wenn Clifford auch darunter die eigentliche Unverschämtheit spürte. Connie spürte sie nicht – vielleicht, weil sie nicht gegen Frauen gerichtet war, sondern nur gegen Männer, gegen ihre Anmaßungen und Überheblichkeiten. Die unausrottbare, tiefe Unverschämtheit dieses hageren Burschen – das war es, was die Männer so aufbrachte gegen Michaelis. Allein seine Anwesenheit war eine Herausforderung für einen Mann der Gesellschaft, wie sehr Michaelis sie auch in angenommene gute Manieren kleiden konnte.
Connie war verliebt in ihn, aber sie brachte es fertig, mit ihrer Stickarbeit dazusitzen, die Männer reden zu lassen und sich nicht zu verraten. Michaelis benahm sich vollendet: er blieb derselbe melancholische, höfliche, abgekapselte junge Mann vom Abend vorher. Er war von seinen Gastgebern unvorstellbar weit entfernt, wortkarg ging er auf sie ein, so wie sie es wollten, doch keinen Augenblick trat er aus sich heraus. Connie dachte, er müsse den Morgen vergessen haben. Aber er hatte ihn nicht vergessen. Er wußte nur, wo er stand… draußen, auf dem nämlichen Platz – da, wo die geborenen Außenseiter stehen. Im Grunde bedeutete ihm körperliche Liebe nicht viel. Er wußte, sie würde aus ihm, einem herrenlosen Hund, den jeder um sein goldenes Halsband beneidet, keinen netten Gesellschaftshund machen.
Entscheidend blieb, daß er auf dem Grund seiner Seele wirklich ein Außenseiter, daß er wirklich antisozial war und diese Tatsache innerlich hinnahm, einerlei, wie sehr er nach außen hin auch nach Bond Street aussah. Seine Isolation war eine Lebensnotwendigkeit für ihn; ebenso, wie der Anschein der Zugehörigkeit zur vornehmen Welt eine Lebensnotwendigkeit war.
Aber gelegentliche Liebe, als Trost und Linderung, war durchaus etwas Gutes, und er war nicht undankbar. Im Gegenteil: er war verzehrend, glühend dankbar für ein bißchen natürliche, spontane Güte – fast bis zu Tränen dankbar. Unter seiner blassen, unbeweglichen, desillusionierten Oberfläche schluchzte seine Kinderseele voll Dankbarkeit der Frau entgegen, und er brannte darauf, wieder zu ihr zu kommen; und in seinem Innern, in seiner Ausgestoßenenseele, wußte er, daß er ganz frei bleiben würde von ihr.
Als sie in der Halle die Kerzen anzündeten, fand er Gelegenheit, mit ihr zu sprechen:
«Kann ich kommen?»
«Ich komme zu Ihnen», sagte sie.
«Oh, gut!»
Er wartete sehr lange auf sie… aber sie kam.