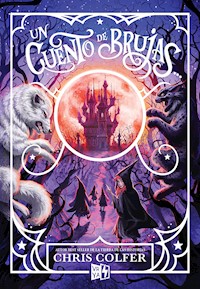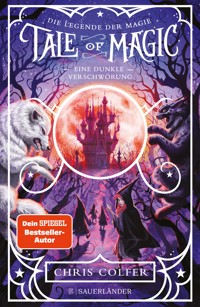12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Land of Stories
- Sprache: Deutsch
Die ganze Wahrheit über Dornröschen, Schneewittchen & Co: Chris Colfers große internationale Bestsellerserie! Alex' und Conners drittes Abenteuer im Land der Märchen stößt sie auf eine jahrhundertealte Botschaft, die von niemand anderem als den Brüdern Grimm persönlich stammt. Dahinter verbirgt sich ein großes Rätsel, das sie lösen müssen, um das Märchenland vor dem Untergang zu bewahren lassen – und die das das Leben der Geschwister für immer verändern wird … "Ein Muss für Märchenfans!" (Hannoversche Allgemeine) Serie bei Antolin gelistet. Weitere Reihen von Chris Colfer: - »Roswell Johnson rettet die Welt« - »Land of Stories« (6 Bände) - »Tale of Magic« (3 Bände)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Chris Colfer
Land of Stories – Das magische Land
Eine düstere Warnung
Über dieses Buch
Die ganze Wahrheit über Dornröschen, Schneewittchen & Co: Chris Colfers große internationale Bestsellerserie!
Alex' und Conners drittes Abenteuer im Land der Märchen stößt sie auf eine jahrhundertealte Botschaft, die von niemand anderem als den Brüdern Grimm persönlich stammt. Dahinter verbirgt sich ein großes Rätsel, das sie lösen müssen, um das Märchenland vor dem Untergang zu bewahren lassen – und die das das Leben der Geschwister für immer verändern wird …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Chris Colfer ist Schauspieler und Autor. Bekannt wurde er vor allem durch die Rolle des Kurt Hummel in »Glee«, für die er unter anderem 2011 mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet wurde. Alle »Land of Stories«-Bände erschienen auf der New York Times-Bestsellerliste.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Karte]
[Widmung]
[Motto]
Prolog Gäste der Grande Armée
Kapitel 1 Eine einmalige Gelegenheit
Kapitel 2 Die Halle der Träume
Kapitel 3 Die Bücherkuschlerinnen
Kapitel 4 Eine Hochzeit in den Wäldern
Kapitel 5 Friedhofserkenntnisse
Kapitel 6 Königin Rotkäppchens Kammer des Fortschritts
Kapitel 7 Strohrascheln bei Suse
Kapitel 8 Der Einführungsball der Feen
Kapitel 9 Alleingang
Kapitel 10 Der Löwe vom Südufer
Kapitel 11 Das Lumière des Étoiles
Kapitel 12 Die Geheimnisse von Schloss Neuschwanstein
Kapitel 13 Die abgesetzte Königin
Kapitel 14 Die Armee fällt ein
Kapitel 15 Ein bittersüßes Wiedersehen
Kapitel 16 Der Maskenmann aus dem Pinocchio-Kittchen
Kapitel 17 Die einzige Zeugin
Kapitel 18 Die Schwanenboten
Kapitel 19 Ein eisiger Handel
Kapitel 20 Der große Troboldsee
Kapitel 21 Aus der Asche
Kapitel 22 Bis auf den Grund
Kapitel 23 Das Reich der Elfen
Kapitel 24 Die vergessene Armee
Kapitel 25 Die heilenden Flammen von Hagettas Feuer
Kapitel 26 Drachenfütterung
Kapitel 27 Das Zeichen am Himmel
Kapitel 28 Die Schlacht um das Königreich der Feen
Kapitel 29 Der Drache erwacht
Kapitel 30 Zurück zur Magie
Kapitel 31 Die Enthüllung
Danksagung
Für J.K. Rowling, C.S. Lewis, Roald Dahl, Eva Ibbotson, L. Frank Baum, James M. Barrie, Lewis Carroll und all die anderen außergewöhnlichen Schriftsteller, die die Welt gelehrt haben, an Magie zu glauben.
Wenn ich daran zurückdenke, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, Kleiderschränke nach geheimen Türen zu durchstöbern, den zweiten Stern rechts zu suchen und auf meinen Brief aus Hogwarts zu warten – kein Wunder, dass meine Schulnoten darunter gelitten haben.
Außerdem widme ich den vorliegenden Band sämtlichen Lehrern und Bibliothekarinnen, die diese Buchreihe unterstützen und in ihren Unterricht einbeziehen.
Das bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann.
»Du hast Feinde? Gut so. Das bedeutet, dass du an irgendeinem Punkt in deinem Leben für etwas eingestanden bist.«
Winston Churchill
PrologGäste der Grande Armée
Die ungewöhnlich dunklen Blätter und Borken der Bäume waren des Nachts beinahe unmöglich zu erkennen und ließen keinen Zweifel darüber, weshalb man die Gegend seit fernen Zeiten »Schwarzwald« nannte. Obwohl ein heller Mond hinter den Wolken hervorlugte wie ein schüchternes Kind, konnte niemand mit Gewissheit sagen, was sich im Dickicht verbarg.
Eine Kühle hielt sich in der Luft, als hätte jemand einen Schleier über die Baumkronen gebreitet. Es handelte sich um einen entlegenen, altehrwürdigen Wald; seine Wurzeln hatten sich tief in das Erdreich gegraben, während die Äste hoch in den Himmel ragten. Wäre der schmale Pfad, der sich durch das Gelände schlängelte, nicht gewesen, hätte man glauben können, alles sei völlig unberührt und noch nie einem Menschen unter die Augen gekommen.
Ein dunkler Wagen, gezogenen von vier starken Pferden, stob durch den Wald. Die beiden schwingenden Laternen erleuchteten den Weg und gaben ihm den Anschein eines riesigen Wesens mit glühenden Augen. Zwei französische Soldaten aus Napoleons Grande Armée ritten nebenher. Schwarze Umhänge verhüllten ihre farbenprächtigen Uniformen und ermöglichten es ihnen, unerkannt zu reisen – denn die Welt sollte nie erfahren, in welcher Mission sie in dieser Nacht unterwegs waren.
Schon bald bremste der Wagen am Ufer des Rheins, in gefährlicher Nähe zur Grenze des beständig wachsenden Französischen Kaiserreichs. Dort entstand soeben ein großes Lager, Dutzende beiger Zelte wurden von unzähligen französischen Soldaten aufgeschlagen.
Auch die Reiter hatten angehalten. Sie stiegen von ihren Pferden, öffneten die Türen der Kutsche und zerrten zwei Männer heraus. Beiden hatte man die Hände hinter dem Rücken gefesselt und schwarze Säcke über die Köpfe gestülpt. Sie ächzten und brüllten unverständliche Worte – denn geknebelt waren sie ebenfalls.
Die Soldaten trieben sie vor sich her zur Mitte des Lagers und stießen sie in das größte Zelt. Selbst mit verdeckten Gesichtern merkten die Gefangenen, wie hell es dort war, und spürten einen weichen Teppich unter ihren Füßen. Die Soldaten drückten sie auf zwei hölzerne Stühle im hinteren Teil des Zeltes.
»J’ai amené les frères«, hörten die beiden einen ihrer Häscher sagen.
»Merci, Capitaine«, entgegnete eine andere Stimme unmittelbar vor ihnen. »Le général sera bientôt là.«
Man zog den Gefangenen die Säcke vom Kopf und entfernte die Knebel. Sobald sich ihre Augen an das Licht gewöhnt hatten, erkannten sie einen großen, muskulösen Mann. Er stand hinter einem massiven Holzschreibtisch. Seine Haltung drückte Autorität aus, und seine Miene war alles andere als freundlich.
»Hallo, Brüder Grimm«, sagte er mit starkem Akzent. »Ich bin Colonel Philippe Baton. Wie nett, dass ihr euch heute Abend zu uns gesellt.«
Wilhelm und Jacob Grimm starrten zu dem Oberst hinauf. Sie waren verschrammt und von blauen Flecken übersät, ihre Kleider zerrissen – offenkundig hatten sie unterwegs nach Kräften Widerstand geleistet.
»Hatten wir denn eine Wahl?«, fragte Jacob und spuckte Blut auf den Teppich.
»Ich nehme an, mit Capitaine De Lange und Lieutenant Rembert habt ihr euch bereits bekannt gemacht«, sagte Colonel Baton und wies auf die beiden Soldaten, die die Brüder hereingebracht hatten.
»Bekannt gemacht würde ich es nicht nennen«, meinte Wilhelm.
»Wir haben es auf die höfliche Art versucht, Colonel, aber die beiden wollten nicht kooperieren«, ließ Capitaine De Lange seinen Vorgesetzten wissen.
»Da mussten wir unsere Einladung ein wenig deutlicher vermitteln«, fügte Lieutenant Rembert hinzu.
Die Brüder blickten sich währenddessen im Zelt um. Dafür, dass es gerade erst aufgestellt worden war, beeindruckte die tadellose Einrichtung: In einer der Ecken tickte eine Standuhr, zwei blankpolierte Armleuchter brannten zu beiden Seiten des Hintereingangs, und eine große Landkarte Europas, auf der winzige französische Flaggen die eroberten Gebiete markierten, lag ausgebreitet auf dem wuchtigen Schreibtisch.
»Was wollt Ihr von uns?«, fragte Jacob und kämpfte dabei gegen die Seile an, die seine Hände zusammenbanden.
»Wenn Ihr uns tot sehen wolltet, hättet Ihr uns schließlich gewiss längst umgebracht«, bemerkte Wilhelm und zerrte seinerseits an den Fesseln.
Ihre Ruppigkeit verdüsterte das Gesicht des Obersts noch weiter. »General Marquis hat nach eurer Anwesenheit heute Abend verlangt – nicht um euch zu schaden, sondern um eure Hilfe zu erbitten«, sagte Colonel Baton. »An eurer Stelle würde ich mir allerdings einen anderen Tonfall zulegen, damit er sich nicht anders besinnt.«
Die Brüder Grimm tauschten nervöse Blicke. General Jacques du Marquis war einer der gefürchtetsten Generäle der gesamten Grande Armée des Französischen Kaiserreichs. Allein sein Name schickte ihnen bereits eine Gänsehaut über den Rücken – doch was um alles in der Welt konnte er mit ihnen vorhaben?
Ein aufdringlicher Moschusduft erfüllte mit einem Mal das Zelt. Den Brüdern Grimm entging nicht, dass auch die Soldaten ihn rochen und sich umgehend versteiften.
»Tss, tss, tss, Colonel«, erklang eine dünne Stimme von draußen. »Behandelt man so etwa Gäste?«
Wer auch immer dort stehen mochte, hatte zweifellos die gesamte Unterhaltung mit angehört.
General Marquis betrat das Zelt. Der plötzliche Luftstoß ließ die Flammen in den Armleuchtern aufflackern, und die strenge, moschusartige Note seines Eau de Cologne durchwaberte noch penetranter das Zeltinnere.
»General Jacques du Marquis?«, fragte Jacob.
Für einen Mann mit solch einschüchterndem Ruf war sein Erscheinungsbild ein wenig enttäuschend: Er war recht kurz geraten, mit großen grauen Augen und gewaltigen Händen. Auf seinem Kopf saß ein imposanter runder Hut, der breiter war als seine Schultern, und an seine Uniform hatte er mehrere Ehrenplaketten geheftet. Nun nahm er den Hut ab und legte ihn auf die Schreibtischplatte; darunter zum Vorschein kam eine spiegelnde Glatze. Der General ließ sich zwanglos in den großen, gepolsterten Stuhl hinter dem Schreibtisch sinken und faltete die Hände über seinem Bauch.
»Capitaine De Lange, Lieutenant Rembert, bitte bindet unsere Besucher los«, wies General Marquis die beiden Franzosen an. »Bloß weil wir in feindseligen Zeiten leben, müssen wir noch lange nicht ungastlich sein.«
Der Hauptmann und sein Leutnant taten wie befohlen. Ein wohlwollendes Lächeln erschien auf dem Gesicht des Generals, doch die Brüder Grimm ließen sich nicht täuschen – in seinen Augen lag keinerlei Mitgefühl.
»Wieso habt Ihr uns hierhergebracht?«, fragte Wilhelm. »Wir stellen weder für Euch noch für das Französische Kaiserreich eine Bedrohung dar.«
»Wir sind Gelehrte und Schriftsteller! An uns könnt Ihr Euch nicht bereichern«, ergänzte Jacob.
Der General gab ein amüsiertes Glucksen von sich und hielt sich im nächsten Moment entschuldigend eine Hand vor den Mund.
»Das ist eine nette kleine Geschichte, aber ich weiß es besser«, sagte er. »Wisst ihr, ich beobachte euch bereits eine Weile, Brüder Grimm, und mir ist klar, dass in euch – ebenso wie in all euren Märchen – mehr steckt, als man auf den ersten Blick denken könnte. Donnez-moi le livre!«
Der General schnippte mit den Fingern, und Colonel Baton reichte ihm ein dickes Buch aus einer Schreibtischschublade. Er ließ es geräuschvoll vor dem General auf die Tischplatte fallen, und dieser fing an, durch die Seiten zu blättern. Die Brüder Grimm erkannten das Buch auf der Stelle – es war ihr eigenes.
»Kommt euch das vertraut vor?«, fragte General Marquis.
»Das ist eine Ausgabe unserer Kinder- und Hausmärchen«, antwortete Wilhelm.
»Oui«, bestätigte der General, ohne von dem Band aufzusehen. »Ich bin ein großer Bewunderer von euch, Brüder Grimm. Eure Geschichten sind so phantasievoll, so merveilleuses – woher nehmt ihr nur all diese Ideen?«
Die Brüder Grimm warfen einander verhaltene Blicke zu; sie waren noch immer nicht sicher, was der General im Schilde führte.
»Das sind bloß Märchen«, sagte Jacob. »Ein paar haben wir uns selbst ausgedacht, aber bei den meisten handelt es sich schlicht um Volksmärchen, die seit Generationen mündlich weitergegeben werden.«
General Marquis nickte beim Zuhören bedächtig. »Aber weitergegeben von wem?«, fragte er und schlug das Geschichtenbuch zu. Sein freundliches Lächeln wich, und die grauen Augen schossen zwischen den Brüdern hin und her.
Weder Wilhelm noch Jacob wussten, auf welche Antwort der General aus war. »Von Familien, bestimmten Gruppen, Kindern und deren Eltern, von –«
»Feen?«, unterbrach ihn der General in völlig ernstem Ton. Kein einziger Muskel zuckte in seinem Gesicht.
Im Zelt wurde es totenstill. Nach einem unbehaglichen langen Moment absoluter Lautlosigkeit spähte Wilhelm zu Jacob hinüber, und beide zwangen sich zu einem Lachen, um die Unterstellung herunterzuspielen.
»Feen?«, wiederholte Wilhelm. »Ihr glaubt, Feen haben uns diese Geschichten eingegeben?«
»Feen gibt es nicht, General«, sagte Jacob.
General Marquis’ linkes Auge begann heftig zu zucken, was die Brüder stutzen ließ. Der General schloss die Augen und massierte langsam sein Gesicht, bis die Krämpfe aufhörten.
»Vergebt mir, Brüder Grimm«, entschuldigte er sich mit einem weiteren falschen Lächeln. »Mein Auge macht sich immer bemerkbar, wenn ich angelogen werde.«
»Wir lügen Euch nicht an, General«, beteuerte Jacob. »Wenn allerdings unsere Märchen Euch derart glaubhaft erschienen sind, dann soll uns das als höchstes Kompliment –«
»RUHE!«, donnerte General Marquis, und wieder pulsierte sein Auge. »Ihr beleidigt meine Intelligenz, Brüder Grimm! Wir folgen euch schon seit geraumer Zeit, und wir wissen von der glitzernden Frau, die euch die Geschichten überbringt!«
Die Brüder Grimm verstummten schlagartig. Beiden raste das Herz, und Schweißperlen traten ihnen auf die Stirn. Jahrelang hatten sie treu ein Schweigegelübde gehalten – und dennoch war das größte Geheimnis ihres Lebens ans Licht gekommen.
»Eine glitzernde Frau?«, fragte Wilhelm. »General, habt Ihr Euch einmal selbst reden hören? Das ist absurd.«
»Meine Männer haben sie mit eigenen Augen gesehen«, entgegnete General Marquis. »Sie trägt Gewänder, die funkeln wie die Sterne am Nachthimmel, weiße Blüten im Haar und einen langen Kristallzauberstab bei sich – und jedes Mal, wenn sie auftaucht, bringt sie euch eine neue Geschichte für eure Bücher mit. Doch woher taucht sie auf? Darüber sinniere ich schon die ganze Zeit. Nachdem ich unzählige Tage darauf verwandt habe, jede Landkarte in meinem Besitz zu durchforsten, muss ich annehmen, dass sie von einem Ort stammt, der auf keiner dieser Karten verzeichnet ist.«
Wilhelm und Jacob schüttelten die Köpfe in dem verzweifelten Versuch, all seine Worte zurückzuweisen. Doch wie konnten sie die Wahrheit verleugnen?
»Ihr Militärs seid alle gleich«, sagte Jacob. »Die halbe bekannte Welt habt Ihr bereits erobert, und trotzdem wollt Ihr immer noch mehr – also denkt Ihr Euch Dinge aus, an die Ihr dann glaubt! Ihr seid wie König Artus, besessen von der Idee des Heiligen Grals –«
»Apportez-moi l’oeuf!«, befahl General Marquis.
Capitaine De Lange und Lieutenant Rembert eilten aus dem Zelt und kamen einen Augenblick später mit einer schweren, in Eisen geschlagenen Truhe zurück. Sie stellten sie direkt vor General Marquis auf dem Schreibtisch ab.
Der General langte in seine Uniform und zog einen Schlüssel hervor, den er sicher um den Hals trug. Er öffnete damit die Schlösser der Ketten und klappte die Truhe auf. Zuerst nahm er ein Paar weißer Seidenhandschuhe heraus und streifte sie über. Dann griff er tiefer in die Kiste und holte ein riesiges Ei hervor – aus dem reinsten Gold, das die Brüder je zu Gesicht bekommen hatten. Dieses goldene Ei stammte eindeutig nicht aus ihrer Welt.
»Ist das nicht das Schönste, was ihr je vor Augen hattet?«, fragte General Marquis mit verzücktem Blick. »Und ich glaube fest, dass es erst der Anfang ist – nur eine kleine Kostprobe jener Wunder, die uns in der Welt, aus der eure Geschichten stammen, erwartet, werte Brüder Grimm. Und ihr werdet uns dorthin führen.«
»Das können wir nicht!«, sagte Jacob. Er versuchte, aufzustehen, doch Lieutenant Rembert drückte ihn fest in seinen Stuhl.
»Die gute Fee – die glitzernde Frau, von der Ihr sprecht – bringt uns die Geschichten aus ihrer Welt, damit wir sie in unserer verbreiten«, erklärte Wilhelm.
»Sie ist die Einzige, die zwischen den Welten wandern kann. Wir selbst sind nie dort gewesen und können Euch daher auch den Weg nicht zeigen«, betonte Jacob.
»Wie seid Ihr überhaupt in den Besitz des Eis gelangt?«, wollte Wilhelm wissen.
General Marquis legte das goldene Ei behutsam zurück in die Truhe. »Eine weitere eurer Bekanntschaften – die andere Frau, die euch mit Geschichten zum Weitererzählen versorgt – hat es mir gegeben. Apportez-moi le corps de la femme oiseau!«
Colonel Baton verließ das Zelt. Als er wenig später zurückkehrte, zog er auf einem Handwagen einen zugedeckten Käfig hinter sich her. Er riss das Tuch herunter, und die Brüder Grimm schnappten nach Luft. Im Käfig lag der leblose Körper von Mutter Gans.
»Was habt Ihr ihr angetan?«, brüllte Wilhelm und mühte sich nun seinerseits, auf die Füße zu kommen, wurde jedoch ebenso unsanft daran gehindert.
»Sie wurde tragischerweise in einem nahen Wirtshaus vergiftet«, sagte General Marquis ohne jedes Bedauern. »Wie unglaublich traurig, dass eine so geistreiche Frau uns hat verlassen müssen, aber solche Unglücksfälle passieren nun mal. Das Ei haben wir in ihrem Besitz entdeckt – was mich ins Grübeln bringt … Denn wenn diese alte Säuferin es geschafft hat, einen Weg zu finden, um ebenfalls zwischen den Welten zu wandern, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass ihr beiden dazu gleichermaßen in der Lage seid.«
Die Gesichter der Brüder liefen scharlachrot an, ihre Nasenflügel bebten. »Und was habt Ihr vor, wenn Ihr erst einmal dort seid? Die Märchenwelt für das Französische Kaiserreich zu beanspruchen?«, fragte Wilhelm.
»Aber gewiss doch«, erklärte General Marquis, als sollte das längst deutlich geworden sein.
»Ihr habt nicht den Hauch einer Chance!«, ereiferte sich Jacob. »In dieser Welt gibt es Menschen und Wesen, die Ihr Euch nicht einmal vorstellen könnt! Menschen und Wesen, die viel mächtiger sind, als Ihr es je sein werdet! Eure Armee wird vernichtet werden, sowie Ihr auch nur einen Fuß über die Schwelle setzt.«
General Marquis lachte erneut auf.
»Das halte ich für höchst unwahrscheinlich, Brüder Grimm.« Er kicherte. »Wisst ihr, die Grande Armée hat sehr große Pläne – es gibt noch viele Gebiete, die wir bis zum Ende des kommenden Jahres zu erobern gedenken. Da ist die Märchenwelt nur ein Krümel des Kuchens, auf den wir aus sind. Während wir uns hier unterhalten, werden Tausende und Abertausende Soldaten ausgebildet; und zusammen werden sie die größte Armee bilden, die die Welt je gesehen hat. Ich bezweifle stark, dass sich auch nur irgendjemand oder irgendetwas uns wird in den Weg stellen können – nicht die Ägypter, nicht die Russen, nicht die Österreicher, und ganz sicher kein Haufen Feen und Kobolde.«
»Und was erwartet Ihr dann von uns?«, fragte Wilhelm. »Was, wenn wir Euch kein Portal in diese andere Welt bieten können?«
Der General lächelte, doch diesmal blitzte Ernsthaftigkeit dahinter auf. Gier trat ihm in die Augen, als er endlich seine wahren Absichten enthüllte.
»Ihr habt zwei Monate, um einen Weg in diese Welt der Geschichten zu finden, Brüder Grimm«, verkündete er.
»Aber was, wenn uns das nicht gelingt?«, wiederholte Jacob. »Wie gesagt: Die gute Fee ist ausgesprochen geheimnisvoll. Womöglich begegnen wir ihr nie wieder.«
Ein kalter, heimtückischer Ausdruck breitete sich über das Gesicht des Generals aus. »Tss, tss, tss, Brüder Grimm. Ihr werdet nicht scheitern, weil die Zukunft eurer Freunde und eurer Familie davon abhängt. Und die wollt ihr doch gewiss nicht im Stich lassen.«
Ein leises Schnauben durchdrang die darauffolgende angespannte Stille im Zelt – doch es kam von keinem der beiden Brüder. Jacob warf einen Blick hinüber zu dem Käfig und bemerkte, wie Mutter Gans sich schmatzend bewegte. Unter den staunenden Augen aller Anwesenden kam sie wieder zu sich, als wachte sie bloß eben aus einem langen Schlummer auf.
»Wo bin ich?«, fragte sie, setzte sich auf und rieb sich den Kopf. Dann ließ sie die Halswirbel krachen und gähnte ausgiebig. »O nein, hat Spanien schon wieder eine Inquisition angezettelt? Wie lange war ich denn außer Gefecht?«
Der General stand langsam auf. Er schien fassungslos, seine Augen wurden immer größer. »Aber wie kann das sein? Sie wurde vergiftet!«, murmelte er.
»Na ja, vergiftet würde ich es nicht nennen … ein bisschen übereifrig bewirtet vielleicht«, meinte Mutter Gans und blickte sich derweil im Zelt um. »Mal schauen. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in meiner Lieblingsgaststube in Bayern gesessen habe. Der Wirt dort schenkt äußerst großzügig aus – sein Name ist Lester, ein herzensguter Kerl und alter Freund von mir. Ich habe immer gesagt, ich würde mein erstes Kind nach ihm benennen, sollte ich jemals eins bekommen – Sekunde mal! Jacob? Willy? Was in Merlins Namen macht ihr zwei denn hier?«
»Wir sind entführt worden«, sagte Jacob. »Diese Männer planen, in zwei Monaten in die Märchenwelt einzufallen. Wenn wir ihnen kein Portal präsentieren, werden sie unsere Familie büßen lassen!«
Mutter Gans klappte die Kinnlade herunter, und ihr Blick sprang zwischen den Brüdern und den Soldaten hin und her. Sie hatte bereits reichlich Mühe damit, ihr Bewusstsein zurückzuerlangen; von dieser Neuigkeit schwirrte ihr nun vollends der Kopf.
»Aber … aber … aber woher wissen sie –?«
»Sie sind uns gefolgt«, sagte Jacob. »Uns allen – sie haben dein goldenes Ei! Und eine tausendköpfige Armee, mit der sie im Namen Frankreichs die Märchenwelt einnehmen wollen –«
»Ruhe!«, fuhr Colonel Baton die Brüder an.
General Marquis hob eine Hand, um den Oberst zum Schweigen zu bringen. »Nein, Colonel, das geht schon in Ordnung. Diese Frau wird nämlich unseren Freunden dabei helfen, meine Bitte zu erfüllen. Schließlich möchte auch sie gewiss nicht, dass der Familie Grimm ein Unglück widerfährt.«
Er lugte durch die Stäbe des Käfigs zu ihr hinein, als wäre sie ein wildes Tier.
Für Mutter Gans war es nichts Neues, an fragwürdigen Orten und in heiklen Situationen wieder zu sich zu kommen, doch das hier schoss den Vogel ab. Seit jeher hatte sie gefürchtet, das Geheimnis ihrer Welt könnte eines Tages aufgedeckt werden. Allerdings hatte sie nie geglaubt, dass es unter derart extremen Umständen geschehen würde.
Röte stieg ihr in die Wangen, sie wurde panisch. »Ich muss hier weg!«, sagte sie und streckte eine geöffnete Hand aus, woraufhin das goldene Ei schnurstracks aus der Truhe zum Handwagen schwebte. Und mit einem blendend grellen Blitz lösten beide sich in Luft auf.
Die anwesenden Soldaten begannen zu schreien, doch der General blieb bemerkenswert ruhig. Sein Blick wurde nur noch entschlossener, während er weiter auf den Käfig starrte, aus dem Mutter Gans soeben verschwunden war. Nie zuvor hatte er etwas ähnlich Faszinierendes erlebt – und es bewies, dass alles, wonach er strebte, tatsächlich existierte.
»Général, quelles sont vos instructions?«, fragte Colonel Baton verunsichert.
Der General senkte den Blick zu Boden und dachte kurz nach. »Emmenez-les!«, befahl er und deutete auf die Brüder Grimm. Ehe sie wussten, wie ihnen geschah, wurden die Brüder aufs Neue geknebelt; die Hände wurden ihnen abermals auf dem Rücken gefesselt und die schwarzen Säcke erneut über die Köpfe gestülpt.
»Zwei Monate, Brüder Grimm«, sagte der General, ohne dabei seinen Blick von dem Wagen loszureißen. »Findet innerhalb von zwei Monaten ein Portal, oder ich lasse euch dabei zusehen, wie ich jeden Einzelnen eurer Lieben persönlich umbringe!«
Die Brüder Grimm stöhnten unter ihren Hauben. Capitaine De Lange und Lieutenant Rembert zwangen sie, aufzustehen, und bugsierten sie aus dem Zelt. Im ganzen Lager waren ihre gedämpften Klagen zu hören, als sie zurück auf den Karren gestoßen und in den dunklen Wald davonkutschiert wurden.
General Marquis nahm wieder auf seinem Stuhl Platz. Er seufzte zufrieden und sah sich um. Sein Blick fiel auf das Märchenbuch der Brüder Grimm, das noch immer auf der Schreibtischplatte lag, und er gluckste leise. Zum ersten Mal erschien ihm sein Streben nach der Märchenwelt nicht mehr wie die verstiegene Suche nach dem Heiligen Gral – sondern als in greifbare Nähe gerückter Sieg.
Er nahm eine der winzigen französischen Flaggen von der Europakarte und rammte sie in den Einband des Märchenbuchs. Vielleicht hatten die Brüder Grimm recht – vielleicht hielt die Märchenwelt Wunder bereit, die er sich nicht einmal vorzustellen vermochte. Doch jetzt konnte er seiner Phantasie freien Lauf lassen …
Kapitel 1Eine einmalige Gelegenheit
Die Uhr zeigte eine halbe Stunde nach Mitternacht, und in nur einem Haus entlang des gesamten Sycamore Drive brannte noch Licht. Hinter einem Fenster bei Dr. Robert Gordon im ersten Stock bewegte sich ein Schatten hin und her: Conner Bailey, der Stiefsohn des Arztes, tigerte dort in seinem Schlafzimmer auf und ab. Schon seit Monaten wusste Conner, dass er nach Europa reisen würde, doch mit dem Packen hatte er bis zum Vorabend seines Abflugs gewartet.
Dass ausgerechnet jetzt Wiederholungen einer spannenden Science-Fiction-Fernsehserie liefen, half wenig gegen Conners Aufschieberitis. Von der Pilotin, die ihr Raumschiff samt Crew vor einem Angriff fieser Außerirdischer zu retten versuchte, konnte er seine Augen einfach nicht loseisen. Doch ein schneller Blick auf seine Uhr – und die damit verbundene Feststellung, dass er in nur sieben Stunden am Flughafen sein musste – zwang ihn, den Fernseher auszuschalten und sich doch auf die Reisevorbereitungen zu konzentrieren.
»Mal nachdenken«, sagte er zu sich selbst. »Drei Tage lang bin ich in Deutschland … also sollte ich wohl am besten zwölf Paar Socken mitnehmen.« Er nickte überzeugt und feuerte ein Dutzend Sockenknäuel in seinen Koffer. »Man weiß nie, vielleicht gibt es in Europa jede Menge Pfützen.«
Conner holte außerdem ungefähr zehn Unterwäschegarnituren aus seiner Kommode und breitete sie auf seinem Bett aus – zweifellos mehr, als er brauchen würde; doch aus einer traumatischen Übernachtung im Kindergarten, die mit einem nassen Fleck auf der Matratze zu Ende gegangen war, hatte Conner gelernt, immer großzügig Reserve einzukalkulieren.
»Okay, ich denke, jetzt habe ich alles«, befand Conner und zählte den Inhalt seines Koffers durch. »Sieben T-Shirts, vier Sweatshirts, meinen Glücksstein, zwei Schals, den anderen Glücksstein, Unterwäsche, Socken, einen Schlafanzug, meinen Glückspokerchip und die Zahnbürste.«
Er sah sich in seinem Zimmer um und überlegte, was ein Jugendlicher in Europa sonst noch brauchen könnte.
»Oh, Hosen!«, fiel es ihm glücklicherweise noch ein. »Hosen brauche ich noch!«
Nachdem er die fehlenden (und so unverzichtbaren) Kleidungsstücke hinzugefügt hatte, ließ Conner sich auf die Bettkante sinken und atmete tief durch. Ein breites, begeistertes Lächeln trat unwillkürlich auf sein Gesicht. Er freute sich wie Bolle!
Am Ende des vorigen Schuljahres hatte Conners Schulleiterin, Mrs Peters, ihn zu sich ins Büro gerufen, um ihm einen äußerst spannenden Vorschlag zu unterbreiten.
»Stecke ich in Schwierigkeiten?«, hatte Conner gefragt, als er vor ihrem Schreibtisch Platz genommen hatte.
»Mr Bailey, wieso stellen Sie mir diese Frage jedes Mal, wenn ich Sie in mein Büro kommen lasse?«, hatte Mrs Peters erwidert und ihn über den Rand ihrer Brillengläser hinweg gemustert.
»Tut mir leid. Alte Gewohnheit, schätze ich.« Er hatte mit den Schultern gezuckt.
»Ich habe Sie aus zwei Gründen hergebeten«, sagte Mrs Peters. »Zum einen wollte ich mich erkundigen, wie Alex sich in ihrer neuen Schule eingelebt hat – wo ist sie inzwischen noch mal? Vermont?«
Conner schluckte, und seine Augen wurden ganz groß. »Oh!«, machte er. Manchmal dachte er beinahe gar nicht mehr an die Lüge, die seine Familie der Schule über den Verbleib seiner Schwester aufgetischt hatte. »Sie kommt ausgezeichnet zurecht dort! Es könnte ihr gar nicht besser gehen!«
Mrs Peters biss sich auf die Lippe und nickte; sie wirkte fast ein wenig enttäuscht. »Wie wunderbar, schön für sie. Auch wenn ich mir manchmal ganz selbstsüchtig wünsche, sie würde wieder zurückziehen und in meinen Unterricht kommen. Allerdings hat Ihre Mutter mir von dem umfangreichen Angebot an Förderprogrammen dort erzählt, daher bin ich mir sicher, dass sie sich wohl fühlt.«
»Absolut!«, bekräftigte Conner und schielte nach links, um den direkten Blickkontakt zu vermeiden. »Und Bäume liebt Alex ja schon immer … und Ahornsirup … also passt sie gut nach Vermont.«
»Verstehe«, sagte Mrs Peters, kniff dabei jedoch die Augen zusammen. »Und sie wohnt bei Ihrer Großmutter? Ist das richtig?«
»Ja, nach wie vor bei Grandma … die ebenfalls Bäume und Ahornsirup liebt. Das muss wohl in der Familie liegen«, meinte Conner und blickte nach rechts. Eine Sekunde lang geriet er in Panik, da ihm nicht mehr einfallen wollte, in welche Richtung Leute, die logen, angeblich schauten – darüber hatte er kürzlich einen Bericht im Fernsehen gesehen.
»Dann grüßen Sie sie ganz herzlich von mir, und richten Sie ihr bitte aus, sie soll mich besuchen, wenn sie demnächst einmal in der Stadt ist«, sagte Mrs Peters.
»Natürlich!«, versicherte Conner, der dringend das Thema wechseln wollte.
»Na dann – kommen wir zum zweiten Grund, aus dem ich Sie einbestellt habe.« Mrs Peters setzte sich besonders gerade in ihrem Stuhl auf und schob eine Broschüre über die Schreibtischplatte. »Soeben haben mich aufregende Neuigkeiten von einer alten Kollegin erreicht, die in Deutschland – genauer in Frankfurt – Englisch unterrichtet. Offenbar haben Wissenschaftler der Freien Universität Berlin eine Zeitkapsel aus dem Besitz der Brüder Grimm entdeckt. Ich gehe davon aus, dass diese beiden Ihnen aus meinem Unterricht in der sechsten Klasse noch ein Begriff sind?«
»Soll das ein Witz sein? Meine Großmutter kannte die zwei persönlich!«, empörte sich Conner.
»Wie bitte?«
Einen Moment lang starrte Conner sie bloß an, erschrocken über seinen eigenen Leichtsinn. »Ich meine … ja, natürlich erinnere ich mich«, versuchte er zurückzurudern. »Das sind die Märchentypen, stimmt’s? Grandma hat uns früher immer ihre Geschichten vorgelesen.«
»In der Tat«, sagte Mrs Peters lächelnd – an Conners sonderbare Ausbrüche hatte sie sich inzwischen so weit gewöhnt, dass sie sich kaum noch darüber wunderte. »Und laut der Freien Universität Berlin befanden sich in der Kapsel drei bislang unbekannte Märchen!«
»Das ist ja toll!« Conner war aufrichtig begeistert, und er ahnte, dass es seiner Schwester nicht anders gehen würde.
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung«, sagte Mrs Peters. »Und, was noch besser ist: Die Freie Universität Berlin plant, diese Märchen im Rahmen einer großen Veranstaltung zu enthüllen. Im kommenden September, drei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres, sollen sie auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof – einem Friedhof in Berlin – zum ersten Mal in der Öffentlichkeit vorgelesen werden. Dort nämlich liegen die Brüder Grimm begraben.«
»Das klingt alles großartig!«, pflichtete Conner ihr bei. »Aber was hat das mit mir zu tun?«
»Tja, da Sie ja inzwischen selbst ein wenig zum Grimm geworden sind …«
Conner lachte verlegen und spähte verstohlen nach links. Mrs Peters hatte keine Ahnung, wie nah sie mit ihrem Kompliment an der Wahrheit lag.
»… dachte ich, dass die Reise, die ich derzeit plane, Sie vielleicht interessieren könnte.« Mrs Peters tippte auf die Broschüre. »Ich habe beschlossen, einige wenige auserwählte Schüler – Schüler wie Sie, die gezeigt haben, dass sie eine Leidenschaft fürs Schreiben und Geschichtenerzählen besitzen – einzuladen, mich nach Berlin zu begleiten, um dort gemeinsam mit mir unter jenen zu sein, die diese Märchen zum ersten Mal hören.«
Conner griff nach dem Heft und starrte mit offenem Mund darauf. »Das klingt gigantisch!« Er schlug es auf und ließ die Augen über all die Sehenswürdigkeiten wandern, die die deutsche Hauptstadt zu bieten hatte. »Können wir uns auch mal diese Nachtclubs anschauen?«
»Leider sind jegliche Exkursionen, die mit mehr als einer Woche Unterrichtsversäumnis einhergehen, im Schuldistrikt verpönt. Daher keine Nachtclubs, fürchte ich. Wir werden nur drei Tage in Berlin verbringen, aber ich hatte das Gefühl, das könnte eine Gelegenheit sein, die Sie nicht würden missen wollen«, sagte Mrs Peters mit zuversichtlichem Lächeln. »Mir scheint, dass uns dort womöglich ein geradezu historisches Erlebnis erwartet.«
Als Conners Blick den unteren Seitenrand der Broschüre erreichte, verblasste sein Lächeln. Dort nämlich stand, was die Reise kosten sollte.
»Hui, das ist aber eine ziemlich kostspielige Gelegenheit«, bemerkte er.
»Reisen sind bedauerlicherweise nie billig«, sagte Mrs Peters. »Aber es gibt jede Menge Unterstützungsangebote der Schule, zu der ich Ihnen Informationen geben kann –«
»Oh, Sekunde mal! Ich vergesse immer wieder, dass meine Mom gerade einen Arzt geheiratet hat! Wir sind gar nicht mehr arm!«, unterbrach Conner sie, und sein Lächeln war auf einen Schlag zurück. »Wobei, Moment … bin ich dann trotzdem noch arm? Da muss ich mal fragen. Irgendwie habe ich diese ganze Stiefsohn-Geschichte noch nicht komplett durchschaut.«
Mrs Peters zog die Augenbrauen hoch und blinzelte zweimal, unsicher, was sie darauf erwidern sollte. »Darüber werden Sie sich wohl in der Tat mit Ihren Eltern unterhalten müssen. Ganz am Ende dieser Broschüre finden Sie jedenfalls meine Bürotelefonnummer, falls Sie Hilfe bei der Überzeugungsarbeit brauchen«, meinte sie mit einem schnellen Zwinkern.
»Danke, Mrs Peters!«, sagte Conner. »Wen haben Sie denn sonst noch gefragt?«
»Nur eine Handvoll Schüler. Ich habe die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass Exkursionen mit mehr als sechs Schülern unter der Aufsicht nur einer Lehrkraft schnell zu Szenen ausarten, die an Der Herr der Fliegen erinnern.«
»Verstehe«, sagte Conner. Nun bekam er das Bild einer Gruppe wilder Sechstklässler mit Kriegsbemalung nicht mehr aus dem Kopf, die Mrs Peters an einen Bratspieß fesselten, um sie über offenem Feuer zu rösten.
»Allerdings hat sich Bree Campbell bereits angemeldet«, fuhr Mrs Peters fort. »Ich glaube, sie ist in Ihrem Englischkurs bei Ms York?«
Conner spürte, wie sein Herzschlag sich beschleunigte. Seine Wangen wurden rot, und er schürzte die Lippen, um ein Lächeln zu unterdrücken. »Oh, gut«, sagte er leise, während er insgeheim brüllte: »O mein Gott, Bree Campbell kommt mit nach Deutschland! Das ist so, SO toll! Der Hammer! Besser geht’s nicht!«
»Sie hat ebenfalls beachtliches schriftstellerisches Talent, muss ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich gut mit ihr verstehen werden«, meinte Mrs Peters, der gar nicht auffiel, wie sehr Conners Puls inzwischen raste. »Ich hoffe, Sie finden eine Möglichkeit, sich uns anzuschließen. Nun aber sollten Sie zurück in den Unterricht gehen.«
Conner nickte, stand auf und machte sich – mit stetig weiternickendem Kopf – auf den Rückweg zu seinem Biologiesaal. Er konnte sich keinen Reim darauf machen, weshalb es jedes Mal wärmer im Raum zu werden schien, wenn er Bree Campbell sah oder jemand sie erwähnte. Er war sich nicht einmal sicher, was er von ihr hielt – doch aus unerfindlichen Gründen freute er sich stets darauf, sie wiederzusehen, und er war ganz erpicht darauf, dass sie ihn mochte.
Ganz gleich, wie lange er darüber nachdachte, eine Erklärung für dieses Phänomen hatte er nicht. Eines aber war klar: Er musste mit nach Deutschland!
Das Gespräch mit seiner Mom und seinem Stiefvater nach der Schule lief so gut, wie Conner es sich nur hätte wünschen können.
»Das ist eine wirklich großartige Gelegenheit«, betonte Conner. »Deutschland ist ein megacleveres Land mit jeder Menge Geschichte. Ich glaube, irgendwann war da auch mal irgend so ein Krieg – darf ich mit? Darf ich mit?«
Charlotte und Bob saßen vor ihm auf der Couch und studierten die Broschüre. Beide waren gerade erst von ihrer Arbeit in der Kinderklinik nach Hause gekommen und hatten nicht einmal Zeit gehabt, sich umzuziehen, ehe sie von einem höchst aufgekratzten Conner überfallen worden waren.
»Das hört sich nach einer tollen Reise an«, befand Charlotte. »Dein Dad wäre ganz begeistert gewesen, wenn er von einer Zeitkapsel der Brüder Grimm erfahren hätte!«
»Ich weiß, ich weiß! Und deshalb muss ich mitfahren – damit ich das für uns alle erleben kann! Bitte, darf ich?«, fragte Conner und wippte ein wenig auf den Fußballen. Jedes Mal, wenn er die beiden um etwas bat, benahm er sich wie ein hyperaktiver Chihuahua.
Die beiden zögerten nur eine Sekunde, die sich für Conner jedoch wie eine Stunde anfühlte. »Oh, kommt schon! Alex darf in einer komplett anderen Dimension leben, aber ich nicht mal einen Schulausflug nach Deutschland machen?«
»Natürlich darfst du«, sagte Charlotte.
»YES!« Conner stieß beide Fäuste in die Luft.
»Aber du wirst selbst dafür bezahlen müssen«, schob Charlotte rasch hinterher.
Sofort fielen Conners Hände nach unten, und seine Begeisterung zerplatzte wie ein angestochener Luftballon. »Ich bin dreizehn – ich kann mir keine Reise nach Europa leisten!«
»Stimmt, aber seit wir bei Bob eingezogen sind, bekommst du ein wenig Taschengeld dafür, dass du im Haushalt hilfst, und bald ist dein vierzehnter Geburtstag«, sagte Charlotte, während sie offenbar im Kopf überschlug. »Wenn du das zusammennimmst und dazu noch eine Spendenaktion in der Schule auf die Beine stellst, solltest du es schaffen –«
»Die Hälfte«, hakte Conner ein. Er hatte selbst bereits sämtliche denkbaren Szenarien zu allen möglichen Reaktionen seiner Mom und seines Stiefvaters durchgerechnet. »Genug für den Hinflug, aber wenn ihr mich wieder zurückhaben möchtet …«
Bob sah auf die Broschüre hinunter und zuckte mit den Schultern. »Charlotte, was wäre denn dabei, wenn wir ihm die Hälfte dazugeben? Das ist eine wirklich phantastische Chance. Außerdem ist er immer so ein lieber Kerl, da schadet es doch nicht, ihn mal ein wenig zu verwöhnen.«
»Danke, Bob! Mom, hör auf deinen Ehemann!«, sagte Conner und gestikulierte so ausgreifend in Bobs Richtung, als wollte er ein Flugzeug auf dem Rollfeld einweisen.
Charlotte ließ sich den Vorschlag einen Moment lang durch den Kopf gehen. »Meinetwegen«, sagte sie schließlich. »Wenn du die Hälfte selbst verdienst und uns zeigst, dass dir ernsthaft etwas an dieser Reise liegt, dann steuern wir den Rest bei. Abgemacht?«
Conner wurde allmählich von all der Aufregung und Vorfreude ganz zappelig. »Danke, danke, danke!«, rief er und schüttelte beiden Erwachsenen die Hand. »Es ist mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen!«
Und so kam es, dass Conner nach vier Monaten – in denen er sein Taschengeld und Geburtstagsgeld gespart sowie bei Benefizveranstaltungen in der Schule Süßigkeiten, Gebäck und hässliche selbstgetöpferte Kreationen (die meist Charlotte und Bob erwarben) verkauft hatte – seinen Anteil der Reisekosten aufbringen konnte und bereit für Deutschland war.
Zu Beginn der Woche vor seinem Abflug, als Conner bereits mit dem Packen hätte anfangen sollen, war Bob mit einer weiteren Überraschung in sein Zimmer spaziert. Er hatte einen sehr alten und staubigen Koffer auf das Bett seines Stiefsohnes gewuchtet – braun, voller Aufkleber von berühmten Orten und so stinkig, dass es im Nu in Conners Zimmer nach Fußschweiß gerochen hatte.
Bob hatte die Hände in die Hüften gestemmt und stolz auf den Koffer hinuntergesehen. »Da ist er!«
»Da ist wer?«, hatte Conner gefragt. »Ist das ein Sarg?«
»Nein, das ist der Koffer, der mich auf meiner eigenen Europareise nach dem Collegeabschluss begleitet hat.« Bob tätschelte zärtlich die Seite des Gepäckstücks, als handelte es sich um einen treuen alten Hund. »Wir hatten eine tolle Zeit miteinander – haben jede Menge Meilen geschrubbt! Ich dachte mir, du könntest ihn für Deutschland gut gebrauchen.«
Conner vermochte sich beim besten Willen nicht vorzustellen, damit zu verreisen – es verblüffte ihn, dass der Koffer nicht augenblicklich zu Staub zerfiel wie eine Mumie, die nach Tausenden von Jahren wieder den Elementen ausgesetzt wurde. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Bob«, druckste er und verbarg seine Vorbehalte hinter einem aufgesetzten Lächeln. Den Koffer rundheraus abzulehnen, kam nicht in Frage, nachdem Bob für ihn eingestanden war und so dazu beigetragen hatte, dass Conner die Reise überhaupt antreten konnte.
»Du brauchst dich überhaupt nicht bei mir zu bedanken«, versicherte Bob ihm, auch wenn das ganz gewiss das Letzte war, was Conner im Sinn hatte. »Tu mir bloß einen Gefallen und besorg einen Sticker aus Berlin für sie.«
»Das ist eine Sie?«
»O ja, und sie heißt Betsy«, bestätigte Bob, bereits wieder auf dem Weg aus dem Zimmer. »Viel Spaß mit ihr! Oh, und beinahe hätte ich es vergessen: Damit die linke Schnalle ordentlich einrastet, musst du extrakräftig drücken.«
Jetzt, am Ende der Woche, begriff Conner haargenau, wovon Bob gesprochen hatte. Er hatte alle Mühe damit, den Koffer, der nun zusätzlich noch einige Hosen enthielt, zu schließen. Nachdem er sich dreimal mit Karacho daraufgeworfen hatte, kapitulierte er vor Betsy.
»Na gut, vielleicht genügen sechs Paar Socken, vier T-Shirts, fünf Unterwäschegarnituren, zwei Pullover, der Schlafanzug, mein Glückspokerchip, eine Zahnbürste und ein Glücksstein«, beschloss Conner. Er nahm die überschüssigen Komponenten heraus und brachte seine Reisevorbereitungen zu Ende.
Es war allerhöchste Zeit fürs Bett, doch Conner wollte unbedingt noch ein wenig wach bleiben und die Vorfreude so lange wie möglich auskosten. In letzter Zeit waren die Gedanken an seine bevorstehende Exkursion nach Deutschland eine großartige Ablenkung von gewissen anderen Dingen gewesen, die ihn beschäftigten. Nun aber, während er den Blick durch sein Zimmer schweifen ließ und der vollkommenen Stille im Haus lauschte, kam die Einsamkeit, die er unterdrückt hatte, wieder hoch in ihm. Etwas – oder vielmehr jemand – fehlte in seinem Leben … Seine Schwester.
Conner öffnete sein Schlafzimmerfenster, um die Lautlosigkeit, die ihn umgab, zu durchbrechen – doch der Sycamore Drive lag ebenso ruhig da wie das Haus und tröstete ihn wenig. Conners Blick wanderte hinauf zu den Sternen am Nachthimmel. Ob Alex, von wo auch immer sie nun sein mochte, wohl dieselben Sterne sah? Vielleicht war das magische Land tatsächlich einer der Sterne, die er in diesem Moment anstarrte, und lediglich noch nicht als solcher entdeckt worden. Dass er und seine Schwester nur durch Lichtjahre und nicht ganze Dimensionen voneinander getrennt sein könnten, schien ihm eine sehr versöhnliche Vorstellung.
Als Conner die Einsamkeit nicht mehr aushielt, fragte er sich laut: »Ob sie gerade wohl wach ist?«
Er schlich die Treppe hinunter ins Wohnzimmer. Dort hing, als einziger Schmuck seiner kompletten Wand, ein großer goldener Spiegel: Es war jener Spiegel, den ihre Großmutter den Zwillingen beim letzten Abschied geschenkt hatte – der eine und einzige Gegenstand, der es den Geschwistern ermöglichte, zwischen den Welten miteinander zu kommunizieren.
Conner berührte den goldenen Rahmen, und er begann zu schimmern und zu leuchten. Entweder würde das Glimmen sich einige Augenblicke halten, bis Alex im Glas erschien – oder der Spiegel würde seinen normalen, mattgoldenen Glanz wieder annehmen, falls sie es nicht tat. Heute Nacht blieb sie fern.
»Wahrscheinlich ist sie beschäftigt«, murmelte Conner leise vor sich hin. »Sie hat ja immer so viel zu tun.«
Ganz zu Anfang, nachdem er frisch von seinem letzten Abenteuer in der Märchenwelt nach Hause gekommen war, hatte Conner sich jeden Tag durch den Spiegel einige Stunden lang mit seiner Schwester unterhalten. Sie hatte ihm alles über die Unterrichtsstunden erzählt, die ihre Großmutter ihr gab, und über die Magie, die sie nun erlernte. Er wiederum hatte von seinen Schultagen und dem Lehrstoff berichtet, doch Alex’ Geschichten waren stets viel spannender gewesen.
Leider waren die täglichen Gespräche der Zwillinge zunehmend seltener geworden, je mehr Alex sich im magischen Land einlebte. Manchmal verging inzwischen über eine Woche, ehe sie das nächste Mal miteinander redeten. Und mitunter fragte sich Conner, ob Alex ihn überhaupt noch brauchte. Ihm war immer klar gewesen, dass sie eines Tages erwachsen sein und eigene Leben führen würden – allerdings hätte er sich nie träumen lassen, dass dieser Tag so schnell anbrechen könnte.
Conner legte erneut eine Hand an den Spiegel und wartete, in der Hoffnung, seine Schwester werde doch noch auftauchen. Er wollte nicht nach Deutschland abreisen, ohne vorher noch einmal mit ihr gesprochen zu haben.
»Dann werde ich ihr wohl im Nachhinein alles erzählen müssen«, grummelte Conner und machte sich auf den Weg ins Bett.
An der ersten Treppenstufe hörte er hinter sich eine zaghafte Stimme: »Conner? Bist du da?«
Er rannte zurück zum Spiegel. Sein Herz hüpfte. Vor ihm, auf der anderen Seite des Glases, stand seine Schwester. Sie trug einen Haarreif aus weißen Nelken und ein glitzerndes himmelblaues Kleid. Obwohl sie auf den ersten Blick fröhlich wirkte, entging Conner nicht, dass sie sehr müde aussah.
»Hi, Alex! Wie geht’s dir?«, fragte er.
»Phantastisch«, erwiderte sie mit breitem Lächeln. Ohne Zweifel freute sie sich ebenso, ihren Zwillingsbruder zu sehen, wie er sich über ihr Auftauchen. »Du bist spät noch wach.«
»Ich konnte nicht schlafen«, gestand Conner. »Zu aufgeregt, schätze ich.«
Alex runzelte die Stirn. »Wieso aufgeregt?«
Noch ehe Conner antworten konnte, fiel es ihr wieder ein: »Oh, du fliegst morgen nach Deutschland, stimmt’s?«
»Jep«, sagte Conner. »Oder eher: später heute. Es ist schon früher Morgen hier.«
»Das hatte ich total vergessen! Tut mir so leid!«, sagte Alex – enttäuscht von sich selbst, dass es ihr entfallen war.
»Macht doch nichts«, meinte Conner. Es juckte ihn wirklich nicht im Geringsten; er war einfach glücklich, sie zu sehen.
»Ich habe in letzter Zeit mit all meinen Magiestunden und den Vorbereitungen für diesen albernen Einführungsball der Feen so viel um die Ohren«, seufzte Alex. Sie rieb sich die Augen. »Da habe ich nicht einmal an unseren Geburtstag gedacht! Ist das nicht verrückt? Grandma und Mutter Gans haben einen Kuchen gebacken, und ich musste sie fragen, wofür der sei!«
Jetzt war es an Conner, die Stirn krauszuziehen. »Einführungsball der Feen? Was ist das denn?«
»Na, diese große Party, die der Rat der Feen gibt, um zu feiern, dass ich ihm nun offiziell beitrete«, sagte Alex, als wäre das kaum der Rede wert.
»Das ist ja großartig, Alex!«, rief Conner. »Du wirst jetzt schon Mitglied des Rats der Feen? Damit bist du doch ganz gewiss die jüngste Fee, die jemals aufgenommen worden ist!«
Ein stolzes und eifriges Lächeln trat auf Alex’ Gesicht. »Ja«, nickte sie. »Grandma findet, dass ich bereit sei. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich ihr da zustimme – es gibt noch so vieles, was ich lernen muss …«
»Du weißt doch, wie fürsorglich Grandma ist. Sie würde den Ozean vor einem Regentropfen beschützen«, sagte Conner. »Wenn sie der Meinung ist, dass du so weit bist, dann hat sie bestimmt recht!«
»Vermutlich«, meinte Alex, klang dabei jedoch nach wie vor ziemlich unsicher. »Das bringt bloß eine große Verantwortung mit sich. Als Mitglied des Rats der Feen bin ich automatisch auch Teil des Märchenrats – und das wiederum heißt, ich muss bald meine Meinung zu so vielen Entscheidungen abgeben … und unheimlich viele Menschen und Wesen werden zu mir aufschauen und sich Führung und Orientierung von mir erhoffen …«
»Ohne dich gäbe es heute gar keinen Märchenrat mehr«, erinnerte Conner sie. »Diese ganze Welt steht bis in alle Ewigkeit in deiner Schuld, seitdem du die Zauberin besiegt hast. Da würde ich mir schon mal gar keine Sorgen machen.«
Ihre Blicke trafen sich, und Alex lächelte. »Danke, Conner.« Seine Bestätigung bedeutete ihr stets viel mehr als die beruhigenden Worte aller anderen.
»Wie geht es eigentlich Grandma?«, erkundigte sich Conner.
»Ihr geht es gut. Sie vermisst dich und Mom fürchterlich – beinahe so sehr wie ich. In den letzten Monaten hat sie mir ungeheuer viel beigebracht. Wirklich, Conner, du wärst total beeindruckt von manchem, was ich jetzt kann.«
Conner lachte. »Alex, ich war schon in Moms Bauch beeindruckt von dir. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass du auf deiner Seite viel ordentlicher und besser organisiert warst als ich.«
Unwillkürlich musste Alex laut lachen – sie vermisste Conners Sinn für Humor. Allerdings wollte sie ihn nicht weiter anstacheln und lenkte daher ab: »Ist denn bei Mom alles in Ordnung? Wenn ich mich mit ihr unterhalte, wirkt sie immer ganz unbeschwert, aber wir wissen beide, wie gut sie ihre eigenen Probleme überspielt.«
Conner nickte. »Im Moment geht es ihr tatsächlich gut. Sie vermisst dich, aber seit wir wieder hier sind, habe ich sie erst ein- oder zweimal dabei erwischt, wie sie über einem alten Foto von uns beiden ein paar Tränen verdrückt hat. Bob macht sie wirklich glücklich. Ich hatte beinahe vergessen, wie es ist, sie ständig so fröhlich zu sehen – fast so, als wäre Dad wieder da.«
»Das freut mich«, sagte Alex. »Dad wäre von deiner Reise nach Deutschland restlos begeistert gewesen. Wahrscheinlich hätte er dich begleitet, wenn er noch leben würde – ich wäre selbst am liebsten dabei.«
Conner warf einen Blick auf die Uhr. »Apropos Reise – ich sollte besser allmählich ins Bett gehen. In ungefähr drei Stunden fahren wir schon los zum Flughafen.«
Alex’ Miene wurde lang. »Ach, wie schade. Du hast mir so gefehlt – und es ist immer wahnsinnig schön, wenn wir mal Gelegenheit haben, ein bisschen zu plaudern«, sagte sie. »Ich war bloß in letzter Zeit immer so eingespannt. Manchmal vergeht eine ganze Woche – und mir kommt es vor, als seien es nur ein oder zwei Tage gewesen.«
»Aber glücklich bist du doch trotzdem, oder?« Conner musterte Alex mit einer hochgezogenen Augenbraue. Er würde es merken, wenn sie ihn anlog.
»Ähm …« Alex dachte an all ihre Unterrichtsstunden, ihre vielen Aufgaben – und obwohl sie derart überwältigt und müde war, sprach sie aus ganzem Herzen die Wahrheit: »Ehrlich gesagt … bin ich nie glücklicher gewesen! Ich stehe jeden Morgen mit einem Lächeln auf, weil es sich anfühlt, als würde ich in einem nie endenden Traum erwachen, seit ich hier lebe!«
Die Zwillinge lächelten einmütig; sie wussten beide, dass das stimmte. Und so schwer es Conner fiel, Alex nicht mehr bei sich zu haben, so klar war ihm zugleich, dass seine Schwester sich an genau dem Ort befand, an den sie gehörte, und es dort richtig gut hatte.
»Ich wünschte, ich könnte dich irgendwie nach Deutschland mitnehmen«, sagte Conner.
»Das wäre toll!«, bekräftigte Alex. »Wobei ich bezweifle, dass es ein Märchen der Brüder Grimm gibt, das Grandma uns noch nicht erzählt hat, oder Dad, oder – Sekunde mal …« Ihr Blick huschte zum unteren Rand des Spiegelglases. »Ist der Rahmen deines Spiegels unten auf der rechten Seite lose?«
Conner nahm die fragliche Ecke unter die Lupe. »Nope – aber Moment, ich glaube, die linke Ecke wackelt.«
»Kannst du sie mal behutsam anheben und die Kante des Glases freilegen?«, fragte Alex und tat derweil auf ihrer Seite das Gleiche.
»Jep!«, machte Conner.
»Oh, gut!«, sagte Alex. »Und jetzt versuch mal, ganz vorsichtig ein Stück abzubrechen, ohne dass dabei –«
Kracks! Conner hielt ein Stück Glas in die Höhe, das größer war als seine Handfläche. »So?«
Kracks! Alex brach ihrerseits eine Ecke ihres eigenen Spiegels ab – kleiner und ordentlicher als die ihres Bruders, doch das erwähnte keiner der beiden.
»Perfekt! Und nun schau rein!« Alex vertiefte sich in ihre Scherbe.
Conner starrte ebenfalls in das kleine Spiegelstück in seiner Hand und stellte fest, dass ihm daraus das Gesicht seiner Schwester entgegensah. »Cool!«, meinte er lachend. »So kann ich dich die ganze Zeit in der Tasche herumtragen! Das ist wie ein Video-Chat!«
»Genial!«, frohlockte Alex. »Ich träume schon ewig von einem Urlaub in Europa! Und jetzt schlaf noch ein bisschen; du sollst ja nicht schon kaputt in Deutschland ankommen.«
»Okay. Gute Nacht, Alex«, sagte Conner. »Ich rufe dich an – oder, ähm, spiegele dich an, wohl eher –, sobald ich aus dem Flugzeug gestiegen bin!«
»Ich freue mich darauf«, entgegnete Alex und freute sich tatsächlich ungemein, nun doch an seiner Reise teilhaben zu können. »Ich hab dich lieb, Conner!«
»Ich dich auch, Alex«, sagte Conner. Und damit verblassten die Zwillinge im Spiegel des jeweils anderen und kehrten beide in ihr eigenes Leben zurück.
Conner tappte die Treppe hinauf und verstaute seine Spiegelscherbe sorgsam in seinem mit Aufklebern übersäten Koffer. Dann legte er sich ins Bett und schloss fest die Augen. Es gelang ihm jedoch nicht, einzuschlafen – das Wiedersehen mit seiner Schwester hatte alle Müdigkeit vertrieben und dafür die Aufregung vor dem kommenden Tag nur noch verstärkt.
Wie er so dort lag, musste er über sich selbst schmunzeln. »Ich bin auf einer magischen Gans geritten, eine gigantische Bohnenranke emporgeklettert, auf dem Rücken einer Riesenschildkröte zu einer unterseeischen Höhle geschwommen und an Bord eines fliegenden Schiffs durch den Himmel einer anderen Dimension gesegelt …«, zählte er leise für sich auf. »Aber jetzt flattern mir die Nerven, nur weil ich demnächst in ein Flugzeug steige! Mannomann …«
Kapitel 2Die Halle der Träume
Am nächsten Morgen erwachte Alex mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. So war es seit ihrem endgültigen Umzug ins magische Land zwar bisher jeden Tag gewesen, doch diesmal strahlte sie besonders, da sie in der vorigen Nacht mit ihrem Bruder gesprochen hatte. Und auch wenn ihr neues Zuhause sie ungeheuer glücklich machte, gab es doch nach wie vor nichts Schöneres für sie, als Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.
Der Feenpalast war der herrlichste Ort, an dem Alex je gelebt hatte. Sie staunte Tag für Tag über die wunderschönen goldenen Säulen, über Bogengänge, Treppen, Türme und die weitläufigen tropischen Gärten. Ein Wermutstropfen allerdings war, dass es im Palast nur sehr wenige Wände und Decken gab – da das Wetter stets so angenehm war, brauchten die Feen sie schlicht nicht. So blieb Alex jeden Morgen, sobald die Sonne über dem Königreich der Feen in den Himmel stieg, gar keine andere Wahl, als ebenfalls aufzustehen.
Zum Glück war es ihr inzwischen immerhin gelungen, einen Magnolienbaum so zu verzaubern, dass seine Äste und Blüten wie ein Vorhang rings um ihr Zimmer wuchsen. Das verschaffte ihr täglich ein paar zusätzliche Minuten seligen Schlummers, ehe sie sich aus dem Bett quälte und ihren Tag begann. Von dem magischen Vorhang abgesehen, hatte Alex ihre Unterkunft recht schlicht belassen: Es gab darin ein großes, bequemes Bett mit weißen Rosenblütenlaken, dazu ein paar Regale, die sich unter der Last von Alex’ Lieblingsbüchern bogen, und einen kleinen Kleiderschrank in der Ecke, der dank einiger magischer Kniffe, die Alex von ihrer Großmutter gelernt hatte, noch nahezu unbenutzt war.
Alex schwang die Beine aus dem Bett, nahm ihren Kristallzauberstab vom Nachttisch und wirbelte damit im Kreis. Auf der Stelle verwandelte sich ihr unspektakuläres Nachthemd in ein langes, glitzerndes, himmelblaues Gewand, und auf ihrem Kopf erschien ein Haarreif aus weißen Nelken – zusammen ergab das die Standard-Feenuniform, die der ihrer Großmutter ähnelte.
»Guten Morgen, Mom, Conner und Bob«, grüßte Alex ein gerahmtes Foto auf ihrem Nachttisch. »Guten Morgen, Dad«, sagte sie zu einem anderen Bild, das ihren verstorbenen Vater zeigte.
Alex atmete tief durch und schloss kurz die Augen. »Also dann: drei Wünsche bis zum Mittag, drei Wünsche bis zum Mittag«, spornte sie sich selbst an. »Das schaffst du, das schaffst du!«
Jeden Tag um Punkt zwölf Uhr mittags traf Alex sich mit ihrer Großmutter in deren Gemächern zu einer neuen Lehrstunde. Manchmal erwarteten sie magische Lektionen, bei anderer Gelegenheit ging es um Geschichte oder Philosophie, doch immer genoss Alex ihren Unterricht ganz außerordentlich.
Und obwohl niemand es von ihr erwartete, hatte Alex es sich jüngst selbst zur Aufgabe gemacht, den Leuten in der nahen Umgebung mit der wenigen Magie, die sie bereits beherrschte, täglich mindestens drei Wünsche zu erfüllen. Für eine vierzehnjährige Fee in der Ausbildung war das ein sehr ehrgeiziges Unterfangen, doch Alex wäre nicht Alex gewesen, wenn sie nicht auch in dieser Welt immerzu den Anspruch gehabt hätte, alles und jeden zu übertrumpfen. Außerdem hatte sie bemerkt, dass sie umso weniger Heimweh verspürte, je mehr sie zu tun hatte – und je weniger sie an ihr Zuhause in der Anderswelt dachte, desto besser lief ihr Unterricht.
Sie marschierte zielstrebig aus ihrem Zimmer, durch den Palast und die Eingangsstufen hinunter. An die schimmernden goldenen Wände und Fußböden hatte sie sich anfangs erst gewöhnen müssen, doch inzwischen machte ihr Anblick Alex längst nicht mehr so schwindelig wie in ihrer ersten Woche im magischen Land.
Auf ihrem Weg kam sie an Rosetta vorbei, die gerade in einem traumhaften Rosenbeet direkt vor dem Palast die Blumen zurechtschnitt. Die Rosen und Dornen waren so groß wie der Kopf der zierlichen Fee.
»Guten Morgen, Rosetta!«, sagte Alex.
»Guten Morgen, Liebes!« Rosetta winkte ihr zu, während Alex vorübereilte. »Wieder früh auf den Beinen, was?«
»Jawohl, Madam!«, erwiderte Alex. »Drei Wünsche bis zum Mittag, so lautet mein tägliches Ziel! Und seit zwei Monaten habe ich es jeden Tag erreicht!«
»Wunderbar, Liebes! Nur weiter so!«
Alex hastete durch die Gärten, bis ein lautes Schnarchen zu ihrer Linken sie erschreckte. Sie schaute zu Boden und entdeckte dort Mutter Gans, die an einem großen Felsbrocken lehnte und einen silbernen Flachmann umklammert hielt. Lester lag bewusstlos neben ihr – offenbar hatten die beiden eine durchzechte Nacht im Freien hinter sich.
»Guten Morgen, Mutter Gans!«, sagte Alex so laut, dass beide wach wurden.
Mutter Gans regte sich schnaubend. »Ach ja?«, meinte sie und zwang ein Auge auf. Lester gähnte und streckte seinen langen Hals.
»Habt ihr die ganze Nacht hier draußen verbracht?«, fragte Alex.
»Na ja, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich nach dem Abendessen mit Lester einen Spaziergang unternommen habe und wir uns nur kurz mal ausruhen wollten«, antwortete Mutter Gans. »Seitdem sind wir wohl hier. Lester, du Daunenfüllung! Du solltest mich aufwecken! Mein guter Ruf steht auf dem Spiel!«
Lester rollte mit den Augen, als wollte er sagen: »Der ist eh schon dahin.«
»Wieso müssen wir auch ausgerechnet in einem Königreich leben, in dem alle früh morgens schon putzmunter sind?«, grummelte Mutter Gans an ihren Ganter gewandt. »Ich schwöre dir, eines Tages ziehe ich ins Östliche Königreich. Da wissen die Leute wenigstens, wie man schläft!« Sie kletterte auf Lesters Rücken und griff nach seinen Zügeln, und gemeinsam hoben die beiden ab in Richtung des Feenpalasts.
Alex blickte ihnen glucksend nach. Dann rief sie sich ihren straffen Zeitplan ins Gedächtnis und setzte sich ebenfalls wieder in Bewegung.
Sie erreichte den Rand der Gärten und fand sich in einer ausgedehnten Wiese wieder.
»Cornelius!«, rief Alex. Sie klatschte sich laut auf den Oberschenkel. »Hierher, mein Guter! Wo bist du? Cornelius?«
Auf der anderen Seite der Wiese stand ein Einhorn, das gerade aus einem Bach trank – doch es glich keinem der übrigen Einhörner des Königreichs. Mit seinem dicken Bauch, der beim Laufen hin- und herschwang, war Cornelius alles andere als anmutig. Das silberne Horn, das ihm aus der Stirn wuchs, hatte er sich bei einem Unfall im Fohlenalter halb abgebrochen.
»Da bist du ja!«, sagte Alex.
Cornelius freute sich ebenso, sie zu sehen, und kam herübergetrottet, damit sie ihm die breite Nase streicheln konnte.
»Guten Morgen, alter Junge.« Alex spürte, dass ihr gehörnter Freund aus irgendeinem Grund betrübt war. Seine Schritte erschienen ihr weniger federnd als sonst. »Was ist denn los, Cornelius? Du wirkst traurig.«
Cornelius senkte seinen massigen Kopf und spähte niedergeschlagen über den Bach. Alex folgte seinem Blick und erkannte in der Ferne eine Herde majestätischer Einhörner: eines prachtvoller als das nächste, allesamt mit langgestreckten, schlanken Körpern und perfekten Hörnern, die im Sonnenlicht funkelten.
»O Cornelius«, sagte Alex und strich ihm zärtlich über die Mähne. »Du musst aufhören, dich mit den anderen Einhörnern zu vergleichen.«
Cornelius nickte, doch Alex sah die Selbstzweifel in seinen Augen. Es gelang ihm nie so recht, seine Gefühle zu verbergen – er trug das Herz auf dem Huf.
»Weißt du, warum ich dich zu meinem Einhorn auserkoren habe, Cornelius?«, fragte sie ihn.
Das bekümmerte Einhorn flehmte und zeigte seine großen, perlweißen Zähne.
»Ja, dein Lächeln ist ganz zauberhaft, allerdings nicht der einzige Grund«, sagte Alex.
Cornelius stellte sich auf die Hinterläufe und beschrieb mit den Vorderbeinen winzige Kreise in der Luft.
»Ja, ein guter Tänzer bist du auch, aber von solchen Dingen rede ich nicht«, beharrte Alex. »Ich habe dich gewählt, weil du anders bist als alle übrigen Einhörner im Königreich der Feen. Mag sein, dass dein Horn klein und gebrochen ist, aber dein Herz ist groß und stark.«
Cornelius schnaubte und wandte sich ab. Alex hatte ihn in Verlegenheit gebracht, und die Röte schimmerte durch sein weißes Fell hindurch.
»Bereit, ein paar Wünsche zu erfüllen?«, fragte Alex.
Er wieherte freudig erregt. »Prima, dann los!«
Cornelius beugte die Knie, und Alex hüpfte auf seinen Rücken. Sie schwang ihren Zauberstab über seinen Kopf und wisperte ihm ins Ohr: »Bring uns zu jemandem, der uns braucht!«
Cornelius’ Hornstumpf begann zu leuchten, er riss den Kopf nach Nordwesten und galoppierte los – wohin auch immer die Magie ihn führen mochte. Einhörner waren wesentlich schneller als gewöhnliche Pferde, und Alex musste ihren Haarreif festhalten, während sie nur so dahinflogen.
Sie preschten durch die Bäume, über einen Fluss und zwei Bäche hinweg und fanden sich schließlich auf einem Pfad wieder, der sie ins Königreich des Gläsernen Schuhs brachte. In der Ferne kam ein kleines, bescheidenes Dorf in Sicht. Cornelius verlangsamte seinen Schritt. Er trug Alex mitten hinein ins Herz des Örtchens – sein Horn leitete ihn wie die Spürnase eines Hundes ihren vierbeinigen Besitzer.
Viele der Dorfbewohner hielten inne, als Alex und das Einhorn an ihnen vorüberschritten.
»Hallo, gute Bürger des Königreichs des Gläsernen Schuhs!«, rief Alex und winkte ihnen ein wenig linkisch zu. »Lasst euch von uns gar nicht stören, wir sind bloß hier, um ein paar Wünsche zu erfüllen!«
Die Dörfler reagierten weitaus weniger begeistert, als Alex es sich erhofft hatte. Sie kehrten tatsächlich einfach zu ihrem Tagwerk zurück.
Cornelius hielt vor einer winzigen Kate mit Wänden aus Astgeflecht und einem Strohdach.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte Alex. Cornelius nickte nachdrücklich, und das Leuchten seines Horns verblasste.
Alex sprang von ihrem Einhorn und ging zur Tür. Sie klopfte zaghaft, doch die dürren Äste zerbrachen unter ihren Knöcheln, so dass ein Loch zurückblieb.
»O weh«, machte Alex. Das schien ihr kein gutes Omen zu sein.
»Wer ist da?«, fragte eine schwache Stimme aus dem Inneren. Alex linste durch das Loch, das sie gerade verschuldet hatte, und sah sich einem Augenpaar gegenüber, das sie anstarrte.
»Hallo«, sagte Alex. »Ich heiße Alex, und ich bin eine Fee! Na ja – genau genommen eine Fee in der Ausbildung. Aber ich bin heute hierhergekommen, um Wünsche zu erfüllen. Und mein Einhorn hat mich zu dieser Tür geführt. Gibt es in Ihrer Hütte vielleicht jemanden, der gern einen Wunsch gewährt hätte?«
Die faltenumrahmten Augen musterten sie von Kopf bis Fuß. Alex war bewusst, dass es mit ihrer Vorstellungsrede noch ebenso haperte wie mit ihrer Magie, doch zu ihrer Verblüffung wurde die Tür geöffnet, und vor ihr tauchte eine ältere Frau auf.
»Komm herein«, sagte die Frau, wenngleich sie über den unerwarteten Besuch nicht allzu begeistert schien.
»Vielen Dank«, erwiderte Alex. Sie tat einen Schritt über die Schwelle und ließ den Blick durch das kleine Haus schweifen. Es war düster und schmutzig und wirkte innen kaum stabiler als von außen. »Ein hübsches Zuhause haben Sie hier«, sagte Alex höflich. »Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein?«
»Das da sind meine Enkeltöchter. Ich nehme an, du bist ihretwegen hier«, meinte die Frau. Hätte sie sie nicht auf die Mädchen aufmerksam gemacht, hätte Alex die eineiigen Drillinge, die sich an eine Wand drängten, wohl gar nicht bemerkt. Die Kinder waren so dreckig, dass sie mit dem Rest des Häuschens geradezu verschmolzen.
»Wie nett, euch kennenzulernen«, sagte Alex, doch keines der Mädchen ergriff ihre angebotene Hand.
»Sie brauchen gute Kleider für die Schule«, sagte die Frau und nahm an einem Tisch Platz, auf dem sich Garn und Stoffe türmten. »Wir können es uns nicht leisten, neue zu kaufen, also habe ich versucht, selbst welche zu nähen. Aber meine Finger sind auch nicht mehr, was sie einmal waren.« Sie hob zwei zitternde Hände, deren sämtliche Gelenke geschwollen und verformt schienen.
»Alles klar!«, rief Alex. »Ich verzaubere ihre schäbigen Leibchen in wunderschöne Kleider, die sie mit Stolz in der Schule tragen werden!«
Die Drillinge sahen einander mit großen Augen an – konnte sie das wirklich?