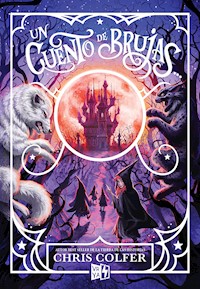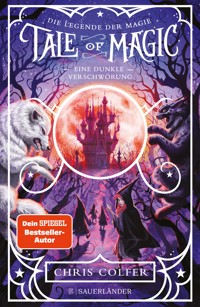9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Tale of Magic
- Sprache: Deutsch
Willkommen in Madame Weatherberrys geheimer Akademie! Brystal Evergreen liebt Bücher. Aber im Südlichen Königreich, wo sie lebt, ist Lesen für sie verboten. Als sie trotzdem an ein geheimnisvolles Buch gerät, ändert sich ihr Leben für immer: Brystal erfährt, dass sie magische Fähigkeiten besitzt! Sie wird an einer geheimen Akademie aufgenommen, wo sie zusammen mit anderen Schülern in guter Magie ausgebildet wird. Doch die magische Gemeinschaft kennt nicht nur gute, sondern auch böse Magie. Brystal, die zu Erstaunlichem bestimmt ist, findet sich mit ihren Freunden plötzlich inmitten eines Kampfs gegen finsterste Hexenkraft wieder. Und nicht nur die Zukunft der Akademie ist in Gefahr – sondern das Schicksal der ganzen Welt. Wie Chris Colfers erste Erfolgsserie »Land of Stories« stand auch »Tale of Magic« monatelang auf der New York-Times Bestsellerliste. Die neue magische Serie besticht als Feuerwerk der Phantasie und mit einer mutigen Heldin, die sich gegen Ungerechtigkeit wehrt. Ein Muss für »Land of Stories«-Fans – und alle Leser die große, phantastische Abenteuer lieben! »Ein durch und durch erfüllendes Abenteuer, auch für Colfer-Neulinge.« Publisher's Weekly »Eingebettet in Magie und Märchen bietet Colfer den Lesern viele Denkanstöße über Identität und Akzeptanz. Mitreißend!« Booklist »Fesselnde Fantasy voller Energie, die den Lesern kurze Nächte und großartige Träume bescheren wird.« School Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Chris Colfer
Tale of Magic Die Legende der Magie
Eine geheime Akademie
Biografie
Chris Colfer ist Schauspieler und Autor. Bekannt wurde er vor allem durch die Rolle des Kurt Hummel in »Glee«, für die er unter anderem 2011 mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet wurde. Alle Bände seiner »Land of Stories«-Reihe wurden zu internationalen Bestsellern und begeistern seither weltweit unzählige Fans.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Das englischsprachige Original erschien 2019 unter dem Titel »A Tale of Magic« bei Little, Brown and Company, New York.
Text © 2019 by Christopher Colfer
Umschlag und Innenillustrationen © 2019 by Brandon Dorman
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2021 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung einer Illustration von Brandon Dorman
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0377-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Vorsatz]
[Widmung]
[Karte]
Prolog Eine überraschende Audienz
Kapitel 1 Bücher und Frühstück
Kapitel 2 Ein Zeichen
Kapitel 3 Zutritt nur für Richter
Kapitel 4 Die Wahrheit über Magie
Kapitel 5 Familiengericht
Kapitel 6 Heil- und Besserungsanstalt für geplagte junge Frauen
Kapitel 7 Erlaubnis
Kapitel 8 Der Feuerjunge und das Smaragdmädchen
Kapitel 9 Madame Weatherberrys Akademie für Magie
Kapitel 10 Die Musikantentochter
Kapitel 11 Dysmagiekulie
Kapitel 12 Die Unerwünschten
Kapitel 13 Der Wächter des Waldes
Kapitel 14 Wut
Kapitel 15 Der Kreis der Wahrheit
Kapitel 16 Versprechen
Kapitel 17 Der Dazwischenwald
Kapitel 18 Das Blumenmädchen und der Baum der Wahrheit
Kapitel 19 Die Schlacht um den Norden
Kapitel 20 Die Schneekönigin
Kapitel 21 Forderungen
Kapitel 22 Die Geschichte der Magie
Dank
Ausblick auf Band 2
[Leseprobe Land of Stories: Das magische Land]
Für all die mutigen Menschen, die es in Zeiten der Unterdrückung gewagt haben, sie selbst zu sein. Dank euch konnte ich zu dem werden, der ich bin.
PrologEine überraschende Audienz
In jedem der vier Königreiche war Magie verboten – vorsichtig ausgedrückt. Es war sogar so, dass vor dem Gesetz Magie das schlimmste Verbrechen war, das ein Mensch begehen konnte, und es gab nichts, dem gesellschaftlich mehr Verachtung entgegengebracht wurde. In den meisten Gegenden drohte jedem die Todesstrafe, der mit einem verurteilten Hexer oder einer Hexe bloß in Verbindung stand.
Im Nördlichen Königreich wurden Straffällige und ihre Angehörigen vor Gericht gestellt und umgehend auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Im Östlichen Königreich reichten sehr wenige Hinweise aus, um die Beschuldigten und ihre Familie zum Tod am Galgen zu verurteilen. Und im Westlichen Königreich wurden verdächtige Hexen und Hexer ertränkt, ohne dass man sie auch nur dem Richter vorführte.
Die Hinrichtung erfolgte selten durch Amtsträger der Königreiche. Meist wurden die Beschuldigten Opfer eines Mobs wütender Bürger, die das Gesetz selbst in die Hand nahmen. Öffentlich missbilligten die Herrscher der Königreiche die Gräuel zwar, in Wirklichkeit aber freuten sie sich, dass ihr Volk etwas hatte, worauf es seinen Zorn richten konnte – solange die Regierung davon verschont blieb. Deshalb unternahmen die Monarchen nichts dagegen, und wenn politische Unruhen ausbrachen, riefen sie sogar zu diesen Untaten auf.
»Wer den Weg der Magie wählt, hat sich für den Weg der Verdammnis entschieden«, verkündete König Edelmut aus dem Norden. Unterdessen verursachte seine Politik die größte Hungersnot in der Geschichte des Königreichs.
»Wir dürfen niemals Mitleid mit Leuten zeigen, die solche Abscheulichkeiten begehen«, erklärte Königin Industria aus dem Osten und erhöhte kurze Zeit später die Steuern, um sich einen Sommerpalast zu bauen.
»Magie ist eine Beleidigung Gottes und der Natur und eine Gefahr für die Moral, wie wir sie kennen«, bemerkte König Kriegsmund aus dem Westen. Glücklicherweise lenkte diese Aussage sein Volk von den Gerüchten über seine acht unehelichen Kinder mit acht verschiedenen Geliebten ab.
Sobald eine Hexe oder ein Hexer enttarnt war, konnten sie der Verfolgung kaum entkommen. Viele flohen in den gefährlichen Urwald namens Dazwischenwald, der zwischen den Grenzen der Reiche wuchs. Unglücklicherweise war der Dazwischenwald jedoch die Heimat von Zwergen, Elben, Kobolden, Trollen, Ogern und all den anderen Spezies, die von den Menschen im Lauf der Jahre verbannt worden waren. Die Hexen und Hexer, die im Dickicht Zuflucht suchten, fanden meist ein schnelles und gewaltsames Ende durch die Hand barbarischer Geschöpfe.
Gnade für Hexen und Hexer (wenn man es Gnade nennen konnte) gab es nur im Südlichen Königreich.
Als König Champion XIV. den Thron von seinem Vater, dem verstorbenen Champion XIII., erbte, schaffte er erst einmal die Todesstrafe für verurteilte Magiekundige ab. Stattdessen mussten die Straffälligen eine lebenslange Haft mit Schwerarbeit verbüßen (und sie wurden jeden Tag daran erinnert, wie dankbar sie dafür sein sollten). Der König änderte das Gesetz nicht aus reiner Herzensgüte, sondern weil er seinen Frieden mit einer schrecklichen Erinnerung machen wollte.
Als Champion ein Kind war, wurde seine eigene Mutter wegen »Verdachts auf Interesse an Magie« geköpft. Den Vorwurf hatte Champion XIII. persönlich erhoben, deshalb kam niemand auf die Idee, die Anschuldigung zu überprüfen und die Unschuld der Königin zu beweisen, obwohl die Motive Champions XIII. schon am Tag nach der Hinrichtung fragwürdig erschienen, denn er heiratete umgehend eine viel jüngere und hübschere Frau. Seit dem allzu frühen Ende seiner Mutter hatte Champion XIV. die Tage gezählt, bis er das Erbe seines Vaters zerstören und sich an ihm rächen konnte. Und sobald die Krone auf seinem Kopf saß, widmete sich Champion XIV. hingebungsvoll der Aufgabe, Champion XIII. aus der Geschichte des Südlichen Königreichs zu tilgen.
Mittlerweile war König Champion ein alter Mann und verbrachte die meiste Zeit damit, möglichst wenig zu tun. Ein königlicher Erlass bestand nur noch aus einem Grunzen oder Augenrollen. Wenn er öffentlich in Erscheinung trat, begnügte sich der König damit, dem Volk aus seiner vorübereilenden Kutsche heraus müde zuzuwinken. Und königliche Verlautbarungen bestanden nur noch aus der Klage, die Korridore des Schlosses seien »zu lang« und die Treppen »zu steil«.
Seinen Mitmenschen ging Champion am liebsten aus dem Weg – allen voran seinen selbstgerechten Verwandten. Seine Mahlzeiten verzehrte er allein, er ging früh zu Bett, schlief lange aus und gönnte sich einen ausgedehnten Mittagsschlaf (und gnade Gott der armen Seele, die ihn zu früh weckte).
Eines Nachmittags wurde der König jedoch vorzeitig aus dem Schlummer gerissen, und zwar nicht durch ein argloses Enkelkind oder ein ungeschicktes Zimmermädchen, sondern durch einen abrupten Wetterwechsel. Schwere Regentropfen hämmerten gegen die Fenster seines Schlafgemachs, und ein heftiger Wind pfiff durch seinen Kamin herein. Es war ein sonniger, klarer Tag gewesen, daher staunte der erschöpfte Monarch nicht schlecht über den Sturm, der sich da zusammengebraut hatte.
»Ich bin auf«, verkündete Champion.
Der König wartete darauf, dass ein Diener hereineilte und ihm von seinem hohen Lager herunterhalf, aber sein Ruf blieb ungehört.
Aggressiv räusperte sich der Herrscher. »Ich sagte, ich bin auf«, rief er noch einmal, aber seltsamerweise rührte sich immer noch nichts.
Die Gelenke des Königs krachten, als er widerwillig aus dem Bett stieg. Leise fluchend humpelte er über den Steinboden, um seinen Morgenrock und seine Pantoffeln zu holen. Sobald er angekleidet war, stapfte er aus seinem Gemach in der Absicht, den ersten Diener, der ihm über den Weg lief, auszuschimpfen.
»Warum rührt sich niemand? Was in aller Welt kann wichtiger sein als …«
Champion verstummte und sah sich ungläubig um. Im Salon vor seinem Schlafgemach wimmelte es normalerweise nur so von Dienstboten, aber jetzt war er absolut leer. Selbst die Soldaten, die Tag und Nacht die Tür bewachten, hatten ihren Posten verlassen.
Der König spähte in den Flur hinaus, aber auch der war menschenleer. Doch es waren nicht nur die Diener und Soldaten verschwunden, sondern auch das Licht. Sogar die Kerzen in den Haltern und die Fackeln an den Wänden waren erloschen.
»Hallo?«, rief Champion in den Flur hinaus. »Ist da jemand?« Aber er vernahm nur den Widerhall seiner eigenen Stimme.
Auf der Suche nach einem lebenden Wesen strich der König vorsichtig durch das Schloss, aber in allen Ecken und Winkeln fand er nur Finsternis. Das war unglaublich beunruhigend – seit seiner frühen Kindheit lebte er in dem Schloss, und er hatte es niemals so entseelt erlebt. Er blickte durch jedes Fenster, an dem er vorbeikam, sah aber nichts außer Nebel und Regen.
Endlich umrundete der König die Biegung am Ende eines langen Korridors und entdeckte flackernde Lichter, die aus seinem privaten Arbeitszimmer drangen. Die Tür stand weit offen, und anscheinend hatte jemand ein Feuer im Kamin angefacht. Es hätte einladend gewirkt, wäre es nicht so unheimlich gewesen. Mit jedem Schritt, den er tat, schlug das Herz des Königs schneller. Ängstlich spähte er durch die Tür, um zu sehen, wer oder was ihn drinnen erwartete.
»Oh, seht! Der König ist wach!«
»Endlich.«
»Aber, aber, Mädchen. Wir müssen Seiner Majestät respektvoll begegnen.«
Der König fand zwei Mädchen und eine schöne Frau vor, die in seinem Arbeitszimmer auf dem Sofa saßen. Als er eintrat, erhoben sie sich rasch und verbeugten sich vor ihm.
»Eure Majestät, es ist uns ein Vergnügen, Eure Bekanntschaft zu machen«, sagte die Frau.
Sie trug ein elegantes violettes Kleid, das ihre großen hellen Augen betonte, und seltsamerweise nur einen Handschuh, der ihren linken Arm bedeckte. Ihr dunkles Haar wurde von einem kunstvollen Kopfputz mit Blumen, Federn und einem kurzen Schleier gehalten, der ihr übers Gesicht fiel. Die Mädchen, die kaum älter als zehn Jahre sein konnten, trugen schlichte weiße Kleider und kunstvoll gewickelte Kopftücher.
»Wer zum Henker seid ihr?«, fragte Champion.
»Oh, verzeiht«, erwiderte die Frau. »Ich bin Madame Weatherberry, und das sind meine Lehrlinge Miss Mandarina Murmin und Miss Skylene Lavendel. Ich hoffe, es stört Euch nicht, dass wir es uns in Eurem Arbeitszimmer bequem gemacht haben. Wir haben eine schrecklich lange Reise hinter uns und konnten der Versuchung eines gemütlichen Feuers nicht widerstehen.«
Madame Weatherberry hatte eine sehr warmherzige, charismatische Ausstrahlung. Sie war die Letzte, mit der König Champion in seinem verlassenen Schloss gerechnet hätte, was ihm die Frau und die Situation noch merkwürdiger erscheinen ließ. Madame Weatherberry streckte ihm die rechte Hand entgegen, aber er beachtete die freundliche Geste nicht. Stattdessen musterte der Monarch seine unerwarteten Gäste von Kopf bis Fuß und machte einen Schritt rückwärts.
Die Mädchen kicherten und musterten den ängstlichen König, als würden sie in seine Seele blicken und sie ulkig finden.
»Dies ist ein privater Raum in einer königlichen Residenz!«, tadelte Champion seine Besucherinnen. »Wie können Sie es wagen, ohne Erlaubnis einzutreten! Dafür könnte ich Sie auspeitschen lassen!«
»Bitte verzeiht unser Eindringen«, erwiderte Madame Weatherberry. »Es ist sonst nicht unsere Art, unangekündigt bei jemandem hereinzuplatzen, aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Leider hat Euer Sekretär Mr. Fellows auf keinen meiner Briefe geantwortet, in denen ich um eine reguläre Audienz gebeten habe. Er ist nicht sehr tüchtig, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Vielleicht wäre es an der Zeit, ihn zu ersetzen? Jedenfalls geht es um eine eilige Sache, die ich mit Euch besprechen möchte, deshalb sind wir hier.«
»Wie ist diese Frau hereingekommen?«, rief der König in das leere Schloss hinein. »Wo in Gottes Namen seid ihr alle?!«
»Ich fürchte, all Eure Untertanen sind im Augenblick unpässlich«, teilte ihm Madame Weatherberry mit.
»Was soll das heißen, unpässlich?«, bellte Champion.
»Oh, kein Grund zur Sorge, sie sind nur – zu Eurer eigenen Sicherheit – ein wenig verzaubert. Ich verspreche, all Eure Diener und Soldaten werden zurückkehren, sobald wir Zeit zum Reden hatten. Ich finde, diplomatische Gespräche kosten so viel weniger Mühe, wenn man nicht abgelenkt wird, findet Ihr nicht?«
Madame Weatherberry sprach mit ruhiger Stimme, nur bei einem Wort machte Champion große Augen und sein Blutdruck schoss in die Höhe.
»Verzaubert?«, keuchte der König. »Sie sind … eine … Sie sind eine HEXE!«
Champion richtete in solcher Panik den Zeigefinger auf Madame Weatherberry, dass er sich eine Muskelzerrung in der rechten Schulter zuzog. Stöhnend umklammerte der König seinen Arm, während seine Gäste über den dramatischen Auftritt kicherten.
»Nein, Eure Majestät, ich bin keine Hexe«, erwiderte Madame Weatherberry.
»Lügen Sie mich nicht an, Frau!«, rief der Monarch. »Nur Hexen können etwas verzaubern!«
»Nein, Eure Majestät, das ist nicht wahr.«
»Sie sind eine Hexe und Sie haben dieses Schloss verflucht! Dafür werden Sie bezahlen!«
»Offensichtlich gehört Zuhören nicht zu Euren Stärken«, meinte Madame Weatherberry. »Vielleicht kommt die Botschaft ja an, wenn ich sie dreimal wiederhole? Bei Begriffsstutzigen hilft das oftmals. Also – ich bin keine Hexe. Ich bin keine Hexe. Ich bin keine …«
»Wenn Sie keine Hexe sind, was sind Sie dann?«
Ganz gleich, wie laut der König brüllte und wie sehr er sich aufregte, Madame Weatherberry blieb stets höflich und ruhig.
»Genau das ist eine der Fragen, Eure Majestät, über die ich heute Abend mit Euch sprechen möchte«, erklärte sie. »Nun sollten wir aber nicht mehr von Eurer Zeit beanspruchen als nötig. Möchtet Ihr nicht Platz nehmen, damit wir anfangen können?«
Wie von einer unsichtbaren Hand gezogen, setzte sich der Stuhl am Schreibtisch in Bewegung, und Madame Weatherberry lud den König mit einer Geste ein, sich zu setzen. Champion nahm zögerlich Platz und blickte nervös zwischen seinen Besucherinnen hin und her. Die Mädchen setzten sich aufs Sofa und falteten artig die Hände auf dem Schoß. Madame Weatherberry ließ sich zwischen ihren Lehrlingen nieder und schlug ihren Schleier zurück, so dass sie dem Monarchen direkt in die Augen schauen konnte.
»Als Erstes möchte ich Euch danken, Eure Majestät«, begann Madame Weatherberry. »Ihr seid der einzige Herrscher in der Geschichte, der gegenüber der magischen Gemeinschaft ein wenig Gnade gezeigt hat – obwohl manche meinen, lebenslängliche Haft mit Zwangsarbeit sei schlimmer als der Tod –, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin zuversichtlich, dass wir anstelle von Schritten Sprünge machen könnten, wenn wir nur – Eure Majestät, was ist passiert? Offenbar habe ich nicht Eure ganze Aufmerksamkeit.«
Ein merkwürdiges Summen und Rauschen hatte die Neugier des Königs geweckt. Er sah sich im Arbeitszimmer um, konnte aber die Quelle der seltsamen Geräusche nicht entdecken.
»Tut mir leid, ich dachte, ich hätte etwas gehört«, entschuldigte sich der König. »Was haben Sie gesagt?«
»Ich drückte meine Dankbarkeit aus für die Gnade, die Ihr der magischen Gemeinschaft erwiesen habt.«
Der König grunzte verächtlich. »Tja, Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, ich hätte das geringste Mitgefühl mit den Angehörigen der sogenannten magischen Gemeinschaft«, spöttelte er. »Ganz im Gegenteil, ich bin genauso fest überzeugt wie andere Monarchen, dass Magie verderblich und unnatürlich ist. Meine Sorge ist, dass Menschen Magie nutzen, um sich dem Gesetz zu entziehen.«
»Und das ist eine löbliche Einstellung, Eure Majestät«, erwiderte Madame Weatherberry. »In Eurer Gerechtigkeitsliebe unterscheidet Ihr Euch von allen anderen Herrschern. Jetzt möchte ich Euch aber über Magie aufklären, damit Ihr aus diesem Königreich einen gerechten, sicheren Ort für alle seine Bewohner machen könnt. Schließlich gibt es keine Gerechtigkeit, wenn sie nicht für alle gilt.«
Das Gespräch hatte gerade erst begonnen, und schon machte es den König wütend. »Was meinen Sie mit ›aufklären‹?«, schnaubte er.
»Eure Majestät, dass Magie zum Verbrechen erklärt und geächtet wird, ist das größte Unrecht unserer Zeit. Aber mit den geeigneten Gesetzesänderungen – und ein wenig strategischer Werbung – können wir das Ruder herumreißen. Gemeinsam können wir eine Gesellschaft schaffen, die alle Geschöpfe in der Entfaltung ihrer Möglichkeiten fördert – Eure Majestät, hört Ihr mir zu? Oder seid Ihr in Gedanken woanders?«
Wieder war der König durch das geheimnisvolle Summen und Rauschen abgelenkt worden. Noch hektischer als zuvor suchte er mit Blicken den Raum ab, und er verstand nur jedes zweite Wort, das Madame Weatherberry sagte.
»Ich muss Sie falsch verstanden haben«, sagte er. »Es hat sich eben so angehört, als wollten Sie für die Legalisierung von Magie eintreten?«
»Oh, das habt Ihr ganz richtig verstanden«, erwiderte Madame Weatherberry lachend. »Das Verbot von Magie aufzuheben ist genau das, was ich vorschlage.«
Champion setzte sich abrupt aufrecht hin, wobei er die Armlehnen seines Stuhls umklammerte. Madame Weatherberry hatte nun seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie konnte doch unmöglich etwas dermaßen Lächerliches andeuten.
»Sind Sie noch gescheit, Frau?«, höhnte der König. »Magie kann niemals erlaubt werden!«
»Keineswegs, Eure Majestät, das ist durchaus möglich«, entgegnete Madame Weatherberry. »Dazu braucht es lediglich einen königlichen Erlass, der die Strafbarkeit der Tat aufhebt, und nach einiger Zeit wird auch die Ächtung der Täter ein Ende haben.«
»Da würde ich lieber Mord und Diebstahl erlauben!«, erklärte der König. »Der Herr sagt ganz klar im Buch des Glaubens, dass Magie eine grauenhafte Sünde ist, und daher gilt sie in diesem Königreich als Verbrechen! Und wenn Verbrechen ungestraft bleiben, würde das Chaos ausbrechen!«
»Genau in diesem Punkt irrt Ihr Euch, Majestät«, sagte sie. »Magie ist nämlich nicht so ein Verbrechen, wie alle Welt glaubt.«
»Natürlich ist sie das!«, wetterte er. »Ich habe beobachtet, wie Magie benutzt wurde, um unschuldige Menschen zu täuschen und zu quälen! Ich habe die Leichen von Kindern gesehen, die für Tränke und Zaubersprüche abgeschlachtet wurden! Und ich habe Dörfer gesehen, die im Bann von Flüchen standen! Wagt es also nicht, Magie zu verteidigen, Madame! Die magische Gemeinschaft wird von diesem Herrscher kein Quäntchen Mitgefühl oder Verständnis ernten!«
Champion hätte seine Ablehnung nicht deutlicher zeigen können, aber Madame Weatherberry rückte auf ihrem Sitzplatz nach vorn und lächelte, als hätten sie sich schon geeinigt.
»Das mag Euch überraschen, mein Herr, aber ich stimme Euch absolut zu«, sagte sie.
»Wirklich?«, fragte er und beäugte sie misstrauisch.
»Ja, absolut«, wiederholte sie. »Ich glaube, wer unschuldige Menschen quält, sollte durchaus für seine Taten bestraft werden – und zwar hart bestraft, möchte ich ergänzen. Es gibt nur einen kleinen Fehler in Euren Überlegungen. Die Ereignisse, die Ihr beobachtet habt, wurden nicht durch Magie ausgelöst, sondern durch Hexerei.«
Der König runzelte die Stirn und sah Madame Weatherberry an, als hätte sie in einer fremden Sprache gesprochen. »Hexerei?«, spottete er. »Davon habe ich noch nie gehört.«
»Dann erlaubt mir, es Euch zu erklären«, bat Madame Weatherberry. »Hexerei ist ein grausiges, schändliches Verfahren. Sie entstammt dem dunklen Wunsch, zu täuschen und zu zerrütten. Nur kaltherzige Menschen sind zur Hexerei fähig, und glaubt mir, sie verdienen das Schicksal, das ihnen blüht. Magie ist jedoch etwas vollkommen anderes. Sie dient dazu, den Elenden zu helfen und sie zu heilen, und sie kann nur tiefer Herzensgüte entspringen.«
Der König sank auf seinem Stuhl zusammen und hielt sich den Kopf. Ihm war ganz schwindelig geworden.
»Du liebe Zeit, ich habe Euch zu viel zugemutet«, bedauerte Madame Weatherberry. »Ich will es für Euch einfacher ausdrücken. Magie ist gut, Magie ist gut, Magie ist gut. Hexerei ist böse, Hexerei ist böse, Hexerei ist …«
»Behandeln Sie mich nicht von oben herab, Frau – ich habe Sie verstanden!«, murrte der König. »Lassen Sie mir etwas Zeit, um das zu begreifen!«
Champion seufzte gedehnt und rieb sich die Schläfen. Normalerweise fiel es ihm schon schwer genug, so kurz nach dem Mittagsschlaf Neuigkeiten zu verarbeiten, aber solche Anforderungen waren ganz neu für ihn. Der König schloss die Augen und konzentrierte sich, als würde er hinter seinen Lidern ein Buch lesen.
»Sie sagen, Magie ist nicht dasselbe wie Hexerei?«
»Ganz richtig.« Madame Weatherberry nickte ermutigend. »Äpfel und Birnen.«
»Und beide sind von Natur aus unterschiedlich?«
»Sie sind unvereinbare Gegensätze.«
»Wenn nicht Hexen, wie nennt ihr dann Leute, die Magie praktizieren?«
Madame Weatherberry reckte stolz den Kopf. »Wir nennen uns Feen, Eure Majestät.«
»Feen?«, fragte der König.
»Jawohl, Feen«, wiederholte sie. »Versteht Ihr nun meinen Wunsch, Euch aufzuklären? Grund zur Sorge geben nicht Feen, die Magie praktizieren, sondern Hexen, die sich der Hexerei verschrieben haben. Aber tragischerweise wurden wir in einen Topf geworfen und seit Jahrhunderten verdammt, als wären wir irgendwie vergleichbar. Glücklicherweise sind wir unter meiner Anleitung und mit Eurem Einfluss durchaus in der Lage, das richtigzustellen.«
»Ich fürchte, da bin ich anderer Meinung«, erwiderte der König.
»Verzeihung?«, fragte Madame Weatherberry.
»Der eine stiehlt aus Gier, der andere, um zu überleben, aber beide sind Diebe.«
»Aber, Majestät, ich dachte, ich hätte absolut klargestellt, dass die Hexerei das Verbrechen ist, und nicht die Magie.«
»Ja, aber beides wurde seit Anbeginn der Zeit als Sünde angesehen«, fuhr Champion fort. »Wissen Sie, wie schwierig es ist, die Meinung einer Gesellschaft zu ändern? Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um mein Königreich davon zu überzeugen, dass Kartoffeln nicht giftig sind – und die Leute auf dem Markt kaufen sie immer noch nicht!«
Madame Weatherberry schüttelte ungläubig den Kopf. »Vergleicht Ihr einen unschuldigen Menschenschlag mit Kartoffeln, Majestät?«
»Ich verstehe, was Sie vorhaben, Madame, aber die Welt ist noch nicht so weit – ich bin noch nicht so weit! Wenn Sie die Feen vor ungerechten Strafen schützen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie ihnen raten, sie sollten sich ruhig verhalten und dem Drang zur Anwendung von Magie widerstehen! Das wäre weitaus leichter, als alle Dickköpfe der Welt für Ihre Sicht der Dinge zu gewinnen.«
»Dem Drang widerstehen? Majestät, das kann nicht Euer Ernst sein!«
»Warum nicht? Normale Menschen widerstehen tagtäglich der Versuchung.«
»Weil Ihr meint, Magie könne man einfach ausschalten – als hätte man die Wahl.«
»Natürlich hat man bei Magie die Wahl!«
»NEIN! DIE! HAT! MAN! NICHT!«
Zum ersten Mal seit Beginn des Gesprächs legte Madame Weatherberry ihre freundlichen Umgangsformen ab. Eine tiefsitzende Wut trübte ihr sonst so fröhliches Gemüt, ihre Miene wurde eisig, ihr Blick stechend. Es war, als hätte Champion eine ganz andere Frau vor sich – eine Frau, die man fürchten musste.
»Magie ist keine freie Entscheidung«, erklärte Madame Weatherberry scharf. »Unwissenheit ist eine Entscheidung. Hass ist eine Entscheidung. Gewalt ist eine Entscheidung. Aber die Existenz an sich ist niemals eine Entscheidung, und sie ist auch kein Fehler, und ganz sicher kein Verbrechen. Das solltet Ihr Euch klarmachen.«
Champion brachte kein Wort mehr heraus. Vielleicht bildete er es sich nur ein, aber der Sturm draußen schien zuzunehmen, als Madame Weatherberry wütend wurde. Offensichtlich kam das bei ihr selten vor, denn ihre Lehrlinge wirkten ebenso beunruhigt wie der König. Die Fee schloss die Augen und holte tief Luft, ehe sie das Gespräch fortsetzte.
»Vielleicht sollten wir Seiner Majestät vorführen, worum es geht«, schlug Madame Weatherberry mit ruhiger Stimme vor. »Mandarina? Skylene? Würdet ihr König Champion zeigen, warum Magie keine freie Entscheidung ist?«
Die Lehrlinge tauschten ein eifriges Lächeln – darauf hatten sie gewartet. Sie sprangen auf, legten ihre Umhänge und ihre Kopftücher ab. Bei Mandarina kamen ein Gewand aus tropfenden Honigwaben und zu einem Bienenstock aufgetürmtes leuchtend rotes Haar zum Vorschein, in dem sich ein lebendiger Hummelschwarm tummelte. Skylene enthüllte einen saphirblauen Badeanzug, und anstelle einer Haarmähne ergossen sich Wasserfontänen über ihren Körper, die verdampften, ehe sie bei ihren Füßen angelangt waren.
Mit offenem Mund starrte Champion die beiden Mädchen an. In all seinen Jahren auf dem Thron hatte er niemals beobachtet, wie sich Magie in der Erscheinung eines Menschen materialisiert. Das Geheimnis des seltsamen Summens und Rauschens war nun auch geklärt.
»Mein Gott«, keuchte der König. »Sehen alle Feen so aus?«
»Magie hat auf jeden von uns andere Auswirkungen«, erklärte Madame Weatherberry. »Manche führen ein völlig normales Leben, bis sich ihre Magie offenbart, während andere von Geburt an körperliche Merkmale aufweisen.«
»Das kann nicht wahr sein«, widersprach der König. »Wenn Menschen mit magischen Eigenschaften auf die Welt kämen, wären die Gefängnisse mit Säuglingen überfüllt! Und unsere Gerichte haben noch niemals ein Baby verhaften lassen.«
Madame Weatherberry ließ den Kopf hängen. Ihr Blick war traurig.
»Das kommt, weil die meisten Feen nach ihrer Geburt getötet oder ausgesetzt werden. Ihre Eltern fürchten die Folgen, wenn sie ein magisches Kind aufziehen, also tun sie alles, um der Strafe zu entgehen. Es war ein Wunder, dass ich Mandarina und Skylene gefunden habe, bevor ihnen etwas zugestoßen ist. Eure Majestät, ich verstehe Eure Bedenken, aber was mit diesen Kindern geschieht, ist grausam und primitiv. Magie zu erlauben würde nicht nur der Gerechtigkeit dienen, es würde Unschuldige retten. Gewiss findet Ihr in Eurem Herzen Mitgefühl und Verständnis für dieses Anliegen.«
Champion wusste, dass er in einer harten Welt lebte, aber von solchen Gräueln hatte er noch nicht gehört. Er schaukelte auf seinem Stuhl vor und zurück, während sein Widerwille mit seinem Mitgefühl rang. Madame Weatherberry entging nicht, dass sie bei ihren Verhandlungen Fortschritte machte, also brachte sie nun einen Gedanken ins Spiel, den sie sich für den rechten Augenblick aufgespart hatte.
»Bedenkt, wie anders die Welt sein könnte, wenn sie ein wenig mehr Mitgefühl für die magisch Begabten hätte. Bedenkt, wie anders Euer Leben hätte aussehen können, Majestät.«
Plötzlich strömten Erinnerungen an seine Mutter auf Champion ein. Er sah ihr Gesicht vor sich, ihr Lächeln, ihr Lachen, vor allem aber erinnerte er sich daran, wie sie ihn fest in die Arme geschlossen hatte, ehe sie ihm von den Henkern entrissen worden war. So eingerostet sein Gedächtnis mit dem Alter geworden war, diese Bilder waren für immer in sein Hirn eingebrannt.
»Ich würde Euch gern helfen, aber Magie straffrei zu stellen, könnte mehr Probleme als Lösungen schaffen. Wenn man die Öffentlichkeit zwingt zu akzeptieren, was sie hasst und fürchtet, könnte das zu einer Rebellion führen! Die Hexenjagd, wie wir sie kennen, könnte in einen regelrechten Völkermord ausarten!«
»Glaubt mir, die menschliche Natur ist mir durchaus vertraut«, erwiderte Madame Weatherberry. »Straffreiheit für Magie darf nicht überstürzt eingeführt werden. Im Gegenteil, man sollte das Thema vorsichtig behandeln – mit viel Geduld und Beharrlichkeit. Wenn wir die Meinung der Welt ändern wollen, muss sie, frei von Zwang, ermuntert werden – und nichts wirkt so aufmunternd wie ein gutes Spektakel.«
Nervös starrte der König sie an. »Spektakel?«, fragte er ängstlich. »Was für ein Spektakel haben Sie im Sinn?«
Madame Weatherberry lächelte, und ihre strahlenden Augen leuchteten noch heller – darauf hatte sie gewartet.
»Als ich Mandarina und Skylene kennenlernte, waren sie Gefangene ihrer Magie«, erklärte sie. »Niemand konnte sich Mandarina nähern, ohne von ihren Hummeln angegriffen zu werden, und die arme Skylene lebte in einem See, weil sie alles durchnässte, worauf sie trat. Also nahm ich die beiden unter meine Fittiche und lehrte sie, ihre Magie zu beherrschen, und heute sind sie beide tüchtige junge Damen. Es bricht mir das Herz, wenn ich an all die anderen Kinder da draußen denke, die nicht wissen, wer oder was sie sind, also habe ich beschlossen, ihnen meine Tür zu öffnen und ihnen eine gute Ausbildung zu geben.«
»Sie wollen eine Schule eröffnen?«, fragte der König.
»Genau«, antwortete sie. »Sie heißt Madame Weatherberrys Akademie für junge Magier und Magierinnen – das ist aber erst der vorläufige Name.«
»Und wo soll sich diese Akademie befinden?«, erkundigte er sich.
»Ich habe unlängst ein paar Tagwerk Land im Südosten des Dazwischenwalds erworben.«
»Der Dazwischenwald?«, protestierte der König. »Frau, sind Sie vollkommen verrückt? Der Dazwischenwald ist viel zu gefährlich für Kinder! Sie können dort keine Schule eröffnen!«
»Oh, das will ich nicht bestreiten«, erwiderte Madame Weatherberry. »Der Dazwischenwald ist außerordentlich gefährlich für alle, die mit dem Gebiet nicht vertraut sind. Es gibt jedoch zahlreiche magisch Begabte, darunter ich selbst, die seit Jahrzehnten im Dazwischenwald ein recht angenehmes Leben führen. Das Land, das ich erworben habe, ist absolut abgeschieden. Und ich habe alle nötigen Vorkehrungen zum Schutz meiner Schüler getroffen.«
»Aber wie soll eine Akademie dazu beitragen, Magie straffrei zu machen?«
»Sobald ich meinen Zöglingen beigebracht habe, wie sie ihre Fähigkeiten beherrschen können, werden wir uns nach und nach der Welt zeigen. Wir werden unsere Magie nutzen, um Kranke zu heilen und Menschen in Not zu helfen. Nach einiger Zeit wird sich die Nachricht unserer Barmherzigkeit in den Königreichen verbreiten. Feen werden zum Musterbeispiel der Großzügigkeit werden, und die Menschen werden uns mit Zuneigung begegnen. Die Welt wird sehen, was die Magie zu bieten hat, sie wird ihre Meinung über uns ändern, und die magisch Begabten werden endlich in der Gesellschaft willkommen geheißen.«
Champion kratzte sich am Kinn, während er über Madame Weatherberrys noblen Plan nachdachte. So detailliert er war, das Wichtigste hatte sie vergessen – die Rolle, die er selbst darin spielen sollte.
»Sie scheinen sehr wohl imstande zu sein, das allein durchzuführen. Was wollen Sie von mir?«
»Selbstverständlich wünsche ich mir Eure Zustimmung«, sagte sie. »Feen ersehnen sich Vertrauen, und Vertrauen können wir nur gewinnen, wenn wir die Dinge richtig anpacken. Deshalb bitte ich um Eure offizielle Erlaubnis, durch das Südliche Königreich zu reisen, um Schüler anzuwerben. Außerdem wünsche ich mir Euer Versprechen, dass die Kinder und Familien, mit denen ich zusammenkomme, von Verfolgung durch den Arm des Gesetzes verschont bleiben. Meine Mission ist es, diesen jungen Menschen ein besseres Leben zu bieten. Und es liegt mir fern, jemanden in Gefahr zu bringen. Es wird höchst schwierig sein, Eltern davon zu überzeugen, dass sie ihr Kind auf eine Schule für Magie schicken. Wenn sie aber den Segen ihres Monarchen haben, wird es ihnen viel leichter fallen – vor allem wenn dieser Segen schriftlich vorliegt.«
Madame Weatherberry strich mit der Hand über den Schreibtisch des Königs, und ein goldenes Pergament erschien vor ihm. Alles, worum sie gebeten hatte, stand bereits darauf – es fehlte nur noch die Unterschrift des Königs. Champion rieb besorgt seine Oberschenkel, während er das Dokument immer wieder durchlas.
»Das könnte gründlich schiefgehen«, meinte er schließlich. »Wenn meine Untertanen herausfinden, dass ich einer Hexe – Verzeihung – einer Fee gestattet habe, Kinder auf eine magische Schule mitzunehmen, dann würde es eine offene Revolte geben! Mein Volk würde meinen Kopf auf einem Silbertablett fordern!«
»In diesem Fall sagt Eurem Volk, Ihr habet mir befohlen, Euer Königreich von magisch begabten Kindern zu säubern«, schlug sie vor. »Erklärt, dass Ihr in dem Bemühen um eine Zukunft ohne Magie die Kinder zusammentreiben und fortschaffen lasst. Ich habe festgestellt, dass eine Verlautbarung desto größeren Anklang bei den Leuten findet, je pöbelhafter sie ist.«
»Dennoch ist das ein Glücksspiel für uns beide! Dass Sie meine Erlaubnis haben, garantiert noch nicht Ihre Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihr Wohlergehen?«
»Eure Majestät, darf ich Euch erinnern, dass ich die komplette Dienerschaft Eures Schlosses habe verschwinden lassen, dass Mandarina über einen Hummelschwarm befiehlt und Skylene mit dem Wasser, das ihren Körper durchfließt, eine Schlucht fluten könnte? Wir können uns schützen.«
Trotz ihrer Worte schien der König eher ängstlich als überzeugt zu sein. Madame Weatherberry war so nah dran zu erreichen, was sie wollte – sie musste Champions Zweifel auslöschen, bevor sie ihn überwältigten. Glücklicherweise hatte sie noch ein Ass im Ärmel.
»Mandarina? Skylene? Könntet ihr mich einen Moment mit dem König allein lassen?«, bat sie.
Offensichtlich wollten Mandarina und Skylene keinen Augenblick der Unterhaltung zwischen Madame Weatherberry und dem König verpassen, aber sie respektierten den Wunsch ihrer Beschützerin und traten auf den Flur. Sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, lehnte sich Madame Weatherberry vor und blickte dem König mit ernster Miene tief in die Augen.
»Eure Majestät, wisst Ihr über den Konflikt im Norden Bescheid?«, fragte sie.
Der König riss die Augen auf, was darauf schließen ließ, dass er mehr als nur Bescheid wusste. Allein die Erwähnung des Konflikts im Norden hatte einen lähmenden Effekt auf ihn, und er rang nach Worten.
»Wie … wie … wie in aller Welt haben Sie davon erfahren?«, fragte er. »Das ist eine Geheimsache!«
»Die magische Gemeinschaft mag klein und zerstritten sein, aber es macht rasch die Runde, wenn einer von uns … nun ja, eine Szene macht.«
»Eine Szene macht? So nennen Sie das also?!«
»Eure Majestät, bitte sprecht leiser«, bat sie und nickte zur Tür hin. »Schlechte Nachrichten gelangen allzu leicht an junge Ohren. Meine Mädchen würden sich schlimme Sorgen machen, wenn sie wüssten, worüber wir reden.«
Dafür hatte Champion Verständnis, denn er spürte selbst den Würgegriff der Sorge. An die Angelegenheit erinnert zu werden glich der Wiederbegegnung mit einem Gespenst – ein Gespenst, von dem er geglaubt hatte, es sei zur ewigen Ruhe gebettet worden.
»Warum sprechen Sie über so etwas Grauenhaftes?«, wollte er wissen.
»Weil es zurzeit keine Garantie gibt, dass der Konflikt im Norden nicht die Grenze überschreitet und an Eure Tür klopft«, warnte Madame Weatherberry.
Der König schüttelte den Kopf. »Das wird nicht geschehen. König Edelmut hat mir versichert, dass er die Lage im Griff hat. Er hat uns sein Wort gegeben.«
»König Edelmut hat Euch belogen! Er hat den anderen Herrschern versichert, er hätte die Lage unter Kontrolle, weil es demütigend für ihn ist, wie schlimm es mittlerweile aussieht! Mehr als die Hälfte des Nördlichen Königreichs ist schon verwüstet! Seine Armee ist auf ein Viertel geschrumpft, und er verliert täglich weitere Soldaten! Der König schreibt den Verlust einer Hungersnot zu, weil er fürchtet, gestürzt zu werden, wenn sein Volk die Wahrheit erfährt!«
Champion wurde leichenblass, und er begann zu zittern. »Nun ja? Kann man da etwas tun? Oder soll ich hier sitzen und abwarten, bis auch ich zugrunde gehe?«
»In jüngster Zeit gibt es Hoffnung«, sagte Madame Weatherberry. »Edelmut hat einen neuen Befehlshaber ernannt, General Weiß, der die restlichen Verteidiger anführt. Bisher hat der General mehr erreicht als seine Vorgänger.«
»Das ist doch schon etwas«, meinte der König.
»Ich hoffe inständig, dass General Weiß Erfolg hat, aber Ihr müsst vorbereitet sein, falls er scheitert«, erwiderte sie. »Und sollte der Konflikt ins Südliche Königreich übergreifen, könnte es sehr hilfreich sein, wenn Euch eine Akademie ausgebildeter Feen beisteht.«
»Sie glauben, Ihre Schüler könnten in dem Konflikt etwas ausrichten?«, fragte der König verzweifelt.
»Ja, Eure Majestät«, erwiderte sie zuversichtlich. »Ich glaube, meine künftigen Schüler werden vieles schaffen, was die Welt heute für unmöglich hält. Aber zunächst einmal brauchen sie einen Ort, um zu lernen, und eine Lehrerin, die sie anleitet.«
Champion ging in sich und dachte über das Angebot nach.
»Ja … ja, sie könnten äußerst hilfreich sein«, murmelte er vor sich hin. »Natürlich muss ich meinen Hofrat der Obersten Richter konsultieren, bevor Sie Ihre Antwort bekommen.«
»Eure Majestät«, sagte Madame Weatherberry, »ich glaube, es handelt sich um eine Sache, die wir ohne die Obersten Richter regeln können. Der Hofrat ist ziemlich altmodisch eingestellt, und ich würde es ungern sehen, dass uns die Richter mit ihrer Querköpfigkeit Steine in den Weg legen. Zudem wird im Land einiges geredet, was Ihr erfahren solltet. Viele im Volk sind überzeugt, dass die Obersten Richter über das Südliche Königreich herrschen und Ihr nur eine Marionette seid.«
»Das ist empörend!«, rief der König. »Ich bin der Monarch – mein Wille ist Gesetz!«
»Stimmt«, sagte sie. »Jeder, der bei Verstand ist, weiß das. Aber die Gerüchte halten sich. An Eurer Stelle würde ich diese bösartigen Theorien widerlegen, indem ich dem Hofrat gelegentlich widerspreche. Und es wäre ein guter Anfang, wenn Ihr das Dokument unterzeichnet, das vor Euch liegt.«
Champion nickte und ließ sich ihre Warnung durch den Kopf gehen, und schließlich gelangte er zu einer Entscheidung.
»Nun gut«, sagte der König. »Sie dürfen zwei Schüler aus dem Südlichen Königreich für Ihre Schule anwerben – einen Jungen und ein Mädchen – aber nicht mehr. Und Sie brauchen dazu die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten.«
»Ich gestehe, dass ich mir eine bessere Vereinbarung erhofft hatte, aber ich nehme, was ich kriegen kann«, erwiderte Madame Weatherberry. »Abgemacht.«
Der König holte Feder und Tinte aus seinem Schreibtisch und nahm einige Änderungen an dem goldenen Dokument vor. Dann unterschrieb er das Abkommen und versah es mit Siegelwachs, in das er das königliche Wappen seiner Familie prägte. Madame Weatherberry sprang auf und klatschte vor Freude in die Hände.
»Oh, was für ein wunderbarer Augenblick! Mandarina? Skylene? Kommt herein! Der König hat unsere Bitte erfüllt!«
Die Lehrlinge eilten herbei und waren ganz aus dem Häuschen, als sie die Unterschrift des Königs sahen. Mandarina rollte das Dokument zusammen, und Skylene versah es mit einem silbernen Band.
»Vielen, vielen Dank, Eure Majestät«, sagte Madame Weatherberry und ließ den Schleier wieder über ihr Gesicht fallen. »Ich verspreche Euch, Ihr werdet Eure Entscheidung nicht bereuen!«
Der König schnaubte skeptisch und rieb sich die müden Augen. »Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, denn wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich dem Königreich erzählen, dass ich verhext und bestochen wurde von einer …«
Champion verschlug es den Atem, als er aufblickte. Madame Weatherberry und ihre Lehrlinge hatten sich in Luft aufgelöst. Der König eilte zur Tür, um zu sehen, ob sie in den Flur hinausgeeilt waren, aber dort herrschte ebenso gähnende Leere wie zuvor. Nur Augenblicke nach dem Verschwinden der drei flammten sämtliche Kerzen und Fackeln im Schloss wie durch Zauberhand wieder auf. Schritte hallten durch die Korridore, weil Dienstboten und Soldaten wieder ihren Pflichten nachgingen. Der König trat an ein Fenster und bemerkte, dass sich der Sturm verzogen hatte, aber das aufklarende Wetter spendete Champion wenig Trost.
Im Gegenteil, Furcht packte den König, als er in den nördlichen Himmel blickte, wissend, dass irgendwo am Horizont der wahre Sturm lauerte …
Kapitel 1Bücher und Frühstück
Es war kein Wunder, dass alle Mönche in der Hauptstadt des Südlichen Königreichs schlecht hörten. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang hüllten sie die Stadt Chariot Hills für zehn Minuten in ohrenbetäubendes Glockengeläut. Wie die Erschütterungen eines Erdbebens rüttelte der klirrende Lärm den Marktplatz durch, pulsierte durch die Straßen der Stadt und ließ die Dörfer in der Umgebung erzittern. Die Mönche läuteten die Glocken absichtlich, als wären sie rasend geworden, damit auch bestimmt jeder Bürger der Stadt aus dem Schlaf schreckte und den Tag des Herrn begehen konnte. Und wenn dann alle Sünder wach waren, huschten die Mönche zurück in ihre Betten.
Trotzdem machte das Glockengeläut nicht jedem in der Gegend zu schaffen. Die Mönche wären außer sich vor Zorn gewesen, wenn sie wüssten, dass ein junges Mädchen auf dem Land den unerträglichen Lärm einfach verschlief.
Die vierzehnjährige Brystal Evergreen wurde auf die gleiche Weise geweckt wie jeden Morgen – durch das Pochen an ihrer Zimmertür.
»Brystal, schläfst du noch? Brystal?«
Als die Mutter zum siebten oder achten Mal gegen die Tür hämmerte, blinzelte Brystal und schlug ihre blauen Augen auf. Sie war nicht unbedingt eine Langschläferin, nur nach Nächten, in denen sie lange aufgeblieben war, fühlte sie sich morgens einfach noch erschöpft.
»Brystal? Antworte, Kind!«
Brystal setzte sich im Bett auf, während die Kirchenglocken in der Ferne ihre letzten Schläge taten. Auf ihrem Bauch fand sie eine aufgeschlagene Ausgabe von Die Abenteuer von Tidbit Twitch von Tomfree Taylor, und an ihrer Nasenspitze hing eine Brille. Wieder einmal war sie beim Lesen eingeschlafen, und schnell machte sie sich daran, alle Spuren zu beseitigen, bevor sie erwischt wurde. Sie versteckte das Buch unter dem Kopfkissen, ließ die Lesebrille in einer Tasche ihres Nachthemds verschwinden und pustete die Kerze auf dem Nachttisch aus, die seit gestern Abend brannte.
»Junge Dame, es ist zehn nach sechs! Ich komme jetzt rein!«
Mrs. Evergreen stieß die Tür auf und stob ins Zimmer wie ein wilder Bulle, den man aus dem Pferch gelassen hat. Sie war eine dünne Frau mit blassem Gesicht und dunklen Ringen unter den Augen. Die Haare hatte sie oben auf dem Kopf zu einem strengen Dutt gebunden, der, wie bei einem Pferd die Zügel, ihre Aufmerksamkeit zu steigern schien, mit der sie allen täglichen Pflichten nachkam.
»Du bist ja doch wach«, sagte sie und hob eine Augenbraue. »Eine kurze Antwort ist wohl zu viel verlangt?«
»Guten Morgen, Mutter«, trällerte Brystal fröhlich. »Ich hoffe, du hast gut geschlafen.«
»Anscheinend nicht so gut wie du«, erwiderte Mrs. Evergreen. »Mal ehrlich, Kind, wie kannst du nur jeden Morgen dieses schreckliche Glockengeläut verschlafen? Das weckt irgendwann noch die Toten!«
»Einfach Glück, schätze ich«, sagte Brystal und gähnte ausgiebig.
Mrs. Evergreen legte ein weißes Kleid an das Fußende von Brystals Bett und warf ihrer Tochter einen scharfen Blick zu.
»Du hast schon wieder deine Uniform auf der Wäscheleine vergessen«, sagte sie. »Wie oft soll ich dich noch erinnern, dass du dich um deine Sachen kümmerst? Mit der Wäsche für deinen Vater und deine Brüder komme ich kaum hinterher – da hab ich wirklich keine Zeit, auch noch dir hinterherzuräumen.«
»Tut mir leid, Mutter«, entschuldigte sich Brystal. »Ich wollte sie gestern Abend nach dem Abwasch holen, aber dann ich hab es wohl vergessen.«
»Diese Nachlässigkeiten müssen aufhören! Tagträumereien sind das Letzte, wonach ein Mann bei einer Frau sucht«, warnte ihre Mutter sie. »Jetzt beeil dich. Zieh dich an, damit du mir beim Frühstück helfen kannst. Dein Bruder hat heute seinen großen Tag, also gibt es sein Lieblingsessen.«
Mrs. Evergreen wandte sich zum Gehen, aber als ihr ein seltsamer Geruch in die Nase stieg, hielt sie inne.
»Ist das Rauch?«, fragte sie.
»Ich habe gerade die Kerze ausgepustet«, erklärte Brystal.
»Und warum hat sie so früh am Morgen gebrannt?«, wollte Mrs. Evergreen wissen.
»Ich … ich hab sie versehentlich über Nacht angelassen«, gab Brystal zu.
Mit verschränkten Armen funkelte Mrs. Evergreen ihre Tochter an. »Brystal, du hast doch nicht getan, was ich glaube, dass du getan hast?«, schimpfte sie. »Denn ich sorge mich, was dein Vater anstellt, wenn er herausfindet, dass du schon wieder gelesen hast.«
»Nein, ich schwöre!«, log Brystal. »Ich schlafe nur lieber mit Licht. Im Dunkeln bekomme ich manchmal Angst.«
Leider war Brystal eine schrecklich schlechte Lügnerin. Mrs. Evergreen durchschaute sie ohne Mühe.
»Die Welt ist dunkel, Brystal«, sagte sie. »Und du bist ein Dummkopf, wenn du dir etwas anderes einreden lässt. Jetzt gib es her.«
»Aber, Mutter, bitte. Ich bin schon fast fertig!«
»Keine Widerrede, Brystal Evergreen!«, entgegnete ihre Mutter scharf. »Du brichst die Regeln dieses Hauses und die Gesetze des Königreichs! Jetzt gib es her, oder ich hole deinen Vater!«
Brystal seufzte, zog Die Abenteuer von Tidbit Twitch unter ihrem Kissen hervor und händigte das Buch aus.
»Und die anderen?«, fragte Mrs. Evergreen und streckte die Hand aus.
»Ich habe nur dieses eine …«
»Junge Dame, ich dulde keine weiteren Lügen! Bücher in deinem Zimmer sind wie Mäuse im Garten – sie kommen nie allein daher. Jetzt gib mir die anderen, oder ich hole deinen Vater.«
Mit ihrem Mut sank auch Brystal in sich zusammen. Sie schlüpfte aus dem Bett und führte ihre Mutter zu einem losen Dielenbrett in einer Zimmerecke, wo sie ihre geheime Sammlung verwahrte. Mrs. Evergreen keuchte, als ihre Tochter über ein Dutzend Bücher im Boden freilegte. Da waren wissenschaftliche Schriften zu Geschichte, Religion, Recht und Wirtschaftsleben, Abenteuergeschichten, Kriminalromane und Romanzen. Und den abgenutzten Einbänden und Seiten nach zu urteilen, hatte Brystal jedes Buch mehrfach gelesen.
»Oh, Brystal«, seufzte Mrs. Evergreen schwermütig. »Von all den Dingen, für die sich Mädchen in deinem Alter interessieren, müssen es ausgerechnet Bücher sein?«
Mrs. Evergreen sprach das Wort aus, als handele es sich dabei um eine übelriechende und gefährliche Substanz. Natürlich wusste Brystal, dass sie Unrecht tat, wenn sie Bücher hortete – die Gesetze des Südlichen Königreichs sprachen in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache: Bücher waren ausschließlich für männliche Augen bestimmt. Aber weil nichts sie glücklicher machte als Lesen, nahm sie die möglichen Folgen in Kauf.
Brystal küsste jedes einzelne Buch, als würde sie sich von einem kleinen Haustier verabschieden, und gab es dann ihrer Mutter. Der Bücherstapel ragte bis über Mrs. Evergreens Kopf hinaus, aber sie war es gewohnt, allerhand herumzuschleppen und fand ohne weiteres zur Tür.
»Ich weiß nicht, wer dich damit versorgt, aber du darfst diese Person nicht mehr treffen«, riet Mrs. Evergreen. »Weißt du, welche Strafen einem Mädchen drohen, das in der Öffentlichkeit liest? Drei Monate Arbeitshaus! Und das auch nur, wenn dein Vater seine Beziehungen spielen lässt!«
»Aber, Mutter«, hakte Brystal nach, »warum dürfen Frauen in diesem Königreich nicht lesen? Im Gesetz steht, unser Verstand sei zu empfindlich für Bildung, aber das stimmt nicht. Was ist also der wahre Grund, warum man uns Bücher vorenthält?«
Mrs. Evergreen blieb in der Tür stehen, sagte aber nichts. Brystal nahm an, ihre Mutter würde darüber nachdenken, weil sie nur selten in ihrer Rastlosigkeit innehielt. Mrs. Evergreen schaute ihre Tochter an, und für einen kurzen Moment hätte Brystal schwören können, dass sie einen Funken Sympathie in den Augen ihrer Mutter sah – als hätte sie sich ebendiese Frage ihr Leben lang gestellt und immer noch keine Antwort gefunden.
»Meiner Meinung nach haben Frauen auch so schon genug zu tun«, beerdigte sie das Thema. »Jetzt zieh dich an. Das Frühstück macht sich nicht von allein.«
Tränen traten Brystal in die Augen, als sie ihre Mutter mit den Büchern abziehen sah. Für Brystal waren sie nicht nur Pergamentseiten in Leder gebunden; Bücher waren ihre Freunde und ihre einzige Zuflucht im bedrückenden Klima des Südlichen Königreichs. Sie wischte sich die Augenwinkel mit dem Saum ihres Nachthemds ab, aber ihre Tränen versiegten bald. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Sammlung wiederaufbauen konnte – denn ihr Lieferant war näher, als ihre Mutter ahnte.
Sie stand vor dem Spiegel und legte all die Schichten und Accessoires ihrer lächerlichen Schuluniform an: das weiße Kleid, weiße Leggings, weiße Spitzenhandschuhe, ein flauschiges weißes Schultertuch und weiße Stöckelschuhe mit Schnallen, und zuletzt band sie sich noch eine weiße Schleife in ihr langes braunes Haar, was die Verwandlung vervollständigte.
Mit einem tiefen Seufzer betrachtete Brystal ihr Spiegelbild. Von den jungen Frauen in ihrem Königreich wurde erwartet, dass sie sich wie eine Puppe zurechtmachten, wenn sie das Haus verließen – und Brystal hasste Puppen. Alles, was Mädchen auch nur im Entferntesten auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten konnte, stand für Brystal ebenfalls auf der Liste der Dinge, die sie verabscheute – und angesichts der verqueren Ansichten über Frauen im Südlichen Königreich war diese Liste sehr lang.
Seit sie denken konnte, war für Brystal klar gewesen, dass sie für ein Leben außerhalb der engen Grenzen ihres Königreichs bestimmt war. Sie würde mehr erreichen, als nur einen Mann zu ergattern und Kinder zu bekommen, sie würde Abenteuer erleben und Erfahrungen machen, die weit übers Kochen und Putzen hinausgingen, und sie würde echtes Glück finden, wie die Personen in ihren Büchern. Brystal konnte nicht erklären, warum sie das dachte und wie es dazu kommen würde, aber sie wünschte es sich von ganzem Herzen. Doch bis der Tag kam, der bewies, dass sie recht hatte, blieb Brystal nichts anderes übrig, als die Rolle zu spielen, die ihr die Gesellschaft zugewiesen hatte.
Unterdessen legte Brystal viel Einfallsreichtum an den Tag, um ihre Situation erträglich zu machen. Unter ihrer Schuluniform trug sie die Lesebrille wie ein Medaillon an einer Goldkette versteckt um den Hals. Nicht dass ihr in der Schule etwas Lesenswertes untergekommen wäre – jungen Frauen brachte man nur so viel bei, dass sie Kochrezepte und Straßenschilder lesen konnten –, aber zu wissen, dass sie darauf vorbereitet war, zu lesen, gab ihr das Gefühl, eine Geheimwaffe bei sich zu tragen. Und diese Rebellion verlieh ihr den Energieschub, den sie brauchte, um durch den Tag zu kommen.
»Brystal! Ich habe das Frühstück HEUTE gemeint! Komm runter!«
»Ich komme!«, erwiderte sie.
Die Familie Evergreen wohnte in einem geräumigen Landhaus, nur wenige Meilen vom Marktplatz von Chariot Hills entfernt. Brystals Vater war ein angesehener Richter, und das hieß, dass die Evergreens besser dastanden als die meisten anderen Familien. Weil aber ihr Einkommen von den Steuerzahlern finanziert wurde, sah man es leider nicht gern, wenn sich die Familie irgendeinen »Luxus« leistete. Und weil dem Richter nichts wichtiger war als sein guter Ruf, gönnte er seiner Familie rein gar nichts, was auch nur entfernt an Luxus erinnerte.
Alles, was die Evergreens besaßen, von der Kleidung bis zu den Möbeln, hatten sie gebraucht von Freunden und Nachbarn bekommen. Jeder Vorhang hatte ein anderes Muster, Geschirr und Besteck passten nicht zusammen, und jeder Stuhl war von einem anderen Schreiner angefertigt worden. Selbst die Tapeten stammten von den Wänden anderer Häuser und zeigten ein chaotisches Durcheinander verschiedener Motive. Das Anwesen war so groß, dass man ohne weiteres zwanzig Leute hätte beschäftigen können, aber Richter Evergreen meinte, Dienstboten und Knechte wären nun wirklich »ein völlig verstiegener Luxus«, und so waren Brystal und ihre Mutter gezwungen, die ganze Arbeit in Haus und Hof allein zu erledigen.
»Rühr den Haferbrei, ich mache die Eier«, ordnete Mrs. Evergreen an, als Brystal endlich in die Küche kam. »Aber koch ihn nicht zu lange, dein Vater hasst pampigen Brei!«
Brystal band sich eine Schürze über die Schuluniform und nahm den Kochlöffel von ihrer Mutter entgegen. Sie stand noch keine Minute am Herd, als ein panischer Ruf aus dem Nebenraum kam.
»Muuuuutter! Komm schnell! Ein Notfall!«
»Was ist los, Barrie?«
»Von meiner Robe ist ein Knopf abgegangen!«
»Um Himmels willen«, murmelte Mrs. Evergreen. »Brystal, geh und hilf deinem Bruder mit dem Knopf. Aber beeil dich.«
Brystal holte sich Nähzeug und eilte ins Wohnzimmer. Zu ihrer Überraschung hockte ihr siebzehnjähriger Bruder auf dem Fußboden. Mit geschlossenen Augen wiegte er den Oberkörper vor und zurück, in der Hand hielt er einen Stapel Kärtchen mit Notizen. Barrie Evergreen war ein schlaksiger junger Mann mit wirrem braunem Haar, der staunend und nervös in die Welt blickte. Heute aber war er außerordentlich nervös.
»Barrie!«, sprach Brystal ihn behutsam an. »Mutter hat mich geschickt, ich soll dir deinen Knopf annähen. Kannst du das Lernen kurz unterbrechen oder soll ich später wiederkommen?«
»Nein, jetzt passt gut«, sagte Barrie. »Ich kann üben, während du nähst.«
Er stand auf und gab seiner Schwester den abgerissenen Knopf. Wie alle Studenten an der Juristischen Universität von Chariot Hills trug Barrie eine lange graue Robe und einen quadratischen schwarzen Hut. Während Brystal den Faden einfädelte und den Knopf wieder an den Kragen nähte, warf Barrie einen Blick auf das Stichwort des ersten Kärtchens. Grübelnd fummelte er an den übrigen Knöpfen seiner Robe herum, und Brystal klopfte ihm auf die Finger.
»Das Läuterungsgesetz von 342 … Läuterungsgesetz von 342 …«, las Barrie laut vor. »Das war, als König Champion VIII. die Trolle wegen gemeinen Benehmens anklagte und ihre Spezies aus dem Südlichen Königreich verbannte.«
Zufrieden mit seiner Antwort drehte Barrie das erste Kärtchen um und las die korrekte Antwort, die auf der Rückseite stand. Leider hatte er falschgelegen, und er stöhnte kläglich. Brystal konnte ein Lächeln nicht unterdrücken – ihr Bruder erinnerte sie an einen Welpen, der hinter dem eigenen Schwanz herjagt.
»Das ist nicht lustig, Brystal!«, protestierte Barrie. »Ich fliege noch durch die Prüfung!«
»Ach, Barrie, bleib ganz ruhig.« Sie lachte. »Du fällst nicht durch. Du studierst die Rechte doch schon dein Leben lang!«
»Genau deswegen ist es ja so demütigend! Wenn ich die Prüfung heute nicht schaffe, dann kann ich keinen Abschluss machen. Und ohne Abschluss werde ich niemals Stellvertretender Richter! Und wenn ich nicht Stellvertretender Richter werde, dann werde ich niemals Richter, so wie Vater! Und wenn ich nicht Richter werde, dann werde ich niemals Oberster Richter!«
Wie alle anderen Männer der Familie Evergreen studierte Barrie, um Richter an einem der Gerichte des Südlichen Königreichs zu werden. An der Juristischen Universität lernte er, seit er sechs Jahre alt war, und um zehn Uhr morgens stand ihm die mörderische Prüfung bevor, die darüber entschied, ob er Stellvertretender Richter wurde. Wenn er bestand, würde Barrie die nächsten zehn Jahre Verbrecher vor Gericht anklagen oder verteidigen. Sobald seine Zeit als Stellvertretender Richter vorbei war, würde Barrie als regulärer Richter Strafprozesse führen, so wie sein Vater. Und falls seine Laufbahn als Richter den König beeindruckte, würde Barrie als erster Evergreen zum Obersten Richter in den Hofrat des Königs berufen werden, wo er den König bei der Gesetzgebung beraten würde.
Oberster Richter zu werden, davon träumte Barrie seit seiner Kindheit, aber sein Weg in den Hofrat des Königs wäre heute beendet, wenn er bei der Prüfung durchfiel. Deshalb hatte Barrie in den letzten sechs Monaten in jeder freien Minute die Gesetze und die Geschichte seines Königreichs studiert, damit er siegreich bestand.
»Wie soll ich Vater je wieder unter die Augen treten, wenn ich nicht bestehe«, jammerte Barrie. »Ich sollte gleich hinschmeißen und mir die Blamage ersparen!«
»Mal nicht den Teufel an die Wand«, mahnte Brystal. »Du weißt das alles. Du bist nur mit den Nerven am Ende.«
»Ich bin nicht bloß nervös – ich bin völlig fertig! Die ganze Nacht habe ich damit verbracht, diese Kärtchen zu schreiben, und ich kann kaum meine eigene Schrift lesen! Was immer in diesem Läuterungsgesetz steht, es hat nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe!«
»Du warst mit deiner Antwort ganz nah dran«, sagte Brystal. »Du hast nur an das Krallenziehergesetz von 339 gedacht – mit dem Champion VIII. die Trolle aus dem Südlichen Königreich verbannt hat. Unglücklicherweise hat seine Armee Elben und Trolle verwechselt und die falsche Spezies rausgeworfen! Um das Durcheinander zu rechtfertigen, erließ Champion VIII. das Läuterungsgesetz von 342 und verbannte damit alle nicht menschlichen sprechenden Lebewesen aus dem Königreich! Die Trolle, Elben, Kobolde und Oger wurden zusammengetrieben und in den Dazwischenwald umgesiedelt! Die anderen Königreiche haben es ihm nachgetan, was zur Großen Säuberung von 345 führte! Ist das nicht schrecklich? Und wenn man bedenkt, dass die schlimmsten Gewaltausbrüche in der Geschichte hätten vermieden werden können, wenn sich Champion VIII. einfach bei den Elben entschuldigt hätte!«
Brystal ging auf, dass ihr Bruder teils dankbar für die Gedächtnisstütze, teils verlegen war, weil sie von seiner kleinen Schwester kam.
»Ach ja, stimmt …«, sagte Barrie. »Danke, Brystal.«
»Gerne«, erwiderte sie. »Außerdem ist es einfach schade. Stell dir vor, wie aufregend es wäre, eines dieser Geschöpfe persönlich kennenzulernen!«
Endlich fiel bei ihrem Bruder der Groschen. »Moment, woher weißt du das alles?«
Brystal schaute über die Schulter, um sicherzugehen, dass sie allein waren. »Es stand in einem der Geschichtsbücher, die du mir gegeben hast«, flüsterte sie. »Das war so spannend! Ich hab es bestimmt vier-, fünfmal gelesen! Möchtest du, dass ich dableibe und dir beim Lernen helfe?«
»Wenn das nur ginge«, sagte Barrie. »Mutter wird Verdacht schöpfen, wenn du nicht gleich wieder in der Küche auftauchst. Und sie wird in die Luft gehen, wenn sie dich dabei ertappt, wie du mir hilfst.«
Brystals Augen funkelten, als ihr eine Idee kam. Rasch riss sie alle Knöpfe von Barries Robe. Bevor er etwas sagen konnte, stürmte Mrs. Evergreen herein, als ahnte sie, was für einen Unfug ihre Tochter trieb.
»Wie lange kann es dauern, einen Knopf anzunähen?«, wollte sie wissen. »Ich habe Haferbrei im Topf, Eier in der Pfanne und Brötchen im Backrohr.«
Brystal zuckte unschuldig mit den Achseln und zeigte ihrer Mutter die abgerissenen Knöpfe in ihrer Hand.
»Tut mir leid, Mutter«, sagte sie. »Es ist schlimmer als gedacht. Er ist wirklich nervös.«
Mrs. Evergreen hob verzweifelt die Hände und stöhnte.
»Barrie Evergreen, dieses Haus ist nicht deine persönliche Schneiderwerkstatt!«, schalt sie. »Hör auf, an deiner Robe herumzufummeln, oder ich binde dir deine nervösen Hände auf den Rücken, so wie früher, als du ein Kind warst! Brystal, wenn du fertig bist, deck den Tisch im Esszimmer. Wir essen in zehn Minuten – Knöpfe hin oder her!«
Verwünschungen murmelnd stampfte Mrs. Evergreen zurück in die Küche. Brystal und Barrie kicherten hinter vorgehaltener Hand über den dramatischen Auftritt ihrer Mutter. Es war das erste Mal seit Wochen, dass Brystal ihren Bruder lächeln sah.
»Ich fasse es nicht, was du da gemacht hast«, sagte er.
»Deine Prüfung ist wichtiger als das Frühstück«, erklärte Brystal und fing an, die restlichen Knöpfe anzunähen. »Und deine Kärtchen brauchst du nicht – ich kann die alten Schulbücher, die du mir gegeben hast, praktisch auswendig. Jetzt nenne ich dir ein historisches Gesetz, und du erzählst mir, was es damit auf sich hat. In Ordnung?«
»Schön«, stimmte er zu.
»Gut. Fangen wir mit dem Grenzgesetz von 274 an.«
»Das Grenzgesetz von 274 … das Grenzgesetz von 274 …«, überlegte Barrie laut. »Ach, ich weiß! Das war der Erlass, der die geschützten Wege durch den Dazwischenwald festlegte, damit die Königreiche gefahrlos Handel treiben konnten.«
Brystal zuckte zusammen. »Knapp daneben«, sagte sie leise. »Die geschützten Wege wurden durch das Geschützte-Wege-Gesetz von 296 geschaffen.«
Barrie stöhnte und rückte von Brystal ab, obwohl sie noch mit Nähen beschäftigt war. Er ging im Wohnzimmer auf und ab und rieb sich das Gesicht.
»Das hat keinen Sinn!«, brummte er. »Ich habe einfach keine Ahnung! Warum muss es in der Geschichte so viele Zahlen geben?!«
»Das liegt tatsächlich an einer interessanten Begebenheit!«, teilte ihm Brystal fröhlich mit. »Das Südliche Königreich führte einen Kalender ein, als der erste Champion zum König gekrönt wurde! Der Kalender hat sich so gut bewährt, dass die anderen Königreiche ihn inzwischen auch benutzen – oh, tut mir leid, Barrie! Das war eine rhetorische Frage, nicht wahr?«
Ihr Bruder ließ die Arme sinken und schaute sie ungläubig an. Er hatte tatsächlich eine rhetorische Frage stellen wollen, aber nach der Erklärung seiner Schwester merkte er, dass er auch über die Erfindung des Kalenders nicht wirklich Bescheid wusste.
»Ich gebe auf!«, verkündete er. »Ich breche mein Studium ab und eröffne einen Laden! Dann verkaufe ich Steine und Stöcke an kleine Kinder! Viel Geld werde ich nicht verdienen, aber wenigstens wird mir die Ware nicht ausgehen!«
Brystal verlor allmählich die Geduld. Sie griff ihrem Bruder unters Kinn, so dass er ihr in die Augen schauen musste.
»Barrie, Kopf hoch!«, sagte sie. »All deine Antworten sind gut, du spannst nur hin und wieder den Karren vor das Pferd. Vergiss nicht, Geschichte ist auch nur eine Geschichte. Jedes dieser Ereignisse hat eine Vorgeschichte, und es hat Folgen – eine Ursache und eine Wirkung. Denk nach, bevor du antwortest, und reihe alle Fakten, die du kennst, auf einer Zeitachse auf. Such nach Widersprüchen, konzentriere dich drauf, was fehlt, und fülle die Lücken, so gut du kannst.«
Schweigend dachte Barrie über den Rat seiner Schwester nach. Langsam aber sicher ging die Saat auf, die sie bei ihm gesät hatte, und er schöpfte neue Hoffnung. Barrie nickte Brystal entschlossen zu und holte tief Luft, als wäre er im Begriff, von einer hohen Klippe ins Meer zu springen.
»Du hast recht«, gab er zu. »Ich muss mich nur entspannen und konzentrieren.«
Brystal ließ Barries Kinn los, so dass sie weiter seine Robe richten konnte, nachdem es bei seinem Selbstvertrauen schon geklappt hatte.
»Jetzt das Grenzgesetz von 274«, sagte sie. »Versuch’s noch mal.«
Barrie konzentrierte sich und machte keinen Mucks, bis er sicher war, dass er die richtige Antwort parat hatte.
»Nach dem Weltkrieg der Vier Reiche von 250 einigten sich die vier Königreiche darauf, nicht mehr um Land zu kämpfen, und ihre Herrscher unterzeichneten das Grenzgesetz von 274. Der Vertrag legte die Grenzen eines jeden Königreichs fest und richtete die Dazwischenzone zwischen den Ländern ein.«
»Sehr gut!«, jubelte Brystal. »Und wie steht es mit dem Dazwischen-Neutralitätsgesetz von 283?«
Barrie dachte sehr genau nach, und seine Augen leuchteten, als ihm die Antwort einfiel.
»Das Dazwischen-Neutralitätsgesetz von 283 war ein internationales Abkommen, das die Dazwischenzone für neutral erklärte, damit keines der Königreiche sie für sein Staatsgebiet beanspruchen konnte. Die Folge war, dass im Dazwischenwald weder Recht noch Gesetz gilt und es dort sehr gefährlich wurde. Was wiederum zum Geschützte-Wege-Gesetz von 296 führte – AUTSCH!«
Brystal war so stolz auf ihren Bruder, dass sie ihn versehentlich mit der Nähnadel gestochen hatte.
»Das ist richtig!«, lobte sie ihn. »Schau, du hast alle Informationen, die du brauchst, um die Prüfung zu bestehen! Du musst nur genauso fest an dich glauben, wie ich es tue.«
Barrie, der vorher so blass gewesen war, wurde rot.
»Danke, Brystal«, sagte er. »Wenn ich dich nicht hätte, würde ich mich in meinem eigenen Kopf verirren. Es ist wirklich schade, dass du … na ja … dass du ein Mädchen bist. Du würdest einen großartigen Richter abgeben.«
Brystal senkte den Kopf und tat so, als wäre sie noch mit dem letzten Knopf beschäftigt, damit er die Trauer in ihren Augen nicht sah.
»Ach so?«, sagte sie. »Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht.«
In Wirklichkeit war es etwas, das sich Brystal sehnlicher wünschte, als ihr Bruder ahnen konnte. Wenn sie Richter wäre, könnte sie Verurteilte retten und Menschen helfen, sie könnte Hoffnung und Verständnis verbreiten, und sie hätte die Mittel, um die Welt für andere Mädchen wie sie zu einem besseren Ort zu machen. Leider war es höchst unwahrscheinlich, dass eine Frau im Südlichen Königreich jemals etwas anderes sein konnte als Hausfrau und Mutter, also verabschiedete sich Brystal von ihren Ideen, bevor Hoffnungen daraus wurden.
»Vielleicht kannst du, sobald du Oberster Richter bist, den König überreden, Frauen lesen zu lassen«, regte sie an. »Das wäre schon ein guter Anfang.«