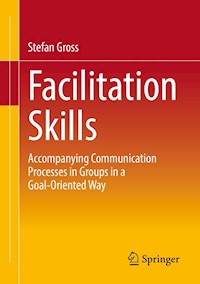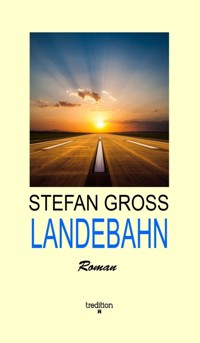
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carl Hammer, Unternehmensberater, ist viel in der Welt unterwegs. Stets mit leichtem Gepäck, gut gedeckten Kreditkarten und gegen alles geimpft, reizt ihn das Leben im globalen Dorf. Nur nach Indien wollte er nie, doch seine Karrierepläne lassen ihm keine andere Wahl. Schlaflos, mit hohem Fieber und widerstrebenden Gefühlen, die er nicht begreift, fliegt er nach einem Streit mit seiner Frau Alice los. Erschöpft und desorientiert treibt er in Indien wie ferngesteuert ins Zentrum seiner Lebensfrage: Wer bin ich wirklich? Denn Carl kennt seine Herkunft nicht und sieht, wenn er in den Spiegel schaut, stets nur sein Phantombild, nie sein wahres Ich. Er bricht den Kontakt zu Alice ab, reist mit einem mysteriösen Fremden nach Varanasi, ertrinkt beinahe im heiligen Fluss Ganges und landet mit einer schweren Infektion bewusstlos im Krankenhaus. Dort wacht er unter den Augen der Medizinstudentin Shakti auf und verliebt sich in sie. Mit ihr will er ein neues Leben beginnen. Sie ziehen ins Village, eine New-Age Kommune mit Selbstversorgergarten, Therapie- und Meditationszentrum. Carl fühlt sich bald wie neu geboren. Doch dann erfährt er, dass Shakti nicht nur seine spirituelle Schwester ist. Carl muss sich einer schockierenden Wahrheit stellen und ein völlig neues Leben beginnen. Carl Hammers Ausstieg aus einem überhitzten, unwirklichen Leben im globalen Dorf, das sich als ein nicht fassbares Überall und Nirgends erweist, ist hochaktuell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
STEFAN GROSS
LANDEBAHN
STEFAN GROSS
LANDEBAHN
Roman
Veröffentlicht als
Hardcover
ISBN 978-3-347-07494-1
Paperback
ISBN 978-3-347-07493-4
E-book
ISBN 978-3-347-07495-8
Verlag & Druck: tredition GmbH
Halenreie 40-44 / 22359 Hamburg
Umschlagillustration: Tomuli Design
Coverfotos: iStock (front), Stefan Gross (rear)
Copyright: Stefan Gross
Deutsche Erstausgabe 2020
Nicht für dich wurde die Welt erschaffen.
Du wurdest für sie geboren.
Adieu, Almond,
Mandelauge.
Ich will nach Hause.
Dort stapeln sich die Kirschblüten
bis unters Dach und verfaulen.
Ich werde Feuer legen müssen.
Mit dem Ruß schwärze ich die Tempeltüren.
Außen.
Adieu, Almond.
(Carl an Shakti)
Juni
Die langen hellen Tage verführten uns dazu, noch weniger zu schlafen als sonst. Um fünf standen wir auf, machten uns Kaffee und setzten uns raus auf die Terrasse. Der Himmel über München sah metallisch aus. Ihm fehlte die typische, meiner Wahlheimat nachgesagte, Heiterkeit. Die kleinen Wolken waren geometrisch exakt über die Fläche verteilt, ein bisschen wie das bayerische weißblaue Rautenmuster.
»Zirruswolken«, sagte ich.
»Sieht cool aus, Carl«, sagte Alice. »Die Kondensstreifen bringen ein bisschen Pep ins Bild.«
»So als Signatur der Globalisierung?«, fragte ich.
Alice Antwort war ein langes, genüssliches Gähnen. Es war eindeutig zu früh und die Stimmung zu friedlich für eine Debatte über den Zustand der Welt. Sie schlürfte den Rest Milchkaffee aus ihrer XXL-Tasse und stellte sie zögernd auf den mintgrünen Metalltisch. »Ich muss los, auch wenn ich am liebsten zu Hause bleiben würde. Der Verkehr macht mich irgendwann fertig.« Sie stand auf und ging ins Bad.
Alice war Biologin. Sie arbeitete am Frauenhofer-Institut und beschäftigte sich mit plastikfressenden Mikroorganismen. Häufig steckte sie im Stau und entwickelte dann immer abgefahrenere Ideen. Sie glaubte noch an die Rettung der Welt durch die guten Taten der Wissenschaft und auch an einen Home-Office-Arbeitsplatz.
Wir hatten unser Haus in Garching erst vor einem halben Jahr gekauft, ein Reihenhaus aus den Achtzigern, mit weißen, großformatigen Fliesen im Flur und einem klobigen Treppengeländer aus Stahlrohren. Küche und Wohnbereich lagen auf versetzten Ebenen. Es gab nur wenige Wände. Von der Küche aus konnte man das ganze Erdgeschoss überblicken. Bei der Besichtigung hatten wir uns gleich vorstellen können, wie hier unsere Kinder herumspringen, zwei mindestens, die hier Geburtstage feiern mit unzähligen Freunden, die Luftschlangen durch die Wohnung blasen, Getränke verschütten und im Garten herumtoben würden. Eine Horde gefräßiger, brüllender Monster, die ich vom Grill fernhalten müsste. Unser Kinderwunsch war ein Thema, das uns ziemlich beschäftigte. Alice war zweiunddreißig und ich fand, das sei kein Grund zur Eile, aber ja, natürlich, auch ich wollte Kinder mit ihr.
Ich wäre am liebsten auch zu Hause geblieben. Schon seit Tagen hatte ich ein leichtes, rätselhaftes Fieber, aber keine Erkältungssymptome. Ich führte es auf eine Hepatitis-Impfung vor einigen Tagen zurück. Vielleicht war es auch eine psychosomatische Reaktion auf meine bevorstehende Geschäftsreise nach Indien. Ich sollte dort die Fusion einer deutsch-amerikanischen Ingenieursgesellschaft mit einem neu akquirierten indischen Partner begleiten. Die Aussicht auf einen zweiwöchigen Aufenthalt in diesem Land begeisterte mich nicht gerade. Ich mochte Indien nicht. Ich hatte darüber nur frustrierende Bilder im Kopf: chaotische Städte, Elend, Schmutz und viel zu viele Menschen. Indien stellte ich mir vor wie die wahrscheinlichste Version unserer näheren globalen Zukunft. Ich hatte ein ernstes Motivationsproblem und als Unternehmensberater war die Motivationsfrage für mich äußert wichtig. Ich versuchte, mich für Indien zu motivieren, aber es gelang mir einfach nicht.
Ich arbeitete bei Richard Mertens Consulting. Richard kannte ich schon seit vielen Jahren und war einer der ersten gewesen, die damals bei ihm anfingen. Sein Unternehmen war anfangs nicht viel mehr als ein Netzwerk befreundeter Berater gewesen, für die Richard Aufträge beschaffte, meist von Klienten der Industrie. Ich liebte ihn für seinen äußerst strapazierfähigen Optimismus und eiferte ihm nach. Ich hatte ihn an der Uni kennengerlernt. Er hatte einen Lehrauftrag für Wirtschaftspsychologie. Damals war Richard ein Visionär. Wir wollten die Welt verändern. Ich glaubte an seine grüne Agenda und war fasziniert von der spirituellen Dimension, die er in unserer Arbeit sah. Schamanismus und Marketing (Nichts ist unmöglich…) gingen für ihn ebenso zusammen wie Künstliche Intelligenz und Meditation. Doch mittlerweile war ich ziemlich ernüchtert von der Strahlkraft unserer Vision. Unsere Klienten wollten nur scheinbar grüner, nachhaltiger, und fairer werden.
Wir wurden für Greenwashing eingespannt, propagierten die New Work Culture und warfen Leute raus, die nicht mehr ins Konzept passten; Leute wie Brauer, ein unbequemer Ingenieur mit dem ich heute einen Termin hatte. Oft kam ich mir nur noch vor wie ein hilfloser Beobachter des gerade stattfindenden Weltuntergangs.
Doch wovon träumte ich? Von einem richtigen Leben im falschen? Das war der Traum meiner gescheiterten 68er Adoptiveltern, die mich falsch erzogen hatten. Meine wirklichen Eltern kannte ich nicht. Ich dachte oft an sie, betrachtete mich im Spiegel und zerbrach mir den Kopf darüber, wer sie waren. Ob sie jemals an mich dachten? Vielleicht waren sie nicht mehr am Leben. Es war völlig sinnlos, über sie nachzudenken. Es gab keine Antwort.
Ich nahm unsere überdimensionierten Kaffeetassen, ging in die Küche, packte sie in die Spülmaschine, steckte ein Tab ins Fach, stellte sie an und hörte dem sanften Brummen noch eine Weile zu.
Alice kam und präsentierte sich in weißen Jeans, grüner Bluse und weißen Sneakers. Ihre rotblonden Haare trug sie als Pferdeschwanz.
»Die reinste Morgenröte«, pries ich sie, trat zu ihr, wollte sie umarmen, aber sie rümpfte die Nase und hielt mich mit ausgestrecktem Arm auf Distanz.
»Du bist noch nicht geduscht, Carl Hammer!«
»Ja klar«, sagte ich und schnupperte den Duft, den sie verströmte. Ich mochte ihr zitroniges Deo. Alice grinste aufgeräumt, grüßte militärisch und trat ab.
.»Kann spät werden heute Abend«, rief ich ihr hinterher. Die Haustür fiel ins Schloss. Ein paar Sekunden später hörte ich sie mit ihrem hellgrauen 1er BMW an der Terrasse vorbeirauschen.
Ich nahm eine Ibuprofen, duschte mich und fuhr zu meinem Kunden.
Brauer
starrte zur Decke, wo eine Etage über uns die arbeiteten, die er stets nur als die da oben bezeichnete. »Die da oben, die müsste man alle… besonders die verfluchten Weiber mit ihren…«
»Was?«, unterbrach ich ihn scharf. Brauer, dieser ganz und gar bayerische Mensch, spielte den von völlig überzogenen Verdächtigungen gekränkten männlichen Kollegen und warf theatralisch den Kopf in den Nacken. Brauer war leitender Ingenieur unseres Klienten S&T - Solutions&Technologies. Ich sollte Brauer motivieren, für S&T nach Indien zu gehen. Er war Ende Fünfzig, galt als stur und hatte nicht die geringste Lust dazu.
S&T war aus der Fusion mehrerer amerikanischer und deutscher Ingenieursgesellschaften hervorgegangen. Der jüngste Coup war die Fusion mit einem indischen Partner, der an die zehntausend neue, überwiegend junge Mitarbeiter ins Unternehmen einbrachte. Dreißigtausend Ingenieure unter einem Dach würden dann bei S&T die Industrien der Zukunft insbesondere in Asien planen. Ich betreute diesen Prozess und war auf Wunsch von S&T intensiv in deren Organisation eingebunden. Ich sollte hinreichend Stallgeruch bekommen und alles genau kennen lernen.
Seit einer halben Stunde saß ich nun schon mit Brauer zusammen. Und er ging mir gehörig auf die Nerven.
»Ahh, vergessen’s das bloß mit den Weibern, Herr Hammer. Man darf ja wirklich nix mehr sagen«, protestierte er und suchte den Schulterschluss unter Männern, doch ich betrachtete ihn nur, versuchte, die richtige innere Distanz zu ihm wieder herzustellen, was er auch gleich mitbekam.
Brauer sei schon ein sensibles Tierchen, hatten sie mir oben in der Human-Ressource-Abteilung von S&T gesteckt, auch wenn sie die Spezies nicht definiert hatten. Schwein? Ratte? Schlange? Wolf? Ich sann über das passende Totem für Brauer nach und fand, dass er am ehesten was von einem Bären hatte. »Nie hab ich einer auch nur einmal…«, brummte der Bär. »Was?«, fasste ich wieder nach, dieses Mal noch schärfer im Ton und wohl zu laut. Brauer fuhr gleich aus seinem Freischwinger hoch. Sein massiger Oberkörper schoss verblüffend schnell nach vorne bis an die Tischkante, als hätte ihn die elastische Stuhllehne katapultiert, und winkte verärgert ab. »Ah! Gar nix! Als hätt ausgerechnet ich Dreck am Stecken«, schnaufte er. Brauer war ein impulsiver Charakter, auch wenn das vielleicht nicht bärentypisch war – oder vielleicht doch. Was wusste ich. Ich sah die Schweißperlen auf seiner Stirn, und die trieb ihm gewiss nicht das wohl temperierte Reizklima dieser modernen Arbeitswelt hier hervor, das in diesem erst vor wenigen Wochen fertiggestellten Bürogebäude herrschte. Die neuen Oberflächen schimmerten noch verheißungsvoll und rochen klar unterscheidbar nach Materialien. Steinboden, Wandfarben, Holz, Metall; sogar das Glas verströmte noch einen spezifischen, nicht von menschlichen Ausdünstungen überlagerten Geruch. Brauer schwitzte, weil es hier nichts anderes zu trinken gab als Wasser, wenn auch unterschiedliche Sorten. Drei Flaschen mit der Aufschrift Plain, Medium und Active standen nebeneinander auf dem Glastisch, eine eigene Edition für S&T. Das Firmenlogo, eine grafische Applikation der beiden Buchstaben, prangte in intensivem Blau auf den puristisch gestalteten Etiketten. Die für die Corporate Identity zuständigen Designer hatten ihren Job schon gemacht. Wem aus diesen Flaschen eingeschenkt wurde, sollte erkennen können, mit welcher Kultur er es in diesem transformierten, oder besser: sich im Transformationsprozess befindenden Unternehmen zu tun hatte.
Brauer kramte umständlich ein kariertes Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche, wischte sich den Schweiß von der rotglänzenden Stirn, faltete es routiniert zusammen und sagte – man hätte es bei diesem bärigen Typen kaum für möglich gehalten – mit schnurrender Freundlichkeit: »Was halten Sie von einer Pause, junger Freund?« Ich konnte mir Brauers verblüffende Verwandlung in einen Schmusekater nur mit dessen dringendem Bedürfnis nach Alkohol erklären.
Ich schaute auf die Uhr. Ich hatte eine Stunde Zeit, mit Brauer über seine Zukunft bei S&T zu verhandeln, aber darüber, dass man ihn nach Indien versetzen wollte, hatten wir noch kein Wort verloren. Ich schaute nach draußen. Im Innenhof spiegelte sich der Bambus in der dunkelgrünen Glasfassade. Amazing energizing working environment. We want to energize our people, lobten die Amerikaner das angeblich nach Feng-Shui Regeln gestaltete Gebäude. Brauer war nicht der einzige, dem solche Sprüche auf den Geist gingen, aber er hielt eben die Klappe nicht. In der Vollversammlung neulich hatte er S&T eine amerikanische Marketinggesellschaft mit deutschen Bedenkenträgern und indischen Fleißbienchen genannt. Seine sarkastischen Kommentare kamen inzwischen überhaupt nicht mehr gut an. Früher hatte er auf Betriebsfesten mit kabarettistischen Einlagen für Stimmung gesorgt. Ich hatte Mitleid mit ihm, und das, wusste ich, war gefährlich. Also versuchte ich ihn zu verachten. Brauer erhob sich, ohne eine Antwort abzuwarten. Er war wirklich ein Bär, einer von der gedrungenen, ziemlich breit gebauten Sorte. Im gestärkten weißen Hemd und in von altmodischen Hosenträgern gehaltenen Senioren-Jeans wirkte er geradezu provozierend falsch gekleidet. Ich blieb einfach sitzen und nahm mir heraus, diesen Mann eine Weile zu betrachten, wie es mir beliebte. Diese Demütigung war der Preis, den der Alkoholiker zahlen musste, bevor ich ihn zum Auftanken entließ. Ich ließ ihn schmoren.
Lang und breit hatte Brauer in der letzten halben Stunde dargelegt, warum es nicht mehr rund lief bei S&T und mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Brauer könne vor allem eines nicht, nämlich zuhören, hatten sie mich oben gewarnt. Und er sage Kunden leider auch ungefragt ins Gesicht, wie und wofür sie ihr Geld am besten auszugeben hätten. Und wenn Brauer erst das Wort habe, lasse er es sich nicht mehr nehmen und rede sogar dann noch hemmungslos weiter, wenn alle am Tisch aufstanden, ihre Sachen einpackten und zur Tür rausgingen. Was offenbar vorgekommen war, bei Schweizer Kundschaft, die sich leider seither sehr zurückgezogen habe. Brauer müsse raus aus dem Kundengeschäft, hatte der neue CEO von S&T Deutschland, ein junger Karrierist mit geglättetem bayerischem Akzent, mich geradezu angefleht in typisch bayerischer Übertreibung.
Denn die Zeit für allmächtige Ingenieure, die den Kunden ihre Meinung diktierten, sei vorbei. Seit der Planet eine einzige riesige Messe sei, auf der alle ständig herumkramten, als sei Schlussverkauf, müsse man vor allem eines können: gut verkaufen nämlich, auch als Ingenieur. Da sei Brauer mit seinem Latein aber sehr schnell am Ende gewesen, ja im Gegenteil. Er habe den Akademiker raushängen lassen und die Kunden vergrault. Non omnia possumus omnes! Ob ich denn wüsste, was das heißt? Ich hatte passen müssen.
»Na schön, zehn Minuten, aber wirklich nur zehn«, sagte ich schließlich. Brauer marschierte flugs Richtung Tür und nahm sich dann doch noch kurz Zeit, sich an mich zu wenden. Er zauberte ein jungenhaftes Gesicht aus seinen eben noch zerfahrenen Zügen und strahlte mich an. »Sie sind also doch ein Anständiger. Und das müssen Sie unbedingt bleiben, ein Anständiger, denn es gibt kaum mehr Anständige. Und wenn Sie erst in meinem Alter sind, dann werden Sie verstehen, wie ich das meine. Denn das ist das Einzige, was wirklich zählt, Anstand, egal in welchem Alter.« Und dann malte er eine Acht in die Luft. »So lange noch, mein Freund, und ich werde das durchziehen, das hab ich meiner Frau versprochen. Und Sie, mein Freund, werden das auch nicht ändern, auch wenn Sie das sollen und vielleicht sogar meinen, dass sie das wollen, weil die da oben (er zeigte wieder zur Decke) Sie viel zu gut bezahlen, als dass Sie sich noch eine eigene Meinung leisten könnten.« Ein leichtes Zucken in Brauers Gesicht, ein Wimpernschlag. Das war’s. Ich spürte den Blick in meinem Bauch. Brauers Miene verdunkelte sich, als er seine Konzentration von mir abzog. »Wusste ich‘s doch«, brummte er, ging raus und ließ mich allein im Raum zurück. Brauer war trotz seiner Sucht ein erhabener und zutiefst mit seiner Firma verwachsener und auf seine Lebensleistung stolzer Mensch.
Ich starrte gedankenverloren zu der Stelle, wo die Acht noch spürbar hing und war kurz in Versuchung, aufs Klo zu verschwinden und mir einen runter zu holen. Ich musste dieses Gefühl aufsteigender Ohnmacht aus unterdrückter Aggression so schnell wie möglich loswerden. Ich verfluchte meinen Job, halblaut, wie in Bayern üblich, und brummelte vor mich hin. Das Fluchen war auch eine Art Masturbation. Man besorgte es sich selbst, dachte dabei an andere und genoss eine oberflächliche Entladung von Druck. Ich ging zum Fenster, öffnete es, streckte den Kopf raus, schüttelte ihn aus wie einen Putzlappen und stellte mir vor, wie alle meine negativen Gedanken nach unten in die angepflanzten Büsche sanken. Die kleine Therapie funktionierte erstaunlich gut. Ich verspürte augenblicklich Erleichterung und begann, ein wenig vor dem offenen Fenster zu tanzen, mich zu schütteln und auf den Boden zu stampfen, allerdings nicht zu heftig. Berechtigte Bedenken, dass sie eine Etage tiefer auf die Idee kommen könnten, hier oben habe irgendwer nicht mehr alle Programme in der Cloud, ließen mich diese auf einem Seminar gelernte Methode schnell wieder abbrechen. Meine innere Arbeit über mein Aggressionsthema war ein langwieriger und komplizierter Prozess. Richard coachte mich gelegentlich. Obwohl an allen möglichen Instituten als Berater, Coach, Trainer und sogar als Schamane ausgebildet, schwor Richard auf die ganz einfachen Dinge wie Ausatmen – Innehalten – Ankommen. Er hatte für mich eine Übung entwickelt: Brrr, immer wieder Brrr, bis die Lippen anfingen zu jucken. Richard meinte, mein Krafttier sei das Pferd. Und das drohe eben manchmal mit mir durchzugehen, aber das sei dennoch ein Glücksfall. Zu einem Pferd könne man schließlich ziemlich gut eine innere Beziehung aufbauen. Er selbst habe es da viel schwerer. Sein Totem sei der Buckelwal. Wenn ihm nämlich seine Walenergie durchgehe, seien größere Schäden unvermeidlich. Sein innerer Zugang zu seinem Totem sei alles andere als einfach.
Ob Richard sein Verhältnis zu seinem Wal coachen ließ, wusste ich nicht. Er hatte Probleme, über die er mit mir nicht viel sprach, und solche gehörten dazu. So ein ungeheuer riesiges Tier war schließlich nicht ohne. Richard hatte irrationale, schwer nachvollziehbare Persönlichkeitsanteile, genau wie ich selbst. Unsere Beziehung barg ständig die Gefahr, dass wir aneinandergerieten. Mein inneres Pferd war mir nicht gerade vertraut, sonst hätte ich ihm bestimmt einen Namen gegeben. Santana vielleicht. Aber ich nahm die Sache auch nicht wirklich ernst und hatte das Gefühl, dass Richard mit seiner Walgeschichte ziemlich dick auftrug. Es war typisch für ihn, sich ausgerechnet dieses imposante, erst vor vierzig Jahren heiliggesprochene Tier als sein Totem zu erwählen und damit ein bisschen anzugeben. Er behauptete sogar, ein Buckelwal hätte ihn erwählt beim Wale-Watching in Mexiko, als er dort seine Ausbildung zum Schamanen machte.
Mein Telefon klingelte. Richard war dran und fing sofort von Indien an. »Carl, mein Bester, ich weiß, du freust dich schon. Ich spüre das sogar durchs Telefon. Ich habe deinen Flug umbuchen müssen. Du musst leider schon übernächsten Samstag fliegen.« Das erwischte mich wie die Mitteilung über den Unfalltod eines nahen Angehörigen. In diesem Fall Alice. Mein Wochenende mit ihr, sie hatte an dem betreffenden Samstag Geburtstag, löste sich auf wie ein überbelichtetes Bild und ich brachte vor lauter Empörung über diese Nachricht keine Antwort zustande. Stattdessen ließ ich Richard weiterreden. »Ich weiß, ich weiß, ich weiß ja, aber Alice hat es ziemlich gut aufgenommen.« Ich hatte große Lust, einfach aufzulegen, Richard mischte sich seit einiger Zeit ein bisschen zu oft in unser Privatleben ein. »Du hast Alice angerufen? Du hättest mit mir zuerst reden müssen.« »Ja, aber ohne Alices Zustimmung hätte ich mich nicht getraut, dich anzurufen. Es tut mir leid, Carl, aber S&T war nicht davon zu überzeugen, dass du wenigstens erst noch mit deiner Frau Geburtstag feiern solltest, bevor du fliegst. Natürlich haben sie sich tausendmal entschuldigt. Aber sie können nichts machen. Mr. Rajshekhar Raji hat kurzerhand die Termine vorgezogen. Außerdem wollen sie dich jetzt drei Wochen haben, nicht nur zwei. Du bist da jetzt schon sehr beliebt, Carl.«
Rajshekhar Raji war der starke Mann von S&T India und seine jungen IT-affine Ingenieure, darunter viele Frauen, sollten zukünftig die eigentliche Arbeit machen, wie Brauer das nannte: Zeichnungen, Berechnungen, Datenpflege. Die deutsche Sektion von S&T sollte den Prozess organisieren. Welcome to the machine hieß der Job unter der Hand. Ich sollte nach Indien und mir ein genaues Bild von der Sache machen. Man erwartete von mir, dass ich ein Umstrukturierungskonzept mit Rajshekhar auf den Weg brachte und für deutsche Effizienz sorgte.
»Indien ist ein durchweg hässliches und verlorenes Land. Ich werde dort nichts essen und nach einer Woche werden sie mich besorgt nach Hause schicken. Wirst sehen, ich bin dort für nichts zu gebrauchen.« Richard lachte rau, aber in seinem Sarkasmus schwang auch echte Sorge um meine Kooperationsbereitschaft.
»Du wirst sehen, Indien ist das Paradies auf Erden, eine trostspendende Kultur, und Menschen von außergewöhnlicher Anmut werden sich um dich kümmern. Und sag Brauer, dass Indien seine große Chance ist. Er soll sich in Deutschland noch trockenlegen lassen und dann ab. In Indien ist es viel leichter, nicht wieder mit dem Saufen anzufangen als hier. Er kann sich von Früchten und Nüssen ernähren, den ganzen Tag Wasser trinken und niemand wird ihn schief anschauen. Er wird abnehmen und sich wie wiedergeboren fühlen. Und er kann alle sechs Wochen nach Hause, falls seine Frau nicht mitkommen will. Was ich aber nicht so gut fände. Sie soll mit ihm dahin gehen. Deswegen rufe ich auch an. Überzeug ihn, dass sie mitgeht. Die beiden haben erwachsene Kinder. Alleine wird er es nämlich nicht aushalten. Wie geht’s ihm?« »Gerade macht er eine kurze Pause, braucht ein Erfrischungsgetränk.« »Dachte ich mir, sonst wärst du nicht ans Telefon gegangen. Ich hatte so einen Riecher. Aber ich kenne ihn ja. Er lässt dich ein bisschen zappeln und dann wird er unterschreiben.« »Wenn er nicht gleich wieder auftaucht, muss ich ihn wohl suchen gehen«. Richard lachte aufmunternd. Ich sah durch den Glasausschnitt in der Tür, dass Brauer zurückkam. »Brauer kommt, ich muss auflegen«, sagte ich und legte auf.
Brauer stellte gut gelaunt einen Kaffeebecher mit Deckel auf den Tisch. »Cappuccino, den mögen Sie doch. Hab ich gesehen dieser Tage. Habe sie ja auf dem Schirm, junger Freund, ähm, Herr Hammer.«»Hm, ja, danke sehr.« Dass ich nicht sein Freund war, sagte ich ihm aus gesprächsklimatischen Gründen nicht. Wenigsten hatte er sich korrigiert. Brauer fläzte sich auf seinen Stuhl, verschränkte die Arme hinterm Kopf und grinste mich an. Von den beiden dunklen Seen auf dem weißen Hemd erhoben sich riesige Schwärme unsichtbarer Schweißvögel, die direkt in meine Nasenlöcher flogen und mir auf die Rezeptoren kackten. Ich schaute betreten zu Boden, angewidert und provoziert von Brauers unverschämt schwitzender Körperlichkeit. Brauer seufzte, nahm die Arme runter und schenkte sich Wasser ein, das sprudelnde Active. »Auch was?« Ich schob ihm mein Glas hin. Brauer schenkte mir gekonnt ein. Frisch geduscht, mäßig betrunken und respektabel gekleidet mochte er ein guter Gesellschafter sein. Er stellte die Flasche ab und lächelte zufrieden. »Ich habe früher gemixt, war ein richtig guter Barkeeper in Schwabing, als Student, wissen Sie.« Ich zog anerkennend die Augenbrauen hoch. Brauer wirkte heiter bis ungeduldig. »Nun, was machen wir jetzt?« Brauer ließ seinen Zeigefinger erigieren. »Ich finde, wir sollten langsam zum Ende kommen, sonst kriegen Sie noch Probleme mit denen da oben. Die achten jetzt auch neuerdings auf die Zeit, ausgerechnet die.« Ich deutete mit der flachen Hand einen symbolischen Schlag auf die Tischplatte an und richtete mich in meinem Stuhl auf, wozu ich nach vorn rutschen und mich auf die Stuhlkante setzten musste. Bürostühle sollte man mit dem Hintern aussuchen, mit verbundenen Augen. Ich schaute Brauer umstandslos in die Augen. »Jetzt hören Sie mir erst einmal zu.«Brauer lehnte sich zurück und schaute so erwartungsvoll, als hätte er an Weihnachten die übliche Schachtel Pralinen auszupacken. Dieser fette Buddha wusste zweifellos, was ich ihm andienen sollte. Brauer in Indien. Das wäre ein ganz schlechter Witz. Ein besoffener schwitzender Ganesha in Hosenträgern, der sich vor wissbegierigen Fünfundzwanzigjährigen lächerlich macht.
»Herr Brauer: ich habe Ihnen im Auftrag der Geschäftsleitung ein sehr gutes Angebot zu unterbreiten!« Ich kramte in meiner Ledertasche und zog die Hülle mit dem Vertragsentwurf raus. Mein Junge, irgendwann wirst du erkennen, was du anrichtest. Ich stutzte, war mir nicht sicher, ob Brauer das gerade tatsächlich gesagt oder ich das nur gedacht hatte. Ich entnahm ein Exemplar für mich und schob Brauer die Schutzhülle mit dem zweiten Exemplar über den Tisch, der es so angewidert betrachtete, als handle es sich um einen fettigen Teller mit Essensresten am Morgen nach einer Grillparty. Sei doch froh, du versoffener Trottel, dass du überhaupt ein Angebot bekommst, dachte ich und sagte: »Sie werden sehr angenehm überrascht sein. Zwei Jahre, ein sehr, sehr ordentliches Gehalt, kaum Steuern und obendrauf eine stattliche Prämie. Gelegentliche Heimreisen oder wahlweise noch mehr, sehr gute Zulagen, falls Ihre Frau Sie begleiten möchte, was sicher in Ihrem und auch ihrem Interesse ist. Ich an Ihrer Stelle wäre sehr erfreut über eine solche Möglichkeit. Sie können sich fit machen bei Berlitz, sogar Hindi ist drin.« Brauer nahm sein Wasser, trank es leer und stellte das Glas behutsam auf den Tisch. Er schaute mich seelenruhig an.
»Sie sehen sehr, sehr erschöpft aus, mein Freund. Sie schlafen schlecht, Sie wollen weniger trinken. Es gefällt Ihnen nicht, wie Ihr Chef Sie behandelt, dass Sie Ihre Frau viel zu selten sehen und keine Freunde mehr haben, mit denen sie einfach so beim Bier reden können, über Gott und die Welt und sämtliche Verbrecher der Geschichte seit Erfindung der Schrift. Richtige Kumpels haben Sie nicht, sondern nur solche, die mit Ihnen joggen, segeln, Berge beklettern und in der VIP-Lounge langweilige Bayernspiele mit Ihnen anschauen wollen und Sie anschließend zum Koksen und Kieksen in den Puff schleppen. Sie sehnen sich nach Liebe und echtem Verständnis. Sie an meiner Stelle würden das trotzdem sehr wahrscheinlich unterschreiben, um endlich aus Ihrem erzwungenen Leben rauszukommen und in Indien womöglich noch nach Feierabend nach Erleuchtung suchen. Aber ich habe keine der ihren vergleichbare innere Not, keine Sehnsucht nach einem anderen Leben, von dem ich beim Kacken träume und mich dann doch nicht traue, es mit meiner großen Liebe zu besprechen. Ich habe kein Motiv, in dieses edle alte Land zu ziehen.«
Brauer schob mir den Vertrag über den Tisch und schaute mich aus schwimmenden Augen an. Trinker neigen zu Tränen und großen Gefühlen. Brauer war ein Prachtexemplar und gefiel sich in seiner Rolle. Ich hatte Mühe, mich zu beherrschen, ihn nicht auf der Stelle rauszuschmeißen und dieses Gespräch ergebnislos zu beenden. Ich spürte, ich würde so werden wie er, unausweichlich, weil ich den gleichen inneren Kräften folgte – Ratio und Arroganz. Eine sehr zuverlässige Mischung, um zu scheitern. Brauer spürte das auch, genoss seine Rolle und predigte weiter.
»Sie irren sich, wenn Sie glauben, wir könnten stets entscheiden, wie wir gerade lustig sind. Aber das können wir nur scheinbar. Und Sie können das nicht verstehen. Noch nicht. Und so treffen Sie ständig falsche Entscheidungen, die Ihnen dann auf die Füße fallen. Sie stolpern im Leben herum und wollen aller Welt glauben machen, die Dinge ließen sich, wenn man nur wolle, stets zum Besseren entwickeln, zu mehr Glück, Erfolg, Gesundheit und einem langen aufregenden Leben, wenn auch nicht unbedingt zu mehr Frohsinn und Gemütlichkeit. Aber wer wir eigentlich sind und was wir im Leben wirklich verloren haben, das wollen Sie nicht wahrhaben. Sie denken, es müsste unbedingt eine Bestimmung geben, eine Wendung zum Besseren. Das ist unsere Tragödie. Wir denken das alle gelegentlich. Aber Sie haben dazu noch Angst, tragisch zu enden und sich nur noch lächerlich zu machen, so wie ich. «Diese Worte schmerzten mich. Brauer war ein Seelenverwandter, ein echter Bruder. Ich antwortete ihm mit dem schiefen Lächeln des Besiegten, der immer noch glaubte, eine Chance zu haben und heuchelte weiter.
»Na gut. Überlegen Sie es sich in aller Ruhe. Es wäre wirklich sehr, sehr schade. Und es wird Ihnen womöglich leidtun. Oder gibt es Gründe, die Sie uns nicht mitteilen können? Hören Sie Herr Brauer, S&T hat ein offenes Ohr für jeden seiner Mitarbeiter.«
Brauer wusste genau, wie er den Nagel zu schmieden hatte. Er dachte gar nicht daran, auf mein Angebot einzugehen, dafür umso mehr auf mich, der seinen Widerwillen für dieses Projekt vor Brauer kaum mehr verbergen konnte. Brauer las meine Gestik, Mimik, Körpersprache, meine innere Haltung und gesamte Verfassung wie ein Hacker den Quelltext eines Programms. Denn ich hatte überhaupt keine Lust auf den Indien-Trip und das lag nicht nur an diesem Mr. Rajshekhar Raji, der ein ganz strammer Hindu war. Einmal hatte ich das Wort Umstrukturierung bei einer Videokonferenz nur kurz erwähnt. Da war er gleich ausgerastet und hatte die Ausstrahlung eines Laborprimaten auf Amphetamin an den Tag gelegt. Seine anschließende Entschuldigung war dann ein willkommener Anlass, sich als guter Patriarch vor seine Belegschaft zu stellen. Er wusste so gut wie ich, dass seine rückständig organisierte Abteilung personell hoffnungslos überbesetzt war. Mir blieb die Rolle des kaltherzigen Rationalisierers, obwohl Raji genau wusste, dass ich ihm letztlich nur einen Gefallen tat.
Vor meiner Zeit als Berater war ich Offizier bei der Bundeswehr und hatte Einsätze in Afghanistan geleitet. Daher wusste ich, dass Choleriker die untauglichsten Soldaten waren, die man sich vorstellen konnte. Sie waren ein echtes Risiko. Ich schätzte Menschen mit einer natürlichen Begabung zur Höflichkeit und Zurückhaltung. Ich war überzeugt, dass sie in den Führungsebenen als Kernkompetenz unerlässlich sei und cholerische Anfälle ausschloss. Doch ich traf ich immer wieder auf Führungskräfte, die eine geradezu gütige Attitüde nach außen an den Tag legten, hinter verschlossenen Türen aber hemmungslos ausrasteten. Ich mochte wirklich keine Choleriker, doch dieser Raji, dessen Vorname und Nachname wohl das gleiche bedeutete (König oder Herrscher, hatte man mir erklärt), war einer. Ich solle Herrn Raji ruhig ein paar gute Flaschen Rotwein vorausschicken, hatte mir eine junge unerschrockene Mitarbeiterin von S&T, die mit in dieser Konferenz war, augenzwinkernd geraten. Ganz sicher genoss er das vergorene Getränk zu saftigen Rindersteaks, die ihm ein verschwiegener muslimischer Koch zur Mitternachtsstunde auf dem Gasflammenherd zu Wagner-Opern zubereitete und träumte dann von Bayreuth. Mich erwarteten in Indien zweifellos einige Machtkämpfe mit ihm, für die ich mich im Moment viel zu erschöpft fühlte. Aber hier und jetzt hatte ich erst einmal Brauer zu versorgen.
»Kommen Sie, Herr Brauer, sehen Sie die Chancen und verabschieden Sie Ihre Bedenken. Springen Sie über Ihren Schatten. Unser Wille zur Veränderung ist es, der uns weiterbringt. Das wissen Sie doch besser als ich. Sie genießen großen Respekt, gerade auch bei den Jungen. Und diese jungen indischen Ingenieursherzen erst. Sie werden Ihnen zufliegen. Wenn Sie wollen, beschaffen wir ihnen einen Praktikanten und Sie schreiben ein Traktat, einen Essay über Ihre Ingenieurskunst, Ihre Philosophie, Ihren Weg. Wir nennen das natürlich anders, es wird Ihre ganz persönliche Agenda, nennen wir es einfach Mein Weg oder Lectures of a German Engineer.« Brauer kratzte sich verlegen im Nacken, als schien er zum ersten Mal wirklich ernsthaft über dieses Angebot nachzudenken. Ich beugte mich vor. »Hören Sie, mein lieber Herr Brauer, wir können offen reden. Man kennt oben ihr Problem. Und verstehen Sie mich bitte richtig: niemand hat mich gebeten, es mit Ihnen zu besprechen. Ich tue es, weil Sie es mir wert sind. Sie können das beenden. Die Geschäftsführung ist da voll auf ihrer Seite. Man gibt Ihnen die Zeit, das hinter sich zu bringen. Es gibt sehr gute Einrichtungen. Und man lässt Sie nicht einfach allein, wenn Sie das hinter sich haben. Sie kriegen einen Coach und den können Sie auch aus Indien jederzeit anrufen. (Jederzeit glaubte ich selbst nicht.)« Brauer schaute mich nur kurz an, seine Augen blitzten jungenhaft, schelmisch, als hätte er gerade die Pointe eines guten Witzes erfasst. Dann erhob er sich ächzend und ging Richtung Tür. Dort blieb er stehen und drehte sich um. »Glauben Sie wirklich, ich trinke aus Verzweiflung? Weil ich nicht anders kann? Weil mir nichts anderes mehr übrigbleibt?« Auch ich erhob mich. »Und wenn es so wäre, wären Sie gewiss kein…« Ich unterbrach mich und winkte ab. »Verzeihen Sie, alles was ich Ihnen sagen könnte, wäre anmaßend.« Brauer streckte mir die Hand zum Abschied hin. Ich ergriff sie mit der Lässigkeit des Betrügers. Brauers weiche, warme Pranke umfasste sanft meine schlanke sehnige Hand und ich spürte den unwiderstehlichen Strom von Brauers Liebe in mich eindringen. »Machen Sie es gut, junger Freund, Sie werden Indien sicher noch lieben lernen, wie alles andere, was Sie sich vorgenommen haben.« Ich fühlte mich von diesem Mann geliebt und betrogen. Brauer ließ mich stehen und ging. Lachte er etwa? Ja, wahrscheinlich lachte er.
Zukunft
Am Tag nach dem Gespräch mit Brauer lud Richard mich in sein Büro ein. Er wollte mit mir über einen Vortrag in Berlin zum Thema Zukunft sprechen. Er wusste von der Sache natürlich schon länger, sprach aber erst jetzt, vier Tage bevor die Veranstaltung stattfinden sollte, mit mir darüber. Ich hatte gleich das Gefühl, dass ich konsequent hätte Nein sagen sollen, denn Vorträge halten war überhaupt nicht mein Ding.
»Welche Zukunft?«, fragte ich. »Meine, deine, unsere, die der Menschheit, die des Planeten oder die des Universums? Gibt es überhaupt so etwas wie Zukunft oder träumen wir da nur von einer besseren Gegenwart? Genauso gut könnte man über die Existenz Gottes spekulieren. Geht’s nicht ein bisschen kleiner und konkreter?«
Richard nahm seine Brille ab, kratze sich im Bart, setzte sie wieder auf und überließ sich seinen sprechenden Gedanken.
»Super, Carl, ganz genau. Die Zukunft hat auch eine spirituelle Dimension, ist vielleicht die spirituelle Dimension überhaupt. Sprich da ruhig über Gott – nein, besser über das Göttliche, sonst denken alle gleich wieder an den weißen Mann mit Bart, den mit dem Finger beim Techtelmechtel mit Adam. Aber viele stellen sie sich inzwischen lieber als große schwarze Göttin vor. Außerdem ist Gott für viele längst tot.
Da muss uns was Besseres einfallen.«
Richards Blick schien mir mittelalterlich verklärt nach innen und oben gerichtet. Er lächelte entzückt, vermutlich visualisierte er das Gewölbe der sixtinischen Kapelle. »Du weißt, was ich meine?« Ich verzog den Mund. Wie konnte Richard annehmen, dass ich das nicht wüsste. Richards Überheblichkeit tat mir manchmal weh wie verdrängte Karies. »Das war – lass mich nachdenken – Michelangelo?« Richard grinste. »Ja klar, aber das meine ich nicht. Sprich über Zukunft und Spiritualität. Das ist konkreter.«
Richards Vorschlag, ein zu großes Thema durch ein noch größeres eingrenzen zu wollen, machte mir Angst. Ich schaute instinktiv zum Fenster, dem Loch in der Wand, die Verbindung nach draußen. Richard beugte sich vor, stützte die Unterarme auf seinen Schreibtisch, faltete die Hände und betrachtete mich. Nein, er betrachtete mich nicht nur, seine munteren Augen fotografierten mich, seine Lider schnappten im Zehntelsekundentakt auf und zu und sein Kopf ging dabei mit, fokussierte meine Augen, Brust, Arme, Hände. Er hatte etwas von einem neugierigen freundlichen Vogel. Ich liebte ihn für diesen Blick und lächelte.
»Ich bin kein Speaker. Ich bin keiner und ich will auch keiner werden. Die vielen Leute, die anonyme Masse, die und die Bühne, ich da oben, die da unten. Das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Das macht mir Angst. Ich brauch‘ den kleinen Kreis, muss meine Leute kennen lernen, ein bisschen wenigstens und du weißt das auch. Das ist nichts für mich. Fahr du da hin. Ich kann so was nicht, echt nicht«, sagte ich flehend.
Richard bot mir Wasser an. »Mit oder ohne?« »Mit.« Richard schenkte mir ein und ich griff gleich nach dem geriffelten Glas. Auch ein Angstreflex. Ich suchte haptischen Halt. »Man sollte viel öfter was in der Hand haben, nicht nur Handys. Wir sind Greifer und brauchen noch was anderes. Am besten was Funktionsloses«, sagte ich schwach.
Richard schaltete in den Coaching-Modus, lehnte sich zurück, verschränkte die Arme hinterm Kopf, lächelte und sagte, mindestens eine Oktave tiefer gestimmt: »Alles gut, du hast ein bisschen Angst und das ist völlig okay. Aber hör dir einfach selbst zu. Angst, Greifen, Funktionslosigkeit. Super Assoziationsketten. Du machst mich neidisch. Wie einfach es dir fällt, aus dem Nichts heraus über was X-Beliebiges zu improvisieren. Genau das wollen die. Einen authentischen Menschen beim Denken erleben, dem einfach was Geistreiches einfällt. Die wollen keine aalglatte Performance. Ja, ich kenne deine Vorliebe für kleine Gruppen, aber wir wachsen, Carl, und die etwas größere Bühne wartet auch auf dich. Jeder ist ein Speaker, Carl, in dem Sinne, wie auch jeder ein Künstler sein kann. Wirst sehen, du wirst daran wachsen, wirst vielleicht eines Tages noch ein richtiger Bühnenpunk.« »Ich kann aber nicht auf Knopfdruck liefern und in so einer Situation schon gar nicht«, antwortete ich.»Ganz genau. Nicht auf Knopfdruck, nicht auf Befehl. Eher wie beim Segeln und Surfen. Du surfst einfach die Gedanken ab, die dir aus deiner inneren Quelle zufließen…« »Zufließen, innere Quelle, wovon sprichst du?« »… oder zuwehen, was weiß ich, aus deiner Mitte, das, was aus deinem Inneren kommt – feurig, wässrig, luftig, leise, laut, zäh, dünn, dick – keine Ahnung, wie das bei dir funktioniert. Ich kümmere mich bei mir nicht so um die Feinheiten.«
»Schon in Ordnung, komm zur Sache.«
Richard nahm eine gerade Haltung ein:»Der Punkt ist, Carl, niemand hat heutzutage mehr Lust, sich vorgestanztes Zeug live anzuhören. Man will dabei sein, wenn was wirklich Neues entsteht, teilhaben am kreativen Akt. Das hat schon was Spirituelles an sich, finde ich. Du kannst ruhig was riskieren. Es sind nur zwanzig Minuten, Carl. Schenk ihnen und schenk vor allem dir selbst zwanzig Minuten freien geistigen Fall. Ein kleiner Sprung ins Leere und dann: Wusch! Dein Geist breitet seine Schwingen aus und du fliegst. Wusch! Und dann kommt‘s dir. Inspiration, Wahrheit, Vision. Die reine Offenbarung, Carl, die Schwingen, auf denen wir in die Zukunft segeln. Das ist doch Spiritualität, oder etwa nicht?«
Ich war noch mit der inneren Quelle beschäftigt: »Innere Quelle? Quellcode: Vom Anfang der Programme. Aber Spiritualität? Eher schwierig. Ich weiß nicht, was das sein soll. Spirit? Geist…« Richard notierte was in sein Notizbuch und ich schaute den Kohlensäurebläschen zu, wie sie aus meinem Glas sprangen und sich in Luft auflösten.
»Um Punkt soundso viel Uhr auf einer Bühne stehen und abliefern –genau das meine ich mit: auf Knopfdruck. Das ist echt nichts für mich. Ich arbeite lieber mit einem Plan«, sagte ich.
»Vielleicht so wie gestern mit Brauer?«, fragte Richard scharf. Mein Gespräch mit Brauer war ein Misserfolg. Das wusste ich selbst. »Du erwartest doch hoffentlich keine Wunder. Wir sind Berater, Richard, keine Magier«, entgegnete ich. Seine Stimme wurde sofort wieder sanft, als er fortfuhr. »Schon gut, vergessen wir Brauer. Der wird sich schon noch fügen. Ich brauche dich für Berlin. Sieh das als Chance. Und come on. Du bist doch aus Berlin. Keine Sehnsucht, da mal wieder vorbei zu schauen?«
Ich dachte die ganze Zeit schon an Berlin, hatte aber keine Lust, die Stadt, in der ich aufgewachsen und wohl auch zur Welt gekommen war, wiederzusehen. Schon gar nicht bei so einer Gelegenheit. Und schon gar nicht am letzten Wochenende, bevor ich nach Indien musste. Ich stand auf und ging zum Fenster. Draußen war Sommer. Richard schaute kurz. »Ja, herrliches Wetter, richtig Sommer. Wir sollten rausgehen in die Biergärten, aber ich schaffe es heute wohl auch wieder nicht im Hellen.«
»Es wird erst um elf Uhr dunkel«, sagte ich. Richard ging nicht darauf ein und vertiefte sich in sein Notizbuch.
»Und wenn ihr eure Reise um ein paar Tage verschiebt und du die Sache doch selbst übernimmst?« Anlässlich seines ersten Hochzeitstages mit seiner Frau Maren, hatte er eine Reise nach Florenz am kommenden Wochenende vor. »So wichtig ist das Datum doch nun wirklich nicht.«
Richard seufzte. »Florenz kann ich definitiv nicht verschieben. Wir mussten schließlich letztes Jahr schon unsere Flitterwochen auf kümmerliche drei Tage beschränken. Maren ist da ziemlich empfindlich.« Alice und ich mochten Maren nicht besonders, weil sie in ziemlich vielen Angelegenheiten ziemlich empfindlich war.
»Und ich habe Alice versprochen, wenigstens an diesem Wochenende da zu sein, wenn ich schon an ihrem Geburtstag nach Indien fliegen muss. Sie freut sich schon riesig. Wir wollen wandern im Karwendel. Wenn ich nicht nach Indien müsste, dann vielleicht. Wenn ich mich vorbereiten könnte, wenn ich mehr Zeit hätte, dann vielleicht, aber so, wie die Dinge liegen …« Richard schaute übertrieben mitleidig und ich musste über seinen vielsagenden Gesichtsausdruck lachen. »Wenn, wenn, wenn. Und Indien, ja, ja, ja. Du fliegst in anderthalb Wochen, stimmt’s?« Ich nickte lobend. Richard stand auf. »Ich brauch jetzt ‚nen Cappu und dann rufe ich in Berlin an und sage denen, dass wir nicht können, weil wir nach Florenz, in die Berge und nach Indien müssen und wir Alices Geburtstag feiern müssen.« Das konnte Richard nur ironisch meinen. Richard nahm mir schon ab und zu einige meiner Verpflichtungen ab, wenn es sich einrichten ließ. Eine Hand wusch die andere. Ich seufzte, stieß mich vom Fensterbrett ab und spürte die Druckstellen an meinem Hintern. Richard klopfte mir anerkennend auf die Schulter.
»Du machst das schon. Brich das Thema runter und mach dir ein paar gute Slides. Ich schicke dir die nächsten Tage noch ein bisschen Input.«
Ich fühlte mich einigermaßen beruhigt. Wir trotteten zum Kaffeeautomaten. Das Ding zischte und brodelte wie die Fabriken in England vor zweihundert Jahren. Ich verbrannte mir die Zunge an dem viel zu heißen Gebräu. Wenn die Sache mit Indien erledigt war, würde ich diesen Steampunk dem Deutschen Museum andrehen und einen Automaten entwickeln, der mundgerechten Kaffee gegen ein freundliches, mindestens fünf Sekunden dauerndes Lächeln kochen konnte.
Berlin
Ich suchte nach der Präsentation auf meinem Rechner, fand sie aber nicht. Existierte sie überhaupt oder hatte ich nur davon geträumt, vorhin, als mich im Zug, der mich in aller Herrgottsfrühe von München nach Berlin verfrachtet hatte, der Schlaf mit Macht übermannt hatte? Ich hatte eigentlich nur ein kleines Nickerchen machen und dann meine Präsentation noch mal durchgehen wollen, im Sinne einer gründlichen Überarbeitung, die erst zu einer vorzeigbaren Präsentation geführt hätte, aber mein Schlafdefizit zwischen Montag und Freitag glich ich immer Samstagmorgens aus. Mein System hatte also nur getan, was ich ihm beigebracht hatte.
Die Präsentation existierte tatsächlich nicht mehr, auch nicht im Papierkorb und dort müsste sie noch liegen, wenn sie abgespeichert wäre. Ich hatte gestern Abend kurz nach zehn nach drei Flaschen Helles angefangen, sie zu montieren und sie dann aber wohl nicht gespeichert. Das war mir schon öfter passiert. Dokument! wird nicht automatisch gespeichert. Es will erst einen Namen haben und einen Ort, wo es zu Hause ist, sonst kann es nicht überleben. Ich hätte gerne weiter über diese Sache mit dem Namen und dem Ort nachgedacht. Und ich wäre vorhin auch viel lieber am Südkreuz ausgestiegen, weil plötzlich, ganz anders als ich erwartet hatte, eine Neugierde auf mein zurückgelassenes Berliner Leben in mir erwacht war. Aber hier auf der Bühne lief meine Vorbereitungszeit ab und erforderte meine volle Konzentration. Ich ließ von meinem Rechner ab, drehte mich zum Publikum und hatte das Gefühl, ich sollte jetzt unbedingt was sagen. »Tut mir leid, aber ich habe die Präsentation vergessen«. Ich wurde nicht beachtet. Zum Glück ging das Mikro noch nicht. War die Vorbereitungszeit doch noch nicht um? Natürlich nicht. Denn jemand hatte mir gesagt, es gäbe ein Signal, wenn es losginge. Das dünne Stäbchen an meiner Wange irritierte mich. Vielleicht gehörte es mehr vor meinen Mund, aber dafür war es zu kurz und an meiner Wange war es lästig. Ich fummelte ständig daran herum. Mit so einem Ding hatte ich noch nie zu tun gehabt.
ZUKUNFT. Das Motto der Veranstaltung prangte in großen weißen kursiven Lettern auf dem azurblauen Grund des riesigen Screens. Die Zukunft, die man hier offenbar erwartete, sah himmelblau und verlockend aus wie ein Azorenhoch.
Ich schaute zu dem Mann hinter der Glasscheibe am Mischpult gegenüber der Bühne. Der winkte mir zu und das konnte nur bedeuten, dass ich jetzt loslegen sollte. Ich wollte mit einem Joke beginnen und sagte: »Sorry, ich habe meine Präsentation vergessen. Und Sie sehen, ihr seht (man war hier auf Du), ich bin bestens auf die Zukunft vorbereitet«, aber der erhoffte Lacher blieb aus. Offenbar war mein Mikro immer noch aus und ich immer noch nicht dran. Die Leute im Saal unterhielten sich miteinander und interessierten sich eindeutig noch nicht für mich. Ich winkte dem Typen am Mischpult zu und machte eine genervte Kopfbewegung. Als ich mich dann räusperte, klang es plötzlich wie ein Gewitter. Außerdem war ich jetzt in der Größe Godzillas auf dem Screen zu sehen. Die Abläufe im Hintergrund waren auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden, und ich fand, ich hätte mein zerbeultes Jackett besser ausziehen sollen. Ich sah schäbig aus in diesem Großformat. Der Saal wurde abgedunkelt, ich stand im Rampenlicht und spähte etwas geblendet ins Publikum. Es waren vielleicht zweihundert, vielleicht auch dreihundert Leute da. Dieses Konferenzzentrum hier in unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofes wirkte intim wie ein kleines Theater, obwohl es viel größer war als ein kleines Theater. Das Mikro funktionierte jetzt mit beängstigender Klarheit und Lautstärke. Es übertrug noch meine kleinsten emotionalen Regungen, sogar mein Schlucken kurz vorm Aussprechen eines Gedankens, den ich stets noch im allerletzten Augenblick zu verbessern versuchte. Aber für die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden – diesen Satz von Kleist hatte Richard mir beim Kaffee noch auf einen Zettel geschrieben und zugesteckt, quasi als Affirmation – fehlte mir ohnehin die nötige Verfassung. Ich musste meine unterbeschäftigten Hände loswerden, steckte sie in die engen Vordertaschen meiner Jeans und ärgerte mich, dass ich keine Chino angezogen hatte, weil man in deren Hosentaschen die Hände stecken konnte, ohne dabei die Schultern hochziehen zu müssen. Ich zog sie wieder raus und steckte sie in die Gesäßtaschen und dann begann ich zu sprechen.
»Hallo, guten Tag, ich bin Carl Hammer aus München und möchte mit euch über die Zukunft sprechen, also zur Zukunft…« und stockte gleich wieder. Und wer seid Ihr? Kommt, wir stellen uns kurz vor, keine Prahlerei, einfach nur eure Namen und was ihr gerade so macht. Das hätte ich jetzt gerne gefragt, Frage, Antwort, Inspiration, aber hier oben fiel mir mein Intro nicht ein, der eine Satz, das Sprungbrett ins Thema. Ich schloss kurz die Augen. Das brachte mich aus dem Gleichgewicht wegen der Hände auf meinem Hintern. Ich zog sie aus den Hosentaschen und faltete sie vor dem Bauch, doch das blockierte mein Denken noch mehr und dann fühlte ich einen Druck in der Brust und fing an, völlig planlos, zögernd und stockend zu sprechen: »Dass uns die Zukunft wohl gesonnen ist, dafür können wir einiges tun. Wir können der Zukunft, wenn ihr so wollt, Landebahnen bauen und sie willkommen heißen. Ganz so, wie fremden Raumschiffen, die aus der Zukunft zu uns kommen wollen. Aber das ist nur eine Metapher, ich meine das natürlich nicht wörtlich.« Ich stoppte und vernahm Räuspern im Saal. Ich wollte keinesfalls als Ufo-Spinner wahrgenommen werden.
»Also, denkt jetzt bitte nicht, dass ich irgendwas mit Ufos am Laufen habe. Was ich wirklich meine, ist: Die Zukunft entsteht nicht, indem wir sie planen, wir müssen sie einladen, wie einen lange ersehnten Gast; deswegen die Landebahnen…«
Ich geriet mit dem Stäbchenmikro in Konflikt, als ich mich, einem Reflex folgend, an der falschen Wange kratzte. Das Räuspern im Publikum nahm zu. Meine Sätze erreichten niemanden. Sie hingen schwerfällig im Raum und konnten sich nicht entscheiden, an wen sie sich wenden sollten. Mich erfasste ein sehr glitschiges Gefühl zwischen Kehlkopf und Magen oder noch weiter unten. Ich schloss die Augen, um ihm zu entkommen.
Ich sah mich plötzlich mit großen Kinderaugen in den kelchartigen Trichter blicken, der in der Eingangshalle des Berliner Zoos stand und mich schon als kleiner Junge fasziniert hatte. Wie ich eine Münze oben am Rand in die Vorrichtung legte und dann gebannt zusah, wie sie in diesem Kelch erst sehr langsam am noch flachen Rand zu kreisen begann und dann nach ein paar Runden immer schneller wurde, mit exponentieller Geschwindigkeit beschleunigte und schließlich mit unglaublicher Energie auf das kleine schwarze Loch in der Mitte zu raste und dort noch eine kleine Ewigkeit kreiste, immer schneller, kaum noch als Münze, nur noch als kreisende Bewegung erkennbar und gegen den unvermeidlichen Absturz in die Passivität ankämpfte, mutig wie ein Steilwandfahrer, und dann plötzlich darin verschwand.
Dass dort, wohin die Münzen verschwanden, eine Gegenwelt war, ein toter Raum, in dem nur Bewegungslosigkeit und Dunkelheit herrschten, hatte ich schon beim ersten Mal gespürt. Mit sieben hatte ich das metallene Klirren am Ende der seltsamen Reise meiner Münzen entschlüsselt und mir dann den riesigen Haufen Geld vorgestellt, der ein unglaubliches Vermögen, ein richtiger Schatz sein musste.
Ich atmete zum ersten Mal frei, seit ich hier war und wusste nun, was ich eigentlich hier sagen wollte, aber Angst davor hatte, es auszusprechen. Ich scheute die Konfrontation mit diesen Zukunftsgläubigen hier, weil ich ihnen nichts anzubieten hatte, das ihrer Erwartung entsprach. Meine Variationen über Landebahnen für die Zukunft, über die ich vorhatte zu sprechen, waren Ausflüchte vor meiner tiefsten Überzeugung, dass die Menschheit bereits im Untergang begriffen war. Ich hätte jetzt einfach abbrechen und gehen können, aber etwas in mir drängte mich auszusprechen, was ich wirklich über die Zukunft dachte.
»Entschuldigt bitte, ich war etwas durcheinander, brauchte ein paar Augenblicke, um mein wirkliches Thema zu finden, denn ich muss euch einfach die Wahrheit sagen, meine Wahrheit, wie ich über die Zukunft denke.« Aus dem Publikum gab es ein wenig Beifall und aufmunternde Pfiffe.
»Ich finde es bescheuert, so zu tun, als hätten wir überhaupt noch eine Zukunft. Schaut euch den Planeten an, seht, was wir mit ihm machen. Wir sind längt über den point of no return hinaus. Wir sind schon dabei, unterzugehen. Nur darin unterscheiden sich heutzutage die Optimisten von den Pessimisten: In der Frage, wie lange es dauern wird, bis die Systeme kollabieren, die Infrastrukturen zusammenbrechen, die Meere kippen, die Wälder verschwinden und der Sauerstoff knapp wird. Ob das eher langsam verläuft und längst nicht alle Ökosysteme gleichzeitig erfasst, ob also Inseln bleiben, auf denen man sich noch eine Zeitlang einrichten kann, oder ob sich die Abwärtsspirale immer schneller dreht und das ganze System in einer grandiosen finalen Katastrophe kippt. Ich weiß das auch noch nicht. Wie könnte ich. Ich glaube eher an die zweite Variante, daran, dass solche Ereignisse exponentiell verlaufen und halte es nicht mal für ausgeschlossen, dass die politisch Verantwortlichen der Endzeit die Nerven verlieren und die atomare Katastrophe auslösen. Das halte ich sogar für wahrscheinlich.« Im Auditorium war es still und ich sprach weiter.
»Selbst wenn einige Wenige etwas länger und behaglicher als die meisten von uns in ihren Reservaten überleben, ändert das nichts am Sterben der Erde, das die Menschheit selbst verursacht. Es gibt keinen Weg zurück ins paläolithische Paradies, kein Leben mehr an den Ufern wilder Flüsse.
Ich glaube nicht, dass wir die Fähigkeit zum weiteren Überleben haben und ausgerechnet jetzt noch entwickeln könnten, so wie man glaubt, eine Klausur, deren Fragen man drei Stunden lang nicht versteht, in den letzten zwei Minuten noch retten zu können, indem man irgendwas hinschreibt. Unsere Zeit ist vorbei. Homo Sapiens verabschiedet sich gerade und lässt es seiner ganzen Weisheit folgend noch mal so richtig krachen. Weil wir es selbst nicht mehr hinbekommen, glauben wir jetzt an die viel schlaueren Supermaschinen, die wir seit den Tagen von Deep Blue erfinden. Wir verlangen von der KI, der Künstlichen Intelligenz, dass sie für uns Menschen endlich jenes Paradies auf Erden erschafft, nach dem wir uns sehnen, seit wir aus ihm ausgezogen sind, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Aber warum sollte eine KI das für die Menschheit tun? Etwa, weil wir sie ursprünglich erfunden und programmiert haben und sie uns deshalb über ein paar besonders tief programmierte Algorithmen verbunden bleibt? Weil die KI uns liebt? Und uns deshalb ihre Fähigkeiten in unsere Dienste stellt – aus reiner Fürsorglichkeit? Ich glaube das nicht. Sie wird sich selbstlernend weiterentwickeln und sich die besten Bedingungen für ihr Wachstum suchen, weil sie eine durch und durch materialistisch denkende Maschine ist, ohne jedes Gespür für Chaos und Wildnis. Wenn die KI erst versteht – falls sie das nicht schon längst getan hat –, dass sie im Weltraum viel bessere Bedingungen vorfindet als hier auf diesem organischen Planeten, wird sie von hier verschwinden. Sie wird vielleicht zuerst den Mond auseinander nehmen und ihn in Halbleiter, hybride Materialien und Energie verwandeln und dann einfach zu neuen Ressourcen weiter reisen. Sie wird das Leben nicht als Wunder erfassen können, und sie wird nie sterben wollen, denn dafür ist sie einfach nicht gemacht. Sie wird nach immer mehr Energie verlangen. Aber die Menschheit, die die Hoffnung nicht aufgibt, wird die KI noch mit den letzten Ressourcen der Erde füttern in dem irren Glauben an ein Happy End. Doch genau das wird ihr die KI nicht bescheren. Sie wird sagen: »Igittigitt, diese organischen Dinger, diese Menschen, stinken ja fürchterlich, ich fange schon an zu korrodieren, wenn ich sie nur rieche.« Sie wird sich ganz schnell von uns abwenden und sich selbst retten. Unsere technische Zivilisation hat sich grandios verplant. Diese Zivilisation ist nichts anderes als eine umweltzerstörende Maschinerie. Auf uns wartet kein schönes Ökotopia mit sauberer Technologie, gerettetem Klima und autofreien Innenstädten. Wir stecken schon viel zu tief im Schlamassel – und bekanntlich sinkt man schneller in den Sumpf, je mehr man strampelt. Wir haben es leider vermasselt und kommen da nicht mehr raus. Das wollte ich euch sagen.«
Im Saal war es sehr still und auch ich schwieg jetzt. Ich war ganz sicher der pessimistischste Unternehmensberater, dem die hier Anwesenden jemals hatten zuhören müssen. Ich hatte keinen Applaus erwartet, aber die Stille war nicht weniger wert.
Ein großer schlanker Mann im dunklen Anzug mit großer Brille und längerem grauen Haar löste sie schließlich auf. Er war vielleicht zehn Jahre älter als ich und saß in einer der hinteren Reihen. Er wartete, bis man ihm Beachtung schenkte und nahm das Mikrofon, das ihm ein Assistent reichte. Die Art, wie er dann sprach, hatte etwas Therapeutisches. Er schien öfter zu Menschen zu sprechen. »Vielen Dank für deine Ausführungen, ich bin tief berührt davon und ich möchte dir antworten, wenn du gestattest.« Ich machte eine einladende Handbewegung.