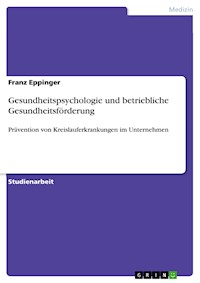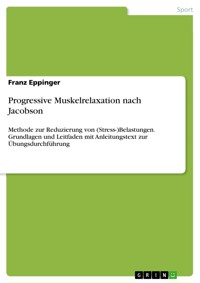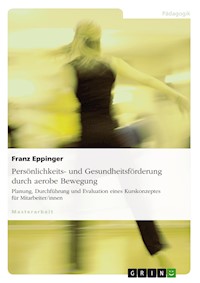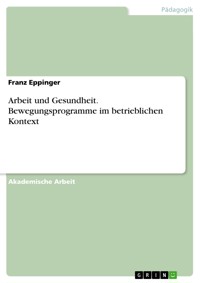15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Akademische Arbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Pädagogik - Erwachsenenbildung, Note: 1,0, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beleuchtet den beliebten Sport Laufen aus therapeutischer Sicht. So soll zwischen aerober und anaerober Bewegung unterschieden und aufgezeigt werden, welche Effekte der langsame Dauerlauf auf Körper und Psyche hat. Kann Laufen als eine Form der Therapie, als Projekt betrachtet werden? Neben einem Standardlaufprogramm liefert diese Arbeit außerdem Informationen rund um das „Therapeutische Laufen“ und zeigt auf, dass es sich bei diesem Sport um eine unspektakuläre, kostengünstige und effektive Art der Bewegung handelt. Die dynamische Bewegung großer Muskelgruppen wie sie beim Radfahren, Laufen, Walken, Schwimmen, Rudern, Skilanglauf usw. auftreten, setzen Adaptionsmechanismen in Gang, die aus medizinischer Sicht wegen ihrer gesundheitsfördernden Wirkung als nahezu ideal empfohlen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Energie für diese ausdauernden Bewegungsarten im Organismus „aerob“ gewonnen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1 Aerobe Bewegung und „Therapeutisches Laufen“
1.1 Aerobe vs. anaerobe Bewegung
1.2 Medizinische Forderungen an Präventionsmaßnahmen
1.3 Effekte des langsamen Dauerlaufs
1.3.1 Körperliche Wirkungen
1.3.2 Einflüsse auf die Psyche
1.3.3 Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften
1.4 Ansatz des therapeutischen Laufens („Lauftherapie“)
1.5 Exkurs: Laufen - eine Therapie?
2 Implementierung des therapeutischen Laufens
2.1 Projektmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung
2.2 Laufen als Projekt
2.3 Leitfaden Kurs „Therapeutisches Laufen“
2.4 Grenzen der Planbarkeit und didaktische Kompetenz
2.5 Laufen als Angebot auf dem Gesundheitsmarkt
3 Laufen – unspektakulär, kostengünstig und effektiv
4 Anhang
5 Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
1 Aerobe Bewegung und „Therapeutisches Laufen“
Die vorliegende Arbeit beleuchtet den beliebten Sport Laufen aus therapeutischer Sicht. So soll zwischen aerober und anaerober Bewegung unterschieden und aufgezeigt werden, welche Effekte der langsame Dauerlauf auf Körper und Psyche hat.
Kann Laufen als eine Form der Therapie, als Projekt betrachtet werden?
Neben einem Standardlaufprogramm (siehe Anhang) liefert diese Arbeit außerdem Informationen rund um das „Therapeutische Laufen“ und zeigt auf, dass es sich bei diesem Sport um eine unspektakuläre, kostengünstige und effektive Art der Bewegung handelt.
1.1Aerobe vs. anaerobe Bewegung
Die dynamische Bewegung großer Muskelgruppen wie sie beim Radfahren, Laufen, Walken, Schwimmen, Rudern, Skilanglauf usw. auftreten, setzen Adaptionsmechanismen in Gang, die aus medizinischer Sicht wegen ihrer gesundheitsfördernden Wirkung als nahezu ideal empfohlen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Energie für diese ausdauernden Bewegungsarten im Organismus „aerob“ gewonnen wird.
Aerob(griech.: mit Sauerstoff) bedeutet, dass aus Muskelzucker unter Verwendung von Atemsauerstoff Energie erzeugt wird. Dabei halten sich Aufnahme und Verbrauch von Sauerstoff die Waage. Diese Prozesse herrschen beim langsamen Dauerlauf vor. Sie halten lange an und durch das vermehrte Sauerstoffangebot im Organismus kommt es zu gesundheitlich positiven Effekten.
AnaerobeProzesse (ohne Luftsauerstoff) laufen bei hoher Muskelintensität ab - wie beim Sprinten oder bei der Kraftarbeit. Die Muskeln sind jedoch nach kurzer Zeit schon erschöpft.
Die folgende Abbildung bezieht sich auf Menschen (Sportler) mit hoher aerober und anaerober Kapazität. Auf der Abszisse ist die Belastungsdauer und die Übertragung auf entsprechende (Lauf-) Strecken markiert. Sie zeigt, dass bei Belastungen, die über zwei Minuten andauern, der aerobe Stoffwechsel zur dominierenden Energiequelle wird. Bei kurzfristigen Belastungen, insbesondere bei Belastungsformen, die beispielsweise einem 100-m-Lauf oder Kraftarbeit entsprechen, „wird der überwiegende Anteil des Energiebedarfs unmittelbar anoxydativ bestritten, sei es durch den Abbau der vorhandenen energiereichen Phosphatspeicher oder aber über die Glykolyse“ (Wessinghage 2004, 36).
Abb. 1 Anteil aerober und anaerober Kapazität an der Energiebereitstellung bei Maximalbelastungen verschiedener Dauer (nach Wessinghage 2004, 36)
Relativ zuverlässige Aussagen über den jeweiligen Fitnesszustand erlaubt ein Laktat-Test. Über die Bestimmung der Milchsäurekonzentration aus dem am Ohrläppchen entnommenen Blut, lässt sich der individuell günstigste Belastungsbereich ermitteln. Überschreitet der Laktatspiegel, z. B. bei zu hoher Laufgeschwindigkeit, die aerob-anaerobe Schwelle, führt dies zu einem Anstieg der Milchsäurekonzentration und zur Übersäuerung des Muskels, was zum Reduzieren oder zum Abbruch der Belastung zwingt. Bis zur aeroben Schwelle findet eine reine aerobe Energieherstellung statt. Die aerobe Schwelle selbst stellt den Punkt der günstigsten Sauerstoffverbrennung bei niedrigster Laktatproduktion dar (vgl. Geiger 1988, 76). Der Punkt der anaeroben Schwelle entspricht der größtmöglichen Belastungsintensität, bei der Laktatbildung und Laktatabbau gerade noch im Gleichgewicht stehen. Belastungen oberhalb der anaeroben Schwelle führen zu einem kontinuierlichen Milchsäureanstieg.