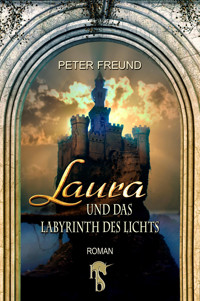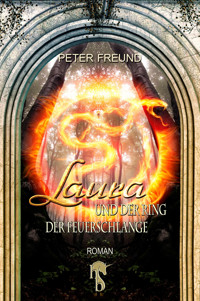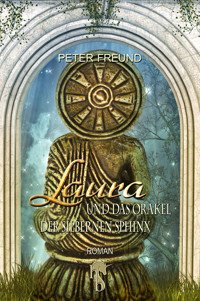4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der Beginn eines fantastischen Abenteuers! Als Laura Leander an ihrem 13. Geburtstag erfährt, dass sie eine Wächterin des Lichts ist, ist nichts mehr wie vorher: Laura muss den Hüter des Lichts vor dem sicheren Tod retten, der auf Aventerra, dem Schwesterstern der Erde, von dem Schwarzen Fürsten Borboron schwer verletzt wurde. Versagt Laura, ist nicht nur Aventerra, sondern auch unsere Erde dem Untergang geweiht. Schlimmer noch: Auch für ihren Vater Marius, der von den Dunklen Kriegern nach Aventerra entführt wurde und in der Dunklen Festung gefangen gehalten wird, gibt es dann keine Rettung mehr. Doch zum Glück ist Laura ein überaus mutiges Mädchen und kann reiten und fechten wie der Teufel. Zudem kann sie sich auf Kaja, ihre beste Freundin, und auf ihren Bruder Lukas stets verlassen. Dazu verfügt sie über so fantastische Helfer wie den Flüsternden Nebel Rauenhauch und den Steinernen Riesen Reimund, der bei Gefahr höchst lebendig wird. Doch auch Borboron hat auf der Erde ganz üble und gewissenlose Komplizen – und so deutet alles darauf hin, als würde Laura trotz ihrer Bemühungen am Ende scheitern, bis sie eine unglaubliche Entdeckung macht … »Wer Harry Potter mag, der wird Laura lieben! Must-Have für alle Fantasy-Fans!« (Bravo Girl) Die Fantasy-Reihe um die spannenden Abenteuer der Laura Leander erzählt die ebenso aufregende wie fantastische Geschichte eines eigentlich ganz normalen Mädchens. Eigentlich, denn an ihrem dreizehnten Geburtstag erfährt Laura, dass ihr seit Anbeginn der Zeiten eine ganz besondere Bestimmung zugedacht ist. Nur sie kann verhindern, dass die vom Schwarzen Fürsten Borboron angeführten Mächte des Dunklen, der Finsternis und des Bösen die Überhand gewinnen. Dies hätte die Vernichtung der Welt zur Folge, und zwar nicht nur die der unseren, sondern auch die von Aventerra, der Welt der Mythen … Die Romanserie besteht aus sieben Bänden: • Laura und das Geheimnis von Aventerra • Laura und das Siegel der Sieben Monde • Laura und das Orakel der Silbernen Sphinx • Laura und der Fluch der Drachenkönige • Laura und der Ring der Feuerschlange • Laura und das Labyrinth des Lichts • Laura und der Kuss des schwarzen Dämons
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Peter Freund
Laura und das Geheimnis von Aventerra
Roman
Für Gabi, Finn und Florian
1. Kapitel: Ein seltsamer Traum
Laura Leander stöhnte im Schlaf. Helles Mondlicht flutete durch das Fenster in ihr Schlafzimmer und tauchte es in einen silbrigen Glanz. Unruhig warf das Mädchen den Kopf auf dem Kissen hin und her. Seine langen blonden Haare waren schweißverklebt.
»Nein«, stöhnte Laura heiser. »Nein, nein, nein!« Ihr hübsches, zartes Gesicht war nur noch eine schmerzverzerrte Grimasse. »Neeeiiin!«
Laura schreckte aus dem Schlaf und richtete sich in ihrem Bett auf. Verwirrt schaute sie sich um. Es dauerte einige Momente, bis ihr endlich dämmerte, dass sie sich in ihrem Schlafzimmer befand.
Im selben Augenblick flammte das Licht an der Decke auf, und ihr Bruder Lukas trat in das Zimmer. »Was ist los, Laura?«, fragte er verschlafen. »Warum hast du so geschrien?«
Lukas war ein Jahr jünger als seine Schwester. Er war zwölf und Laura dreizehn. Das heißt: fast dreizehn, denn bis zu ihrem Geburtstag waren es noch zwei Tage. Lukas war genauso blond wie Laura, hatte die gleichen blauen Augen wie sie, und auch sein Grübchen am Kinn sah genauso aus wie das seiner Schwester. Im Gegensatz zu Laura trug Lukas eine große Brille auf der Nase, die ihm ein leicht professorenhaftes Aussehen verlieh.
Laura starrte ihren Bruder verständnislos an. »Ich hab geschrien?«
»Exaktenau!«, erwiderte Lukas. »Exaktenau« war eines von Lukas’ heißgeliebten Spezialwörtern. »Du hast geschrien, dass ich es bis in mein Zimmer gehört habe. Warum?«
Im ersten Moment konnte Laura sich an nichts erinnern. Sie schaute sich in ihrem Zimmer um, als könne sie da die Antwort finden. Es unterschied sich kaum von einem Zimmer anderer Mädchen ihres Alters. An den Wänden hingen Pferdebilder und Poster ihrer Lieblingsbands. Neben ihrem Schrank stand ein großes Regal mit ihren Büchern: Harry Potter, Die unendliche Geschichte, Der Goldene Kompass und andere dicke Schmöker. An der dem Bett gegenüberliegenden Wand stand ihr Schreibtisch, und darüber hing ein Filmplakat, von dem Frodo Beutlin sie mit großen braunen Augen anschaute.
Auf dem Schreibtisch herrschte eine wüste Unordnung: Bücher, Hefte und Zeitschriften waren kreuz und quer darauf verstreut. Dazwischen lagen CDs und Disketten, und ein buntes Sammelsurium von Kugelschreibern, Malstiften, Bleistiftspitzern und Radiergummis vervollständigte das Durcheinander. Einige der gerahmten Fotos, die für gewöhnlich darauf aufgereiht waren, waren umgefallen und nicht wieder aufgerichtet worden. Als Lauras Blick auf eines der Fotos fiel, das sie in ihrem weißen Fechtanzug und mit Florett in der Hand zeigte, erinnerte sie sich plötzlich wieder.
»Ich hab geträumt«, sagte sie nachdenklich. »Von Rittern.«
»Von Rittern? Was für Ritter denn?« Eine kleine Falte grub sich bis zur Nasenwurzel in die Stirn ihres Bruders – das sichere Zeichen, dass er Zweifel hegte.
»Es waren weiße und schwarze Ritter«, erinnerte sich Laura. »Und sie haben ganz wild miteinander gefochten, mit mächtigen Schwertern, Streitäxten und Morgensternen – mit richtig gefährlichen Waffen!«
»Echt?«, fragte Lukas, und die Falte kerbte sich noch tiefer in seine Stirn.
»Ja.« Laura nickte eifrig, und die Erinnerung an ihren Traum wurde immer lebendiger. »Da war auch eine riesengroße Burg, und das Land drum herum sah ein bisschen so aus wie Mittel-Erde in dem Film.« Sie deutete auf das Plakat über ihrem Schreibtisch.
»Kein Wunder«, sagte Lukas mit leicht oberlehrerhaftem Ton. »Den Herrn der Ringe hast du ja auch schon zwölfmal gesehen!«
»Dreizehnmal!«, korrigierte Laura. »Aber dann ist was Eigenartiges passiert: Als die Ritter gerade am heftigsten kämpften, war ich plötzlich mitten unter ihnen, und ein alter Mann mit weißen Haaren und einem langen weißen Bart –«
»Gandalf – oder Albus Dumbledore?«, unterbrach Lukas und grinste.
Laura schüttelte den Kopf. »Nein, weder Gandalf noch Dumbledore. Obwohl – ein bisschen ähnlich sah er ihnen schon. Also, dieser alte Mann kam auf mich zu und lächelte mich erst ganz freundlich an. Doch dann machte er ein ernstes Gesicht und sagte, ich müsse den Kelch suchen!«
»Den Kelch? Welchen Kelch denn?«
»Keine Ahnung!« Laura zuckte mit den Schultern. »Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass plötzlich ein schwarzer Ritter auf den Alten zu sprang. Seine Augen waren rot vor Wut, und er hob ein Schwert, um den alten Mann zu töten. Aber was dann geschah –« Sie brach ab, überlegte einen Moment und drehte eine Haarsträhne um den Finger. »Keine Ahnung, es fällt mir nicht mehr ein. Aber trotzdem: Irgendwie habe ich das Gefühl, es war furchtbar wichtig, dass ich diesen Kelch finde – sogar lebenswichtig. Wenn ich nur wüsste, warum?!«
Lukas musterte seine Schwester mit nachdenklichem Blick. Diese Frage schien sie ernsthaft zu quälen. Deshalb machte er eine beschwichtigende Geste. »Ist doch auch egal, Laura«, sagte er. »War doch nur ein Traum!«
Aber Laura schüttelte heftig den Kopf und schaute ihren Bruder aus großen Augen an. »Ich weiß, es klingt verrückt – aber es kam mir alles so schrecklich echt vor. Und das macht mir …« Sie hob abrupt den Kopf und warf ihrem Bruder einen Hilfe suchenden Blick zu. »… das macht mir irgendwie Angst, Lukas!«, flüsterte sie. »Große Angst.«
Der nächste Tag war ein Sonntag – der zweite Advent. Ein blassblauer Winterhimmel, an dem eine kraftlose Sonne hing, spannte sich über Hohenstadt. Das Städtchen besaß einen nahezu intakten mittelalterlichen Kern. Die verwinkelten Straßen und verträumten Gassen mit liebevoll restaurierten historischen Gebäuden zogen vor allem im Sommer viele Touristen an und waren vom frühen Morgen bis zum späten Abend belebt. Im Winter war es nur geringfügig ruhiger, denn auch der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um den stattlichen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz lockte eine Menge Besucher an. Besonders natürlich an den Wochenenden.
Doch Hohenstadt hatte weit mehr zu bieten als eine malerische Altstadt. Es gab auch einige moderne Viertel mit Boutiquen, Kaufhäusern, Restaurants und Verwaltungsgebäuden. In einem erst kürzlich eröffneten Einkaufszentrum hatten zwei Discos, eine Bowlingbahn und ein modernes Multiplex-Kino Platz gefunden. Den Saum des Städtchens aber bildeten Wohnsiedlungen, die sich mehr und mehr in das umliegende Hügelland fraßen, das jetzt in winterkalter Starre dalag.
Das Haus der Familie Leander stand am Rande von Hohenstadt in einem kleinen Garten. Der Rauch der auf vollen Touren laufenden Ölheizung kringelte sich aus dem Schornstein des hübschen Walmdachbungalows in den Himmel. Eine Krähe segelte langsam auf einen hohen Baum im Garten zu. Auf einem dicken Ast in seinem Wipfel landete sie und lugte hinüber zu einem Dachfenster des Hauses.
Die Krähe war unnatürlich groß. Geradezu unheimlich.
In der Nacht hatte es Frost gegeben, die kahlen Äste der Bäume und Sträucher waren mit Raureif überzogen, und die umliegenden Wiesen und Felder wirkten wie mit Puderzucker bestäubt.
Als Laura nach dem Anziehen aus dem Fenster hinunter in den Garten blickte, glaubte sie einen Augenblick, es habe endlich geschneit. Aber schon im nächsten Moment wurde sie sich ihres Irrtums bewusst, und sie war enttäuscht. Sie hatte so sehr gehofft, dass es auch diesmal zu ihrem Geburtstag Schnee geben würde – genauso wie im letzten Jahr. Damals hatte es am vierten Dezember angefangen zu schneien, und am fünften Dezember, an Lauras Geburtstag, war das ganze Land in eine dicke schneeweiße Decke gehüllt gewesen. Laura und Lukas hatten den ganzen Tag mit ihren Freunden im Freien herumgetobt, waren Schlitten und Snowboard gefahren, und sie hatten eine fröhliche Schneeballschlacht veranstaltet. Am späten Nachmittag aber hatte es den Höhepunkt gegeben: Ihr Vater Marius hatte einen alten Pferdeschlitten organisiert, Lauras Pferd Sturmwind angespannt, und dann hatte die ganze Meute eine Schlittenfahrt durch Wiesen und Wälder unternommen. Laura hörte noch immer das leise Bimmeln der Glöckchen, die Marius an Sturmwinds Geschirr angebracht hatte. Während der gedämpfte Hufschlag an ihr Ohr drang und der Schnee unter den Schlittenkufen knirschte, war Laura sich vorgekommen wie in einem Wintermärchen. Fehlte nur noch, dass der Eisriese um die nächste Ecke bog oder die Schneeprinzessin sie in ihren eisigen Palast einlud. Aber obwohl natürlich nichts dergleichen geschehen war, würde Laura diesen Tag nie wieder vergessen – in ihrem ganzen Leben nicht. Denn gut zwei Wochen später, drei Tage vor Weihnachten, war ihr Vater plötzlich verschwunden.
Am Vormittag hatte Marius Leander noch wie gewohnt seine Unterrichtsstunden abgehalten – er war Geschichts- und Literaturlehrer an der Internatsschule Ravenstein, die auch Laura und Lukas besuchten. Beim gemeinsamen Mittagessen der Lehrer und Schüler hatte er noch am Tisch gesessen, und am Nachmittag hatte er seine Aufsicht absolviert und Nachhilfeunterricht gegeben. Anschließend hatte er sich auf sein Zimmer zurückgezogen, weil er seine Forschungsarbeit weitertreiben wollte. Marius beschäftigte sich seit einiger Zeit intensiv mit der Geschichte der Burg Ravenstein.
Einige Zeit nach dem Abendessen hatte dann ein Kollege beobachtet, wie Marius Leander das Internatsgebäude verließ. Von da an verlor sich jede Spur von ihm im Nichts. Obwohl seine Familie natürlich die Polizei eingeschaltet und auch eigene Nachforschungen betrieben hatte, gab es bis zum heutigen Tage nicht den geringsten Hinweis darauf, was sich damals zugetragen hatte. Niemand wusste, wo Marius geblieben sein könnte. Er war wie vom Erdboden verschluckt, und alle – die Polizei, seine Kollegen, seine Freunde und natürlich erst recht seine Familie – standen vor einem Rätsel.
Wie es ihm wohl geht?, überlegte Laura. Und wo er nur sein mag? Sie war ganz sicher, dass ihr Vater nicht freiwillig verschwunden war, sondern dass ihn irgendjemand oder irgendetwas dazu gezwungen haben musste. Aus welchem Grund auch immer. Marius musste noch am Leben sein. Er musste einfach! Nicht auszudenken, wenn –
»Laura, Frühstück!« Die schrille Stimme ihrer Stiefmutter riss Laura aus den Gedanken. »Wo bleibst du denn, Laura?«
Unwillkürlich schnitt das Mädchen eine Grimasse. »Ich komm ja schon!«, blökte es und drehte sich um, um aus dem Zimmer zu gehen.
In diesem Augenblick bemerkte es die Krähe. Laura blieb stehen und blickte hinüber zu dem Vogel auf dem Baum vor ihrem Fenster. Zum Schutz gegen die Kälte hatte er sein pechschwarzes Gefieder aufgeplustert und wirkte dadurch noch größer, als er ohnehin schon war. Eine derart riesige Krähe hatte Laura noch nie zuvor gesehen. Wie ein schwarzes Gespenst hockte sie nahezu unbeweglich da und starrte Laura aus dunklen Knopfaugen an. Laura hatte gerade erst gelesen, dass einige Urvölker Krähen als Vorboten eines Unglücks betrachteten. Unwillkürlich begann sie zu frieren. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, und auf ihren Unterarmen bildete sich Gänsehaut.
Als Laura in die Küche trat, stieg ihr der Duft von frischem Kaffee, Kakao und Brötchen in die Nase. Lukas saß bereits am Tisch und hob gerade einen Becher mit dampfendem Kakao an den Mund.
Wortlos setzte sich Laura neben den Bruder und griff nach der Kanne mit dem Kakao, um sich daraus einzugießen.
»Ist das Fräulein heute schlecht gelaunt?«, fragte ihre Stiefmutter mit spitzem Ton, »oder warum höre ich kein ›Guten Morgen‹?«
Während Sayelle Leander-Rüchlin ihre Stieftochter vorwurfsvoll ansah, entging ihr, dass Lukas seiner Schwester einen tröstenden Blick zuwarf.
Mama war ganz anders als Sayelle, dachte Laura, während sie Cornflakes in ihre Frühstücksschüssel rieseln ließ und Milch darüber goss. Die hat mich morgens immer in Ruhe gelassen!
Anna Leander, die leibliche Mutter von Laura und Lukas, war bei einem tragischen Autounglück ertrunken, als Laura gerade mal fünf Jahre alt war. Laura, die auch im Wagen gesessen hatte, war in letzter Minute gerettet worden. Sayelle Rüchlin, mit der Lauras Eltern seit den gemeinsamen Studientagen befreundet waren, hatte sich in der Folgezeit ganz rührend um Laura und Lukas gekümmert und versucht, ihnen, so gut es eben ging, über den Verlust der Mutter hinwegzuhelfen. Marius war der jungen Frau natürlich unendlich dankbar für ihre liebevolle Fürsorge, und so waren sich die beiden fast zwangsläufig näher gekommen und hatten nach einiger Zeit schließlich geheiratet.
Marius war glücklich mit der Journalistin, deren Karriere seit der Hochzeit steil angestiegen war. Obwohl sie deshalb nur wenig Zeit für die Familie hatte, fühlten sich Laura und Lukas zunächst rundum wohl mit ihr. Doch mit Marius’ rätselhaftem Verschwinden hatte Sayelle sich stark verändert. Nicht dass sie sich nicht mehr um die Kinder kümmerte – im Gegenteil: Sayelle beaufsichtigte sie seither noch strenger. Sie kontrollierte alles und schnüffelte fast ständig hinter ihnen her. Besonders hinter Laura. Aber gleichzeitig verhielt sie sich abweisend ihnen gegenüber. Anfangs hatten Lukas und Laura vermutet, ihre Stiefmutter habe nun auch Angst um sie. Und da Sayelle mit dem Verlust des geliebten Mannes fertig werden musste, nahmen die beiden einiges hin. Aber mit der Zeit war ihre Stiefmutter so schlimm geworden, dass Laura am liebsten nur noch mit ihr gestritten hätte. Doch an diesem Morgen hatte sie keine Lust auf Stunk, und so muffelte sie einfach nur: »Sorry! Morgen.«
»Na, also, geht doch!«, sagte Sayelle mit einem kaum merklichen Lächeln.
Sie nahm die Kaffeekanne von der Maschine, setzte sich ebenfalls an den Tisch und goss sich eine Tasse ein. Obwohl sie freihatte und nicht in die Redaktion musste, war ihr brünettes Haar tadellos frisiert. Auch ihr Make-up war perfekt, wenn auch eine Spur zu dick aufgetragen. Im Gegensatz zu Laura und Lukas, die in ausgewaschene Jeans und bequeme Sweatshirts geschlüpft waren, trug Sayelle einen hochmodischen Hosenanzug in Altrosa. Er saß perfekt und betonte ihre schmale Taille. Während sie eine Knäckebrotscheibe hauchdünn mit Diätmargarine bestrich und einen winzigen Klecks Hüttenkäse darauf verteilte, schaute sie die Kinder an.
»Ich hab mir gedacht, wir gehen heute Nachmittag gemeinsam in die Passions-Kirche«, erklärte sie mit einem erwartungsfrohen Lächeln. »Da gibt es ein Adventskonzert mit Weihnachtskantaten. Der Chor soll ganz toll sein, hat Max gesagt.«
Max?, überlegte Laura. Wer um alles in der Welt ist noch mal Max?
Dann fiel es ihr ein: Maximilian Longolius war der Besitzer eines gigantischen Medienunternehmens, zu dem unter anderem ein Fernsehsender und mehrere Zeitungen gehörten. Auch DIE ZEITUNG, bei der Sayelle Leander-Rüchlin als Leiterin der Wirtschaftsredaktion beschäftigt war, gehörte ihm. Laura hatte Maximilian Longolius erst einmal erlebt, bei einem Essen in einem pickfeinen Restaurant, in das er Sayelle und sie und Lukas eingeladen hatte: ein schon etwas älterer, geleckter Typ mit zurückgegelten, schwarzen Haaren – Laura hatte auf den ersten Blick bemerkt, dass sie gefärbt waren – in edlem Anzug und mit Designerbrille. Sein Händedruck war genauso lasch wie ein Kaninchenpups, erinnerte sich Laura schaudernd. Aber am Schlimmsten war gewesen, dass er Sayelle ununterbrochen angeschleimt hatte. Seine Schweinsäuglein hatten förmlich an ihr geklebt, und er hatte immerzu gelächelt.
Einfach eklig! Wenn dieser Typ etwas toll fand, dann konnte es doch nur ätzend sein!
»Ach nö, keine Zeit«, sagte Lukas da auch schon. »Ich hab ‘ne Verabredung mit meinem Computer.«
»Und was ist mit dir, Laura?«
»Ich wollte eigentlich reiten gehen«, sagte Laura gedehnt. »Sturmwind braucht dringend Bewegung, und vor den Weihnachtsferien komm ich sonst bestimmt nicht mehr dazu.«
»Wie ihr meint«, antwortete Sayelle knapp.
Sie war eingeschnappt, das merkte Laura an ihrer Stimme, die dann immer etwas dünner klang. Mit Sicherheit würde sie jetzt wieder schlechte Laune bekommen, denn das war immer so, wenn etwas nicht nach ihrem Willen lief. Und dann wurde sie jedes Mal so zickig, dass man ihr besser aus dem Weg ging.
Grässlich!
Allerdings – manchmal konnte Laura Sayelle sogar verstehen: Ihre Stiefmutter nahm sich immer so viel vor für die Wochenenden, denn das war die einzige Zeit, die sie gemeinsam verbringen konnten. An den anderen Tagen wohnten Laura und Lukas nämlich im Internat. Nur an den Wochenenden und in den Ferien lebten sie im Haus der Familie in Hohenstadt. Und irgendwie schien Sayelle sich dazu verpflichtet zu fühlen, diese knappe Zeit fast vollständig mit ihnen zu verbringen, sodass sie jedes Mal ein Monsterprogramm mit ihnen durchziehen wollte. Aber vielleicht war das auch nicht mehr als eine lästige Pflichtübung, denn sonst hätte sie doch längst kapiert, dass sie keine Lust auf Museen und Konzerte hatten.
Sayelle schien in einer völlig anderen Welt zu leben als Lukas und sie und einfach keine Ahnung davon zu haben, was Jugendliche in ihrem Alter so machten. In letzter Zeit kam es Laura zunehmend so vor, als wolle sie auch gar nicht mehr wissen, was Lukas und sie beschäftigte. Sayelle schien nur noch ein Interesse zu haben – dass Lukas und sie sich widerspruchslos den Vorstellungen und Wünschen ihrer Stiefmutter fügten. Ganz egal, ob die ihnen gefielen oder nicht.
Kein Wunder, dass sie dieses Jahr nicht an Adventskalender für uns gedacht hat, ging es Laura durch den Sinn. Und meinen Geburtstag wird sie bestimmt auch vergessen!
Schon häufig hatte sie sich den Kopf darüber zerbrochen, warum ihre Stiefmutter sich so sehr verändert hatte und immer noch seltsamer wurde. Aber sosehr sie auch grübelte, sie fand keine einleuchtende Erklärung. Aber vielleicht täuschte sie sich ja auch und tat Sayelle Unrecht? In einem aber war Laura sich vollkommen sicher: Als ihr Vater noch bei ihnen gewesen war, war alles anders gewesen.
Ganz anders!
Wenn ich nur endlich wüsste, was an diesem verflixten einundzwanzigsten Dezember des letzten Jahres passiert ist, grübelte Laura. Es kann doch nicht sein, dass jemand einfach so verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. So etwas gibt es doch einfach nicht!
Plötzlich bemerkte Laura, dass Sayelle sie aus schmalen Augen anstarrte und dabei lautlos den Mund auf und zu machte wie ein Fisch im Aquarium. Aber da drangen Sayelles Worte auch schon an Lauras Ohr.
»Träumst du, oder hast du es einfach nicht nötig, mir zu antworten?«, fragte sie. Ihr Ton war gereizt.
Na, bitte!
»Sorry«, antwortete Laura schnell. »Ich war in Gedanken.«
»Ich hab gefragt, ob du es nicht vernünftiger fändest, dich hinzusetzen und für die Schule zu lernen, anstatt dich mit deinem Pferd zu vergnügen!«, sagte Sayelle streng.
Laura erwiderte nichts.
Sayelle ließ nicht locker. »Jedenfalls würde ich das so machen, wenn ich in Mathe und Physik auf einer glatten Fünf stände!«
»Ich hab doch gestern den ganzen Tag gelernt«, murmelte Laura leise.
»Das ist auch dringend nötig!«, erwiderte Sayelle vorwurfsvoll. »Oder willst du wieder durchrasseln wie im letzten Jahr? Du weißt doch, was das bedeutet – du musst Ravenstein verlassen, weil man eine Klasse nicht zweimal wiederholen kann. Das würde dir doch auch nicht gefallen, oder?«
Laura wollte zu einer heftigen Antwort ansetzen, doch dann schwieg sie lieber. Natürlich hatte sie grässliche Angst davor, wieder sitzen zu bleiben und vom Internat zu fliegen. Diese Angst war manchmal so schlimm, dass ihr richtig schlecht wurde. Aber das ging Sayelle doch nichts an! Die würde sie doch nicht verstehen – und helfen konnte sie ihr schon gar nicht. Ganz bestimmt nicht! Deshalb erwiderte Laura nur trotzig den vorwurfsvollen Blick ihrer Stiefmutter.
»Mensch, Laura, werd doch endlich vernünftig«, sagte die in einem fast flehenden Ton. »Ich will doch nur dein Bestes, verstehst du das nicht? Ich weiß doch, wie gerne du im Internat bist! Und noch ist ja nichts verloren. Du hast bis zum Ende des Schuljahres noch genügend Zeit, um die schlechten Zensuren auszubügeln! Allerdings …« Sayelle seufzte, bevor sie mit leichtem Kopfschütteln fortfuhr: »… wenn du nicht endlich vernünftig wirst und dich auf den Hintern setzt und lernst, dann sehe ich schwarz. Ziemlich schwarz sogar!«
Laura schluckte. Ihre Augen waren noch schmaler geworden, aus den Schlitzen funkelte der pure Trotz. »Ich werde nicht sitzen bleiben«, flüsterte sie. »Das garantiere ich dir!«
Der eiskalte Wind schlug Laura ins Gesicht und pikte ihre frostroten Wangen wie winzige Stecknadeln. Obwohl sie in ihren dicken roten Stepp-Anorak gehüllt war, warme Wollhandschuhe trug und sich ihre Dock-Mütze tief über die Ohren gezogen hatte, setzte die Kälte ihr ganz schön zu. Aber gab es etwas Schöneres als Reiten?
Auf einer kleinen Anhöhe zügelte Laura ihr Pferd und schaute sich um. Die hügelige Landschaft erstreckte sich bis zum Horizont. Der morgendliche Raureif war längst verschwunden, und Felder und Wiesen waren leer und grau. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Nur das Heulen des Windes und das Schnauben ihres Pferdes drangen an Lauras Ohr.
Sturmwind war ein prächtiger weißer Hengst. Seine Mähne und der Schweif allerdings waren schwarz. Fast unbeweglich stand er da. Das Mädchen auf seinem Rücken schien er kaum zu spüren. Aus seinen Nüstern stiegen kleine Wolken auf, und sein Leib dampfte. Das Fell war schweißnass.
Kein Wunder – nachdem Laura den Hof von Bauer Dietrich verlassen und das freie Feld erreicht hatte, hatte sie die Zügel gelockert, und Sturmwind hatte die ungewohnte Freiheit genutzt. Gerade so, als wolle er die Enge des Stalles mit aller Gewalt von sich abschütteln, war er im Galopp davongeprescht – ein stürmischer, wilder Ritt, wie Laura ihn kaum jemals zuvor erlebt hatte. Während die Pferdehufe wie rasend trommelten, war die Welt förmlich vorbeigeflogen, bis Laura sie gar nicht mehr richtig wahrzunehmen schien. Das Einzige, was noch von Wichtigkeit gewesen war, waren sie und ihr Pferd. Die unbändige Kraft von Sturmwind schien sich auf Laura zu übertragen, und im gleichen Augenblick fiel alle Angst von ihr ab. Die Angst, vom Pferd zu stürzen und sich zu verletzen, die Angst, in der Schule zu versagen – sie waren wie weggepustet. Laura fühlte sich plötzlich leicht und unbeschwert, und es kam ihr vor, als schwebe sie.
Sie hätte endlos so weiterreiten können, aber auch wenn Sturmwind keinerlei Anzeichen von Schwäche oder gar Erschöpfung gezeigt hatte, war es besser, es nicht zu übertreiben. Und nun merkte sie, dass sie selbst laut keuchte und ihr Herz heftig pochte.
Während sich ihr Atem wieder beruhigte, spürte Laura einen leichten Metallgeschmack auf den Lippen, und der Geruch des schweißnassen Pferdefells und des feuchten Sattelleders stiegen ihr in die Nase. Bevor sie Sturmwind mit leichtem Zungenschnalzen aufforderte, sie zum Stall zurückzubringen, warf sie noch einen letzten Blick zu dem Hügel, hinter dem das Internat Ravenstein liegen musste. Da bemerkte sie eine Gestalt, die vorher noch nicht da gewesen war: einen Reiter.
Einen Reiter auf einem pechschwarzen Pferd.
Er war noch so weit entfernt, dass sie nur die düstere Silhouette erkennen konnte, die sich wie eine Drohung vor dem blassen Himmel abzeichnete. Aber trotz der großen Entfernung ging etwas Unheimliches von ihm aus, und Laura fühlte, dass es wohl besser war, ihm nicht zu begegnen. Eiseskälte fuhr ihr ins Gesicht und kroch unter den Anorak, sodass sie fröstelte. Im gleichen Moment legte sich eine dicke Wolke vor die fahle Sonne, und es wurde dunkler. Viel dunkler – als hätte jemand plötzlich das Licht gedämmt. Dann, wie aus dem Nichts, hörte Laura ein unheimliches Geräusch über sich.
Sie blickte auf und sah die Krähen. Es mussten Hunderte sein, vielleicht sogar Tausende! Eine riesige Wolke aus schwarzen Vogelleibern zog über den Himmel und näherte sich rasch. Mit heiserem Krächzen wirbelte der Schwarm auf Laura zu. Plötzlich fiel ihr auf, dass die Laute ziemlich fremd klangen. Die Vögel hörten sich gar nicht so an wie richtige Krähen, sondern krächzten schrill und verzerrt und fast unwirklich – geradeso, als kämen sie aus einer anderen Welt.
Sturmwind schnaubte aufgeregt und begann unruhig auf der Stelle zu treten.
Die Krähen rauschten heran, immer näher, bis sie genau über Laura kreisten. Der ganze Himmel schien von einem unheimlichen Wirbel bedeckt zu sein. Plötzlich stieß ein schwarzer Todesvogel aus der Wolke hervor und schoss mit schrillem Kreischen direkt auf Laura zu. Sie konnte sich gerade noch ducken, sodass der spitze gelbe Schnabel ihr Gesicht knapp verfehlte und ins Leere fuhr.
Sturmwind ließ ein ängstliches Wiehern hören und stieg mit den Vorderbeinen jäh in die Höhe.
»Ho! Ho!« Laura gab sich Mühe, ihre Panik zu verbergen und das Tier zu beruhigen.
Aber der Schimmel stieg erneut wiehernd hoch, und Laura hatte Mühe, sich im Sattel zu halten. Außerdem wurde sie schon wieder von einer Krähe angegriffen. Der Vogel strich so dicht an ihrem Kopf vorbei, dass sie den harten Schlag eines Flügels spürte und sein gellender Schrei in ihren Ohren schmerzte.
Da machte Sturmwind einen Satz nach vorne und galoppierte davon. Laura wäre beinahe aus dem Sattel geschleudert worden. Nur mit allergrößter Anstrengung konnte sie das Gleichgewicht wiederfinden und sich auf dem Rücken des Hengstes halten. Sosehr sie auch an den Zügeln zerrte, Sturmwind war einfach nicht zu stoppen. Im Gegenteil – er lief immer schneller.
Die Krähen folgten ihnen. Wie ein schwarzer Schleier wogten sie am Himmel dahin und flogen unablässig Attacken auf das Mädchen. Zum Glück verfehlten sie Laura jedes Mal um Haaresbreite, sodass sie mit der Zeit den Eindruck gewann, dass die Vögel sie gar nicht treffen wollten.
Vielleicht wollten sie ihr einfach nur Angst einjagen?
Das jedenfalls gelang ihnen. Ein kaltes Grauen packte Laura und trieb ihr Schauer über den Rücken. Sie schaute sich nicht mehr nach den Vögeln um, sondern hielt den Blick starr nach vorne gerichtet. Nur ein einziger Gedanke hatte noch Platz in ihrem Hirn: Zum Dietrichs-Hof! Ich muss zurück zum Hof! Immer wieder hallte er durch ihren Kopf, bis trommelnder Hufschlag ihn jäh unterbrach.
Laura trieb Sturmwind mit einem leichten Druck ihrer Schenkel an. Sie wagte nicht, sich umzudrehen, denn sie wusste auch so, dass es der dunkle Reiter war, der da heranpreschte. Aber warum verfolgte er sie? Was wollte er von ihr? Plötzliches Hundegebell stellte ihr die Nackenhaare auf. Es musste eine ganze Meute sein, die sich im Schlepp des unheimlichen Reiters befand. Ihr heiseres Hecheln und wütendes Kläffen schwoll an.
Waren sie auf der Jagd? Auf der Jagd nach – ihr? Was sollte sie tun, wenn die Hunde sich in Sturmwinds Läufen verbissen?
Die Angst um ihr Pferd ließ Laura nun doch einen Blick über die Schulter werfen – aber da war nichts! Weder ein Pferd noch ein Reiter und schon gar keine Hunde! Selbst die Krähen waren verschwunden. Im selben Augenblick verstummten die unheimlichen Geräusche, und es war wieder still.
Totenstill.
Laura war ebenso erstaunt wie ratlos. Sollte sie sich das alles am Ende nur eingebildet haben?
2. Kapitel: Im Zeichen der Dreizehn
Dunkelheit hatte sich über Aventerra gesenkt. Ein eisiger Wind heulte über die Hochebene von Calderan, peitschte die mächtigen Bäume in den alten Auenwäldern, sodass sie ächzten und stöhnten. Er ließ das silbrige Wispergras auf der weiten Ebene zittern und trieb dickbauchige Wolken wie flüchtende Streitrosse über den roten Himmel. Den beiden Monden von Aventerra, dem schwefelgelben Goldmond und dem leuchtend blauen Menschenstern, gelang es deshalb kaum, mit ihrem matten Licht den ältesten der alten Planeten zu erhellen.
Im Norden, wo die Ebene steil abfiel und das Dunkel des Landes mit dem Nachtrot des Himmels verschmolz, erhob sich eine mächtige Burg: Es war Hellunyat, die uralte Gralsburg. Ihre zinnenbewehrten, dicken Mauern, die trutzigen Türme und der gewaltige Bergfried zeichneten sich als riesiger schwarzer Schattenriss vor dem Horizont ab.
Wie Aventerra, so existierte auch Hellunyat schon seit Anbeginn der Welten. Niemand konnte sich daran erinnern, wann die Festung erbaut worden war, und jeder war sich sicher, dass sie auch das Ende der Zeiten überdauern würde. Schließlich war Hellunyat die Heimstatt des Hüters des Lichts und seiner Gefolgschaft. Nun aber hatte sich die Stille der Nacht über Hellunyat und seine Bewohner gesenkt. Alles schlief, nur die Wachleute, die auf den vier Türmen Posten bezogen hatten, kämpften gegen den Schlummer an.
Tarkan, ein junger Ritter, und der alte Marun taten Dienst auf dem Ostturm. Der hoch aufgeschossene Tarkan hatte seine Ausbildung im letzten Mond beendet und war vom Hüter des Lichts in den Kreis seiner Ritter aufgenommen worden. Es war erst seine zweite Nachtwache, und so wanderte der junge Mann unruhig auf und ab. Angestrengt spähte er durch die Schießscharten der Turmkrone hinaus auf die Ebene. Doch wohin er auch blickte, ob nach Osten, wo in weiter Ferne das tückische Modermoor hinter einem schmalen Streifen Auwald gelegen war, oder nach Süden, wo die mächtigen Drachenberge die Ebene begrenzten, oder nach Norden, wo das flache Land über schroffe Felsen steil abfiel in die finstere Dusterklamm – alles war friedlich und still. Nur der Wind heulte. Nach Westen hin aber, zum dichten Raunewald, verwehrten die Mauern der Burg dem Wächter den Blick.
Die Kälte ging Tarkan unter die Haut. Während er seinen Filzumhang über dem ledernen Brustpanzer dichter zusammenzog, schreckte ihn ein ungewohntes Geräusch auf. Tarkan lauschte. Und tatsächlich – da war es wieder, dieses schaurige Pfeifen. Schon hatte er die Hand an den Griff des Schwertes gelegt, als ihm klar wurde, was es mit diesem unheimlichen Laut auf sich hatte: Es war nur ein harmloser Nachtpfeifer, der seinen klagenden Ruf in der Ferne erschallen ließ. Verärgert über sich selbst, schüttelte Tarkan leicht den Kopf.
Marun lächelte nur still vor sich hin. Für den untersetzten Mann war der Wachdienst im Laufe der Jahre längst zur Routine geworden. Der alte Ritter konnte sich gar nicht mehr erinnern, wie viele dieser langweiligen, sich endlos dehnenden Stunden er schon hinter sich gebracht hatte. Immerhin hatte er eines dabei gelernt: Die ewige Warterei und das anhaltende Starren in die Dämmerung oder die Dunkelheit konnten einem so manchen Streich spielen. Selbst die harmlosesten Geräusche und Schattenspiele konnten einem in der Anspannung gefährlich erscheinen. Doch Marun wusste, dass Ruhe und Gelassenheit gegen solche Täuschungen und Trugbilder am besten halfen. Er hatte sich auf den Boden gesetzt, den Rücken an die Mauer gelehnt, die Hände über dem kugelförmigen Bauch gefaltet, und döste schläfrig vor sich hin. Nun aber hob er den Kopf und blinzelte Tarkan verärgert an.
»Meine Güte, Tarkan«, raunzte er, »du machst mich noch verrückt mit deinem ewigen Gerenne. Gib endlich Ruhe, und setz dich zu mir!«
»Wir haben Wache«, entgegnete Tarkan mit leichtem Trotz. »Wir müssen aufpassen, dass sich die Schwarzen Heere nicht unentdeckt der Burg nähern.«
»Was du nicht sagst! Du hast noch in den Windeln gelegen, als ich meine erste Wache geschoben habe, und ausgerechnet du willst mir erklären, was wir zu tun haben?«
»Nichts für ungut, Marun«, antwortete der junge Mann. »Aber du hast doch selbst gehört, was Ritter Paravain gesagt hat – seit die Mächte der Dunkelheit den Kelch der Erleuchtung in ihren Besitz gebracht und auf dem Menschenstern versteckt haben, müssen wir jederzeit mit ihrem Angriff rechnen!«
»Irrtum, mein Freund!« Ein leichter Ärger schwang in Maruns Stimme mit. »Wir müssen seit Anbeginn der Zeiten mit ihrem Angriff rechnen! Und selbst wenn du und ich längst nicht mehr sein werden und auch unsere Kinder und Kindeskinder schon lange nicht mehr leben, wird sich daran nichts ändern! Aber warum, meinst du, bist du ausgerechnet zum Dienst auf dem Ostturm eingeteilt worden?«
Tarkan schaute den Alten verständnislos an.
»Dann will ich es dir verraten, junger Tarkan«, fuhr Marun fort. »Wie alle neuen Ritter hat Paravain auch dich zum Dienst auf dem Ostturm eingeteilt, weil der Schwarze Fürst seine Truppen noch niemals von Osten herangeführt hat! Hörst du: Die Schwarzen Heere haben Hellunyat noch nie aus östlicher Richtung angegriffen!«
Tarkan schien wie vor den Kopf geschlagen.
»Und weißt du auch, warum?«, fragte Marun. »Weil sie in dieser Richtung keinerlei Deckung finden und wir sie deshalb schon von Weitem sehen könnten, deshalb!«
»Willst du damit sagen, dass der Dienst hier eigentlich ein Kinderspiel ist? Dass ihn selbst ein Knabe wie Alarik, Paravains Knappe, versehen könnte?«
»Nein.« Marun schüttelte den Kopf. »Der Dienst auf diesem Turm soll dich und die anderen jungen Ritter ganz allmählich mit dem Wachdienst vertraut machen. Ich will damit nur sagen, dass du es nicht übertreiben sollst. Du brauchst nicht ohne Unterlass wie ein Nachtfalke in die Dunkelheit zu starren. Setz dich lieber, und gönn deinen armen Augen ein wenig Ruhe!«
Tarkan zögerte. Er wusste nicht genau, was er tun sollte. Der Hüter des Lichts hatte seinen Rittern sein Leben anvertraut – und Paravain, der erste der dreizehn Weißen Ritter und damit der Anführer der Leibgarde, hatte die jungen Männer erst kürzlich bei der Schwertleite beschworen, im Kampf gegen die Kräfte des Dunklen stets wachsam zu sein. Denn die Dunklen lagen seit Anbeginn der Zeiten mit den Mächten des Lichts im Streit und trachteten ohne Unterlass danach, das Gute zu besiegen und dem Ewigen Nichts zur Herrschaft zu verhelfen.
Tarkan schüttelte nachdenklich den Kopf – nicht auszudenken, wenn es dem Feind ausgerechnet während seines Wachdienstes gelingen sollte, in Hellunyat einzudringen! Andererseits klang das, was Marun gesagt hatte, durchaus einleuchtend, und der stand schon länger im Dienste ihres Herrn als er. Viel länger!
Tarkan spähte hinaus auf die Ebene, doch dort war nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Keine noch so geringe Bewegung. Kein verdächtiger Schatten. Nichts. Er drehte sich um zu seinem Kameraden, und der winkte ihm auffordernd zu. Einen Moment noch zauderte Tarkan, doch dann setzte er sich neben Marun an die Mauer.
»Endlich wirst du vernünftig«, murmelte der Alte, schloss die Augen und schnarchte schon wenig später vor sich hin.
Tarkan aber konnte nicht schlafen. Ihm war nicht wohl in seiner Haut.
*
Kastor Dietrich, ein fast sechzigjähriger Mann von kräftiger Statur, lehnte träge an der Absperrung der Pferdebox. Sinnierend zog er an seiner Pfeife und beobachtete Laura, die ihren schweißnassen Schimmel mit einem Tuch trocken rieb. Das Mädchen stand offensichtlich noch ganz unter dem Eindruck des unheimlichen Erlebnisses, von dem es ihm berichtet hatte. Es war blass im Gesicht und zitterte, obwohl es im Pferdestall angenehm warm war.
Der Bauer nahm die Pfeife aus dem Mund, ließ eine Rauchwolke aufsteigen und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich glaube nicht, dass du dir das nur eingebildet hast«, sagte er.
Laura ließ das Tuch sinken und schaute ihn an.
»Aber es gibt doch keine andere Erklärung dafür. Oder?«, fragte sie fast hilflos.
Kastor antwortete nicht. Er hatte die Pfeife wieder in den Mund gesteckt und schien nachzudenken. Der würzige Duft des Pfeifentabaks schmeichelte sich in Lauras Nase und überlagerte die vertrauten Gerüche des Stalles und der Tiere. Aus den Nachbarboxen war das Schnauben der anderen Pferde zu hören, das Scharren ihrer Hufe und selbst das Mahlen ihrer Kiefer, die unentwegt duftendes Heu aus den Raufen rupften.
»Oder?«, wiederholte Laura, und ihre Frage kam einem Flehen gleich.
Bauer Dietrich kniff die dunklen Augen zusammen. »Du hast morgen Geburtstag, stimmt’s?«, fragte er.
Laura war überrascht. »Stimmt. Woher wissen Sie das?«
Der Mann lächelte geheimnisvoll. »Das tut nichts zur Sache, Laura. Du wirst es bald erfahren. Schließlich bist du im Zeichen der Dreizehn geboren.«
»Im Zeichen der Dreizehn? Was hat das nun wieder zu bedeuten?«
Kastor Dietrich schüttelte nur sanft den Kopf. »Nur Geduld«, antwortete er. »Du wirst schon bald verstehen! Glaub mir, Laura!«
Er machte einen Schritt auf Sturmwind zu und streichelte dem Hengst liebevoll über den Hals. »Sturmwind wird mächtigen Durst haben nach diesem Höllenritt. Gib ihm ordentlich Wasser, und spar nicht mit dem Heu. Er hat es sich verdient!« Damit verließ er den Stall.
Als Dietrich hinaus auf den Hof trat, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Die kalte Winterluft stieg ihm in die Nase. Er blähte die Nasenflügel und schnupperte einmal, zweimal wie ein Tier, das Witterung aufnimmt. Dann blickte er zum Himmel, an dem dunkle Wolken aufgezogen waren. Es würde einen Sturm geben in der Nacht. Kastor Dietrich drehte sich um und sah durch die geöffnete Stalltür direkt in die Box von Sturmwind, wo Laura gerade Heu in die Raufe gabelte.
Er machte sich Sorgen um sie – große Sorgen.
*
Der Wind legte sich. Die dicken Wolken am Himmel kamen zur Ruhe und verdeckten die beiden Monde. Das Plateau von Calderan versank in nachtschwarzer Finsternis.
Am Saum des alten Auwaldes, vor dem sich das Wispergras bis zur Gralsburg erstreckte, war nun alles still. Nur das dichte Laub im Geäst der Bäume raschelte leise vor sich hin. Dann erklang wieder der Ruf des Nachtpfeifers, der Tarkan so erschreckt hatte. Lang und klagend ging er durch die Dunkelheit, bis ihm ein zweiter Vogel antwortete. Noch ein dritter war kurz zu hören, aber dann herrschte wieder Stille.
Eine unwirkliche, unheimliche Stille, die nur durch ein heiseres Flüstern gestört wurde.
Dann kam der erste Nebel aus dem Wald.
Dick und schwarz waberte er zwischen den Bäumen hervor und rollte auf die Ebene hinaus. Andere folgten, unzählige, übermannsgroße schwarze Nebelhaufen ragten plötzlich auf wie eine dunkle Armee – eine Armee, die unentwegt wuchs. Die Nebel flüsterten miteinander. Flüsternde Nebel waren auf Aventerra nichts Ungewöhnliches. Es gab sie – wie Singende Winde und Tanzende Schatten – seit Anbeginn der Zeiten. Mit diesen Flüsternden Nebeln hier aber hatte es eine besondere Bewandtnis, denn in ihnen war Leben, auch wenn das mehr zu ahnen als zu erkennen war.
»Alle Mann voran!«, flüsterten die Nebel, und dann wälzten sich die Dunsthaufen über die Wispergrasebene auf Hellunyat zu. Ein halbes Dutzend Pfeillängen von der Gralsburg entfernt vereinten sie sich zu einer mächtigen schwarzen Flut, die fast unhörbar heranwogte, näher und näher rollte.
Nicht mehr lange, und sie würden die dicke Mauer in der Nähe des Ostturms erreicht haben.
*
»Das ist doch alles Quatsch!« Sayelle klang höchst gereizt. »Das ist nichts weiter als das dumme Geschwätz eines senilen alten Mannes«, fuhr sie fort, während sie mit der linken Hand einen dicken Strahl Öl aus einer Flasche in eine stählerne Schüssel goss.
In der anderen Hand hielt sie einen Schneebesen und rührte damit hektisch in der Schüssel herum. »Im Zeichen der Dreizehn, das macht doch keinen Sinn! Schließlich ist morgen der fünfte, und nicht der dreizehnte. Und dein Sternzeichen ist Schütze. Wie kann der Bauer da behaupten, dass du im Zeichen der Dreizehn geboren bist?«
Laura zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung«, sagte sie. Und dann fügte sie leise hinzu: »Papa würde das bestimmt wissen! Zumindest wüsste er, wo man das nachschlagen kann.« Damit drehte sie sich um und ging aus der Küche.
Sayelle schickte ihr einen wütenden Blick hinterher. »Papa würde das bestimmt wissen!«, äffte sie ihre Stieftochter nach.
Plötzlich verschlug es ihr den Atem. Sie starrte mit großen Augen in die Schüssel. Die Ölflasche schien wie festgefroren in der Luft zu schweben, und der Schneebesen klebte am Schüsselrand.
»Mist!«, fluchte sie. »Diese verdammte Mayonnaise ist schon wieder geronnen!«
Sie feuerte den Schneebesen in die Spüle und kippte den Inhalt der Stahlschüssel hinterher. Die aufgetauten Krabben landeten im Müll. Dann legte sie die Schürze ab, hängte sie an einen Haken und verließ die Küche. Im Flur nahm Sayelle das tragbare Telefon von der Station und wählte. Die Nummer des Pizza-Lieferdienstes kannte sie längst auswendig.
*
Tarkan schreckte hoch. War er tatsächlich eingeschlafen, oder hatte er nur gedöst? Er lauschte. Von seiner rechten Seite erklang das leise Schnarchen Maruns, doch ansonsten war nichts zu hören. Absolut nichts, nicht einmal der Wind. Und plötzlich fiel es ihm wieder ein: Die Schwarzen Kräfte vermögen sogar über den Wind zu gebieten, wenn es zu ihrem Nutzen ist, hatte Ritter Paravain ihnen eingeschärft.
Tarkan sprang auf, griff zu seinem Schwert und spähte über die Zinnen des Wachturms. Eine riesige schwarze Nebelbank war vor der Ostseite von Hellunyat aufgezogen. Überrascht kniff der junge Mann die Augen zusammen. Derartiges hatte er noch nie gesehen. Der schwarze Nebel war dicht, nahezu undurchdringlich, und schien auf eine merkwürdige Art zu leben. Langsam kroch der unheimliche Dunst an der Mauer hoch, die ersten Nebelschleier waberten bereits über die Mauerkrone. Plötzlich spürte Tarkan die eisige Kälte, die von ihnen ausging, und da entdeckte er die unheimlichen Gestalten, die sich im Nebel verbargen: Ritter in schwarzen Rüstungen. Im Schutze des Dunstes waren sie kaum zu erkennen. Ihre Konturen verflossen ständig, sodass sie mit den wabernden Nebelschwaden zu verschmelzen schienen. Nur ihre blutroten Augen, in denen ein heißes Höllenfeuer zu glühen schien, glimmten deutlich sichtbar im Gewölk. Tarkan erstarrte bis ins Mark: Es waren Krieger der Schwarzen Mächte!
Der Ritter wollte einen lauten Warnruf ausstoßen, doch der Schrei blieb ihm im Halse stecken. Er brachte nur erstickte Laute hervor, als raube eine unheimliche Macht ihm den Atem. Tarkan würgte und rang verzweifelt nach Luft. Das Schwert glitt aus seinen kraftlosen Händen und fiel krachend zu Boden, als ein unheimlich großer Nebelfetzen über die Turmkrone waberte. Borboron, der Schwarze Fürst höchstpersönlich, erhob sich vor Tarkan! Als der Junge die stechend roten Augen sah, die ihn mitleidslos musterten, war es zu spät. Ein mächtiges Schwert fuhr aus dem Nebel und drang Tarkan tief in die Kehle. Der junge Ritter fiel auf die Knie, ein Schwall Blut und ein Stöhnen drangen aus seinem Mund.
»Verzeiht mir, Herr, ich habe versagt«, gurgelte er kaum hörbar.
Dann stürzte er vornüber auf den Boden und starb. Seine gebrochenen Augen konnten die Horde der Schwarzen Krieger nicht mehr sehen, die sich lautlos aus dem Nebel lösten, die Mauer überwanden und in das Innere der Gralsburg eindrangen.
Marun aber schnarchte nicht mehr. Denn der ewige Schlaf bringt vollkommene Stille.
*
Laura stand im Arbeitszimmer ihres Vaters am Schreibtisch und blätterte hastig durch ein dickes, in Leder gebundenes Lexikon. Der Eintrag unter dem Stichwort »Dreizehn« half ihr nicht viel weiter: »Primzahl; gilt in manchen Kulturen als Unglückszahl«, war da zu lesen. Und unter »Zeichen« wurde sie auch nicht fündig. Enttäuscht klappte sie das Buch zu.
Sie hatte nicht den geringsten Hinweis darauf entdeckt, was es mit diesem geheimnisvollen »Zeichen der Dreizehn« auf sich haben konnte, von dem Bauer Dietrich gesprochen hatte. Als sie den Wälzer ins Regal zurückstellte, fiel ihr plötzlich das Kästchen wieder ein.
Vor vielen Jahren, ihre Mutter Anna war noch am Leben, hatte sie es rein zufällig entdeckt. Sie hatte ihren Vater etwas fragen wollen, ihn aber nicht in seinem Arbeitszimmer angetroffen. Laura wollte gerade wieder gehen, als ihr Blick auf das Holzkästchen auf seinem Schreibtisch gefallen war – und sie hatte einen unwiderstehlichen Drang verspürt, es sich anzusehen. Wie von einer fremden Macht geleitet, war sie auf den Schreibtisch zu gegangen.
Offensichtlich handelte es sich um ein Schmuckkästchen. Auf allen Seiten war es mit fremdartigen Mustern verziert, die Laura noch nie zuvor gesehen hatte. Sie hatte die Hand danach ausgestreckt, als ihr Vater unvermittelt aufgetaucht war und sie barsch aufgefordert hatte, das sein zu lassen. Laura war erschrocken zurückgezuckt, und sogleich hatte Marius ihr in versöhnlicherem Ton erklärt, dass der Inhalt des Kästchen sehr wohl für sie bestimmt sei, sie es aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten sollte. »Am Fest der Dreizehn wirst du erfahren, was es damit auf sich hat«, hatte er ihr lächelnd erklärt und das Kästchen an sich genommen. Schon wenig später hatte Laura den Zwischenfall vergessen und seither nie mehr daran gedacht.
Nachdenklich starrte Laura vor sich hin. Am Fest der Dreizehn, überlegte sie. Vielleicht hat das etwas mit dem Zeichen der Dreizehn zu tun? Und vielleicht kann der Inhalt des Kästchen mir helfen, das Rätsel zu lösen?
Sie zog die große Schreibtischschublade auf und begann darin herumzuwühlen. In der hintersten Ecke, verborgen unter einem Stapel von handschriftlichen Notizen, wurde Laura schließlich fündig. Fast andächtig nahm sie das Kästchen an sich, bevor sie die Schublade wieder schloss.
Das Behältnis maß etwa dreizehn mal neunzehn Zentimeter, hatte eine Höhe von vielleicht drei Zentimetern und sah genauso aus, wie Laura es in Erinnerung hatte. Bei den fremdartigen Mustern handelte es sich um feinste Intarsienarbeiten aus hellem Edelholz. Nachdem Laura das Kästchen von allen Seiten betrachtet hatte, klappte sie den Deckel hoch – und erblickte ein Schmuckstück auf einem Kissen aus blauem Samt. Eine einfache Schlangenkette mit einem goldenen Anhänger.
Sie war überraschend schwer. Dabei war der Anhänger nicht besonders groß. Er stellte ein stilisiertes Rad mit acht Speichen dar und hatte einen Durchmesser von höchstens drei Zentimetern. Seinem Gewicht nach zu urteilen, musste er aus purem Gold gefertigt sein.
Höchst verwundert musterte Laura die Kette. Wie kam ihr Vater in den Besitz eines so wertvollen Stückes? Und warum war es für sie bestimmt? »Seltsam«, murmelte sie nachdenklich vor sich hin. »Das verstehe, wer will.«
Eine Stimme in ihrem Rücken antwortete ihr. »Nur Geduld, Laura, du wirst schon bald verstehen!«
Ein kalter Schauer lief Laura über den Rücken, und ihr Herz galoppierte schneller, als ihr Pferd es jemals getan hatte. Das war doch Mamas Stimme!, durchfuhr es sie. Aber Mama ist tot! Seit mehr als acht Jahren schon! Es ist völlig unmöglich, dass sie mit mir spricht!
Laura schnappte nach Luft, und Schweiß trat auf ihre Stirn. Langsam, ganz langsam drehte sie sich um und ließ den Blick mit angehaltenem Atem durch das kleine Zimmer schweifen. Doch da war nichts. Niemand war zu entdecken – schon gar nicht ihre Mutter. Nur ein gerahmtes Foto von Anna Leander hing an der Wand.
Laura atmete hörbar aus, und ihr Puls beruhigte sich wieder. Sie legte die Kette in das Kästchen zurück, steckte es ein und machte ein paar Schritte auf das Foto zu, um es näher zu betrachten. Es musste wenige Wochen vor Annas Tod aufgenommen worden sein. Sie war damals achtundzwanzig, eine hübsche junge Frau. Sehr hübsch sogar, fand Laura. Sie selbst und auch Lukas hatten die blonden Haare von ihr geerbt und ebenso die blauen Augen. Anna wirkte nachdenklich auf dem Foto.
Vielleicht hat sie damals schon geahnt, was passieren würde, schoss es Laura plötzlich durch den Kopf. Aber im gleichen Augenblick verwarf sie den Gedanken. Wie sollte so was möglich sein? Niemand, wirklich niemand hatte voraussehen können, dass Anna Leander einige Wochen später auf der Fahrt von Hohenstadt nach Ravenstein plötzlich zwei großen schwarzen Hunden würde ausweichen müssen, die wie aus dem Nichts vor ihrem Wagen aufgetaucht waren, sodass sie die Gewalt über ihr Auto verlor und in einem See landete.
Niemand!
Laura strich mit der Hand behutsam über den Rahmen. Und da geschah es: Anna Leander verzog die vollen Lippen zu einem sanften Lächeln und nickte ihrer Tochter aufmunternd zu. Laura erschrak und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Ihre Kopfhaut begann zu kribbeln, und sie merkte, dass sich die Haare an ihrem Hinterkopf und im Nacken aufrichteten.
Neeiin!
In diesem Augenblick trat Lukas in das Zimmer und bemerkte, dass seine Schwester mit totenbleichem Gesicht auf das Foto ihrer Mutter stierte.
»Was hast du denn, Laura?«, fragte er verwundert.
Laura antwortete nicht, sondern starrte unverwandt auf das Foto. Das Lächeln war wieder aus dem Gesicht der Mutter verschwunden. Ernst und nachdenklich wie immer blickte Anna ihrer Tochter entgegen.
Lukas berührte seine Schwester an der Schulter. »Laura, sag schon, was ist?«
Laura schüttelte verwirrt den Kopf, als wolle sie sich dadurch versichern, dass sie nicht träumte. Irgendwie musste sie sich das alles eingebildet haben, es gab keine andere Erklärung. Aber andererseits war sie sich ganz sicher, dass ihre Mutter ihr zugelächelt hatte, und die Stimme hatte sie auch ganz deutlich gehört: »Du wirst schon bald verstehen, Laura!«
Was geht hier vor, verdammt noch mal?
»Hey!« Lukas riss sie unsanft aus ihren Gedanken. »Redest du nicht mehr mit mir, oder was? Was ist denn los?«
»Ni … ni … nichts!«, stotterte Laura. »Es ist nichts!«
Lukas kniff das linke Auge zusammen und schaute sie skeptisch an. Die Falte hatte sich wieder in seine Stirn gekerbt.
»Schau mal, was ich entdeckt habe«, sagte er dann und hielt ihr einen Computerausdruck entgegen. »Ich hab ein bisschen im Internet gesurft und bin auf eine Website über Mythen gestoßen. Hör mal, was da steht.«
Er senkte den Blick auf das Blatt und las: »›Eine ganz besondere Rolle spielt die Zahl Dreizehn in der mythischen Zeitrechnung. Danach beginnt und endet das Jahr am Tag der Wintersonnenwende; die Zeit dazwischen ist in dreizehn Monde eingeteilt, die jeweils achtundzwanzig Tage umfassen. Aus diesem Grunde gilt die Dreizehn in vielen Kulturen auch als eine heilige Zahl. Den Menschen aber, deren Geburtstag auf den dreizehnten Tag des dreizehnten Mondes fällt, werden ganz besondere Kräfte und Fähigkeiten nachgesagt – weil sie im Zeichen der Dreizehn geboren sind.‹«
Lukas ließ den Ausdruck sinken und schaute seine Schwester erwartungsvoll an.
Doch Laura machte nur ein ratloses Gesicht. »Ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun haben soll.«
Lukas wirkte ernsthaft verblüfft. »Wirklich nicht?«
Laura schüttelte den Kopf. »Nein. Wirklich nicht.«
Lukas verdrehte genervt die Augen. »Typisch Spar-Kiu!«, sagte er.
Laura reagierte nicht auf das Schimpfwort. Lukas hatte es für Menschen erfunden‚ die nicht so ein Superhirn besaßen wie er. Mit seinem hohen Intelligenzquotienten hielt er sich selbst natürlich für einen »Super-Kiu« – wie Albert Einstein zum Beispiel oder Stephen Hawking, den englischen Astro-Physiker.
Überlegenheit schwang in Lukas’ Stimme mit, als er fortfuhr: »Dabei ist das so easy! Überleg doch mal: Wenn das Jahr mit dem Tag der Wintersonnenwende beginnt und endet – und wie selbst du wissen müsstest, fällt die auf den einundzwanzigsten Dezember – und die Zeit dazwischen in dreizehn Monde zu achtundzwanzig Tagen eingeteilt ist, dann ist der dreizehnte Tag des dreizehnten Mondes der … na, was glaubst du?«
Lukas sah seine Schwester über den Rand seiner großen Brille an, die ihm auf die Nasenspitze gerutscht war. Doch Laura zog nur verärgert die Stirn kraus. Sie konnte es verdammt noch mal nicht leiden, wenn ihr Bruder einen auf neunmalklug machte. Natürlich wusste er mehr als sie. Was ja auch kein Wunder war! Dauernd steckte er den Kopf in irgendwelche schlauen Bücher oder durchforstete das Internet nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sollte er doch! Sie hatte nichts dagegen – solange er sich deshalb nicht aufspielte. Oder sich einbildete, er sei was Besseres als sie.
»Mann, Lukas, du weißt doch, dass ich in Mathe nicht so gut bin wie du!«, sagte sie genervt.
Wieder verdrehte Lukas theatralisch die Augen. »Das hat mit Mathe nichts zu tun«, erklärte er dann mit einem überheblichen Grinsen. »Das ist nichts weiter als ein einfaches Abzähl-Problem, das jeder Viertklässler lösen kann!«
Laura zog eine Grimasse. »Wenn du meinst«, maulte sie, ziemlich eingeschnappt. »Und wie lautet die Lösung, Mister Super-Kiu?«
Lukas grinste. Er machte ihm Spaß, Laura auf die Palme zu bringen. Am leichtesten gelang ihm das, wenn er ihr unter die Nase reiben konnte, dass er auf vielen Gebieten größere Kenntnisse besaß und mehr wusste als sie. Obwohl er jünger war und eine Klasse unter ihr besuchte. Da er besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern dem Lehrstoff weit voraus war, hatte er natürlich auch Laura längst überflügelt.
»Also, pass auf«, erläuterte er in gönnerhaftem Ton. »Der dreizehnte Tag des dreizehnten Mondes nach dem mythischen Kalender entspricht unserem fünften Dezember. Deinem Geburtstag also!«
»Echt?«, fragte Laura verblüfft.
»Echt!« Lukas nickte. »Ist doch logosibel!«
Laura machte ein verwundertes Gesicht. »Logo-was?«
»Logosibel!«, wiederholte ihr Bruder, und da endlich verstand sie, dass Lukas schon wieder ein neues Wort erfunden hatte. »Und damit hat der Bauer voll recht«, fuhr der Junge fort. »Du bist tatsächlich im Zeichen der Dreizehn geboren!«
»Ähm«, brummte Laura. »Klingt einleuchtend. Aber trotzdem: Was hab ich denn mit diesem komischen Kalender zu tun? Oder mit irgendwelchen Mythen?«
3. Kapitel: Der Fluch des Schwertes
Im riesigen Thronsaal von Hellunyat herrschte Schweigen. Nur das Schmauchen der rußenden Fackeln in den schmiedeeisernen Wandhaltern und das Prasseln des Feuers im steinernen Kamin waren zu hören. Elysion, der Hüter des Lichts, saß in einem Sessel und starrte wie abwesend in die Flammen. Der Widerschein des Feuers lag auf seinem furchigen Gesicht, und der würzige Harzgeruch der Holzscheite stieg in seine Nase.
Doch der alte Mann schien das ebenso wenig zu bemerken wie den Strauß mit den wunderschönen roten Blüten, der als einziger Schmuck in einer Vase auf der Kommode neben einem der hohen Fenster stand. Elysion wirkte unendlich müde. Unzählige Jahre hatten ihre Spuren in seinem gütigen Antlitz hinterlassen und sein Haupthaar ebenso schlohweiß gefärbt wie seinen langen Bart. Der Hüter des Lichts war in ein einfaches weißes Gewand gehüllt und trug eine schlichte Kette mit einem Anhänger um den Hals. Er war aus purem Gold gefertigt, eine feine, äußerst sorgfältige Arbeit, die ein stilisiertes Rad mit acht Speichen darstellte.
Obwohl der Alte dicht am Feuer saß, fröstelte es ihn. Ein leichter Schauder durchlief seinen Körper, und er seufzte kaum merklich vor sich hin. Seit Stunden war Elysion von einer seltsamen Unruhe befallen, die seine Gedanken umtrieb und ihn wach hielt. Im Gegensatz zu seinen sonstigen Gepflogenheiten hatte er seine Schlafkammer deshalb erst gar nicht aufgesucht. Er wusste, dass er in dieser Nacht keine Ruhe finden würde.
Dabei hatte Ritter Paravain ihm versichert, dass es keinerlei Anlass zur Besorgnis gebe. Alle Wachtürme seien doppelt besetzt, überall in der Burg Wachposten verteilt. Es sei so gut wie unmöglich, unbemerkt in Hellunyat einzufallen. Doch der Hüter des Lichts hatte den Führer seiner Leibgarde daran erinnert, dass es den Mächten des Dunklen vor fast dreizehn Monden sogar gelungen war, in das Labyrinth der Burg einzudringen und den Kelch der Erleuchtung mit dem Wasser des Lebens zu rauben.
»Eine Kette von unglücklichen Zufällen!«, hatte Paravain erklärt. Und dann hinzugefügt: »Außerdem wisst Ihr doch, Herr, dass sie nur erfolgreich waren, weil sich ein Verräter in unsere Reihen eingeschlichen hatte!«
Der Hüter des Lichts hatte seinen Ritter ruhig angeblickt und geantwortet: »Es gibt keine Zufälle, Ritter Paravain. Alles, was geschieht, hat einen besonderen Sinn, auch wenn wir den manchmal nicht sofort zu erkennen vermögen. Und vor Verrat ist man niemals gefeit!«
Der alte Mann nickte unwillkürlich mit dem Kopf. O ja, wie oft schon hatte er in seinem langen Leben Verrat erlebt! Wie oft hatte erfahren müssen, dass einer seiner Gefolgsleute den Verlockungen des Feindes nicht hatte widerstehen können und sich heimlich in dessen Dienst gestellt hatte. Was ihn zu einem besonders gefährlichen Verbündeten der Dunklen machte, denn ein erkannter Gegner ist leichter zu bekämpfen als ein vermeintlicher Freund, in dessen Herzen der Verrat nistet. Deshalb unternahmen die Dunklen Kräfte immer wieder den Versuch, Ritter der Gralsburg auf ihre Seite zu ziehen.
Trotz dieser Anstrengungen war es den Dienern der Dunkelheit aber immer noch nicht gelungen, die Mächte des Lichts zu besiegen. Auch wenn die Auseinandersetzungen immer häufiger und heftiger wurden – im fortwährenden Kampf zwischen Gut und Böse war das Schicksal stets der Seite des Lichts zugeneigt! Bei diesem Gedanken strahlte das Gesicht des Alten, und seine wässrigen blauen Augen blitzten auf wie die eines jungen Mannes. O ja, er war noch immer in der Lage, die Aufgabe zu erfüllen, die ihm seit Anbeginn der Welten anvertraut war! Aber vielleicht, vielleicht war es langsam an der Zeit, sich Gedanken über einen Nachfolger zu machen …
Noch bevor die Tür geöffnet wurde, spürte Elysion die Gefahr. Er sprang auf, und im selben Augenblick wurden die Flügel der großen Tür mit ungestümer Heftigkeit aufgestoßen. Eine Handvoll Schwarzer Ritter polterte in den Saal, angeführt von Borboron. Der Schwarze Fürst trug sein Schwert erhoben in der Hand, und die scharfe Klinge, die von zahllosen Blutflecken gesprenkelt war, leuchtete im Schein des Feuers.
Als der Hüter des Lichts die Waffe erblickte, erschrak er heftig. Er wusste nur zu gut um die grausame Macht dieses Schwertes, das nicht ohne Grund den Namen Pestilenz trug: Zu Anbeginn der Zeiten von den Dunkelalben jenseits der Feuerberge geschmiedet und von den teuflischen Fhurhurs mit schwarzmagischen Kräften versehen, war es die einzige Waffe, die ihm zum Verhängnis werden konnte. Und ausgerechnet in dem Augenblick, in dem er zum ersten Male seit undenklichen Zeiten wieder von dem furchtbaren Schwert bedroht wurde, war Elysion ohne Schutz.
Die Feueraugen des Schwarzen Fürsten durchmaßen den großen Thronsaal. Als er bemerkte, dass der Hüter des Lichts alleine war, ging ein grimmiges Grinsen über sein leichenfahles Gesicht.
»Sei mir gegrüßt, Meister des Lichts!«, höhnte er und stürmte mit langen Schritten auf den Alten zu. Seine tiefe, kehlige Stimme schien direkt aus den Schlünden der Hölle zu kommen.
Seine Schwarzen Ritter verteilten sich im Saal.
Elysion saß in der Falle. Er wich voller Furcht zurück. Es schien keine Aussicht auf Rettung zu geben, denn Borboron kam rasch näher.
Mit wohlgefälligem Grinsen beobachteten die Männer ihren Anführer.
Da sprang eine zweite Tür auf, und dreizehn Ritter drängten in den Saal. Sie waren in weiße Rüstungen gehüllt und hatten die Schwerter gezogen. An ihrer Spitze stand ein hoch gewachsener junger Mann: Ritter Paravain. Mit einem schnellen Blick zu seinem Herrn erkannte der Anführer der Leibgarde den Ernst der Lage.
»Im Namen des Lichts – schlagt sie zurück!«, rief er seinen Mannen zu.
Während sich seine Ritter den Schwarzen Kriegern in den Weg stellten, hastete Paravain auf den Hüter des Lichts zu, um dessen Leben zu beschützen. Doch diesmal schien er zu spät zu kommen, denn Borboron hatte Elysion schon fast erreicht, und er selbst war noch viel zu weit entfernt, um eingreifen zu können. Zu allem Überfluss versperrte ihm auch noch der große runde Tisch, der in der Mitte des Saales stand, den Weg.
Der Anführer der Dunklen Mächte hob sein Schwert über den Kopf. »Deine Stunde ist gekommen, alter Mann!«, rief er – und schlug mit unbarmherziger Wucht zu. Die Klinge hielt genau auf den Kopf des Alten zu – als Borboron plötzlich laut aufstöhnte. Etwas hatte ihn mit ungeheurer Wucht im Rücken getroffen, sodass er ins Taumeln geriet und sein Schwerthieb das Haupt des Gegners um Haaresbreite verfehlte.
Ein erleichtertes Lächeln ging über das Gesicht von Ritter Paravain, als er sah, dass der von ihm geschleuderte Schemel seinen Herrn im letzten Augenblick vor dem sicheren Tod bewahrt hatte. Mit einem einzigen Satz sprang er auf den Tisch, hetzte darüber hinweg und stürmte auf den Schwarzen Fürsten zu, um ihn zu attackieren.
Borboron hatte sein Gleichgewicht bereits wieder gefunden. Sein Schwert fuhr dem Weißen Ritter in die Parade. Dann griff der Schwarze Fürst seinerseits an. Doch schon beim ersten Streich musste er erkennen, dass er es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun hatte, auch wenn dieser viel jünger war als er und ihm an Erfahrung unterlegen sein mochte. Borborons bleiches Gesicht verzog sich zu einer wütenden Fratze, und die Höllenglut in seinen Augen glimmte heftiger denn je, während Paravain die Schläge von Pestilenz geschickt parierte, um dann selbst zu attackieren. Ein erbitterter Kampf entspann sich zwischen den beiden ungleichen Männern. Keiner wollte weichen, beide wussten, dass es auf Leben und Tod ging.
Auch ihr Gefolge lieferte sich ein heftiges Gefecht. Das Keuchen und Stöhnen der Männer und das metallische Klirren der Schwerter hallten durch den Saal. Feurige Funken stoben wie verirrte Glühwürmchen durch den Raum, wenn die Klingen mit wilder Wucht aufeinandertrafen. Mit heiserem Todesröcheln stürzte Kämpe um Kämpe zu Boden, was die Kameraden nur noch anzuspornen schien. Die Schwarzen Ritter setzten sich mit aller Macht zur Wehr, vermochten sich aber nur für kurze Zeit gegen Elysions Leibgarde zu behaupten. So viele Männer waren den Schwertern der Weißen Ritter zum Opfer gefallen, dass der Schwarze Fürst erkennen musste, dass keine Aussicht auf Erfolg mehr bestand.
»Zurück, Männer! Zieht euch zurück!«, befahl er seinen Kriegern, und die Enttäuschung in seiner Stimme war unüberhörbar.
Sein Gefolge gehorchte sofort, während Borboron einen letzten wütenden Versuch unternahm, seinen Gegner zu töten. Die scharfe Spitze von Pestilenz fuhr auf die Kehle von Paravain zu, der seine Aufmerksamkeit einen Moment zu lang auf Elysion gerichtet hatte. Doch schon schnellte das Schwert des Weißen Ritters empor, um auch diese Attacke abzuwehren, sodass er um Haaresbreite dem tödlichen Stoß entging.
»Freu dich nicht zu früh, du Narr!«, grollte Borboron. »Wir sehen uns wieder, und dann werde ich dich töten!« Damit wirbelte er auf dem Absatz herum und flüchtete als letzter der Schwarzen Ritter aus dem Saal.
»Verfolgt sie und sorgt dafür, dass keiner von ihnen in den Mauern von Hellunyat zurückbleibt!«, befahl Paravain der Leibgarde.
Die Weißen Ritter eilten den Feinden nach, um sie endgültig aus der Gralsburg zu vertreiben. Ihr junger Anführer aber schritt auf den Hüter des Lichts zu, der neben dem Kamin im Schatten der Wand stand. Der Schrecken war dem Alten in die Glieder gefahren, denn er zitterte, und sein Gesicht war aschfahl.
Paravain steckte sein Schwert in die Scheide. »Ich verstehe einfach nicht, wie –«
»Die Nebel!«, schnitt ihm Elysion barsch das Wort ab. »Sie sind von Osten gekommen und haben sich der Flüsternden Nebel bedient. Hast du die Männer nicht davor gewarnt?«
»Doch! Aber sie haben meine Warnungen offensichtlich nicht ernst genommen. Schließlich haben nur die wenigsten von ihnen bislang Bekanntschaft mit diesen tückischen Nebeln gemacht.«
»Sie sind eine große Hilfe für den, der sich ihrer zu bedienen weiß«, sagte der Hüter des Lichts nachdenklich. »Schärf das deinen Männern ein morgen beim Appell!«
»Gewiss, Herr. Seid versichert –« Paravain suchte den Blick seines Gebieters, und da wich alles Blut aus seinem Gesicht. »Oh, nein!«, stöhnte er, schlug die Hände vor den Mund und starrte den Hüter des Lichts aus schreckgeweiteten Augen an.
»Ich weiß«, sagte der alte Mann mit brüchiger Stimme. »Er hat mich erwischt.«
Mit der rechten Hand strich er sich über die linke Wange und hielt Paravain die Finger entgegen. Die Kuppen waren blutrot. Dann drehte er dem Ritter die linke Gesichtshälfte zu, über die sich eine fünf Zentimeter lange, dünne Wunde zog.
Paravain wusste nur zu gut, was diese Verletzung durch das Schwert Pestilenz bedeutete: Wunden, die mit seiner Klinge geschlagen wurden, heilten niemals. Die Verletzten mussten eines qualvollen Todes sterben, wenn sie nicht rechtzeitig mit dem einzig wirksamen Gegenmittel behandelt wurden: dem Wasser des Lebens. Nur das Elixier aus dem Kelch der Erleuchtung vermochte seinen Herrn nun noch zu retten. Doch der Kelch befand sich im Besitz der Feinde. Niemand wusste, wo auf dem Menschenstern die Dunklen Mächte ihn versteckt hielten. Angst stieg auf in Paravain.
Eine Angst, die ihn zu überwältigen drohte.
»Es ist nur ein kleiner Kratzer«, erklärte der Hüter des Lichts in beruhigendem Ton. Doch plötzlich taumelte er, seine Knie zitterten, und seine Kräfte schwanden sichtlich.