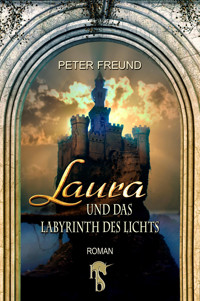
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Laura Leander musste auf alle ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten verzichten, um ihre Mutter aus den Fängen der Feuerschlange zu befreien. Sie erinnert sich weder an Aventerra noch an die Abenteuer, die sie dort erlebte. Aber ist sie wirklich sicher? Albträume beunruhigen sie. Auch ihre Familie und Freunde, die über sie wachen, ahnen, dass der Kampf um die Macht auf Aventerra weitergeht: Ein gefährlicher Zaubertrank soll dem Schwarzen Fürsten Borboron endlich den Sieg über die Menschen und die Krieger des Lichts bringen. Beim Training für ein Wettrennen auf Burg Ravenstein, zu dem ihr Bruder Lukas sie überredet, stürzt Laura schwer mit dem Mountainbike und fällt ins Koma. Die Ärzte sind ratlos, denn anscheinend ist sie völlig gesund. Doch Lukas spürt, dass das Leben seiner Schwester in größter Gefahr ist, und zögert nicht, einzugreifen, als sich ihm die Chance bietet. Er macht sich auf eine gefährliche Reise. Wird er Laura retten können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Freund
Lauraund das Labyrinth des Lichts
Roman
Für alle, die Laura Leanderseit Jahren die Treue halten
Kapitel 1Der Todesdämon
Lukas Leander zuckte zusammen. Er trat auf die Bremse seines Mountainbikes und starrte wie gebannt nach vorn. Auf einer Hügelkuppe, kaum hundert Meter von ihm entfernt, erschien urplötzlich ein riesiger schwarzer Schemen, der sich wie eine düstere Drohung gegen den bleigrauen Februarhimmel abzeichnete.
Es war ein Reiter, ganz in Schwarz gekleidet, auf einem pechschwarzen Pferd.
Im selben Augenblick verdunkelte sich der Himmel. Das Licht verblasste, als habe jemand einen dichten Schleier über die fahle Spätwintersonne geworfen.
Lukas begann zu zittern. Obwohl es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild war, erfasste ihn Eiseskälte. Sie kroch ihm in die Hosenbeine, unter die Mütze und den Anorak und überzog seinen gesamten Körper mit einer Gänsehaut. Ihm war, als marschiere eine Armee winziger Schneetrolle über seinen Rücken. Die Haare im Nacken richteten sich auf wie bei einem Hund, der Gefahr witterte.
Dann hörte Lukas ein Krächzen, schrill und bedrohlich. Er blickte auf und sah die Krähen: Es mussten Tausende von schwarzen Vögeln sein, die wie eine riesige Wolke über den Himmel zogen und geradewegs auf ihn zuflogen. Ihre Schreie klangen so verzerrt, als kämen sie aus einer fremden Welt.
Zugleich vernahm er das heisere Bellen von Hunden. Lukas senkte den Blick und erkannte zu seinem Entsetzen, dass der Reiter auf der Kuppe von einer Meute riesiger Hunde umgeben war – dunkle Bestien, die wie aus dem Nichts gekommen waren und ihn mordlüstern anfunkelten.
Lukas erstarrte. »O nein!«, stöhnte er atemlos.
Da stieß der Reiter dem Pferd jäh die Sporen in die Flanken, sodass es einen Satz nach vorn machte und in wilden Galopp verfiel. Die Hundemeute folgte ihm mit lautem Kläffen.
Der unheimliche Rappe mit der Spukgestalt auf dem Rücken stürmte direkt auf den Jungen zu. Seine Augen funkelten feuerrot und aus den Nüstern wehte schwefliger Dampf. Die mächtigen Hufe trommelten über den gefrorenen Boden.
Lukas war zu keiner Bewegung fähig. Als stünde er unter einem geheimnisvollen Bann, verharrte er reglos an Ort und Stelle und sah der schattengleichen Gestalt mit eisigem Grauen entgegen.
Sie kam näher, immer näher.
Immer bedrohlicher schien sie über Lukas aufzuragen.
Mit einem Mal wurden die Konturen des Reiters schärfer, wie die Bilder eines unscharfen Films, die nach dem Justieren des Projektors plötzlich klarer hervortreten. Lukas sah die Gestalt nun viel deutlicher und der Anblick war so entsetzlich, dass dem Jungen beinahe das Herz stehen blieb.
Das war kein Mensch, sondern ein schreckliches Wesen, scheinbar geradewegs einem Horrorfilm entsprungen. Der Kopf mit den beiden Hörnern glich dem eines Monsters. Das mit schrundigen Narben und eitrigen Warzen überzogene Gesicht war tiefschwarz. Ein dumpfes rotes Glühen lag in den Augen, die Pupillen leuchteten schwefelgelb und die Iris glänzte schwarz wie Kohle. Hauerartige Eckzähne ragten aus den von langen Barteln verunstalteten Mundwinkeln. Am Kinn hing ein strähniger schwarzer Ziegenbart und aus dem Rücken des Reiters ragte ein riesiges Paar dunkler Fledermausflügel. Lukas glaubte, den Verstand zu verlieren!
Dann erkannte er auch noch, dass das Monster gar kein Pferd ritt. Das nachtschwarze Tier musste vielmehr ein Einhorn sein, denn auf der Stirn prangte ein langes Horn, spitz und flammend rot wie das Höllenfeuer.
Der Reiter war höchstens noch zehn Meter entfernt – da löste er sich einfach auf! Es wurde heller und alles war still und friedlich wie zuvor. Die Kuppe lag im blassen Licht der Sonne einsam und verlassen da. Lukas konnte wieder die drei Windräder sehen, die erst vor wenigen Wochen auf dem Hügel errichtet worden waren. Reiter und Einhorn hingegen waren ebenso verschwunden wie die Hunde.
Auf dem Abhang blieben nur Büsche und Sträucher zurück, Wacholder, Brombeeren und Krüppelkiefern. Ein sanfter Wind strich hindurch. Mit leisem Rascheln wehte er verdorrte Blätter und dürre Zweige über die Felder und Wiesen, die sich nach allen Seiten bis zum Horizont erstreckten, wo leichter Nebel aufstieg.
Noch immer war Lukas keiner Regung fähig.
»Hey!« Dumpf und verschwommen drangen die Worte von Mr Cool an sein Ohr. »Was ist denn los?«
Lukas schüttelte sich, als erwache er aus einem bösen Traum. Dann erinnerte er sich wieder: Ja, klar – Mr Cool und er unternahmen gerade eine Mountainbike-Tour über die Hügel rund um Ravenstein.
Hier zeigten sich bereits die ersten wagemutigen Vorboten des Frühlings: vereinzelte grüne Blattspitzen, vorwitzige Weidenkätzchen und zarte Buschwindröschen. Im weitläufigen Park der alten Festung blühten sogar schon erste Krokusse.
Burg Ravenstein war im zwölften Jahrhundert erbaut worden und hatte damals dem berüchtigten Raubritter Reimar von Ravenstein als Stammsitz gedient. Das historische Gemäuer war längst modernisiert worden und beherbergte inzwischen das gleichnamige Internat, das Lukas Leander und seine ein Jahr ältere Schwester Laura besuchten. Und ebenso Philipp Boddin – wie Mr Cools richtiger Name lautete. Mit diesem Jungen hing Lukas seit ein paar Wochen immer öfter zusammen. Lukas ging in die siebte Klasse und Mr Cool in die 8b, genau wie Laura.
»Was ist los?« Philipp hatte sein Bike neben Lukas zum Stehen gebracht. Obwohl er nur ein Jahr älter war als sein Begleiter, überragte er ihn um Haupteslänge. Er schob seine Sonnenbrille – das neueste Modell von Gucci – auf die Stirn und blickte Lukas verwundert an. Auf dem Ärmel seines roten Stepp-Anoraks prangte die schwarze Wolfstatze von Jack Wolfskin. Die schicke Strickmütze, die seine semmelblonde Mähne bedeckte, stammte ebenfalls von einem angesagten Outdoor-Ausstatter.
Lukas tat erstaunt. »Was soll denn los sein?«, fragte er.
»Du hast den Hügel hier angeglotzt, als hättest du ein Gespenst gesehen«, erklärte Mr Cool. »Das ist los!«
Lukas schluckte. Sollte er sich Philipp anvertrauen und ihm von seiner Vision erzählen?
Keine leichte Frage!
Natürlich war Mr Cool in Ordnung, ein guter Freund sogar, auf den immer Verlass war. Außerdem hatte er im Laufe der letzten Monate mitbekommen, was auf Burg Ravenstein hinter den Kulissen vorging. Lukas und seine Schwester Laura hatten Philipp mehrere Male um Hilfe gebeten und ihn deshalb andeutungsweise in das große Geheimnis eingeweiht, das die Welt der Menschen mit der Welt der Mythen verband. Philipp wusste somit zumindest bruchstückhaft Bescheid über den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, der seit Anbeginn der Zeiten auf der Erde und ihrem geheimnisvollen Schwesterstern Aventerra geführt wurde.
Er wusste von den Wächtern, die für die Sache des Lichts stritten, und von ihren erbitterten Feinden, den Dunklen, die der Finsternis und damit dem Ewigen Nichts zum Sieg verhelfen wollten. Und natürlich ahnte Philipp längst, dass Laura Leander in dieser erbitterten Auseinandersetzung eine wichtige Rolle innegehabt hatte.
Doch dann, vor rund zwei Monaten, an ihrem vierzehnten Geburtstag, hatte Lukas’ Schwester ein großherziges Opfer gebracht. Vor vielen Jahren war ihre Mutter Anna in das Reich der Feuerschlange Rygani verschleppt worden. Um sie zurückzuholen, hatte Laura auf all jene fantastischen Fähigkeiten verzichtet, die sie sich als Wächterin des Lichts mühsam angeeignet hatte: Gedankenlesen, Telekinese und Traumreisen.
Damit ihr der Verzicht nicht aufs Gemüt drückte, hatte ein gnädiges Schicksal dafür gesorgt, dass Laura sämtliche Erinnerungen an ihre aufregenden Erlebnisse verlor. Und damit sich niemand in ihrer Gegenwart verplapperte und sie durch eine unbedachte Bemerkung verwirrte, hatte Lukas jeden darüber informiert, der auch nur andeutungsweise mit dem großen Mysterium vertraut war.
So wussten inzwischen nicht nur Lauras Familie und ihre Wächterfreunde Bescheid, sondern auch ihre beste Freundin Katharina »Kaja« Löwenstein – und Mr Cool. Selbst Magda Schneider, die ebenfalls in Lauras Klasse ging und zumindest am Rande in einige ihrer Abenteuer verwickelt gewesen war, hatte Lukas so weit wie nötig in Kenntnis gesetzt.
»Hey!« Mr Cool schien langsam die Geduld zu verlieren. »Hat es dir die Sprache verschlagen, Lukas – oder warum antwortest du nicht?«
»Nein, nein«, entgegnete der Junge hastig. »Alles okay.«
»Na, dann erzähl mir doch mal, warum du wie ein vom Blitz getroffenes Mondkalb auf diesen Hügel dort gestarrt hast!«
In tiefe Gedanken versunken eilte der Fhurhur durch die verwinkelten Flure der Dunklen Festung und strebte seinem Gemach zu, das ganz oben in einem der hohen Türme gelegen war. Sein scharlachroter Kapuzenumhang flatterte, während der Schwarzmagier schnellen Schrittes die steinerne Wendeltreppe emporstieg. Das hagere Männlein, dessen faltiges Gesicht von kränklich gelber Farbe und mit unzähligen Altersflecken übersät war, achtete nicht auf die Wachen und die übrigen Bediensteten, die ihm hinterherblickten – verächtlich die einen, fast hasserfüllt die anderen.
Er wusste auch so, dass sie ihm die Schuld an der vernichtenden Niederlage gaben, die ihr Gebieter, der Schwarze Fürst, unlängst gegen den Hüter des Lichts erlitten hatte. Er habe die alte Prophezeiung falsch ausgelegt, warfen sie ihm vor, und Borboron nicht von dem Schwertduell gegen Elysion abgehalten, aus dem der Anführer des Lichts überraschend als Sieger hervorgegangen war.
Diese Narren!
Als ob es ein Kinderspiel wäre, solche rätselhaften Vorhersagen richtig zu deuten! Selbst für einen gefürchteten Magier wie ihn, der sich auf die schwärzesten der Schwarzen Künste verstand, stellte das jedes Mal aufs Neue eine große Herausforderung dar. Die Prophezeiungen waren meist überaus vieldeutig formuliert und deshalb schwer zu entschlüsseln.
Hinterher, wenn es zu spät war, konnte jeder klug daherschwätzen und behaupten, er hätte es besser gewusst. Und genau das hatten Aslan, der Anführer der Schwarzen Garde, und diese hinterhältige Schlange, die Gestaltwandlerin Syrin, getan: Sie hatten ihm die Schuld an der verheerenden Niederlage zugeschoben und es zudem geschickt verstanden, auch beim restlichen Gefolge Stimmung gegen den Schwarzmagier zu machen. Kein Wunder also, dass man in der Dunklen Festung inzwischen fast einhellig der Meinung war, nur er allein, der einstmals von allen bewunderte und hochverehrte Fhurhur, trage die Verantwortung für das Debakel.
Dabei hatte doch nicht er das Schwert gegen diesen Knecht des Lichts geführt, sondern vielmehr sein Gebieter Borboron, der siegessichere Anführer der Dunklen Heere! Ein wahrer Hüne, der vor Kraft kaum laufen konnte – und sich dann von dem greisen und gebrechlichen Elysion im Zweikampf übertölpeln ließ.
Aber den Schwarzen Fürsten wagte natürlich niemand zu beschuldigen! Weil jeder wusste, was geschehen würde, wenn Borboron Wind davon bekam: Er würde denjenigen unverzüglich dem Henker überantworten und ohne Gnade hinrichten lassen.
Während der Fhurhur, tief in Gedanken versunken, Stockwerk um Stockwerk emporstieg, klang ihm der Hall der eigenen Schritte wie eine dumpfe Mahnung ans Ohr:
Du musst etwas tun!
Du musst etwas tun!
Du musst …
Eines stand schließlich fest: Wer auch immer die Schuld an dem Misserfolg trug – die Lage war so ernst wie lange nicht mehr. Die Dunkle Streitmacht war erheblich geschwächt und Borborons Ansehen im Schwinden. Aber was das Schlimmste war: Ihre mächtigste Waffe, das Schwarze Schwert Pestilenz, war in die Hände der Feinde gefallen. Die Aussichten, Elysion und seine Krieger des Lichts zu besiegen, waren damit auf einem Tiefpunkt angelangt.
Im Lager der Dunklen machte sich bereits Unruhe breit. Langjährige Verbündete wie die Wolfsköpfigen oder die Wunschgaukler fügten sich den Anordnungen des Schwarzen Fürsten nur noch widerwillig und unter Murren. Wenn das so weiterging, war die offene Rebellion bloß eine Frage der Zeit. Dann aber wären Borborons Tage gezählt. Der Schwarze Fürst würde seinen Kopf verlieren – und er selbst, als dessen engster Ratgeber, mit Sicherheit auch.
Aber das würde er nicht zulassen – niemals!
Endlich war der Fhurhur im obersten Stockwerk des Turmes angekommen. Er schloss die Tür zu seiner Kammer auf, trat ein und ging rasch auf den großen Schrank zu, der an der gegenüberliegenden Wand stand. Gerade wollte er ihn öffnen, da fiel sein Blick durch das schmale Fenster gleich daneben.
Obwohl es erst später Nachmittag war, hatte sich der Himmel über der Dunklen Festung bereits verdüstert. Die schwarzen Nebel, die ständig um die Türme waberten, und die riesigen Krähenschwärme, die rastlos über der finsteren Feste kreisten, schluckten das Licht. Das ungewöhnliche Sternzeichen am Firmament war klar und deutlich zu erkennen: sieben Sterne, von denen einer kräftiger funkelte als der andere, formten ein hell leuchtendes Herz am Himmel. Der Fhurhur fluchte laut bei diesem Anblick.
Dieses verdammte Siegel der Sieben Monde!
Als wolle es sich über ihn lustig machen, leuchtete es heller denn je zuvor.
Es war höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen!
Nur mühsam zügelte der Schwarzmagier seinen Zorn und öffnete den Schrank, in dessen Fächern Dutzende von Behältern aufgereiht standen: Tiegel, Flaschen, Becher, Schalen, Töpfe, Phiolen und Glaskolben. Der Fhurhur reckte sich, um das oberste Fach besser einsehen zu können, griff nach einer unscheinbaren Phiole in der hintersten Ecke und nahm sie in die Hand. Fast andächtig betrachtete er das Gefäß, das eine kleine Menge – höchstens einen Fingerhut voll – einer glasklaren Flüssigkeit enthielt.
Der Fhurhur erschauderte vor Ehrfurcht: Obwohl völlig unscheinbar, war das Elixier der seltenste und gleichzeitig wirkungsvollste Schwarzzauber unter der Sonne. Die Stunde, in der er es gebraut hatte, war der Höhepunkt seines bisherigen Wirkens gewesen, und so erinnerte er sich noch gut daran.
Es lag nun schon viele Jahre zurück. In der Nacht der Wintersonnenwende hatte eine vollständige Mondfinsternis geherrscht, was nur höchst selten vorkam. Am Himmel über dem Schwarzen Schlund, dem finstersten Ort von ganz Aventerra, war nicht ein Schimmer des Goldmondes und des Menschensterns zu sehen gewesen – was die Macht der Dunkelheit, die zur Wintersonnenwende am größten war, um ein Vielfaches verstärkt hatte. Nur deshalb hatte er dieses Elixier brauen können – und weil er sich im Besitz der Fünf Zeichen der Schlange befand!
Ein böses Lächeln huschte über das faltige Gesicht des Fhurhurs: Die Wirkung des Elixiers war verheerend. Es löste den Todesschlaf aus, eine Folter, weit schlimmer als die Todesstarre und noch schwieriger zu heilen. Denn auch dazu benötigte man die Fünf Zeichen der Schlange, von denen in der Uralten Offenbarung die Rede war – einer geheimnisvollen Schrift, die Beliaal, der Herr der Finsternis, am Anbeginn der Zeiten den Wolkentänzern entwendet hatte und die er seitdem an einem geheimen Ort versteckt hielt.
Als könne er den Blick nicht von dem schwarzmagischen Elixier wenden, starrte der Fhurhur es unverwandt an. Seit vielen Jahren bewahrte er die Phiole nun schon in seiner Kammer auf. Bislang war er stets vor der Anwendung des Elixiers zurückgeschreckt. Nicht etwa aus Mitleid mit dem entsprechenden Opfer, sondern weil er die wirkungsmächtige Tinktur nicht unnötig verschwenden wollte. Er besaß nur eine winzige Menge davon, und auf absehbare Zeit würde es auch keine mondlose Wintersonnenwende mehr geben – der einzige Zeitpunkt, an dem das Elixier gebraut werden konnte.
Um seine Stellung als engster Ratgeber des Schwarzen Fürsten zu sichern, hatten andere Mittel ausgereicht, weit weniger wirksam und viel leichter herzustellen. Dabei strebten Syrin und viele weitere Rivalen schon seit Jahren nach seinem Platz an Borborons Seite. Bislang jedoch hatte er nicht nur jede ihrer hinterhältigen Intrigen zunichtegemacht, sondern gleichzeitig auch seine schwarzmagischen Künste zuverlässig und höchst wirksam gegen die Krieger des Lichts eingesetzt.
Seit Elysion jedoch den Schwarzen Fürsten besiegt hatte, war alles anders. Wenn er selbst nicht untergehen wollte, musste er sich endlich seines wirksamsten Mittels bedienen – ob ihm das nun recht war oder nicht.
In den endlosen Stunden, in denen er sich während der letzten Wochen den Kopf zerbrochen und alles durchdacht hatte, war ihm allerdings eines klar geworden: Das Elixier allein würde kaum ausreichen, um Borborons Macht zu bewahren. Die Dunklen Mächte konnten sich nur dann aus ihrer nahezu hoffnungslosen Lage befreien, wenn sie endlich jenes geheimnisvolle Wesen fanden, von dem in der Uralten Offenbarung die Rede war: Das Kind des Dunklen Blutes, das ihnen zum Sieg über die Mächte des Lichts verhelfen konnte. So blieb dem Fhurhur nichts anderes übrig, als Kontakt mit Beliaal aufzunehmen, dem gefürchteten Dämon des Todes – auch wenn ihm davor schon seit Tagen angst und bange war.
Doch es gab keinen anderen Weg!
Der Fhurhur stellte das Elixier in den Schrank zurück und nahm stattdessen zwei Lederbeutel heraus. Dann trat er vor den offenen Kamin, in dem ein Holzfeuer loderte. Einen guten Schritt von den Flammen entfernt ließ er sich auf den Boden nieder, griff in einen der Beutel, holte eine Handvoll graues Pulver daraus hervor und streute es ins Feuer.
Während die Flammen ein unheimliches Fauchen von sich gaben und hell aufloderten, streckte der Fhurhur die Hände zur Decke und murmelte eine Beschwörungsformel: »O mächtiger Beliaal, Herrscher der Finsternis und Herr aller Dämonen, ein ergebener Diener der Dunkelheit fleht Euch an: Zeigt Euch mir, o mächtiger Beliaal, damit ich in Verbindung mit Euch treten kann!« Damit kreuzte er die Arme vor der Brust und verneigte sich, bis seine Stirn die steinernen Bodenfliesen berührte.
Augenblicklich erhob sich ein gespenstisches Brausen. Das Feuer prasselte und zischte und ein schauriges Haupt zeichnete sich in den zuckenden Flammen ab: der Kopf eines zweifach gehörnten Dämons. Obwohl nur aus feuriger Lohe geformt, waren die schrundigen Narben und eitrigen Warzen auf der hässlichen Fratze deutlich erkennbar. Ebenso die Augen und die Eckzähne, die wie die Hauer eines Ebers aus dem Maul ragten. Selbst sein Ziegenbart glich züngelnden Flammen.
»Hier bin ich, elender Wurm«, erhob sich eine Stimme. »Wie kannst du es wagen, mich in der Ruhe meines Schwarzen Schlosses zu stören?«
Der Fhurhur richtete sich auf, kniff die Augen zusammen und starrte ängstlich ins blendende Feuer. »Ich benötige Eure Hilfe, o mächtiger Herr der Finsternis«, krächzte er. »Deshalb bittet Euch Euer ergebener Diener, ihm Zutritt zu Eurem finsteren Reich zu gewähren.«
Der Dämon zögerte mit der Antwort. »Hast du dir das auch gut überlegt?«, fragte er schließlich. »Du weißt doch, was passiert, wenn du meinen Zorn erregst?«
»Natürlich, o mächtiger Gebieter.« Erneut verbeugte sich der schmächtige, kleine Mann. »Aber ich bin mir sicher, dass meine Worte Euch nicht erzürnen, sondern im Gegenteil mit großer Freude erfüllen werden.«
Die Flammen auf der Stirn des Dämons schienen sich zusammenzuziehen. Sein Maul verformte sich zu einem Grinsen. »Nun denn, mein Freund, du hast es nicht anders gewollt«, fauchte Beliaal wie ein brausender Feuersturm. »Du weißt, wie du auf schnellstem Wege in mein Schwarzes Schloss gelangst. Das Feuer des Phönix wird dich zu mir bringen. Also zögere nicht länger und mach dich auf den Weg!« Die Flammen loderten noch einmal höllenrot auf, dann war das grässliche Haupt verschwunden, als hätte die Lohe es verzehrt.
Der Fhurhur erhob sich, griff in den zweiten Beutel und holte eine Feder daraus hervor – die goldene Schwanzfeder eines Phönix. Er machte einen Schritt auf den Kamin zu, warf die Feder ins Feuer – und sprang hinterher!
Im nächsten Moment war er spurlos verschwunden. Die Flammen fielen in sich zusammen, bis nur noch ein unscheinbares Feuer im Kamin vor sich hin züngelte.
Lukas zögerte immer noch, von seiner Vision zu berichten. Klar war Mr Cool ein Freund! Andererseits hatte Lukas ihm bislang verschwiegen, dass nicht nur seine Schwester über besondere Fähigkeiten verfügte, sondern auch er selbst. Lukas konnte nämlich Schattensehen!
Seine Großmutter Lena, die aus Aventerra stammte, hatte ihm diese äußerst seltene Gabe vererbt. Wie jeder Schattenseher war auch Lukas in der Lage, die Aura eines Lebewesens wahrzunehmen – jene geheimnisvolle Energie, die jedes Geschöpf ausstrahlte. Er konnte das sogar dann noch, wenn das entsprechende Wesen schon längst nicht mehr anwesend war.
Und genau das war vor wenigen Augenblicken geschehen: Lukas war sicher, den Energieschatten jenes unheimlichen schwarzen Reiters beobachtet zu haben, der seine Schwester Laura am Tag vor ihrem dreizehnten Geburtstag gejagt und in Todesangst versetzt hatte. Sie war nur deshalb mit heiler Haut davongekommen, weil der Verfolger sich auf unerklärliche Weise in nichts aufgelöst hatte.
Oder stand dem Monster der beobachtete Ritt erst noch bevor? Schließlich konnten Schattenseher sogar zukünftige Ereignisse wahrnehmen.
Dieser Gedanke versetzte Lukas einen Schock. Schwebte Laura womöglich in Gefahr? Würde der Reiter vielleicht zurückkehren und sie erneut attackieren, um den fehlgeschlagenen Angriff von damals wettzumachen? Angst und Sorge stiegen in dem Jungen auf und schnürten ihm regelrecht die Kehle zu.
Hatte seine Schwester womöglich nicht alles vergessen und konnte sich daher ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten noch immer bedienen? Ansonsten stellte sie für die Dunklen doch keine Gefahr mehr dar, und diese hätten keinen Grund, gegen sie vorzugehen! Lukas musste so schnell wie möglich herausfinden, ob Laura Gefahr drohte. Damit er sie notfalls warnen und ihr zur Seite stehen konnte!
Aber sollte er seine Bedenken tatsächlich mit Mr Cool teilen?
Lieber nicht!
Dann würde Philipp sich ebenfalls um Laura sorgen, vielleicht sogar mehr als ihr Bruder. Philipp war schließlich in sie verknallt, davon war Lukas überzeugt. Und zwar bis über beide Ohren, auch wenn Laura gar nichts von ihm wissen wollte! Es war daher bestimmt besser, Mr Cool nicht zu beunruhigen.
»Ach, weißt du«, sagte Lukas leichthin, »mir ist nur plötzlich was eingefallen.«
»Echt?« Mr Cool schob die Wollmütze in den Nacken und kratzte sich am Kopf. »Und was, bitte?«
»Ich hatte Laura ja versprochen, mit ihr zu lernen«, antwortete Lukas, sehr erleichtert darüber, dass ihm auf die Schnelle eine glaubwürdige Ausrede eingefallen war. Lächelnd schielte er Mr Cool über den Rand seiner dicken Hornbrille an. »Du weißt doch, sie hat letztes Jahr häufig im Unterricht gefehlt und dadurch viel versäumt. Ich will ihr helfen, alles so schnell wie möglich nachzuholen, damit sie nicht noch mal sitzenbleibt. Klaromaro?« Er schaute den Jungen mit der Mütze treuherzig an. »Das verstehst du doch, oder?«
»Yo – klar!« Mr Cool nickte. »Worauf warten wir noch? Machen wir, dass wir zurückkommen! Wir dürfen Laura doch nicht hängen lassen.«
Damit wendeten die Jungen ihre Räder, stiegen in die Pedale und flitzten davon. Sie hatten es so eilig, dass sie gar nicht daran dachten, zum Himmel zu schauen, wo ein mächtiger Vogelschwarm lautlos seine Kreise zog.
Es waren Krähen. Tausende von riesigen, pechschwarzen Krähen.
Kapitel 2Im Schwarzen Schloss
Der Thronsaal des Schwarzen Schlosses war in Dunkelheit gehüllt. Nur ein paar Kerzen und das still schwelende Feuer im eindrucksvollen Kamin an der Stirnwand des Raumes ließen kleine Inseln aus rötlichem Licht entstehen. Inmitten des Dämmerlichts dröhnte mit einem Mal ein fernes Brausen heran. Es kam näher und wurde immer lauter, bis das Kaminfeuer dunkelrot aufloderte und die Flammen mehr als mannshoch emporschlugen. Das Gebraus verstummte und eine Gestalt trat aus dem Feuer hervor, klein und schmächtig und in einen scharlachroten Kapuzenumhang gehüllt.
Während die Flammenzungen in sich zusammenfielen, machte der Fhurhur einen zögernden Schritt in den Raum hinein. Er kniff die Augen zusammen und spähte in die Finsternis.
»Sei mir gegrüßt, Diener der Dunkelheit!«, erklang eine kehlige Stimme aus der Tiefe des Saales. »Wie ich sehe, weißt du dich immer noch der Kräfte des Phönix zu bedienen.«
Der Fhurhur lächelte. Obwohl er seinen Gastgeber noch nicht erkennen konnte, verbeugte er sich. »Auch ich entbiete Euch meinen Gruß, o mächtiger Beliaal, und bitte um Erlaubnis, näher treten zu dürfen.«
»Nur zu!« Die Stimme erinnerte an das Grollen eines Hundes. »Warum sonst habe ich dir den Weg durch das Feuer geöffnet?«
Nach einigen tastenden Schritten gewöhnten sich die Augen des Fhurhurs an die Dunkelheit, und die Konturen des Raumes und der spärlichen Einrichtung traten langsam hervor. Beliaals Thron zeichnete sich als undeutlicher Schattenriss an der Wand gegenüber dem Kamin ab, und der Besucher schritt bedächtig darauf zu. Immer wieder zog er dabei den Kopf ein, um den Krähen auszuweichen, die wie lautlose Luftgeister durch den Raum huschten.
Die Wände des Saals waren fast vollständig kahl und ebenso tiefschwarz wie Decke und Fußboden. Nur an einer Seite erhob sich ein gewaltiger übermannshoher Spiegel. Nicht ein Fenster war zu sehen, denn im Gegensatz zu gewöhnlichen Festungen reckte sich das Schwarze Schloss nicht zum Himmel empor. Es war im Schwarzen Schlund gelegen, der finstersten Stelle des Schattenforstes. Dort ragte es sieben Stockwerke tief in den Grund von Aventerra hinein, und der Thronsaal befand sich im untersten Geschoss. Fenster gab es hier nirgendwo.
Vor dem mächtigen Eingangsportal, gleich neben dem Kamin, kauerte ein seltsames Wesen. Es hatte den Kopf eines Menschen, Rumpf und Beine eines roten Löwen und den Schwanz eines Skorpions – ein Mantikor, wie der Fhurhur von seinem letzten Besuch her wusste. Beliaal hatte das Untier vor vielen Jahren von der Feuerschlange Rygani als Geschenk erhalten. Die Geister, die über den Lauf der Welten bestimmten, hatten Rygani in die Welt der Schatten verbannt, wo sie Taranos, dem Herrscher des Totenreiches, zwölf Monde lang zu Diensten sein musste. Nur für die Dauer eines einzigen Mondes war es Rygani gestattet, sich auf Aventerra aufzuhalten.
Diese kurze Spanne verbrachte sie meistens im Schattenforst und im Schwarzen Schloss, und so hatte sie sich bemüßigt gefühlt, Beliaal ein Gastgeschenk zu machen. Seitdem bewachte der Mantikor den Thronsaal und zerfetzte jedem unerwünschten Eindringling mit seinen spitzen Krallen die Kehle, bevor er ihn mit dem messerscharfen Gebiss zerriss und verschlang – genau wie sein Zwillingsbruder, der draußen vor dem Portal des Schlosses lauerte.
Beliaal hatte Ryganis Geschenk mit großer Freude angenommen. Der mächtige Dämon war zwar der unbestrittene Herrscher der Nacht und galt als unangreifbar. Dennoch war er besessen von der Sorge, jemand könnte das große Geheimnis entdecken, das er in der tiefsten Tiefe seiner Festung hütete.
Aus diesem Grund ließ er das Schwarze Schloss strengstens bewachen. Neben den Mantikoren sicherten unzählige andere Geschöpfe das versteckte Eingangsportal und den Zugang zu den wichtigsten Räumen: die Werwolf-Wache, Dunkeltrolle, Erdvampire und blutrünstige Kopfflügler. Kaum jemandem war es bislang gelungen, ohne die Erlaubnis des Dämons in den lichtlosen Herrschersitz einzudringen. Die wenigen, die es dennoch schafften, zahlten dafür mit ihrem Leben.
Dem Fhurhur lief es bei dem Gedanken kalt den Rücken herunter. Er konnte nur hoffen, dass ihm ein ähnliches Schicksal erspart blieb. Beliaal war berüchtigt für seine Unbeherrschtheit, die selbst vor Verbündeten nicht Halt machte.
In der Mitte des Saals stand eine lange Tafel aus dem schwarzen Holz der Bäume aus dem Schattenforst. Darauf standen zwei fünfarmige Kerzenleuchter, die trotz der Dunkelheit bleich schimmerten. Waren sie etwa aus Knochen gefertigt?
Als habe der Todesdämon den bangen Blick des Fhurhurs bemerkt, spreizte er die mächtigen Fledermausflügel auf seinem Rücken und ließ ein spöttisches Lachen hören. »Keine Angst, dunkler Freund«, fauchte er, während er wie beiläufig mit der fünfschnürigen Peitsche spielte, die er zwischen den spitzen Krallen der rechten Klaue hielt. »Es sind nur die Gebeine harmloser Tiere. Von Rehen und Hirschen, die meine Geschöpfe der Nacht zur Strecke gebracht haben.«
Mit einem tiefen Seufzer wandte Beliaal die Augen zur Decke, wo Myriaden faustgroßer Käfer herumkrabbelten. Ab und an glommen ihre Flügel wie Phosphor, was fast wie ein unheimliches Wetterleuchten aussah. »Dabei ist es mein sehnlichster Wunsch, eines Tages einen Leuchter aus dem Horn der verfluchten Einhornkönigin zu besitzen!«
Der Fhurhur wusste, dass der Herr der Finsternis die Einhörner mehr hasste als alle anderen Geschöpfe Aventerras. Trotzdem schwieg er lieber. In seinem langen Leben hatte er gelernt, dass es unklug war, bei einem Anliegen gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Stattdessen ließ er den Blick über den Thron schweifen, auf dem sich sein Gastgeber fläzte.
Beliaal legte offensichtlich keinerlei Wert auf Äußerlichkeiten. Sein schlichter Sitz war ebenfalls aus dem dunklen Holz der Schattenforstbäume gefertigt. Das gegerbte Fell eines schwarzen Ebers polsterte Sitzfläche und Rückenlehne, während die Armlehnen aus den versteinerten Rippenknochen eines Feuerdrachen bestanden.
Rund einen Meter über dem oberen Ende der Rückenlehne ragte der ausgestopfte Kopf eines schwarzen Einhorns aus der Wand. An dem flammend roten Horn auf dessen Stirn baumelte ein Geschöpf, das einer riesigen Fledermaus ähnelte. Es war ein Kopfflügler. Wie bei diesen Wesen üblich, saß auf dem Fledermausrumpf das Haupt eines gehörnten Wichtes, aus dessen Mundwinkeln spitze Vampirzähne ragten.
Mit einer herrischen Geste deutete Beliaal auf einen Stuhl am Kopfende des Tisches. »Zieh den Stuhl heran und tritt näher. Leiste mir Gesellschaft, dunkler Freund. Auch wenn dein Weg zu mir kaum beschwerlich genannt werden kann, will ich dich gern bewirten, wie es Brauch ist im Schattenforst.« Das entstellte Antlitz zu einem unfrohen Lächeln verzogen, wartete der Dämon, bis der Besucher Platz genommen hatte. »Etwas roten Wein vielleicht? Oder bist du ein ebensolcher Narr wie dein Gebieter Borboron, dass du dergleichen Köstlichkeiten verschmähst?«
»Nein, nein, mächtiger Beliaal«, antwortete das Männchen rasch. »Ich nehme Eure Einladung mit Freuden an.«
Der Dämon legte den Kopf in den Nacken und warf dem geflügelten Wesen über ihm einen raschen Blick zu. »Schwarzschwinge!«, kommandierte er scharf, während er gleichzeitig die Peitsche knallen ließ. »Der Kammerdiener soll uns Wein bringen. Vom besten natürlich, und so rasch wie möglich!«
»Wie Ihr befehlt, Gebieter!«, krächzte der Kopfflügler und flatterte augenblicklich davon.
Der Herr der Finsternis wandte sich wieder dem Besucher zu. »Und jetzt sprich, Diener der Dunkelheit! Was führt dich zu mir?«
»Nur eine bescheidene Bitte, o mächtiger Beliaal.« Der Fhurhur deutete eine Verbeugung an. »Mein Herr Borboron und ich wären Euch sehr verbunden, wenn Ihr uns bei der Suche nach dem Kind des Dunklen Blutes behilflich wäret, von dem in der Uralten Offenbarung die Rede ist.«
Blanker Hohn verzerrte die Monsterfratze. »Dann habt ihr es also immer noch nicht gefunden? Dabei seid ihr doch schon eine halbe Ewigkeit auf der Suche. Selbst dieser Schwarzmagier auf dem Menschenstern, der den Ring der Feuerschlange trägt, dieser Hermann …«
»Hermes Trismegistos«, verbesserte der Fhurhur und zuckte rasch zurück, als fürchte er den Biss der Peitsche.
Der Dämon schien das nicht zu bemerken. »Genau den meine ich«, antwortete er gleichmütig. »Dieser Trismegistos hat mich einst beschworen, damit ich ihm Einblick in die Schrift gewähre.«
»Und?«, fragte der Besucher erstaunt. »Habt Ihr ihm die Bitte gewährt?«
»Nun …« Beliaal nickte versonnen. »Nicht direkt. Ich habe die Uralte Offenbarung noch niemals aus der Hand gegeben und werde das auch in Zukunft nicht tun.«
Der Fhurhur kniff die Augen zusammen. »Aber?«
»Der Magier besaß Ryganis Ring, der ihn als ergebenen Diener der Dunkelheit auswies. Deshalb ließ ich ihn in den Besitz einer anderen verborgenen Schrift gelangen, der ›Bruderschaft der Sieben‹. Darin haben die sieben Urväter der verfluchten Wächter ihr geheimes Wissen festgehalten, das zu großen Teilen der Uralten Offenbarung entspricht.«
»Aber das Kind des Dunklen Blutes hat dieser Hermes dennoch nicht entdeckt?«
»So ist es.« Ein schadenfrohes Grinsen verzerrte Beliaals Miene. »Der Narr hat mit dem geheimen Wissen ebenso wenig anzufangen gewusst wie du!«
Der Fhurhur versuchte, sich den Zorn nicht anmerken zu lassen. »Was ich durchaus verstehen kann, o mächtiger Beliaal«, erwiderte er und verneigte sich erneut. »Die Worte der Uralten Offenbarung sind höchst rätselhaft. Es kommt beinahe einem Glücksfall gleich, sie richtig auszulegen. Das ist auch der Grund, warum ich Euch heute persönlich aufsuche.«
Der Dämon musterte ihn mit höhnischem Blick. »Lass hören!«, bellte er knapp.
»Ich bin mir sicher, dass Ihr das große Geheimnis um das Kind des Dunklen Blutes längst enträtselt habt. Deshalb bitte ich Euch inständig, mich an Eurem Wissen teilhaben zu lassen.«
Ein hintergründiges Lächeln spielte um die Lippen des Dämons. »Jeder muss die großen Mysterien selbst ergründen – so besagt es das Gesetz des Lebens, das für alle Geschöpfe unter der Sonne gleichermaßen gilt, ob Gefolgsmann der Dunkelheit oder Diener des Lichts.« Beliaal kniff die Augen zusammen. »Warum also sollte ich dir diese Mühe ersparen?«
Der Fhurhur schluckte. Wenn er den Herrscher der Nacht nicht zur Mithilfe überreden konnte, waren die Tage seines Gebieters Borboron mit Sicherheit gezählt – und damit auch die seinen! Furcht stieg in ihm auf, aber er rang sich ein Lächeln ab. »Das will ich Euch gern erklären«, hob er an, als sich der Kammerdiener näherte.
Es war eine hagere menschenähnliche Gestalt mit totenbleichem Gesicht und feuerrotem Haar. Er trug ein Tischchen, auf dem zwei Kelche und eine Karaffe standen, stellte es neben dem Thron ab und verbeugte sich tief. »Der Wein, mein Gebieter«, krächzte er mit heiserer Stimme.
»Schon recht, Konrad«, knurrte Beliaal ungeduldig. »Und jetzt verschwinde!«
Erneut dienerte die Gestalt und zog sich dann ebenso lautlos zurück, wie sie gekommen war.
Der Dämon blickte den Besucher an und deutete auf das Tischchen. »Bedien dich! Und schenk mir ruhig auch ein Glas ein.«
Der Fhurhur tat, wie geheißen. Dann hob er seinen Kelch und nahm einen Schluck. Obwohl der Wein entsetzlich schmeckte, leicht süßlich und mit einem metallischen Nachgeschmack, verzog er keine Miene. »Wie Ihr sicherlich wisst«, erklärte er, »hat mein Gebieter unlängst eine empfindliche Niederlage gegen Elysion, diesen Hund des Li…«
Mit einer herrischen Geste schnitt Beliaal ihm das Wort ab. »Das ist mir schon bekannt«, sagte er gelangweilt und tat einen tiefen Zug aus seinem Pokal. »Den Geschöpfen der Nacht, die mir zu Diensten sind, bleibt nichts verborgen, und sie haben mir längst davon berichtet. Aber was geht mich der Kampf an, den Borboron gegen die Krieger des Lichts führt?«
»Nun …« Der Fhurhur lächelte. »Ist es nicht Euer größtes Bestreben, Euer dunkles Reich auch auf den lichten Tag auszudehnen?«
»Natürlich«, stieß Beliaal hervor. Seine Augen funkelten, während er die Peitsche ein weiteres Mal knallen ließ. »Ich kann den Tag gar nicht erwarten, an dem das Horn der Hölle den Tod der Einhörner und die Herrschaft der Finsternis verkündet. Diese Stunde wird kommen, so wahr ich Beliaal heiße!« Eine Mischung aus grenzenloser Gier und ohnmächtiger Wut zeichnete die Dämonenfratze. Seine Fledermausflügel zuckten wütend. »Ich werde die Einhörner aus dem Karfunkelwald vertreiben, und dann wird mich niemand mehr aufhalten können!«
»Das wünsche ich Euch von Herzen. Und dennoch …« Der Fhurhur hielt inne und nippte an seinem Wein. Er wollte Zeit gewinnen, um seine Worte sorgfältig abzuwägen. Der Herr der Finsternis war unberechenbar. Eine einzige falsche Bemerkung konnte ihn in rasenden Zorn versetzen. Bedächtig fuhr der Schwarzmagier fort: »Ihr wisst doch, dass die Einhörner die reinsten Geschöpfe des Lichts sind und weder Ihr noch wir ihnen etwas anhaben können.«
»Natürlich weiß ich das!«, grollte der Dämon aus tiefer Kehle. »Ich mache schließlich schon seit Jahrhunderten Jagd auf sie!«
»Die Zauberkräfte der Einhörner waren niemals größer als im Augenblick. Denn unsere Gegner sind uns weit überlegen, und die Macht des Lichts ist so gewaltig wie nie zuvor. Wenn sich daran nichts ändert, werdet Ihr die Einhörner niemals aus dem Karfunkelwald vertreiben können.«
»Wie auch immer«, knurrte der Dämon unwirsch. »Ich werde schon einen Weg finden.« Der Klang seiner Worte verriet jedoch, dass er davon selbst nicht mehr überzeugt war.
»Nichts gönne ich Euch mehr!« Ein listiges Lächeln schlich sich auf die schmalen Lippen des Fhurhurs. »Aber dazu benötigt Ihr die Hilfe eines unschuldigen Wesens, eines Menschenkindes. Das Schicksal der Einhörner liegt allein in der Hand der Menschen, wie die Uralte Offenbarung uns ebenfalls kundtut.«
»Als ob ich das nicht selber wüsste!«, erwiderte Beliaal ungehalten. »Sonst hätte ich doch kaum versucht, dieses Mädchen in meine Gewalt zu bringen. Und um ein Haar wäre es mir sogar gelungen! Das Horn der Hölle hatte bereits den ersten Ton geblasen, aber dann …« Erneut ließ der Zorn seine Augen aufleuchten, höllisch rot und schwefelgelb. Dann beugte er sich vor, bis seine Nasenspitze nur noch eine Handbreit vom Gesicht des Fhurhurs entfernt war. »Sieh dich bloß vor, du elender Wurm! Wenn du gekommen bist, um dich über mich lustig zu machen und mich an die schlimmsten Stunden meines Lebens zu erinnern, dann rufe ich auf der Stelle die Werwolf-Wache herbei, damit sie sich deiner annimmt!«
Der Fhurhur zuckte zurück, aus Angst und weil ihm der beißende Schwefelatem des Dämons Übelkeit verursachte. »Nein, nein, großmächtiger Beliaal!«, beteuerte er rasch. »Das lag keineswegs in meiner Absicht. Ich wollte Euch vielmehr einen Vorschlag unterbreiten.«
Beliaal schnaufte heftig. Giftgelber Dampf quoll aus seinen Nasenlöchern, die groß waren wie Pferdenüstern. »Und der wäre?«
»Ihr habt bestimmt schon vernommen, was in der kommenden Mittsommernacht geschehen wird. Ihr verpasst also eine einmalige Gelegenheit, wenn Ihr diese schicksalhafte Stunde ungenutzt verstreichen lasst!«
»Willst du mir Lehren erteilen, du Wicht?« Erneut entströmte eine Wolke aus schwefeligem Dampf der platten Nase des Dämons. »Komm endlich zur Sache oder verschone mich mit deinem Geschwätz!«
Der Fhurhur triumphierte: Kein Zweifel, er hatte Beliaals Interesse geweckt. Der Dämon hatte den Köder geschluckt! »Mein Gebieter schlägt Euch folgenden Handel vor: Ihr offenbart uns dieses Kind des Dunklen Blutes, und wir spielen Euch ein Wesen vom Menschenstern in die Hände, das Euch in der Mittsommernacht zum Sieg über die Einhörner verhilft!«
Der Todesdämon musterte seinen Besucher zweifelnd. »Und wie wollt ihr das anstellen?«
»Das lasst nur meine Sorge sein, o mächtiger Beliaal.« Der Fhurhur erhob sich, machte einen Schritt auf den Dämon zu und streckte ihm die rechte Hand entgegen. »Schlagt ein, mächtiger Herrscher der Finsternis! Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen.«
Während Mr Cool noch einige Runden durch den weitläufigen Park von Burg Ravenstein drehte, brachte Lukas sein Rad in den Fahrradkeller und schloss es dort an. Als er wieder nach draußen hastete, stieß er mit einem kräftigen Mann zusammen, einem grobschlächtigen Burschen mit massigem, völlig kahlem Schädel. Der Mann hatte übermäßig lange Arme und er hielt einen altertümlichen Reisigbesen in den Pranken, mit dem er das Kopfsteinpflaster des Burghofs fegte.
»Ho, ho, Lukas«, beschwerte sich Attila Morduk, der Hausmeister des Internats. Sein gutmütiges Grinsen verriet, dass er es nicht allzu ernst meinte. »Immer sachte mit den jungen Pferden. Oder bist du etwa auf der Flucht?«
»Sorry, Attila«, rief der Junge ihm über die Schulter hinweg zu. »Ich hab leider keine Zeit.« Während der letzte der Zwergriesen ihm kopfschüttelnd hinterhersah, überquerte Lukas den verlassenen Hof und eilte auf die Freitreppe zu, die zum Eingangsportal führte.
Als Lukas die geflügelten Steinlöwen passierte, die wie zwei stumme Wächter an den äußersten Rändern der ersten Stufe standen, hielt er verwundert an. Die vermeintlich leblosen Kreaturen konnten durch die Wächter und ihre Verbündeten zum Leben erweckt werden und sie hatten Laura und ihm als Flugtiere schon manch wertvollen Dienst erwiesen. Heute wirkten Latus und Lateris, wie die beiden Löwen genannt wurden, ungewöhnlich besorgt und schienen grimmiger dreinzublicken als üblich. War das ein Zeichen, dass Lukas’ Schwester tatsächlich in Gefahr schwebte? Oder war es nur seine eigene Sorge um Laura, die ihn irrtümlich zu dieser Annahme verleitete?
Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend hastete der Junge weiter. Er sprang die Stufen hinauf, nur um gleich darauf erneut innezuhalten und einen Blick auf die massige Steinsäule zu werfen, die neben der Treppe aufragte. Sie war in der Gestalt eines Riesen gehalten und trug das weit ausladende Vordach, das sich über die Stufen spannte. Genau wie die Löwen war auch die Säule aus den Steinen des aventerrischen Scheinsteingebirges gehauen. Deshalb konnte auch sie von den Wächtern zum Leben erweckt werden, um diesen als reimender Riese Reimund Portak zu Diensten zu sein.
Lukas blinzelte und starrte forschend in das gutmütige Gesicht des Giganten. War Portaks Miene nicht anders als sonst? Schauten seine freundlichen Augen diesmal nicht eher sorgenvoll drein? Und wirkte der verschmitzt lächelnde Mund heute nicht bekümmert? War auch das ein schlechtes Omen oder nur eine weitere Sinnestäuschung?
Lukas eilte weiter und betrat die Burg durch das große Portal. In der Eingangshalle, wo die Flure zu den Unterrichtsräumen abgingen und zwei Treppen zu den anderen Stockwerken des viergeschossigen Gebäudes führten, befiel ihn die gleiche Irritation wie schon zweimal zuvor. Auf dem riesigen Ölgemälde gegenüber dem Eingang sah man eine hübsche junge Frau im weißen Gewand. Silva hatte zu Lebzeiten des Reimar von Ravenstein schrecklich unter dem grausamen Ritter leiden müssen. Und heute erschien Silvas Gesicht Lukas weit blasser als üblich. Zudem sah sie so unsagbar traurig drein, dass ihm ganz weh ums Herz wurde.
Sorgte auch die Weiße Frau sich um Laura? Oder lag das nur am schummrigen Zwielicht, das in der Halle herrschte, weil der geizige Hausmeister nicht eine Lampe mehr als unbedingt nötig eingeschaltet ließ? Doch weder Silva beantwortete die stumme Frage des Jungen noch der mächtige schwarze Wolf, der zu ihren Füßen lag.
Alienor spähte zum wolkenlosen Himmel, der sich wie ein Zelt aus blauer Seide über die Welt von Aventerra spannte. Die Sonne stand im Zenit und leuchtete und funkelte so prächtig, als wolle sie Zeugnis geben von der Kraft des Lichts. War das ein gutes Omen? Oder hatte es nichts weiter zu bedeuten?
Eine Stimme aus dem Hintergrund riss das Mädchen aus den Gedanken: »Was stehst du hier rum und starrst Löcher in die Luft?«
Morwena, die Heilerin von Hellunyat, schaute ihre Elevin vorwurfsvoll an. »Wolltest du nicht erleben, wie man sich der Wissenden Dämpfe bedient?«
»Ja, ja, Herrin, natürlich«, antwortete Alienor rasch. »Ich eile!« Hurtig sprang sie auf und tauchte in die Höhle ein, vor deren Eingang sie gesessen hatte. Ihre dicken blonden Zöpfe hüpften dabei wie aufgeregte Füllen auf und ab.
In der Höhle war es schummrig, obwohl ihre Herrin ein kleines Feuer entzündet hatte. Die Rauchwolken, die durch die enge Felsenkammer wehten, nahmen Alienor fast den Atem. Zum Glück war sie an den würzigen Geruch gewöhnt, der sich in den Rauch mischte.
Morwena hatte ihr längst beigebracht, welchem Zweck die verbrannten Kräuter dienten: Sie öffneten den Geist der Heilerinnen, damit sie die Botschaft der Wissenden Dämpfe empfingen, bei denen sie seit Anbeginn der Zeiten Rat suchten. Tief aus dem Bauch Aventerras stiegen die Schwaden durch eine schmale Felsspalte empor, um den Eingeweihten ihre Geheimnisse zu offenbaren. Allerdings sprachen sie nur auf rätselhafte und verschlüsselte Weise, sodass es entscheidend darauf ankam, die Vision auch richtig auszulegen. Wurde sie falsch interpretiert, konnte das verhängnisvolle Folgen haben.
Obwohl alle Heilerinnen dieser Aufgabe seit jeher sorgfältig und nach bestem Vermögen nachkamen, hatte es schon des Öfteren Fehldeutungen gegeben. Die Elevinnen wurden daher besonders gewissenhaft auf die edle Kunst der Orakeldeutung vorbereitet, und so hatte auch Alienor ihren ersten Versuch noch vor sich, obwohl sie bereits seit einigen Sommern bei Morwena in die Lehre ging. Doch jetzt war der große Tag endlich da, dem sie seit Wochen entgegenfieberte.
Stunde über Stunde hatte sie den Ausführungen und Anweisungen ihrer Lehrmeisterin gelauscht und versucht, sich jedes Wort genau einzuprägen. Zudem hatte sie Morwena mehrere Male zur Orakelhöhle begleitet, die in einem kleinen Seitental der Dusterklamm gelegen war. Alienor erinnerte sich, was das Ritual bei ihrer Lehrmeisterin bewirkt hatte.
Mitunter war ein Leuchten über Morwenas Antlitz gegangen, und manchmal hatte sich ihr Gesicht vor Schmerz verzerrt. Einmal – ein einziges Mal nur! – hatte die Heilerin laut aufgeschrien und war gleich darauf aus der Trance hochgeschreckt. Sie musste eine schlimme Botschaft empfangen haben, denn auf die entsprechende Frage ihrer Elevin hatte sie nicht geantwortet – bis zum heutigen Tage nicht.
All das ging Alienor nun durch den Kopf, während sie den letzten Anweisungen ihrer Lehrmeisterin lauschte.
»Hab keine Angst.« Morwena wollte ihr Mut zusprechen. »Mach alles genau so, wie ich es dir erklärt habe. Vertrau auf die Kraft des Lichts, dann wird es dir auch gelingen.«
»Natürlich, Herrin.« Alienor versuchte, ihre Anspannung hinter einem Lächeln zu verbergen.
»Und noch eins!« Mahnend hob die Heilerin den Zeigefinger. Die Flammen des Feuers zuckten und das Wechselspiel von Licht und Schatten irrlichterte in Morwenas kastanienbraunem Haar. »Denk stets daran: Es ist durchaus möglich, dass das Orakel stumm bleibt. Die Wissenden Dämpfe lassen sich nicht zu einer Botschaft drängen. Wer ein Orakel zu erzwingen sucht, dem werden sie sich verweigern – oder ihn in die Irre führen, was eine große Gefahr darstellt! Öffne dich also der Macht des Lichts und lass es einfach geschehen. Hast du verstanden, Alienor?«
»Ja, Herrin«, antwortete das Mädchen. »Dann mach dich bereit.«
Alienor sah die Heilerin ein letztes Mal an, dann setzte sie sich neben die Felsspalte, der ein gelblicher Dampf entströmte. Sie schloss die Augen. Den Orakelgesang kannte sie längst auswendig und er kam wie von allein über Alienors Lippen. Sie ließ den würzigen Rauch des Feuers in ihre Nase steigen und öffnete sich den schwefeligen Dämpfen aus der Erde. Ohne dass sie es merkte, beschleunigte sich der Fluss ihrer Worte. Die Bewegungen des schlanken Mädchenkörpers wurden schneller und schneller, bis er sich wie ein Halm im Wind sacht hin und her wiegte.
Doch Alienor nahm von all dem längst nichts mehr wahr. Sie war in Trance versunken. Weder die Heilerin noch die Höhle hatten noch Platz in ihrem Kopf. Bilder drifteten durch ihre Gedanken, schwerelos und wie von weit her. Zunächst noch undeutlich und verschwommen, dann immer klarer, zeigten sie ihr einen geheimnisvollen Wald. In ihrem ganzen Leben hatte die Elevin noch keinen vergleichbaren gesehen. Dann erblickte sie eine verzauberte Lichtung mit einem verwunschenen See. Auf seiner Oberfläche spiegelten sich zwei Monde, rund und prall, glänzend golden der eine, strahlend blau der andere. Am Ufer des Sees aber stand eine stolze Einhornstute mit einem Füllen, das sich an ihren Bauch schmiegte.
Ein verzaubertes Lächeln schlich sich auf Alienors Gesicht, doch sie merkte es gar nicht. Morwena, die abwartend neben ihrer Elevin saß und sie ständig beobachtete, gewahrte es wohl. Sie empfand ein tiefes Glücksgefühl, denn die entrückte Miene der Schülerin bewies eindrucksvoll, dass die Wissenden Dämpfe dem Mädchen eine Botschaft übermittelten. Beim ersten Versuch kam das höchst selten vor, und so war es ein weiterer Beweis für das große Talent, das in Alienor schlummerte.
Während die Heilerin ihre Elevin noch voller Stolz betrachtete, verzerrten sich Alienors anmutige Gesichtszüge mit einem Male zu einer Fratze der Furcht. Ihr schmächtiger Körper bebte so heftig, als werde er von schweren Krämpfen geschüttelt, dann erstarrte sie und sank in sich zusammen. Hätte Morwena nicht gedankenschnell die Arme ausgebreitet und Alienor aufgefangen, wäre sie mit dem Kopf auf den felsigen Boden geschlagen.
Kapitel 3Das Labyrinth des Lichts
Das Internatszimmer, das Laura zusammen mit Kaja Löwenstein bewohnte, befand sich im dritten Stock des Hauptgebäudes. Als Lukas zur Tür hereinstürmte, saßen die beiden Freundinnen an der großen Tischplatte vor dem Fenster, die ihnen als gemeinsamer Schreibtisch diente. Kaja war in ein Schulbuch vertieft, während Laura eine SMS schrieb.
»Hey! Was sind denn das für Sitten?«, rüffelte Laura ihren Bruder. Ihr hübsches Gesicht, das von einer blonden Haarmähne umrahmt wurde, verfinsterte sich und sie legte das Handy zur Seite. Ihre blauen Augen funkelten grimmig. »Klopf beim nächsten Mal gefälligst an!«
»Genau!«, empörte sich auch Kaja. »Du konntest doch nicht wissen, dass wir Hausaufgaben machen. Wir hätten uns genauso gut gerade umziehen können.«
Lukas lag schon eine spöttische Erwiderung auf der Zunge, doch er besann sich eines Besseren. Der rüde Anpfiff deutete darauf hin, dass die beiden Mädchen im Augenblick nicht zum Scherzen aufgelegt waren. »Sorry«, sagte er deshalb rasch. »Tut mir aufrichtig leid. Ich hab’s in der Eile einfach vergessen. Es soll nicht wieder vorkommen.«
»Das möchte ich dir auch geraten haben!« Laura wirkte immer noch verstimmt. »Was willst du von uns?«
»Äh …«, stammelte der Junge. »Ich … Ich hab ein Problem.«
»Ein Glück, dass du das endlich einsiehst!«, kommentierte Laura spitz und feixte übers ganze Gesicht. »Aber das ist ja nicht erst seit heute so, sondern schon viel länger.« Sie drehte sich ihrer Freundin zu. »Hab ich nicht recht, Kaja?«
Auch das Mädchen mit den roten Korkenzieherlocken verzog das sommersprossige Gesicht zu einem breiten Grinsen. »Und wie!«, bestätigte sie. »Aber vielleicht können wir ihm ja helfen?«
»Das könnt ihr in der Tat.« Lukas tat, als hätte er die frechen Anspielungen nicht verstanden. »Ich … Äh … Ich knobele gerade an einem Preisrätsel in meinem Wissenschaftsmagazin …«
»Und was haben wir damit zu tun?«, unterbrach ihn Laura.
»Genau!«, pflichtete Kaja ihr bei. »Ist doch allein deine Schuld, wenn du dir so was antust.«
Lukas gab ihr einen versteckten Wink: Jetzt halt doch endlich mal den Mund!
Obwohl Kaja nicht zu verstehen schien, was er meinte, verstummte sie. Lukas wandte sich an seine Schwester.
»Es gibt schöne Preise zu gewinnen«, erklärte er. »Die Fragen sind allerdings ziemlich kniffelig. Deshalb wollte ich euch um Rat fragen.«
»Echt?« Laura rümpfte die Nase. »Und du glaubst wirklich, dass wir dir helfen können?«
»Klaromaro! Sonst wäre ich doch nicht hier.«
»Ach, hör auf!« Laura zog die Brauen hoch und winkte ab. »Du machst dich nur lustig über uns!«
Die Reaktion seiner Schwester wunderte Lukas nicht im Geringsten. Er hatte sie bisher selten um Rat gefragt, genau genommen noch nie. Obwohl er ein Jahr jünger war als Laura und auch eine Jahrgangsstufe unter ihr, wusste er viel mehr als sie. Seinen Altersgenossen war Lukas ohnehin um Längen voraus. Aufgrund seiner überragenden Intelligenz und seines unstillbaren Wissensdurstes konnten ihm in manchen Fachgebieten, wie zum Beispiel Informatik oder Astrophysik, nicht einmal Abiturienten das Wasser reichen. Lukas war klar, dass Laura sich insgeheim über ihn lustig machte und ihn einen »neunmalklugen Schlaumeier« schimpfte. Es war also verständlich, dass sie jetzt befürchtete, auf den Arm genommen zu werden.
»Keine Angst«, versicherte er ihr. »Ich meine es wirklich ernst.«
Laura wirkte immer noch nicht überzeugt. »Wirklich?«, fragte sie mit skeptischer Miene.
Der Junge nickte eifrig.
»Na, gut. Dann schieß los!«
»Also …« Lukas gab vor, nachzudenken, und richtete den Blick zur Decke. Seine Schauspielkünste waren höchst bescheiden, aber Laura schöpfte keinen Verdacht. »In diesem Rätsel wird nach merkwürdigen Sachen gefragt. Nach dem ›Geheimnis von Aventerra‹ zum Beispiel. Oder dem ›Siegel der Sieben Monde‹. Dem ›Orakel der Silbernen Sphinx‹. Dem ›Fluch der Drachenkönige‹ und dem ›Ring der Feuerschlange‹.« Lukas machte einen Schritt auf die Schwester zu. »Hast du eine Ahnung, was das alles bedeuten könnte?«
Laura schaute ihn für einen Moment mit großen Augen an und schüttelte dann den Kopf. »Sorry«, sagte sie, »aber ich hab keinen blassen Schimmer. Was soll das denn sein?«
Super!, jubelte Lukas im Stillen. Sie hat also doch alles vergessen!
Natürlich ließ er sich seine Erleichterung nicht anmerken. »Das weiß ich doch nicht«, antwortete er und tat enttäuscht. »Sonst wäre ich nicht zu euch gekommen.«
»Merkwürdig, dass du auch mal was nicht weißt«, kommentierte Laura trocken. »Andererseits finde ich das im höchsten Maße beruhigend.«
»Beruhigend?« Eine kleine Falte grub sich bis zur Nasenwurzel in Lukas’ Stirn, wie immer, wenn er Zweifel hegte. »Wieso das denn?«
»Weil es beweist, dass du doch nicht so ein neunmalkluger Schlaumeier bist, wie du immer behauptest.« Laura feixte übers ganze Gesicht. »Du hast also keinen Grund, uns immer als Spar-Kius zu bezeichnen.«
Lukas hatte das Schimpfwort für Menschen erfunden, die er für weniger klug hielt als sich selbst – also für fast alle! »Tja«, muffelte er und zuckte scheinbar gelangweilt die Schultern. »Wenn du meinst.«
Laura fiel etwas ein: »Hast du Mama und Papa schon gefragt?«
»Logosibel!« Da er das angebliche Preisrätsel nur aus Sorge um Laura erfunden hatte, schien ihm diese Notlüge ausnahmsweise erlaubt zu sein. »Aber die wissen auch nicht weiter.« Er wandte sich an Kaja. »Und was ist mit dir?«
»Ich?« Kaja hatte inzwischen offensichtlich begriffen, worum es ging, und spielte die Unschuld vom Lande. »Woher soll ich das denn wissen?« Dabei zwinkerte sie Lukas mit verstohlenem Grinsen zu.
Nicht doch! Mit einer raschen Geste bedeutete er ihr, bloß nicht zu übertreiben, damit Laura keinen Verdacht schöpfte.
»Na gut«, sagte Lukas scheinbar niedergeschlagen. »Wenn ihr mir nicht weiterhelfen könnt, dann muss ich mein Glück halt woanders versuchen.«
Er wandte sich ab und ging zur Tür, als seine Schwester ihn aufhielt. »Einen Moment noch«, sagte sie und starrte nachdenklich vor sich hin.
Lukas zuckte erschrocken zusammen. Erinnerte sich Laura etwa doch noch an etwas? Er hielt den Atem an und musterte sie mit banger Miene. »Ja?«
»Könnte es dabei vielleicht um Bücher gehen?«, überlegte das Mädchen laut. »Ich meine, das alles klingt doch verdächtig nach irgendwelchen Fantasy-Romanen. Hast du in dieser Richtung schon nachgeforscht?«
»Nee, hab ich nicht.« Lukas atmete erleichtert aus. »Aber danke für den Tipp!«
In diesem Moment sprang Laura auf und schlug sich gegen die Stirn. »O Mann, das hätte ich beinahe verschwitzt. Monsieur Valiant, der Sportlehrer, wartet ja auf mich. Wahrscheinlich hofft er immer noch, mich überreden zu können.« Damit eilte sie zum Schrank, holte den Anorak hervor und warf ihn über. Nur Sekunden später war sie an Lukas vorbei zur Tür hinaus.
Lukas schaute ihr kopfschüttelnd nach. »Was meinte sie denn damit«, fragte er Kaja. »Wozu will Percy sie überreden?«
»Och nö!« Das rothaarige Mädchen machte große Augen. »Sag bloß, das weißt du nicht?«
»Ja, was denn?«, knurrte Lukas ungehalten. »Spuck’s aus!«
»Laura will mit dem Reiten aufhören. Und mit dem Fechten auch!«
»Waaas?« Fassungslos riss Lukas die Augen auf, bis sie fast so groß waren wie Untertassen. »Das glaub ich einfach nicht!«
»Es stimmt aber trotzdem!« Kaja nickte heftig. »Tja, Lukas, seit deine Schwester auf ihre außergewöhnlichen Gaben verzichten musste …«
»Sie musste nicht«, unterbrach Lukas sie. »Sie hat es freiwillig getan!«
»Okay, okay.« Kaja verdrehte die Augen. »Jedenfalls hat sie sich seitdem ziemlich verändert. Und ich fürchte …« Sie machte eine kleine Pause, als überlege sie, ob sie ihren Verdacht wirklich aussprechen sollte. »… dass es noch viel schlimmer werden wird!«
Für einen Augenblick herrschte Stille. Nur ein weit entferntes Krächzen war zu hören, während die beiden Freunde nachdenkliche Blicke tauschten.
»Aber jetzt mal zu dir«, fuhr Kaja schließlich fort. »Was sollte denn die komische Nummer eben?«
Lukas tat überrascht. »Was meinst du?«
»Deine blöde Fragerei natürlich.« Die roten Locken wippten aufgeregt. »Nach Aventerra, dem Siegel der Sieben Monde und so weiter. Was hast du denn damit bezweckt?«
»Ach so«, antwortete der Junge gedehnt. »Ich wollte nur sichergehen, dass Laura auch tatsächlich alles vergessen hat.«
»Aber warum?«, fragte Kaja verwundert. »Und wieso ausgerechnet heute?«
Lukas schob die Brille zurück, die ihm auf die Nasenspitze gerutscht war, und knabberte für einen Moment an der Unterlippe, bevor er antwortete: »Weil ich heute den schwarzen Reiter gesehen habe, mit dem damals alles angefangen hat.«
»Was?« Kajas Gesichtszüge entgleisten. »Du meinst diese Spukgestalt, die Laura und Sturmwind verfolgt hat? Am Tag vor ihrem dreizehnten Geburtstag?«
»Genau die!« Der Junge nickte mit ernster Miene. »Aber Laura hat den Reiter damals gar nicht richtig angeschaut, weil sie es mit der Angst zu tun bekam. Und als sie sich endlich umdrehte, war er bereits wieder verschwunden.«
Kaja kniff die Augen zusammen und sah ihn erwartungsvoll an. »Ja und?«
»In meiner Vision vorhin, da habe ich ihn deutlich gesehen.« Lukas machte einen Schritt auf das Mädchen zu. »Es war gar kein Reiter, Kaja«, flüsterte er heiser. »Und auch kein gewöhnliches Pferd.«
Das Mädchen schluckte. »Nein?«
»Nein.« Lukas schüttelte den Kopf. »Es war das entsetzlichste Wesen, das ich jemals gesehen habe: ein Dämon oder so etwas Ähnliches. Und er saß auf einem pechschwarzen Einhorn mit einem flammend roten Horn auf der Stirn!«
»Oh!« Kaja stöhnte entsetzt auf, nur um gleich darauf abzuwinken: »Aber was soll’s? Zum Glück müssen wir uns deswegen keine Sorgen machen. Erstens ist das schon über ein Jahr her, und zweitens ist Laura damals ja nichts passiert. Sie hat nur einen Riesenschreck bekommen, das war alles.«
»Das mag ja durchaus stimmen.« Lukas blickte Kaja mit großen Augen an. »Trotzdem bedeutet das noch lange nicht, dass die Geschichte endgültig ausgestanden ist. Im Gegenteil: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch einiges auf uns zukommt – und besonders auf Laura!«
Der Wächter des Labyrinths blieb stehen und richtete die leblosen Augen auf den Hüter des Lichts. »Wir sind da, Herr«, sagte er und deutete auf die schmale Maueröffnung, aus der gleißende Helligkeit drang.
»Vielen Dank, Luminian«, antwortete Elysion lächelnd. »Du kannst dich zurückziehen. Ich werde dich rufen, sollte ich deine Hilfe brauchen.«
Der Mann mit dem bleigrauen Gesicht verneigte sich und ging davon. Paravain sah ihm nach, bis die schmächtige, in eine weiße Toga gekleidete Gestalt in der Tiefe des dunklen Ganges verschwunden war. Der Weiße Ritter verstand immer noch nicht, wie der Blinde sich so problemlos in dem geheimnisvollen Ganglabyrinth zurechtfand, das tief unter dem Turm der Gralsburg verborgen war.
Der Hüter des Lichts blickte den Anführer seiner Leibgarde tadelnd an. Es war, als habe er die Gedanken des Ritters gelesen. »Ich dachte, ich hätte es dir längst erklärt, Paravain. Nicht die Augen zeigen uns das Ziel. Was wirklich entscheidend ist, kannst du mit ihnen nicht sehen, denn es verbirgt sich meist unter der Oberfläche. Deshalb kann auch ein Blinder zu den Sehenden zählen und ein Sehender zu den Blinden.«
»Ich weiß, Herr«, antwortete der junge Ritter hastig. »Und dennoch kommt es mir jedes Mal wie ein Wunder vor.«
»Wer weiß …« Ein sanftes Lächeln ließ die scharfen Falten im Gesicht des greisen Herrschers ein wenig milder wirken. »Vielleicht ist es das ja auch?« Damit deutete er auf die Öffnung in der Mauer. »Aber jetzt komm. Ich will dir etwas zeigen.« Damit betrat Elysion das Zentrum des Labyrinths, einen kreisrunden Raum, der in überirdischer Helligkeit erstrahlte.
Als Paravain ihm folgte, erging es ihm ähnlich wie im letzten Sommer, als er das Heiligtum des Lichts zum ersten Mal besucht hatte: Er fühlte sich unvermittelt ganz leicht, beinahe schwerelos, als wäre jedes Gewicht der Welt von ihm abgefallen. Er blickte sich um und bemerkte, dass alles noch fast genauso war wie damals.
Das Rad der Zeit, das in die Bodenfliesen eingelassen war. Die Lichtsäule direkt über dessen Zentrum, mit dem von geheimnisvollen Kräften getragenen Kelch der Erleuchtung. Die Rubine und Smaragde, die das wertvolle Gefäß schmückten, leuchteten noch immer in allen Farben des Regenbogens – wenn nicht sogar majestätischer und eindrucksvoller als jemals zuvor. Paravain konnte sich kaum sattsehen.
Eine lange, schmale Nische in der Wand war ebenfalls mit überirdischem Licht geflutet. Während sie bei Paravains erstem Besuch leer gewesen war, schwebte darin nun Hellenglanz, das mächtige Schwert des Lichts. Die Krieger der Gralsburg hatten allerdings wenig Verdienst daran, dass die kostbare Waffe sich wieder im Labyrinth des Lichts befand. Das war vielmehr Laura Leander zu verdanken, die Hellenglanz ausfindig gemacht und unter Einsatz ihres Lebens an den angestammten Platz zurückgebracht hatte.
»Sieh dich in aller Ruhe um, Paravain.« Elysion zeigte mit der rechten Hand in die Runde. »Und dann sage mir, ob es hier noch Platz für ein zweites Schwert gibt.«
Der junge Ritter schwieg. Elysion hatte recht – im Zentrum des Lichts herrschte eine perfekte Harmonie. Jeder weitere Gegenstand hätte das Gleichgewicht gestört. Zudem gab es keine weitere Nische, die ein zweites Schwert hätte aufnehmen können. Und es der zentralen Lichtsäule anzuvertrauen, war schlichtweg undenkbar. Sie war dem Kelch der Erleuchtung vorbehalten.
»Unsere Vorväter haben das Labyrinth des Lichts vor unzähligen Generationen errichtet«, erklärte Elysion, ohne die Antwort des Ritters abzuwarten, »und seine Gestalt und Ausstattung dabei wohl durchdacht. Vor dem Bau haben sie die Geister, die über den Lauf der Welten bestimmen, um Unterstützung angefleht, und dank ihrer Weisheit bekam das Labyrinth schon damals seine heutige Form. Seitdem ist es unser größtes Heiligtum und gleichzeitig die wichtigste Quelle unserer Kraft, aus der wir alle schöpfen – vorausgesetzt, sein Gleichgewicht wird nicht gestört. Oder erinnerst du dich nicht mehr an die Zeiten, als Borborons Schwarze Krieger den Kelch der Erleuchtung entwendet hatten?«
»Wie könnte ich das vergessen, Herr?« Ein grimmiges Lächeln umspielte die Lippen des Ritters. »In der Folge konnten wir uns ihrer Angriffe kaum mehr erwehren, und es hätte nicht viel gefehlt, und Ihr selbst wärt dem Bösen zum Opfer gefallen.«
»Genau so ist es, Paravain!« Das Licht des Labyrinths ließ das graue Haar und den Bart des Herrschers silbern glänzen. »Seit Hellenglanz sich an seinem alten Platz befindet, hat die Waage des Schicksals sich erneut auf unsere Seite geneigt. Glaubst du also immer noch, das Labyrinth wäre der richtige Ort, um das Dunkle Schwert Pestilenz aufzubewahren?«
»Nun …« Der Ritter zögerte mit der Antwort. Vor rund drei Monden, als Elysion den Schwarzen Fürsten auf wundersame Weise im Zweikampf besiegen konnte, hatte Paravain das Schwert des Dunklen Herrschers an sich genommen, das der Feind an der Stätte seiner schändlichen Niederlage zurücklassen musste. Seither sann er darüber nach, was mit Pestilenz geschehen sollte, und so hatte er seinem Gebieter vorgeschlagen, es dem Labyrinth des Lichts anzuvertrauen. Nicht weil er glaubte, das schreckliche Schwert könne ihnen zusätzliche Kräfte verleihen – ganz bestimmt nicht! Paravain wollte lediglich sicherstellen, dass das schwarzmagische Schwert nie wieder in die Hände ihrer Feinde fiel. Und das Labyrinth des Lichts war der sicherste Ort auf der Gralsburg.
Niemals wieder würde es einem Unbefugten gelingen, dort einzudringen. Dafür sorgten nicht nur Luminian, der blinde Wächter des Labyrinths, sondern auch die doppelten Posten, die seit jenem dreisten Diebstahl ständig vor dem Eingang Wache standen.
»Ich weiß, was dein Herz bewegt«, erklärte Elysion. »Du sorgst dich um die Sicherheit. Doch selbst, wenn hier drin noch Platz wäre für das Dunkle Schwert, könnten wir es in dieser Kammer nicht aufbewahren.«
»Aber warum denn nicht, Herr?«
»Weil seine schwarzmagischen Kräfte das Labyrinth des Lichts entweihen würden, Paravain! Damit wäre nicht nur unser Ende besiegelt, sondern auch das des Menschensterns.«
Der Weg von Burg Ravenstein zum Bauernhof von Nikodemus Dietrich war nicht weit. Selbst mit Monsieur Valiants klapprigem Peugeot dauerte es nicht länger als fünf Minuten, bis der Wagen die Landstraße verließ und in den schmalen Fahrweg einbog, der zu dem einsamen Gehöft führte. Weit und breit waren keine anderen Häuser zu sehen.


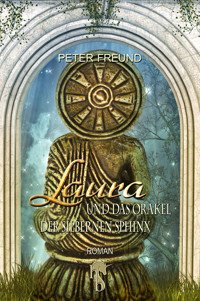















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










