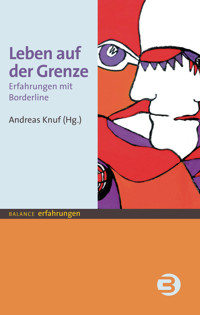
Leben auf der Grenze E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind für Außenstehende schwer zu verstehen. Ihr Verhalten wirkt »verrückt«, löst Befremden aus und macht Angehörigen und Freunden Angst. Dagegen hilft nur ein besseres Verständnis. Und das schafft dieses Buch: Zwanzig Menschen mit Borderline-Erfahrung, Betroffene und Angehörige, schreiben über ihr Erleben, über ihre Gefühle, über ihren Umgang mit sich und anderen. Dieses Buch ist eine Chance, denn die Texte schaffen Verständnis zwischen Betroffenen und Angehörigen. Und sie machen Hoffnung: Denn sie zeigen, dass Veränderungen möglich sind und dass es gelingen kann, eine neue Haltung sich selbst gegenüber zu gewinnen und liebevoller mit sich, seiner Familie und seinen Freunden umzugehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Knuf
Leben auf der Grenze
Erfahrungen mit Borderline
Andreas Knuf (Hg.): Leben auf der Grenze. Erfahrungen mit Borderline.
3. Auflage 2011, korrigierter Nachdruck 2016
© BALANCE buch + medien verlag GmbH & Co. KG, Köln 2007
Der BALANCE buch + medien verlag ist ein Imprint der Psychiatrie Verlag GmbH, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
ISBN-ePub 978-3-86739-802-2
ISBN-Print 978-3-86739-003-3
ISBN-PDF 978-3-86739-702-5
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Originalausgabe: Psychiatrie-Verlag, Köln 2002
Umschlagkonzeption: GRAFIKSCHMITZ, Köln unter Verwendung eines Bildes von Barbara Rüesch, Zürich
Satz: BALANCE buch + medien verlag, Köln
Homepage: www.balance-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Herausgeber
Impressum
Sind alle Borderliner schrecklich?
WAS IST EIGENTLICH LOS MIT MIR?
Die unerklärbare Krankheit • Christiane
Fühlen und Handeln – Was ist »Borderline«?
Risse in Spiegeln • Ivy Anger
ALLTAG IM CHAOS DER GEFÜHLE
Die Diamanten der Seele • Katharina Reith
Die Angst und das Leben mit ihr • Mark Tiek
Kinderwünsche und die Belastungsproben • Regine Schaub
Im zehnten Jahr • Anonymus
Chance vertan – meine erste große Liebe • Tom
Free Jazz im Kopf • Jenny & Co.
HILFEN
Der Weg ins autonome Leben • Cindy
Arztgespräche • Heike Marie Lohse
Ein rasantes Auf und Nieder – Therapien • Angelika Pauly
Drei Geheimnisse …… die ich meinem Therapeuten nie verraten würde • Lisa
Ein neuer, passenderer SchuhErfahrungen mit einer Selbsthilfegruppe • Konrad
NachwortDas Schillern des Abgrunds oder eine ganz normale Krankheit • Andreas Knuf
Informationen
Autorinnen und Autoren
Der Herausgeber
Sind alle Borderliner schrecklich?
Vor fast 15 Jahren, als Psychologie-Student, hätte ich dieses Buch gebraucht. Damals versuchte ich zu verstehen, was es mit der Borderline-Erkrankung auf sich hat. Aber statt zunächst Erfahrungsberichte zu lesen, lernte ich Diagnosekriterien auswendig und verstand: gar nichts. Nein, das stimmt nicht ganz, denn ich verstand zumindest so viel, dass mir diese Krankheit zunehmend mysteriöser erschien; auch erfahrene Therapeuten hatten mir nicht nur einmal die Empfehlung gegeben, mich vor Borderlinern in Acht zu nehmen. Das aber wollte ich ganz und gar nicht und so entstand mein Wunsch, eine Ahnung davon zu bekommen, was Menschen mit Borderline-Identität erleben, warum sie auf ihre Art handeln und was ihnen vielleicht etwas mehr Boden unter den Füßen geben könnte. Daraus erwuchs die Idee, Schilderungen von betroffenen Menschen zusammenzutragen, um zunächst jene zu Wort kommen zu lassen, die genau wissen, worüber sie schreiben, weil sie es selbst erlebt haben.
Zwanzig betroffene Menschen berichten in diesem Buch, was Borderline-Erleben für sie konkret bedeutet und wie sie mit, trotz oder gerade wegen ihrer psychischen Probleme (über)leben. Manchmal ist es ein ziemlich hartes und mühsames Leben, manchmal aber auch von einer tiefen Freude, wie sie vielen Menschen nur selten zuteil wird.
Insgesamt hatte ich in der eineinhalbjährigen Arbeit zu diesem Buch mit etwa 100 betroffenen Menschen und mit zahlreichen Angehörigen Kontakt. Die meisten lernte ich über Mailinglisten und Kontaktforen im Internet kennen, einige über Mundpropaganda und Zeitschriftenanzeigen. Manchmal war die Arbeit an diesem Buch ganz schön anstrengend: Da hatte ich mühsam jemanden für einen bestimmten Text gewonnen und kurz vor dem Abgabetermin erhielt ich die Nachricht, es gehe ihm gerade sehr schlecht, er versinke im Chaos und mit dem Text habe er leider noch nicht beginnen können. Alles ging von vorne los. In solchen Augenblicken verfluchte ich alle Borderliner und vor allem mich selbst mit meiner verrückten Idee, eine solche Textsammlung veröffentlichen zu wollen. Dann verstand ich auch, warum es ein solches Buch bisher noch nicht gab. Wenig später erhielt ich aber ganz unerwartet einen wirklich beeindruckenden Text von jemandem, dem ich das Schreiben gar nicht recht zugetraut hatte, und war wieder versöhnt, zumindest bis zur nächsten Absage. So zeigten sich die immer wiederkehrenden Borderline-Schwierigkeiten auch in der Arbeit an diesem Buch: die völlige Begeisterung, der aber auch schnell der Atem ausgehen kann, das Ertrinken im Chaos und die fehlende Wahrnehmung für die eigenen Grenzen. Aber auch die positiven Seiten der Borderline-Persönlichkeit spiegelten sich in der Arbeit wider: die ausgeprägte Kreativität, die beeindruckende Offenheit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, der Wille, etwas zu schaffen.
Borderline ist eine ganz normale psychische Erkrankung, aber sie ist für Außenstehende schwer einfühlbar, und zwar nicht nur für Angehörige und Freunde, sondern auch für viele Fachleute. Deshalb entstehen Missverständnisse. »Alle Borderliner sind schrecklich«, »Die führt sich doch nur auf« – viele Betroffene kennen solche Aussprüche nur zu gut. Sie sind nicht fair, aber sie sind nachvollziehbar. Scheinbar wie aus heiterem Himmel wird aus Freude Verzweiflung, aus Angst Wut, im einen Augenblick noch unbekümmert, fügt sich jemand plötzlich schwere Verletzungen zu. Das wirkt »verrückt«, macht Angst. Gegen diese Angst hilft nur ein besseres Verständnis. Und das ermöglichen die Texte dieses Buches – wer sie liest, kann die Borderline-Sprache besser entschlüsseln. Das ist für Betroffene, Angehörige und Fachleute gleichermaßen hilfreich.
Aber die Texte ermöglichen nicht nur ein besseres Verständnis des Borderline-Erlebens, für mich haben sie auch zwei weitere Botschaften. Zunächst: Du bist nicht allein mit deinem Erleben, anderen geht es ähnlich. Das bringt keine Heilung, aber tröstlich und hilfreich ist es trotzdem. Viele Betroffene haben mir berichtet, wie froh sie waren, als sie erstmals jemanden kennen lernten, der ihr Erleben sofort verstand. Die zweite Botschaft lautet: Veränderung ist möglich, teils mit therapeutischer Unterstützung, teils in Selbsthilfe, oft nur in kleinen Schritten, aber immerhin. Dabei geht es an keiner Stelle um leichtfertige Lösungen, sondern zumeist um eine neue Haltung sich selbst gegenüber, die es möglich macht, liebevoller mit sich und seinen Freunden und Bekannten umzugehen.
Ich möchte mich bei allen Autorinnen und Autoren sowie bei den vielen »Begleitern« dieses Buchprojektes herzlich bedanken, vor allem für das Vertrauen, das sie mir als Fachmann entgegengebracht haben. Mein Dank gilt auch Christiane, die dieses Buchprojekt über längere Phasen kritisch begleitet hat und deren Kommentare mich immer wieder zum Nachdenken gezwungen haben.
Andreas Knuf
Was ist eigentlich los mit mir?
Die unerklärbare Krankheit
Christiane
»Ja, und was ist das, dieses Borderline?« Diese Frage wird mir häufig mit einem Unterton des Befremdens gestellt. Unter einer Depression meinen die meisten Leute sich etwas vorstellen zu können, schließlich sei doch jeder mal niedergeschlagen. Magersucht ist seit den Schlagzeilen aus diversen Königshäusern salonfähig und damit weniger exotisch geworden. Auch von der Schizophrenie glauben die meisten Menschen eine Vorstellung zu haben, auch wenn diese möglicherweise nur das medienvermittelte Bild des Sexualstraftäters enthält, der im Anfall geistiger Umnachtung Frauen oder Kinder ermordet, und zwar mit dem Ergebnis, als nicht schuldfähig in die Psychiatrie eingewiesen zu werden.
Über meine Erkrankung machen sich die Medien noch nicht einmal Gedanken. Zwar gibt es hin und wieder Sendungen zum Thema Suizidalität und in diesem Zusammenhang werden auch Selbstverletzungstendenzen hervorgehoben, aber die Erkrankung Borderline-Störung wird dabei nicht thematisiert, obwohl ich denke, dass ein Zusammenhang in vielen Fällen auf der Hand liegt. Als ich in der Erwachsenenpsychiatrie das erste Mal die Diagnose »Borderline-Störung« bekam, war ich vor allem beleidigt. Das Einzige, was ich mir unter dieser Störung vorstellen konnte, war das Verhalten einer ehemaligen Mitpatientin aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die hin und wieder Aggressionen an ihrer Umgebung ausließ, indem sie sich beispielsweise mit dem Pflegepersonal der Station prügelte. Sie war »borderline«.
So sollte ich nun also auch sein?! Diese Einschätzung meines behandelnden Arztes ging mir entschieden zu weit. Ich konnte und wollte keine Parallelen zwischen dieser Patientin und mir sehen, auch wenn ich sie durchaus nicht unsympathisch fand und wir uns in vielen Dingen sicher äußerst ähnlich waren.
Einige Tage ärgerte ich mich über diese Diagnose, dann äußerte ich dem Arzt gegenüber meinen Unmut. In der Visite erfuhr ich mehr über meinen neuen »Stempel«. Das Verhalten der Patienten mit dieser Krankheit sei sehr unterschiedlich, erklärte er mir, und nicht jeder gehe aggressiv auf sein Umfeld los, es gebe auch Patienten, die Aggressionen ausschließlich gegen sich selbst richteten. Na, das kannte ich ja von mir selbst. Ich schien also mehr ein »autoaggressiver Fall« zu sein. Vorstellen konnte ich mir unter der Erkrankung allerdings immer noch nicht viel.
Das änderte sich, als ich – unzufrieden mit den ärztlichen Erklärungen – das erste Fachbuch über meine Krankheit las. In diesem Buch wurde mein Verhalten ganz deutlich beschrieben. Heimlich und mit roten Ohren las ich Dinge über mich, die ich niemals anderen gegenüber zugegeben hätte. Ich war erleichtert, dass ich nicht die Einzige zu sein schien, die merkwürdige Wege wählte, um das Leben und den Alltag auszuhalten, aber es war mir auch peinlich, ich fühlte mich ertappt und durchschaut. Woher kannten die Autoren mein Erleben so genau? War ich wirklich ernsthaft krank, wie im Buch beschrieben? Manchmal hatte ich das Gefühl, doch nur ein gigantisches Theaterstück zu spielen, aus dem ich einfach nur aussteigen müsse, wenn ich wollte. Der Psychiatrieaufenthalt schien Teil des großen »Experiments« zu sein, das ich gerade selbst durchführte, ohne das Ziel zu kennen. Vielleicht simulierte ich nur und war eigentlich kerngesund? Ich war sehr unsicher, wo ich eigentlich stand und wie ich selbst zu meiner Erkrankung stehen sollte.
Bis heute gerate ich also immer wieder in die Verlegenheit, erklären zu müssen, was meine Krankheit ausmacht. Üblicherweise möchten meine Gesprächspartner eine kurze Schilderung der Symptome, die sie über alles ins Bild setzt. Beim Versuch, die Borderline-Störung zu beschreiben, stelle ich immer wieder fest, wie unerklärbar diese Krankheit eigentlich ist. Sie lässt sich nicht in zwei Sätzen beschreiben, weil sie zu komplex ist.
Ich wirke zu »normal«, um in das Klischee »verrückt« zu passen, auch wenn es in mir vermutlich »verrückter« aussieht als in den »Normalen«. Wenn ich nach außen auffälliger, richtig »verrückt« wirken würde, komische Dinge täte, wäre es für die anderen vielleicht leichter zu verstehen, warum ich Probleme habe, den Alltag zu bewältigen. Doch auf den ersten Blick bin ich einfach nur unauffällig, eben »normal«. Von Freunden etwa, die mich nach einer Erklärung für die Borderline-Störung fragen, unterscheide ich mich kaum. Das kann die Sache dann noch deutlich verkomplizieren, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Ähnlichkeit Angst macht und Abstand erzeugt. Deshalb muss ich nach »ungefährlichen« Parallelen im Erleben suchen, um meine Gesprächspartner »abholen« zu können, um einen Ausgangspunkt bei der Beschreibung zu haben, mit dem mein Gegenüber etwas anfangen kann. Davon ausgehend, kann ich dann vorsichtig versuchen zu erklären, was mein Erleben von dem Erleben der »Normalen« unterscheidet. Wenn ich nicht missverstanden werden will, muss ich mich in den anderen hineinversetzen und Entgegenkommen zeigen, über meinen Schatten springen und auch ungeschickte oder verletzende Fragen beantworten. Das erfordert eine Menge Toleranz, aber auch Fantasie, weil ich nur Vermutungen über das, was »normales« Erleben bedeutet, anstellen kann. Oft gelingt es mir nicht, anderen zu erklären, wie verletzlich ich bin und wie sehr ich meinen Stimmungsschwankungen unterworfen bin.
Wenn ich keine Lust habe, große Erklärungen über meine Krankheit abzugeben, »oute« ich mich nur als psychisch Kranke. Da ich sehr dünn bin, ist die nächste Frage meines Gegenübers meist, ob ich magersüchtig gewesen sei. Nur die Andeutung eines Nickens erspart mir eine Menge Erklärungen, denn mein Gegenüber meint alles über mich zu wissen. Manchmal ist das ganz praktisch. Reaktionen meiner Umwelt haben mich vorsichtig gemacht, zu meiner Diagnose zu stehen. Bei professionell Tätigen ist mir das gesamte Spektrum der Einstellungen zu dieser Erkrankung begegnet: Interesse an den Symptomen und meinem Erleben wurde ebenso gezeigt wie offene Aggression und Abwertung meiner Person als Personifizierung dieser Störung.
Im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung habe ich gesehen, wie viel Angst das wenig Greifbare der Störung bei Schülern, aber auch bei vermittelnden Lehrern auslöst. Es blieb der Eindruck, dass »Borderliner« mit Vorsicht zu genießen seien. Schlimm genug, denn meine Mitschüler von gestern sind die Therapeuten von heute. Viel hilfreicher hätte ich es gefunden, den Umgang mit der eigenen Angst und Unsicherheit bei der Arbeit mit dieser Patientengruppe zu thematisieren, um zu zeigen, dass eben diese Gefühle auftauchen können, wenn man mit Borderline-Patienten arbeitet. In meinem Kurs wusste zu dem Zeitpunkt keiner, dass ich als »Borderlinerin« gelte, und ich hatte nicht den Mut, mich zu »outen«, weil eigene Erfahrungen grundsätzlich unerwünscht waren. Im Unterricht fühlte ich mich irgendwie wie eine Spionin, die das »feindliche Lager« der »Profis« belauschte, um herauszukriegen, mit welcher Taktik sie die »Borderliner« überlisten wollten.
»Borderliner« zu enttarnen, sie zu überführen, ihnen ihre »Schlechtigkeit« vor Augen zu halten ist eine Einstellung, mit der mir einige Profis begegnet sind. Ich fand das ziemlich unpassend und wenig hilfreich, weil ich selbst immer am meisten unter meinem eigenen Verhalten gelitten habe. Mir ging es jedenfalls nicht darum, die Profis persönlich zu ärgern, sondern sie waren diejenigen, die als Projektionsfläche dienten. Einige waren damit vielleicht überfordert. »Borderline« scheint in Fachkreisen auf jeden Fall oft negativ besetzt zu sein (was mich nach meiner Ausbildung nicht mehr in Staunen versetzt). In einer Ärztezeitschrift habe ich eine Empfehlung gelesen, »Borderliner« sofort weiterzuüberweisen, da sie sehr zeitaufwendig und kostenintensiv seien. Ob das dann die Kosten reduziert, wage ich zu bezweifeln.
Neulich hat mir meine Freundin mal wieder jemanden, den sie extrem schwierig und anstrengend fand, als »borderlinig« beschrieben. Das Wort dient als Abkürzung und soll alles ausdrücken, was zu beschreiben wäre. Ich weiß, was gemeint ist, aber trotzdem bleibt mir das Lachen im Hals stecken.
Ich finde es verletzend, wenn jemand behauptet, dass die Symptome meiner Erkrankung auf jeden zuträfen und die Diagnose immer dann gestellt werde, wenn die Psychiater nicht wissen, wo sie die Patienten einordnen sollen. Ich weiß, dass das nicht stimmt, trotzdem bleibt mir das Gefühl, nicht zur Gruppe der wirklich psychisch Kranken zugerechnet zu werden, sondern nur eine »Verlegenheitsdiagnose« zu haben. Wieder einmal gehöre ich nicht dazu, diesmal bin ich, wie es scheint, nicht psychisch krank genug. Was ist schon meine »Verlegenheitsdiagnose« gegen eine Schizophrenie?
Ich fühle mich persönlich angegriffen und abgewertet, vielleicht weil die Borderline-Störung zwangsläufig Teil meiner Identität ist. Ich glaube, dass es sich bei meiner Diagnose um mehr als nur eine »Krankenkassendiagnose« handelt, die die Abrechnung sicherstellt, aber nichts aussagt. Vielleicht fängt das Erklärungsproblem meiner Krankheit schon damit an, dass die Störung selten sofort klar diagnostiziert wird.
In der Fachliteratur als Grenzstörung zwischen Psychose und Neurose beschrieben, erlebe ich bis heute immer wieder, dass Ärzte oder Therapeuten mir neue Diagnosen zuordnen, obwohl ich die Borderline-Störung selbst als sehr zutreffend für die Beschreibung meiner Problematik halte. Wenn ich mir meine diversen Diagnosen in den Arztberichten ansehe, denke ich, dass sehr gut die verschiedenen Facetten der Krankheit deutlich werden: Anorexia nervosa, latente Suizidalität, Medikamentenabusus, Identitätsstörung, Bulimie, Essstörungen, Panikattacken, akute Suizidalität bei depressiver Entwicklung, Laxantienabusus, Verhaltensstörung, psychogenes Erbrechen, Depression, multiple Suizidversuche, komplexe frühe Störung mit multiplen Symptomen und Beschwerden, multiple Schnittwunden, akute Belastungsreaktion, Psychose, Borderline-Störung, Posttraumatisches Belastungssyndrom, dissoziative Störung und schließlich Borderline-Persönlichkeit mit ausgeprägt autoaggressiver Tendenz bei Drogen- und Tablettenabusus, latenter Suizidalität und Bulimie. So lauten die medizinischen Umschreibungen für mein Erleben.
Ich selbst halte die Borderline-Störung für eine lebensgefährliche Erkrankung. Es hat für mich Zeiten gegeben, in denen ich nicht in der Lage war, meinen Alltag zu bewältigen, ohne eine Überdosis Tabletten oder Rasierklingen bei mir zu haben. Ich habe viele Stunden an Bahngleisen gestanden mit der Überlegung, meinem Leben ein Ende zu setzen. Ich habe versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden und mich zu strangulieren. Der Gedanke, mein Leben beenden zu können, wenn ich das »Spiel des Lebens« nicht mehr aushalte, lässt mich letztlich überleben. Der Einsatz meines Lebens als Fluchtversuch aus der Verzweiflung oder um unbewusst Beziehungen auf ihre Tragfähigkeit zu testen hätte mit einem gelungenen Suizid enden können. Ich weiß, dass ich ohne die Psychiatrie heute nicht mehr leben würde.
Das »Verrückte« an der Beschreibung meines Erlebens der Borderline-Störung ist vielleicht, dass ich mich selbst nie als krank empfunden habe. Daher kann ich auch schwer sagen, ob ich jetzt gesund bin. Ich denke, dass mein Empfinden irgendwie anders war und ist als das der »Normalen«. Was den Unterschied macht, kann ich schwer erklären. Empfinden ist immer subjektiv. Vielleicht bin ich empfindlicher. Nicht »normal« ist wahrscheinlich, dass ich mir ein Leben ohne Angst nicht vorstellen kann. Ich habe wahnsinnige Angst vor Menschen und vor Situationen, in denen ich auf mich gestellt bin. Paradoxerweise bin ich gut an einem Arbeitsplatz, an dem ich den ganzen Tag über ständig neue Patientinnen und Patienten sehe, denen ich die Angst vor dem Erstkontakt nehmen und Sicherheit vermitteln muss. In meinem Freundeskreis gelte ich als kontaktfreudig und erstaunlicherweise gelingt es mir in kürzester Zeit, mit wildfremden Leuten ins Gespräch zu kommen und einiges über sie zu erfahren – und trotzdem habe ich unendlich viel Angst dabei.
Ich lebe mit einer ständigen Verlustangst und habe dabei Angst vor Nähe. Gleichzeitig suche ich mit größter Verzweiflung immer wieder Geborgenheit und Sicherheit. Leider ist das Einzige, was in meinem Leben sicher ist, dass nichts sicher ist. »Stabile Instabilität« nennen »meine« Profis das und für mich ist es eine Beschreibung des Chaos in meinem Innern, das mich immer begleitet. Oft bin ich verzweifelt über meine Stimmungswechsel. Innerhalb von Stunden kann ich von totaler Euphorie in absolute Hoffnungslosigkeit stürzen. Solche Zustände können sich im Lauf eines Tages mehrfach wiederholen und kosten unendlich viel Kraft. Wenn ich mich in einem Gefühlszustand befinde, habe ich keinerlei Zugriff auf anderes Erleben. Wenn ich verzweifelt bin, spüre ich nur die Verzweiflung und habe »vergessen«, dass es jemals wieder anders sein könnte. Geht es mir gut, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mir irgendwann wieder schlecht gehen könnte.
Wenn ich ins Nichts, in die Hoffnungslosigkeit stürze, kann ich meinen Körper nicht mehr spüren. Mein innerer Schmerz ist überwältigend und ich habe das Gefühl, innerlich auszubluten. Es ist fast unmöglich, diesem Gefühl etwas entgegenzusetzen. Um wieder eine Vorstellung von den Grenzen meines Körpers zu bekommen, schneide ich mir mit Rasierklingen die Arme und manchmal den ganzen Körper auf. In der Klinik habe ich oft den Kopf gegen die Wand geschlagen und erst damit aufgehört, wenn mir das Blut übers Gesicht lief. Erst wenn ich den Schmerz spüre, gewinne ich langsam wieder Boden unter den Füßen.
Gerade die Selbstverletzungen sind ein Teil, den ich nur sehr zögerlich und allenfalls in »abgespeckter Version« erzähle, und gerade die Selbstverletzungen sind eigentlich der einzige Teil der Erkrankung, der für Außenstehende sichtbar ist. Die Frage, woher meine Narben stammen, kommt den wenigen Leuten, die sie sehen, weil ich sie vor ihnen nicht verstecke, zunächst noch leicht über die Lippen. Meine Antwort auf diese Frage wird meist mit sprachlosem Entsetzen und nicht ausgesprochenem Ekel aufgenommen. Ich schäme mich unendlich für die Narben auf den Armen, die meine »blauen Flecke auf der Seele« widerspiegeln. Nicht nur meine Schmerzgrenze ist verschoben, auch meine Körpergrenzen kann ich oft nicht wahrnehmen. Deshalb geht es für mich immer wieder um das Thema Grenzen. Besonders deutlich ist dies während meiner Psychiatrieaufenthalte geworden. »Eingesperrt« auf der geschlossenen Station der Erwachsenenpsychiatrie habe ich gegen diese »Gefangenschaft« rebelliert, immer mit der Angst, wirklich in die »Freiheit entlassen« zu werden und den einzigen Rahmen, in dem ich mich in meinem desolaten Zustand orientieren konnte, verlassen zu müssen. Während dieser Zeit war es unendlich wichtig für mich, wenigstens im übertragenen Sinne festgehalten zu werden, auch wenn ich das zu dieser Zeit niemals hätte wahrhaben wollen. So habe ich auch die Fixierung in manchen Situationen als Sicherheit empfunden, weil sie mir eine ganz klare Information über Körpergrenzen und Gehaltenwerden geben konnte. Um gewaltsame Fixieraktionen zu vermeiden, habe ich mit dem Arzt und meiner Bezugsperson eine Absprache getroffen, nach der ich mich melden konnte, wenn ich mich dafür entschieden hatte, mich zu meiner eigenen Sicherheit freiwillig auf dem Bett festschnallen zu lassen. So sehr mich die Fixierungen, die gegen meinen Willen vorgenommen wurden, verletzt haben, so wichtig waren die freiwilligen Fixierungen für mich.
Vielleicht ist es typisch für meine Erkrankung, kontrollieren zu müssen, die Entscheidung für etwas selbst zu treffen. Gerade weil in meinem Leben viele Entscheidungen von anderen für mich getroffen wurden, geht es für mich immer wieder um Selbstbestimmung. Nach außen wirken meine Entscheidungen oft paradox. In der Psychiatrie habe ich viele Verhaltensmuster, mit deren Hilfe ich mein Leben bis dahin bewältigt hatte, noch einmal neu inszeniert. Ich habe »die Puppen tanzen lassen« und mit den Therapeuten »gespielt«, wenn sie mir keine klaren Grenzen aufgezeigt haben. Viele »Profis« waren wütend auf mich, andere hatten viel Verständnis. Ich denke, dass sie das Schwarz und Weiß meines Erlebens sehr genau gespiegelt haben. Wenn ich wieder einmal »erfolgreich« ein Team gespalten hatte, habe ich letztlich selbst am meisten darunter gelitten. Es war für mich die einzige Möglichkeit, meinem Selbsthass und meiner grenzenlosen Hilflosigkeit Ausdruck zu geben.
Ich lebe in einer ständigen Dissonanz. Auf der einen Seite funktioniere ich hundertfünfzigprozentig, andererseits bin ich ein »emotionales Wrack«. Am Arbeitsplatz kann ich Aufgaben zur vollen Zufriedenheit erfüllen, während ich mich gefühlsmäßig in vollkommen unterschiedlichen Altersstufen befinden kann, beispielsweise auf dem Stand eines Kleinkindes. So ist ein Irrtum in Zeit, Ort und Person oft vorprogrammiert und ich brauche unendlich viel Energie, um die Fassade trotz des inneren Chaos aufrechtzuerhalten. Ebenso viel Energie brauche ich, um die Arbeit zu erledigen. Verdränge ich die Gefühlsseite zu lange und gehe beispielsweise im Job ununterbrochen über meine emotionalen Grenzen, breche ich irgendwann vollkommen zusammen, bin nicht mehr in der Lage, Leistung zu bringen, und kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Das passiert dann scheinbar aus »heiterem Himmel«, in Wirklichkeit kündigt sich diese Art der Erschöpfung aber lange Zeit vorher an.
Ich halte eine Menge aus, solange ich es schaffe, Verstand und Gefühle voneinander zu trennen. Das ist ein erstaunlicher Mechanismus, der nahezu perfekt funktioniert, aber gerade das ist gefährlich. Wenn ich nur noch funktioniere, verschafft sich die andere Seite irgendwann Gehör und ich verliere die Kontrolle. Die einzige Chance, die ich habe, ist, Freiräume für die »unreife« Seite in mir zu schaffen, Zeiten zu haben, in denen jegliche Kontrolle über die Außenwelt wegfällt und ich die Konzentration ausschließlich auf meine Innenwelt richten kann. Suche ich mir diese Freiräume nicht, bricht irgendwann das gesamte System zusammen, dann funktioniere ich nicht mehr.
Was meine Erkrankung deutlich kennzeichnet, ist die Gestaltung von Beziehungen. Rückblickend kann ich immer gleiche, typische Beziehungsmuster erkennen. Meine Mitmenschen empfand ich in der Vergangenheit oft entweder als gut oder als böse. Schwarz und Weiß sind die »Farben«, die meinen Alltag auch heute noch weitestgehend bestimmen, wenn ich auch in den letzten Jahren gelernt habe, dass menschliches Verhalten auch für mich in Grautönen wahrnehmbar ist. »Typisch Borderline« ist an mir sicher, dass ich so gut wie kein Vertrauen in andere Menschen haben kann. Aus Angst, fallen gelassen zu werden, verlasse ich beispielsweise therapeutische Beziehungen, wenn ich nur erahne, dass der Therapeut mich an die »frische Luft« setzen könnte, oder wenn die Konfrontationsphase in der Therapie unmittelbar bevorsteht und ich zu dicht an »gefährlichen« Themen bin. Allerdings ist mein Selbsterhaltungstrieb durchaus stark genug, mich vorher nach einer neuen therapeutischen Beziehung umgesehen zu haben, um nicht allein dazustehen, denn Alleinsein würde mich umbringen. Noch heute ist es für mich eine Katastrophe, wenn meine Therapeutin in den Urlaub fährt. Dass ich sie jemals wiedersehen werde, kann ich mir kaum vorstellen, auch wenn mir rational klar ist, dass die nächste Therapiestunde sicher stattfinden wird. Lange Zeit waren Leute, die nicht in Sicht- oder Hörweite waren, für mich nicht existent. Aus diesem Grund konnte ich es nicht ertragen, allein zu sein, weil ich dabei das Gefühl hatte, von allen verlassen, allein auf der Welt zu sein, ohne zu wissen, ob sich dieser Zustand jemals ändern könnte.
Um dieses Alleinsein zu verhindern, besuchte ich teilweise mehrere therapeutische Anlaufstellen parallel. Viele Wochenenden habe ich mit stundenlangen Telefonanrufen beim Krisendienst irgendwie überstanden. Ich war bereit, jedem Profi am Telefon Auskunft über meine Lebens- und Krankengeschichte zu geben. Es war überlebenswichtig für mich, Kontakte zu haben. Das Telefonkabel – für mich die Nabelschnur zur Welt. Viele hielten mich für einen »interessanten Fall« und schon bald habe ich mich nur noch auf meine Krankengeschichte reduziert. Im Rückblick finde ich das erschreckend und es ist mir äußerst peinlich.
Oft war ich wochenlang sozusagen »chronisch suizidal«. Teilweise habe ich nur für die nächste Therapiestunde gelebt. Es gab Orte, an die ich einfach nicht gehen durfte, weil ich genau wusste, dass ich dort der Versuchung, mich umzubringen, nicht würde widerstehen können. Oft ging es während meiner Psychiatrieaufenthalte und später auch in Kontakten mit dem Krisendienst und Therapeuten um stündliche Absprachen darüber, dass ich mich nicht umbringen werde bis zum nächsten Kontakt.
»Meine« Profis haben es nicht leicht gehabt mit mir und mehreren ist unterwegs die Puste ausgegangen. Noch heute ist die Nennung meines Namens für einige ein Reizwort. Während meiner Psychiatrieaufenthalte habe ich mehrere Teams gespalten und mit Vorliebe »dünne Bretter« – Praktikanten oder Schüler – »angebohrt«. Dabei war es erstaunlicherweise so, dass diese oftmals besser als die Profis mit mir klarkamen, gerade weil sie mir mit wesentlich weniger professionellem Abstand, dafür aber mit Neugier und Interesse entgegenkamen. Ich denke, sie boten mir gute Identifikationsmöglichkeiten, da sie meist ungefähr in meinem Alter waren und viele Interessen sich ähnelten. Die Gespräche hatten oft kameradschaftlichen Charakter und ich hatte für kurze Zeit das Gefühl, doch noch mitreden zu können und nicht so weit vom »normalen« Leben entfernt zu sein, wie ich gedacht hatte.
Bis heute ist sicher ein Kennzeichen meiner Erkrankung, dass ich täglich gegen den Wunsch nach Regression anarbeiten muss. Gerne möchte ich mich verkriechen oder fallen lassen, versorgt werden und zwischendurch einmal nicht kämpfen müssen. Oft wünsche ich mich auch jetzt noch in die Psychiatrie zurück, nur um noch einmal die Verantwortung für mich, an der ich manchmal ganz schön schleppe, wenigstens teilweise abgeben zu können. In dem Rahmen, in dem »normale« Menschen sich anvertrauen und fallen lassen, habe ich mich immer unter Kontrolle. Niemals würde ich meinem Alltagsumfeld meine Verzweiflung zumuten. Ich denke, dass Freundschaften nicht unendlich belastbar sind und an meinen inneren Abgründen zerbrechen könnten.
Ich weiß, dass meine Eltern froh sind, dass ich wieder »normal« bin, und wage es nicht, an diesem Bild zu rühren. Meine Krankheit ist zum Tabuthema geworden, wir haben zu Hause niemals darüber gesprochen. Offen miteinander zu reden, über ungefährliche Konversation hinauszugehen, würde bedeuten, dieses Tabu zu brechen. Von meinen Eltern würde dadurch plötzlich verlangt, sich ihrer Verstrickung in meine Problematik zu stellen. Sicher würden Parallelen zwischen uns deutlich und Familienähnlichkeit würde nicht nur in »normalen«, sondern auch in »verrückten« Anteilen sichtbar werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Versuch, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu einer sinnlosen Aneinanderreihung von Schuldvorwürfen wird.
Ich halte mich selbst für die Symptomträgerin eines »verrückten« Familiensystems. Mein Vater hat die Flucht in die Arbeit gesucht, meine Mutter ist ständig krank und mein Bruder hat sich dem direkten Zugriff der Familie entzogen. Als schwächstes Glied in der Kette bin ich am familiären »Wahnsinn« psychisch krank geworden, überfordert mit der Aufgabe, das sensible Familiengleichgewicht in der Waage zu halten. Mit Sicherheit war ich ein problematisches Kind und meine Eltern waren sehr unsicher und hatten Angst, Fehler in der Erziehung zu machen. Daher haben sie mich schon im Vorschulalter bei der Erziehungsberatungsstelle »abgeliefert«, um der alleinigen Entscheidung im Umgang mit mir enthoben zu sein. Für mich ist die Information geblieben, dass man sich bei Problemen an Fachleute wenden sollte. Deshalb sind die »Profis« meine Adressaten.
Vielleicht haben sie weniger Angst vor meinen Abgründen, vielleicht haben sie mehr Abstand, weil sie nicht in mein soziales Umfeld verstrickt sind. Ich bin froh, dort nicht erklären zu müssen, dass mein Leben als »Borderlinerin« anstrengend ist, dass es Dauerstress bedeutet, zwischen sich widersprechenden Gefühlen und rationalen Überlegungen die Balance zu halten. Die Fachleute wissen darum und sind bereit, mit mir die Traurigkeit und Verzweiflung auszuhalten, die ich meinen Eltern niemals zumuten würde, weil wir uns inzwischen viel zu fremd geworden sind. Die hier beschriebenen Facetten meines Erlebens sind mein Versuch zu erklären, was dieses »Borderline« ausmacht. Für mich gehört die Diagnose zu meiner Identität, und ich bin nicht sicher, ob ich damit einverstanden wäre, wenn sie mir genommen würde. Ich weiß nicht, woran ich erkennen könnte, dass ich nicht mehr »borderline« bin. Ich habe gelernt, meine Reaktionen auf Alltagsprobleme mit denen meiner »normalen« Mitmenschen zu vergleichen. Spannend finde ich, dass diese Menschen unterschiedlich reagieren. Personen, die um meine Vergangenheit wissen, erklären mein Verhalten oft als »typisch Borderline«. Die »Unwissenden« bestätigen dasselbe Verhalten als angemessen, erklären oft, dass sie ähnlich gehandelt hätten.
Mein Fazit ist, letztlich meine Vergangenheit so weit wie möglich geheim zu halten, um an den Reaktionen der »Normalen« auf mich ablesen zu können, wie nah ich am »normalen Leben« bin, zu dem ich nie wirklich das Gefühl habe dazuzugehören. »Borderlinerin« zu sein bedeutet für mich Zuschauerin zu sein und mein »Doppelleben« so zu organisieren, dass ich auf der Grenze zwischen meiner Innenwelt und der Außenwelt stehen kann, ohne dass Vergangenheit und Gegenwart durcheinander geraten.
Fühlen und Handeln – Was ist »Borderline«?
Die Borderline-Störung ist eine nur schwer zu fassende Krankheit. Betroffenen fällt es häufig schwer, zu beschreiben, was an ihnen eigentlich »borderline« ist; aber auch Psychologen und Ärzte haben ihre große Mühe damit.
Seit den achtziger Jahren gibt es diagnostische Kriterien, anhand derer Fachleute eine Borderline-Erkrankung diagnostizieren. Mittlerweile gibt es neun solcher Kriterien, von denen mindestens fünf erfüllt sein müssen, um eine »Borderline-Störung« diagnostizieren zu können. Aber auch diese Aspekte klingen in wissenschaftlichen Fachbüchern sehr theoretisch bzw. konstruiert – weit ab vom tatsächlichen Erleben der Betroffenen. Wir haben hier versucht diese wissenschaftlichen Kriterien mit »Leben« zu füllen, indem neun Betroffene ganz konkret von ihrem Erleben und Fühlen berichten.
Diese Diagnosekriterien entstammen dem so genannten Diagnostischen und Statistischen Manual (DSM IV). Sie eignen sich nicht zu einer Selbstdiagnose, denn es sind Erlebnisweisen, wie sie sehr viele Menschen in milder Ausprägung durchaus kennen. Erst ihre Intensität und ihr gemeinsames Auftreten machen sie zu einer Erkrankung.
Gegen die lähmende Taubheit
Katrin
Was aber, wenn jemand nicht allein sein kann?
Ich hatte mehrere Jahre mit diesem Thema zu tun und kann nur sagen, dass es sehr ermüdend war, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld. Wie oft habe ich des Nachts bei einem Freund angerufen und ihm erzählt, dass ich es mit mir allein nicht aushalte.
Fast immer bekam ich dann das Angebot, mit meinem Schlafsack zu ihm kommen zu dürfen, und ich machte mich mit dem Fahrrad in der Dunkelheit auf den Weg. Er erwartete mich meist schon in der Tür und kurz darauf saßen wir zusammen am Küchentisch. Nie war er genervt oder verärgert über die späte Störung. Gleichwohl wusste ich, wie strapazierend meine unangekündigten Besuche sein mussten. Und weil ja Beziehungen nicht endlos belastbar sind, fragte ich mich, wie anstrengend ich denn sein darf? Ich war beschämt, denn ich selbst empfand diese Hilferufe von mir als äußerst rücksichtslos, zumal ich wusste, dass er am Morgen zum Frühdienst rausmusste.
Andernorts war ich nicht selten auf Unverständnis gestoßen, wenn ich mitteilte, die nächste Nacht allein nicht zu überstehen. »Aus dem Alter müsstest du doch allmählich raus sein«, bekam ich hören, und meine Bitte, dort übernachten zu dürfen, wurde abgelehnt. Dabei graute mir ja nicht wie vermutet vor dem Kellergeist oder Ähnlichem.
Aber wie sollte ich erklären, dass ich Angst hatte, mich in mir zu verlieren?
Deshalb und weil ich verhindern wollte, in ein noch stärkeres Abhängigkeitsverhältnis zu rutschen, suchte ich nach einer anderen Überlebensstrategie.
Ein nahe liegender Schritt war es, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Aber auch dort nahmen die Mitbewohner gelegentlich Reißaus, um in Urlaub zu fahren. Zuweilen arbeitete ich dann in der Krankenpflege und schob eine Nachtwache nach der anderen, um mich nicht mit mir auseinander setzen zu müssen.
Ich muss zugeben, das war ein sehr unstetiger Lebenswandel, und ich fand mich bald in einem Zustand völliger Erschöpfung wieder. Zudem handelte es sich bei den erwähnten Beispielen ja auch leider nur um ein Vermeidungsverhalten, das an meiner grundlegenden Problematik nichts änderte. Nach wie vor war ich auf der Flucht vor mir selbst und nirgendwo zu Hause.
Was aber ist am Alleinsein nicht auszuhalten?
Lange fehlte mir der Antrieb, mich mit dieser Frage auseinander zu setzten. Heute habe ich verstanden, dass ich Leben um mich brauchte, wenn schon kein Leben in mir war. Kaum war ich allein, sah ich mich einer dunklen inneren Leere ausgesetzt, einem »Gefühl der Gefühllosigkeit«. Es ist schwer, diesen Zustand zu erklären. In mir wohnte eine lähmende Taubheit, von der mich nur die Anwesenheit anderer ablenken konnte.
Hinzu kommt, dass ich mehrmals erfahren hatte, wie Menschen sich von mir verabschiedeten und nicht mehr wiederkehrten. Damals habe ich den bodenlosen Fall erlebt, wenn keiner da ist, um einen aufzufangen. Noch heute habe ich eine absurde Angst (absurd deshalb, weil ich inzwischen durchaus gute soziale Kontakte habe) vor dem Gefühl des Verlassenseins und fühle mich unverhältnismäßig einsam, wenn ich nur ein paar Augenblicke mit mir allein bin.
Trotzdem war ich lange nicht sehr um menschliche Nähe und Gespräche bemüht, ich wollte lediglich Menschen um mich wissen. Hinderlich, jemanden kennen zu lernen, war nämlich der Gedanke, dass sich dieser Jemand ja doch alsbald wieder von mir abwenden würde. Und erneut diese schmerzlichen Folgen ertragen ... das wollte ich nicht. Deshalb zog ich für mich den traurigen Schluss, mich gar nicht mehr auf andere einzulassen, und brachte mich so um jegliche Art von zwischenmenschlichen Beziehungen. Isoliert und allein unter vielen hielt ich mich dann nachts zunehmend am Flughafen auf, wo noch genug reges Treiben herrschte, um mich zu halten. Ich klammerte mich an die Geräusche in der Wartehalle und fixierte die Lichter auf dem Rollfeld, um mein Gesicht nur nicht in mich kehren zu müssen.
Aber kann man das Alleinsein wieder lernen? Ich behaupte mal, dass es mit Hilfestellungen möglich ist.
Nach dem DSM IV heißt das entsprechende Diagnosekriterium: »Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden«.





























