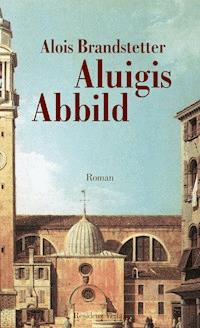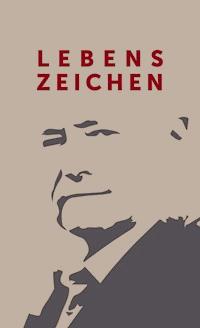Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seiner "Lebensreise" erzählt Alois Brandstetter von seinem Werdegang als 7. Kind eines Müllers und Bauern, das seinen Weg in Wissenschaft und Literatur fand. Doch tritt er diese "Wallfahrt" in die Vergangenheit mit einem Augenzwinkern an: Szenen und Bilder aus seiner Kindheit und Jugend in der oberösterreichischen Provinz wechseln mit humoristischen Betrachtungen des modernen Lebens und Eindrücken oder Begegnungen des begeisterten Lesers Alois Brandstetter. Eine Reise auf den Spuren seines Namenspatrons, des Heiligen Aloysius, gibt den Rahmen für diese sehr persönlichen, lebendig erzählten Erinnerungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Brandstetter
Lebensreise
Wallfahrt,oder Werdegang und Lebenslauf
Wir danken für die Unterstützung
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2020 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
Lektorat: Jessica Beer
ISBN Print 978 3 7017 1735 4
ISBN eBook 978 3 7017 4647 7
Auf der Rückreise von Genua nach Klagenfurt, nach Gastvorträgen an der dortigen Universität, wollte ich vor nun schon über 25 Jahren in Mantua und Castiglione delle Stiviere Station machen, um mich sozusagen an Ort und Stelle mit dem »Lebensraum« meines Namenspatrons Aloysius von Gonzaga vertraut zu machen, über den zu schreiben ich mir schon lange vorgenommen hatte. Dann war aber der Drang nach Hause zu Frau und Söhnen stärker, und ich bin »auf schnellstem Weg« nach Klagenfurt zurückgefahren. Doch aufgeschoben war nicht aufgehoben. Ich bin gewissermaßen reumütig zurückgekehrt und habe im Jahr 2015 mit dem Roman »Aluigis Abbild« dem Gonzaga-Prinzen (und dem Mantovaner Hofmaler Peter Paul Rubens) nach Recherchen vor Ort literarisch gehuldigt … »Damit nicht genug«, hat mir meine Frau zu meinem 80. Geburtstag einen Reisegutschein für eine »Wallfahrt« nach Castiglione und das Versprechen ihrer Begleitung geschenkt. Das Nachfolgende ist das Protokoll dieser Lebensreise, mit Erinnerungen an frühere Italien- und Romfahrten (eine als Gymnasiast mit dem Fahrrad), mit Anmerkungen auch zu meiner literarischen (und religiös-kirchlichen) Sozialisation. Erzähltechnisch bitte ich, mir einige Freiheiten herausnehmen zu dürfen, auch Seitenwege zu nehmen. Diese Lebensreise ist kein Durchmarsch, vielmehr manchmal ein umwegfreundliches Schlendern. Ich berufe mich dabei auf den großen irischen Dichter James Joyce, den Jesuitenschüler von Clongowes Wood, und vor allem seinen Roman »Ein Porträt des Künstlers als junger Mann«, und seine kühne Methode des »Stream of consciousness« im »Ulysses«. Und wenn auch nicht gerade als Odyssee, so doch stellenweise als Irrfahrt ist auch mein (bisheriges) Leben »abgelaufen« und »verlaufen« …
Wallfahrt,oder Werdegang und Lebenslauf
Als ich im Jahr 1974 von Saarbrücken nach Klagenfurt kam, einem Ruf auf den Lehrstuhl »Deutsche Philologie unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik« an die junge Hochschule für Bildungswissenschaften folgend, suchte ich alsbald den Kontakt mit dem damaligen Hochschulseelsorger oder »Studentenpfarrer«, dem Theologen Karl Matthäus Woschitz, der später Ordinarius in Graz wurde und als hochgelehrter Mann mit bedeutenden Publikationen wie dem Buch »Elpis« (Hoffnung) heute großes Ansehen genießt. Der polyglotte, aus St. Margareten im Rosental gebürtige Kärntner Slowene wunderte sich ein wenig über den neuzugezogenen Germanisten und sagte lachend zu mir, ich würde als Neuling in Kärnten bald erfahren, daß in diesem Land ein starker Antiklerikalismus herrsche. Es gelte: »Religio pudendum est!«, Religion sei hier öffentlich »verpönt«.
Der 2011 verstorbene slowenische Dichter und Philosophielehrer am Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt/Celovec Janko Messner wunderte sich übrigens, daß ein Schriftsteller wie ich nach Kärnten (und Österreich) übersiedelt und sich hier niederläßt, wo doch bekanntlich Autoren von Rang eher von hier wegstreben, nach Graz, Wien oder gleich ins Ausland, nach Deutschland wie Elfriede Jelinek, Italien wie Ingeborg Bachmann oder nach Frankreich wie der nunmehrige Nobelpreisträger Peter Handke. Messner nannte die entsprechenden bekannten Namen … Auf Gert Jonke, Josef Winkler und Egyd Gstättner, die hiergeblieben sind, hat er vergessen …
Für Religiosität müsse man sich also schämen? »Verschämtes« Christentum? Ratlose Religiöse? Religiosität gilt im Sinne Sigmund Freuds und der Psychoanalyse als »Wahn«, dem Marxismus-Leninismus war Religion bekanntlich »Opium des Volks« … Beim Wiener Philosophen Friedrich Kainz habe ich in Vorlesungen gehört, daß die unsterbliche Seele eine »katathyme Konzeption« sei, also eine unhaltbare Annahme, ein Wunsch vielleicht. In den Fremdwörterbüchern wird katathym mit »affekt-, vorstellungs- und wunschbedingt« erklärt. Bertolt Brecht schließlich ist sich sicher: »Ihr werdet sterben wie die Tiere, und es kommt nichts nachher.« Den Verhaltensforscher Konrad Lorenz habe ich im Saarländischen Rundfunk in einem Interview sagen gehört, die Vorstellung eines »persönlichen Gottes« halte er für einen »Frevel«! Frevel bedeutet »schweres Vergehen gegen ein ehernes Gesetz«, in der Sprachgeschichte konnotierte das Wort als Adjektiv aber einst durchaus auch positiv, als »kühn, mutig«. Ein Frevler ist ein schneidiger Draufgänger …
Dem Verhaltensforscher wird das an sich veraltete Wort wohl auch aus der Forstwirtschaft geläufig gewesen sein, die von Wald-, Wild- oder Jagdfrevel spricht … Konrad Lorenz war als Professor in Königsberg auch ein später Kollege des Immanuel Kant und wird wohl mit dem Aufklärer, dem Verfasser von »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«, weitgehend übereingestimmt haben. Und über die Metaphysiker dachte Kant, sie seien Denker, die Ochsen melken und ein Sieb darunter halten! Aude sapere! Hab Mut zum Denken und begnüge dich mit dem, was man wissen kann: Bleibt letztlich wirklich nur der Ausweg, den die (irrtümlich) Quintus Septimus Florens Tertullian zugeschriebene Phrase »Credo quia absurdum est« nahelegt? Und: »Contra spem sperare«, »Gegen alle Hoffnung hoffen«? Soll man sich nach der Lektüre der reichen, umfangreichen, religions- und kirchenkritischen Literatur von Immanuel Kant über Baruch de Spinoza und seinen »Tractatus theologico-politicus« bis hin zu Ernst Topitsch, der mit seiner Weltanschauungsanalyse und Ideologiekritik, dem Buch »Vom Ursprung und Ende der Metaphysik«, großes Aufsehen und Widerspruch erregte, »einschüchtern« lassen?
Vor allem mein Freund Fridolin Wiplinger, Topitschs Kollege – und Konkurrent – am Philosophischen Institut der Universität Wien, Bewunderer von Martin Heidegger und von dessen Existenzialphilosophie, hat sich auf einer »Wallfahrt«, die wir gemeinsam mit dem Hochschulseelsorger Karl Strobl im Opel der Hochschulgemeinde unternommen haben und von der noch die Rede sein soll, in langen Monologen heftig gegen Topitschs Thesen ausgesprochen und Luft gemacht. Die Zeiten seien wohl so oder so vorbei, als man die Philosophie für eine »ancilla theologiae«, eine Magd der Theologie, gehalten hat. Diese Zumutung beantwortet der Philosoph mit »Non serviam«. Doch man muß deshalb nicht gleich an Luzifer und den Höllensturz denken!
Ich bin Ernst Topitsch einmal frühmorgens auf dem Weg zu meinem Rigorosum bei Erich Heintel begegnet, ohne gleich zu wissen, mit welcher Koryphäe ich es bei diesem immer ein wenig grinsenden, verschmitzten Mann mit rosigem, rundem Gesicht und sorgfältig gescheiteltem, spärlichem Haar zu tun hatte, der stets in altmodischer Kleidung und mit schwarzen Ärmelschonern auftrat. Ich hielt ihn für einen Pedell oder allenfalls einen Bibliothekar oder Beamten … Und natürlich wußte ich nicht, daß mein »Gesprächspartner« – es ging nur um Organisatorisches und Raumfragen für mein bevorstehendes Rigorosum – der Mann war, der als Assistent von Alois Dempf Ingeborg Bachmann ihr (erstes) Dissertationsthema vorgeschlagen und die Arbeit betreut hat: »Der Heilige bei Conrad Ferdinand Meyer, Friedrich Nietzsche und Jacob Burkhardt«. Daß sich Bachmann als ersten »Doktorvater« für Alois Dempf, den als katholisch-liberal geltenden Philosophen entschieden hat, hat neben theoretischen Gründen – der Sympathie für seine Philosophie in der Tradition des »logischen Empirismus« – aber auch mit der aufrechten, eben nicht »rechten« oder konservativen politischen Gesinnung Dempfs zu tun, der in der Zeit des Nationalsozialismus in der inneren Emigration lebte und Verbindung zur Widerstandsgruppe der »Weißen Rose«, vor allem zum 1943 hingerichteten Willi Graf hatte. Ernst Topitsch sah sich selbst durchaus auch in der Nachfolge des auf Ernst Mach zurückgehenden »Wiener Kreises«, auch Moritz Schlicks, der in der Universität von einem seiner Dissertanten wegen seiner antimetaphysischen Philosophie, die diesem Studenten sein geistiges Weltanschauungsfundament zerstört habe, erschossen wurde. Oft bin ich während meiner Wiener Studienzeit (1957–1962) auf der »Philosophenstiege« des Hauptgebäudes der Wiener Universität über jene Stelle hinweggeschritten, wo sich heute die Gedenktafel befindet, die an das unerhörte Ereignis des 22. Juni 1936 erinnert … Bei allem Abscheu für die fanatische Untat des Mörders Hans Nelböck aus Lichtenegg bei Wels in Oberösterreich hatte ich doch auch ein gewisses Verständnis für die weltanschaulichen Nöte eines jungen Menschen vom Land, dem an der Universität durch kalten Rationalismus und Positivismus sozusagen sein naiver Kinderglaube ausgetrieben wurde …
Alois Dempf hatte hochbegabte Studentinnen und Studenten – wie zum Beispiel Ingeborg Bachmann. Einer seiner geistesverwandten Studenten war Hermann Krings, Vertreter der sogenannten Transzendentalphilosophie, dessen Schüler und Assistent wiederum Hans Michael Baumgartner war. Hermann Krings war zu meiner Saarbrücker Zeit Rektor der Universität des Saarlandes. Einer seiner aus München mitgekommenen Studenten war Christoph Wild, später langjähriger Geschäftsführer des Kösel-Verlags, erfolgreicher Geschäftsmann mit christlich-sozialer Gesinnung. Ein begnadeter Rhetor, der etwa bei den Verleihungen des Geschwister-Scholl-Preises aufsehenerregende Reden gehalten hat.
Unter den bekannten Namensträgern des Taufnamens Alois ist nach Alois Alzheimer und anderen natürlich auch Alois Dempf angeführt. Nun weiß ich nicht, lieber Prinz Aloysius, ob Dempf mit seinem Vornamen zufrieden war oder ein Problem damit hatte. Man kann aus dieser Namenswahl auf ein christliches oder christkatholisches Elternhaus schließen. Denn der Name Alois ist gewissermaßen auch ein Programm und ein Bekenntnis. Er wurde nur im katholischen Süden nach deiner Heiligsprechung im Jahr 1726 oft als Taufname verwendet. Und er war in der Gegenreformation fast ein Kampfname gegen den Protestantismus. Man kann freilich aus Namen nicht immer linear auf die Weltanschauung oder Gesinnung des Namensträgers oder der Namensgeber schließen. Herbert Eisenreich erwähnt in einer Erzählung über den Spanischen Bürgerkrieg einen besonders brutalen Kombattanten und Kommandanten, der mit Vornamen Jesus heißt. Die Spanier und mit ihnen die spanischsprechenden katholischen Länder Südamerikas kennen oder kannten ja keine Scheu vor diesem »Namen, der über allen Namen« ist.
Ich habe einmal geschrieben, daß ich mit deinem, meinem Namen, lieber Namenspatron, schon deswegen zufrieden bin, weil im Dezember 1938 viele Adolfs und Hermanns getauft oder diese Namen von »Gottgläubigen« ohne kirchliche Taufe angenommen wurden. Im Monologdrama »Der Herr Karl« von Carl Merz und Helmut Qualtinger fragt der Magazineur Karl seinen fiktiven Gesprächspartner, den Lehrling, wann er geboren sei, und auf die Antwort (»1938«) legt der charakterlose Mitläufer und Opportunist los – und seine Sicht der damaligen Ereignisse dar. Dezember 1938?! Eh schon wissen! Neun Monate nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich. Damals hat sich ein Pichler Gastwirt am Straßenrand vor Begeisterung so heiser gebrüllt, daß er eine ganze Woche lang keine Stimme mehr hatte und seine Gäste wortlos und stumm bedienen mußte … Mich hat das Stück von Merz und Qualtinger auch darum so »angeheimelt«, weil ich während meiner Welser Gymnasialzeit oft meinen Kindheits- und Jugendfreund, den Lehrling oder »Lehrbuben«, heute muß man sagen Azubi, »Auszubildenden«, Josef Kaser an seinem Arbeitsplatz im Warenlager, im Gewölb der Großhandlung Unterholzer am Welser Stadtplatz, besuchte, später im Lager der Großhandlung Stadelbauer. Dort gab es nicht nur Ratten, die hinter den Regalen Nester bauten, dort gab es im Herrn Zeilberger auch einen alten, bramarbasierenden Magazineur, von dem ich meinte, Qualtinger müßte ihn gekannt und »nachgemacht« haben, was natürlich nicht der Fall war. Obwohl Qualtinger, wie sich herausstellte, bei der Niederschrift einen Kellner in einem Wiener Café im Auge gehabt hatte, der sich später selbst und von sich aus stolz als Karl-Vorbild öffentlich machte …
Auch bei der Lektüre des Buches »Soll und Haben« von Gustav Freytag, dem Klassiker von den tüchtigen deutschen Kaufleuten (mit antisemitischen Untertönen), wurde ich an das Milieu der Welser Großhandelskaufleute erinnert. Am Welser Stadtplatz gab es auch eine Gerberei und ein Lederwarengeschäft, wo mein Vater für seine Mühle die Lederriemen bezog. Dort war ein anderer meiner Jugendfreunde Lehrling, Josef Mühlberger. Im Roman »Die Mühle« habe ich eine kleine Riemen- und Lederkunde inseriert, die ich im Wesentlichen meinen Besuchen bei der Firma Reichardt am Welser Stadtplatz und meinem Jugendfreund Mühlberger verdanke, auch einen namenkundlichen Exkurs über die Personennamen Mühlberger und Müller, die die älteren, urgermanischen Namen Kürnberger und Kürner fort- oder ersetzen.
Ingeborg Bachmann, die zunächst begann, bei Alois Dempf und seinem Assistenten Ernst Topitsch, der sich Bachmann auch mit seiner philosophisch und politisch motivierten Abneigung gegen Martin Heidegger und den Existenzialismus verbunden fühlte, zu dissertieren, und an die am Tor der Ursulinen-Schule in Klagenfurt eine Tafel mit einem Satz aus ihrer Erzählung »Jugend in einer österreichischen Stadt« erinnert, war ja eigentlich Protestantin. Oft habe ich mich mit Elisabeth Reichmann-Endres, der 2016 verstorbenen Kärntner Landeskonservatorin, in ihrem Haus in der »Abstimmungsstraße« in Viktring oder bei mir in der Weihergasse in Klagenfurt unterhalten. Sie war Bachmanns Mitschülerin gewesen und wurde deshalb von den Medien immer wieder und besonders in »Bachmann-Jahren« befragt, wie es denn mit ihrer Freundin Ingeborg gewesen sei. Frau Reichmann-Endres war nobel zurückhaltend, auch wenn sie einiges in der Literatur über »die« Bachmann modifizieren oder korrigieren mußte, sei es auch manchmal Nebensächliches gewesen. So heißt es, sogar in der gediegenen Biographie von Hans Höller im Rowohlt Verlag, sie hätte bei ihren Kolleginnen und Freundinnen den Spitznamen »Elfchen« gehabt. Sie nannten sie aber nicht Elfchen, sondern Els-chen, weil sie von der Oper »Lohengrin« von Richard Wagner schwärmte und ihr der Name Elschen (nach Elschen von Brabant) gefiel …
Von Reichmann-Endres und anderen Klassenkameradinnen hat man erfahren, daß Ingeborg Bachmann sehr oft gefehlt hat und als abwesend ins Klassenbuch eingetragen wurde. Sie war wohl eigentlich nicht kränklich. Manche vermuten aber, daß sie vielleicht von zu Hause, also von ihrem Elternhaus und ihrem Vater her, traumatisiert war, worauf es im Kapitel 4 des Romans »Malina« gewisse Hinweise gibt.
Walter Wimmer, emeritierter Pfarrer von St. Konrad in Linz, nun in Pension und im Domherrenhof in der Linzer Rudigierstraße wohnhaft, ein Bauernsohn aus Gunskirchen bei Wels, jüngerer Bruder meines Kollegen Josef Wimmer im Kollegium Petrinum, der Bischöflichen Lehranstalt der Diözese Linz, der auch Priester wurde und schließlich Religionsinspektor und 2019 leider verstorben ist, Walter Wimmer also hat erzählt, daß Ingeborg Bachmann im sogenannten Germanikum, wo die Priesterstudenten aus Deutschland, Österreich und ursprünglich auch einmal aus Ungarn wohnten, die an der Päpstlichen Universität, der »Gregoriana«, Theologie studierten, Walter Wimmer also hat erzählt, daß Ingeborg Bachmann im Germanikum gewesen sei, dort auch eine Lesung gehalten und sich bei den jungen Theologen wohlgefühlt habe, mit denen sie später sogar Ausflüge unternommen habe.
Ich darf aus meinem Briefwechsel mit Walter Wimmer zitieren. Zuvor meine Anfrage vom 19. Juli 2016: »Sehr geehrter Herr Konsistorialrat Dr. Walter Wimmer, lieber Walter! Als Studienkollege Deines Bruders Josef und als Pichler bitte ich den Gunskirchner, mir das Du nachzusehen. Mich beschäftigt gerade jetzt, wo der 90. Geburtstag Ingeborg Bachmanns ›gefeiert‹ wird, die Erinnerung an etwas, was ich einmal von Dir gehört haben muß. Nämlich, daß Bachmann einmal oder öfter Kontakt zu den Theologen des Germanikums aufgenommen hat. Ich bin hier in Klagenfurt mit Frau Elisabeth Reichmann-Endres in Verbindung, die eine Mitschülerin der Bachmann war und immer wieder als Auskunftsperson für die Klagenfurter Zeit bemüht wird. Aber von Rom weiß sie wenig. Nun war Ingeborg Bachmann ja Protestantin und in einem eben erschienenen Fotoband ›Bachmanns Rom‹ steht, daß sie über eine Begegnung mit Papst Paul VI. geschrieben hat, sie habe ›den Antichrist von Angesicht zu Angesicht‹ gesehen! Sie ist also polemisch wie weiland Martin Luther … Und wenn von ihrem Unglück in Rom und ihrer Einsamkeit die Rede ist, dann hängt das vielleicht auch damit zusammen, daß sie in der »Heiligen Stadt« kaum integriert war. Der Besuch bei Euch Theologen war vielleicht der ein wenig hilflose Versuch einer Art Annäherung? Was meinst Du dazu? Ich hoffe, es geht Dir gut. Über einen Mangel an Reichgottesarbeit wirst Du Dich ja nicht gerade beklagen können, wenn man Deine Bio im Internet liest … Sei herzlich gegrüßt und grüße von mir auch Deinen Bruder Josef!
Dein Alois Brandstetter«
Darauf bekam ich von Walter Wimmer eine Antwort, aus der ich ebenfalls zitieren darf: »Da die Germaniker Ingeborg Bachmann kennenlernten, habe ich als Österreicher und Präfekt sie auch im Namen der Hausleitung zu einem Leseabend ins Germanikum eingeladen. Obwohl sie offenbar schon lange keinen öffentlichen Auftritt hatte und auch nicht wollte, ist sie der Einladung gefolgt und war am 10. Juni 1971 abends im Kolleg. Sie hat in der Sala de Gregorio aus ihrem kurz vorher erschienenen Buch ›Malina‹ gelesen. Ich habe ein Exemplar, das sie signiert hat und in das sie auch das Datum eingeschrieben hat. Meine Erinnerungen: Ich durfte sie begrüßen und willkommen heißen. In den ersten 20 Minuten hatte sie eine sehr leise Stimme und man hatte den Eindruck, daß ihr die Stimme versage. Dann aber wurde ihre Stimme immer kräftiger. Nach ihrer Lesung saßen wir, zwei Präfekten, der Rektor, der Spiritual und noch zwei Personen im Patreszimmer im ersten Stock beisammen und plauderten angeregt über dieses und jenes. Frau Bachmann erzählte z. B. von ihrer Doktorarbeit ›gegen‹ Martin Heidegger. Es war Mitternacht, als wir uns verabschiedet haben. Am Österreichischen Kulturinstitut, zu dem wir Österreicher guten Kontakt hatten (Direktor war Dr. Schmidinger, der Vater des jetzigen Rektors der Universität Salzburg), hörte man offenbar von Bachmanns Lesung bei uns, so daß man sie auch an das Institut eingeladen hat. Ich habe gehört, daß sie unter der Bedingung zugesagt hat, daß auch die Germaniker eingeladen werden. Wir waren auch einige dort. Ich weiß, daß nach ihrem traurigen Unfall, an dessen Folgen sie gestorben ist, noch zwei oder drei Germaniker für sie Blut gespendet haben …«
Bachmanns erster Ansprechpartner im katholischen Rom war als Kärntner Landsmann Helmut Gfrerer, ein Kollege Walter Wimmers, später Seelsorgeamtsleiter in Klagenfurt, nun Pfarrer in Weißenstein im Drautal. Er hat mir berichtet, daß der Fundamentaltheologe der Universität Münster in Westfalen, Harald Wagner, die jungen Theologen ermuntert hat, so wie er selbst es hielt, mit den bedeutenden deutschen Dichtern in Italien – Stefan Andres oder Luise Rinser oder eben Ingeborg Bachmann – in Kontakt zu treten, um daraus auch geistigen Nutzen für ihren priesterlichen, geistlichen Beruf als Seelsorger zu ziehen. Nach Helmut Gfrerer hat sich ein anderer aus Kärnten stammender Alumne solcher Kontakte mit Bachmann befleißigt. Er trug den in Kärnten bedeutend klingenden Familiennamen Perkonig. Er ist leider, wie die von ihm bewunderte und verehrte Dichterin, tragisch geendet.
Ich bin in Kärnten zwei katholischen Geistlichen begegnet, die zur Literatur und zu Literaten ein besonderes Verhältnis hatten. Der eine war Hans Duller, Religionsprofessor und langjähriger Präses der Kolpingfamilie. Er stammte wie die Dichterin Christine Lavant, mit der er lebenslang freundschaftlich verbunden war, aus dem Lavanttal, darum war er auch prädestiniert, als Priester und Freund die Grabrede zu halten, die im Buch »Steige, steige verwunschene Kraft. Erinnerungen an Christine Lavant« abgedruckt ist: Sie heißt »Am offenen Grabe« und beginnt mit einem Lavant-Gedicht: »Hab dich lange nicht gefunden, / Hilfe meiner Abendstunden; / hab nicht mehr gedacht, / daß ich soll getröstet werden / hier auf Erden. Kann die schwerste Nacht nun kommen, / so in deine Hand genommen, / bleib ich dennoch heil. / Wie am sichern Seil / klimm ich ins Gebirg der Gnaden, / trostbeladen.«
Ein anderer Beiträger der Erinnerungsschrift war der Pfarrer von Althofen im Gurktal, Johannes Pettauer, ein Priester nach altem Schlag, wohl auch ein Anhänger des konzilkritischen Bischofs Marcel Lefèbvre, der ebenfalls nach altem Ritus die lateinische Messe mit dem Rücken zum Volk gelesen hat. Pettauer, von Kirche und Staat hochverdient hochdekoriert, Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst, Gründer und Leiter des sogenannten »Zammelsberger Kulturkreises«, der sich selbst einen »Rilkomanen« nannte, weil er in vielen Veranstaltungen Rainer Maria Rilke auswendig und mit schöner baritonaler Stimme rezitierte, wie auch die Kärntner Lyriker Guido Zernatto und Johannes Lindner. Pettauer, der also nach dem Krieg als Kaplan in Wolfsberg in Kärnten mit Christine Lavant »viel zu tun« hatte, sah sie weniger positiv als Hans Duller in seiner Grabrede. De mortuis nil nisi bene? »Unser beider Beziehung litt aber, ehrlich gestanden, unter der Belastung völlig gegensätzlicher religiöser Anschauungen. Meine damals (wie heute) ungebrochene, fast naive kindliche Weltanschauung konnte ihre anklagenden, oft wie Vulkane ausbrechenden Jobsiaden keineswegs befriedigen. Ich mußte ihr doch, was ja die Wahrheit ist, sagen, daß sie eine aggressive, Gott-lose Person sei, welche sich seines Namens nur als Vorwand bediene.« Auch verglich er sie zu ihrem Nachteil mit seinem Favoriten Rilke. Pettauer dürfte ihr auch ihre Beschwerderede beim Gurker Bischof über die lärmende Katholische Jugend vor dem Fenster ihres über 30 Jahre älteren kranken Mannes, des naiven Malers Habernig, für die Pettauer ja wohl als Jugendkaplan verantwortlich war, übel genommen und nicht vergessen haben.
Dem aus Wuppertal-Elberfeld stammenden Maler Werner Berg, den Christine Lavant unglücklich liebte, verdanken wir ausdrucksstarke expressionistische Porträts der Dichterin, auch eine Briefmarke, nicht weniger eindrucksvolle Kohlezeichnungen dem Maler und Kunsterzieher Egon von Wucherer, der zu »Steige, steige, verwunschene Kraft« auch einen berührenden Erinnerungsaufsatz beigesteuert hat.
Ein besonderes Kapitel ist in diesem Zusammenhang Christine Lavants Verhältnis zu ihrem Arzt, dem Neurologen, Publizisten und Politiker des nationalen Flügels der Freiheitlichen Partei – und 1986 sogar deren Präsidentschaftskandidat – Otto Scrinzi. Ihren Krankheitszustand beschreibt er wie folgt: »Chronisches Augenleiden, das sie halb blind macht, Mittelohreiterungen rauben ihr Teile des Gehörs, Lungentuberkulose, Schilddrüsenüberfunktion, Asthma und ein hartnäckiges Magen-Darmleiden.« Christine Lavant hatte Bewunderer, Freundinnen und Freunde unterschiedlichster sozialer und politischer Herkunft, wie ihre vielen Briefe an Otto Scrinzi und an ihre Freundin, die Wolfsbergerin Ingeborg Ilse Teuffenbach in Innsbruck (verehelichte Capra und Mutter des 1939 geborenen Fritjof Capra), aber auch an Gerhard und Maja Lampersberg vom Maria Saaler Tonhof belegen, wo sich auch Thomas Bernhard mit ihr anfreundete, der auch eine postume Ausgabe ihrer Gedichte besorgte. Bernhard hat auch gemeint, er müsse sie vor dem Odium, für eine katholische Dichterin gehalten zu werden, schützen …
Thomas Bernhard selbst hat sich von seinen eigenen lyrischen Anfängen, etwa dem Gedichtband »In hora mortis«, und seiner Nähe zu Personen aus dem Umkreis des Otto Müller Verlags wie Otto Müller selbst, aber auch Ludwig von Ficker oder Ignaz Zangerle, bis hin zum letzten großen Roman »Die Auslöschung« und zum von Ignaz Hennetmair mitgeteilten Kirchenaustritt zunehmend kritisch über den österreichischen Katholizismus geäußert. Man erinnert sich auch an seine, im Zusammenhang mit dem Skandal um die Verleihung des Kleinen (!) Staatspreises geäußerte, heftige Verachtung für Rudolf Henz und Minister Piffl-Perčević, »den dummen Mann aus der Steiermark«. In einem Almanach des Residenz Verlages zum Thema »Feinde« hat er an erster Stelle den österreichischen Staat und gleich danach die Kirche genannt … Was hatte sie ihm angetan? Sicher dürfte sein, daß er auch von Christen respektiert und ernstgenommen wurde, nicht nur von sogenannten »Linkskatholiken«, die freilich oft mehr links als katholisch sind.
Ein außerordentlich verständnisvoller Intellektueller war im Sinne der Verständigung und Versöhnung von Sozialismus und Kirche Norbert Leser. Er war der Sohn der Schriftstellerin Jolanthe Leser, einer Frau, die in ihrem Werk, etwa »Die Pappelallee«, ein besonderes Verständnis für bedrängte, arme, aus der »Provinz«, im besonderen dem Burgenland, stammende Menschen in Wien, zeigt. Norbert Leser hat mir das erwähnte Buch seiner Mutter mit einer persönlichen Widmung nach meinem Vortrag in seinem Kreis im Juni 1983 geschenkt. Natürlich besitze ich auch sein eigenes Buch »Salz der Gesellschaft«. Vielleicht sollte man den österreichischen Sozialdemokraten etwas vom kritischen Geist Lesers wünschen und zur Lektüre seiner Schriften raten, damit sich nicht an ihnen das Wort der Schrift erfüllt: »Wenn das Salz schal geworden ist, wirft man es weg …«
Als ich nun am 5. Dezember 2018 80 Jahre alt geworden war und mit Ehrungen geradezu »überhäuft« wurde, unter anderem dem Franz Theodor-Csokor-Preis des Österreichischen PEN-Clubs, war neben öffentlichen Ehrungen auch ein besonderes privates Geschenk meiner Frau dabei, ein Reiseversprechen für einen Ausflug oder eine Wallfahrt nach Castiglione delle Stiviere und Mantua, jene Ortschaften, die in einem meiner Romane, »Aluigis Abbild«, Schauplatz und Thema sind. Wohl war ich bereits bei meinen Recherchen zu diesem, meinem letzten Roman über meinen Namenspatron Aloysius von Gonzaga und über den neun Jahre nach Aloysius, also 1577, in Siegen geborenen Hofmaler der Gonzagas Peter Paul Rubens an Ort und Stelle in der Lombardei gewesen. Unglücklicherweise war ich in Mantua an einem Montag gewesen, und am Montag sind in Italien die Museen und Palazzi bekanntlich geschlossen, weil sich die Kunstwerke und die Wärter und Wächter der Schätze von den Touristenscharen erholen müssen. Die Kirchen haben natürlich immer und vor allem auch am Sonntag geöffnet … Manche Geistliche, »Kultarbeiter«, nehmen sich gern, wie die Friseure, dann auch am Montag frei.
Diesmal freilich hat meine Frau im Internet alles genau untersucht und ausgesucht, was Quartiere in Schauplatznähe und Öffnungszeiten der Kultusstätten betrifft, so daß wir alles Großartige an Bildern von Andrea Mantegna, Peter Paul Rubens und Giulio Pippi Romano im Palazzo Ducale und im Palazzo del Te bewundern können würden. Die in Wien mit ihrer Familie lebende Italienerin Gabriella Telera, die in Turin studiert und sich als Germanistin mit meinen Romanen, vor allem mit »Die Abtei«, befaßt und sie teilweise ins Italienische übersetzt hatte, hat uns über das kirchliche Programm am 21. Juni, dem Todes- und Namenstag des Aloysius di Gonzaga, in Castiglione delle Stiviere informiert und uns den Termin der Festmesse um 10.30 mitgeteilt. Dort zog es mich hin. Im Zentrum von Castiglione an der Piazza San Luigi Gonzaga, am quadratischen Platz vor der Kirche mit seiner mächtigen Platane, gibt es leider kein Hotel, so daß wir am Rande der Stadt gegen Solferino hin in einem Hotel, das nach dem Gründer des Roten Kreuzes Henri Dunant benannt ist, übernachten mußten. Auf dem Platz vor der Kirche in Castiglione herrschte auf einem Wochenmarkt reges Treiben. Vor der Festmesse im Santuario di San Luigi Gonzaga besichtigte ich im Dom, der Chiesa dei Santi Nazario e Celso Martiri, noch das Grab, das heißt die Grabplatte über der Gruft vor dem Presbyterium, wo die Mutter des Aloysius und von sieben weiteren Kindern, Marta Tana di Santena di Chieri, 1804 – umgebettet vom Friedhof des Klosters Santa Maria vor den Toren Castigliones – ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.
Da wir von Solferino aus und dem Hotel Henri Dunant mit unseren Koffern und Taschen unterwegs nach Mantua waren, wo wir im Hotel Gonzaga gebucht hatten, wußten wir nun in Castiglione, wo wir die für 10.30 angesetzte Festmesse besuchen wollten, nicht, wohin mit dem vielen Gepäck. Mutig und findig, wie meine Frau ist, erklärte sie dem Sakristan, einem Afrikaner in schwarzem Talar, einem »Kirchenschweizer«, unser Problem, der sich darauf mit dem Kirchenrektor besprach, der uns erlaubte, unsere Koffer und Taschen in einem der vielen Beichtstühle und zwar im mittleren Teil eines Beichtstuhls, auf dem Sitz des Beichtvaters, hinter einem Vorhang, abzustellen und abzulegen. Es war ja auch keiner der vielen wunderbar geschnitzten Beichtstühle von Priestern besetzt und von Sündern besucht … Ursprünglich hatte ich geplant, in dieser Kirche nach meinem 80. Geburtstag eine sogenannte Lebensoder Generalbeichte abzulegen und sozusagen einen Schlußstrich unter alle bedenklichen Handlungen, »Worte und Werke« (verba et opera), meines Lebenswandels zu ziehen und um Nachsicht (remissio) und Nachlaß (absolutio) zu ersuchen … Schon bei meinem ersten Recherchebesuch vor fünf Jahren hatte ich mich nach einem Geistlichen umgesehen, der Deutsch verstünde, aber keinen gefunden. Ein jesuitisch ernst und streng wirkender Priester schritt, Rosenkranz betend, im Mittelgang der Kirche auf und ab. Den wollte ich in seiner Andacht nicht stören, hatte aber ohnehin keine Hoffnung, daß ich mich verständlich machen könnte.
Während eines Gastsemesters an der Universität in Genua im Jahr 1980 stand mir auch einmal der Sinn nach Aussprache und Beichte. Dort behalf ich mir mit meinen Lateinkenntnissen … Confiteor Deo omnipotenti … apostolis Petro et Paulo … beatae Mariae virgini … quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere … Es kann freilich sein, wenn man in einer Fremdsprache beichtet, daß man »läßliche« Sünden« nennt, die man eigentlich nicht begangen hat, nur weil man die Vokabeln kennt, während einem die Begriffe für die wirklichen Verfehlungen, vor allem für die sogenannten »Todsünden«, nicht einfallen wollen und fehlen … An die sogenannten »schweren« oder »Todsünden«, die nach der strengen alten Meinung in die Hölle als ewige Verdammnis führen, mag man ja gar nicht denken!
Im Religionsunterricht an der Volksschule in Pichl bei Wels habe ich von Pfarrer Alois Einberger, dem ich seinen, meinen Vornamen verdanke und der mir oft am 21. Juni, unserem Namenstag, ein sogenanntes Heiligenbildchen mit einem Aloysius-Gebet auf der Rückseite schenkte, aber aus heutiger religionspädagogischer Sicht bedenkliche, manche meinen verheerende Ansichten vermittelt bekommen. Ich erinnere mich an eine sogenannte »Höllenpredigt«, die dem Spezialisten aus dem 17. Jahrhundert auf diesem Gebiet, dem damals schier unvorstellbare 82 Jahre alt gewordenen Martin von Cochem, Kapuziner, Volksmissionar und Schriftsteller, »Ehre« gemacht hätte, in der Einberger davon sprach, daß in der Hölle eine Uhr »Immer – Nimmer« ticke, um die Ewigkeit und Ausweglosigkeit der Strafe anzuzeigen und bewußtzumachen. So etwas erzeuge, wie eine liebe befreundete evangelische Theologin und Germanistin in Saarbrücken, Ulrike Gräff, in einer »Personenbeschreibung« in »Das große Brandy-Buch« (Brandy war mein Spitzname) über mich schrieb, »ekklesiogene Neurosen« … Sie führte meine damaligen psychischen Probleme, Phobien, Panikattacken und Depressionen, auf anerzogene Schuldgefühle durch Eltern und Religionslehrer zurück, so daß mir auch unschuldige Vergnügungen und harmlose Freuden verwehrt seien, weil ich sie mir nun, nach den »beherzigten« internalisierten Ermahnungen der schwarzen Pädagogik, selbst verbieten würde …. Sie hatte in vielem recht, wenn auch ihre schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich meiner Zukunft dann Gott sei Dank doch nicht ganz so eintrafen. Pfarrer Einberger jedenfalls beschwor und zitierte auch gern in seinen Predigten die »Nacht, da niemand mehr wirken kann«, obwohl der Evangelist Johannes (9/4) es nicht so infernalisch gemeint hat: »Ich muß das Evangelium am Tag verkünden, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann …« Das Evangelium ist doch eine frohe und keine rohe Botschaft, keine Drohbotschaft …
Heute hat sich der Teufel als Thema der Theologie verabschiedet, der Satan hat abgedankt. Eben macht ein Buch des Autors Gerhard Roth mit dem abgewandelten, auf William Shakespeare zurückgehenden Titel Furore: »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier.« Die Teufel sind alle unter uns? In Shakespeares »Sturm« heißt es: »Hell is empty and all the devils are here.« Und wenn man bald täglich von abscheulichen Attentaten, Terroranschlägen und grauenhaften Massakern mit zahlreichen Toten, darunter immer auch Frauen und Kindern, von nichts als Krisen und Kriegen hört, möchte man dies bald als Erklärung gelten lassen.
James Joyce, der überragende irische Autor des »Ulysses«, der Revolutionär und Pionier des modernen Romans, hat in seinem Frühwerk »Porträt des Künstlers als junger Mann« seine Jugend als Internatsschüler in zwei der bekanntesten Jesuiten-Schulen Irlands, dem Kollegium Clongowes Wood und dem College Belvedere, beschrieben und »aufgearbeitet«. Im dritten Kapitel dieses »semiautobiographischen« Romans über Stephen Dedalus (als der Joyce dann auch im »Ulysses« erscheint) schildert er Exerzitien, also »geistliche Übungen«, die ein Pater Arnall leitet. Dort ist über viele Seiten eine der eindrucksvollsten Höllenpredigten »protokolliert«, die dem jungen Stephen besonders nahe und zu Herzen geht und ihn beunruhigt, da er eine venerische »Todsünde« begangen hat, die in die ewige Verdammnis führt. Und gerade hier ist auch von jener Uhr im Inferno die Rede, die »Immer-Nimmer« tickt, von der wortgleich auch Alois Einberger im Religionsunterricht an der Volksschule Pichl bei Wels gesprochen hat. Es gibt in diesem Roman des James Augustine Aloysius Joyce noch viele andere Stellen, die mir buchstäblich unheimlich vertraut sind und von denen noch zu reden sein wird, wie etwa die über seine Mutterbindung … Schon architektonisch gleicht das Linzer Kollegium Petrinum am Fuße des Pöstlingberges Clongowes Wood nahe Dublin in Irland. Das »Aloisianum«, die Jesuiten-Anstalt der Diözese Linz am Freinberg, hingegen kann sich, architektonisch gesehen, mit Clongowes Wood nicht messen …
Als ich in Castiglione bei meiner ersten Recherche keinen Beichtvater fand, der Deutsch gesprochen hätte, und da meine Lateinkenntnisse in der Zwischenzeit weitgehend reduziert, wenn nicht gar geschwunden waren, sagte ich mir, der Wille gilt für das Werk … Und: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich erinnerte mich aber natürlich an die Büßerlegende »Gregorius« des Hartmann von Aue aus dem späten 12. Jahrhundert, die ich in so vielen Sprachgeschichte-Proseminaren an den Universitäten in Saarbrücken, Klagenfurt und Salzburg als Lektüretext den Übungen zugrundegelegt hatte: Dort, im berühmten Prolog, macht sich Hartmann Sorgen und Vorwürfe, weil er viel gedichtet habe, was ihm den Beifall der Welt bringen sollte. »Dazu verführten ihn die jungen Jahre.« Jetzt aber weiß er, daß derjenige, der jung ist und im Hinblick auf seine Jugend »drauflossündigt«, weil er sich denkt, du bist noch ein junger Mann und deine Sünden wirst du schon im Alter noch Zeit haben zu büßen, gründlich falsch denkt, weil der Tod sein »Vorhaben« oder seinen »Vorsatz« (vürgedanc) mit einem plötzlichen Ende schlagartig zunichte machen kann.
Lieber Aloysius, mir ist, als hättest du Hartmann von Aue gelesen oder ein Proseminar bei mir besucht, weil ein Passus aus einem deiner Briefe aus Rom an deinen Bruder Francesco in Castiglione, der nach Rodolfo jene Stelle eingenommen hatte, die dir zugedacht war und zugestanden hätte, sich genau wie eine »Prosaauflösung« der Verse Hartmanns in der Gregorius-Legende liest. Du mußt nämlich wissen, daß sich meine Habilitationsschrift mit der Prosaauflösung befaßt hat, im Untertitel heißt sie »Studien zur Rezeption der höfischen Epik im frühneuhochdeutschen Prosaroman«. Du schreibst: »Und außerdem möchte ich, daß Sie des Abends nicht zu Bette gehen, bevor Sie nicht in Ihr Inneres geschaut, damit Sie, falls Sie sich einer schweren Sünde, wovor Sie Gott bewahren wolle, schuldig finden, den Vorsatz fassen, sie möglichst bald durch eine Beichte auszutilgen, die Sie immer dann für notwendig halten müssen, wenn Sie etwas zu bereuen haben. Deshalb warten Sie niemals bis auf eine bestimmte Zeit, wie etwa Ostern oder ähnliche Gelegenheiten, da Ihnen niemand die Gewißheit geben kann, daß Sie dann noch leben.«
Du warst also mit deinem Bruder per Sie! Und deiner Mutter sagst und schreibst du: Erlauchteste in Christo hochzuverehrende Frau Mutter, und dem Vater: Erlauchtester Herr Vater. Ist dir das nicht schwergefallen, da du doch erleben mußtest, wie dich dein Vater, ein Spieler und Trinker, der dich unbedingt von deinem Vorsatz abbringen wollte, Jesuit zu werden, und der seiner Familie viel Sorgen bereitet hat, behandelt hat? Ja, selbst deinen Bruder Rodolfo, den »Übeltäter«, den die Menschen in der Gegend wohl begründet einen Tyrannen nannten, dessen Ermordung sie gefeiert haben und der wohl so lange in einer sogenannten wilden Ehe oder Ehe zur linken Hand oder auch Friedelehe mit der bürgerlichen Elena Aliprandi lebte, bis du ihm gedroht hast, ihn nicht mehr als Bruder zu betrachten – sogar ihn sprichst du im Brief vom 6. Februar 1591 so an: »Erlauchtester in Christo hochzuverehrender Bruder«! Hochzuverehren?
Dieser Brief, den du aus Mailand, wohin du, deine Studien in Rom unterbrechend, gefahren bist, hat es in sich! Abgesehen davon, daß er ein stilistisches Kabinettstück und große Literatur ist, zeugt er von einer großen Entschlossenheit und einem ungewöhnlichen sittlichen Ernst. Du redest deinem Bruder Rodolfo ins Gewissen, er möge um Christi willen den Skandal seiner wilden Ehe aus der Welt schaffen, andernfalls du mit ihm brechen würdest. »Sollte mir dies nicht gelingen, so erkenne ich Sie als Bruder allein ›secundum carnem‹ nicht an und will Sie nicht anerkennen.« Aus den Anmerkungen zu diesem Brief erfährt man Erstaunliches, so zum Beispiel, daß Rodolfo eigentlich nicht in wilder Ehe lebte, sondern in einer geheim geschlossenen Ehe mit der nicht standesgemäßen Tochter des Münzmeisters Antonio Aliprandi, Elena Aliprandi. Geheimgehalten hat Rodolfo seine Ehe, weil er die Reaktion der Familie fürchtete, und »aus Scheu vor dem Unwillen seiner Verwandten«, und ganz besonders seines Onkels Alfonso, des Herrn von Castel Goffredo, dessen Besitz er erben und vor allem dessen Tochter er heiraten sollte. Aloysius, du erwähnst in diesem Brief auch das Beispiel des »Herrn Herzogs von Mantua« Vincenzo Gonzaga, Herzog nach seinem Vater Guglielmo Gonzaga, dessen Mutter Eleonora von Österreich war, der die Auflösung seiner Eheangelegenheit – die Ungültigkeitserklärung seiner nur ein Jahr dauernden Ehe mit Margerita Farnese, einer Prinzessin von Parma – auch durch Unterstützung des Mailänder Bischofs Karl Borromäus erreicht hat. Vincenzo Gonzaga hat in zweiter Ehe Eleonora Medici geheiratet, von ihr steht in den Anmerkungen zum Brief, sie sei die Gespielin der Brüder Aloysius und Rodolfo gewesen, als sie am Hof in Florenz Pagen waren. Nicht in den Anmerkungen zum Brief, aber in meinem Roman »Aluigis Abbild« steht, daß Vincenzo »der Prächtige« jener kunstsinnige Herzog war, der viele Künstler nach Mantua brachte, vor allem Peter Paul Rubens …
Man spricht ja auch in den Literaturgeschichten bei Autoren, die sozusagen klein angefangen haben und später groß »herausgekommen« sind, von »Jugendsünden« – also weniger im ethisch-moralischen Sinn, sondern im ästhetischen Sinn. Von Rainer Maria Rilke heißt es etwa, daß sein Frühwerk eher bescheiden gewesen sei und nicht erwarten ließ, zu welcher Größe er sich in seinem lyrischen Spätwerk »aufschwingen« würde. Es gibt das Sprichwort: Jugend hat keine Tugend. Es bedeutet, daß sich junge Menschen oft bedenkenlos über moralische Grundsätze hinwegsetzen. Du, lieber Namenspatron, bist der überzeugendste Gegenbeweis. Oder muß man sagen: Ausnahmen bestätigen die Regel? Auch in der Literatur bist du das – denn ich halte dich auch für einen begnadeten Schriftsteller, in gleich mehreren Sprachen, Latein zuvörderst, aber auch im Italienischen, und zwar im geschliffenen toskanischen Hochitalienisch, das zu lernen man euch Brüder, dich und Rodolfo, ja zu den Medici nach Florenz geschickt hat. Darum habe ich dich in meinem Roman auch mit dem aus Andes bei Mantua stammenden bedeutendsten lateinischen Dichter des Altertums verglichen, der von Haus aus, vom Elternhaus her, einen Dialekt gesprochen hat, in Rom aber wie du das sogenannte klassische Latein gelernt hat, Publius Vergilius Maro nämlich, der mit seinen Dichtungen, den Bucolica und Georgica, vor allem aber mit dem Jahrtausendwerk der »Aeneis« das Höchste an Sprachkunst geleistet hat.
Das Musterbeispiel eines zu äußerster Meisterschaft gelangten, jung verstorbenen Dichters ist Georg Büchner. Er starb wie du, Aloysius, mit 23 Jahren! Und hat mit »Dantons Tod«, »Woyzeck«, »Leonce und Lena«, der Novelle »Lenz« und dem »Hessischen Landboten« ein großartiges, revolutionäres Werk hinterlassen. Ich habe mich in meinem Germanistikstudium einmal an einer Arbeit über die Novelle »Lenz« versucht, aber buchstäblich aus Angst, panischer Angst vor dem bedrohlich dargestellten Leiden des Sturm und Drang-Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz, vor seiner »Dementia praecox«, seinen schizophrenen »Schüben«, meine Arbeit aufgegeben und »unterlassen« … Eine ähnliche Betroffenheit hat mich auch bei der Lektüre von Werken E.T.A. Hoffmanns und Franz Kafkas erfaßt. Es erging mir wohl ähnlich wie den vielen, von Goethes »Die Leiden des jungen Werthers« »verunsicherten«, zu Tode verängstigten jungen Menschen, die sozusagen dem »einladenden« Beispiel des Helden Werther in den Tod gefolgt sind … Die Todessehnsucht wird später ein großes Thema in der Romantik, die Goethe im Gegensatz zur »gesunden« Klassik als »krank« bezeichnet hat. Eigentlich spricht Goethe nicht von der Klassik und der Romantik, er sagt vielmehr: »Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke.« (Gespräch mit Eckermann am 2. April 1829)
Als hättest du, lieber Aloysius, Hartmann von Aue gelesen, was nicht anzunehmen ist, lautet einer der vom Castiglioner Dominikanerpater Claudio Fini, deinem Gesprächspartner, mitgeteilten Aussprüche, die in deinem Seligsprechungsprozess eine Rolle gespielt haben und an die ich mich vor deiner Kopfreliquie in der Kirche nach der Festmesse mit höchstem Respekt erinnerte: »Die freiwilligen Bußübungen des Leibes dürfen nicht bis auf das Alter verschoben werden, wenn die Kräfte dem nicht mehr gewachsen sind.« Und manches, was du gesagt und geschrieben hast, ist durchaus nicht ohne Humor gesagt. Ich denke etwa nur an deinen Ausspruch, daß man den Leib durch Hiebe wie einen störrischen Esel antreiben müsse …
Nichts war der alten Theologie schrecklicher als die mors repentina, der unvorhergesehene und »unversehene, plötzliche Tod«. Unvorbereitet hinüberzugehen galt als Gräuel. Sine viatico, »ohne Wegzehrung«! In einem solchen Fall wurde damals ins Sterbebuch der Pfarre »Non provideri potuit«, also: Er oder sie konnte nicht versehen werden, eingetragen. Versehen – welch merkwürdiges, vieldeutiges Wort! Eine der priesterlichen Obliegenheiten war in meiner Kindheit und Jugend auf dem Land der Versehgang, der Besuch der Kranken mit dem »Ciborium«, einem Behälter für die konsekrierten Hostien. Der Pfarrer wurde dabei meist von einem Ministranten begleitet, der von Zeit zu Zeit, wenn Leute vorbeigingen, mit einer kleinen Handglocke läutete. Fromme knieten sich manchmal nieder, wenn sie den Priester mit der Stola über dem Talar bekleidet kommen sahen. So wie sich viele Passanten, die die Brücke über den Innbach bei der Mühle und meinem Elternhaus in Pichl bei Wels überquerten, vor dem in der Mitte des Geländers angebrachten metallenen Kruzifix bekreuzigten. Ernst Jandl bringt mich zum Schmunzeln, ja Lachen, wenn er in einem »Gedicht« schreibt: »Immer, wenn ich an einer Kirche vorbeigehe, bekreuzige ich mich, bei einem Zwetschgenbaum aber bezwetschgige ich mich. Wie ich ersteres tue, weiß jeder Katholik, wie ich letzteres tue, ich allein.« Mein Freund Josef Winkler beschreibt, wie er den Pfarrer von Kamering im Drautal, den aus dem oberösterreichischen Offenhausen stammenden Franz Reintaler, auf ähnlichen »Versehfahrten« im Auto, das von den Smart Export, die der Pfarrer rauchte, »imprägniert« war, begleitete. Denn wenn ein Geweihter, ein Geistlicher, Zigaretten, Zigarre oder Pfeife raucht, erzeugt das ja auch nicht gerade Weihrauch …
Die Lektüre dieser Stelle in Josef Winklers Buch erinnerte mich wieder an den denkwürdigen und bereits erwähnten Ausflug von Wien nach Rom in der Karwoche 1962 mit dem Auto der Katholischen Hochschulgemeinde, das ich steuerte. Wir, die drei Insassen, der unvergessene Wiener Studentenseelsorger Monsignore Karl Strobl, von uns liebevoll »Monsi« genannt, Gott hab ihn selig, der Philosoph Fridolin Wiplinger – auch er lange tot und auf dem Friedhof in Haslach im oberen Mühlviertel beerdigt – und ich, wir waren alle starke Raucher, und dementsprechend hat der Innenraum des Opel Rekord bei unserer Ankunft in der Ewigen Stadt wie eine Selchkammer oder Rauchkuchl gerochen … Die Autos, die »Luxusautos«, wie man auch sagte, hatten damals ja auf dem Armaturenbrett ein eingebautes elektrisches Feuerzeug. Wenn man den äußeren Knopf über dem zylindrischen Corpus hineindrückte, begannen am anderen Ende, im Inneren dieses Anzünders, Drähte zu glühen. Man zog das Ding heraus und berührte mit der Zigarette den glühenden Draht. Aber nicht nur diese Anzündhilfe, auch ein herausziehbarer Aschenbecher gehörte zum Standardinventar dieser »Luxusautos«. Das gerät heute angesichts des neuverordneten Rauchverbots in den Gaststätten und der allgemeinen Ablehnung des Rauchens in geschlossenen Räumen sowie der Raucher langsam in Vergessenheit. Und einen »geschlosseneren«, engeren Raum als den Innenraum eines Autos gibt es ja wohl nicht.
Mich erinnert dies alles an den unvergeßlichen populären Kärntner Mundartdichter und Humoristen Wilhelm Rudnigger, der ein Kettenraucher war und im Auto, mit dem er seine Lesetouren, auch solche bis Hamburg, unternahm, oft oder immer vergaß, den Aschenbecher zu benützen, was an seiner braunen Trachtenjoppe aschgraue Spuren hinterließ … Ich wollte einmal zu ihm ins Auto steigen, er warnte mich aber und bat mich, davon Abstand zu nehmen. Seine Sitze waren nämlich nicht nur mit Asche imprägniert und besudelt, sondern auch von den Haaren seines Hundes Felix übersät, der ihn auf seinen Fahrten von Café zu Café immer begleitete … Mir hat Rudniggers bester Freund, der Goldschmied und Schmuckkünstler Sepp Schmölzer, einige Artefakte, Objekte und Fotos, aber auch viele »Rudniggeriana« vermacht. Ich habe sie, nachdem der Nachlaß Rudniggers, auch sein berühmter Spazierstock(!), ins Musil-Literaturmuseum gekommen ist, auch dorthin gebracht.
Etwas anderes bleibt mir von jener erwähnten Romfahrt ewig – oder »bis auf Weiteres« – im Gedächtnis: Im Dom von Bologna wollte Monsi auf der Hinfahrt eine Messe zelebrieren und bat mich, ihm zu ministrieren. Ich dachte, das wird wohl an einem Seitenaltar sein, und war wegen meiner Platzangst, der »Klaustrophobie«, bereits richtig in Panik, als ich sah, daß uns ein Sakristan zum hohen Hochaltar führte. Man hatte Monsignore Strobl also als Substituten und Einspringer für einen ausgefallenen ortsfesten Zelebranten »eingeteilt«, den sonntäglichen Hauptgottesdienst vor einer großen Gottesdienstgemeinde zu übernehmen. Ich war geradezu geschockt und habe mich bei den damals in der vorkonziliaren Zeit noch gebräuchlichen Psalmen des »Staffelgebetes« wohl einige Male vertan. Vor allem beim sogenannten »Confiteor«, das zwei Syntagmen hat, im ersten Teil vor dem »Mea culpa!« dominiert der Dativ: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, den Aposteln Petrus und Paulus … und euch Brüdern und Schwestern … Im zweiten Teil, dem Schlußteil, aber herrscht der Akkusativ: Precor – »ich bitte« – beatam Mariam virginem … und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Ich habe mich aber im zweiten Teil wieder in den Dativ verirrt und so hat Monsignore Strobl meinem verbalen »Perpetuum mobile« ein Ende bereitet, indem er mir mit dem Schlußvers einfach ins Wort gefallen ist: Introibo ad altare Dei. Da wußte ich wieder, wie antworten: Ad Deum qui laetificat iuventutem meam – »Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf.«
An der Windschutzscheibe unseres Opel Rekord klebte natürlich jene SOS-Plakette – ein blaues Kreuz auf weißem Grund –, die bedeutete, daß der Fahrzeughalter und -lenker sich als Christ und Katholik versteht und bekennt und im Falle eines schweren Unfalls »versehen« werden und kirchlich von einem Priester betreut werden will. Christen haben damals, wie vielleicht heute die »Zeugen Jehovas«, die man ein wenig abfällig als »Bibelforscher« bezeichnete, die Religion wichtiger genommen als die Medizin. Und mehr als nach dem Arzt nach dem Priester gerufen. Wie auch das oben erwähnte »Versehen« wird auch das Sakrament der Krankensalbung kaum noch gespendet. Die im Volksmund als »Letzte Ölung« bezeichnete Krankensalbung, lateinisch Sacra unctio infirmorum, wurde freilich nicht nur ante, sondern auch post mortem, also vor oder nach dem Ableben gespendet, »verabreicht« … Ableben – welch merkwürdiges Wort …
Der alten Theologie und dem Volksglauben entsprechend und gemäß, wird wohl von älteren Geistlichen am 3. Februar, dem Namenstag des heiligen Blasius, der Blasiussegen gespendet, ein sogenanntes Sacramentale, also keines der sieben Sakramente. Blasius war ein frühchristlicher Märtyrer, der der Legende nach ein Kind, das zu ersticken drohte, von einer Fischgräte im Hals befreite, was ihn zu einem der vierzehn Nothelfer und hier insbesondere für HNO zuständig werden ließ. Und am Aschermittwoch wird das Aschenkreuz ausgeteilt: »Gedenke o Mensch, daß du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst.« Pulvris es, Pulver, Staub bist du … Das ist, naturwissenschaftlich gesehen, nicht richtig oder nur teilweise korrekt. Bei Georg Büchner, dem Dichter, Mediziner, Naturwissenschaftler und Revolutionär, könnte man nachlesen, woraus sich der Mensch wirklich zusammensetzt, in der Hauptsache wohl aus Wasser und Salzen. Und auch Gottfried Benn, den großen expressionistischen und pessimistischen Dichter und Arzt, könnte man zu dieser Frage konsultieren. Aber man sollte sich nicht deprimieren lassen! Schwimmt die Seele im Wasser? Der Geist Gottes schwebt jedenfalls über den Wassern …
Unsere Aloysius-Wallfahrt begannen wir, meine Frau Suchra und ich, in Desenzano am Gardasee, und da in Castiglione selbst kein passendes Hotel zu finden war, nahmen wir, wie gesagt, Quartier im benachbarten Solferino, in einem nach Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, benannten Hotel. Im Vestibül des Hauses, an der Rezeption, wo wir eincheckten, unsere Vouchers vorweisen und uns ausweisen mußten, neben einer Theke, die wie eine riesige, glänzend gelb schimmernde Plastikwurst oder ein aufgeblähter Dickdarm, sicher von einem ambitionierten Designer, gestaltet war, standen Gegenstände herum, ramponierte Tische und Sessel und durchgesessene Fauteuils, auch landwirtschaftliche Geräte, alles in einem malerisch beschädigten, desolaten Zustand. Der ästhetische und moralische Hintergedanke dieser zerrütteten Gegenstände war wohl, an den gräßlichen Krieg und das grauenhafte Gemetzel der Schlacht bei Solferino am 24. Juni 1859 zu erinnern, die mit der Niederlage Österreichs gegen das Königreich Sardinien und Frankreich unter Napoleon III. endete und den Namensgeber des Hotels zu seiner großen humanitären Anstrengung und Tat, der Gründung des Roten Kreuzes, bewogen hat.
Genau hundert Jahre vor dem Tod Jean-Henri Dunants im Jahr 1910 starb in der Lombardei und zwar in Mantua der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer. Er starb aber bekanntlich keines natürlichen Todes, sondern er wurde hingerichtet, und ich wollte nach der eigentlichen Wallfahrt nach Castiglione auch der Spur Hofers folgen und jene Stelle aufsuchen, wo die grausame Prozedur der Exekution bei der Zitadelle an der »Porta nuova« im Norden Mantuas stattgefunden hat. Einige Zeit vor der Wallfahrt hat mir, seinem »Doktorvater«, ein ehemaliger Student und Dissertant aus Saarbrücken, der Luxemburger Pit Schlechter, der über das Luxemburger Volksstück, das triviale Theater, wie es von Laien, örtlichen Vereinen, gespielt und gepflegt wird, promoviert hatte, auf mein Buch »Lebenszeichen« hin, in dem unsere gemeinsame Zeit im Saarland in einigen Geschichten vorkommt, einen Brief geschrieben, aus dem ich zitieren darf: »Wiederholt war ich auch bei den Amischen in den USA, denen Sie in Ihrem Buch eine ›archaische‹ Landwirtschaft zuschreiben, was so nicht ganz zutrifft. Sie benutzen zwar immer noch Pferde statt Traktoren, entwickeln und benutzen aber hochmoderne Geräte und Maschinen für den Pferdezug. Ansonsten genieße ich das Landleben, übrigens nicht weit von dem Ort, aus dem einst der junge Mann kam, der als Offizier in französischen Diensten Ihrem Andreas Hofer in Mantua nach einem etwas stümperhaften Exekutionsversuch den Gnadenschuss geben musste.« Der zitierte junge Mann, der Andreas Hofer den Gnadenschuß geben mußte, hieß Michel Eiffes und stammte aus dem Ort Befort, wo er nach seinem Militärdienst noch dreißig Jahre lang als angesehener Gastwirt und Bürgermeister lebte.
Das Andreas-Hofer-Lied »Zu Mantua in Banden / der treue Hofer lag« wurde zur Tiroler Landeshymne. Und im viel beschworenen und besungenen »heiligen« Land Tirol, in der Innsbrucker Hofkirche, hat er – bzw. seine sterblichen »Überreste« – nach der Beisetzung in der Kirche San Michele in Mantua und nach der Odyssee seiner Leiche von Mantua mit Zwischenstationen unter anderem in Verona und Sterzing seine letzte Ruhestätte gefunden. Er ist hier der prominenteste Tote, da Kaiser Maximilian, der vor 500 Jahren in der Welser Burg gestorben ist, das für ihn gedachte Mausoleum mit den »Eisernen Mandern« nicht in Anspruch genommen hat und in Wiener Neustadt seine Grablege fand. Wie mag dieser Transport eines Toten vonstatten gegangen sein? Im Welser Museum gibt es ein anschaulich gestaltetes Diorama jenes Zuges, mit dem der tote Kaiser in seinem hölzernen Sarg auf dem von drei Pferdepaaren, also dreispännig gezogenen Paradewagen in die Welser Stadtpfarrkirche zu einer ersten Einsegnung und Exequie gebracht wird, begleitet und eingerahmt von einer Schar Ministranten und Akolythen, etliche mit Fahnen oder brennenden Kerzen, und zahlreichen hohen Klerikern und Geistlichen und Priesteramtskandidaten in Talaren und Chorhemden, sicher auch von Bischöfen aus den Erzdiözesen Salzburg und Passau und von Adeligen, vermutlich vor allem Aristokraten aus dem Geschlecht der Polheimer, in deren Stadtschloß, in einem Erkerzimmer, Maximilian am 12. Jänner 1519 verstorben war. Und weil, wie gesagt, Winter war, wird der weitere Leichentransport über Enns, St. Pölten und Wien nach Wiener Neustadt zumindest klimatisch keine Schwierigkeiten bereitet haben. Über diese Schwierigkeiten, im heißen Sommer eine Leiche – in diesem Fall jene Oswalds von Wolkenstein, des Diplomaten, Minnesängers und Spruchdichters – über Berg und Tal von Meran nach Brixen zu bringen, hat Dieter Kühn in seinem Buch »Ich Wolkenstein« ausführlich und eindrucksvoll geschrieben, auch Auskünfte verwendet, die er von einem Pathologen bekommen hat. Ja, selbst in der Bibel heißt es im Zusammenhang mit der Totenerweckung des Lazarus (Joh. 11,39), des Bruders von Martha und Maria, drastisch, daß Martha zu Jesus sagt: »Er ist schon vier Tage tot«, »Iam fetet« in der lateinischen Vulgata. Luther übersetzt: »Herr, er stinckt schon, denn er ist vier Tage gelegen«.
Die »letzte Ruhestätte« hat Oswald in Neustift, im Kloster der Augustiner Chorherren, eigentlich vorerst auch nicht gefunden. Nachdem sein Leichnam lange verschollen war und erst 1973 am alten Friedhof an der Außenmauer des Doms in Brixen entdeckt wurde, hat man die Knochen des Skeletts und den Schädel schließlich in Linz und Bern untersucht und anhand einer angeborenen Mißbildung des rechten Auges, wie auf dem bekannten Porträt ersichtlich, identifiziert. Erst dann konnte er wirklich und ein zweites Mal »beigesetzt« werden. Dann erst hat also der unruhige und streitbare Geist, der in viele Prozesse und Scharmützel und Händel verwickelte Baron, seine Ruhe und ewigen Frieden gefunden …
Im Fall von Kaiser Maximilian ist davon die Rede – nachzulesen etwa im Buch »Maximilian I.« von Hermann Wiesflecker, dem aus Lienz gebürtigen Grazer Historiker –, daß der Kaiser testamentarisch verfügt hat, daß er nach dem Ableben geschoren werden will, daß ihm die Zähne gebrochen werden sollen und daß er in seinem Eichendoppelsarg mit Asche und Kalk überschüttet werde. Die Redewendung »in Sack und Asche Buße tun« ist laut Lutz Röhrichs »Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten« bereits biblisch belegt (Ester 4,1). Und der fromme Kaiser hat sich nicht nur wegen eines venerischen Leidens als Sünder gefühlt. Er war demütig und »reumütig« …
Auch ich habe Exhumierungs- und Umbettungsvorgänge miterlebt: Die Mutter meiner Frau, also meine Schwiegermutter, wurde im Klagenfurter Hauptfriedhof in Annabichl beerdigt. Es war jedoch der Wunsch meines Schwiegervaters, eines gebürtigen Albaners und Moslems, daß sie ein Jahr nach dem Begräbnis in die Nähe seiner Wohnung in der Dag-Hammerskjöld-Siedlung auf den Friedhof Sankt Martin umgebettet werde, damit er sie sozusagen in seiner Nähe hat und ein Friedhofsbesuch im weit entfernten Annabichl nicht immer eine »Weltreise« mit den Stadtbussen und öfterem Umsteigen nötig machte. Umgebettet wird ganz diskret nachts oder im Morgengrauen, wenn die Einwohner der Stadt noch schlafen. Mein Schwiegervater Teka Selman – sein Name Suliman wurde im Krieg eingedeutscht – schlief in jener Nacht aber nicht, sondern begab sich aus einem gewissen Mißtrauen, das er sich wohl im Krieg und in Lagern in Exjugoslawien und Italien »zugezogen« hatte, und auch, weil ihm in seinem Flüchtlingsleben oft übel mitgespielt worden war, auf den Friedhof, um mit eigenen Augen zu sehen, daß nicht geschwindelt und der Sarg wirklich ausgegraben und erhoben und schließlich im neu angemieteten Grab im Friedhof Sankt Martin in die am Vortag ausgehobene Grube versenkt wurde. Er wollte nicht für nichts und wieder nichts die nicht unerheblichen Kosten und Gebühren bezahlen … Er wurde aber von den Arbeitern der Bestattung, den »Pompfüneberern«, die absolut kein Publikum duldeten, verscheucht und konnte nur aus der Ferne dem Geschehen folgen … Nun ruht auch er in diesem Grab, er ist zehn Jahre nach seiner Frau im zweiundneunzigsten Lebensjahr verstorben. Sein Begräbnis, den Kondukt, hat der brave, unermüdlich tätige und vielbeschäftigte Pater Anton Wanner, Kapuziner und Krankenhausseelsorger, freundlicherweise gestaltet und in seiner Grabrede von jenen Propheten, namentlich Abraham, gesprochen, die Christen, Juden und Moslems gleicherweise kennen, anerkennen und verehren. Es war wahrlich ein interkonfessionelles Begräbnis …
Als vor einigen Jahren ein Kind, die neunjährige Tochter eines albanischen Moslems in der erwähnten Dag-Hammerskjöld-Siedlung auf tragische Weise verbrannte und ums Leben kam und ebenfalls nach christlichem Ritus von einem katholischen Geistlichen auf ihrem letzten Weg »begleitet« wurde, hat der Betreffende Schwierigkeiten mit dem Seelsorgeamt der Diözese Gurk bekommen. In Leserbriefen wurde dann aber die Kaltherzigkeit des Kirchenrechts kritisiert, noch dazu, wo es sich nicht um einen Selbstmörder wie Werther, sondern um ein Kind, ein unschuldiges Mädchen, handelte … Begräbnisse von Anders- oder auch »Ungläubigen«, aus ihrer Kirche Ausgetretenen, zeremoniell und liturgisch zu moderieren, ist, um es ein wenig flapsig auszudrücken, zu einem bevorzugten »Geschäft« der Altkatholischen Kirche, der Markus-Kirche in der Klagenfurter Kaufmanngasse in der Nähe der Stiege, die nach einem der Gründer der Altkatholischen Kirche Johann Joseph Ignaz von Döllinger benannt ist, geworden. Der zuständige Ortsbischof der Altkatholiken wird vor allem für seine rhetorischen und spirituellen Fähigkeiten von vielen dankbar geschätzt und auch bewundert.
Altkatholisch wurde auch die Schriftstellerin Brigitte Schwaiger auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Ein Ehrengrab, wie sie es verdient hätte, hat Brigitte Schwaiger nicht bekommen … Den Wunsch, den sie einmal geäußert hat, ein Grab zwischen den Grabstätten von Gerhard Bronner und Friedrich Torberg zu bekommen, hat man ihr auch nicht erfüllt. Gewünscht hätte sie sich vielleicht auch, daß der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, für den sie eine große, unglückliche Sympathie empfand, sie auf ihrem letzten Weg begleitete … Mit ihrem surrealistischen, irrwitzigen Humor, hat sie sich ja brieflich an den Kardinal gewandt und vorgeschlagen, er und sie sollten aus der Kirche austreten, mosaisch werden und heiraten … Altkatholisch beerdigt wurde auch der eingangs erwähnte Dichter und Lehrer am Slowenischen Gymnasium Janko Messner, der sich, obwohl sein Bruder katholischer Priester war, über die Rolle der katholischen Kirche im Volksgruppenstreit und in der Minderheitenfrage oft geärgert und in geharnischten Briefen an das Ordinariat bitter beschwert hat. Katholisch geblieben, wenn auch in kritischer Distanz zum Klerus und zur Hierarchie und zum Bischof, wie die Erzählung »Das Kind« zeigt, ist Christine Lavant. Viel besucht ist das Grab Ingeborg Bachmanns auf dem Friedhof Annabichl in Klagenfurt, wohin man sie nach ihrem rätselhaften Tod in Rom überführt hat. Ihrer Grabstätte hat sich nachträglich ihre Heimatstadt Klagenfurt im Sinne eines Ehrengrabs angenommen, Kritiker sagen »bemächtigt« … Uwe Johnson hat in dem Buch »Eine Reise nach Klagenfurt« seinen Besuch von Bachmanns Grab und der kritisch gesehenen Landeshauptstadt Klagenfurt protokolliert. Werner Berg hat unter dem Eindruck des Buches »Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod« von Jean Améry, der in einem Salzburger Hotel freiwillig aus dem Leben geschieden ist, auch diesen Ausweg gewählt. Der Wunsch, auf dem Salzburger Kommunalfriedhof beerdigt zu werden, wurde Berg erfüllt. Die Welt der Unglücklichen ist eine grundsätzlich andere als die Welt der Glücklichen, heißt es sinngemäß bei Améry.