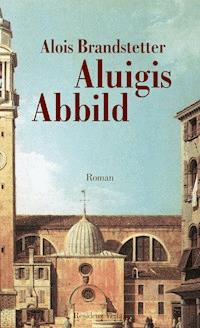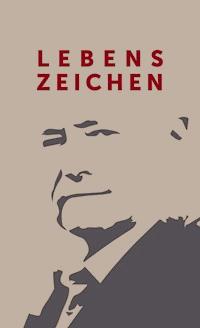Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Alle Jahre wieder ...", so beginnt eines unserer geläufigsten Weihnachtslieder, und es liegt gewiß etwas Beruhigendes in dieser gleichbleibenden Wiederkehr. Und doch ist kein Jahr wie das andere, und wenn die Adventszeit naht, wenn es draußen kalt und in der Stube geheizt ist, dann rückt man wohl so manches Mal mit der Familie und guten Freunden zusammen und erinnert sich gegenseitig an Geschichten und Begebenheiten. Sie liegen vielleicht schon lang zurück, aber sind im Gedächtnis geblieben, weil sie für die Erwachsenen etwas Besonderes oder für die Kinder etwas Neues waren. Da mischt sich dann oft Behagliches mit Bewahrtem. Solcherart sind auch die Geschichten, die Alois Brandstetter in diesem Buch erzählt. Es sind Erinnerungen an die Winter und Weihnachtsfeste seiner Jugend, die er in dem kleinen Ort Pichl in Oberösterreich verbracht hat in den Jahren nach dem großen Krieg und der bösen Herrschaft. Aber ob Brandstetter vom Eisstockschießen, vom Sternsingen oder von frühen Skiversuchen berichtet, vom ersten Radioapparat oder von einer großen Überschwemmung, er tut es erfrischend unsentimental und immer detailfreudig und genau. Wenn volkstümliche Erzählliteratur heute noch möglich ist, dann so.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALOIS BRANDSTETTER
VOM SCHNEE DER VERGANGENEN JAHRE
Winter- und Adventgeschichten
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2009 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4306-3
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1521-3
Advent
In der Vorweihnachtszeit des Jahres 1948 bekamen wir das erste Radio. Meine Eltern waren ursprünglich sehr gegen das Radiohören eingestellt. Schließlich gaben sie aber auf das Drängen von uns Kindern in Gottes Namen nach, die Mutter fuhr nach Wels und brachte ein Gerät nach Hause.
Der Vater war recht konservativ und sträubte sich gegen alles Neue, so auch gegen den Volksempfänger des Dritten Reiches. Da steckt der Teufel dahinter, sagte er. Er war über die Erste Republik und den Ständestaat hinweg Monarchist geblieben. Die Ablehnung des Volksempfängers war seine Art des Widerstandes. Er richtete sich gegen die technische Neuerung, aber auch gegen den gottlosen Geist, der aus ihr heraustönte. Vater hatte freilich plausible und praktische Gründe für seine Verweigerung. So redete er sich dem Bürgermeister gegenüber, der zu ihm gesagt hatte: Nun, Müller, du wirst dir doch auch einen Radio anschaffen, auf seine Gleichstromanlage heraus, die das Betreiben des Volksempfängers, der auf Wechselstrom angewiesen sei, leider nicht erlaube. In der Familie aber sagte er: Wenn einer keinen Radio hat, dann kann auch niemand kommen und zu ihm sagen, er hat einen Feind- oder Schwarzsender gehört.
Es war ein kalter Tag Anfang Dezember, als die Mutter mit dem 12-Uhr-Autobus aus Wels mit einem Radio heimkehrte. Sie hatte schon am Morgen zu meinem Bruder Josef und mir gesagt, daß wir sie zu Mittag vom Omnibus (sie sagte Onibus) abholen sollen. So standen wir zur festgesetzten Zeit an der Haltestelle und sahen, wie die Leute aus dem überfüllten Autobus stiegen. Mittendrin eine kleine Frau mit einer großen Schachtel, unsere Mutter mitsamt dem Radio! Sie gab es uns zum Tragen. Das Paket war schwer und ließ so schon vom Gewicht her einiges erwarten. Zuhause wurde es vor den Augen der versammelten Familie aufgeschnürt und das Radio auf den großen Tisch gestellt. Unser neues Radio war ein Apparat mit einer ausgeprägten Vorder- und Rückseite. Die Front war eine richtige Fassade, ein mit zwei kleinen hölzernen Halbsäulen an den Ecken regelrecht architekturmäßig gestalteter Prospekt, auch orgelähnlich, während die Rückseite unansehnlich war, flach und mit einem Brett mit einigen Löchern recht lieblos vernagelt. Vorne hui, hinten pfui, sagte Bruder Felix. Das Gehäuse machte insgesamt einen sehr massiven Eindruck, es war Vollbau. Damals wurden von der Radioindustrie auch noch Tischler und Maler beschäftigt. Gestrichen war der Kasten wie ein feines Schlafzimmermöbel.
Seitlich war ein Schalter angebracht, mit dem man Lang-, Mittel- und Kurzwelle einstellen konnte. Die Mutter sagte aber, daß für uns nur die Mittelwelle in Frage komme. Außerdem habe der Verkäufer gesagt, daß man die meisten Namen, die vorne darauf geschrieben stehen, vergessen könne, für uns, habe er gesagt, komme nur Linz und München in Betracht. München sei für die Wettervorhersage sehr günstig. Die Namen der Stationen waren aber auch zu verrückt, ich hielt die meisten für reine Phantasienamen: Sottens, Hilversum, Bordeaux, Ceneri, wo hat denn einer schon so etwas gehört! Da schau her, sagte der Vater, da sind auch Feindsender dabei. Mir leuchtete als Kind auch sofort ein, daß für uns, eine Bauernfamilie auf dem Land, höchstens die Mittelwelle in Frage kam. Die Langwelle war sicher für die reicheren Leute in der Stadt. Die Kurzwelle wieder brachte ich mit einigen ärmeren Arbeiter- und Kleinhäuslerfamilien in Zusammenhang. Die Ultrakurzwelle war seinerzeit noch nicht erfunden.
Die Mutter sagte, daß der Verkäufer den Radio schon eingestellt und gesagt habe, daß wir ihn immer so lassen können, wie er ihn eingestellt hat. Die Mutter hatte dem Verkäufer gesagt, daß der Vater vor allem die politischen Nachrichten und sie und die Kinder eigentlich nur das Wunschkonzert, das immer recht schön sein soll, hören möchten. Die Mutter hatte den Verkäufer gefragt, wie man den Radio einschalten muß, damit man die politischen Nachrichten und das Wunschkonzert hören kann. Da hat ihr der Verkäufer das Radio gleich eingestellt.
Mein Bruder Felix, der die Hauptschule besucht hatte und physikalisch und technisch der Verständigste unter uns war, hatte zur Mutter gesagt, sie müsse einen Radio mit 6 Röhren verlangen. Mit 6 Röhren, sagte er, bekommt man schon eine ganz gute Musik. Als ich später einem Freund erzählte, daß wir einen Radio mit 6 Röhren bekommen haben, sagte dieser, das sei gar nichts, über 6 Röhren könne er nur lachen, sie hätten daheim nämlich ein Radio mit 12 Röhren. Außerdem müsse man das Radio sagen und nicht der Radio. Er fragte mich, ob ich vielleicht meine, daß das Wort Radio vom Radi komme, den man auf Hochdeutsch als Rettich aussprechen müsse. Dann zeigte er mir mit den Händen, wie groß ihr Radio mit den zwölf Röhren sei. So groß, sagte ich, ist euer Radio? Mich ziemt, du verwechselst den Radio mit dem Kachelofen, sagte ich.
Die Frage der Anzahl der Röhren spielte in den Gesprächen der Kinder über die Radios eine große Rolle, ähnlich wie die Frage der Anzahl der Steine bei den Uhren. Wenn einer seine Firmuhr bekam, war die erste Frage: Wie viele Steine hat deine Uhr? Außerdem mußte es eine Armbanduhr und durfte es keine altmodische Taschenuhr sein. Wenn einer sagte, seine Uhr habe 15 Steine, dann verstummte das Gespräch. 15 war viel, mehr konnte man nicht erwarten. 15 bedeutete einen reichen Göden. Eine Uhr, die etwas wert war, mußte am Zifferblatt Made in Switzerland und 15 Jewels stehen haben. Alles andere nannten die Kinder einen Prater. Ein anderer wichtiger Punkt war die Garantie. Wieviel Garantie, fragte ich den Nachbarsbuben, hast du auf dieser Uhr? Ein Jahr, sagte er. Da kann ich nur lachen, sagte ich triumphierend, meine Gödenuhr hat 12 Monate Garantie!
Lange Zeit konnten wir kein Radio brauchen, weil wir es nicht anschließen konnten. Vater betrieb neben seiner Mühle einen kleinen Generator, der das Haus mit Gleichstrom versorgte. Der Strom aber, den der Vater von der Mühle ins Haus herüberlieferte, war für die Mutter und uns eine ständige Quelle des Ärgers. Daß er sich mit diesem Strom nicht schämt, sagte die Mutter. Jetzt schaut euch einmal diesen Strom an, sagte die Mutter zu uns, wenn das Licht der Stubenlampe besonders schwach war und die Stube nur sehr notdürftig beleuchtete. Sicher ist der Müller drüben auf seinen Säcken eingeschlafen und hat vergessen, das Laub vom Rechen der Turbine herauszuheuen. Und wir müssen hier im Dunkeln sitzen, sagte sie, und sehen die eigene Hand nicht vor dem Gesicht. Wenn wir doch auch endlich bei der Stromgenossenschaft angeschlossen würden! Auch unsere Magd beschwerte sich oft über Vaters Strom. Im Winter, sagte sie, muß sie die Kühe bei dieser Finsternis beim Euter angreifen, damit sie spürt, ob sie diese Kuh schon gemolken hat oder nicht.
Leider, sagte sie, ist sie keine Katze, die auch in der Finsternis sehen kann. Vor allem im Winter, wenn der Innbach wenig Wasser führte und Vater seine ganze Wasserkraft für den Mahlgang brauchte, bekamen wir im Haus herüben nur sehr wenig Strom ab. Du hast es gut, spottete einmal ein Nachbar dem Vater gegenüber, du brauchst bei deiner Funsel wenigstens nicht verdunkeln. Das war gegen Ende des Krieges, wo statt der Führerreden aus den Volksempfängern immer die Meldungen über Luftangriffe und den Anflug der Geschwader kamen und Verdunklung angeordnet wurde. Der Winter war für uns während des Krieges und nach dem Krieg bis zu unserem Anschluß an die Stromgenossenschaft immer eine sehr dunkle und düstere Zeit. Dieses Licht, sagte die Mutter, ist nur gut zum Ausdrehen und zum Bettgehen. Bei einer Handarbeit verdirbst du dir nur die Augen. Und sie hätte so viel zu stopfen!
Am Heiligen Abend aber war das Haus hell erleuchtet. Der Vater stellte nämlich am sogenannten Fastweihnachtstag, das ist der Heilige Abend, immer schon am frühen Nachmittag die Mühle ab und kam ins Haus herüber. Seine gesamte Wasserkraft aber warf er an diesem Tag auf den alten Gleichstromgenerator. Jetzt hatten wir es wunderbar hell in der Stube, so hell, daß einem der Raum fast fremd wurde. So ein Licht! sagte die Magd, das ist ein Licht! sagte sie, so ein Licht sollte sie alle Tage haben! Da wäre die Stallarbeit freilich eine Spielerei. Der Vater blickte stolz auf die Glühbirnen. Heute wird ihnen eingeheizt, sagte er. Es kam aber natürlich gerade zu Weihnachten oft vor, daß eine Glühbirne ging. Die Birnen waren so sehr an die Unterversorgung gewöhnt, daß sie dem plötzlichen weihnachtlichen Stromstoß nicht standhielten, Weihnachten war für unsere Birnen wie ein Schock. Die Mutter hatte stets Kerzen in Griffweite. Ohne Kerzen, sagte sie, stünden wir schön da.
Nachdem nun das neue Radio von uns allen gehörig bestaunt und eine Zeitlang ausprobiert worden war, sagte die Mutter, daß wir den Radio jetzt abdrehen und erst am Heiligen Tag zu Mittag, wenn sie aus Rom den Segen des Heiligen Vaters übertragen, wieder einschalten wollen. Das ist ein guter Anfang und gewissermaßen eine Einweihung für unseren Radio, sagte sie. In der Adventszeit, in der Fastenzeit und an Freitagen, sagte sie, gehört sich das Radiohören nämlich nicht. Die Mutter rechnete das Radiohören von Anfang an zu jenen Lustbarkeiten, die einem Kirchengebot zufolge – wie das Hochzeithalten – zu den sogenannten geschlossenen Zeiten nicht angebracht waren. Das Radiohören fiel ihrer Meinung nach eindeutig unter Lust und Vergnügen. Vergnügungen, auch unschuldige, gehörten aber nicht zum Ernst dieser Zeiten. So schickte sich etwa am Freitag auch das Ausgehen nicht. Am Freitag gehen die Rotzigen aus, sagte die Mutter. Jährlich aber am 25. November, dem Namenstag der heiligen Katharina von Alexandrien, der Patronin der Müller und zugleich der heiratswilligen Jungfrauen, drehte die Mutter den Knopf des Radios nach links und sagte: Kathrein stellt den Tanz ein.
Die Seuche
Im Winter des Jahres 1952 brach in Oberösterreich die Maul- und Klauenseuche aus, kurz vor Neujahr befiel sie auch unsere Kühe. Die Maul- und Klauenseuche hat ihre Zeit im Winter. Gegen Wärme ist der Erreger empfindlich, Hitze gar bringt ihn um, sagte der Tierarzt. Menschen können von der Maul- und Klauenseuche nicht befallen werden. Der Mensch hat kein Maul und keine Klauen, sondern einen Mund, Finger und Zehen mit Nägeln. Der Mensch ist kein Paarhufer. So ist das also, dachte ich, daß einen schon die Sprache vor Krankheiten schützen kann. Und dann war doch von einem Burschen die Rede, der die Seuche angeblich bekommen, dabei alle Zähne verloren und viel leiden hat müssen.
Unter der Bevölkerung herrschte in jenem Winter eine große Ansteckungsangst. Die Leute hatten eine starke Scheu vor Bazillen, jeder hielt den anderen für infiziert und für einen Überträger von Bazillen. Damals litten auch viele alte Bekanntschaften und nachbarliche Freundschaften. Mit Bazillen, sagte der Tierarzt, hat diese Seuche übrigens gar nichts zu tun, hier handelt es sich um Viren. Die Leute blieben aber bei den Bazillen. Mach’ einmal der Landbevölkerung den Unterschied zwischen Bazillen und Viren klar, seufzte der Tierarzt resignierend. Es gäbe zwischen Bazillen und Viren aber einen Unterschied wie zwischen Pferden und Kühen. Das Beispiel mit Pferd und Kuh war schlagend. Also Viren, sagen Sie, Herr Doktor. Die Tierärzte waren in dieser kritischen Zeit bei der Bevölkerung nicht beliebt, die Viehbesitzer hielten die Tierärzte selbst für die großen Seuchenausbreiter. Die Bauern gewöhnten sich ab, die Tierärzte mit Handschlag zu begrüßen.
Noch Jahre später, als sich der Tierarzt ein Haus baute, sagten die Bauern: Das verdankt er der Seuche. Dieses schöne Haus verdankt der Herr Doktor einzig und allein seinen Viren. Viribus unitis, sagte der Tierarzt, ein Mann mit gutem Humor und großer Gelassenheit, als ihm dieses Gerücht zu Ohren kam. Was hat er gesagt?, fragten die Leute. Die Bauern stöhnen und seufzen, sagte der Obmann des Bauernbundes, und der Herr Doktor fährt wöchentlich zum Commers seiner Verbindung nach Wels, Gaudeamus igitur singen. Des einen Leid, des andern Freud, sagten die Menschen.
Die Weihnachten jenes Jahres habe ich als sehr traurig in Erinnerung, es wollte nirgends Weihnachtsstimmung aufkommen, sozusagen nicht ums Verrecken. Es gab bereits einige verseuchte Häuser in unserer Gemeinde, und es wurden ständig mehr. Dabei ging die Seuche nicht konsequent und Haus um Haus vor, sondern sprunghaft. Das Glück ist eine blinde Kuh, sagte der Tierarzt. Dem Herrn Doktor, sagten die Leute, ist jeder recht. Am Schluß hatte die Seuche praktisch kein Haus vergessen und ausgelassen. Zum Rosenkranz am Heiligen Abend beteten wir damals ein zusätzliches Gesätzchen mit der Meinung: Gib, heiliger Leonhard, daß uns Gott das Vieh im Stall bewahrt.
Meine Familie war in Sorge wegen des Geschäftes. Vater hatte im Jahre 1950 seine Schwarzbäckerei, die er vor dem Krieg betrieben hatte und die als Gewerbeberechtigung, entsprechend der alten Erlaubnis und Lizenz des sogenannten Maria-Theresia-Patents, auf der Mühle war, wiederaufgenommen und fürchtete darum, daß sich während einer dreiwöchigen Quarantäne, wie sie über die verseuchten Häuser verhängt wurde, die kaum gewonnenen Kundschaften wieder verlieren und verlaufen könnten. Diese Befürchtung betraf vor allem auch die Bauern, die zunehmend in jener Zeit ihre eigene Bäckerei einstellten und sich im Umtausch mit Getreide oder, wie andere Kundschaften auch, mit Brot vom Bäkker versorgten. Auch bei den Müllern war die Konkurrenz groß, ja, es war die Zeit des großen Mühlensterbens. Im österreichischen Müllereiwesen, sagte der Vater, grassiert die Seuche schon lange. So dachte der Vater diesmal daran, sein Vieh abzuschaffen und durch Viehlosigkeit möglichen Geschäftsschwierigkeiten vorzubeugen, kam aber nicht mehr dazu. Es war ein Freitag nach Weihnachten, kurz vor dem Neujahr – Vater hatte eine Menge Brot gebacken, normales Bauernbrot und viel sogenanntes Störbrot, wie es um Weihnachten und Neujahr in Oberösterreich der Brauch ist –, als die Kühe in unserem Stall plötzlich appetitlos dastanden und nicht mehr fressen wollten. Im Maul aber hatten sie bald eiternde Blasen, das untrügliche Zeichen der Krankheit. Da hatte also alle Vorsicht und alles Streuen von Chlorkalk bei den Türen und Toren nichts geholfen, vom heiligen Leonhard ganz zu schweigen. Vater war nun der Ansicht, daß sich an der Seuche nichts mehr ändere, ob wir sie heute oder morgen anmeldeten und bekanntgäben. So wollen wir damit noch ein wenig zuwarten, meinte er, und wenigstens noch das vorrätige Brot verkaufen. Wir können es ja nicht dem Vieh füttern, sagte er, noch dazu jetzt, wo das Vieh gar nicht mehr fressen kann. Es wanderte im übrigen nicht selten Brot, in Trank aufgeweicht, in den Barn der Kühe, wenn sich Vater um einen Schuß, das heißt einen Ofen, verrechnet hatte.
Nachdem die Mehrzahl der Viehhaltungen von der Seuche befallen war, normalisierte sich das Zusammenleben allmählich wieder. Anfangs, als uns die Epidemie erreichte, galten die wenigen von der Seuche Heimgesuchten als aussätzige Außenseiter, nachdem das Seuchenschicksal aber den überwiegenden Teil der Bauernhöfe ereilt hatte und so demokratisiert worden war, galten im Gegenteil die Besitzer der wenigen noch nicht verseuchten Höfe als die suspekten Sonderlinge, die auch keine weitere Rücksicht mehr verdienten. Hatten sie die Seuche vielleicht überhaupt verheimlicht? Die Statistik hatte sie zu Ausnahmen gestempelt und so ins Unrecht gesetzt.
Am Schluß, nach dem Entsetzen und der großen Wut und dem Fluchen über die Seuche, kam bei den Verseuchten sogar Galgenhumor auf. Es fanden sich auf den winterlich zugefrorenen Teichen in Verletzung der Quarantänebestimmungen viele Eisschützen aus verseuchten Häusern zusammen, die Teiche waren bald fast völlig in der Hand der Verseuchten, auf einem einzigen Teich trafen sich die Seuchefreien, die freilich nur als Nochnichtverseuchte angesehen wurden. Die Teiche der Verseuchten nannten die Schützen scherzhaft Seuchenherde. Kam ein neuer Schütze hinzu, so fragte er: Darf ich mich, bittschön, bei euch anstecken? Die Schanzen wurden nicht mehr mit Sechse Neune Aus verrechnet, sondern als Sechse Neune Seuch gezählt. Die Stuben aber, in denen verseuchte Bauern zum Kartenspielen zusammentrafen, hießen Pesthöhlen. Die Redensarten von Kühen und Kälbern, die in der Mundart an sich eine große Rolle spielen, wurden nun, zum Teil umgemünzt und in Anspielung auf die aktuelle Situation, besonders häufig und bewußt gebraucht. Wagte einer etwa beim Schnapsen oder Kratzen gefährlich viel, so sagte er auftrumpfend: Ist die Kuh hin, soll das Kälbl auch hin sein! Tat einer besonders groß mit seinem Blatt, so neckte ihn der Gegenspieler mit: Die Kühe, die am meisten brüllen, geben die wenigste Milch! Ein schlechtes Blatt wurde als ein verseuchtes Blatt verflucht. Aber auch außergewöhnlich gute und wertvolle Karten und Gänge wurden damals wegen ihrer durchschlagenden Wirkung als Pest, Epidemie oder Seuche bezeichnet; so kam der sogenannte Durchmarsch beim sogenannten Preferanzen, eine besonders radikale Spielart, zur Bezeichnung Seuche. Hier mußte man alle Stiche machen, durfte somit keinen schonen. Spielte einer sofort nach dem Kartenverteilen aus, so nannte man diese prompte Spielweise die kuhwarme. Ein unzusammenhängendes Blatt mit sporadischen Vertretern der Farben und Werte nannten die Bauern Saumist. Hiezu ist zu wissen, daß der Schweinemist im Gegensatz zum strohigen Kuhmist sehr kurzfaserig und als kompostierter Dung auch leicht zu stechen und fassen ist. Einer sah fragend den Talon an und sagte: Kuh- oder Saumist, das sollte ich halt jetzt wissen. Beim Romme oder Rummy, dessen mundartliche Bezeichnung verdächtig ans Wort Remmeln anklang, was seinerseits vom Wort Rammeln kommt und von den Hasen gesagt wird, hieß der Jolly Joker der Tierarzt. Den Talon aufheben nannten einige künstlich befruchten. Und so fort.
Zu Beginn aber, als unsere Kühe erkrankten, waren die Quarantänebestimmungen noch sehr streng und von Lässigkeit und Großzügigkeit weder bei der Veterinärbehörde noch bei den Betroffenen selbst die Rede. Das alles war sehr ernst und kein Spaß.