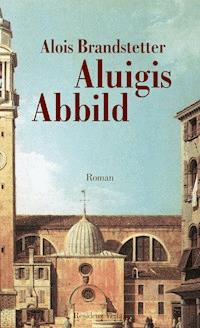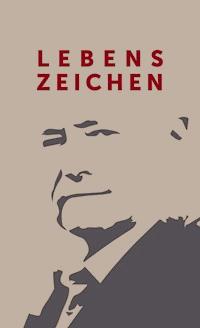
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Lebenszeichen ist nach der Definition des Duden ein "Anzeichen oder Beweis dafür, dass jemand (noch) lebt. Herzschlag und Atem sind die wichtigsten Lebenszeichen." Alois Brandstetter Von Adalbert Stifter bis zum Plastikdübel, von Sebastian Brants "Narrenschiff" bis zur Alarmanlage, die sich die Gattin des Autors zu Weihnachten wünscht, von heiligen Reliquien bis zu unheiligen Frömmlern: Alois Brandstetter widmet sich gleichermaßen neugierig, scharfsichtig und ironisch den Details des Alltags und den großen Fragen des Lebens. Begegnungen mit seltsamen Zeitgenossen oder zeitgeistigen Begriffen werden zum Anlass für Überlegungen voller Wissen und Lebensklugheit. Die "Lebensbescheinigung", die Brandstetter dem deutschen Renten Service jährlich abliefern muss, inspiriert ihn zu einem der kräftigsten und hintersinnigsten "Lebenszeichen" dieses wunderbar vergnüglichen Bandes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Brandstetter
Lebenszeichen
Wir danken für die Unterstützung:
Einige Texte sind in gekürzter oder veränderter Formbereits in Zeitungen oder Zeitschriften erschienen.
© 2018 Residenz Verlag GmbHSalzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Thomas Kussin/buero 8Lektorat: Jessica Beer
ISBN Print 978 3 7017 1702 6ISBN eBook 978 3 7017 4582 1
Inhalt
Lebenszeichen
Stifter
Brandstatt
Brandstetters Narrenschiff
Namenkunde
Rückbau
Bauleute
Kaufleute
Aktivraucher und Passivraucher
Zeitgenossen
Modemacher
Spieler
Erfinder und Heimwerker
Wie die Tiere
Kinder
Glaubensfragen
Die lustigen Alten
Das gefundene Fressen
Geschmacksverstärker
Wetter
Freundschaft
Doppelleben
Reliquien und Souvenirs
Dreimal Weihnachten
Lebenszeichen
Jahr für Jahr muß ich der Deutschen Post AG, Niederlassung Renten Service in Berlin, eine sogenannte Lebensbescheinigung (Life Certificate, Certificat de vie), bestätigt von einer österreichischen Behörde und von mir beglaubigt unterzeichnet, senden, damit ich weiterhin meine deutsche Rente überwiesen bekomme, die mir auf Grund meiner dreizehnjährigen Tätigkeit an der Universität des Saarlandes zusteht und für die ich, auch wenn sie nicht besonders hoch ist, Deutschland mein Leben lang dankbar war … Lebensbescheinigung, auch Lebensnachweis, lautet der amtliche Ausdruck für das, was man umgangssprachlich vielleicht Lebenszeichen nennt. Ein Beamter bestätigt, bekräftigt, bescheinigt und beglaubigt, daß sich der Bittsteller am und vor dem Schalter bewegt hat … Da ich eigentlich spät, aber doch, wie es sich gehört, ein Testament »errichtet« oder von einem Notar errichten habe lassen, und für den Fall der Fälle (Demenz, Alzheimer) auch die Frage der »Sachwalterschaft« geregelt habe, müßte dann wohl mein Sachwalter nach Deutschland mitteilen, daß ich, vielleicht beeinträchtigt, aber im Grunde »still alive« bin. Es besteht aber sicher nicht die Gefahr, daß mein als Sachwalter benannter Sohn der deutschen Behörde meinen Tod verschweigt, um weiterhin meine Pension zu kassieren, dafür haben wir ihn zu gut erzogen. Von Betrugsfällen dieser Art liest man freilich manchmal.
Ein Lebenszeichen ist nach der Definition des Deutschen Universalwörterbuchs (Duden) ein »Anzeichen oder Beweis dafür, daß jemand (noch) lebt. Herzschlag und Atem sind die wichtigsten Lebenszeichen.« Und das erste Lebenszeichen des Neugeborenen ist bekanntlich der Schrei, ein unartikulierter, vielsagender Schrei, der Mutter und Hebamme beruhigt. Im »Deutschen Wortschatz« meines Saarbrücker Lehrers Hans Eggers ist zum Stichwort Lebenszeichen auf das Kapitel D, Geistesleben, verwiesen, und darunter auf Brief … Der Brief also als das Lebenszeichen schlechthin. »Von den Analphabeten wissen wir wenig. Sie schreiben uns keine Briefe …« Aus dem Internet erfahre ich zu meinem Erstaunen, daß ich diesen Satz im Zusammenhang mit den schlecht beleumundeten Galatern und dem Galaterbrief des Apostels Paulus in meinem Roman »Ein Vandale ist kein Hunne« erörtert habe. Ein alter Mensch darf sich auch einmal wiederholen. Aber Alter soll auch kein Freibrief für dauernde Wiederholungen sein. Bei den Stammtischen älterer Menschen gibt es freilich immer wieder Teilnehmer, die bald wöchentlich den gleichen, nein, denselben Witz zum besten geben, für den sie freilich immer wieder mit beifälligem Gelächter belohnt werden. Nicht nur die Erzähler, auch die Hörer sind vergeßlich. Die »Narratoren« fragen nicht lange: Kennt ihr den schon?
Das lateinische Wort Narrator klingt, vom Deutschen her angesehen, wie ein Kompositum aus Narr und Tor … Die Sprachwissenschaft spricht bei Wörtern, die in einer anderen Sprache ähnlich klingen, aber anderes bedeuten, von »gegensinnigen« Wörtern. Das Standardbeispiel ist sicher das italienische caldo, das die Italienisch lernenden Deutschen gern als »kalt« mißverstehen, obwohl es bekanntlich im »Gegensinn« »heiß« bedeutet. Caldo und kalt sind »falsche Freunde«, wie es die Sprachwissenschaft nennt. Manchem »Narrator« (deutsch »Redhaus«) möchte man gern in Latein zurufen: Si tacuisses philosophus mansisses, frei übersetzt: Reden ist Silber (Blech), Schweigen ist Gold. Ich habe mir das selbst manchmal leider zu spät gesagt und hätte mich gern in die Zunge gebissen! Aus der Benediktinerregel, über die ich oft nachgedacht und sowohl im Roman »Die Abtei« als auch neuerdings für ein Internet-Projekt der Schweizer Abtei Disentis in Graubünden einiges geschrieben habe, könnte man gerade über die taciturnitas, das Schweigen, eine Menge lernen. Sie ist eine der mönchischen Kardinaltugenden. Viel vom Schweigen zu reden verstößt freilich auch gegen die taciturnitas … Die Verschwiegenheit kann eine Tugend sein, aber auch ein Laster … Oft wenn wir in Sitzungen des Universitätskollegiums auf die Schweigepflicht hingewiesen wurden, handelte es sich um eine nicht ganz »stubenreine« Materie. Und irgend jemand hat es dann doch einem befreundeten Journalisten unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt und der hat es dann zur Unzeit publiziert und hinausposaunt. Es gibt keine Gremien ohne die sogenannten »undichten Stellen«. Es regt sich im Menschen immer und manchmal zur Unzeit die Sensationslust, auch die Lust, etwas Unerhörtes und oft auch Banales mitzuteilen. Auch Gerüchte werden auf diesem Weg ausgestreut …
Es rühren sich die sogenannten »Lebensgeister« oft wie Quälgeister … Die Lebensgeister gehören nach Wehrle-Eggers in das Kapitel Gefühlsleben, im besonderen zu Gemütsart. Gleich in zweien meiner Wörterbücher steht der Beispielsatz: »Ein starker Kaffee erweckte seine Lebensgeister!« Im Deutschen Wörterbuch der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm gibt es im übrigen sehr wohl den in neueren Wörterbüchern in Abrede gestellten Singular Lebensgeist. »Von allen guten Geistern verlassen« zu sein, ist bitter, für den oder die Betroffene, vor allem aber für seine oder ihre Mitmenschen. Schon gar, wenn es sich um Potentaten und Machthaber handelt, die mit Atomkriegen drohen und an deren Geisteszustand es berechtigte medizinische Zweifel gibt …
Ein besonders wichtiges »Lebenszeichen« ist bei sich dem Ende zuneigenden Schriftstellerkarrieren (wie meiner …) der Leserbrief, wenn der lange epische Atem versagt – und die Lust am Recherchieren schwindet. Ist das Leserbriefschreiben unter der Würde eines zünftigen Schriftstellers? Der Leserbrief ist immerhin gelebte Demokratie! Julian Schutting hat freilich gemeint, daß Autoren, die ganz allgemein für Zeitungen zu schreiben beginnen, alsbald auch anfangen würden, die Bedeutung dieser Beiträge zu überschätzen. Die letzte »Publikation« Thomas Bernhards war ein Leserbrief an die Salzkammergut-Zeitung, ein Plädoyer für die Erhaltung der Gmundner Straßenbahn – sein letztes literarisches »Lebenszeichen«! Er hat ja auch sonst das Leserbriefeschreiben und das Verfassen »Offener Briefe« nicht gerade verschmäht … Die Initialzündung einiger seiner berühmten Skandale war ein explosiver »Offener Brief«. Und im Gegensatz zu Karl Ignaz Hennetmair, »Bernhards Eckermann«, bin ich der Meinung, er sei bei seinem letzten Brief an die Salzkammergut-Zeitung noch sehr wohl bei Verstand gewesen … In »Goethe schtirbt« schreibt Bernhard, die letzten Worte Goethes seien nicht »Mehr Licht!«, sondern »Mehr nicht!« gewesen. War Thomas Bernhards persönliches »Vermächtnis« also trotz allem nicht der pessimistische Hype der »Auslöschung«, auch nicht das schlußendliche Dementi alles von ihm Geschriebenen durch Goethe selbst, der sich bei Bernhard als »Vernichter des Deutschen« bezeichnet und als anachronistischer Wittgenstein-Verehrer (!) darstellt –, sondern das rührende Plädoyer für die Erhaltung der Gmundner Stern und Hafferl-Schmalspurbahn?
Es heißt von Martin Luther, daß er gesagt haben soll: »Und wenn ich wüßte, daß morgen die Welt untergeht, so würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen …« Im Vorgarten des Augustiner-Eremiten-Klosters in Erfurt, wo Luther von 1505 bis 1512 Mönch war, gibt es eine gigantische Eiche, die schon Jahrhunderte vor der Reformation gepflanzt worden ist, wenn nicht gar um Christi Geburt … Es ist ein Erlebnis, auf einen mächtigen Baum zu schauen, von dem man weiß, daß ihn schon Menschen vergangener Jahrhunderte angesehen und bewundert und sich in seinem Schatten wohlgefühlt haben. Als ich 60 Jahre alt geworden bin, hat meine Heimatgemeinde mir zur Ehre in der Nähe meines Vaterhauses eine Eiche gepflanzt, weil ich einmal in einer Erzählung das Schlägern vieler Eichen um Aichmühl in meiner Kindheit beklagt habe. Der Baum entwickelte sich in den 20 Jahren seither prächtig. Ach, könnte ich das auch von mir sagen! Bäume als Lebenszeichen … Der Baum blüht auf, der Pate verwelkt.
Thomas Bernhard also, moribund und »todgeweiht«, kurz vor seiner Fahrt zum Salzburger Notar, um sich und sein Lebenswerk in einem Testament dem verhaßten Österreich ganz und gar zu »entziehen«, gibt ein letztes, versöhnliches Lebenszeichen an eine Lokalzeitung … Nicht lange nach diesem Lebenszeichen kam aus Gmunden die Todesnachricht. Franz Kafka hat kurz vor seinem Tod als Vierzigjähriger in seinem Testament um die Vernichtung seines Nachlasses gebeten, Max Brod hat sich das höchste Verdienst erworben, indem er Kafkas Letzten Willen nicht befolgt hat. Es gab und gibt mir immer zu denken, daß das Deutsche einmal Tod mit weichem d (wie in tödlich) und einmal mit hartem t (wie in tot) kennt. Im definitiven Ernstfall gilt die sogenannte Tenuis oder Fortis (der Starklaut).
Es ist heute, im Zeitalter des Internets und Mobiltelephons, von E-Mails und WhatsApp und Skype, so einfach geworden, seinen Freunden (und auch Feinden) Lebenszeichen (oder Drohungen …) zu senden und »Bescheid« zu geben. Man kann eine sorglos und schlampig formulierte Nachricht per Mouseclick und Tastendruck als »Rundbrief« an alle möglichen, im Adreßbuch gespeicherten Teilnehmer loslassen … Und man kann der Nachricht, im Rucksack gewissermaßen, als Attachment (deutsch eigentlich »Befestigung« …) viel zusätzliches Material, vor allem digital photographierte oder eingescannte alte Bilder anhängen und mitgeben. Als Emeritus der Universität Klagenfurt habe ich Anspruch auf alle Mitteilungen des Intranets der Uni, die mich eigentlich nichts mehr angehen … So füllt sich die Mailbox mit Müll. Nur Liebesbriefe und Kondolenzschreiben sollte man per gelber Post aufgeben und zustellen lassen. »Der Tischler macht’s persönlich« – damit könnte auch der Briefträger werben! Egyd Gstättner, Kollege und Freund am Ort, dereinst auch »Hörer« meiner Proseminare an der Universität Klagenfurt, hat geschrieben, daß er von seinem Vater aus der Klinik eine beruhigende Nachricht bekommen hat: »Mir geht es gut. Macht euch um mich keine Sorgen!« Als die Familie Gstättner in der Waidmannsdorfer Straße die Botschaft auf dem Anrufbeantworter entdeckte und abhörte, war Vater Gstättner aber bereits verstorben und beerdigt … Es war also ein postumes Lebenszeichen, eine Botschaft aus dem Jenseits …
Egyd Gstättner war es auch vorbehalten, die auf Band gesprochenen Ansagen als literarische Textsorte zu etablieren: »Please, hold the line!« in »Herzmanovskys kleiner Bruder und andere Geschichten von Künstlern, Müßiggängern und Abenteurern«. Meine, das heißt die mir zugedachte und »angedichtete« Meldung lautet: »Grüß Gott! (Sic!) Ich bin derzeit in der Kirche. Wenn Sie mir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes eine Nachricht hinterlassen wollen, so sprechen Sie bitte nach dem Amen. Amen.«
Amen! Nach den Lebenszeichen kommt unweigerlich einmal auch die Zeit, wo es heißt »klinisch tot«, die Zeit also der Totenschau nach dem Ausbleiben von Herzschlag, Puls und Atem, also »Stillstand«. Als mein Pichler Nachbar, ein alter Bauer, im Sterben lag, hat mich die Nachbarin darüber verständigt und geholt. Wir sind um sein Krankenbett beziehungsweise nun Sterbelager gestanden, haben ein Vaterunser gebetet und gesehen und erlebt, wie er starb. Ableben – welch merkwürdiger und doch vielsagender Ausdruck! Hinübergehen, das Zeitliche segnen … Kurze Zeit später kam der zuständige Kematner Gemeindearzt, um als Amtsarzt seines Amtes zu walten, um den Totenschein auszustellen. Er überzeugte sich, daß der gute Nachbar nicht mehr atmete und schließlich bei der Nagelprobe, einem Stich mit einer Nadel in das Nagelbett unter den Fingernagel des Zeigefingers der rechten Hand an dem hochgehobenen, offensichtlich noch warmen, jedenfalls geschmeidigen Arm, keine Reaktion, also kein Lebenszeichen mehr zeigte. So erteilte der Mediziner als »Leichenbeschauer« die Erlaubnis für die Beerdigung. Ich habe im Saarland in der Ortschaft Spiesen einige Jahre als Untermieter bei einem Tischler oder Schreiner und Bestattungsunternehmer gewohnt und bin dadurch – also durch die Gespräche nach Feierabend mit meinem Vermieter –, was »Funeralien« betrifft, ein wenig vertraut und abgehärtet geworden. Herr H. hat mich auch ermuntert, mir in der Leichenhalle seine Aufbahrungen anzusehen, weil er sehr stolz war, wie er seine Toten, seine »Kunden«, durch Schminke wie lebendig erscheinen lasse, was ihn von seinem Konkurrenten wohltuend unterscheide, der keine so glückliche Hand habe. Manchmal mußte mein Vermieter auch einen tödlich Verunfallten von irgendwoher in Deutschland oder gar im Ausland abholen und mit seinem schwarzen Mercedes heimbringen, was ihn, namentlich wenn es sich um Jugendliche handelte, die vor ihrem Unglück viel Coca-Cola getrunken hatten, viel Trauer und physischen Kummer bereitete, wie er »gern« erzählte.
Die Mediziner haben ein eigenes Vokabular, eine Nomenklatur und Terminologie für Krankheiten, auch einen Hang zu »beschönigenden« Lexemen, die das schwer Erträgliche leichter kommunizierbar machen sollen. Die Zeiten aber, als Medizinstudenten das große Latinum nachweisen oder nachholen mußten, sind vorbei. Heute ist das Englische als »lingua franca« an die Stelle des Lateinischen getreten, und oft handelt es sich bei Krankheitsbezeichnungen um sogenannte »Initialwörter« oder »Akronyme«, also eine Kombination mehrerer Anfangsbuchstaben, die oft auch die Ärzte selbst kaum entziffern und auflösen können. Geschweige denn die so benannten Krankheiten heilen: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom), HIV (Human Immundefizienz-Virus), MS (Multiple Sklerose), FMS (Fibromyalgiesyndrom). »Durch die arbiträre Eigenschaft der Initialwörter kann unerwünschte Motivation vermieden werden, eine Tatsache, die oft in der Medizin genutzt wird«, heißt es in einem linguistischen Fachwerk zum Thema »Sprachliche Kürze«. Und oft verwirrt die Sprache der Mediziner, der »Götter in Weiß«, die »gewöhnlichen Sterblichen« durch »Gegensinn«: Wenn der Arzt jemanden auf eine Krankheit hin etwa per Ultraschall austestet und das Ergebnis seiner Diagnose (deutsch »Erkenntnis«) als positiv bezeichnet, so ist das alles andere als erfreulich … Negativ wäre positiv! Positiv aber oft geradezu wie ein Todesurteil! Es muß aber zur Ehre der Ärzte gesagt werden, daß es unter ihnen viele gibt, die den Willen und die Fähigkeit haben, ihren Patienten auch Hartes »schonend beizubringen«. Die Patienten-Ombudsmänner und Ombudsfrauen haben trotzdem genug zu tun.
Eine eigene Art, über Krankheit und Tod zu sprechen, haben natürlich auch die Theologen und die Kirchen, in vergangenen Zeiten hatte der Klerus geradezu ein Monopol auf Gegenstände des »Lebensgeleites«. Und in vielen Pfarrmatriken ist verzeichnet, ob die Verstorbenen im christlichen Sinne vorbereitet hinübergegangen sind. Ein großer Schrecken aber war die mors repentina, also der unvorhergesehene Tod, wenn der Mensch also nicht mehr mit dem Viaticum, der »Wegzehrung«, »versehen« werden konnte und aus dem Leben gerissen wurde: Non provideri potuit steht gerade bei Selbstmördern oft im Akt … Ich habe mich als »Altgermanist« oft mit Ausgaben der »Kunst des heilsamen Sterbens« nach der lateinischen »Ars moriendi« lehrend beschäftigt, nicht nur vor den Seniorstudenten, sondern auch bei »jungen Semestern«. Zitiert habe ich freilich auch gern einen Satz aus einem Interview Thomas Bernhards: »Die Jugend glaubt nicht an die Unsterblichkeit, die Jugend ist unsterblich!« Das Thema Tod aber bleibt prekär. Wie darüber sprechen, ohne frömmelnd, zynisch, makaber oder lasziv zu wirken? Oder soll man sich an Ludwig Wittgensteins »Tractatus logico-philosophicus« und sein vielzitiertes Schweigen halten? Zweimal mußte ich in meinem Leben Grabreden halten, und keine meiner vielen Reden ist mir so schwergefallen wie diese. Schon wegen des »De mortuis nihil nisi bene«, auch wenn mir natürlich der Sinn nicht nach Denunziation stand. Heute gilt wohl als opinio communis »Pathos meiden!« Aber kann man denn ernst und würdig bei einem traurigen Anlaß wie dem Tod eines Freundes ohne »Pathos« sprechen? Eigentlich heißt das griechische pathos ja »Leiden«, wie das lateinische compassio in einer deutschen »Lehnübersetzung« »Mitleid« heißt und bedeutet. Diese müssen wohl ihren rhetorischen Ausdruck finden.
Auch einen Fehl- oder Mißgriff bei einer Grabrede muß ich hier einbekennen. Ich habe nichtsahnend und ahnungslos den Satz »Die Erde sei dir leicht«, wenn auch in Latein »Sit terra tibi levis« zitiert, der bekanntlich aus der Antike, aus der »Alcestis« von Euripides stammt. Nach dem Requiem sagte Olaf Colerus Geldern, Protonotar und Generalvikar, den ich überaus schätzte und dessen Tod ich bedauere, mit Befremden zu mir, ob ich nicht wüßte, daß der betreffende Satz gern von den Ewiggestrigen, also den in der Nazizeit als »Gottgläubige« Bezeichneten, aus der Kirche Ausgetretenen, verwendet würde und in Kärnten gerade von den katholischen Slowenen als Beleidigung empfunden werde. Das wußte ich tumber tor aus Oberösterreich nicht!
Wiederholt habe ich mir die Grabrede Franz Grillparzers auf Ludwig van Beethoven auf YouTube angehört, gelesen von Albin Skoda. So konnte nur er, Grillparzer, über einen wie ihn, Ludwig van Beethoven, sprechen. Grillparzer sagt am Schluß seiner Rede zur Trauergemeinde, sie könne einmal sagen: »Wir waren dabei, als sie ihn begruben. Und als er starb, haben wir geweint!« Grillparzer kommt aber durchaus auch auf Beethovens besondere Tragödie, seine Einsamkeit und »Misanthropie« als Folge seiner Taubheit zu sprechen. Aber alles wird überglänzt von seinem Genie und dem Glück, das er für die Menschheit und die ganze Welt bedeutet.
An einigen Gräbern von Freunden bin ich gestanden, die, freiwillig oder durch Unglück und Depression erzwungen, gegangen sind. Mit großer Dankbarkeit denke ich an Gerhard Fritsch zurück, der mich mit drei Veröffentlichungen in der Zeitschrift »Literatur und Kritik« von Beginn an gefördert hat. Aber auch an Brigitte Schwaiger, die wie Ophelia in William Shakespeares »Hamlet« gegangen ist, oder an Franz Innerhofer, der mich einmal, was mich ein wenig stolz macht, in einem Interview als seinen frühen Mentor genannt hat. Noch bedrängend nahe ist die Erschütterung über den unfaßbaren Abschied von Fabjan Hafner, den viele und auch ich gerne als Leiter des Musil-Hauses in Klagenfurt gesehen hätten!
Der Name Shakespeare ist gefallen. Er ist es, von dem man wie sonst nur aus der Bibel das Sprechen über das Unaussprechliche lernen kann, auch jenen Humor, der dem Thema entspricht, ENTSPRICHT! In der 1. Szene des 5. Aufzugs in »Hamlet« unterhalten sich zwei Totengräber über ihre Arbeit, das Schaufeln eines Grabes für Ophelia. Der erste Totengräber sagt: »Soll die ein christlich Begräbniß erhalten, die vorsätzlich ihre eigene Seligkeit sucht?« Darauf der zweite Totengräber: »Ich sage dir, sie solls, mach also flugs ihr Grab. Der Todtenbeschauer hat über sie gesessen, und christlich Begräbniß erkannt.« Dann ist davon die Rede, daß es sich die Reichen auch in diesem Fall richten können: »Wollt ihr die Wahrheit wissen? Wenns kein Fräulein gewesen wäre, so wäre sie auch nicht auf geweihtem Boden begraben«, sagt der zweite Totengräber. Später beschwert sich Laertes, Ophelias Bruder, über die Dürftigkeit der Exequien und des Libera des Priesters für seine Schwester. Darauf der Priester: »Wir würden ja der Todten Dienst entweihn, / Wenn wir ein Requiem und Ruh ihr sängen, / Wie fromm verschiedenen Seelen.« Darauf Laertes: »Ich sag dir, harter Priester, / Im Engelchor wird meine Schwester sein, / Während du heulend liegst!« Immerhin ging es hier anders und versöhnlicher zu als in den »Leiden des jungen Werther« des Shakespeare-Bewunderers Johann Wolfgang von Goethe, deren letzter Satz bekanntlich heißt: »Kein Geistlicher hat ihn begleitet.«
Daran und an Einschlägiges mußte ich denken, als ich für meinen letzten Roman »Aluigis Abbild« recherchierte: Obwohl kein Selbstmörder, sondern ein tyrannischer Markgraf, wurde dem von empörten Untertanen erschossenen Bruder des Heiligen Aloisius von Gonzaga, Ridolfo Gonzaga, ein Begräbnis auf dem Friedhof in Castiglione verweigert. Und es bedurfte inständiger Bitten der Mutter Marta Tana beim Papst in Rom, daß er später »umgebettet« und innerhalb der Friedhofsmauern beerdigt werden durfte …
Grandios ist Shakespeares Totengräberhumor in der folgenden Szene: Der erste Totengräber schickt seinen Kollegen weg, er soll ins Wirtshaus gehen und einen Schoppen Branntwein holen. Nachdem er grabend ein munteres Lied von der unbeschwerten Jugend singt, sagt der hinzutretende Hamlet: »Hat dieser Kerl kein Gefühl von seinem Geschäft. Er gräbt ein Grab und singt dazu.« Worauf der Hamlet begleitende Horatio sagt: »Die Gewohnheit hat es ihm zu einer leichten Sache gemacht.« Von höchster psychologischer Einsicht ist Hamlets Antwort: »So pflegt es zu sein. Je weniger eine Hand verrichtet, desto zarter ist ihr Gefühl.« Da denkt vielleicht einer einige Jahrhunderte voraus an den großen Dramatiker des 20. Jahrhunderts, Bert Brecht nämlich, der den Gedanken, daß die feine Moral weitgehend ein Luxus der Wohlhabenden ist, weiter und zu Ende gedacht hat …
Meine »Lebenszeichen, Lebensnachweise und Lebensbescheinigungen« – seien es die eingangs beschriebenen an die deutsche Rentenstelle in Neubrandenburg, aber auch hin und wieder einen kleinen Aufsatz oder ein Feuilleton für die Zeitung (lange Romane, wie sie der zweiundneunzigjährige Martin Walser Jahr um Jahr veröffentlicht, habe ich nicht mehr vor) – schreibe ich nach wie vor im wesentlichen mit dem Zeigefinger der rechten Hand nach der »Bussard-Methode«: über der Tastatur kreisen und dann auf den gesuchten Buchstaben hinunterstürzen! Diesen Finger habe ich im Laufe der Jahre wohl überstrapaziert. Das hat er mir nun sichtlich als Beleidigung übelgenommen, jedenfalls hat er sich im letzten Jahr nun mit dem, von meinem Hausarzt so bezeichneten »Raynaud-Syndrom« gerächt. Er wird beim leichtesten Anhauch von Kälte, ja nur Kühle »madenweiß, eiskalt und blutleer«, wie die Symptome im Lehrbuch beschrieben sind. Auslöser sei in der Regel ein Kältereiz und niedriger Blutdruck. Mit diesem (erträglichen) Leiden befinde ich mich vor allem in weiblicher Gesellschaft, nachdem es heißt, daß diesen Defekt nahezu nur Frauen haben, 90 Prozent der Patienten seien Patientinnen. Nachdem ich dieses Phänomen an einer meiner Schwestern im Buch »Vom Schnee der vergangenen Jahre« beschrieben habe, liegt es vielleicht auch in meinen Genen … Im Lexikon steht, das nach dem französischen Arzt Maurice Raynaud benannte »Syndrom« sei keine schwere Krankheit, sondern eher eine »Laune der Natur«, so wörtlich. Ich lasse mir jedenfalls davon die Laune nicht rauben. Ich hoffe, auch mit diesem wachsgelben und madenweißen Zeigefinger noch einige Lebenszeichen in meinen PC zu tippen, mag auch dieses »Raynaud-Syndrom« im Deutschen gern als »Leichenfingerkrankheit« bezeichnet werden.
Stifter
Als wir, die Klasse 1a des Kollegium Petrinum, vor über sechzig Jahren mit unserem Klassenvorstand, dem Maler und Zeichenlehrer Willi Zawischa, am heutigen »Stifterhaus« vorübergegangen sind, um ganz in der Nähe im Hafen ein Donauschiff zu besichtigen, wurden wir wohl auf dieses Gebäude und seine Geschichte als Wohn- und Sterbehaus des Adalbert Stifter aufmerksam gemacht, Stifter gelesen hatten wir damals ja noch nicht. Damals las ich »Durch die Wüste« und »Durchs wilde Kurdistan«. Und wegen des (lauten) Karl-May-Lesens während der Exerzitien habe ich dann auch Schwierigkeiten und das sogenannte »Consilium abeundi« bekommen. Ich wurde »relegiert«, die Direktion verständigte meine verzweifelte Mutter, die mich abholen mußte … Hätte ich (leise) Stifter gelesen, wäre ich vielleicht sogar gelobt und gefeiert, jedenfalls nicht gefeuert worden. Denn Stifter war, im Gegensatz zu mir, ein folgsamer Zögling des Gymnasiums in der Benediktinerabtei Kremsmünster, an das er sich sein Leben lang dankbar erinnert hat. Und Stifter lesen war mir später immer ein wenig wie eine Frömmigkeitsübung, eine Art säkularer Andacht …
Die Bücher des wahrlich nicht unfrommen, ja »christlichen« Autors Karl May hatte ich freilich aus der privaten Bücherei unseres Pfarrers Alois Einberger entlehnt und geliehen bekommen. Als Exerzitien-Lektüre waren sie natürlich nicht vorgesehen, vielleicht auch wegen ihres Humors, wenn man an Kara ben Nemsis Verhältnis zu »Hadschi« Halef Omar, seinem Diener, denkt. Meist gilt bei Adalbert Stifter »Ernst auf Ernst«. Sein »Humor« ist sehr zurückhaltend. Ironie oder gar Sarkasmus sind ihm durchaus fremd. Ich kann mich mit Stifter nicht vergleichen. Auch nicht als Stifter-Preisträger des Landes Oberösterreich. Und auf eine Erinnerungs- und Gedenktafel, wie sie Stifter in Kremsmünster in der Nähe des Meierhofs bekommen hat, werde ich im Petrinum wohl nicht hoffen dürfen.
Was aber aus dem Haus am heutigen Stifter-Platz einmal werden würde, hätten wir uns damals, als wir Knabenseminaristen hier mit unserem Zeichenlehrer vorbeigingen, nicht träumen lassen. Und nicht träumen hätten wir uns auch lassen, daß einer aus unserer Klasse, der auf dem Erinnerungsphoto vom Schulausflug mit dem Donauschiff mit rundem Bubengesicht fröhlich in die Kamera lacht, diesem Stifter-Institut einmal als Direktor vorstehen würde: Johann Lachinger aus Vöcklamarkt. Ist die Redensart vom »Träumenlassen«, eine rhetorisch-poetische Verlegenheitsformel, hier vielleicht doch insofern angebracht, als mit dem Stifter-Institut für viele Kulturinteressierte, oberösterreichische »Patrioten«, Heimatverbundene, Mundart- und Sprachbewußte, tatsächlich ein »Traum« in Erfüllung gegangen ist? Mit dem Sprachatlasunternehmen und der Forschungsstelle für die bairisch-österreichische Landesmundart ist gewissermaßen ja auch Franz Stelzhamer, die Leitfigur der Mundartdichtung und der Schöpfer der mundartlichen Landeshymne, »bei Stifter« eingezogen. Und da Franz Stelzhamer einen so köstlichen, freilich maliziösen Brief, wie ihn Hermann Friedl in dem famosen Buch »Beginn der Errichtung eines Denkmals« an den Nachlaßverwalter und Stifter-Intimus Johann Aprent fingiert, in Wahrheit ja nie geschrieben hat, wird ihn, den alten Freund und Spezi aus dem Lande ob der Enns, Stifter in seinem Hause an der Donaulände wohl wenigstens als Untermieter dulden … Stifter selbst dürfte ja bei seinen Gesprächen mit Stelzhamer, im Gegensatz zu seinem Gesprächspartner, das Mundartliche, wenigstens das sogenannte »Grobmundartliche«, vermieden haben, wie er sich ja auch in seinen Schriften eher am heute so genannten »Binnendeutschen«, im Gegensatz zum »österreichischen Deutsch«, und im Besonderen natürlich an Johann Wolfgang von Goethe orientiert hat. So herrlich mundartlich wie meine Petriner Schulkollegen aus dem Mühlviertel, aus Putzleinsdorf, Liebenau, Kirchschlag oder Haslach, die zu Kuh kui und zu Bub bui sagten, hat er sicher nicht gesprochen. Und auch »geböhmakelt« hat er wahrscheinlich nicht. Er wird wohl später, wie ein Wiener Hofrat, »Schönbrunnerisch« parliert haben. Hat er genäselt? Wir wissen es nicht, das heißt, ich weiß es nicht, stelle mir aber vor, daß er ein wenig gravitätisch und umständlich wie ein »alter Herr« und Philister ein Honoratioren- oder Beamtenidiom gesprochen hat, »gepflegt«, auf jeden Fall gepflegt!
Einmal hatte sich im Kollegium Petrinum der Schulinspektor, also ein Nachfolger Adalbert Stifters im Amte, angesagt, und es herrschte große Aufregung. Und weil er auch in unsere Deutschstunde kommen sollte, hat mich der Deutschlehrer, Professor Johann Demmler, ausgewählt, vor dem hohen Besuch eine Ballade aufzusagen: »Nis Randers« von Otto Ernst, weil ich ihm wegen meiner Vorliebe für das Hochdeutsche und meiner korrekten Aussprache aufgefallen war … Größer als meine Aufregung war schließlich meine Enttäuschung, als der Herr Professor in die Klasse trat und mitteilte, daß der strenge Herr Inspektor aus Zeitmangel von der Inspektion unserer Klasse Abstand nehmen müsse. Ich hätte heulen können, und mir war elend wie einem Schiffbrüchigen zumute, wenn ich an meine schöne Ballade dachte: »Krachen und Heulen und berstende Nacht … Ein Schrei durch die Brandung … Und brennt der Himmel, so sieht man’s gut: Ein Wrack auf der Sandbank, noch wiegt es die Flut.« Vielleicht hätte aber Stifter an der Ballade gar keinen Gefallen gefunden, weil er doch ein Verfechter, nein, Verehrer, des so genannten »sanften Gesetzes« war, das er in der Vorrede zu den »Bunten Steinen« formuliert hat …
Ich hatte bereits die Schule gewechselt, war nun in Wels am Bundesrealgymnasium und nicht mehr im Konvikt, als Professor Demmler dort, vermutlich zum ersten Mal, im Deutschunterricht der 4. Klasse Adalbert Stifter »durchgenommen hat« und meine fernen Kollegen mit den »Bunten Steinen« vertraut gemacht wurden. Und wenn dabei von stifterischen Ortsbezüglichkeiten und Stifter-Denkmälern die Rede war, dann wird wohl Josef Wimmer aus Gunskirchen bei Wels sich gemeldet haben und von jenem Gedenkstein an der Bundesstraße 1, nahe beim so genannten »Wirt am Berg«, dem Gasthaus Wiesinger, und auch seinem Elternhaus, dem vulgo Hochfurtner in Bichlwimm, erzählt und berichtet haben, dem Gedenkstein, der für den an dieser Stelle tödlich verunglückten Vater Adalbert Stifters, Johann Stifter, errichtet worden war, dem bei einem Flachs-Transport in die Spinnerei in Stadl-Paura hier am 3. Dezember 1817 die Pferde durchgegangen waren … »200 Schritte gegen Lambach hin von einem fallenden Flachswagen erschlagen«, schreibt Stifter 1846 in einem Brief an seinen Freund Hermann Meynert. Johann Stifters Grab befindet sich auf dem Friedhof von Gunskirchen, fern seiner Heimat Oberplan im Böhmerwald, wo seine Familie und der kleine 12-jährige Sohn Bertl vergeblich auf ihn gewartet haben …
Ich habe mich »mein Lebtag« für Erinnerungs- und Gedenkstätten (und Friedhöfe!) interessiert. Natürlich weiß ich aber und es ist mir bewußt, daß alles Memoriale in dieser Hinsicht ein wenig touristisch ist und nicht das Wesentliche der Literatur- und Geistesgeschichte ausmacht. Und mancher Gegenstand und manches so genannte »Souvenir«, das in Museen aufbewahrt und vorgezeigt wird, ist eher kurios als seriös, und nicht ohne Komik. Das »Souvenir« heißt, ins Deutsche übertragen, ja auch »Überbleibsel«, was bleibet aber stiften die Dichter, und sie schreiben es in ihre Bücher. Und auch das Bleibende, das Adalbert Stifter »gestiftet« hat, findet sich im »Nachsommer« und in der »Mappe meines Urgroßvaters«, im »Witiko« und nicht in einem Kuriositätenkabinett oder irgendeiner »Rumpelkammer« eines Heimatmuseums. Die großen, und das heißt in vielen Fällen auch umfangreichen, Werke muß man lesen, in sozusagen mühevoller und lustvoller Kleinarbeit und in Muße, das Werk muß man lesen, das »Beiwerk« kann man im Literaturmuseum betrachten …
Thomas Manns Roman-Tetralogie »Joseph und seine Brüder« kann schon für den Leser zu einem »Lebenswerk«, zu einer »Lebensaufgabe« werden, die Schreibmaschine, auf der Mann das Manuskript getippt hat, vielleicht auch das Manuskript selbst, das Chirograph, kann man im Vorübergehen im Heimatmuseum »besichtigen« … Es gibt ein Photo, aufgenommen von meinem Freund Hans-Jürgen Schrader, das mich an Wilhelm Raabes Schreibtisch im Braunschweiger Raabe-Haus zeigt, wo der große poetische Realist vielleicht »Pfisters Mühle«, »Altershausen« oder »Zum wilden Mann« geschrieben hat … Nichts also gegen Literatur- und Heimatmuseen! Ich habe seinerzeit in meinem Haus in Pichl bei Wels auf dem Weinberg auch selbst ein agrarisches »Kleinhäuslermuseum« zusammengesammelt und ausgestellt …
Sammeln als Leidenschaft. Peter Marginter hat das »zuständige« Buch über diese »Krankheit« geschrieben: »Der Sammlersammler. Für Käuze und Spinner« (1972). Natürlich wird es nachgerade auch ein kulturpolitisches und finanzielles Problem werden, die vielen Dichter- und Künstlerhäuser als solche zu erhalten und als Museen weiterzuführen. Alfred Kubin hat in Zwickledt bei Schärding in seinem Wohnschlössel eine würdige Gedenkstätte bekommen, die drei großen Besitzungen und Häuser, die Thomas Bernhard in Ohlsdorf, Traunkirchen und Ottnang hinterlassen hat, wird man, das heißt das Land Oberösterreich, nicht gleichermaßen als Gedenkstätten erhalten und »betreiben« können …
Eines der seltsamsten Literaturmuseen habe ich im vorigen Jahr nahe der Therme Abano bei Padua besucht: Arquà oder genauer Arquà Petrarca, wie es heute nach dem berühmten italienischen Dichter Francesco Petrarca heißt, der dort eine Villa besessen hat, in der er auch gestorben ist, im Jahre 1374, die berühmte Hauskatze zu seinen Füßen. Diese viel besungene Katze kann man nun, ausgestopft, in der zum Literaturmuseum mutierten Villa in Arquà in den Euganeischen Hügeln bestaunen. Daß sich eine Ortschaft im Toponym den Namen einer hochberühmten Persönlichkeit »einverleibt«, kommt wohl selten vor. In Deutschland denkt man vielleicht an das mittelfränkische Obereschenbach, dessen offizielle Bezeichnung seit 1917 Wolframs Eschenbach lautet. Bedingung einer solchen Namenswahl ist wohl, daß der Namensgeber überragend – die Ortschaft aber nicht allzu groß ist. Nicht vorstellbar etwa wäre, daß sich Frankfurt am Main zu Goethes Frankfurt umbenannt hätte oder Salzburg zu Mozarts Salzburg … Öfter geschieht es freilich umgekehrt, daß sich ein Künstler nach einer Ortschaft, meist seinem Geburtsort, benennt. So ähnlich liegt der Fall bei Jacques Offenbach oder beim Maler Albin Egger-Lienz. Nur die sich überschätzenden Politiker, namentlich die Diktatoren, haben sich in einigen Ortsnamen breit gemacht und ein Denkmal setzen wollen. So wurde einmal aus St. Petersburg Leningrad. Mir reichen auch Wittenberg statt Lutherstadt Wittenberg und Chemnitz statt Karl Marx-Stadt …
Das beziehungsreichste und denkwürdigste Souvenir oder »Überbleibsel« eines Erdenbürgers, eines bedeutenden Kirchenmannes oder Künstlers etwa, sind natürlich seine »sterblichen Überreste«. In wie vielen Kirchen sind unter den Altären in gläsernen Särgen die Skelette der Heiligen »ausgestellt«. Die Kirche des aufgelassenen Augustiner Chorherren-Stiftes in Ranshofen, die ich auch zur Recherche meines Romans »Der geborene Gärtner« besucht und besichtigt habe, ist reich an solchen, oft gruselig anmutenden Sensationen. Und ganz besonders »angesprochen« – und erschreckt – haben mich in Castiglione delle Stiviere, in der Basilika des Heiligen Aloisius, die ich zur Einstimmung auf die Arbeit an meinem Roman »Aluigis Abbild« über meinen Namenspatron, den Prinzen Aloisius von Gonzaga, besucht habe, die »Vitrinen« mit den unverwesten, einbalsamierten, in Ordenstracht gekleideten Leichen der Nichten des Heiligen Aloisius, Cinthia, Gridonia und Olimpia, den Töchtern des Ridolfo di Gonzaga, seines »unheiligen« Bruders, den seine von ihm unterjochten Untertanen erschossen haben, jener drei Jungfrauen, die im Geiste und in der Verehrung ihres heiligen Onkels ein jesuitisches Institut für adelige Mädchen gegründet haben. Heute ist in Ablehnung aller Reliquien- und Totenkulte, des Aufbahrens und Erdbestattens der Vergangenheit, das Einäschern und Verbrennen der »sterblichen Überreste« in Krematorien, das von der Kirche lange heftig bekämpft und verpönt und am 2. Vatikanischen Konzil konziliant sanktioniert wurde, Brauch geworden. In den gewissen Instituten stauen sich die Särge in Warteschleifen. Eigentlich aber ist Reliquie ein »Überrest« und somit ein anderer Ausdruck für Souvenir … Und viele erst in der jüngeren Vergangenheit angelegte neue Friedhöfe sind eigentlich überflüssig geworden, weil die anfallenden Urnen, wenn die Asche nicht überhaupt verstreut oder ins Meer, in die Nordsee etwa, geworfen wird, platz- und raumsparend in kleinen Nischen in der Friedhofsmauer auf- oder abgestellt werden können.
Erdbestattet, und zwar im Garten seines Landhauses in der niederösterreichischen Gemeinde Kirchstetten, wurde der von vielen als Dichter hochgeachtete, von anderen aber wegen seiner Verstrickung in den Nationalsozialismus tief verachtete Lyriker Josef Weinheber, der sich im Jahr 1945 aus Angst vor den von Wien her anrückenden Russen das Leben genommen hat. Ich habe auf Einladung seines Sohnes und Erben Christian Weinheber-Janota und dessen Schwestern einige Tage im Kirchstettner Haus verbringen dürfen und abends dem Vortrag von Weinheber-Gedichten und Erinnerungen seiner Lebensgefährtin Janota im Arbeits- und Sterbezimmer des an Depressionen leidenden, alkoholkranken Dichters zuhören dürfen. Tagsüber haben wir, unbekümmert und jung, wie wir waren, im Garten Federball gespielt, und ich erinnere mich an eine gewisse Beklemmung und Hemmung, als ich den von ihrer Tochter Gabriele verschossenen Federball vom Grabhügel, der am Gartenrand zum Wald hin gelegen ist, aufheben mußte. Heute würde von der staatlichen und auch kirchlichen »Behörde« ein solches Privatgrab im eigenen Garten wohl kaum mehr erlaubt. Es war die Bewilligung wohl auch damals schon schwer zu bekommen. Daß dies im Falle Kirchstetten und Weinheber möglich war, zeugt von der auch nach Kriegsende ungebrochenen Beliebtheit und Prominenz des Verfassers der Gedichte von »Wien wörtlich«. Konfessionell gesehen ist der Kirchstettner Garten wohl kein »geweihter Gottesacker«, eher ein natürliches Biotop, wie es wohl auch den freireligiösen, eher in Goethes Sinn pantheistischen Vorstellungen Weinhebers entspricht. Weinheber, im Grunde ein »Heidenchrist«, hat ja wiederholt die Konfession gewechselt, zuerst anläßlich der Hochzeit mit seiner zweiten Frau Hedwig Krebs vom bereits verlassenen Katholizismus zum Protestantismus. Nach der Rückkehr seiner Frau zum Katholizismus hat auch er seine »Rekatholisierung« angekündigt. So konnte das Kirchstettner Pfarramt in seine »Sterbematrikel« zum Tod (Freitod) Weinhebers am 8. April 1945 eintragen: reversus in corde …
Ja, »es gibt mir etwas«, wenn ich im Stifter-Haus in Linz wie einst der Hausherr – oder war er nur Mieter? – die Treppe in den zweiten Stock mit Mühe hochsteige, den inzwischen eingebauten Lift verschmähend. Als älterer Mensch kommt man hier außer Atem und macht auf dem Absatz im ersten Stock am besten eine Schnaufpause. Es gibt sogar den Bericht eines Besuchers, der gesehen und beschrieben hat, wie sich der alte Dichter und seine Gattin Amalie die Treppe hochgequält haben. Schließlich bin ich aber inzwischen 15 Jahre älter als Stifter, der nur 63 Jahre alt geworden ist … Fast 15 Jahre älter als der große Dichter ist auch Johann Lachinger, mein Petriner Schulfreund und später Kommilitone im Germanistik-Studium in Wien, der große Stifter-Forscher und langjährige Leiter des Linzer Stifter-Hauses geworden … Er ist am 16. Oktober 2016 76jährig gestorben, sein Grab hat er am Linzer Kommunalfriedhof St. Barbara in unmittelbarer Nachbarschaft zum Grab und Denkmal Adalbert Stifters gefunden. »Sein Grab finden« – wie richtig und vielsagend ist hier dieser Ausdruck! Man darf vielleicht in diesem Fall auch ein wenig an die starke Neigung der Menschen in früherer Zeit denken, möglichst nahe am Gotteshaus und den Altären ihre ewige Ruhe zu finden. Die Mächtigen und Privilegierten des Klerus und des Adels erhielten ihre letzte Ruhestätte überhaupt in der Kirche selbst oder in einer Gruft und Krypta, in Katakomben. Die Kirche, der Anton Bruckner so treu als Organist im Alten Dom von Linz und im Stift St. Florian gedient hatte, hat dem überragenden Komponisten seinen letzten Willen erfüllt, seinen Metallsarg unter der Orgel, die heute seinen Namen trägt, in der Krypta frei aufzustellen. So ist dieser »Keller« zu einem Wallfahrtsort nicht nur für Musik-Enthusiasten, sondern auch für einfache, von der Musik und besonders der »Musica sacra« Anton Bruckners tief berührte Menschen geworden. Seine Musik ist ein wahres Wunder. Und es ist verständlich und sozusagen kein Wunder, daß begeisterte Verehrer in ihm einen von Rom anerkannten Seligen sehen wollen … Nihil obstat?
Brandstatt
Oder: Sich einen Namen machen
»Lust aufs Land« heißt ein Lesebuch im dtv-Verlag, das Alexander Knecht und Günter Stolzenberger 2015 herausgegeben haben. Auf dem Umschlag wird mit folgendem Text geworben: »Der Stadt den Rücken kehren, hinaus aufs Land, in die Natur – für eine kleine Weile oder gar für immer! Von diesem Wunsch erzählen fünfundzwanzig namhafte Autoren […] in heiter skurrilen und berührenden Geschichten. Wer Lust aufs Land hat, wird dieses Buch mit großem Vergnügen lesen.« Im Nachwort zum Verhältnis Stadt–Land heißt es: »Man hat sich an die Städter gewöhnt. Die gegenseitigen Vorurteile sind einer gewissen Neugier aufeinander gewichen. Obwohl es natürlich noch die Eingefleischten gibt, die wie Alois Brandstädter der Meinung sind, dass die Städter vom Land keine Ahnung haben. Er hat damit vielleicht sogar recht …« Hinter meinen Namen müßte ich in diesem schwerwiegenden Fall eigentlich ein dickes (Sic!) setzen. Als Brandstätter wurde und werde ich oft verschrieben, daran habe ich mich fast schon gewöhnt. Ich habe auch 1990 in einem Text »Alois« für eine Anthologie (»Nenne mir deinen lieben Namen, den du mir so lang verborgen«) geschrieben: »Immer Ärger mit Emil. Ärger ist das Ansagewort im Telegrammalphabet für Ä und Emil für E.« Als Brandstädter mit Umlaut a (ä) und dt statt tt wie im zitierten Nachwort bin ich bisher meiner Erinnerung nach erst einmal verschrieben worden, bezeichnenderweise von Thomas Bernhard in einer Widmung, die er mir nach einer Lesung in Saarbrücken im Jahr 1968 in das Buch »Amras« schrieb. Das Entstellen von Namen scheint in seinem Fall ein wenig Methode gewesen zu sein, der »Übertreibungskünstler« hat bekanntlich den Namen seines besten Freundes Karl Ignaz Hennetmair auf gleich mehrere Arten »transkribiert« … Den vielen Maier, Meier, Mayer, Mair etc. können es freilich auch Gutwilligere selten orthographisch recht machen. Daß ich gerade im Nachwort eines Lesebuchs über die »Lust aufs Land«, in dem ich neben den Idyllikern als Kritiker und Städter-Beschimpfer vertreten bin, als Brandstädter »bezeichnet« wurde, könnte nach einer veritablen Bosheit, eines Bernhard würdig, aussehen. Ist es aber sicher nicht, dafür bin ich nicht prominent genug, bin ja am Umschlag unter den »namhaften Autoren wie Eva Demski, Robert Gernhardt, Hermann Hesse, Siegfried Lenz und Herbert Rosendorfer« gar nicht genannt … Das Wort namhaft bedeutet ursprünglich freilich nur »einen Namen habend«. Namhaft ist jeder, der einen Identitätsausweis oder Paß hat, nicht nur jene wenigen, die Prominenten, also die »Herausragenden«, die sich »einen Namen gemacht haben« … Der Germanistik gelingt es freilich, ähnlich wie der Kriminalistik, auch jene, die sich einen falschen Namen gegeben oder gemacht haben, ein Pseudonym also, zu entlarven und namhaft