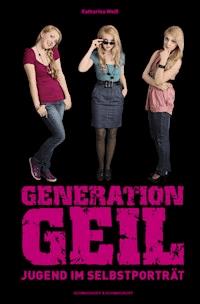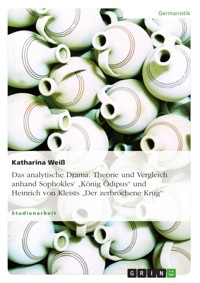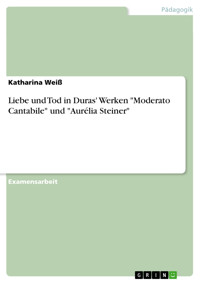9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sie sind allgegenwärtig: Schauspieler und Musiker, die über Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte hinweg Massen bezaubern, Politiker, die den Frieden oder die demokratischen Werte geschützt haben, und Wissenschaftler, deren Erfindungen uns noch heute den Alltag erleichtern ? kurz: echte Legenden. Die Medien lieben sie, Otto Normalbürger schaut zu ihnen auf. Kein Wunder, dass die Zahl derer, die sich selbst zu ihnen zählen wollen, immer weiter wächst. Und tatsächlich: Ob als Internetstar, Gesangstalent oder Gründer eines Start-up-Unternehmens ? wer will, der kann dieser Tage schnell berühmt werden. Das Schwierige ist nur, es auch zu bleiben. Wie wird man also zu einer echten Ikone ? einer Marlene Dietrich, einem Carl Benz oder einer Nina Hagen? Kann man schon heute erkennen, welche Ideen in einigen Jahren legendär sein werden? Und wer wird später mal von sich behaupten können, das politische Klima oder die Kultur in Deutschland mitgestaltet zu haben? Katharina Weiß und Philipp Zumhasch sind der Frage nachgegangen, wer aus ihrer Generation das Zeug dazu hat, noch lange von sich reden zu machen, und haben 35 junge Menschen aus Politik, Medien und Kultur aufgespürt, die auf dem beste Wege dahin sind. Die Newcomer verdienen ihr Geld mit Youtube-Videos, sitzen morgens in der Uni und pokern abends an der Börse, sahnen reihenweise Preise bei Wettbewerben wie 'Jugend forscht' ab oder kämpfen an der Spitze der Piratenpartei für eine neue Art der Demokratie. In intimen Interviews erzählen sie von ihren Visionen und ihrem Werdegang ? und berichten davon, was ihnen Erfolg bedeutet und wie man mit ihm umgehen sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Katharina Weiß & Philipp Zumhasch
LEGENDEN VON MORGEN
35 Porträts von jungen Menschen mit Visionen
VORWORT
GROSSE KÖPFE, GROSSE IDEEN
Eine Spurensuche
»Think like a man of action, act like a man of thought«
Henri-Louis Bergson
Alle reden immer über die Legenden von gestern und heute, aber was ist mit denen von morgen?
Auch Die Ärzte haben bestimmt mal die popeligen JuZes in ihrer Heimat bespielt, Angela Merkel hat sich vielleicht ein ganzes Physikstudium über in Vorlesungen gelangweilt und Thomas Gottschalk musste als Jugendbetreuer seine Ministrantengruppe bespaßen. Große Namen, große Biografien, große Legenden, ganz klar – aber wer aus unserer Generation wird später mal von sich behaupten können, popkulturelle Phänomene, das politische Klima oder die persönlichen Lebensumstände der Deutschen mitbeeinflusst zu haben?
Während der eine (Phil) aufgrund akuter Planlosigkeit die Welt bereiste und seine Freunde via Skype an seinem Au-pair-Alltag in Neuseeland oder seinem Spaziergang über den Walk of Fame teilhaben ließ, pendelte die andere (Kathi) nach dem Abi ein wenig orientierungslos von Party zu Party. Als die erste Euphorie über die neu gewonnene Freiheit des Nichtstuns verebbt war, hatten wir Tausende Ideen. Wir wollten Menschen treffen, die uns inspirieren, uns Mut machen und vielleicht erzählen, wie das Leben und die Sache mit der Berufung eigentlich funktionieren. Denn wie man einen Job findet, für den man kein akademisches Pflichtprogramm durchlaufen kann, um im Anschluss erfolgreich und erfüllt zu sein, ist für Studien- und auch Berufsanfänger meistens undurchsichtig.
Wie schafft man es zum Beispiel, als Hacker der Bundesregierung angestellt zu sein und nebenbei als Teamleiter eine private Mondmission zu planen wie Robert Böhme? Welche Hindernisse muss man überwinden, um sich wie Schmidt, Mia Diekow oder Max Prosa vom musikalischen Einheitsbrei der Popbranche abzuheben? Wir fühlt sich jemand, der mit 17 den ersten Fantasy-Bestseller veröffentlichte, wie Jenny-Mai Nuyen?
Aber uns, die wir dieses Buch geschrieben haben, verbindet nicht nur die Leidenschaft für das Schreiben, sondern auch der Hang zum Wagnis. Schlichte Porträts waren uns als Rechercheerlebnis zu wenig. Deshalb besuchten wir unsere Gesprächspartner in ihren Studios und Galerien, verbrachten Stunden um Stunden beim Kaffeekränzchen oder betranken uns bis zur glückseligen Unprofessionalität.
Unsere Gesprächspartner verdienen ihr Geld beispielsweise via Youtube-Videos, streiten für eine neue Art der Politik, begeistern als Hochleistungssportler oder genießen die Exzesse der ersten eigenen Tour im Nightliner … Kurz gesagt, interessierten wir uns für Menschen, die für ihr junges Alter überproportional viel erreicht haben. Uns trieben viele Fragen um: Wie wird man zum Idol, und inwiefern verändert das die eigene Weltsicht? Wie beeinflussen Herkunft und Familienstatus Ehrgeiz, Selbstständigkeit oder das eigene soziale Netzwerk?
In unseren Porträts begleiten und interviewen wir, stecken aber immer auch selbst drin und zeichnen in unseren ganz subjektiven Eindrücken die Gesprächspartner so eindringlich und leidenschaftlich nach, wie sie uns begegnet sind. Im Journalismus werden Ideale und Vorbilder so oft in Grund und Boden geschrieben, man sucht eher nach Schmuddeleien und Dreck denn nach Inspiration. Wir wollen diese ganz speziellen, wunderbaren, polarisierenden Künstlerseelen mit der Liebe von Fans darstellen. Und wir wollen damit gegen den allgemeinen Medienpessimismus anschreiben und ein bisschen dabei mithelfen, die Legenden von morgen zu erschaffen.
Dieses Buch ist für alle, die – wie wir – noch auf der Suche nach der eigenen Bestimmung sind, mit Beispielen, die Mut machen sollen, die eigene Biografie anzupacken. Wenn ihr mit uns auf diese literarische Reise durch rasende Dialoge und hellwache Nächte geht, dann werdet selbst zum Kind, zum Clown, zum Sänger, zum Forscher, zum Maler oder Dichter!
Katharina Weiß & Philipp Zumhasch
1. PORTRÄT: MAX PROSA
ZU GAST IM CAFÉ NOIR
Katharina über Max Prosa, Musiker, Jahrgang 1990, Berlin
Die ältesten Lieder, jene, die Jahrhunderte, Kriege, Revolutionen überdauert haben, sind nicht nur reine Unterhaltungsmusik. Sie sind uns erhalten geblieben, weil sie Geschichten erzählen. Panegyriker und reisende Barden verdichteten Legenden und Ideologien und verwoben die Motive ihrer Zeit so eindringlich, dass die Bauern auf dem Feld und die Mütter an der Kinderwiege diese Lieder nicht mehr aus dem Kopf bekamen. Sie sangen die Geschichte immer weiter, bis das Liedgut zum identitätsstiftenden Charakter einer Kultur zählte. Heute haben wir – zumindest in Mitteleuropa – eine reiche, manche würden fast sagen überfüllte Kunst- und Musikszene. Melodien zur schlichten Unterhaltung sind genauso gefragt wie komplexe Klanggebilde. Die dazugehörigen Texte ergänzen die Stimmung des Songs oder dienen als Konstrukt, um die Stimme zu rechtfertigen. Das Prinzip des einsamen Mannes, der in seinem Koffer nicht nur die Gitarre, sondern auch einen Haufen Geschichten vom Leben, besonders vom Lieben und Leiden, mit sich rumschleppt, ist trotzdem nicht aus der Mode gekommen.
Weil wir eben immer noch gern von den Abenteuern anderer hören.
Wer keine Geschichten und Lieder mehr hat, ist verloren. Gegen die Verlorenheit des Daseins generell singt momentan in deutscher Sprache keiner so schön an wie Max Prosa. Den jungen Berliner umweht ganz natürlich jenes Flair, das sich verzweifelte Szeneschnösel mit Opas Klamotten, selbstgedrehten Zigaretten und White-Trash-Ironie zu erkaufen versuchen: der hin- und hergerissene Chic der zeitlosen Bohemiens, die verqualmte Kaffeehausphilosophie der Zwanziger und ein bisschen vom trotzig-sehnsuchtsvollen Blick der Seefahrer.
Ein paar Wochen, nachdem wir ihn zum Abschluss der Festivalsaison in den Fliegenden Bauten in Hamburg live gesehen haben, besuchen wir Max bei den Aufnahmen zu seinem zweiten Album. Ganz nah an der Spree liegt das legendäre Funkhaus, in dem er sich mit seinem Team für eine Woche einquartiert hat. Die auf dem Gelände befindliche Milchbar sieht noch aus wie zu besten DDR-Zeiten. Und auch wenn wir drei gerade ganz allein unser Bier bestellen, kann man sich gut vorstellen, wie Generationen von Musikern hier nach Feierabend mit ihren Bandkollegen angestoßen haben.
Phil bestellt sich dazu noch einen Riesenteller fettiger Kartoffelpuffer mit Apfelmus, und das Ganze fühlt sich jetzt ein bisschen nach Plaudern im Gemeinschaftsraum eines Schullandheims an.
»Aber das eigentliche Klassenfahrtgefühl ist ja eher das Auf-Tour-Gehen. Beim Aufnehmen ist ja mittlerweile nicht nur die Band dabei, sondern ein unheimliches Kollektiv. Das entwickelt mit der Zeit so seine Eigendynamik, und das ist auch eine der tollsten Sachen an dem, was ich mache: die Begegnung mit verschiedenen Leuten, die was können und das dann gemeinsam entstehen lassen. Es ist natürlich auch ungeheuer chaotisch, sich zu überlegen: Welche Vorzüge oder welche Energie von wem kann jetzt dazu beitragen? Und du weißt halt nie, was gewesen wäre, wenn der eine Vorschlag nicht gekommen wäre oder der andere nicht zufällig an dem Punkt der Produktion zur Tür reingeplatzt wäre.«
Mittlerweile besteht seine Band aus sechs Musikern. Angefangen hat er aber ganz allein in seinem Kinderzimmer in Charlottenburg. Wie es ist, nur von Luft und Liedern zu leben, erfuhr er, als er nach dem Abi durch Irland reiste und auf der Straße spielte.
»Ich habe zunächst nur die Songs nachgespielt, die ich so kannte – Strokes, Libertines und so weiter, aber das kam bei den Leuten nicht so gut an, und ich musste viele Stunden stehen und singen, um das nötige Geld für den Tag zusammenzuhaben. Ich wollte also meinen Gewinn optimieren, und dann habe ich mir ’ne Mundharmonika gekauft und mit Bob Dylan angefangen.«
Max und Phil tauschen sich kurz über ihre Auslandserfahrungen aus, aber Max erzählt, dass er von Reisen immer ziemlich schnell wieder nach Hause will. Weil auch in Irland der innere Druck, Musik machen zu müssen, zu groß war. »Ich hätte sonst keine Ruhe gehabt.«
Auch wenn »Musiker« heutzutage keine so zwielichtig anmutende Berufsbezeichnung wie noch zu Opas Zeiten ist, ist das Streben nach Erfolg auf lange Sicht, gerade in Zeiten der saisonal verglühenden Popsternchen, oft ein aussichtsloses Unterfangen. »Wenn man mit dem Abitur fertig ist und sich entscheidet, Künstler zu werden, fällt man natürlich aus diesem üblichen Schema raus, wo es von selbst immer weitergeht und man weiß, was kommt. Und die Familie steht auch da und fragt: ›Was passiert denn jetzt mit dir?‹ Man spürt eine gewisse Bringschuld und versucht dann, alles nach vorne zu bringen, um aus dieser Klemme rauszukommen, um zu zeigen, dass das nicht alles für die Katz ist, was man macht. Es gab so viele Diskussionen mit meinen Eltern. Aber das gab mir meistens noch mehr trotzige Energie. Jetzt ist der Drang, es wieder zu schaffen, immer noch da, aber eben ein anderer, ein künstlerischer: sich selber immer neu zu erfinden und diese Welt in Worten auszudrücken. Diese Prozesse, von der Idee zum Song auf der Bühne, dauern aber immer ewig.«
Als kleiner Junge wollte er immer eher die ordentlichen Berufe machen, während die anderen davon träumten, Meisterdetektiv, Schatzsucher oder Zirkuskind zu sein. Der Vater seines besten Freundes war Physikprofessor. Und wohl aus dieser Faszination und einer gewissen Unentschlossenheit heraus begann er, in Berlin Physik zu studieren. Nach zwei Semestern im Vorlesungssaal war er dann exmatrikuliert und sich seiner Bestimmung plötzlich sicher. In seinen Augen hat die Physik etwas ganz Existenzielles mit Musik gemeinsam: Strukturen.
»Da trifft es sich ja. Im Songwriting geht es auch um Strukturen, ob bewusst oder unterbewusst, jeder Songwriter arbeitet damit. Texte sind Strukturen der Wirklichkeit, stark vereinfacht abgebildet und miteinander verknüpft. Es lässt sich nichts sagen, was nicht schon gesagt wurde – nur Komposition und Methode sind unser Handwerk. In der Physik ist es ähnlich, nur ist die Sprache der Mathematik viel abstrakter auf die eine Art und realer auf die andere Art. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es mir mehr liegt, Zusammenhänge durch Worte und Metaphern auszudrücken.«
»Fühlst du dich absolut frei?«, frage ich und weiß selbst nicht genau, was ich damit meine. Freiheit, ein großes, vielleicht überbewertetes, wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogenes Wort.
»Nein, das nicht. Je bekannter man wird, desto unfreier wird man. Ich glaube, es geht vor allem immer darum, wie frei man sich fühlt. Die Namenlosigkeit ist ein hohes Gut, was man erst zu schätzen lernt, wenn man es nicht mehr hat. Es hat etwas Wunderbares, dass sich Menschen begegnen können, ohne im Vorhinein etwas übereinander zu wissen. Freiheit hat aber auch noch viele andere Aspekte. Ich bin sehr dankbar für die Freiheit, Dinge tun zu können, von denen ich noch nicht weiß, was sie sind.«
Phil hat seine Pampe so langsam aufgegessen und wir gehen raus, eine rauchen und über Bücher schwadronieren. In vielen Texten von Max findet man literarische Motive, kein Wunder also, dass seine Leidenschaft für gebundene Fantasiewelten groß ist und es auch schon Ideen für einen eigenen Roman gibt. Ähnlich wie Schriftsteller können sich auch Musiker manchmal nach einiger Zeit nicht mehr so intensiv mit ihren Texten identifizieren wie zum Entstehungszeitpunkt. Vielleicht, weil man die betreffenden Songs zu oft spielen musste, oder einfach, weil sich die Gefühlslage verändert hat. Sein aktueller Lieblingsreim stammt aus dem Song Der Chaossohn.
»›Der Zauber bleibt scheu dem Staunenden treu.‹ Aber ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt aufs Album kommt.«
Das erste gute Lied, mit dem alles begann, war damals Straßen nach Peru. Nachdem er es Freunden und Bekannten vorgespielt hatte, dauerte es nicht lange, bis er an seinen jetzigen Manager, Andie Welskop, geriet, der auch Clueso betreut. Und bald ging Max zum ersten Mal auf große Musikreise, als Support von Clueso. Seine Bühnenpeformance hat sich seitdem nicht viel verändert: Leicht weggetreten haften seine Augen auf dem spektakulären Bühnenboden, während sein Körper etwas tranceartig zum Takt der Musik hin und her schwingt und seine Locken ekstatisch herumflattern. Doch manchmal verlässt er auch seinen einsamen Gedankenpalast, und er wälzt sich auf dem Boden, während ein Gedicht aus ihm herausbricht.
Das vehement Introvertierte passt zu Max. Es wäre wohl mehr als seltsam, wenn er plötzlich zur La-Ola-Welle aufrufen oder sein Publikum mit »Zickezackezickezacke!« zum Schnapssaufen verleiten würde.
»Ich gehe nicht so viel feiern, war schon seit einem Jahr in keinem Club mehr. Aber ich hab mir das auch alles schon mal angesehen.«
In Berlin gibt es eben so viele skurrile Orte, der Absturz lauert hinter jeder Ecke.
»Da gibt’s auch ’ne lustige Geschichte zu. Ich war gerade in die Weserstraße eingezogen. Meine beiden neuen Mitbewohner waren irgendwo in Deutschland unterwegs, hatten mir nur vorher gesagt: Da kommt nachher jemand und holt was ab. Es hatte mir aber niemand den Briefkastenschlüssel dagelassen. Na, irgendwann hat’s an der Tür geklingelt, und es kam ein aufgeregter Typ und musste unbedingt an den Briefkasten. Er meinte, es sei total wichtig. Und ich dachte: Vielleicht Medikamente oder so. Er sprach nur so gebrochenes Englisch, ich hab es nicht verstanden. Also haben wir den Briefkasten aufgebrochen, mit Werkzeugen, die wir uns bei den Nachbarn geliehen hatten. Und am Ende war’s tatsächlich nur ein Paket voller Drogen. Welcome in Neukölln.«
Auch wenn wir vermutlich einsehen müssen, dass Sex, Drugs and Rock’n’Roll in unserer Generation ein billiges Klischee sind, setzt man sich als junger Künstler meistens eingehend damit auseinander.
»Die Anfangszeit, noch lange bevor das so professionell losging, identifiziere ich total damit. Wir haben uns da ziemlich abgeschossen. Das war so ein Kapitel, und man kriegt natürlich die Rechnung dafür. Es ist ein Pakt mit dem Teufel, alle nächsten Tage sind scheiße, und man ist in diesem depressiven Loch. Brecht schrieb: ›Der Geschlagene entrinnt nicht der Weisheit.‹ Es wird, finde ich, ein viel zu großes Trara um diese ganze Drogengeschichte gemacht, es bewirkt das Gegenteil: Das große Verbot stachelt nur an, und dann kommt es dazu, dass irgendwelche Kids das nehmen, um cool zu sein, und mit der Zeit davon abhängig werden.«
Da klingelt Max’ Handy – sein Team einige Stockwerke über uns hat noch ein paar Fragen. Während er telefoniert, beschließen Phil und ich, jetzt mit meiner beliebten Interviewkategorie, dem Stichwort-Ping-Pong, zu beginnen. Eigentlich wollen wir Max ein paar Stichworte hinwerfen, und er darf dann spontan assoziieren, aber nachdem wir es erklärt haben, legt er selbst los:
»Astronaut«, sagt Max, und mir fällt spontan ein: »Mondlandung und Men in Black 3.«
»Knallfrosch«, fährt er fort, und es entschlüpft mir: »Philipp!«
Dann darf ich mal: »Gier.«
Max: »Dritte Welt, Kolonialisierung, Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe ist die neue Kolonialisierung.«
»Linkspartei.«
Da reichen Stichwortantworten nicht mehr, jetzt verstricken wir uns im Morast der deutschen Tagespolitik. Max gibt zu, nicht sagen zu können, was er jetzt gerade wählen würde.
»Von der Idee her, dass das personenbezogen ist, finde ich das amerikanische Wahlsystem recht ehrlich. Macht ist in jedem Fall auch eine Frage der Biologie, erst in zweiter Linie geht es um Ideen und Inhalte. Wenn jemand sagt ›Ich will was verändern‹, dann muss er auch danach aussehen, ein Feuer in den Augen haben. Das kann gleichzeitig sehr gefährlich sein, wenn es instrumentalisiert wird und derjenige eigentlich nur eine Marionette im Spiel der wirklich Mächtigen ist. Aber ich würde und könnte auch nie nach Parteiprogrammen wählen – die sowieso im Nachhinein sehr vielseitig auslegbar sind.«
An dieser Stelle nehmen wir noch mal kollektiv den Weg an die frische Luft, und Max zeigt uns die künstlerische Attraktion des Geländes. Mitten an der Spree steht ein uraltes, ziemlich großes Ufo. Einfach so. Keiner von uns weiß wieso, aber ich bin total fasziniert und suche mindestens fünf Minuten vergeblich nach einer Möglichkeit, es zu erklimmen.
Mit strahlenden Kinderaugen pilgern Phil, Max und ich zurück in die DDR-Gedenkkantine. Wieder im Warmen, decken wir ein anderes Geheimnis auf: Max war auch mal Hip-Hop-Fan.
»Samy Deluxe und Co., aber vor dem ganzen Aggro-Berlin-Zeug.«
Fan sein ist überhaupt etwas, das Max durchaus selbst kennt. Das volle Programm – sich stundenlang anzustellen, um in der ersten Reihe zu stehen – hat er sich aber vor Kurzem bei Radiohead zum letzen Mal angetan.
Philipp hantiert jetzt an der Kamera herum, um ein paar Schnappschüsse zu machen, und ich erfrage noch ein paar Sachen, die mich persönlich an Max interessieren: »Glaubst du an irgendwas, bist du religiös?«
»Ja, ich wurde evangelisch getauft, bin vor Kurzem aus der Kirche ausgetreten. Ich bin auf jeden Fall nicht kirchlich religiös, aber ich glaube an einen kreativen Gott. Und Kreativität ist Gottesdienst, weil sie so viel Gutes schafft.
In unserer Gesellschaft ist es so einfach, nicht zu glauben. Für andere, zum Beispiel für Zwangsarbeiter in Sibirien, ist es, glaube ich, schlicht gar nicht möglich, ohne Gott auszukommen. In Notsituationen werden wir alle an einem bestimmten Punkt gläubig. Aber verschiedenste Institutionen haben so viel kaputt gemacht von dem, was eigentlich wahr und gut und schön war an der Religion. Das ist aber trotzdem da und steht in der Bibel, dem Buch der Bücher. Ich will nicht in den allgemeinen Religionshass mit einstimmen. Auf die Kirche schimpfen kann jeder, sich zum Glauben bekennen nicht. Auch Liebe als Gottesdienst zu sehen – das ist das, woran ich glaube.«
»Weißt du noch, wie oft du schon ›Ich liebe dich‹ gesagt hast?«
»Nee, ich hoffe bloß, nie nur als leere Phrase. Ich hab mich immer gegen Definitionen gewehrt. ›Ich liebe dich‹ kann sehr schnell einengen, weil es gesellschaftliche Formen ausdrückt, weil da immer gleich Regeln mitschwingen. Ich glaube, dass viele Leute darunter leiden, dass sie sich immer wieder wie zwanghaft diesen Strukturen anpassen müssen, weil sie meinen, nur dann glücklich sein zu können.«
Mein kleines Kathiherz widerspricht streckenweise vehement, vor allem, als wir über den kitschigen Brauch sprechen, Eisenschlösser an Brücken zu befestigen, als Symbol ewiger Liebe. Findet Max ganz unverständlich. Und während Phil eher zustimmt, erkläre ich umständlich etwas von diesem Forever-and-a-day-Gefühl: Auch wenn es endlich ist, kann man sich doch wohl in manchen Momenten der Illusion hingeben, dass es für immer ist. »Das rührt von einem Nicht-verletzt-werden-Wollen her, man schließt eine Art Vertrag.«
Ob er das nicht auch kennt, frage ich ihn – jeder würde sein Herz doch manchmal am liebsten in die Gefriertruhe packen.
»Doch, klar, aber das größte Vertrauen, was es irgendwie geben könnte, ist doch, dass diese ganze Definition egal ist. Weil du weißt, dass diese Verbindung besteht, ganz egal, was man macht. Warum kann man sich für die Erlebnisse des anderen nicht freuen und dann sagen: Tu, was immer dich glücklich macht, weil ich weiß, unsere Liebe ist unantastbar. Aber das ist ein Ideal, in der Wirklichkeit ist das nicht so einfach, es fällt den meisten Menschen schwer, in undefinierten Räumen zu leben. Dadurch sind viele Menschen sexuell frustriert, lassen es aneinander und an den Mitmenschen aus, aber wollen sich bloß nicht angreifbar machen und den Beziehungsstatus verlieren, weil sie dann per se als unglücklichere Menschen wahrgenommen werden. Was hat Eifersucht mit Liebe zu tun? Ist es nicht eher ein Besitzanspruch? Wenn jemand Schluss macht, dann sind wir ja immer noch dieselben Menschen, es ändert ja nichts an unseren Gefühlen. Sondern nur an der Definition der Beziehung. Es erlaubt uns quasi, dass andere Sachen wieder möglich sind, in dieser Nomenklatur der Gefühle.«
Phil murmelt versonnen etwas vor sich hin, und als wir ihn fragen, was er meint, sagt er nur: »Ein schöner Ansatz, ich habe nur lächelnd zugestimmt.«
Max’ Team ruft ihn noch mal an, wir ziehen jetzt um ins Studio.
Sieht alles ziemlich gemütlich aus, Marihuana-Geruch liegt in der Luft, und an den Reglerknöpfen klebt das Gesicht von Dieter Bohlen. Alles fühlt sich gemütlich und familiär an.
»Die Leute, mit denen ich mich öfter treffe, sind nur so eine Handvoll, der Kreis in Berlin ist klein, ein Nest eben.«
Wir hören uns ein paar Auszüge aus dem neuen Album an, unter anderem auch eine deutsche Version von Hallelujah, die Max in wunderbarer Kneipenatmosphäre interpretiert. Danach essen wir ihm und seinem Team noch ein bisschen was von der Pizza weg, die sie sich haben kommen lassen, und trinken alle zusammen noch ein letztes Bier. Es ist fast Mitternacht, wir verabschieden uns und denken, der Tag sei für Max und seine Leute jetzt auch endlich rum. Aber die bleiben noch länger.
»Wenn man grad so drin ist, dann will man auch den ganzen Tag nur weiterarbeiten, auch wenn es richtig anstrengend wird.«
Vielleicht treffen manche von Max Prosas Liedern diese schläfrig-begehrliche Morgengrauenstimmung gerade deshalb so gut, weil sie erst bei Tagesanbruch fertiggestellt wurden.
2. PORTRÄT: REGULA MÜHLEMANN
SCHLUSS MIT KLISCHEES
Philipp über Regula Mühlemann, Opern- & Konzertsängerin, Jahrgang 1986, Luzern
Das stereotype Bild der Opernsängerin ist das der Diva, die erhaben und etwas mollig in edler Abendrobe auf der Bühne steht und mit einem hochnäsig verzogenen Gesicht ihre Arie trällert. Darüber, ob es auch talentierte und versierte junge Talente in dieser Szene gibt, erfährt man in den Massenmedien wenig. Klar, es gibt die Möglichkeit, im Feuilleton seiner Zeitung zu diesem Thema Informationen zu erhalten, doch wirklich cool und hip genug, um die niederen musikalischen Ansprüche unserer Zeit zu erfüllen, mutet diese Profession anscheinend nicht mehr an.
Liegt es an der anspruchsvollen Musik? Daran, dass Arien nicht immer stumpf in Viervierteltakten gespielt werden? Daran, dass man heute seine Musik nur noch in höchstens vierminütigen Songs zu sich nimmt? Man kann es höchstens einkreisen, aber Fakt ist, die breite Masse hat das Interesse an diesem alten Handwerk schon vor langer Zeit verloren. Wenn man nun aber eine Person wie Regula in diesen Kontext setzt, eine wahnsinnig lässige Sängerin, die sich mit ihrem hellen Sopran in die Herzen der Klassik-Fans gesungen hat und so gar nicht das verspannte und altbackene Klischee ihrer Profession erfüllt, dann darf man die Voreiligkeit der breiten Entscheidung gegen die klassische Musik ruhig beklagen.
Wenn sie davon erzählt, wie groß die junge Szene rund um die Klassik ist und wie viel Leidenschaft noch immer in dieser Sparte lodert, dann fühlt man sich schnell einseitig informiert. Die Relevanz dieser Musik für die heutige Zeit wird mit jedem Wort, das man mit Regula wechselt, offensichtlicher. Da sie, vom Beruf getrieben, zur Zeit unseres Interviews in Wien ist und sich dort auf eine Rolle vorbereitet, für die sie nur eine Woche vor Probenbeginn eingesprungen ist, ist unsere einzige Möglichkeit eines Interviews mit Sichtkontakt Skype. Doch liegt es ganz an der ehrlichen Art Regulas, dass sich dieses Interview nicht weniger persönlich anfühlt, als säße man tatsächlich neben ihr in einem Raum. Sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen und erfüllt das Divenklischee, wenn überhaupt, nur mit ihrem guten Aussehen.
Vorhang auf.
»Ich habe meine klassische Ausbildung in Luzern an der Musikhochschule gemacht und nach einem ersten Master of Arts letzten Sommer, also 2012, noch einen zweiten Master abgeschlossen, Solo Performance, wobei ich mich noch mehr auf meine Stimmbildung und Technik spezialisiert habe«, beginnt sie Tee schlürfend mit der Schilderung ihres Lebensweges.
»Meine Familie war schon immer musikalisch, es lief nicht jeden Tag Klassik, sondern auch viel Musik der Siebziger und Achtziger, aber oft wurden dann die LPs der großen Meister wie Mozart, Bach und Beethoven aufgelegt und das war mein erster Ansatzpunkt zu dem Thema. Ich habe mich nie wirklich viel mit Klassik beschäftigt, bis ich dann in der siebten Klasse in einen Mädchenchor eintrat, und von da an erweiterte ich stetig mein Repertoire im Bereich klassischer Musik. Mir bewusst, dass ich eine so viel versprechende Stimme habe, war ich mir lange Zeit nicht, das kam erst langsam und vor allem durch meinen Gesangslehrer. Da war ich aber schon 16 Jahre alt, es war also ein längerer Weg für mich. Mit 19 habe ich dann das Studium an der Luzerner Musikhochschule angefangen und da dann immer mehr gecheckt, was ich mit meiner Stimme alles Tolles anstellen kann. Und das habe ich von dort an gezielt trainiert.«
Singen ist für sie ein Handwerk, in das man, wie in jedes andere auch, viel Zeit und Fleiß investieren muss, um es erfolgreich und respektabel ausführen zu können. Man ist sein eigenes Instrument, man muss sich bilden und formen und dafür einen Lehrer haben, der das verständlich rüberbringt.
»Es gibt so vieles, das man lernen muss. Man muss eine hohe Lautstärke erreichen können, um ohne Mikrofon auf der Bühne eines großen Hauses zu singen und dabei rüberzukommen, muss aber gleichzeitig ökonomisch mit dem Instrument Stimme umgehen, sprich: dieses nicht überlasten oder ausreizen, da sonst schnell Schäden entstehen, die irreversibel sind und die Karriere schnell beenden würden. Und die Metapher meiner Lehrerin, dass ich mein Instrument bin, hat mir einen deutlich höheren Respekt gegenüber meiner Stimme eingebracht.«
Das klingt in Regulas Fall einfacher gesagt als getan, denn die Stimme zu schonen bei dem Pensum, das sie an Auftritten absolviert, ist eine harte Probe.
»Ich arbeite Vollzeit als Sopranistin, reise unheimlich viel hin und her, nach Baden-Baden, Venedig, Salzburg, Berlin, dann zwischendurch mal wieder nach Hause nach Luzern, um ein wenig zu faulenzen«, gibt sie zu und muss ansteckend lachen, »aber so war das auch schon während meiner Studienzeit, ich habe nicht sieben Jahre lang studiert und nebenbei nichts getan, so wäre mein Erfolg niemals zustande gekommen. Das Nonplusultra in der Branche ist Vernetzung, und ohne Auftritte wäre ich nach dem Studium eine topausgebildete Sängerin gewesen, die aber niemand auf dem Zettel gehabt hätte, und das wäre ja Quatsch gewesen, nicht?«
Sie beschreibt ihren rasanten Aufstieg in die Top-Liga der Klassik als einen Strang, der sich von Auftritt zu Auftritt weitergesponnen hat und von dessen Stärke Regula sich damals noch kein richtiges Bild machen konnte.
»Es war nie mein erklärtes Ziel, eines Tages in der Berliner Staatsoper zu singen, das hätte ich niemals erwartet, aber es hat sich einfach so ergeben. Einer der Schlüsselmomente war, dass meine Schule mich nach dem Bachelor als einzige Ausgewählte auf einen Klassik-Wettbewerb geschickt hat, auf dem ich mich mit den Besten der Schweizer Hochschulen maß. Da habe ich dann das erste Mal selber gedacht: Oh, ich hab was drauf und es lohnt sich wirklich, daran weiterzuarbeiten.«
Dann geht vieles um Empfehlungen, und so sitzt in einer Aufführung ein Agent, oder in der Wettbewerbsjury ist eines der Mitglieder Casting Director eines wichtigen Opernhauses. So kommen Vorsingen zustande. Und bei erfolgreichem Vorsingen Engagements. In diesem Prozess des Sich-Referenzen-Schaffens beschloss Regula, bei einer geplanten Produktion von Jens Neubert, einer Constantin-Verfilmung der Weber-Oper Der Freischütz, für eine Nebenrolle vorzusingen. Doch dann kam alles anders.
»Ich sang für die kleine Nebenrolle vor, das war nur eine Zeile, aber ich dachte, es bringt vielleicht schon dieser kurze Auftritt etwas im Hinblick auf künftige Engagements, und Teil eines Filmes zu sein wäre ohnehin toll. Ich habe bei der Bewerbung erwähnt, dass ich die Oper kenne, weil ich die Arie einer der weiblichen Hauptrollen oft vorsinge. Und Gott weiß warum wollte man meine Arie hören und besetzte mich tatsächlich für diese Hauptrolle. So ist aus dem Gedanken, eine Zeile zu singen, eine meiner wohl wertvollsten Referenzen geworden.«
Diese sind so wichtig, da die junge Szene der Klassik eben doch noch eine weltumspannende Gemeinschaft ist und die Musikhochschulen allesamt mit vielversprechenden Talenten voll sind. Man kann schneller den Anschluss verlieren, als es einem lieb ist, und Regula weiß um ihr Glück.
»Die Konkurrenz ist riesig und ich habe jetzt schon die Sicherheit meiner Ausnahmestellung, darüber bin ich heilfroh. So jung in der oberen Liga zu sein ist keine Selbstverständlichkeit, und viele junge Sänger und Sängerinnen würden viel dafür geben, um an diese Position zu gelangen. Es ist ein sehr intensives Business. Denn nur gut sein reicht oft leider nicht, um auch tatsächlich engagiert zu werden, dafür kommt es ähnlich wie im Schauspiel darauf an, dass man eine breit aufgestellte Agentur im Rücken hat. Bei mir ergab es sich so, dass ich im Opernhaus Zürich auftrat und im Cast war mit Ronaldo Villazón, einem der Stars der Szene. Seine Agentin hat die Performance angeschaut und fand mich sehr überzeugend, woraufhin sie mich für ihre Agentur anfragte. Jetzt bin ich in dieser übernational zwischen Berlin und London agierenden Agentur und stehe auf der Liste neben den Top-Namen der Szene. Ich würde mich niemals als etabliert bezeichnen, aber natürlich kommt man an größere und renommiertere Engagements, wenn man so aufgestellt ist.«
Größere Rollen bringen einerseits höheres Ansehen mit sich, andererseits aber auch eine stärkere öffentliche Wahrnehmung. Dass Letztere schon mal mit Problemen verbunden sein kann, davon weiß Regula zu erzählen.
»Ich hatte eine Zeit lang einen Stalker, der mich täglich mit Nachrichten zugebombt hat, auf allen möglichen Wegen, er hatte alle meine Mail-Adressen und Telefonnummern, und ich musste Maßnahmen ergreifen, da ich mich wirklich stark bedrängt gefühlt habe. Sowieso ist es ein wackliges Spiel mit den Fans, die man über die Zeit gewinnt. Der Großteil von ihnen ist super und will einem einfach nur seine Begeisterung mitteilen, doch dann gibt es immer wieder ein paar seltsame Menschen, die in meine offene und freundliche Art zu viel reininterpretieren und anfangen, Forderungen zu stellen«, beschreibt sie die Zweiseitigkeit des Fantums, dem sie bisher begegnet ist. Dass es ihr ungemein schmeichelt, wenn jemand einen Autogrammwunsch hat oder herzliche Glückwünsche loswerden möchte, das steht außer Frage.
»Ich erinnere mich noch an die ersten Autogrammjäger, die meinetwegen vor dem Eingang warteten, das war in Baden- Baden. Da das eine komplett neue Situation für mich war, hatte ich sogar erst etwas Bammel, alleine vor die Tür zu treten, ich wusste ja nicht, ob die zu mir wollten oder zu einem der großen Stars. Ich habe mich dann zusammen mit einem Kollegen nach draußen gestellt, und die kamen dann tatsächlich zu mir mit Fotos aus dem Internet, die sie signiert haben wollten. Ich war ganz überfordert von so viel netten Worten und Glückwünschen.
Nach zu vielen Komplimenten komme ich mir immer komisch vor«, gibt sie ehrlich zu, Hybris sucht man bei ihr vergebens, so etwas Negatives hat im Gute-Laune-Paket Regula nichts verloren.
»Ich finde es auch grausam, wenn jemand hinter jede Aussage so ein sarkastisches Grinsen setzt und man nie weiß, ob das Gesagte ernst gemeint, ironisch oder gar beleidigend war. Ich habe keine Angst, Gefühle zu zeigen. Da bin ich eher Romantikerin, sprich: Ich will Emotionen auch klar als die definieren, die sie sind.«
Aus ehrlichen Emotionen zieht sie darüber hinaus ihre Inspiration, nichts berührt sie mehr, als bei einem Theaterstück oder einer Oper im Publikum zu sitzen und zu merken, wie ihr ein kalter Schauer über den Rücken läuft, weil das Dargebotene so echt wirkt.
»Ich liebe es zu sehen, wie ein Schauspieler eine Rolle ausfüllt, die schon mehrere Hundert Jahre alt ist, aber trotzdem wie für ihn geschrieben scheint. Ich selber werde oft für die Rolle eines Scherzkekses, einer Colombina gebucht. Das entspricht meinem Stimmfach sehr, und ich schaffe es, meinen Part besonders glaubhaft auszufüllen. Das ist ein tolles Gefühl, und das spiegelt sich auch in den Reaktionen des Publikums.«
Doch wenn immer alles einfach und glatt läuft, dann fehlt ihr etwas. Das Adrenalin und der Nervenkitzel bringen sie auf zweihundertprozentige Leistung, dann wird sie aber auch gerne zum Faulpelz – wie wohl jeder liebt auch sie es, einfach mal nichts tun zu müssen. Neben Vollgasgeben muss das zwischendurch auch sein!
»Ich war schon immer eine Stressliebende, ich habe im Abitur auf den letzten Drücker gelernt und ich bin immer in der letzten Minute zum Bus gerannt. Inzwischen bin ich vernünftig geworden und fange sehr früh an, eine Partie zu lernen. Auf guter Vorbereitung basiert die Professionalität in diesem Beruf. Aber gut mit Stress umgehen zu können ist noch immer hilfreich – sei es auf der Bühne auf unvorhersehbare Dinge reagieren zu können oder, wie bei meinem aktuellen Projekt in Wien, eine Partie innerhalb einer Woche auswendig zu lernen, um dann auf der Bühne einen Mann zu spielen. Das ist eine gigantische Herausforderung, die mir alles abverlangt, aber ich genieße es jede Sekunde. Diese Schaffenszeiten der Proben sind die härtesten Zeiten des Berufes, aber man merkt nach jedem Mal, wie viel man dabei gelernt hat und wie sehr man an seinen Herausforderungen gewachsen ist.«
Also, nach einem Leben abseits der modernen Gesellschaft klingt der Beruf der Sopranistin für mich definitiv nicht. Und altbacken? Keineswegs, nicht einmal ansatzweise. Es ist eine sehr anspruchsvolle und stilvolle Weise, mit Musik sein Geld zu verdienen, der man Respekt entgegenbringen und über die man sich auch Gedanken machen sollte, dass es ohne die berühmten Schöpfer der klassischen Musik wohl heute eher mau aussehen würde mit der musikalischen Vielfalt in unseren Gefilden. HipHop oder Minimal ohne String-Samples? Spannungsbögen ohne Pauken? Wohl kaum.
So quicklebendig wie ihre Vertreterin Regula Mühlemann ist die Klassik und mit dem breiten Angebot, das jungen Leuten den Eintritt in Opern und Theater ermäßigt, findet sich auch ein immer größeres junges Publikum dafür.
Eine herzliche Verabschiedung später sitze ich in meinem Keller, denke noch kurz über die Eindrücke nach, die ich von Regula habe, und gehe dann Beethovens Neunte pfeifend die Treppe hinauf.
Vorhang fällt.
3. PORTRÄT: ANOUK JANS
WAS KOMMT NACH »IMMER MEHR«?
Katharina über Anouk Jans, Fotografin & Kulturjournalistin, Jahrgang 1995, Hamburg
Anouk und ich sind eigentlich grundverschieden. Zwar schwimmen wir in derselben kreativen Suppe, was uns dann irgendwie doch zu Seelenschwestern macht, aber an sich sind wir wie zwei kontrastierende Elemente, wie Rausch und Reinheit oder Pop und Punk. Am ehesten haben wir vielleicht die Leidenschaft fürs Leiden und das Leiden an Philipp gemeinsam. Denn ohne Anouk hätte Phil mich nie bei Facebook angepostet und ohne diesen herrlich dreisten Post – »Lass doch ’n Buch zusammen schreiben!« – hättet ihr jetzt vermutlich doch wieder einen Bahnhofsroman über heiße Oberärzte und versaute Krankenschwestern in den Händen.
Denn auch nachdem sich die Teenagerliebe von Anouk und Phil am Baum der vergessenen Märchen erhängt hat, blieben die beiden Freunde. Und weil Freundesfreunde ja irgendwann in den eigenen Besitz übergehen, kommt es dazu, dass wir an einem unfassbar verkaterten Freitag in einem jüdischen Gourmetrestaurant nahe Anouks Nobelapartment zusammensitzen. Weil Anouk ja auch irgendwie Mitschuld an unseren literarischen Verbrechen trägt und außerdem zu den erfolgreichsten Burn-out-Gefährdeten der jungen Kreativszene gehört, ist ihr ein Kapitel in unserem Buch natürlich sicher. Sie ist mit 17 auf der Karriereleiter bereits so weit nach oben geklettert, dass der Vorsprung für Gleichaltrige beinahe unmöglich aufzuholen ist. Aber anstatt sich ein paar tragisch-trunkene Partynächte und einen Gammelurlaub in Llorett de Mar zu gönnen, lässt sich Anouk weiter von ihrem inneren Sklaventreiber anspornen – zu Recht, denn jeder Tag ohne eine neue künstlerische Blüte von ihr ist ein verschwendeter Tag für die Schatzsucher der Szeneblogs und Hochglanzmagazine.
Während ich eher zerknittert dreinschaue – die letzte Nacht auf der Reeperbahn hat mir meine Tagesenergie schon jetzt ausgesaugt –, ist Anouk frisch wie immer. Trotzdem klagt sie über Müdigkeit. »Ich ziehe gerade so viel Inspiration aus meinem Leben, aber das macht es auch so schwer, mal runterzukommen.« Die Angst, dass in ihrer Kunst zu viel von ihrem Leben ist und zu wenig Fiktion, beschäftigt Anouk zwar schon länger. Aber ganz besonders seit sie an einem Buch arbeitet, das neben sehr persönlichen Texten auch Polaroids von Freunden und (Ex-)Geliebten enthält.
»Die Arbeit an meinem Buch, Für dich oder auch nicht, begann vor einem dreiviertel Jahr, als ich mich gerade emotional von jemandem zu lösen versuchte. Ich verarbeitete Schmerz, Freude, Erinnerungen und Zukunftsträume in meinen Texten, die bald so zahlreich wurden, dass ich beschloss, ein Buch aus ihnen zu machen. Schlussendlich ist es ein Roman geworden, teils autobiografisch, teils fiktiv. Über zwischenmenschliche Beziehungen und das Chaos im Kopf einer jungen Frau, die auf der Suche nach sich selbst, ihrer verloren geglaubten Kreativität und der Liebe ist.«
Auch ansonsten ist sie gut unterwegs. Da verliert man als Außenstehender leicht den Überblick. Sie arbeitet zusammen mit dem Hamburger Szene-Magazin an Artikeln, ist exklusiv Style-Beraterin für das neue Schuh-Label Binné, steht für Auftragsarbeiten und ihre Fotostrecke über Hamburgs Kreativszene im Studio, ist als Referentin in Hamburg, Düsseldorf und München unterwegs und ist als PR-Beraterin für Jungdesigner wie Lilli Sachse, Nina Binné und Jose Bénédí tätig. Bei den tausend Hochzeiten, auf denen sie da tanzt, ist ein bisschen Spiritualität nicht ganz fehl am Platz.
»Ich glaube in erster Linie an Ästhetik, Kunst und Liebe. Genauso stark glaube ich jedoch auch an mich selbst. Selbstbewusstsein und ein freier Geist sind für das, was ich tue, unverzichtbar. Ich hatte auch manchmal Angst, zu früh mein Herzensfeuer zu verbrennen. Und sie kommt ständig wieder. Dann suche ich mir ein neues Projekt oder verliebe mich und es beginnt wieder zu brennen.«
Sie lacht ihr weißes, einzigartiges Lachen, und dabei denke ich mir: Vielleicht ist Anouk die einzige Person, in die Phil und ich gleichermaßen verliebt sind. Und gerade deshalb nehmen wir uns raus, sie auch manchmal zu kritisieren. Und uns darum zu sorgen, dass sie vielleicht zu wenig Teenager und zu sehr Karrierefrau ist. Aber wenn es um unsere Berufung geht, sind wir drei völlig beratungsresistent, stur und ein bisschen narzisstisch. Wir leiden gerne an uns selbst, ein Jammertal ist das mit den Möchtegern-Künstlern.
»Ist Kunst, die aus Unglück oder Sehnsucht heraus entsteht, nachhaltiger?«, stelle ich in den Raum.
»Nachhaltiger würde ich nicht sagen. ›Lang ist die Kunst, flüchtig ist das Leben‹, hat Baudelaire gesagt. Da mein Leben, sei es geprägt von Sehnsucht, Unglück oder Freude, mein Kunstwerk ist, sehe ich es immer als flüchtig an.«
Die Stimmung bei diesem Interview unterscheidet sich ziemlich von den anderen. Nicht nur, weil wir Anouk schon länger kennen. Auch der Ort und die Tageszeit, am Mittag in diesem ruhigen, hellen Restaurant … Es passt so sehr zu Anouk und so wenig zu mir. Eigentlich würde ich jetzt noch schlafen und weil ich so müde und verkatert bin, mache ich endlich mal etwas richtig: Ich bin zu schwach, um ständig dazwischenzuquatschen und immer neue Themen in den Raum zu werfen. Endlich ergibt sich aus einer nachdenklichen Stille ein Diskurs, den unser Gegenüber in sich austrägt und vor uns ausbreitet. Plötzlich fängt sie an: »Die Kunst des klaren Denkens beherrsche ich überhaupt nicht. Ich hab generell keine Zeit- und Raumvorstellung. Ein Freund hat sich erst halb weggeschmissen, weil ich ihm nicht sagen konnte, wo Australien liegt. Ich könnte auch nicht schätzen, wie groß dieser Raum ist, oder wie lange wir hier so sitzen. Ich messe das Leben an Momenten, ich sammle sie so auf, aber ich kann sie nur schwer in einen zeitlichen Kontext, in dem ich sie erlebt habe, setzen.«
»Ach, was misst schon das Leben«, sage ich und fühle mich selber gerade überhaupt nicht lebendig. »Hast du Angst vor dem Tod?«
»Nein. Vor einem schnellen Sterben auch nicht. Ich hab mich bei der Beerdigung von meinem Opa vor Lachen nicht halten können, so unglaublich lächerlich fand ich das alles. Ich mochte ihn auch nicht besonders, wahrscheinlich lag’s daran. Aber hab ich Angst vor dem Tod? Nein … gar nicht. Wenn ich weiß, jetzt ist alles richtig, jetzt kann ohne mich nichts mehr schiefgehen, die paar Kinder, die man hat, sind glücklich. Bei mir hoffentlich nur eins. Aber ich will irgendwo sterben, wo es schön ist. Georgia O’Keeffe ist in dem Haus gestorben, in dem sie gemalt hat. Wirklich, in der Steppe, in ihrem Glashaus, irgendwo bei Santa Fe.«
»Für mich klingt das einsam«, bemerke ich.
»Allein vielleicht, aber nicht einsam. Der Tod ist auch so ungeheuer inspirierend. Ich glaube, die antreibende Kraft ist eben genau, dass man weiß, dass etwas endet. Und wenn man doch in dieser Welt bleiben möchte, dann versucht man, etwas zu schaffen, das die Zeiten überdauert.«
Phil beschreibt das als den dokumentarischen Aspekt der Kunst, in die man sein Leben hineinpackt – und somit einen Teil von sich, außerhalb seiner physischen Vergänglichkeit, als Gefühlseindruck hinterlässt.
Ich störe die Romantik der hohen Philosophie, indem ich mich über mein Essen beschwere. »Viel zu gesund!«, befinde ich und schiebe das Grünzeug hin und her.
»Wunderbar, hier gibt es nur gesund«, freut sich Anouk, der meine Fast-Food-Liebe ganz unverständlich ist. Ganz im Gegensatz zur düsteren Todesthematik fällt mir in diesem Augenblick einmal mehr auf, dass Anouk so viel Leben in sich hat. Nicht im Sinn von Quirligkeit, sondern von Frische. Sie sieht immer knitterfrei, gesund und rein aus. Nicht klassisch schön und langweilig wie diese Babydoll-Gesichter aus der bebe-Werbung. Sondern eher so naturbelassen wie eine Elfe, die gerade aus einer Gebirgsquelle aufgetaucht ist.
»Was kommt nach dem Tod?«, greife ich unser Gespräch wieder auf.
»Die Unendlichkeit? Keine Ahnung, und ich bin ganz froh, dass ich das nicht weiß, denn sonst hätte ich vielleicht doch Angst. Ich personalisiere den Tod auch ganz gerne. Also ich stelle mir wirklich eine Person vor, die da irgendwo wartet. Und sie spielt auch jedes Mal einen Charakter. Wenn ich schreibe oder fotografiere. Präsent ist der Tod immer. Wenn er so gut aussieht wie Brad Pitt in Rendevouz mit Joe Black, dann gehe ich am Ende sogar gerne mit. Großartiger Film. Etwas Schreckliches in so großer Schönheit verpackt. Der Tod verliebt sich in das Leben.«
So langsam wird es Phil zu viel mit der Endzeitstimmung. Zeit, dass das Glück in unsere Unterhaltung einzieht. Aber was ist das schon, richtiges Glück?
»Ich bin glücklich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mich begeistern, inspirieren und erfüllen. Ich bin glücklich, wenn ich geliebt werde, gewürdigt und wenn sich das Gefühl des Erfolges einstellt.«
Und wenn man jung ist und so viel mit scheinbarer Perfektion zu tun hat wie Anouk in ihrer Tätigkeit als Fashion-Fotografin, dann ist Glück wohl auch ein Stück weit, sich schön zu fühlen. Das ist bei Anouk immer dann der Fall, »wenn ich von jemandem geküsst werde, der mir etwas bedeutet«.
Phil fallen plötzlich ein paar weiße Zettel in Anouks Tasche auf, die er ausgiebig studiert. Anouk und ich unterhalten uns unterdessen über das Leben und die Liebe. Sie erzählt mir gerade, dass sie als Kind das Märchen vom räudigen Seefahrer Blaubart am meisten mochte. »Sexuelle Problematik auf amüsante Art und Weise erzählt.« Überhaupt landet man mit Anouk verdächtig schnell beim Gesprächsthema Sex, kein Wunder, ist ja auch eines ihrer Lieblingswörter: »Sex«, »Alexithymie« (Gefühlsblindheit) und seit Neustem »Shosholoza«, das tansanische Wort für »vorwärts denken«.
Während ich ganz unsexy in mich hineinmampfe – der Kampf mit dem Grünzeug ist noch nicht beendet – und Phil weiter die weißen Zettel mustert, referiert Anouk mit ihrer erotischen Stimme zum Thema Sex im Kunst-Kontext: »Sex ist für mich ein Entstehungsprozess. Lebensenergie und sexuelle Energie sind identisch, zeigen sich aber in der Polarität von männlich und weiblich. Wenn zwei Dinge zusammenkommen und etwas Neues entsteht, sei es bloß ein Gefühl oder zwei ineinanderlaufende Farben auf einer Leinwand, die einen besonderen, neuen Farbton ergeben. Dieser Prozess, dieser Zusammenstoß von Gegensätzen, ist für mich in der Kunst wie auch im Leben essenziell. Gerade deshalb versuche ich zu experimentieren, wo ich nur kann. Es fühlt sich schrecklich an, so stark von Männern abhängig zu sein, was meine Kreativität betrifft. Ich versuche immer wieder, mich von dem Einfluss, den Männer auf mich haben, zu lösen, aber ich scheine sie doch mehr zu brauchen, als ich mir eingestehen möchte. So sehr sie meine Kreativität auch beflügeln können, so sehr können sie sie auch zunichte machen. Daran arbeite ich noch.«
Phil wedelt mit den weißen Zetteln herum und blickt Anouk fragend an. Sie erklärt, dass das ihre Fragebögen für die Jungs sind, die in ihrem Buchprojekt verarbeitet sind. Bei manchen hat sie allerdings noch Informationsbedarf. Und um auch ja nichts zu vergessen, schleppt sie die weißen Zettel mit sich rum, auf denen in ihrer schwer leserlichen, aber hübsch geschwungenen Handschrift so ziemlich alle Fragen stehen, die sie ihren Buchprotagonisten noch stellen möchte. Kaum ist sie fertig, ergreift Phil die Chance, dreht den Spieß einfach um und stellt Anouk eine der Fragen, die sie sich für ihr Buchprojekt ausgedacht hatte: »Also, ich hab mir da so ein paar Fragen für dieses Interview notiert, fangen wir mal mit der ersten an: Was wünschst du dir in Beziehungen?«
»Jetzt fällt mir erst auf, wie kompliziert das ist – und ich hab diese Fragen aufgeschrieben und gedacht, keiner hätte Schwierigkeiten, die zu beantworten. Also … Ich bin sehr gespannt auf die erste Beziehung, die länger als ein Jahr halten wird und in der ich jemanden wirklich zu kennen glauben werde.
Spontanität, Vielfalt, Sanftmut, Verlässlichkeit. Und dass sich jeder vom anderen inspirieren lässt und den anderen inspirieren möchte. Dass zusammen reisen möglich ist, sei es in Gedanken oder an konkrete Orte. Körperliche Anziehungskraft. Der verbale Austausch ist unglaublich wichtig. Ich war kürzlich mit ein paar Freunden unterwegs, alles bildhübsche Jungs, die aber nichts zu sagen hatten. Es war frustrierend.«
»Was davon hat dir in deiner letzten Beziehung gefehlt?«, will Phil wissen und irgendwie ist die Situation jetzt ein bisschen seltsam, schließlich waren Phil und Anouk ja mal zusammen, das hatten wir in unserem journalistischen Eifer ganz vergessen.
Schnell schwenken wir um auf Herbert Grönemeyer. Über ihn zu schwärmen liegt in Anouks Natur, daran ist thematisch zur Abwechslung mal nichts heikel. »Ich habe ihn schon drei Mal getroffen. Er ist einfach wunderbar. Er ist vielleicht der klügste Mensch, den ich kenne. Es würde mich so sehr interessieren, wie ein Lied klingen würde, das er über mich schreibt.«
Wir spielen noch ein wenig das Frage-Antwort-Spiel, danach brechen wir zur Hafencity auf. Wir rennen noch schnell durch einen Supermarkt und holen was fürs Großstadtpicknick, also Drinks und Chips. Es ist ziemlich windig, wie so oft in Hamburg, und wir setzen uns an die Spree. Anouk mit ihrem Saft, Phil und ich mit Bier. Ich habe Anouk noch nie betrunken erlebt, tragisch eigentlich. Da passieren doch immer diese legendären Geschichten, über die man sich mit guten Freunden noch Jahre später totlacht. Deshalb will ich wissen, was eigentlich ihre verrückteste Nacht war.
»Da habe ich noch in Spanien gelebt. Vier Freunde haben mich besucht, und wir haben nachts neben einem uralten Fußballplatz gechillt. Und da nebendran war ein Swimmingpool, und wir sind nackt rein und über den Rasen gerannt. Und wie in einem Buch oder einem Film ist dann die Polizei gekommen, weil das Betreten des Grundstücks natürlich nicht erlaubt war. Und ich bin dann auf dem Motorrad von ’nem Freund zurückgefahren.«
Anouk hat bald ihren nächsten Termin, ich plane, mich danach noch mal schlafen zu legen. Als Letztes frage ich sie, wie sie die Ironie des Schicksals empfindet, dass sie Phil und mich quasi zu diesem Buchprojekt »zusammengebracht« hat: »Ich finde sie … anregend. Da sieht man mal, wie sich die Wege kreuzen und was so Tolles aus ein plus eins macht zwei entstehen kann.«
4. PORTRÄT: SIMON DESUE