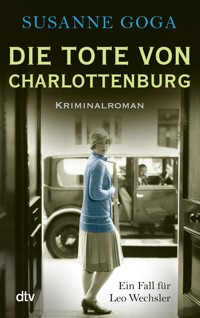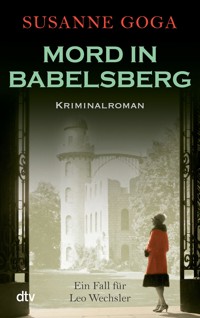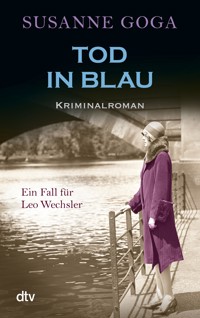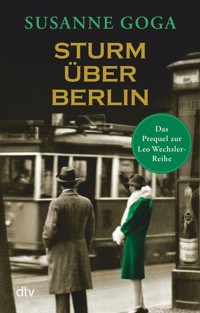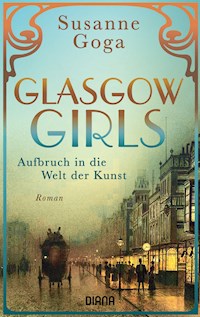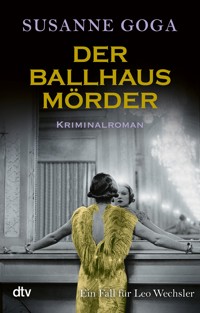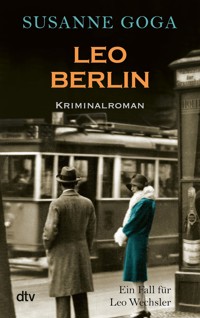
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Ein atmosphärischer Krimi aus dem Berlin der zwanziger Jahre Berlin 1922. Deutschland ist politisch zerrissen, die Menschen finden nach dem verlorenen Krieg keine Ruhe. Kriminalkommissar Leo Wechsler bekommt es mit einem mysteriösen Mord zu tun: Ein Wunderheiler, der in besseren Kreisen verkehrte, wurde mit einer Jade-Figur erschlagen. Keine Zeugen, keine Spuren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Susanne Goga
LEO BERLIN
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Neuausgabe 2012© 2005Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenVermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, GarbsenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, StuttgarteBook ISBN 978-3-423-41371-8 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21390-5Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Für Axel– für alles
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Danksagung
Prolog
»Na los, Kleiner, nicht so schüchtern.« Nie würde er die Worte vergessen. Den Geruch in dem heißen Raum mit seiner üppiggeschmacklosen Dekoration, den blutroten Samtportieren und dem goldenen Spiegel. Das schwere Parfüm, das sinnlich wirken sollte, aber nur schwül und abstoßend war. Die Rufe spielender Kinder unten auf der Straße, die nicht wussten, was hinter den Fenstern des unauffälligen Hauses geschah. Die feuchten, sauren Flecken, die sich unter seinen Achseln gebildet hatten. Seinen trockenen Mund, in dem die Zunge am Gaumen klebte. Und die Frau im geöffneten Negligé, die mit gespreizten Beinen auf dem Bett lag und die ganze Szene mit einer Mischung aus Langeweile und Belustigung betrachtete.
»So ein großer Kerl und noch Jungfrau«, sagte einer spöttisch. »Herbert, schubs ihn mal.«
»Bitte schön.« Der Angesprochene stieß ihn ein Stück näher ans Bett. Er senkte den Kopf, als könnte er so seine Scham verbergen, verriet sich aber durch seine verkrampfte Haltung, die Hände, die sich in die Hosennaht krallten.
»Wenn ihr nicht bald zur Sache kommt, wird’s richtig teuer«, sagte sie mit einer lässigen Handbewegung. Ihre Lippen waren blutrot, das Rouge ließ ihre blasse Haut wie Porzellan aufschimmern. Eigentlich war sie nicht hässlich, hatte er flüchtig gedacht und sich gewundert, dass er zu einer so nüchternen Überlegung fähig war.
Doch dann stieß ihn jemand von hinten, zerrte an seinem Jackett, riss ihm den Hosenschlitz auf, dass ihm die heiße Röte ins Gesicht schoss, und er hörte sie »Herbert, Herbert!« rufen, und er ließ alles mit sich geschehen, hörte ihr Johlen, als sie ihn aufs Bett stießen, auf die Frau.
Herbert zerrte, angefeuert von den Kameraden, an seinen Schuhen, dann an seiner Hose, und die Frau bewegte sich unter ihm und sagte, als sie seine Erektion sah: »Immer sachte, du kommst ja dran«, was eigentlich am schlimmsten war. Sie würde glauben, dass er es insgeheim wollte, dass ihm nur der Mut fehlte, und tief im Inneren spürte er, dass sie Recht hatte. In diesem Augenblick, der sein Leben für immer in zwei Hälften spalten würde, wollte er sie. »Na los, enttäusch sie nicht!«, schrie Herbert heiser. Und als die Tür hinter seinem letzten grölenden Kameraden zugeschlagen war, riss er mit beiden Händen ihr Negligé herunter.
Als der Rausch vorbei war, lag er neben der Frau, auf angenehme, nie gekannte Weise erschöpft. Seine Begierde hatte über die Scham gesiegt. Doch als er sich zu ihr drehte und ihr Gesicht aus der Nähe sah, die Falten um Augen und Mund, nur unzureichend von der Schminke verdeckt, und die wässrig blauen Augen, deren Augäpfel rot geädert waren, kehrte sein Abscheu zurück.
Seine sogenannten Freunde, auf die sein Vater größten Wert legte, hatten ihn in dieses Haus gebracht. Freunde aus guter Familie, die ein zügelloses Leben führten, gegen alle Regeln verstießen, ihre Untaten aber geschickt verbargen. Sie hatten sich über ihn lustig gemacht, und er argwöhnte insgeheim, dass sein Vater hinter dieser erzwungenen Entjungferung steckte. Seine Mutter hätte nie geduldet, dass er sich mit einer solchen Frau abgab, sie berührte, sie–
Aber sein Vater fand ihn zu weich, das hatte er oft gesagt. Zu weich, um die Firma zu übernehmen, zu weich, um in der anspruchsvollen Berliner Gesellschaft etwas zu gelten. Zu weich, um zum Militär zu gehen, dabei litt er doch an Asthma. Das hatte seine Mutter ihm erzählt. Dass er als Junge im Bett nach Atem gerungen, dass sie sich um ihn gesorgt hatte. Zwar hatte er nie etwas davon gemerkt, doch bei der Musterung befand man ihn für untauglich. Seine Mutter hatte eben Beziehungen gehabt.
Er war froh gewesen, als er das Bordell verlassen und zu Hause ein gründliches Bad genommen, die Frau von sich abgewaschen hatte. Und allmählich gelang es ihm, die Erinnerung an sie fortzuschieben.
1
»Herr Kommissar, wollen Sie nicht allmählich nach Hause gehen?«, fragte Ursula Meinelt, die Stenotypistin, und legte Leo Wechsler einige Blätter auf den Schreibtisch. »Ihre Kinder warten sicher schon.«
Leo blickte kurz von seinen Akten hoch, ein wenig misstrauisch, als wollte er prüfen, ob Fräulein Meinelt nicht einfach Lust auf Feierabend hatte.
»Schauen Sie mich nicht an wie ein Polizist«, sagte sie forsch.
»Ich bin Polizist«, entgegnete Leo trocken. »Sie erinnern mich jeden Tag daran. Und wenn man einen Mitarbeiter wie von Malchow hat, kann man die Arbeit gleich allein machen.«
Sie hob beschwichtigend die Hand. »Ich weiß, aber . . . wenn Sie ehrlich sind, ist es auch nicht leicht, mit Ihnen auszukommen.«
Er sah sie überrascht an. »Wieso? Sie kommen doch auch mit mir aus.«
»Darüber wundere ich mich jeden Tag.«
»So frech heute?«, fragte er grinsend. »Wissen Sie, warum ich mit Ihnen auskomme?«
»Weil ich nicht der Sohn eines pommerschen Gutsbesitzers bin, der nur aus Spaß zur Polizei gegangen ist und eigentlich sein Leben mit Forellenfischen auf dem elterlichen Anwesen zubringen könnte«, lautete die schlagfertige Antwort.
»Genau«, sagte Leo Wechsler. »Mit Ihrer Beobachtungsgabe sollten Sie Detektivin werden.«
»Um in Warenhäusern Frauen aufzulauern, die drei Schichten Unterwäsche tragen? Nein danke, da sitze ich lieber vor meiner Schreibmaschine und tippe Ihre Berichte«, sagte sie lächelnd und griff in ihre Rocktasche. »Nehmen Sie die mit, wenn Sie nach Hause gehen.« Sie hielt ihm zwei Zuckerstangen hin.
Er öffnete den Mund, schloss ihn wieder und steckte die Süßigkeiten ein. Beinahe hätte er gesagt, die kann ich selber kaufen. Verdammt, warum glaubte er ständig, dass alle ihn mitleidig anschauten und sich nur für die Tatsache interessierten, dass Kommissar Wechsler verwitweter Vater von zwei Kindern war?
Energisch schlug er den Aktenordner zu und schob ihn zur äußersten Ecke des Schreibtischs. »Sie haben Recht, ich mache Schluss für heute. Und danke für die Zuckerstangen. Wer weiß, wie viel die demnächst kosten.« Er zog sein Portemonnaie heraus. »Sehen Sie sich das mal an. Geht kaum noch zu bei den vielen Scheinen. Letztens habe ich gesehen, wie bei Wertheim jemand mit einem Zehntausendmarkschein bezahlt hat.«
Ursula Meinelt betrachtete die Geldscheine in Leos Hand und schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht, wohin das noch führen soll. Wie kommt es, dass unser Geld immer weniger wert ist?«
»Weil man im Krieg so viel davon gedruckt hat, als wäre es Spielgeld«, antwortete Leo und hängte sich den leichten Sommermantel über den Arm. »Und jetzt sitzen wir in der Achterbahn und wissen nicht, wohin sie fährt. Schönen Abend noch.«
Mit diesen Worten verließ er das Büro.
Als er draußen auf dem Alexanderplatz vor dem Präsidium stand, das im Polizeijargon gern »Fabrik« genannt wurde, atmete er erst einmal auf. Es war halb sieben und taghell, der längste Tag des Jahres nicht mehr fern. Er beschloss, ein Stück Unter den Linden entlangzugehen, bevor er die Elektrische nach Moabit nahm.
Menschen in sommerlicher Kleidung schlenderten über den Boulevard. Von einem Zeitungskiosk sprang ihn das Wort »Blausäure« an. Leo blieb kurz stehen und las die ersten Zeilen.
»Am gestrigen Pfingstsonntag verübten bisher Unbekannte ein Blausäure-Attentat auf den Politiker Philipp Scheidemann (SPD). Er soll dem Vernehmen nach schwere Verletzungen erlitten haben.«
Leo Wechsler schüttelte den Kopf. Manchmal kam es ihm vor, als wäre die Welt verrückt geworden. Als hätte sie acht Jahre zuvor den Verstand verloren und ihn nie wiedergefunden. Zuerst der lange Krieg, dann Revolution und Straßenkämpfe, Hunger, Unsicherheit und . . . Er zuckte zusammen, als ihn die Erinnerung an Dorotheas Tod überfiel. Sie war im Januar 1919 gestorben, die Spanische Grippe war schon beinahe abgeflaut. Als hätte die tückische Krankheit gewartet, bis Marie geboren war, und Dorothea dann umso heftiger gepackt.
Zuweilen ertappte er sich dabei, dass er etwas zu ihr sagen oder sie berühren wollte und erst dann merkte, dass sie nicht mehr da war. Vielleicht hatte er sich zu wenig Zeit gelassen nach ihrem Tod, alles möglichst schnell vergessen wollen. Andererseits erinnerten ihn seine Kinder jeden Tag an Dorothea, und er genoss immer wieder die mit Schmerz vermischte Freude, die sie ihm bereiteten. Wenn Marie eine kluge Frage stellte oder Georg eine gute Note mit nach Hause brachte, dachte Leo, dass er Dorotheas letzte Bitte, gut für die Kinder zu sorgen, wohl doch erfüllt hatte.
Er klopfte auf die Zuckerstangen in seiner Manteltasche, blieb einen Augenblick stehen und schaute nach oben in die grünen Baumwipfel der Mittelpromenade. Eigentlich war es kein Abend zum Nachhausegehen. Solche Abende sollte man lieber in einem Schankgarten verbringen, natürlich nicht allein, ein bisschen tanzen, sich den Kopf verdrehen lassen. Einfach drauflosleben. Das hatte er schon lange nicht mehr getan.
Leo schüttelte den Kopf, wie um sich aus seinen Träumereien zu reißen, und ging zur nächsten Straßenbahnhaltestelle.
Gabriel Sartorius beugte sich über den Tisch. Er starrte die glattgeschliffenen Halbedelsteine an, die in einem nur ihm bekannten Muster auf der unbearbeiteten Holzplatte angeordnet waren. Er spürte, wie die Kraft der Steine in seine Finger strömte, seinen ganzen Körper durchdrang. Sie verlieh ihm übermenschliche Energien, mit denen er die Frau auf dem Diwan von ihrem Leiden heilen würde.
Ellen Cramer lag ganz still auf dem Diwan, die Augen geschlossen, die Arme neben sich ausgestreckt. Sie vertraute Gabriel Sartorius blind. Er behandelte sie seit einigen Wochen wegen ihrer schweren Migräneanfälle, und sie meinte schon eine gewisse Erleichterung zu verspüren. Nachdem sie von einem angesehenen Berliner Arzt zum anderen gelaufen war, ohne die quälenden, von Sehstörungen und Übelkeit begleiteten Schmerzen loszuwerden, hatte sie sich zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschlossen.
Eine Freundin hatte sie auf den Wunderheiler aufmerksam gemacht. Zunächst war Ellen skeptisch gewesen, und ihr Mann wusste bis heute nichts von diesen Besuchen, da er alles ablehnte, dem nicht mit Rechenschieber und Kontenbüchern beizukommen war. Doch er musste auch nie davon erfahren. Sie besaß selbst genügend Geld, um die Honorare des Heilers zu bezahlen.
In Berlin waren Hellseher und Hypnotiseure zurzeit groß in Mode. Man munkelte, dass sogar die Polizei gelegentlich ihre Dienste in Anspruch nahm, um schwierige Fälle aufzuklären.
Sartorius schien sich allerdings nicht als Modedoktor, sondern als Berufener zu empfinden, der auserwählt war, die Leiden der Menschheit zu lindern. Sein wallendes, schulterlanges Haar und die orientalischen Gewänder, in die er sich zu hüllen pflegte, erinnerten an Christus-Gemälde der Renaissance. Er sprach mit sanfter Stimme und verströmte eine Gelassenheit, die Ellen gleich beim ersten Besuch die Angst genommen hatte.
Jetzt spürte sie seine Hände, die beruhigend über ihre Schläfen strichen, über die Stirn fuhren, sich sacht auf ihre Augen legten und wieder zu den Schläfen wanderten.
»Ich übertrage jetzt die Kraft der Steine auf Sie«, hörte sie ihn sagen. »Amethyst gegen die Schmerzen. Karneol für besseres Blut. Diamant für klare Erkenntnis. Hämatit für mehr Lebendigkeit. Opal für mehr Lebensfreude. Brauner Chalcedon für Herzenskraft.«
Sie überließ sich ganz seinen Händen. Seine heilende Kraft umfloss wohltuend ihren Kopf. Beinahe wäre sie eingeschlafen, doch dann klopfte er sanft gegen ihre Wange. »Sie können die Augen öffnen. Die heutige Sitzung ist beendet. Hören Sie auf meinen Rat: Viel Ruhe, genießen Sie Ihr Leben. Überlassen Sie sich Ihrem inneren Fluss, er wird Sie leiten.«
Ellen setzte sich auf und schaute sich im Zimmer um, als hätte die Sitzung auch ihre Umgebung verwandelt. Gedämpftes Licht, schwere Samtvorhänge, an den Wänden eine Mischung aus christlichen, hinduistischen und buddhistischen Motiven, die sie beim ersten Anblick ein wenig irritiert hatte, inzwischen aber vertraut schien. Auf einem kleinen Intarsientisch befanden sich mehrere Gegenstände, die zusammengewürfelt wirkten, dem Heiler aber viel zu bedeuten schienen: ein Dolch mit wunderschön ziselierter Klinge, ein Bild der heiligen Hildegard von Bingen, ein Buddha aus grüner Jade.
Sie legte das Honorar dezent neben den Dolch und verabschiedete sich von Sartorius. »Nächste Woche um die gleiche Zeit?«, fragte er, als er sie zur Tür begleitete.
»Gern. Vielen Dank.«
Er schloss die Tür hinter ihr, nahm das Geld vom Tischchen und steckte es in die Tasche der leichten Hose, die er unter seinem weiten Gewand trug. Dann ließ er sich auf dem Diwan nieder und nahm eine Hand voll Weintrauben aus einer Obstschale. Nach einer Sitzung brauchte er immer Nahrung, um neue Kraft zu gewinnen. Es war anstrengend, den Edelsteinen als Medium zu dienen und ihre heilende Wirkung auf seine Patienten zu übertragen, aber seine wirksamste Therapie. Manchmal ließ er sie auch Szenarien aus den Steinen legen, mit denen er ihren Gemütszustand deutete und ihnen neue Wege aufzeigte.
Da klingelte es an der Tür. Sartorius warf einen Blick auf seinen Terminkalender, doch Ellen Cramer war an diesem Nachmittag als letzte Patientin eingetragen. Seltsam. Er legte die Trauben neben die Schale und ging zur Tür.
Manche Patienten wunderten sich, dass er sie persönlich an der Tür empfing, doch ein Hausmädchen hätte ihn nur gestört. Erst abends kam eine Frau, die den Haushalt besorgte und für ihn kochte, wenn er nicht auswärts aß. Auch heute war er zu einer Gesellschaft bei einem wichtigen Patienten eingeladen und er ärgerte sich, dass noch jemand kam, da er eigentlich ein Bad nehmen und sich in Ruhe umziehen wollte.
Er führte seinen Gast ins Behandlungszimmer. »Ich hatte nicht mit Ihnen gerechnet, es ist so lange her. Ein Anruf wäre ratsam gewesen, dann hätte ich mir mehr Zeit für Sie nehmen können.«
»Ich werde Sie nicht lange aufhalten, Herr Sartorius.« Die rechte Hand in dem eleganten Wildlederhandschuh zitterte leicht.
Als Leo Wechsler die baumbestandene Emdener Straße in Moabit erreichte, in der er seit seiner Heirat wohnte, klebte ihm das Hemd am Körper. Die Straßenbahn war übervoll gewesen, und er war eine Haltestelle früher ausgestiegen, doch der Fußmarsch hatte ihn nicht erfrischt. Es war einfach zu warm.
Er nickte dem Wirt der Eckkneipe zu, mit dem er gelegentlich eine Weiße trank, und ging in Gedanken versunken weiter. Dann hörte er eine vertraute Stimme, nackte Kinderfüße patschten auf ihn zu, und seine Tochter Marie sprang so heftig an ihm hoch, dass sie ihn beinahe umgeworfen hätte. »Vati, da bist du ja endlich. Tante Ilse hat gesagt, du kaufst mir bestimmt ein Eis. Kann ich ein Eis haben, bitte?«
Er küsste seine Tochter auf die Nasenspitze, umschlang mit dem rechten Arm ihre Taille und stellte sie auf den Boden. Sie reichte ihm inzwischen fast bis zur Hüfte, dabei kam es ihm vor, als hätte er sie erst gestern als winziges Bündel im Arm gehalten. »Ich glaube kaum, dass Tante Ilse das gesagt hat. Aber, Moment mal, was ist denn das hier in meiner Manteltasche?« Er tat geheimnisvoll, bevor er eine von Fräulein Meinelts Zuckerstangen hervorzauberte.
Marie griff mit strahlenden Augen nach der Stange, riss das Papier ab und steckte sie zufrieden in den Mund. Sie lutschte hingebungsvoll, hielt dann aber inne. »Hast du auch eine für Georg?«, fragte sie besorgt.
Leo wurde es heiß in der Brust. Seine Tochter. »Ja, natürlich, Liebes. Wo steckt er eigentlich?«
Marie zeigte die Straße hinunter. »Im Hof von Nr.56.Mit den Jungs vom Hufschmied. Die suchen bestimmt wieder Kippen.«
Leo runzelte die Stirn. Manchmal bereute er, dass sie hier wohnen geblieben waren, nur weil er in dieser Gegend aufgewachsen war. Sentimentalität, dachte er dann. Vielleicht wären seine Kinder woanders besser aufgehoben. Einerseits wusste er, dass auch die Straße eine Schule war, in der man Dinge lernen konnte, die in keinem Buch standen. Aber Kippen sammeln, Tabak herauspulen und verkaufen ging dann doch zu weit.
»Hol Georg! Wir wollen essen«, sagte Leo und blieb vor der Haustür stehen.
Marie rannte los, bog ein paar Häuser weiter in die Toreinfahrt und kam kurz darauf mit ihrem achtjährigen Bruder wieder, der nur ein abgetragenes Hemd und kurze Hosen anhatte. »Hallo, Vati«, sagte er. Leo fuhr ihm durchs Haar.
»Ich mache keine große Sache draus, aber das mit den Kippen lässt du in Zukunft bleiben.«
Sein Sohn schaute ihn schuldbewusst an. »Na ja, wir haben gedacht, wir verdienen uns was dazu. Sind doch schlechte Zeiten, Vati.«
Wie sollte er da hart bleiben? Seufzend schloss Leo die Haustür auf und trat in den wohltuend kühlen Flur. Das schlichte Treppenhaus war hell und sauber, die Holztreppe blank gebohnert, die rot-weißen Fliesen frisch gescheuert, und es roch nie nach abgestandenem Essen oder muffiger Wäsche wie in den Hinterhäusern. Seltsam, wie eng diese Welten beieinander lagen. Er kannte die Hinterhäuser, hatte dort oft genug Ermittlungen durchgeführt und war immer wieder betroffen von dem Elend, das in ihnen herrschte.
Dabei gehörte diese Gegend im Westen Berlins noch nicht zu den schlimmsten. Er kannte Mietskasernen im Norden und Osten, die an wimmelnde Bienenkörbe erinnerten, nicht an menschliche Behausungen. Im ersten Stock blieb er vor der linken Tür stehen und fragte seine Kinder leise: »Wie ist die Lage?«
»Leicht bewölkt, aber trocken«, meinte Georg grinsend im geheimen Kode, der die jeweilige Stimmung seiner Tante bezeichnete.
Sein Vater grinste zurück und schloss die Wohnungstür auf. Aus der Küche drang der Geruch von frischen Pellkartoffeln, und er spürte plötzlich seinen Magen. Bei der Arbeit vergaß er gelegentlich das Essen.
»Bist du das, Leo?«, rief seine Schwester aus der Küche. »Hast du die Kinder mitgebracht? Wer weiß, wo die sich wieder rumtreiben.«
»Keine Sorge, Ilse.« Er ging in die Küche und legte seiner Schwester die Hand auf die Schulter. Sie war kleiner als er, hatte aber seine dunklen Haare und die gleichen blaugrünen Augen. Obwohl sie nur zwei Jahre älter war, wirkte ihr Gesicht matt, resigniert und vorzeitig gealtert. Er spürte die Spannung, die sich nie ganz gelegt hatte, seit Ilse vor über drei Jahren zu ihnen gezogen war. Nach Dorotheas Tod hatte sie ihm angeboten, sich um die Kinder zu kümmern, doch insgeheim vermutete er, dass es eher aus Pflichtgefühl geschehen war und Ilse nun fürchtete, das Leben laufe an ihr vorbei.
»Die Erdbeeren sehen wunderbar aus«, sagte er und biss in eine leuchtend rote Frucht. »Schmecken nach Sommer.«
Sie lächelte verhalten. »Das war ein Glücksfall. Ein Bauer hielt mit seinem Karren genau vor der Tür, da konnte ich nicht nein sagen. Die Kinder haben so gebettelt.«
»Danke.« Er strich ihr leicht über den nackten Oberarm, eine scheue Geste, mit der er seinen Dank besser als mit Worten ausdrücken konnte. »Georg war wieder mit Pollacks Söhnen zusammen. Haben Kippen gesammelt. Vielleicht sollte ich ihm ein bisschen Taschengeld geben.«
Ilse streute etwas Zucker über die klein geschnittenen Erdbeeren und rührte vorsichtig um, damit sie Saft zogen. »Ach, übertreib’s mal nicht, Leo. Wer weiß, wer es ihm wegnimmt.«
»Du bist misstrauischer als die Polizei«, meinte Leo ironisch. »Siehst in allen Leuten nur das Schlechte.«
Ilse lachte, aber das Lachen erreichte ihre Augen nicht. »Wenn du öfter hier wärst, wüsstest du, was in den Hinterhöfen passiert. Georg hat erzählt, dass sie einem Mitschüler auf dem Heimweg die gute Jacke gestohlen haben.«
»Wer schickt denn in solchen Zeiten sein Kind mit einer guten Jacke in die Schule? Und davon abgesehen– was glaubst du, mit wem ich es tagsüber zu tun habe? Mit der Heilsarmee?«
Manchmal kam ihm das Leben mit ihr vor wie eine alte, abgenutzte Ehe. Sie kannten sich, kamen halbwegs miteinander aus, doch es gab keine echte Zuneigung. Ob er überhaupt noch dazu fähig war?
Seufzend setzte er sich an den Tisch und goss sich ein Glas Wasser ein.
»Ansonsten alles in Ordnung? Hat Georg seine Hausaufgaben gemacht?«
»Ja, alles bestens.« Ilse zögerte und sah ihn unschlüssig an.
»Was ist denn?«
»Na ja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber . . . Er hat gesagt, dass ein Junge aus seiner Klasse komische Sachen erzählt.«
»Was für komische Sachen?«
»Dass lauter Verbrecher an der Regierung sind. Und dass vor dem Krieg, als wir noch den Kaiser hatten, alles besser war.«
»Ach, Ilse, das ist doch das übliche Gewäsch, das kann er in jeder Zeitung lesen. Warum soll ich mir darüber Sorgen machen?«
»Er hat auch erzählt, dass dieser Junge einen Klassenkameraden verprügelt hat, weil er nicht vor ihm salutieren wollte.«
Leo schaute hoch. »Wie bitte?«
»Der Junge hat wohl behauptet, der Vater des anderen sei ein Roter, der Deutschland verraten habe.«
Leo seufzte. »Wir sind hier in Moabit, da gibt es Rote wie Sand am Meer.«
»Schon, aber der Schläger war der Sohn vom Lehrer.«
»Was? Hat Scheller schon wieder mit seinen Sprüchen angefangen?« Obwohl kriegsverherrlichende Propaganda an den Schulen gesetzlich verboten worden war, gab es noch viele treue Staatsdiener, die den Jungen Flausen in den Kopf setzten und vom Tod fürs Vaterland schwärmten. Ludwig Scheller war ein Hetzer der übelsten Sorte, und Leo war mehr als einmal mit ihm aneinander geraten. Zurzeit herrschte zwischen ihm und dem Lehrer eine Art Waffenstillstand. »Wenn es so weitergeht, muss ich wohl noch mal mit ihm reden.« Er trank einen Schluck Wasser. »Hast du gehört? Man wollte Scheidemann mit Blausäure töten. Weißt du noch, wie er damals am Fenster gestanden und die Republik ausgerufen hat?«
Ilse zuckte gleichgültig mit den Schultern und stellte die Schüssel mit den Erdbeeren auf den Tisch, dazu Kartoffeln, Margarine und etwas Wurst. »Die Politik ist schmutzig, das habe ich schon immer gesagt. Und nur weil jetzt die anderen dran sind, wird sie nicht besser. Ich hole die Kinder zum Essen.« Mit diesen Worten ging sie aus der Küche und Leo sah ihr nach. Auf einmal kam er sich unendlich allein vor.
Marie stürmte in die Küche und kletterte auf den Stuhl neben ihrem Vater. »Guck mal, Papa, Tante Ilse hat Erdbeeren gekauft. Sehen die nicht lecker aus?«
Fünf Minuten später war ihr Mund rot verschmiert und ihre Augen strahlten. »Für wen ist die letzte?«, fragte sie mit einem besorgten Blick auf ihren Bruder.
»Ach, ich bin so satt«, meinte Georg vielsagend und schaute seinen Vater an, der anerkennend lächelte.
Leo trat ans Wohnzimmerfenster, riss es weit auf und rauchte eine seiner seltenen Zigaretten. Komisch, viele Menschen rauchten nur in Gesellschaft, er aber rauchte, wenn er einsam war.
In Gedanken versunken fuhr er mit einem Finger über seine linke Schläfe, an der eine lange weiße Narbe vom Haaransatz bis zur Höhe des Wangenknochens lief. Vor drei Jahren, bei den Straßenkämpfen im Winter, hatte er bemerkt, wie drei Polizisten einen Arbeiter verprügelten, der schon am Boden lag, die Arme um den Kopf geschlungen. Spontan war er dazwischengegangen. Worauf die Polizisten mit ihren Gummiknüppeln auf ihn einschlugen. Manchmal glaubte er, dass sie ihn nur bei der Kripo behalten hatten, weil Kriminaloberkommissar Ernst Gennat sich für ihn eingesetzt hatte.
Auf der Straße spielten noch ein paar Kinder. Ein Betrunkener taumelte aus der Eckkneipe und umschlang den nächsten Laternenpfahl wie eine Geliebte. Von hier oben sah alles aus wie immer, kein Hunger, kein Elend, keine Krankheiten. Aber das war nur die Täuschung eines hellen Sommerabends.
Später las er in einem Buch über Malerei, eine seiner privaten Leidenschaften. Gegen neun klingelte das Telefon. Sie besaßen einen der wenigen Anschlüsse in dieser Gegend, weil Leo als Kriminalkommissar ständig erreichbar sein musste.
»Wechsler.«
»Leo, du musst kommen«, meldete sich sein Kollege Robert Walther, mit dem er befreundet war. »Wir haben einen Mordfall in Charlottenburg. Ein Mann namens Gabriel Sartorius wurde erschlagen.«
Er saß am Schreibtisch, vor sich ein Glas Weinbrand. Seine Hände ruhten auf der polierten Tischplatte, reglos, ohne die Spur eines Zitterns. Mit diesen Händen . . .
Dabei hatte er nur mit ihm reden wollen. Ihn fragen, wie jemand außer ihnen beiden von den Dingen wissen konnte, die er ihm anvertraut hatte. Wie jemand diesen Brief hatte schreiben können. Ob jemand, der Sartorius nahe stand, den Heiler missbraucht hatte, um dessen Patienten zu schaden. Das musste der Mann ihm sagen, das war Sartorius ihm schuldig, nachdem er seine ganze Heilkunst an ihm ausprobiert hatte: Edelsteine, Meditation, Pendel, Hypnose . . . einfach alles, was Hilfe versprach.
Doch als er davon erzählte, hatte er eine flüchtige Veränderung bemerkt, ein verstohlenes Grinsen, das einen Mundwinkel des Heilers kräuselte. Sollte er . . .? Nein, das war undenkbar.
2
Kriminalsekretär Robert Walther holte ihn ab. Leo hatte sich kurz gewaschen, ein frisches Hemd übergezogen und Ilse Bescheid gesagt, die sich mit einem säuerlichen Blick von ihm verabschiedet hatte. Dann war er die Treppe hinuntergeeilt und in den dunkelblauen Dienstwagen gestiegen. Im Fond saßen die Kriminalassistenten Stahnke und Berns, die Leo kannte und schätzte. Es gab keine festen Mordkommissionen, sondern nur Ermittlergruppen, die von einem Kommissar geleitet und für jeden Fall neu zusammengestellt wurden. Daher war es Glückssache, wer einem zugeteilt wurde.
»Gott sei Dank, dass sie dich geschickt haben und nicht von Malchow«, sagte Leo zu Walther, nachdem er sich auf dem Beifahrersitz niedergelassen hatte.
Sein Kollege grinste ihn schräg von der Seite an. »Ich glaube, der ist über Pfingsten weggefahren.«
Leo antwortete mit einem Knurren. »Für den besteht das Leben nur aus Feiertagen.« Er schwieg eine Weile. »Wer hat angerufen?«
»Das Charlottenburger Revier. Die Haushälterin hat die Leiche gefunden und ist auf die Straße gerannt. Zum Glück kam gerade eine Fußstreife vorbei.«
»War sonst niemand im Haus?«
»Wohl nicht. Es sind nur drei Wohnungen, eine ist zu vermieten, die Mieter der dritten sind verreist.«
»Dabei hatte ich es mir gerade mit einem Buch bequem gemacht«, meinte Leo seufzend, als der Wagen am Charlottenburger Schloss vorbei den Spandauer Damm entlangschoss. Er bog einmal links ab, rechts, dann waren sie in der Nussbaumallee. Walther hielt vor einer eleganten Mehrfamilienvilla, die in einem üppigen Garten mit alten Bäumen lag. Die Männer stiegen aus, Walther mit seiner Kamera bewaffnet, Stahnke und Berns mit dem Spurensicherungsbesteck, und gingen durch das Gartentor zu der säulenflankierten Eingangstür. Auf ihr Klingeln öffnete ein Schutzpolizist die zweiflügelige Haustür und grüßte.
»Guten Abend. Kommen Sie bitte mit. Der Arzt wird gleich kommen.«
Das Treppenhaus war ganz in Weiß gehalten, weiße Marmortreppe, weiß getünchte Decke mit üppigen Stuckornamenten. Das Geländer hatte einen Handlauf aus poliertem honigfarbenem Holz und war aus glänzend schwarzem Schmiedeeisen. Ganz schön feudal, dachte Leo bei sich. Der Polizist führte sie in den ersten Stock, wo hinter einer Wohnungstür lautes Schluchzen hervordrang. »Die Haushälterin, Elisabeth Moll«, sagte der Schupo leise. »Sie hat die Leiche gefunden.«
»Wurde die Wohnungstür aufgebrochen?«, fragte Leo mit einem Blick auf das Schloss.
»Nein, sie war vollkommen unversehrt. Frau Moll hat sie mit ihrem eigenen Schlüssel geöffnet. Die Tür war nur zugezogen, nicht abgeschlossen. Darüber hat Frau Moll sich gewundert, wie sie sagte. Im Wohnzimmer fand sie dann die Leiche ihres Arbeitgebers«, erklärte der Streifenpolizist.
Leo nickte. »Gut. Walther, Stahnke, Berns, ihr seht euch den Tatort an. Ich rede erst mal mit der Frau.«
Leo fand die Haushälterin in der Küche, wo sie vor einem Glas Weinbrand am Tisch saß und sich die Tränen mit einem karierten Geschirrtuch abtrocknete. Ihr dickes Gesicht mit dem Doppelkinn war stark gerötet, die Augen verquollen. Er reichte ihr sein Taschentuch, worauf sie ihn dankbar und zugleich verwirrt ansah. »Sind Sie von der Kriminalpolizei?«
»Kommissar Leo Wechsler«, stellte er sich vor. »Erzählen Sie mir bitte in Ruhe, was geschehen ist.« Er setzte sich zu ihr an den Tisch.
»Ich, na ja, ich sollte um sieben kommen und sauber machen. Kochen brauchte ich nicht, weil Herr Sartorius«, sie schluckte, als sie den Namen aussprach, »weil er heute eingeladen war.«
»Bei wem?«
»Bei Konsul Werresbach in Zehlendorf.«
»Er verkehrte also in illustren Kreisen?«
»Er war ein Heiler, er hat vielen Menschen geholfen. Auch armen Leuten«, fügte sie hinzu, als wollte sie ihn nachträglich in Schutz nehmen. »›Wer viel bezahlen kann, bezahlt viel, wer wenig hat, zahlt wenig‹, hat er mal zu mir gesagt. Wie er das mit dem Heilen gemacht hat, weiß ich aber auch nicht. Davon verstehe ich nichts«, sagte sie entschuldigend.
»Darum kümmern wir uns noch. Wie war er denn so als Mensch? Lebte er allein? Hatte er Familie? Ich muss das alles fragen, damit ich mir ein Bild von dem Toten machen kann. Wir müssen herausfinden, wer ihn getötet hat, aber das ist nur möglich, wenn wir ihn nachträglich kennen lernen. Verstehen Sie das?«
Frau Moll nickte. »Er wohnte allein und hatte, soweit ich weiß, auch keine Verlobte. Seine Familie lebt irgendwo im Osten. Er war immer freundlich. Hat nie ein böses Wort zu mir gesagt. Und als ich letztes Jahr den schlimmen Hexenschuss hatte, hat er mir die Hände auf den Rücken gelegt, einfach so. Mir wurde ganz warm, das hat Wunder gewirkt.«
»Gab es denn auch Leute, mit denen er Streit hatte? Ehemalige Patienten vielleicht, denen er nicht geholfen hat? Die sich um ihr Geld betrogen fühlten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin auch nur die Haushälterin . . . ich meine, ich war–« Sie schluckte wieder, und Leo spürte ihre Angst, sich in diesen Zeiten nach neuer Arbeit umsehen zu müssen. Eine Stelle wie diese war Gold wert und ungeheuer schwer zu finden.
Er stand auf und legte ihr die Hand auf den Arm. »Bleiben Sie bitte noch hier. Beruhigen Sie sich ein wenig, ich komme später noch einmal zu Ihnen.«
Mit diesen Worten verließ er die Küche und ging zu den Kollegen ins Wohnzimmer.
Gabriel Sartorius lag auf dem Rücken, die Arme weit ausgestreckt, ein Bein gerade, das andere angewinkelt. Sein Kopf war von einer roten Lache umgeben, die langen Haare waren an der rechten Kopfseite mit Blut verklebt und hingen dem Toten ins Gesicht, so dass Leo die Züge nicht erkennen konnte.
Die Kollegen hatten bereits ganze Arbeit geleistet. Ein Kreidekreuz markierte eine Stelle nicht weit vom rechten Arm der Leiche. Daneben lag ein grüner Gegenstand.
Leo kniete sich hin.
»Das ist eine Figur aus . . . wie heißt dieser grüne Stein doch gleich?«, fragte Stahnke, ein kräftiger Mann mit rotem Walrossschnurrbart.
»Jade. Ein Buddha aus Jade.«
Walther begann den Tatort sorgfältig zu photographieren, nahm zuerst das Opfer aus allen Winkeln auf, dann den Buddha und das Wohnzimmer als Ganzes. Das Kreidekreuz war die einzige Markierung im Raum.
»Sonst nichts?«, fragte Leo erstaunt.
»Nein, Herr Kommissar«, erwiderte Berns. »Keine Kampfspuren, keine Gegenstände, die auf den ersten Blick nicht hierher gehören, keine aufgerissenen Schubladen oder Schranktüren, nichts, was auf einen Raubmord hinweist. Neben der Obstschale liegen Weintrauben, als hätte er davon gegessen, bevor der Mörder ihn überraschte. Vermutlich wird man im Magen Reste davon finden. Wir können die Haushälterin fragen, ob ihr etwas auffällt, aber–«
»Lasst nur, sie hat genug gesehen.« Walther wunderte sich immer wieder, wie rücksichtsvoll Leo Wechsler mit den Beteiligten an Mordfällen umging, während er sich seinen Kollegen gegenüber manchmal grob und unduldsam zeigte.
Der Kommissar sah sich den Buddha näher an, ohne ihn zu berühren. Die Figur war blutverschmiert, an einer Ecke des Sockels klebte ein Büschel Haare. »Jedenfalls brauchen wir nicht lange nach der Mordwaffe zu suchen. Einen Moment, ich komme gleich wieder.«
Er nickte den Männern zu, die ihr Spurensicherungsbesteck auspackten und anfingen, sämtliche Oberflächen von Möbeln, Gegenständen und Türklinken mit feinen Pinseln und Rußpulver zu bestäuben, und ging noch einmal in die Küche. Frau Moll hatte sich nicht von der Stelle gerührt und sah ihn ängstlich an.
»Keine Sorge, ich habe nur noch eine Frage. Vermutlich wurde Herr Sartorius mit einer Buddhafigur aus grüner Jade erschlagen. Können Sie mir sagen, ob die Figur ihm gehört hat und wenn ja, wo er sie aufbewahrte?«
»Meinen Sie den dicken Mann?«, fragte Frau Moll spontan. »Der hat immer auf dem Tischchen neben dem Diwan gestanden. Ich musste ihn jedes Mal hochheben, wenn ich Staub gewischt hab. War ganz schön schwer.«
»Das glaube ich gern«, entgegnete Leo und dachte an den zerschlagenen Kopf des Heilers. »Vielen Dank. Die Kollegen nehmen jetzt noch Ihre Fingerabdrücke, danach können Sie Ihre Aussage unterzeichnen. Wir melden uns, falls wir Sie noch einmal brauchen.«
Die Haushälterin schaute ihn entsetzt an. »Fingerabdrücke? Warum denn? Ich bin . . . ich hab doch nicht . . .« Sie brach erneut in Tränen aus. Leo legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter.
»Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, Frau Moll. Nur so kann unser Erkennungsdienst die Fingerabdrücke des Täters von denen aller anderen Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten haben, unterscheiden. Und Ihre Aussage ist uns sehr wichtig.«
Sie nickte, schniefte und ging rasch zur Tür hinaus.
Leo kehrte ins Wohnzimmer zurück und sah die Kollegen fragend an. »Schon was gefunden?«
»Nicht viel«, meinte Stahnke. »Bis jetzt können wir nur wenig sagen, müssen erst die Abdrücke des Toten nehmen. Die Haushälterin scheint beim Staubwischen sehr penibel zu sein, es sind nur wenige brauchbare Abdrücke vorhanden. Mal sehen, was wir an der Mordwaffe finden.« Er bückte sich, streifte Handschuhe über und steckte den Buddha vorsichtig in eine Papiertüte.
Leo schickte Berns zu Frau Moll in die Küche, dann sahen er und Walther sich in den übrigen Zimmern um.
Auf den ersten Blick wirkte alles unberührt und aufgeräumt. Anscheinend war nichts durchsucht worden. Er wies Stahnke und Berns an, sämtliche Türklinken zu behandeln, obwohl ihm sein Gefühl sagte, dass der Täter nur Flur und Wohnzimmer betreten hatte. Die ganze Wohnung war teuer eingerichtet, mit einem Hang zum Exotischen. Das Bett war mit orientalischen Schnitzereien verziert, an den Wänden hingen exquisite chinesische Malereien, die sich bei näherem Hinschauen als reichlich pornographisch entpuppten. Im Kleiderschrank hingen kaum Herrenanzüge oder Sakkos, dafür zahlreiche wallende Gewänder und Kimonos in leuchtenden Farben, die mit üppigen Stickereien verziert waren. Nur die Küche war schlicht und zweckmäßig eingerichtet.
Es klingelte an der Tür, und kurz darauf führte der Polizist einen Mann mit Stahlbrille herein, der einen schwarzen Lederkoffer in der Hand trug. »Dr.Lehnbach vom kriminalärztlichen Bereitschaftsdienst«, stellte er sich vor. »Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen.«
Er untersuchte die Leiche, ohne ihre Lage zu verändern, und fragte dann in knappem Ton: »Wer kann das Diktat aufnehmen?«
Kriminalassistent Berns zückte Notizblock und Bleistift.
»Ich treffe abends um zehn vor zehn am Tatort ein. Der Tote, männlich, ungefähr vierzig Jahre, liegt auf dem Rücken. Todesursache vermutlich Schädel-Hirn-Trauma infolge eines Schlages mit einem schweren Gegenstand. Der Schädel weist rechtsseitig eine Platzwunde auf, die Blutung ist beträchtlich. Der Tod ist schätzungsweise vor vier bis fünf Stunden eingetreten.«
»Könnte das hier die Mordwaffe sein?«, fragte Leo und hielt dem Arzt die geöffnete Tüte hin.
Dr.Lehnbach schaute sich den Buddha an und wog die Tüte in der Hand. »Sieht ganz danach aus. Alles Weitere erfahren Sie nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Sie hören in zwei bis drei Tagen von mir. Guten Abend, die Herren.«
Dann hatte er die Arme vor der Brust verschränkt und von oben herab gesagt: »Glauben Sie etwa, ich rede mit anderen über meine Patienten? Glauben Sie, ich könnte kein Geheimnis wahren? Ich bin zwar kein Arzt, aber ich habe meinen eigenen Ehrenkodex, und der verbietet mir, über meine Arbeit zu sprechen.« Er hatte auf die Uhr gesehen, als wollte er ihn zum Gehen drängen.
»Natürlich, Herr Sartorius, aber irgendjemand muss doch davon wissen. Sonst hätte ich nicht den Brief–«
Der Heiler hob die Hand. »Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass Sie vielleicht gar nicht mehr wissen, mit wem Sie worüber reden? Dass Sie anfangen, Dinge zu vergessen? Dass Ihnen Ihre Welt allmählich entgleitet?«
»Nein«, hatte er gestammelt, war sich plötzlich vorgekommen wie ein Junge, der seinem strengen Vater gegenübersteht, eine Situation, die er nur zu gut kannte.
»Sie kommen her und machen mir dreiste Vorwürfe. Was gehen mich Ihre Frauengeschichten an? Woher wollen Sie wissen, dass es nicht jemand aus Ihrer Vergangenheit war, der sein Wissen zu Geld machen will? Die Zeiten sind schlecht, da kann man jede Mark gebrauchen.«
Doch als ihn Sartorius’ Blick wie ein Seziermesser traf, wusste er, von wem der Brief stammte.
Der Heiler wandte sich ab, beugte sich ungerührt über seinen Terminkalender. »Wenn Sie nun bitte–«
Der Griff nach dem Buddha war nicht überlegt, eher ein Automatismus, wie von fremder Hand geführt. Er erinnerte sich, wie er Sartorius bei seinem ersten Besuch danach gefragt hatte. »Ja, ein wirklich außergewöhnliches Stück. Ich habe ihn aus China mitgebracht, wo ich die asiatische Heilkunst studiert habe.«
Die Figur wog schwer in seiner Hand, und doch war es so leicht, Sartorius bot sich ihm förmlich dar, und er hob den Buddha hoch und schwang ihn, schwang ihn . . .
Irgendwann schaute Leo auf die Uhr. Mittlerweile war es halb elf, und er wurde allmählich müde. Daher war er froh, als die Leiche abtransportiert war und sie endlich Schluss machen konnten. Sie packten ihre Utensilien ein, versiegelten die Wohnung und verließen das Haus. Draußen vor dem Gartentor blieb Leo stehen. »Heute ist noch Ruhe. Falls er wirklich Patienten aus der feinen Gesellschaft behandelt hat, wird uns die Presse belagern, sobald sie davon Wind bekommt. Ich wüsste gern mehr über diesen Heiler und seine Methoden. Morgen nehmen wir uns seinen Terminkalender und das Patientenbuch, oder wie immer er es genannt hat, vor. Ich glaube, das wird eine interessante Lektüre.«
»Steig ein, ich setz dich zu Hause ab«, meinte Walther.
Doch Leo schüttelte den Kopf. »Ich gehe lieber zu Fuß.«
»Ich dachte, du bist müde. Der Weg ist ganz schön weit.« Aber Leo winkte ab und ging davon.
Manchmal wusste er selbst nicht, ob es gut war, immer seinen Impulsen zu gehorchen, aber es war eben seine Art.
Walther war einer der wenigen Kollegen, die Leos gelegentliche Sprunghaftigkeit akzeptierten und als das erkannten, was sie war: ein starkes kriminalistisches Gespür, das nicht selten zum Ziel führte.
Dieser Mord war nicht aus Habgier geschehen, das ahnte er. Und die Waffe war auf jeden Fall einer der Schlüssel.
Entweder hatte der Täter im Affekt gehandelt und nach dem erstbesten Gegenstand gegriffen, der sich bot, oder er hatte die Wohnung gekannt und die Tat geplant. Vermutlich hatte Sartorius den Mörder gekannt, da die Tür unversehrt war, oder ihm zumindest so weit vertraut, dass er ihn in sein Wohnzimmer gelassen hatte. Er würde Frau Moll morgen fragen, ob sie ihren Arbeitgeber als eher vorsichtig oder vertrauensselig empfunden hatte.
Leo näherte sich in Gedanken versunken der breiten, von Geschäften gesäumten Turmstraße, die wie eine Lebensader mitten durch Moabit führte, als plötzlich ein frischer Wind aufkam, der die Gedanken an den Mord vertrieb. Er sah auf die Uhr. Fast halb zwölf.
Es war, als stieße ihn die Emdener Straße ab wie ein Magnet mit gleichem Pol. Etwas in ihm wollte nicht nach Hause. Die Kinder schliefen, Ilse war vermutlich auch nicht aufgeblieben.
Er seufzte. Seine Frau hatte oft auf ihn gewartet, wenn er spätabends zu einem Fall gerufen wurde, weil sie spürte, dass er mit ihr darüber sprechen wollte. Vor allem, wenn es um die abscheulichsten Verbrechen ging, die Morde an Kindern. Die wenigen Fälle, die er bearbeitet hatte, waren ihm lange nachgegangen.
Er dachte flüchtig an Marlen, ihr dunkles Lachen, die verständnisvollen Augen. Nein, nicht heute. Leo spürte, wie etwas Dunkles an ihm zerrte, eine vertraute Finsternis, die ihn ansprang, wenn er am wenigsten damit rechnete. Manchmal konnte Marlen sie vertreiben, aber heute . . . Er zog die Schultern hoch und machte einen zögernden Schritt. Er würde wohl doch nach Hause gehen.
Kurz vor der Haustür hörte er Schreie aus einem Innenhof und blieb einen Moment in dem dunklen Torborgen stehen. Schuster Matussek schlägt mal wieder seine Frau, dachte er beinahe gleichgültig. Das ging schon lange so. Die Nachbarn beschwerten sich, hatten ihn sogar darauf aufmerksam gemacht, weil er doch ein »Kriminaler« war, aber der Frau war offenkundig nicht zu helfen. Einmal war sie mit aufgeplatzter Augenbraue in den benachbarten Kolonialwarenladen gestürzt und hatte um Hilfe geschrien, worauf man ihren Mann verhaftete. Am nächsten Tag holte sie ihn auf der Wache ab und erklärte, sie habe sich an einer Schranktür gestoßen. Das Spiel wiederholte sich alle paar Monate.
Ihn störte nur, dass seine Tochter mit Inge Matussek spielte. Bei der Arbeit ging er täglich mit Gewalt um und konnte daher umso weniger hinnehmen, dass seine Kinder damit in Berührung kamen. Es fiel ihm schwer, ihnen solche Dinge zu erklären oder einen Rat zu geben. Einmal hatte Marie ihn gefragt, warum Inges Mutter ein blaues Auge habe, und er war ihr mit einer Notlüge ausgewichen. Und ob seine Ratschläge Georg in der Schule helfen konnten, bezweifelte er.
Er stieß die Hände in die Taschen und schaute nach oben zum schweigenden Himmel. Einen Mord aufzuklären erschien ihm leichter, als Kinder zu erziehen, denn obwohl bei seinen Fällen oft Fragen offen blieben, gab es letztlich nur eine Lösung. Bei Kindern hingegen schien es tausend Antworten zu geben, und meist wusste man nicht, welche richtig war.
Dann und wann ertappte er sich dabei, wie er seine Frau verfluchte, sie und die tückische Krankheit, die ihre Lunge binnen Tagen in einen blutigen Schwamm verwandelt und sie in ihrem eigenen Atem hatte ertrinken lassen. Er hatte den Kindern nicht von den letzten Stunden erzählt. Wie sie nach Luft gerungen, um sich geschlagen, nach ihrer Mutter gerufen hatte. Von dem Gurgeln, das jeden qualvollen Atemzug begleitete. Von seinem fassungslosen Entsetzen, dass diese Seuche den harmlosen Namen Grippe tragen sollte.
Als das Ende kam, hatte sie sich mit übermenschlicher Kraft im Bett aufgesetzt, ihn ruhig angeschaut und mit fester Stimme gesagt: »Die Kinder.« Mehr nicht. Aber er hatte es als Auftrag verstanden. Und er zwang sich, daran zu denken, wenn ihn die vertraute Dunkelheit zu überfallen drohte.
Seit er Viola kannte, war alles anders geworden. Viola, das Veilchen. Als hätten ihre Eltern bei der Geburt geahnt, dass ihre Tochter in dieser Farbe einmal ganz bezaubernd aussehen würde. Und auch ihre Augen erinnerten an zwei frisch erblühte Veilchen, Tränen wie Tau an ihren Wimpern . . .
Er lachte leise. Was die Liebe aus den Menschen machte– Heilige, Verrückte oder sogar Dichter.
Natürlich würden sie die Verlobung bald bekannt geben, auch im großen Rahmen, wenn ihr daran lag. Und eine prächtige Hochzeitsfeier sollte sie haben, mit Orangenblüten und weißem Tüll, wenn sie es altmodisch mochte. Er würde Frack und Zylinder tragen, wie es sich für einen Mann seiner Stellung gehörte. Und die Flitterwochen würden sie an einem romantischen Ort wie Venedig verbringen.
3
Das Büro mit der hohen Decke wirkte nüchtern und gleichzeitig sakral. Einige bunte Kunstdrucke milderten die Eintönigkeit der weißen Wände, obwohl manche Kollegen die »modernen« Bilder eher misstrauisch betrachteten. Die Einrichtung war– wie in den meisten Dienstzimmern– schlicht und zweckmäßig. Nur der Kollege Ernst Gennat hatte in seinem Büro ein gemütliches Sofa stehen, auf dem er seine Fälle zu erörtern und dabei Kuchen zu essen pflegte.