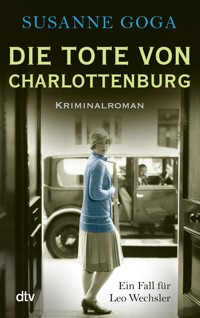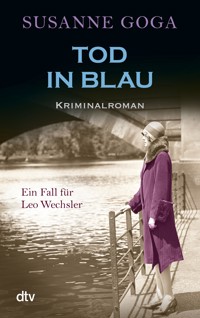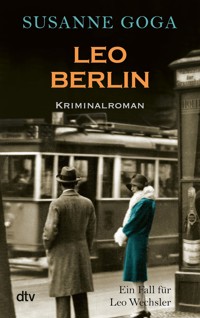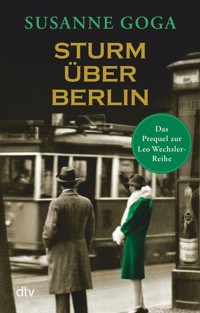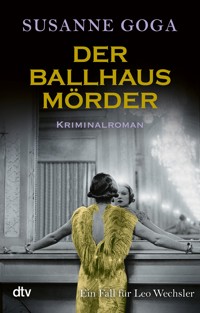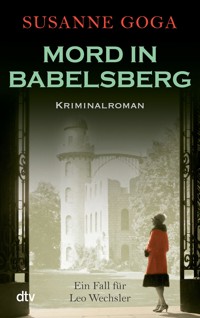
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Intrigen, Mord und Zelloloid Berlin 1926. Im Hof einer eleganten Wohnanlage in Kreuzberg wird die Leiche einer Frau entdeckt, die mit einer Scherbe aus rotem Glas erstochen wurde. Kommissar Leo Wechsler muss am Tatort erkennen, dass es sich bei der Toten um seine ehemalige Geliebte Marlen Dornow handelt, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Er erzählt niemandem von seiner Verbindung zu der Toten, auch nicht seiner Frau Clara, sondern stürzt sich verbissen in die Ermittlungen. Wie sich herausstellt, hatte Marlen sich von wohlhabenden Männern aushalten lassen, zuletzt von einem Politiker, der ein enger Mitarbeiter des Außenministers Gustav Stresemann ist. Kurze Zeit später gibt es einen zweiten Toten: Viktor König, der gefeierte Filmregisseur, wurde ebenfalls mit einer roten Glasscherbe erstochen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Susanne Goga
MORDIN BABELSBERG
Kriminalroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2014
© 2014 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41991-8 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21486-5
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Websitewww.dtv.de/ebooks
Für meinen Papa –1926 war ein gutes Jahr.
Harriet –Jenny Blau dankt für die Songs.
1
FREITAG, 4. JUNI 1926
»So etwas wie diesen Wagen hat es noch nie gegeben«, sagte Kriminalrat Ernst Gennat begeistert und beugte seinen massigen Körper über den großen Tisch im Besprechungszimmer der Inspektion A. »Ich habe ihn selbst entworfen, meine Herren, und die Firma Benz wird den Wagen nach unseren Anforderungen konstruieren. Auf der Polizeiausstellung im September werden wir ihn den Besuchern präsentieren.«
Die Kollegen betrachteten bewundernd die Konstruktionszeichnungen, die der Leiter der Zentralen Mordinspektion vor ihnen ausgebreitet hatte.
»Als Grundlage dient eine Limousine 16/50 PS der Firma Benz«, verkündete Gennat stolz. Er deutete mit einem dicken Finger auf die Einzelheiten. »Das Innere lässt sich bei Bedarf in ein Büro umwandeln. Zwei versenkbare Tische, ein Platz für die Stenotypistin, Klappstühle und Klapptisch, wenn wir draußen arbeiten müssen.«
»Wie sieht es mit der Kriminaltechnik aus?«, erkundigte sich Leo Wechsler.
»Keine Sorge, das habe ich alles bedacht. Die Ausstattung für die Spurensicherung wird ebenso untergebracht wie Werkzeuge, Spaten, Scheren und die Ausrüstung für Messarbeiten. Gummischürzen und -handschuhe. Behälter für die Aufbewahrung von Beweisstücken. Alles, was wir am Tatort benötigen. Bedenken Sie, wie viel Zeit wir im Einsatz sparen, wenn wir wichtige Untersuchungen sofort durchführen können.«
Sein Stellvertreter Dr. Ludwig Werneburg pfiff durch die Zähne. »Das ist beeindruckend, Herr Gennat.«
Gennat lächelte zufrieden. »Natürlich werden andere nachziehen, wenn wir damit Erfolg haben. Aber wir können immerhin von uns behaupten, dass wir die Ersten waren, die ein solches Automobil entwickelt haben.«
»Schade, dass wir den Wagen erst nach der Ausstellung einsetzen können«, sagte Leo mit einem anerkennenden Blick auf die Pläne. Heute Abend würde er Georg davon erzählen, sein Sohn interessierte sich brennend für alles, was mit Autos zu tun hatte. Nachmittags drückte er sich gern in einer benachbarten Werkstatt herum und sah den Mechanikern bei der Arbeit zu. Vermutlich hatte er sogar ein Zigarettenbild dieser Limousine in seinem Sammelalbum.
»Meine Herren, ich möchte, dass unsere Abteilung die beste Mordinspektion Deutschlands wird«, verkündete Gennat und blickte in die Runde. »Der Anfang ist gemacht. Seit der Neuorganisation läuft die Arbeit deutlich besser.«
Zum 1. Januar war auf Gennats Initiative die Zentrale Mordinspektion eingerichtet worden, die von ihm selbst geleitet wurde. Man hatte mehrere neue Dienststellen geschaffen, darunter eine für Vermisstenfälle und unbekannte Tote und eine weitere für die Zentralkartei, in der sämtliche Tötungsdelikte und tödlichen Unfälle registriert wurden. Auf diese Weise wurden endlich alle Fälle erfasst, in denen keine natürliche Todesursache nachgewiesen werden konnte. Gab es Ähnlichkeiten zu einem anderen Fall, die auf einen Mehrfachtäter deuteten, wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet. Das war bisher nicht möglich gewesen.
Leo war fasziniert von den neuen Aussichten, die sich für die Aufklärung von Kapitalverbrechen boten. Er hatte Gennat immer geschätzt, doch sein Vorgesetzter war ein ungewöhnlich bescheidener Mensch, der lange auf die verdiente Beförderung gewartet hatte. Seit dem vergangenen Jahr war er Kriminalrat, ein Dienstgrad, der dem legendären Ermittler längst zugestanden hätte.
»Bevor wir uns nun ein Stück Kuchen genehmigen, wie es bei mir Sitte ist«, fuhr Gennat fort, »möchte ich eine weitere Veränderung ankündigen. Der Kollege Wechsler übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung der Reserve A 1.«
Leo sah ihn überrascht an. In den letzten Monaten hatte er in der Aktiven Mordkommission unter Gennat gearbeitet, in einer großen Gruppe, zu der sechs bis zwölf Kriminalbeamte, eine Stenotypistin und weitere Kollegen gehörten.
»Gucken Sie nicht so, Wechsler«, sagte Gennat grinsend. »Das ist keine Degradierung, ganz im Gegenteil. Sie haben in einer kleinen Gruppe immer besonders gut gearbeitet und sind schon lange Kommissar. Es wird Zeit, Sie auf neue Aufgaben vorzubereiten.«
Die Beförderung zum Oberkommissar, dachte Leo erfreut. Eigentlich hatte er gern mit den Kollegen Walther, Berns und Sonnenschein zusammengearbeitet, sie waren ein verschworener Kreis gewesen, in dem jeder die Macken und Stärken der anderen kannte. Berns war kürzlich pensioniert worden, doch Leo hoffte, die beiden anderen in seiner Kommission zu behalten. Mit Robert Walther war er seit langem befreundet, und Jakob Sonnenschein hatte sich in den vergangenen drei Jahren zu einem ausgezeichneten Kriminalbeamten entwickelt.
»Wer wird dabei sein?«
»Glauben Sie allen Ernstes, ich würde es wagen, Ihnen Walther und Sonnenschein wegzunehmen?«, fragte Gennat lächelnd. »Nachdem Sie brauchbare Ermittler aus ihnen gemacht haben?«
»Danke, Herr Kriminalrat, ich werde mich bemühen.«
»Das will ich hoffen. Und nun, meine Herren – Schwarzwälder Kirsch oder Stachelbeer?«
Viktor König warf einen Blick aus dem Fenster. Sein Sinn für Dramatik hatte eigentlich nach Fackeln verlangt, die den Weg zur Haustür säumen sollten, ein lodernder Kontrast zu den klaren, vollendet symmetrischen Linien des Gebäudes. Doch sie wären nicht zur Geltung gekommen, weil es Juni war, kurz vor der Sommersonnenwende, und die Dunkelheit erst in einigen Stunden hereinbrechen würde. Also hatte er sich für senkrechte Quader aus schwarzem Glas entschieden, die wie eine Allee abstrakter Bäume zu der weißen Villa führten. Er trat einen Schritt zurück, um die Inszenierung in Augenschein zu nehmen, und nickte zufrieden. Schwarz und Weiß, rechte Winkel, nichts Weiches oder Fließendes, ganz wie er es sich erhofft hatte. Von einem Filmregisseur erwartete man roten Plüsch und vergoldetes Louis-seize-Mobiliar, Gemälde in barocken Rahmen und orientalische Teppiche. Nichts davon würden sie hier finden. Er war ein Mann, der überraschen wollte, der alle Regeln brach, der unberechenbar blieb. Das machte seinen Erfolg und sein Charisma aus.
Der Architekt Ludwig Mies van der Rohe hatte ganze Arbeit geleistet, obwohl es nicht leicht gewesen war, ihn zu dem Entwurf zu überreden. Er war stets sehr beschäftigt, entwarf Wohnsiedlungen in verschiedenen deutschen Städten, so demnächst in Stuttgart, und hatte gezögert, den privaten Auftrag zu übernehmen. Es hatte Königs ganzer Beredsamkeit bedurft – eine seiner Stärken, die er gewöhnlich einsetzte, um die begehrtesten Schauspieler und besten Techniker für seine Filme zu gewinnen. Letztlich hatte der Architekt zugesagt, vorausgesetzt, man ließe ihm völlig freie Hand bei der Gestaltung des Hauses und des Grundstücks in Neubabelsberg, das König vor drei Jahren während der Inflationszeit von einem bankrotten Unternehmer erworben hatte.
König hatte sich an die Abmachung gehalten und war während der Bauzeit nicht ein einziges Mal dorthin gefahren. Er hatte Mies van der Rohe sogar erlaubt, die Innenarchitekten auszuwählen, damit das gesamte Gebäude seinen Vorstellungen entspräche. Und der Architekt hatte ihn nicht enttäuscht. Vom Mobiliar über die Vorhänge bis hin zu Porzellan und Besteck war alles wie aus einem Guss, ohne künstlich oder vorgefertigt zu wirken. Böden aus Naturstein, viel Glas, klare Linien und die vorherrschenden Farben Schwarz, Weiß und Beige mit einigen goldenen und chromfarbenen Akzenten. Die Ledersessel im Wohnzimmer hatte er sogar selbst entworfen und anfertigen lassen.
Und heute Abend gab Viktor König hier einen Empfang, bei dem er seinen neuesten Film vorstellen wollte. Er hatte lange nach einem Thema gesucht, mit dem er an seinen letzten Erfolg Undine anknüpfen konnte, ohne ihn zu imitieren. Er gehörte nicht zu jenen Regisseuren, die einen Film nach dem anderen abdrehten, getrieben von der Schnelllebigkeit des Geschäfts und der Sensationslust der Zuschauer, die nun, da das Geld endlich wieder etwas wert war, nach immer neuen Zerstreuungen verlangten. Seine Filme waren kostspielig, weil er sich auf allen Gebieten nur mit dem Besten zufriedengab, doch die Mühe lohnte sich, denn seine Werke wurden von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert.
»Bist du fertig, Viktor?«
Elly stand in der Tür und sah ihn schmollend an. Er ging rasch zu ihr, wobei er mit den Fingern flüchtig über einen der schwarzen Quader strich. Sie gefielen ihm, vielleicht würde er sie behalten. Sie wirkten wie schwarze Wächter, die sein neues Heim beschützten.
Er ergriff Ellys Hand, um sie zu beschwichtigen, und zog sie an sich. »Ihr Haus, Frau König.«
Sie lächelte geschmeichelt. Er tätschelte ihre Wange, schaute aber an ihr vorbei ins Wohnzimmer, in dem schon weißgedeckte Tische mit Getränken bereitstanden.
»Wirst du denn auch hier sein? Öfter als bisher, meine ich?«, fragte sie.
Ein ewiger Streitpunkt. Er hatte Elly Pawlak vor drei Jahren geheiratet. Es war das Beste, was der jungen Frau, die von einer Karriere als Schauspielerin träumte, und auch ihm selbst hatte passieren können. Das war zumindest seine Überzeugung. Mit einer großen Karriere beim Film war nicht zu rechnen, doch Elly besaß außer ihrem hübschen Gesicht und der erotischen, unmodern rundlichen Figur einen nicht unwesentlichen zusätzlichen Reiz: Ihr Vater, der in Schwerin Sanitärbedarf produzierte, hatte ihr bei der Heirat eine gewaltige Mitgift übereignet. Königs Filme kosteten nun einmal viel Geld.
Er seufzte. »Goldkind, du weißt doch, dass ich ein vielbeschäftigter Mann bin.«
»Und ich habe deinen neuen Film mitproduziert. Aber du hast mir keine Rolle gegeben. Wenn ich etwas vorschlage, lächelst du lieb und tust doch nur, was du willst.«
»Es gab keine passende Rolle für dich«, sagte er mit unterdrückter Ungeduld. Dieses Gespräch hatten sie schon hundertmal geführt.
»Das ist nicht wahr. Bei einem historischen Stoff können auch Frauen mitspielen, die nicht wie Hungerhaken aussehen. Damals wussten die Männer es zu schätzen, wenn eine Frau …«
»Heute Abend bist du doch dabei.«
»Ja. Und sehe den Film zusammen mit allen anderen«, erwiderte sie unzufrieden.
Sie verlangte mehr, als er ihr geben wollte, das war schon immer so gewesen.
»Bei dieser Gelegenheit weihen wir den Vorführraum ein. Es sind Leute von allen großen Zeitungen eingeladen. Ich habe gehört, dass Fritz ein sensationelles Werk plant, angeblich hat ihn seine Reise in die Vereinigten Staaten dazu inspiriert. Vermutlich wird es ein modernes Thema sein. Also habe ich etwas ganz anderes gemacht.«
»Aber was ist mit mir?«, fragte sie beharrlich.
»Du wirst an meiner Seite sein, wenn ich den Film ankündige, und ich stelle dich als meine Mitarbeiterin und Produzentin vor.«
Elly gab sich noch ein bisschen zögerlich, doch als die Lieferanten mit dem kalten Büfett eintrafen, gab König der Haushälterin ein Zeichen, sich darum zu kümmern, und zog seine Frau in einen mit schwarzem Marmor ausgelegten Flur. Dort schob er sie sanft in eine Nische und küsste ihren Ärger einfach weg.
Clara Wechsler saß reglos da und schaute zu Boden. Von der Praxis aus war sie sofort zu ihrer Freundin Magda gefahren und hatte sie mit Ilse beim Kaffee angetroffen. Clara hatte einen Augenblick gezögert, als die alte Unsicherheit wieder in ihr aufstieg, doch dann hatte sie sich einen Ruck gegeben und war ins Wohnzimmer getreten. Ihre Bekanntschaft mit Ilse hatte schwierig begonnen, doch seit ihre Schwägerin sich eine eigene Wohnung genommen hatte und bei Magda als Sprechstundenhilfe arbeitete, waren sie einander nähergekommen. Sie hatte von ihr nichts zu befürchten.
Nachdem Clara es ihnen erzählt hatte, trank sie einen Schluck Kaffee. Ihr Mund war trocken. Dann sagte sie leise: »Es war … seltsam. Als würden wir gar nicht über mich sprechen, sondern über irgendeine Frau, die ich nur flüchtig kenne. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Am ehesten leer, glaube ich.«
Die beiden anderen saßen auf dem Sofa, Clara auf einem Stuhl, und sie kam sich plötzlich vor, als sei sie wieder bei der Ärztin.
»Damit war zu rechnen«, sagte Magda, die rational dachte. »Du warst vier Jahre mit diesem von Mühl verheiratet und bist nicht schwanger geworden.«
Clara biss sich auf die Lippen. »Vier Jahre, auf dem Papier. Das will nichts heißen.«
»In dieser unsäglichen Ehe wohl nicht«, bemerkte Magda nüchtern.
»Es ist eine Fehlbildung der Gebärmutter«, sagte Clara rasch, um es hinter sich zu bringen. »Ungefährlich. Aber inoperabel.«
Magda und Ilse schauten einander an. Man hörte nur das Ticken der Uhr auf der Anrichte und das Klirren des Löffels, als Ilse ihren Kaffee umrührte. Clara versuchte ihren Gesichtsausdruck zu deuten. Dachte sie an ihren Bruder? Fragte sie sich, ob er sich weitere Kinder wünschte? Oder hatte er vielleicht sogar mit ihr darüber gesprochen? Nein, das passte nicht zu Leo.
Schließlich hielt Clara es nicht mehr aus. »Sagt doch etwas! Ich bin zu euch gekommen, weil ich mit jemandem reden wollte, und jetzt sitzt ihr da und seht überall hin, nur nicht zu mir.«
»Möchtest du denn Kinder?«, fragte Ilse.
Clara war verblüfft. Ging man nicht davon aus, dass jede Frau sich Kinder wünschte, vor allem wenn sie den Mann geheiratet hatte, den sie über alles liebte? Sie spürte, wie ihr die Hitze vom Hals ins Gesicht stieg, und schob die Kaffeetasse von sich.
»Es ist so warm heute. Fast zu warm für Kaffee.«
Sie merkte, dass die anderen auf eine Antwort warteten. Welche wäre richtig?
Magda stellte ihre Tasse ab und beugte sich vor. »Du musst es uns nicht sagen, wenn du nicht möchtest.«
Ilse erhob sich halb von ihrem Stuhl. »Wenn ihr lieber allein …«
»Nein.« Clara stand auf und trat ans Fenster. Ein leichter Wind ging durch die Bäume und ließ die Schatten auf dem Pflaster tanzen. Kinder hatten mit Kreide Hinkelkästchen auf den Gehweg gezeichnet und hüpften konzentriert umher, wobei sie den Stein vorsichtig mit dem Fuß voranschoben. Clara schaute ihnen zu, ohne Wehmut zu empfinden. War das ein Zeichen?
Sie wandte sich um und sah die beiden Frauen offen an. »Ich wollte immer nur Leo.« Sie schluckte. »Ich betrachte Marie und Georg als meine Kinder. Aber … ich glaube, ich brauche kein eigenes Kind, um glücklich zu sein. Ich hatte früher so wenig und habe jetzt so viel. In den letzten Jahren bin ich glücklicher gewesen als je in meinem Leben. Nur weiß ich nicht, ob Leo …« Ihre Stimme wurde unsicher.
»Das kann er dir nur selbst sagen«, meinte Ilse. »Du solltest mit ihm darüber sprechen.«
»Ich weiß.«
»Lass dir ein wenig Zeit und warte den richtigen Moment ab«, fügte Magda hinzu. »Alles wird gut. Ganz sicher.«
Clara atmete tief durch. Hoffentlich würde sie den richtigen Moment erkennen.
Um sieben hatten sich die Gäste in der Villa König versammelt und bildeten einen Halbkreis um das Rednerpult aus Ebenholz, das in der Mitte des Raums aufgebaut war. Viele Journalisten waren gekommen, wie König sich erhofft hatte, dazu einige enge Freunde und Schauspielerinnen und Schauspieler, die in seinem neuen Film mitwirkten. Sein Freund und Kompagnon Alfred Hahn, mit dem zusammen er die Gallus-Filmgesellschaft gegründet hatte. Alle waren bis zur offiziellen Premiere zu strengem Stillschweigen verpflichtet worden.
Die diskreten Leuchten an den Wänden warfen gedämpfte Lichtkreise in den Raum, und es wurde still, als er ans Pult trat und sich räusperte. Elly stand an seiner rechten Seite, einen Schritt hinter ihm, um ihre Bedeutung zu betonen, ohne jedoch die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich zu lenken. So hatten sie es besprochen.
»Meine Damen und Herren von der Presse und den Wochenschauen, liebe Freunde«, begann König und schaute in die Runde. Obwohl seine Darsteller in den Filmen stumm agierten, wusste er aus seiner Zeit beim Theater, wie wichtig Intonation und dramatische Pausen waren. »Es ist schon ein Jahr her, dass mein letzter Film Undine in den Lichtspielhäusern Premiere gefeiert hat, und man hat mich oft gefragt, wann endlich ein neues Werk zu erwarten sei. Ich halte es mit meinen Plänen wie mit einem guten Wein: Ich gebe ihnen Zeit, um zu reifen und ihr volles Aroma zu entfalten. Nach dem Erfolg von Undine hätte ich rasch ein ähnliches Werk nachschieben können, doch genau das wollte ich vermeiden. Ich bin nicht wie manche Kollegen, die ihre Filme wie in einer Fabrik produzieren und Dutzendware liefern, weil sie fürchten, das Publikum könnte sie sonst vergessen.« Er legte eine erneute Pause ein. »Doch ihre Werke werden ebendarum vergessen, denn an ihnen ist nichts Besonderes, es mangelt ihnen an Sorgfalt, an Mühe, an Phantasie.«
Er konnte sich diese Worte erlauben, auch wenn sie nicht zu seiner Beliebtheit beitrugen. Doch die hatte Viktor König noch nie interessiert. Wenn er rief, sollten die kommen, die wichtig waren, das allein zählte. Er brauchte zuverlässige Mitarbeiter, die besten, die zu haben waren, und es war bekannt, dass er gut zahlte. Er verlangte höchste Hingabe von allen, die an seinen Filmen mitwirkten, nicht zuletzt von sich selbst. Diese unbedingte Liebe zur Arbeit war nötig, wenn er Lang übertreffen wollte. Und genau das war seine Absicht.
»Ich habe mich mit dem Stoff, den ich verfilmen wollte, so gründlich beschäftigt, als müsste ich eine Doktorarbeit darüber schreiben.« Leises Gelächter. »Die Insel des Magiers.« Er ließ die Worte fallen wie Kiesel in einen Teich, ließ sie Kreise ziehen und sich in alle Richtungen ausbreiten, bevor er fortfuhr. »Johann Kunckel von Löwenstern, Wissenschaftler und Scharlatan, Alchemist, Apotheker und Glasmacher. – Elly.« Er streckte ihr mit einer fließenden Bewegung die Hand hin und hielt gleich darauf eine goldene Kugel in die Höhe. Ein Raunen ging durch den Raum. »Man erzählt sich, der Kurfürst von Sachsen habe ihm tausend Taler im Jahr geboten, damit er Gold für ihn herstellte. Später trat er in die Dienste des Großen Kurfürsten von Brandenburg, der ihm die Pfaueninsel schenkte. Eine Insel, deren eigene Geschichte schon geheimnisvoll ist. Man hat dort Schmuckstücke aus uralter Zeit gefunden. An diesem Ort stellte Kunckel kostbares Glas her, während die Menschen in der Umgebung an Hexenwerk glaubten, weil dunkler Rauch und seltsame Gerüche ans Ufer herüberwehten.«
Er gab Elly die Kugel zurück. »Diesem faszinierenden Mann habe ich meinen neuen Film gewidmet. Seiner Lebensreise von den Anfängen als Apotheker, dem Aufenthalt in Murano, wo er die Glasherstellung studierte, den Versuchen der Goldherstellung für den Kurfürsten von Sachsen. Sie können erahnen, welch prächtige Kulissen sich da bieten.«
Er machte eine ausladende Bewegung mit dem Arm, als deutete er auf eine Leinwand. »Venedig – der Hof in Dresden – die Universität Wittenberg – die unberührte Schönheit der Pfaueninsel – Stockholm. Die prunkvollen Kostüme des 17. Jahrhunderts. Und was wäre all das ohne eine hinreißende Liebesgeschichte?« Die frei erfunden war, aber dazugehörte, denn die Menschen wollten keine Geschichten ohne Liebe sehen.
»Die Vorführung heute Abend ist ausdrücklich für einen ausgewählten Kreis bestimmt – für Sie. Niemand in Berlin wird diesen Film früher erleben. Für die Titelrolle habe ich Rudolf von Hagen gewinnen können. Leider kann er heute Abend nicht unter uns sein, weil er sich zurzeit noch auf der Rückreise aus den Vereinigten Staaten von Amerika befindet, wo er einen Film mit dem berühmten D. W. Griffith gedreht hat. Er wird jedoch am kommenden Mittwoch zur Premiere erwartet. Und nun habe ich das große Vergnügen, Ihnen meine Hauptdarstellerin Carla Vasary vorzustellen.«
Applaus brandete auf, als eine zarte junge Frau mit kurzem goldbraunem Haar in die Runde lächelte. Er legte sich erst, als König die Hand hob.
»Bevor wir uns nun der Vorführung widmen, möchte ich Ihnen meine Frau Elly vorstellen, die diesen Film mitproduziert hat.«
Freundlicher Beifall, als Elly neben ihn trat und in die Runde nickte. »Ich bin sehr gespannt auf den Film meines Mannes und war stolz, bei den Dreharbeiten an seiner Seite zu stehen.« Sie hatte den Satz auswendig gelernt, um bei ihrem Auftritt ja nicht ins Stocken zu geraten.
»Und jetzt folgen Sie mir bitte in den Vorführraum«, sagte Viktor König und breitete die Arme aus wie ein gütiger Monarch, der seinen Untertanen eine Audienz gewährt.
Als Leo mit Clara das Haus verließ, fragte er unvermittelt: »Weißt du noch? Es war im Juni.« Mehr brauchte er nicht zu sagen.
»Natürlich. Seitdem ist das mein Lieblingsmonat.«
Er zog lächelnd die Tür hinter sich zu. Georg und Marie durften noch draußen spielen, weil es so hell und warm war, und so hatten sie Zeit für einen Spaziergang zu zweit. Als er von der Arbeit gekommen war, hatte er schwungvoll den Hut auf die Garderobe geworfen, Clara hochgehoben und im Kreis gedreht. Sie hatte ihn überrascht angesehen, als sie wieder Boden unter den Füßen hatte. »Was ist los? Gute Neuigkeiten?«
Er hatte sie auf die Folter gespannt, in aller Ruhe die Krawatte abgenommen und den Hemdkragen aufgeknöpft. »Wie würde es dir gefallen, mit einem Oberkommissar verheiratet zu sein?«
»Du wirst befördert?«, hatte sie geantwortet und so viel Freude wie möglich in ihre Stimme gelegt. »Das ist wunderbar, du hast es verdient. Schon längst.«
»Gennat hat mir die Leitung einer der Reservekommissionen übertragen. Dort arbeite ich mit Robert und Sonnenschein zusammen, etwas Besseres kann mir gar nicht passieren. Im Augenblick ist so viel Bewegung im Dezernat, Gennat hat Großes vor.«
Er hatte nicht bemerkt, dass Clara zur Seite schaute, um ihm die Freude nicht zu verderben. Sie hatte ungeduldig darauf gewartet, dass er nach Hause kam, weil sie das Gespräch nicht aufschieben wollte, doch nun fürchtete sie sich davor, seine unbeschwerte Stimmung zu zerstören.
»Wo sind die Kinder?«, fragte Leo.
»Im Hof nebenan. Sie spielen noch. Falls sich Georg nicht wieder in der Werkstatt herumtreibt.«
»Dann lass uns spazieren gehen. Ich genieße es immer, meine schöne Frau auszuführen, und sei es nur um die vier Ecken.« Und so waren sie hinausgegangen.
»Dein Lieblingsmonat? Meiner auch. Vier Jahre.« Leo blieb stehen und zog sie an sich. Als sie seine Lippen spürte, vergaß sie für einen Moment, was sie bedrückte.
»Immer ran, bevor se dir verduftet«, rief ein Mann im Vorbeifahren, und Leo löste sich lachend von Clara. Dann bemerkte er ihren Blick. »Du … wirkst so verändert. Was ist denn?«
Er schaute sie an, alle Leichtigkeit war verflogen, und es versetzte ihr einen Stich. Sie waren seit zweieinhalb Jahren verheiratet, und doch spürte sie manchmal seine Angst, sie zu verlieren. Dabei war sie es doch, die ihn am liebsten nie mehr loslassen würde, weil sie immer noch nicht glauben konnte, dass er ihr Mann war.
Sie wandte sich ab und kniff die Augen zu, um die Tränen einzusperren. Sie holte zitternd Luft und zuckte zusammen, als sie Leos Hand auf ihrer Schulter spürte. Er drehte sie zu sich um und nahm ihr Gesicht in die Hände. »Sieh mich an, Clara. Was ist mit dir?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.«
»Möchtest du wieder nach oben?«, fragte er, und sie hörte die Ratlosigkeit in seiner Stimme.
»Nein.« Sie schluckte. »Lass uns ein Stück gehen.«
Leo legte den Arm um ihre Schulter, doch sie wich kaum merklich zur Seite, und er ließ ihn wieder sinken. Sie musste etwas sagen, dachte sie verzweifelt. Sie hatte ihm schon die Stimmung verdorben, und er hatte die Wahrheit verdient.
»Es geht um Kinder«, begann sie schließlich. Dumm, das klang dumm. »Ich … wir haben nie darüber gesprochen, ob du dir noch ein Kind wünschst.«
»Natürlich hätte ich gern ein Kind mit dir. Die letzten Jahre waren schwer, da habe ich gedacht …«
Sie schaute ihn von der Seite an. Er hatte die Hände in die Hosentaschen gesteckt und ging leicht vorgebeugt, wobei ihm eine widerspenstige dunkle Haarsträhne ins Gesicht fiel. In diesem Augenblick liebte sie ihn so sehr, dass sie kaum atmen konnte.
»Wir haben gewartet, auf bessere Zeiten. Aber jetzt, wenn du möchtest …« Er blieb stehen und schaute sie erwartungsvoll an.
»Leo, ich … ich war bei einer Ärztin.«
Sie sah, wie sich seine Augenbrauen zusammenzogen. Eine dünne Falte grub sich in seine Stirn. Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck, und sie begriff, was er dachte. Sie streckte unwillkürlich die Hand aus und berührte seine Wange. »Es geht mir gut. Ich bin nicht krank.« Er sprach selten über Dorothea, doch sie hatte die Angst in seinen Augen gesehen. Der Tod seiner ersten Frau in der großen Grippeepidemie war schrecklich für ihn gewesen. »Aber – die Ärztin hat mich untersucht und festgestellt, dass ich keine Kinder bekommen kann.« Es war heraus. Sie atmete tief durch und schaute ihn an.
Er sagte nichts, sondern legte seine Hand über ihre und hielt sie fest. »Ich bin froh.« Er wurde rot. »Unsinn, ich meine, ich bin froh, dass es nichts … dass du gesund bist.«
Clara spürte, wie eine gewaltige Last von ihr abfiel. Der erste Schritt lag hinter ihr. »Lass uns weitergehen.«
Er legte ihr den Arm um die Schultern und zog sie wieder an sich. Sie ahnte, dass er etwas sagen wollte, aber noch nach den richtigen Worten suchte.
»Ist es sehr schlimm für dich?«, fragte er dann. »Wir haben Georg und Marie, und ich weiß, dass du sie lieb hast, aber wenn du dir ein eigenes Kind wünschst …«
»Leo, ich wünsche mir vor allem, mit dir zusammen zu sein«, sagte sie mit fester Stimme. »Natürlich wäre ich sehr glücklich gewesen, wenn wir ein gemeinsames Kind bekommen hätten, aber – mein Glück hängt nicht davon ab.« Sie zögerte. »Wir haben zwei Kinder, die ich beide sehr liebe. Und da ist die Bücherei. Du weißt, wie wichtig sie mir ist.« Sie verstummte, weil ihr die Worte plötzlich kalt erschienen, obwohl sie so nicht gemeint waren.
»Mein Leben mit dir ist vollkommen, und es ist mehr, als ich mir vor vier Jahren erhofft hätte«, sagte er leise und sah zur Seite, als schämte er sich seiner offenen Worte. »Wenn du mit diesem Leben, das wir haben, glücklich bist, bin ich es auch.«
Sie blieb unvermittelt stehen. Als er sich zu ihr umdrehte, lehnte sie sich an ihn und atmete seinen Geruch ein.
2
MONTAG, 7. JUNI 1926
Leo verließ die S-Bahn am Hackeschen Markt und ging das letzte Stück zu Fuß. Die Sonne schien ihm warm auf den Rücken, und er bedauerte, dass er den größten Teil des Tages im Büro würde sitzen müssen. Es war ihm gelungen, von dem schönen Sonntag, den er mit Clara und den Kindern am Wannsee verbracht hatte, ein bisschen Unbeschwertheit in die Woche hinüberzuretten. Er hatte Claras Erleichterung gespürt, sie schien beinahe zu schweben. Nach dem Bad im See hatten sie sich auf einen Steg gesetzt und den Kindern beim Schwimmen zugesehen.
Sie waren die ganze Zeit über Hand in Hand gegangen wie ein junges Paar. Clara drückte wiederholt seine Hand, als wollte sie ihm eine Botschaft übermitteln, und er wusste genau, was sie meinte. Sie waren eine Familie. Worte waren dafür nicht nötig.
Schon jetzt freute er sich darauf, sie nach Dienstschluss zu sehen, und spürte, wie sich etwas in seinem Inneren schmerzlich und wunderbar zugleich zusammenzog. Über ihm ratterte die S-Bahn in Richtung Friedrichstraße, doch der Lärm war so vertraut, dass er Leo nicht in seinen Gedanken störte, während er sich dem gewaltigen roten Bau des Präsidiums näherte. Selbst Herbert von Malchow, der in der Eingangshalle an ihm vorbeiging und so knapp nickte, dass es auch ein nervöses Zucken des Kopfes hätte sein können, gelang es nicht, ihm diesen Montagmorgen zu verderben.
Leo begrüßte Fräulein Meinelt und betrat sein Büro, in dem schon Robert Walther und Jakob Sonnenschein warteten.
»Freut mich, Leo, das war mehr als überfällig«, sagte Walther strahlend und schlug seinem Freund auf die Schulter, bevor er sich wieder auf den Stuhl fallen ließ. »Dann dürfte die Beförderung nicht lange auf sich warten lassen. Lass uns nach Dienstschluss einen darauf trinken.«
»Die Runde geht auf mich«, sagte Leo. »Sind Sie dabei, Sonnenschein?«
Er nickte. »Freut mich sehr, Herr Wechsler.«
Leo stellte die Aktentasche neben den Schreibtisch. »Noch ist es natürlich nicht so weit. Aber wenn wir den nächsten Fall nicht vermasseln, sieht es ganz gut aus.« Dann warf er Walther einen prüfenden Blick zu. »Du grinst wie ein Honigkuchenpferd. Das kann doch nicht nur die Freude über meine beruflichen Perspektiven sein.«
Sein Freund wurde rot.
»Na los, raus mit der Sprache«, sagte Leo belustigt.
»Sie heißt Jenny.«
»Schöner Name«, meinte Leo anerkennend. »Und was hat sie sonst noch zu bieten?« Er genoss es, Robert ein bisschen aufzuziehen. Dieser hatte ihm oft genug vorgehalten, er sei zu ernst, doch heute Morgen war Leo übermütig gestimmt.
»Sie ist Sängerin.«
Ein Leuchten ging über Sonnenscheins Gesicht. »Oh, eine Künstlerin? Das ist ja interessant.«
Leo grinste. »Und diese Jenny bringt dich dazu, uns einladen zu wollen? Ein Wunder von einer Frau muss das sein.«
Walther holte tief Luft, streckte die Beine vor sich aus und verschränkte die Arme. »Dann erzähle ich eben nichts über sie.«
»Ich würde es gerne hören«, warf Sonnenschein ein wenig schüchtern ein. »Ich liebe Musik.«
»Tut mir leid, Sonnenschein, aber der Kollege Walther ist anscheinend beleidigt. Dann müssen wir uns wohl gedulden.« Leo tat, als suchte er etwas in den Akten auf seinem Schreibtisch, bis Walther es nicht mehr aushielt.
»Na gut. Sie tritt demnächst im Continental-Keller in der Charlottenstraße auf.«
»War das nicht früher die Weiße Maus?«, unterbrach ihn Leo.
»Nein, die ist um die Ecke in der Jägerstraße. Anita Berber hat dort getanzt. Sie und ihre hübsche Freundin, du weißt schon, der Fall mit dem Maler in den Rehbergen – Thea Pabst, so hieß sie. Jedenfalls gibt es dort donnerstags eine Talentveranstaltung, ähnlich dem ›Kabarett der Namenlosen‹. Jeder, der möchte, kann dort auftreten.«
»Augenblick mal«, warf Leo ein. »Wirklich jeder? Egal wie untalentiert?«
Sonnenschein sah etwas gequält drein, sagte aber nichts.
»Es ist ein Anfang, und nicht alle sind unbegabt«, erklärte Walther eifrig. »Jenny ist ein prima Mädchen und schreibt alle Lieder selbst. Und es geht angeblich nicht so schlimm zu wie bei den ›Namenlosen‹.«
»Was für Lieder singt sie denn?«, wollte Sonnenschein wissen. Leo, der die Liebe des Kollegen zur klassischen Musik kannte, seufzte leise. Sonnenschein hatte sogar ein Abonnement auf einen Stehplatz in der Oper.
»Freche Chansons. Ein bisschen wie die Waldoff. Nicht ganz jugendfrei, aber die Jugend kommt ohnehin nicht ins Continental. In einem heißt es: ›Als er mein Strumpfband um seinen Rumpf wand …‹«
Leo, der gerade Kaffee trinken wollte, verschluckte sich und musste husten, bis ihm die Tränen kamen. Dann warf er einen Blick zu Sonnenschein und lachte noch lauter. So laut, dass er das Klopfen an der Tür nicht hörte.
Fräulein Meinelt trat ein und schaute fragend in die Runde.
»Herr Walther hat einen Witz erzählt«, sagte Leo und wischte sich die Augen.
»Den würde ich auch gern hören.«
Walther räusperte sich. »Verzeihung, aber er war nicht für Damen.«
»Wer sagt, dass ich eine Dame bin?« Sie legte Leo eine Mappe auf den Tisch. »Der Bericht von Dr. Lehnbach im Fall Schwarz ist gerade gekommen. Sie wollten ihn sofort haben.«
»Danke, Fräulein Meinelt.«
Er schlug die Mappe auf und überflog den gerichtsmedizinischen Befund. »Hab ich’s mir doch gedacht.«
»Was denn, Herr Kommissar?«, fragte Sonnenschein und beugte sich gespannt vor.
Leo schob den Kollegen die Mappe hin. »Es waren die Bohnen. Lehnbach hat Botulinumtoxin in der Konserve gefunden, das zum Tod der Frau geführt hat.«
»Hätte sie nicht merken müssen, dass die Bohnen verdorben waren?«, warf Walther ein, der von der Schuld des Ehemanns überzeugt gewesen war.
»Nicht unbedingt. Selbst wenn der Deckel des Einmachglases lose war, hat sie sich womöglich nichts dabei gedacht. Am Geschmack kann man es nicht immer erkennen. Die Symptome waren allerdings ziemlich eindeutig, Lehnbach dürfte nicht lange nach dem Erreger gesucht haben.«
»Also doch kein Mord?«, fragte Walther.
Leo schüttelte den Kopf. »Frau Schwarz hat sich unwissentlich selbst vergiftet. Der Mann hat nichts von der Konserve gegessen, weil er laut eigener Aussage keine Bohnen mag. Das können wir ohne weiteres bei Verwandten überprüfen.« Er klappte die Mappe zu und lächelte. »Der Tod der Frau ist wohl ein bedauerlicher Unfall. In diesem Fall war der Täter ein Bakterium, das wir nicht zur Rechenschaft ziehen können.«
Sein Telefon klingelte. »Wechsler. Ja, ich komme.« Er stand auf und ging zur Tür. »Robert, du rufst den Richter an, dann fragt ihr bei den Verwandten der Toten nach, ob der Mann tatsächlich keine Bohnen mochte. Ich muss zum Chef.«
Gennats normalerweise gerötetes Gesicht war blass, der ganze gewichtige Mann wirkte ungewöhnlich ernst, als er Leo empfing. »Ganz Breslau ist in Aufruhr, es herrscht Ausnahmezustand«, sagte er. »Angesichts der besonderen Tatumstände sieht sich die dortige Polizei außerstande, den Fall allein zu bewältigen, und hat um sofortige Amtshilfe ersucht.«
»Fahren Sie persönlich hin, Herr Kriminalrat?«, fragte Leo.
»Nein, ich fliege.«
Dann war es wirklich dringend.
»Ich muss noch einige Angelegenheiten regeln. Danach packe ich zu Hause das Nötigste und fahre von dort aus sofort nach Tempelhof.«
»So eilig?«, fragte Leo.
Gennat nickte. »Ich werde Ihnen die Sache kurz schildern, damit Sie wissen, womit wir es zu tun haben. Möglicherweise benötige ich Informationen von hier, die müssten Werneburg oder Sie zusammenstellen.«
Schon nach wenigen Sätzen wünschte Leo sich, Gennat hätte nie davon angefangen.
Ein Paket, eingewickelt in hellbraunes Papier und fest verschnürt, war am Samstagabend von Spaziergängern aufgefunden worden. Es lehnte an einer Mauer in der Nähe der Technischen Hochschule. Darin eine Mädchenleiche. Grausam verstümmelt. Und der Kopf eines Jungen.
»Könnte es sich um einen – wie Sie es nennen – Serientäter handeln?«
Gennat nickte. »Das befürchten die Kollegen in Breslau auch. Daher muss es so schnell gehen. Dr. Werneburg übernimmt stellvertretend die Leitung der Inspektion A. Wie Sie wissen, sind wir noch mit den Raubmorden in Zehlendorf befasst. Um herauszufinden, ob es sich bei dem Fall in Breslau um einen Serientäter handelt, werden wir vermutlich für das gesamte Reichsgebiet überprüfen müssen, ob es in den letzten Jahren Morde mit einer ähnlichen Vorgehensweise gegeben hat. Falls das Personal knapp wird, zieht Werneburg Ihre Kommission hinzu.«
»Gewiss.« In diesem Augenblick klingelte das Telefon, und der Kriminalrat bedeutete ihm, noch sitzen zu bleiben. »Gennat. Stellen Sie durch, Trudchen.« Er hörte schweigend zu. »Mein Gott. Ja. Sicher. Ich nehme die nächste Maschine. Auf Wiederhören.«
Er legte auf und schaute Leo an. »Man hat den Rumpf und die Gliedmaßen des Jungen in einer Parkanlage gefunden.«
Leo versuchte, die aufsteigende Übelkeit zu unterdrücken, und ertappte sich bei der Hoffnung, Gennat möge ohne seine Unterstützung auskommen.
Er dachte wieder an den Wannsee, sah Georg und Marie mit einem Ball im Wasser planschen und seinen Sohn dazwischengehen, als ihr jemand den Ball wegnehmen wollte. Immer noch der große Bruder, auch wenn Marie sich manchmal dagegen wehrte, dass er den Beschützer spielte. Sie war neun und wollte nicht mehr nur die Kleine sein.
Gennat sah ihn an, als könnte er seine Gedanken lesen, sagte aber nur: »Wenn ein neuer Fall hereinkommt, übernehmen Sie ihn.«
»Selbstverständlich.« Leo stand auf und ging zur Tür. Dann drehte er sich noch einmal um. »Ich wünsche Ihnen Erfolg und das nötige Glück, Herr Kriminalrat.«
Trotz der Hängebacken war zu sehen, wie Gennats Kiefer mahlten. »Das kann ich weiß Gott gebrauchen, Wechsler.«
Leo lehnte sich mit geschlossenen Augen von innen an die Toilettentür und wartete, bis sein Atem wieder ruhig ging. Dann wusch er sich das Gesicht mit kaltem Wasser und schaute in den Spiegel. Kindermorde waren das Schlimmste für jeden Polizisten, es waren Bilder, die man nie loswurde, die einen bis in die Schutzlosigkeit der Träume verfolgten.
Junge und Mädchen. Selbst das Alter war fast gleich. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare, atmete noch einmal durch und kehrte in sein Büro zurück.
Fräulein Meinelt sah ihn fragend an, doch er winkte ab. »Was ist mit dem Bericht über den Fall Schwarz?«
»Bin dabei, Herr Kommissar.«
Er nickte und schloss die Tür des Vorzimmers hinter sich. Nebenan hörte er Walther und Sonnenschein miteinander reden. Vorhin erst hatten sie über Walthers neue Flamme gescherzt. Es kam ihm vor, als wären seither Stunden vergangen, doch der Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es nur zwanzig Minuten gewesen waren.
Er hörte Gelächter, dann klopfte jemand an die Verbindungstür. »Ja, bitte?«
Walther steckte den Kopf zur Tür herein. »Leo, um noch mal auf die Sache mit dem Continental …« Er trat näher. »Wie siehst du denn aus?«, fragte er besorgt.
»Setz dich, Robert.«
Wie sie da im Gras saß, hätte man sie für gesund halten können. Der Kittel wirkte von weitem wie ein weißes Sommerkleid, und das Bild erinnerte ihn an das letzte Picknick vor dem Krieg, am Tegeler See, als Erika noch gelebt hatte. Sie hatten einen Korb mit dem Essen dabeigehabt – belegte Brote, Buletten, eingelegte Gurken, Obst, sogar eine Schüssel Vanillepudding hatte sie mitgeschleppt. Dazu eine Flasche Limonade und eine Flasche Moselwein.
Dr. Erich Hartung schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben, die sich störend auf seine Arbeit auswirkten. Er war Arzt, Sentimentalität gegenüber Patienten konnte er sich nicht leisten. Sie war nicht Erika Hartung, sondern Johanna Gerber, und ihr Kleid nur ein Anstaltskittel. Dennoch erregte ihr Fall sein besonderes Interesse.
Seit ihrer Einlieferung hatte sie apathisch im Bett gelegen oder dort gesessen, wo man sie hinbrachte, wehrte sich nicht, sprach nicht, zeigte keine Reaktion. Wenn sie einschlief, litt sie unter Albträumen, und schließlich verweigerte sie den Schlaf ganz. Sie lag reglos da und hielt angestrengt die Augen offen, bis man ihr Veronal spritzte. Doch das Mittel bewirkte keinen natürlichen Schlaf, sondern eine Betäubung, ein gewaltsames Aussetzen des Bewusstseins, als hätte man einen Schalter umgelegt, um ein schmerzhaft grelles Licht auszuschalten. Er wusste, dass man aus diesem Zustand nicht erholt erwachte, weil er ein künstlicher, nicht aus dem natürlichen Bedürfnis geborener war. Etwas an der jungen Frau rührte ihn, und er musste verhindern, dass sie sich selbst zerstörte.
Er wandte sich um und trat wieder in sein Arbeitszimmer. Seufzend setzte er sich an den Schreibtisch, der sich unter Patientenakten und anderen Unterlagen bog. Entwürfe für wissenschaftliche Vorträge, Korrespondenz mit Kollegen im In- und Ausland, all das, was er neben seiner eigentlichen Tätigkeit erledigte. Er nahm die Brille ab und massierte seinen Nasenrücken. Er war dreiundfünfzig und recht gesund, doch an Tagen wie diesen fühlte er sich alt. Nicht nur, weil sich seine Haare endgültig vom Oberkopf zurückgezogen hatten und zu einem grauen Kranz geschrumpft waren, der den Schädel wie ein verrutschter Heiligenschein umrahmte. Nein, auch weil ihm seit seinem Wechsel von der Universität hierher nach Wittenau sein jugendlicher Idealismus abhandengekommen war, die Zuversicht, fast jeden Patienten heilen und in ein normales Leben zurückführen zu können.
Er war stets ein Optimist gewesen, jedenfalls bis Erika gestorben war, und auch danach noch, denn ihr Unfalltod war für ihn zwar kaum erträglich, für sie aber ohne Schmerz und Leid gewesen. Ein Lastwagen, der auf vereister Straße ins Schleudern geraten war, eine Frau am Bordstein, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte … Er konnte es rational erklären, was die Trauer nicht geringer machte, ihm aber half, den Verstand nicht zu verlieren.
Doch wenn ein Mensch den Verstand verlor und niemand ihn zurückgeben konnte? Eigentlich durfte er nicht in diesen Begriffen denken. Man »verlor« nicht den Verstand, es waren physiologische und psychische Vorgänge, die das Denken und die Wahrnehmung störten. Und doch – er stand auf und schaute aus dem Fenster. Sah das junge Mädchen auf dem Rasen sitzen.
Er fragte sich, was ihre Augen gesehen haben mochten, bevor ihr Geist sich vor der Welt zurückzog.
Leo und seine beiden Kollegen waren in eine Kneipe in der Nähe des Alexanderplatzes gegangen, in der man in aller Ruhe nach dem Dienst seine Weiße trinken konnte. Hier verkehrten kaum Polizeibeamte. Im Präsidium hatte sich schnell herumgesprochen, weshalb der Chef der Inspektion A nach Breslau gereist war, aber Leo wollte nach Feierabend nicht darüber reden. Er hatte Walther und Sonnenschein davon erzählt, das musste reichen. Er konnte immer noch darüber nachdenken, falls Gennat tatsächlich seine Unterstützung benötigte.
»Der Buddha dürfte inzwischen angekommen sein«, bemerkte Walther, der offensichtlich in Gedanken ebenfalls bei ihrem beleibten Chef war, und stellte drei Gläser auf den Tisch.
»Hm«, sagte Leo nur und hob sein Glas, um mit ihm anzustoßen. »Trinken wir lieber auf Jenny und das Strumpfband.«
Sonnenschein lachte. »Auch wenn es nicht Verdi ist, würde ich mir gern einmal anhören, was Ihre Verlobte singt.«
Walther verschluckte sich fast an seinem Bier. »Immer langsam, Herr Kollege. So weit sind wir noch nicht. Ich kenne sie erst seit vier Wochen.«
»Nun, das ist doch eine lange Zeit«, sagte Sonnenschein lächelnd. »Sehr viel länger kenne ich meine Esther auch nicht, und wir wollen bald heiraten.« In letzter Zeit sprach Sonnenschein ständig von seiner Verlobten und hatte schon angedeutet, dass Leo und Walther eine Einladung ins Haus stünde.
Leo versuchte, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, konnte aber nicht verhindern, dass seine Gedanken immer wieder zu dem grausamen Geschehen in Breslau wanderten. Er schreckte auf, als Walther ihn anstieß. »Hörst du mir eigentlich zu?«, fragte er. »Jenny überlegt, ob sie sich lieber auf dem Akkordeon oder der Ukulele begleiten soll.«
»Ich persönlich bevorzuge das Akkordeon«, erklärte Sonnenschein.
»Für mich hat das immer etwas Maritimes«, gab Walther zu bedenken. »Es klingt nach Reeperbahn und Großer Freiheit, nach Matrosenliebchen. Ob das in Berlin ankommt, wage ich zu bezweifeln.«
»Aber eine Ukulele ist so … so exotisch. Ob die hierher passt?«, fragte Sonnenschein, der sich vom Akkordeon anscheinend nicht so rasch verabschieden mochte.
»Exotik ist in Mode«, sagte Walther eifrig. »Denken Sie an Josephine Baker.« Die amerikanische Tänzerin war im Winter mit ihrer Revue Nègre am Kurfürstendamm aufgetreten.
»Die spielt doch nicht Ukulele«, meinte Sonnenschein.
»Aber sie hat ein Röckchen aus Bananen«, warf Leo ein.
»Also die Ukulele«, sagte Walther. »Jenny schreibt nämlich an einem Lied über Hawaii. ›Mit meiner Lula tanz ich den Hula‹ oder so ähnlich. Ihr müsst mal mitkommen, wenn sie auftritt. Ich würde euch gern mit ihr bekannt machen.«
Nachdem Leo sein Bier getrunken hatte, fühlte er sich besser. Es gelang ihm endlich, die Gedanken an die Kindermorde beiseitezuschieben und sich auf den Augenblick zu freuen, in dem er die Wohnungstür aufschloss und wieder bei seiner Familie war. Vielleicht würde er dann die Leichtigkeit vom Morgen wiederfinden.
3
DIENSTAG, 8. JUNI 1926
Oberwachtmeister Schmehl ging die übliche Streife, die ihn jeden Morgen durch die Yorckstraße führte. Es war schon warm und hell, und er genoss die ersten Sonnenstrahlen auf dem Rücken seiner Uniformjacke. Später würde es unangenehm heiß werden unter dem Tschako. An der nächsten Straßenecke würde er sich eine Schrippe kaufen, wie er es immer tat, wenn er um diese Zeit die Runde Yorckstraße–Großbeerenstraße–Hagelberger Straße–Belle-Alliance-Straße ging. Von der belebten Belle-Alliance hörte er schon das Dröhnen des Verkehrs, doch hier war es noch ruhig.
Er prallte beinahe mit der Frau zusammen, die völlig unvermittelt aus dem imposanten Eingang von Riehmers Hofgarten stürzte. Sie ergriff seinen Arm und zerrte ihn wortlos durch den gewaltigen Torbogen, der in die Wohnanlage führte.
»Moment mal«, sagte Schmehl, als er sich gefasst hatte, hielt die Frau an beiden Armen fest und drehte sie zu sich um. »Nicht so schnell. Was ist denn mit Ihnen los?«
Sie war ordentlich gekleidet und frisiert, nur ihr panischer Blick verriet, dass etwas nicht stimmte. »Kennen Sie moderne Kunst?«
Mit dieser Frage hatte er nicht gerechnet. Hatte sie getrunken?
»Jetzt beruhigen Sie sich mal.«
Die Frau ignorierte seine Worte. »Ich habe es in einer Illustrierten gesehen. Lauter bunte Flecken, wild durcheinander. Man kann nichts darauf erkennen, keine Menschen oder Häuser oder Landschaften. Nur diese Flecken.«
Oberwachtmeister Schmehl beugte sich vor und roch an ihrem Atem, woraufhin sie empört zurückwich. »Ich bin nicht betrunken. Sie sind da drüben, die Flecken. Kommen Sie.«
Er folgte ihr über das Kopfsteinpflaster in den Innenhof mit den weißen Fassaden, Rasenflächen und Bäumen, dessen Schönheit und Ruhe ihn oft erfreut hatten. Er beneidete die Menschen, die hier wohnten, mitten in der Stadt und doch fernab ihrer lauten Geschäftigkeit.
Oberwachtmeister Schmehl arbeitete erst seit einem Jahr auf diesem Revier. Er war seit fünfundzwanzig Jahren bei der Polizei und nicht mehr leicht zu erschüttern. Aber er hatte gehofft, das Elend der Mietskasernen, das er von seiner alten Streife in Friedrichshain kannte, hinter sich zu lassen. Dort hatte er abgemagerte, misshandelte Frauen und Kinder gesehen, verwüstete Wohnungen, in denen Betrunkene ihre letzten Habseligkeiten zertrümmert hatten. Jämmerliche Diebstähle, Betrügereien, Mundraub, nichts war ihm fremd. Er hatte gelernt, die Bilder nach Dienstschluss nicht mit nach Hause zu nehmen und als Erstes seine Frau zu umarmen, wenn er die Wohnung betrat. Luise hatte sich gefreut, als man ihn nach Kreuzberg versetzt hatte, in ein ruhiges Revier, in dem er hoffentlich bis zur Pensionierung bleiben würde.
Auf das, was die Frau ihm zeigte, war er trotz seiner langen Berufserfahrung nicht vorbereitet. Es stimmte, die roten Flecken auf der weißen Mauer erinnerten an ein abstraktes Gemälde. Doch das schreckliche Bild auf dem Pflaster davor hatte nichts mit Kunst zu tun.
Er zog seine Signalpfeife hervor und blies hinein: zweimal kurz, einmal lang. Damit konnte er jeden Schutzmann in der Umgebung herbeirufen.
Er führte die Zeugin zur Hausmeisterwohnung im nächsten Gebäude und klingelte. »Maletzke« stand auf dem Türschild. Eine ältere, grauhaarige Frau öffnete noch im Morgenmantel und schaute ihn erschrocken an. »Ja, bitte?«
»Die Dame muss sich setzen oder hinlegen. Und geben Sie ihr ein Glas Wasser.«
»Was ist denn passiert?«
»Das werden Sie noch früh genug erfahren. Kümmern Sie sich bitte um die Frau.« Oberwachtmeister Schmehl führte die Zeugin in die Küche und half ihr, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Er wartete, bis Frau Maletzke an die Spüle trat und ein Glas aus dem Regal nahm, bevor er wieder hinauslief, um den Tatort zu sichern. Er musste verhindern, dass der nächste ahnungslose Passant einen ähnlichen Schock erlitt.
Die Frau lag auf dem Rücken, die Beine ausgestreckt und leicht gespreizt. Hals, Schultern und Brust waren mit Blut bedeckt, unter der Toten hatte sich eine Lache gebildet. Schmehl fühlte sich weniger an moderne Kunst als an einen Schlachthof erinnert. Er wusste, dass er nichts anrühren durfte. Ernst Gennat hatte durchgesetzt, dass an einem Tatort nichts verändert wurde, bevor ein Ermittler eingetroffen war. Sobald genügend Kollegen da waren, um die Zugänge zum Innenhof abzusichern und Zeugen zu ermitteln, würde er die Inspektion A im Präsidium verständigen. Dies war ein Fall für Gennats Leute.
Er schaute sich um. Ein Mann ging mit seinem Hund die Hagelberger Straße entlang, ohne einen Blick in den Hofgarten zu werfen. Nur gut, dass es noch so früh am Morgen war. Wer es eilig hatte, nahm nämlich gern die Abkürzung durch die Anlage.
Schmehl betrachtete die Tote aus dem Augenwinkel und hakte im Geist einige Punkte ab: Gut gekleidet. Teure Schuhe. Seidenstrümpfe. Die Spritzer, die bis an die Wand reichten, und die Menge des Blutes deuteten auf eine Verletzung der Halsschlagader hin. Der Täter musste mit äußerster Gewalt vorgegangen sein.
Dann hörte er ein Motorengeräusch und sah erleichtert, wie ein Mannschaftswagen vor dem Eingang Yorckstraße hielt.
Jetzt war er mit der Toten nicht mehr allein.
»Hast du gut geschlafen?«, fragte Clara beim Frühstück und schaute Leo über die Kaffeetasse hinweg an. Sie hatte das Fenster geöffnet, der frühsommerliche Duft der blühenden Linden wehte herein. »Wegen der Geschichte in Breslau, meine ich.«
Sie warf einen Blick auf die Zeitung, die groß über den Doppelmord und die nachfolgende Dienstreise des bekannten Ermittlers berichtete. In dem Artikel wurde vermutlich keine grausige Einzelheit ausgespart. Die Breslauer Presse berichtete gewiss ebenso ausführlich, und Clara fragte sich, was das für die Angehörigen der Kinder bedeuten mochte.
»Einigermaßen.« Leo hielt kurz inne und schaute sie bedrückt an. »Allerdings hoffe ich nach wie vor, dass ich mich nicht näher damit befassen muss.«
»Gennat wird den Täter finden, du sagst doch immer, er sei der Beste von euch. Er hat sogar Großmann gefasst.«
Carl Großmann sagte man nach, er habe bis zu hundert Mädchen und Frauen getötet. Er war vor fünf Jahren auf frischer Tat ertappt worden und hatte sich ein Jahr später an seiner Zellentür erhängt.
»Ja. Nachdem er in Berlin drei Jahre lang ungehindert wüten konnte«, sagte Leo. »Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, was in drei Jahren in Breslau passieren kann. Oder schon passiert ist.«