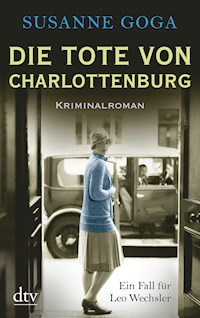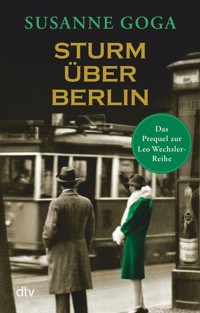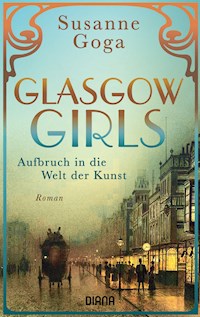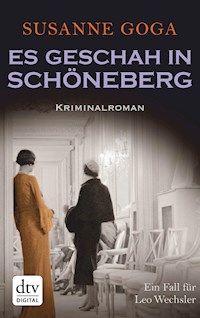9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London 1894. Zwei Jahre nach der Hochzeit liegt ein Schatten über dem Glück von Charlotte und Tom Ashdown. Durch ihre Kinderlosigkeit steht vieles unausgesprochen zwischen ihnen. Ein spannendes Buchprojekt über die magischen Orte Londons bringt die beiden einander unverhofft wieder näher. Doch ohne es zu ahnen, geraten Charlotte und Tom nach einem Leichenfund an der Themse in tödliche Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Seit zwei Jahren sind die aus Deutschland stammende Charlotte und der Journalist Tom Ashdown verheiratet. Doch die selbstbewusste Charlotte vermisst ihre frühere Arbeit als Gouvernante und sucht eine Herausforderung, die nicht unbedingt in der Mutterrolle liegt. Unterschwellig wird ihre Ehe dadurch auf eine harte Probe gestellt, zumal die gesellschaftlichen Konventionen Anderes fordern.
Da kommt ein aufregendes Buchprojekt gerade recht: Tom soll einen »Magischen Atlas Londons« verfassen und bittet Charlotte, mit ihm die Mythen und Legenden zu erforschen, die sich um die Stadt und die Themse ranken. Als man kurz darauf eine Frauenleiche und ein aus Kerzen geformtes Pentagramm am Themseufer findet, geht das Paar auf Spurensuche. Ist es möglich, dass an dem Fluss, der einst als heilig verehrt wurde, düstere Rituale mit tödlichem Ausgang stattfinden? Tom und Charlotte ermitteln in dunklen Gassen und in der eleganten Londoner Gesellschaft – das wird ihnen zum Verhängnis …
SUSANNE GOGA
Das
Geheimnis
der Themse
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 02/2021
Copyright © 2021 by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Hanna Bauer, Gisela Klemt
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Drunaa/Trevillion Images;
LML Productions/Arcangel Images
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-25694-4V002
www.diana-verlag.de
Where beauteous Isis and her Husband Tame
With mingl’d Waves, for ever, flow the Same.
Wo Isis schön mit Themse als Gemahl
strömt welleneinig Jahre ohne Zahl.
Matthew Prior, Henry and Emma (1709)
Prolog
Ihr Kopf tat weh, er pochte dumpf und sandte einen Stich der Übelkeit bis in den Magen. Sie öffnete die Augen, doch alles um sie herum war dunkel; erst nach und nach zeichneten sich schwache Umrisse ab. Ein Spalt zwischen Vorhängen, durch den ein schmaler Silberstreifen auf den Boden fiel. Es mochte Mondlicht sein. Ihr wurde schwindlig, als sie genauer hinschauen wollte.
Sie lag weich, also auf einem Bett oder bequemen Sofa. Wo war sie? Wie war sie hierhergelangt? Doch wo sie sich Antworten erhoffte, war nur Leere, als hätten sich alle Erinnerungen aufgelöst. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die sich trocken und rissig anfühlten. Sie verspürte Durst, die Zunge klebte am Gaumen. Die Haut um Lippen und Nase schmerzte, als wäre sie wund. Was war mit ihr geschehen?
Sie musste wieder eingeschlafen sein, denn als sie erneut aufwachte, roch sie ein Parfum, das ihr vertraut erschien. Jemand musste im Zimmer gewesen sein, ohne dass sie es gemerkt hatte. Sie wollte sich aufsetzen, doch ihr wurde abermals schwindlig, und sie sank kraftlos in die Kissen zurück. Immerhin tat ihr Kopf nicht mehr so weh, und allmählich tauchten einzelne, verschwommene Bilder auf: der Fluss, die Trauerweiden, flackernder Kerzenschein und eine Stimme, die sie nur zu gut kannte, die in ihr widerhallte wie ein Echo. Und da war noch etwas gewesen – eine Hand, die ihren Nacken umfasste, sie niederdrückte …
Während sie die Bilder an sich vorüberziehen ließ, regte sich Angst in ihr. Dieser fremde Ort, ihr betäubter Zustand, die absolute Stille, die sie umgab – all das war vertraut wie ein schützender Kokon und zugleich bedrohlich.
Sie schloss die Augen, atmete den Duft ein und wartete. Irgendwann würde jemand kommen. Und dann würde sie …
Die Stimme war sanft, die Hand auf ihrer Stirn kühl und beruhigend. »Beweg dich nicht. Alles ist gut. Ich bin bei dir.«
»Warum … hast du mich geholt?«, fragte sie und öffnete die Augen. Das Zimmer war in gedämpftes Licht getaucht, man hielt ihr ein Glas Wasser an den Mund.
»Weil du besonders bist. Weil ich dich brauche. Weil ich dich warnen will. Weil du vom Wege abzukommen drohst.«
Sie schluckte. Einerseits schmeichelten ihr die Worte, andererseits lösten sie auch Furcht aus. »Wieso komme ich vom Wege ab?«
»Du darfst mit niemandem über das hier sprechen.«
»Natürlich nicht. Ich werde schweigen.«
»Schwöre es.«
Sie hob die rechte Hand. »Ich schwöre es. Bei der Göttin.«
1
Charlotte betrachtete den Magnolienbaum vor dem Fenster, der in einer geradezu unerhörten Pracht blühte. Die ersten Blütenblätter waren abgefallen und lagen wie rosafarbener Schnee auf dem Fleckchen Rasen, aus dem der Baum emporwuchs. Das Fenster war geöffnet und ließ einen Hauch von Frühling herein, auch wenn der Maiabend hier in London noch kühl war. Das Stimmengemurmel hinter ihr war wie eine Begleitmelodie, die sich um ihre Gedanken wand, ohne sie zu stören.
Heute vor zwei Jahren war es noch der Duft des Flieders gewesen, der durchs Fenster wehte, als wollte selbst die Natur ihnen alles Glück der Welt wünschen. Ihr war vom Wein ein bisschen schwindlig gewesen, doch an einem Tag wie diesem – umgeben von Freunden, an der Seite des Mannes, den sie über alles liebte, ihres Mannes, von nun an – hatte sie das nicht gekümmert.
Als sie daran dachte, wie Tom sie zum Hochzeitstanz geführt hatte, während alle zusahen, sie beide aber nur Augen füreinander besaßen, überkam sie eine leise Traurigkeit. Sie spürte noch seine Arme, die sie umfangen hielten, seine dunklen Locken an ihrer Wange, hörte noch den Takt des Walzers und das leise Murmeln ihrer Gäste. Es war ein vollkommener Moment gewesen. Ein Moment, der sie – das wusste sie genau – ihr Leben lang begleiten würde.
Ihre Brautrede war kurz. Sie hatte allen gedankt, die sie so freundlich aufgenommen und ihr das Gefühl gegeben hatten, willkommen zu sein. »Vor allem aber möchte ich Tom danken – für seine Liebe, seinen Humor, seine grenzenlose Begeisterung und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen.«
Es war eine Zeit gefolgt, in der sie glücklich war, die ihr mehr geschenkt hatte, als sie sich je erhofft hatte. Doch in den letzten Monaten war es, als wehte ab und an ein kühler Hauch durchs Haus, als legte sich ein Schatten auf sie beide, für den Charlotte keinen Namen wusste. Gerade weil er nicht greifbar war, schien es unmöglich, Tom darauf anzusprechen. Bisweilen war es, als befände sich eine unsichtbare Mauer zwischen ihnen, die sie nicht durchdringen konnte.
Und nun stand sie hier an ihrem zweiten Hochzeitstag und wusste nicht wohin mit ihrer Traurigkeit.
»Charlotte, wir vermissen dich schon!« Sarah Hoskins trat neben sie ans Fenster, um die Magnolie zu betrachten. »Sie ist wunderschön.«
»Ich kann mich gar nicht satt daran sehen. Mir ist, als würde sie die Blüten verlieren, sowie ich ihr den Rücken kehre.«
Sarah tippte ihr auf die Schulter. »Wir wollen jetzt anstoßen«, sagte sie. »Der Umzug in ein neues Haus ist ein feierlicher Anlass.«
Charlotte und Tom wohnten seit drei Wochen in ihrem neuen Heim in Nr. 47 Clerkenwell Close, nicht weit von ihrem alten Haus entfernt.
»Du siehst so nachdenklich aus«, stellte Sarah fest. »Ihr habt es doch wunderbar hier.«
Charlotte drehte sich schulterzuckend zu ihr um. »Ich liebe dieses Haus, und der Garten und die Kirche gleich nebenan sind zauberhaft, aber … manchmal zweifle ich und frage mich, ob Tom in Nr. 54 nicht glücklicher gewesen wäre.«
Sarahs Hand schoss vor und umfasste ihren Unterarm. »Wie kann eine kluge Frau nur solchen Unsinn reden? Es war Toms eigener Wunsch, das alte Haus zu verlassen, das hat er John schon vor geraumer Zeit erzählt.«
Tom hatte mit seiner verstorbenen Frau Lucy in Nr. 54 Clerkenwell Green gewohnt, und nach ihrer Heirat war Charlotte als zweite Mrs. Ashdown dort eingezogen. Es war nicht ungewöhnlich, dass die zweite Ehefrau im Haus der ersten lebte, inmitten der Möbel und Dekorationen, die ihre Vorgängerin ausgesucht hatte, umgeben von Erinnerungen, die ihr Mann nicht mit ihr teilte. Es hatte Charlotte nicht gestört, da sie als Gouvernante stets in Räumen gewohnt hatte, in denen ihr nichts gehörte außer ihren Kleidern und Büchern und deren Einrichtung sie nicht selbst ausgesucht hatte. Sie war in Nr. 54 bald heimisch geworden und hatte nur hier und da dezente Änderungen vorgenommen, ohne das Andenken an Lucy Ashdown auszulöschen. Und dennoch …
»Du hast recht. Es war Toms Idee hierherzuziehen. Habe ich dir überhaupt erzählt, wie er es angestellt hat?«
Sarah schüttelte lächelnd den Kopf.
»Wir hatten wie so oft einen Spaziergang unternommen, vom Green über den Kirchhof. Es war Vollmond, das weiß ich noch, ein kühler Abend im März. Doch statt nach Hause zu gehen, bog Tom nach rechts ab, blieb vor diesem Haus stehen und sah mich einfach an.«
»Schweigend?«
»Ausnahmsweise«, sagte Charlotte belustigt. »Was mir verriet, dass es wichtig war. Also habe ich ihn auch angesehen und geschwiegen. Es war wie ein Duell, um zu prüfen, wer länger durchhält.«
»Wer hat gewonnen?«
»Ich. Denn irgendwann hielt Tom es nicht mehr aus. ›Die Tür hat ein schönes Oberlicht‹, sagte er. Ich muss ihn ziemlich dumm angesehen haben. ›Der Garten ist klein, aber es wächst ein Magnolienbaum darin.‹ Als ich immer noch nichts sagte, ergriff er meine Hände und sah mich ernst an. ›Nun mach es mir doch nicht so schwer, Liebste. Ich möchte dieses Haus kaufen. Ein neues Haus für mein neues Leben mit dir.‹« Charlotte schluckte, als sie den Augenblick noch einmal durchlebte. »›Du wirst es einrichten, wie es dir gefällt, es soll dein Wesen widerspiegeln. Du verdienst ein Heim, das nur dir gehört, in dem es keine Schatten gibt.‹«
»Hast du sofort Ja gesagt?«
»Nein, ich wollte in Ruhe darüber nachdenken und habe mir Zeit gelassen. Mehr Zeit, als Tom lieb war, er ist tagelang wie ein ungeduldiger Kater um mich herumgestrichen. Letztlich habe ich erkannt, dass ein neuer Anfang für uns beide besser wäre und wir uns von den Erinnerungen lösen sollten. Also habe ich zugestimmt.«
»Und das war richtig«, sagte Sarah. »Außerdem ist heute euer zweiter Hochzeitstag. Nun musst du aber wirklich mitkommen und mit uns anstoßen. Die anderen warten schon auf dich.«
Toms dunkle Augen strahlten, als Charlotte das Wohnzimmer betrat. Er kam auf sie zu und streckte ihr beide Hände entgegen, worauf alle zu applaudieren begannen. Er küsste sie auf die Wange und schaute in die Runde.
»Freunde, nun, da meine liebe Frau wieder bei uns ist, möchte ich euch alle bitten, mit uns zu trinken. Heute vor zwei Jahren haben wir einander in eurem Beisein versprochen, unser Leben miteinander zu verbringen. Es war einer der glücklichsten Tage für mich, und ich möchte nie wieder ohne dich sein, liebe Charlotte. Dich an meiner Seite zu wissen hat mein Leben viel heller und leichter gemacht. Und nun haben wir für unsere Zukunft auch den angemessenen Ort gefunden.«
Er holte zwei Weingläser, reichte eins davon Charlotte und stieß klingend mit ihr an. Alle anderen taten es ihnen nach.
»Auf Charlotte und Tom und ein langes, glückliches Leben in Clerkenwell Close Nr. 47!«
Sie standen ganz still da, einander zugewandt, und Charlotte fuhr mit dem Zeigefinger sanft über seine pflaumenblaue Weste. Ihr Mann liebte diese ausgefallenen Kleidungsstücke, und sie liebte es, ihn darin zu sehen.
Dann stellte er sein Glas ab und grinste. »Nun aber zu den wirklich drängenden Fragen – wer von euch hat den unerhörten ›König Lear‹ in Drury Lane gesehen?«
John Hoskins, sein Freund aus Studientagen, schüttelte den Kopf. »Die Kunde davon ist noch nicht bis nach Oxford gedrungen. Was habe ich versäumt?«
»Gar nichts«, erwiderte Leland Williams, der Theaterkritiker des Morning Herald. »Und leider ist mir unser guter Tom zuvorgekommen. Ich hatte mich schon auf die Ehre gefreut, den ersten Verriss zu schreiben.«
»Es gibt viele Gründe, von Oxford nach London zu reisen, aber diese Inszenierung gehört nicht dazu«, warf Tom ein. »Bernard LaGrange gibt einen übergewichtigen Lear von achtundzwanzig Jahren, womit er nicht nur kein Greis, sondern auch jünger als seine Töchter Regan und Goneril ist. Die Darstellerin der Cordelia ist immerhin sechsundzwanzig, doch auch hier dürfte eine Vaterschaft ausgeschlossen sein.«
Er hielt inne, weil das Gelächter zu laut wurde. Tom war Kritiker und liebte es, über das Theater zu dozieren. Je schlechter die Aufführung war, desto mehr genoss er es, sie zu zerpflücken. Charlotte hatte ihn zu Anfang ihrer Bekanntschaft einmal gefragt, ob er eine gute Inszenierung überhaupt zu schätzen wisse, und er hatte geantwortet: »Natürlich. Die guten wärmen mir das Herz. Aber die schlechten befeuern meine Feder.«
»Kühnheit ist ein Privileg der Jugend«, warf Toms Freund Stephen Carlisle ein. »Und es zeugt von Kühnheit, eine solche Rolle so früh zu wagen.«
Tom zog eine Augenbraue hoch. »Lear ist ein Vater, das ist der eigentliche Kern der Rolle. Es geht um Väter und Töchter. Um das, was ein Vater von seinen Kindern erwartet und diese von ihrem Vater. Um Liebe und Wertschätzung, um echte und vorgetäuschte Gefühle. Um Schuld und Unschuld, Vertrauen und Verrat. Selbst wenn LaGrange ein guter Schauspieler wäre, was er nicht ist, erscheint er mir zu jung für diese Rolle.«
»Und wo würdest du das Mindestalter für einen Lear ansetzen?«, fragte Sarah Hoskins.
»Nun, das ist eine Frage der Mathematik, nicht wahr?«, erwiderte Tom. »Sagen wir, Lears älteste Tochter wäre Mitte zwanzig und die jüngste sechzehn. Dann sollte er mindestens Mitte vierzig sein.«
Carlisle wiegte den Kopf. »Wer sitzt schon im Theater und rechnet das nach? Ich habe Mütter auf der Bühne gesehen, die kaum älter als ihre Söhne waren oder sogar jünger. Da ist unsere Fantasie gefragt.«
Charlotte schaute zu Tom, der plötzlich still geworden war und nachdenklich sein Glas betrachtete. Niemand außer ihr schien es zu merken.
»Tom, du hast die Frage aufgeworfen, dann solltest du auch der Schiedsrichter sein!«, rief jemand.
Er zuckte leicht, als wäre er aus seinen Gedanken aufgeschreckt, fuhr sich durch die Haare und lächelte in die Runde. »Ich glaube, es ist weniger eine Frage der Mathematik als der Reife. LaGrange wirkt viel zu unreif, um als Vater zu überzeugen, gleichgültig, wie alt die Töchter sind. Ich selbst würde mich bemühen, ihnen als Kind und Erwachsener zugleich zu begegnen, ihre kindliche Begeisterung heraufzubeschwören, ihnen aber auch beizustehen, wie es nur ein Erwachsener kann. Ich frage mich, wie Lear mit seinen Töchtern umgegangen ist, als sie noch klein waren.« Er hielt inne. »Verzeiht, ich schweife ab.«
Charlotte spürte, dass etwas in Tom vorging, das er vor den anderen verbergen wollte, und kam ihm rasch zu Hilfe. »Mir kommt Lear greisenhaft vor, starrsinnig und doch allzu vertrauensselig. Wie ein sehr alter Mann. Also müssten auch seine Töchter entsprechend älter sein.«
»Oder er ist spät Vater geworden«, sagte Emma Lowndes, Sarahs Schwester, die mit einem deutlich älteren Mann verheiratet und kürzlich zum ersten Mal Mutter geworden war. »Lebenserfahrung kann einem Vater nur zugutekommen.«
»Das glaube ich auch«, sagte Miss Clovis, eine ältere Nachbarin, die sich beim Einzug vorgestellt und ihnen Brot und Salz gebracht hatte, um im Heim viel Glück und Segen zu wünschen. Sie wurde rot, als bereute sie, so kühn gesprochen zu haben, gab sich dann aber einen Ruck. »Mein lieber Vater war dreiundvierzig, als er meine Mutter heiratete. Ich habe ihn als sanften und wohlgebildeten Mann erlebt, der stets ein offenes Ohr für seine Kinder hatte.«
»Was beweist, dass wir Shakespeare nicht immer rückhaltlos glauben dürfen«, sagte Charlotte, die Toms anhaltendes Schweigen beinahe körperlich spürte. »Aber es wäre eine lohnende Idee für ein neues Buch, nicht wahr, Tom? Elternschaft bei Shakespeare – eine ideale Fortsetzung für deine Frauen bei Shakespeare.«
Er nickte knapp, schaute in die Runde und wechselte abrupt das Thema. »Bitte entschuldigt mich kurz. Charlotte beginnt schon einmal mit der Führung durchs Haus, die bleibt euch nicht erspart!«
Tom schloss die Augen und lehnte sich an den mit geschnitzten Tieren verzierten Kaminsims, der ihn gleich beim ersten Besuch des Hauses magisch angezogen hatte. Er war mit den Fingern über die Löwen, Elche und Elefanten gefahren und hatte zu Charlotte gesagt: »Dieses Haus hat auf uns gewartet.«
Im Wohnzimmer herrschten warmes Rot und honigbraunes Holz vor, Bücherregale und die von Daisy gehegten Topfpflanzen. Charlotte liebte das Zimmer und hatte große Mühe darauf verwandt, es einzurichten, hatte Bilder aus dem alten Haus aufgehängt, dazwischen neue Zeichnungen und Stiche, die sie bei ihren Spaziergängen in kleinen, verborgen liegenden Läden entdeckt hatte. Eine alte Ansicht von Richmond, St. Paul’s Cathedral, eine Ansicht der Stadt vom Südufer der Themse aus und von Hampstead Heath. Und eigens für ihn Kupferstiche mit Shakespeare-Szenen aus dem 18. Jahrhundert, die sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte.
Vorhin war etwas mit ihm geschehen. Gerade noch hatte er sich unbekümmert über den Schauspieler mokiert, der den Lear spielte, und dann plötzlich davon angefangen, wie er mit seinen eigenen Kindern umgehen würde. Es war, als hätte das Gespräch über Lear an etwas gerührt, das ihn schon länger bewegte, das er sich aber nicht eingestehen konnte. Es war wie ein Aberglaube, die Angst, etwas real werden zu lassen, indem man es in Worte fasste.
Sie hatten nie über Kinder gesprochen. Es mochte daran liegen, dass es seine zweite Ehe war, sie beide nicht mehr ganz jung waren, Charlotte selbstständig gewesen war und ein eigenes Leben geführt hatte. Ihre Erwartungen waren daher anders als bei einem jungen Paar.
Wie es wohl wäre, wenn er ein Kind mit Charlotte hätte, ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen, einen neuen Menschen, der aus ihrer Liebe entstanden war? Doch sie war in den zwei zurückliegenden Jahren nicht schwanger geworden.
Tom blieb noch einen Augenblick lang stehen, atmete tief durch und legte die Hand auf den Kaminsims, als könnte ihm das warme Holz Zuversicht verleihen. Dann gab er sich einen Ruck und wandte sich zur Tür.
2
»Wie reizend, dass Sie gekommen sind, Mrs. Ashdown! Ich hoffe, meine Einladung traf nicht unhöflich spät ein, aber nach dem wunderbaren Abend bei Ihnen wollte ich mich revanchieren. Leider war ich einige Wochen indisponiert. Eine Sommererkältung.«
Miss Clovis sprudelte die Sätze hervor, noch ehe sie Charlotte in ihr kleines Wohnzimmer geführt hatte, in dem der Teetisch gedeckt war. »Nehmen Sie doch Platz, die Chelsea Buns sind ganz frisch, aber hoffentlich nicht zu heiß. Das Rezept stammt von meiner lieben Mutter, die auch immer Zitronenschale dazugegeben hat. Sie pflegte zu sagen, warm seien sie am besten.«
Charlotte schaute sich um und staunte, wie ihre Gastgeberin auf so wenig Raum so viele Möbel, Kissen, Deckchen, Bilder und Vasen untergebracht hatte. Sie wagte kaum zu atmen, da sie fürchtete, der leichteste Luftzug könnte die heiklen Arrangements aus Porzellan, die auf den Regalen balancierten, zum Einsturz bringen. Es roch nach Staub und Lavendel, und sie spürte, wie ihre Nase kitzelte.
Miss Clovis schenkte ihr Tee ein und reichte ihr den Teller mit dem Gebäck. »Ich kaufe Zimt und die Gewürzmischung bei Cranleys in der Farringdon Road. Nicht billig, aber exquisit.«
Der erste Bissen bewies, dass sie recht hatte. Charlotte genoss den saftigen, beinahe weihnachtlich duftenden Teig. Dann schaute sie zu der Vitrine, die neben der Tür stand.
»Sie haben eine eindrucksvolle Porzellansammlung.«
»Vielen Dank, die meisten Stücke stammen von meiner Großmutter. Das Sammeln liegt in der Familie. Mein lieber Vater hat mir seine Münzen vermacht, doch die habe ich verkauft und von dem Erlös dieses Haus erworben. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, aber ich hatte kein Erbe zu erwarten und fand es nur angemessen, mir damit ein Auskommen zu sichern.«
Charlotte war überrascht, dass Miss Clovis so offen über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sprach, zumal sie einander erst seit Kurzem kannten. »Das ist verständlich. Aber erwähnten Sie nicht, Sie seien Lehrerin gewesen?«
Miss Clovis rührte Zucker in ihren Tee und legte den Löffel ab, bevor sie antwortete. »Gewiss, aber in einer Armenschule. Wir brauchten das ganze Geld für die Kinder, also habe ich fast umsonst gearbeitet. Das war bei Ihnen selbstverständlich anders.« Sie hielt inne und schaute Charlotte verlegen an. »Verzeihung, ich wollte Sie nicht kränken.«
Charlotte lächelte. »Es kränkt mich nicht, wenn jemand meinen Beruf erwähnt. Ich hatte viel Freude an meiner Tätigkeit. Sie war der Grund, aus dem ich damals nach England gekommen bin.«
Charlotte erinnerte sich, wie sie Deutschland hinter sich gelassen hatte, um als Gouvernante in Chalk Hill zu arbeiten. Dieser Schritt hatte ihr Mut und Kraft verliehen, von denen sie bis heute zehrte. Sie hatte sich damals nicht vorstellen können, ihren Beruf aufzugeben, nicht mehr allein für sich zu sorgen, doch dann war sie Tom begegnet, und alles war anders geworden.
»Fehlt sie Ihnen?«
Sie kehrte abrupt in die Gegenwart zurück. Miss Clovis war rot geworden, und Charlotte staunte, wie rasch sich Taktlosigkeit und Bedauern bei ihr abwechselten.
»Verzeihen Sie die Frage. Als glücklich verheiratete Frau haben Sie Ihren Beruf hinter sich gelassen und widmen sich neuen Aufgaben.«
Hatte sie ihn wirklich hinter sich gelassen?, fragte sich Charlotte und spürte, wie der Gedanke ungewollt Wurzeln in ihr schlug. Bisweilen stand sie vor dem Regal, in dem sie ihre Schulbücher aufbewahrte, und strich mit der Hand über die Rücken, erinnerte sich daran, wie sie damit unterrichtet hatte, wie die Augen der Kinder geglänzt, sich aber dann und wann auch vor Langeweile geschlossen hatten. Sie erinnerte sich an verstohlenes Gähnen und eifrig emporgereckte Hände. »Meine Aufgabe als Gouvernante war erfüllend. Ich war oft glücklich, vor allem, wenn ich mit den Kindern draußen in der Natur sein oder mit ihnen Dinge entdecken konnte, die nicht im Lehrplan standen. Deutsche Märchen beispielsweise. Aber es war auch befriedigend zu sehen, wie sie Fortschritte im Lesen, Schreiben und Rechnen machten.«
Miss Clovis räusperte sich. »Eine Freundin von mir war auch Gouvernante und furchtbar einsam, das konnte ich ihren Briefen entnehmen. Als sie an einem Herzanfall starb, hat die Familie nicht einmal für das Begräbnis gesorgt.«
Charlotte schaute betreten auf ihren Teller und überlegte, wie sie die Stille durchbrechen konnte, die sich über den Raum gesenkt hatte. »Das tut mir leid. Wie ich schon sagte, ich habe die Kinder gern unterrichtet, aber es ist mir nicht schwergefallen, den Beruf für eine eigene Familie aufzugeben.«
»Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diese bald haben.« Diesmal schien Miss Clovis nicht einmal zu merken, wie unangemessen ihre Worte waren.
Charlotte brauchte einen Moment, bis sie sich gefasst und eine Entgegnung gefunden hatte. »Sie haben recht, wir haben noch keine Kinder.« Ihre Wangen waren heiß geworden. Gewiss, ihre Ehe war nach zwei Jahren noch kinderlos, doch war sie bisher nie darauf angesprochen worden. In Toms Kreisen dachte man unkonventionell und diskutierte über Frauenwahlrecht, Kunst und übernatürliche Phänomene, darum trafen die unerwarteten Worte sie wie ein gut platzierter Stich. »Ich würde jedoch zwei Menschen, die einander aufrichtig lieben, auch als Familie bezeichnen.«
Miss Clovis beugte sich vor und legte Charlotte die Hand auf den Arm. »Bitte verzeihen Sie, Mrs. Ashdown, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Mir war leider nie das Glück einer Ehe beschieden, da mein Verlobter an der Cholera verstarb. Sicher werden Sie sich zu gegebener Zeit einer wachsenden Familie erfreuen.«
»Das tut mir leid«, sagte Charlotte, doch das Unbehagen blieb. Sie rutschte auf dem Stuhl hin und her und fragte sich, wie sie möglichst schnell die Flucht ergreifen konnte, ohne ihre Gastgeberin zu brüskieren.
»Jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht«, sagte Miss Clovis betreten. »Am besten unterhalten wir uns wieder über Porzellan.«
»Erzählen Sie mir lieber von der Armenschule«, sagte Charlotte entschlossen.
Miss Clovis seufzte erleichtert. »Nehmen Sie noch ein Chelsea Bun, Mrs. Ashdown. Nun, die Schule lag in Field Lane, einer sehr armen Gegend, gar nicht weit von hier. Sie ist schon vor vielen Jahren nach Hampstead umgezogen, und kurz danach habe ich die Arbeit dort aufgegeben.«
»Was haben Sie unterrichtet?«
»Es waren arme Kinder, denen Geografie oder Musik nicht geholfen hätte. Wir mussten sie darauf vorbereiten, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. Die Jungen wurden auch als Schneider oder Schuhmacher ausgebildet und lernten grobe Arbeiten wie Holzhacken.«
Charlotte schaute sie nachdenklich an. »Ich habe immer Kinder unterrichtet, denen es an nichts fehlte. Im materiellen Sinne jedenfalls. Natürlich kann Geld nicht die Liebe der Eltern ersetzen, aber es gab einige glückliche, die beides besaßen.«
Miss Clovis schenkte ihr Tee nach. »Vor meiner Zeit – es war kurz nach Gründung der Schule in den Vierzigerjahren – kam einmal Mr. Dickens zu Besuch. Er war erschüttert von der Armut und dem Elend, denen diese Kinder zu entfliehen suchten. Er besichtigte auch den Schlafsaal, in dem jene unterkamen, die gar kein Heim besaßen, und zeigte sich tief bewegt. Kennen Sie ›Oliver Twist‹? Er hat viele Szenen in unserer Schule angesiedelt.«
»Das ist interessant. Allerdings muss ich gestehen, dass ›Unser gemeinsamer Freund‹ mir von seinen Werken am liebsten ist.«
Miss Clovis sah sie überrascht an. »Eine ungewöhnliche Wahl, Mrs. Ashdown. Sehr düster.«
Charlotte lachte. Ihrer Gastgeberin zu widersprechen war seltsam befreiend. »Nun, mich haben die morbiden Szenen auf der Themse unwiderstehlich angezogen. Die Leichenfledderer, die nachts mit ihren Booten auf Beutejagd fahren. Mr. Boffin mit seinem Imperium aus Abfall. Und eine Heldin, der lange Zeit Geld wichtiger ist als Liebe. Ich fand den Roman herrlich verdreht. Darum gehe ich auch so gern an der Themse spazieren.« Sie beobachtete belustigt, wie Miss Clovis zusammenzuckte.
»Hm, nun, der späte Dickens hat sicher seine Vorzüge, aber ich halte mich doch lieber an ›Oliver Twist‹ und ›Große Erwartungen‹.« Dann blitzte etwas in Miss Clovis’ Augen auf. »Und Sie sagen, Ihnen gefällt die Themse? Ich selbst finde sie eher furchteinflößend, mit den Gezeiten und den vielen Schiffen und ungehobelten Männern, die man dort antrifft. Wapping, Rotherhithe, Limehouse, das sind verrufene Gegenden in der Nähe des Flusses. Und denken Sie nur an das ganze Opium! Aber in Limehouse gibt es eine hübsche Kirche von Nicholas Hawksmoor. St. Anne’s, das ist die mit der Pyramide.«
»Dort war ich noch nie. Was für eine Pyramide ist das?«
Nun wirkte Miss Clovis beinahe eifrig. »Auf dem Kirchhof gibt es ein Monument, es stammt wohl aus der Zeit, in der die Kirche gebaut wurde. Eine Pyramide aus Portland-Stein, die die Aufschrift ›Die Weisheit Salomos‹ trägt. Falls Sie noch einmal dort spazieren gehen, sollten Sie darauf achten.«
»Das werde ich tun.« Sie erhob sich, worauf Miss Clovis sie überrascht ansah.
»Sie gehen schon? Wie schade.«
»Bedauere, aber mein Mann erwartet mich.« Es war nicht ganz gelogen, da Tom sie gebeten hatte, seinen neuesten Artikel über ein Märchenstück nach den Brüdern Grimm zu lesen und ihm ihre Meinung zu sagen. Nur hatte sie das schon vor ihrem Besuch bei Miss Clovis erledigt …
»Es hat mich so gefreut, Sie hier zu empfangen.«
Als Charlotte auf der Straße stand, sog sie die Luft in tiefen Zügen ein. Dann drehte sie sich um und schaute zurück zu Miss’ Clovis Haus. An diesem Nachmittag war etwas geschehen, das sie nicht in Worte fassen konnte. Es war, als hätte ihr die ältere Frau Gedanken eingepflanzt, die sie mit nach Hause nehmen würde.
Die Fragen nach eigenen Kindern und ob sie ihren Beruf vermisse – hatte sie womöglich in Charlottes Gesicht etwas gelesen, das sie darauf gebracht hatte?
Sie wohnten beinahe nebeneinander. Es würde sich kaum vermeiden lassen, Miss Clovis wieder zu begegnen. Doch die Teestunde wollte Charlotte nicht so bald wiederholen.
3
Tom öffnete ihr selbst die Tür. Als er so vor ihr stand, die Ärmel des weißen Hemdes aufgekrempelt, mit offener Weste, zerzausten Haaren und tintenfleckigen Fingern, konnte Charlotte nicht anders und stürzte in seine Arme. Er drückte sie an sich, schloss mit dem Fuß die Haustür und hielt Charlotte ein wenig von sich weg. Seine dunklen Augen – die Wimpern waren beinahe ungehörig dicht und schön geschwungen – weiteten sich verwundert.
»Ich weiß deine Leidenschaft zu schätzen, aber du siehst aus, als wäre dir ein Gespenst begegnet.«
Charlotte lachte. »Ich bin einfach froh, dich zu sehen. Was für eine sonderbare Teestunde das war!«
Er nahm sie sanft am Arm und führte sie ins Wohnzimmer, wo er sie in den Ohrensessel am Kamin drückte. »Einen Sherry?«
Charlotte überlegte nicht lange. »Gern.«
Tom trat an das niedrige Tischchen, auf dem die Karaffe stand, und schenkte zwei Gläser ein. Er reichte ihr eins und setzte sich ihr gegenüber aufs Sofa. »Zum Wohl. Und jetzt bin ich darauf gespannt, von der sonderbaren Teestunde zu hören.«
Charlotte leerte das Glas auf einen Zug und stellte es auf den Tisch. »Vermutlich lachst du mich aus.«
»Erzähl mir, was geschehen ist, dann kann ich entscheiden, ob ich lache.«
Doch nun, da sie ihm davon berichtete, erkannte sie, wie wenig es zu sagen gab. Hatte sie sich die seltsame Stimmung bei Miss Clovis eingebildet? Die Mischung aus Taktlosigkeit und Forschheit? War es nur ihre Fantasie, die den Worten eine Bedeutung beimaß, die sie in Wahrheit nicht gehabt hatten?
Tom zog die Augenbrauen hoch. »Es klingt, als wäre diese Frau nicht gerade höflich. Ich bereue, dass wir sie zu unserer Feier eingeladen haben. Du solltest ihr Gerede schnell vergessen.«
»Sie hat selbst weder Mann noch Kinder und behauptet dennoch, wir seien keine Familie, weil wir ...« Sie hielt inne, da Tom plötzlich ernst aussah.
Er drehte sein Glas zwischen den Fingern, ohne daraus zu trinken. »War es das, was dich gestört hat?«
Charlotte zuckte mit den Schultern. »Es war einfach sonderbar. Sie sprach, als gehörte es sich nicht, verheiratet zu sein und keine Kinder zu haben.« Als er schwieg, fügte sie hinzu: »Sie gab sich gastfreundlich und teilnahmsvoll, aber ich fühlte mich beobachtet.« Tom betrachtete immer noch sein Glas. »Mir ist in ihrer Gegenwart nicht wohl.«
Er trank entschlossen seinen Sherry aus, stellte das Glas neben ihres und stützte die Handflächen auf die Knie. Dann beugte er sich vor und schaute sie an. »Wenn dir diese Frau unangenehm ist, Liebste, bleib ihr fern. Sie mag unsere Nachbarin sein, aber das bedeutet nicht, dass wir mit ihr gesellschaftlich verkehren müssen. Ich möchte, dass du hier glücklich bist.«
Zu ihrer Überraschung kniete er sich vor den Sessel, ergriff ihre Hände und strich sanft mit den Daumen darüber. Charlotte schaute auf seinen dunklen Kopf mit den einzelnen silbernen Strähnen, die im Lampenlicht schimmerten. In diesem Augenblick fühlte sie sich ihm so nahe wie schon lange nicht mehr. Am liebsten hätte sie ihren Kopf in seinen Haaren vergraben und nie mehr aufgeschaut.
Nach dem Essen fiel ihr ein, worüber sie eigentlich hatten sprechen wollen. »Tom, ich habe deinen Artikel gelesen, bevor ich zu Miss Clovis gegangen bin. Er gefällt mir gut, das Stück würde ich gern sehen. Nur gut, dass sie nicht den Machandelboom aufführen«, sagte Charlotte.
»Den was?«
Sie lachte. »Das wohl gruseligste Märchen, das ich kenne. Das aufzuführen würde gewiss einen Skandal hervorrufen.«
Tom lehnte sich an den Kamin, schob die Hände in die Hosentaschen und schaute sie erwartungsvoll an. »Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Erzähl.«
Sie war froh, dass die dunkle Stimmung von vorhin verflogen war, und senkte theatralisch die Stimme. »Na schön. Aber beschwere dich nicht, wenn du Albträume davon bekommst. Beim Märchen vom Machandelboom geht es um eine Stiefmutter, die dem Stiefsohn den Kopf abschlägt, den Mord ihrer kleinen Tochter in die Schuhe schiebt und den Jungen in der Suppe kocht, um das Verbrechen zu vertuschen. Der Vater isst die Suppe mit gutem Appetit. Aus den Knochen entsteht erst ein Vogel und dann der Junge, und die Stiefmutter wird am Ende von einem Mühlstein erschlagen.«
Tom schaute sie entsetzt an. »Ist das dein Ernst?«
Sie lachte. »O ja. Davor habe ich mich als Kind sehr gefürchtet. Und deshalb habe ich das Märchen als Gouvernante nie erzählt, sonst hätten die Kinder Angst bekommen.«
Er räusperte sich. »Schon wieder Kinder. Mir scheint, Miss Clovis übt ihren Bann durch mehrere Hausmauern aus.«
Charlotte stieß ihn mit dem Fuß an. »Erinnere mich jetzt nicht an sie.« Dann besann sie sich. »Vermutlich ist sie einsam. Sie hat nie dieses Glück erlebt.« Sie machte mit der Hand eine rasche Bewegung von sich zu Tom.
Er stand auf und streckte ihr die Hände entgegen. Sie ließ sich von ihm aus dem Sessel ziehen, trat dicht vor ihn hin und legte den Kopf auf seine Schulter. Sie waren beinahe gleich groß, was ihr immer gefallen hatte. Sie konnten einander in die Augen sehen, ohne den Kopf neigen oder zum anderen hinaufschauen zu müssen, und das erschien ihr wie ein Sinnbild ihrer Ehe.
Sie spürte Toms warme Hand im Nacken und schloss die Augen, genoss seine Nähe. Seine leisen Worte rissen sie aus der Versunkenheit.
»Wie wäre es, wenn wir heute Abend früh zu Bett gehen?«
Sie nickte, den Kopf noch fest an seiner Schulter, und spürte, wie ihr ganzer Körper warm wurde.
Irgendwann in den frühen Morgenstunden wachte sie auf und merkte, dass das Bett neben ihr leer war. Das Laken fühlte sich kühl an, die Decke war zurückgeschlagen. Tom musste schon länger fort sein. Sie drehte sich auf den Rücken und schaute an die Decke, deren Stuck sich im ersten grauen Licht abzeichnete. Sie wartete. Doch er kam nicht zurück.
4
Im Tempel herrschte gedämpftes Licht, dem die alten Mauern einen warmen Schein verliehen. Kerzen flackerten in eisernen Haltern und beleuchteten die Bilder an den Wänden.
Ein alter Mann mit wallendem weißen Bart, dessen Gewand von einer gewundenen Kordel gehalten wurde, kniete an einem Fluss, den Kopf wie zum Gebet gesenkt. Vor ihm lagen ein schimmernder Helm, in dem ein Loch klaffte, und ein Schwert, dessen Klinge zerbrochen war. Daneben, nur angedeutet, war ein menschlicher Kopf zu sehen, der vom Körper abgetrennt schien.
Auf einem anderen Bild war ein Flussufer dargestellt, an dem sich Häuser erhoben. Ein Kirchturm überragte mit eckigen Zinnen die niedrigen Dächer. Auf einer steinernen Brücke, die den Fluss überspannte, stand eine rothaarige Frau, die Hände auf den Rücken gefesselt, den Kopf stolz erhoben. Um sie herum bildeten Priester und Soldaten einen drohenden Halbkreis, aus dem es kein Entkommen gab. Aber die Frau war von einem warmen Licht umgeben, das sie zu schützen schien, sodass ihr die Männer nichts anhaben konnten. Aus dem Wasser unter ihr reckte sich ein Arm empor, als wollte er sie willkommen heißen.
In der Mitte prangte das größte Bild, auf dem eine Göttin mit langen, geflochtenen Haaren und reichem Halsschmuck zu sehen war. Sie trug eine Krone aus Hörnern auf dem Kopf, zwischen denen eine Sonne prangte. Nirgendwo standen mehr Kerzen als hier, kein Bildnis war heller erleuchtet.
Die Adeptinnen waren um den Tisch versammelt, auf dem eine sehr große, mit Wasser gefüllte Schale stand. Eine weiß gekleidete Frau am Kopfende hob die Hände und begann in feierlichem Ton zu sprechen.
»Oh Isis, Beschützerin des Lebens, Herrin über Geburt, Tod und Wiederkunft, Hüterin des Wassers, hilf allen, die sich auf den Weg zu dir begeben. Empfange sie und führe sie zum Licht, wie du es mit deinem Bruder und Gemahl Osiris tatest, den du auf magische Weise aus dem Tod errettet hast, worauf das Reich der Dunkelheit entstand. Oh Isis, schlage für uns die Brücke zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Tod und Leben, wie du es für ihn getan hast. Lass uns aus dem Reich der Nacht ins göttliche Licht eingehen.«
Alle senkten die Köpfe und stimmten einen monotonen Gesang an, aus dem keine Wörter herauszuhören waren. Die Melodie schwoll wellenförmig an und ab und erinnerte an die Flüsse, die an den Wänden abgebildet waren. Sie hielten einander an den Händen und beschrieben damit einen Kreis, eine endlose Kette der Kraft, die sich von der Hohepriesterin ausbreitete und die Adeptinnen durchdrang. Diese Kraft war wie der Fluss, in dem sich die Göttin offenbarte, und die Hohepriesterin wiederum verkörperte die Göttin hier in ihrer Mitte.
Annas Herz klopfte heftig, wie immer, wenn sie der Hohepriesterin begegnete, und sie war von Ehrfurcht erfüllt. Das Wort traf es sehr gut, denn in ihre Verehrung mischte sich auch Furcht, und sie konnte sich der Ausstrahlung dieser Frau kaum entziehen.
Man gelangte nur ins Licht, wenn man den schweren Weg wählte, das Reich der Nacht durchquerte und sich mit dem vereinte, das man verehrte. Es erschien Anna klar und überzeugend. Sie staunte, wie wundersam sich alles ineinanderfügte, was Außenstehenden als Hokuspokus oder Blasphemie erscheinen mochte. Nachdem sie die Lehre verinnerlicht hatte, war ihr bewusst geworden, dass sie nur ihr Herz und ihren Geist öffnen musste, um sie zu verstehen. Und hatte man die Lehre erst verstanden, das Licht gesehen und in sich aufgenommen, wurde die Welt ganz hell und leicht.
5
Alfie zog die Jacke enger um sich und eilte zu den steinernen Stufen, die ans Wasser hinunterführten. Der Spätnachmittag war ziemlich kühl für Juli, und er war dankbar für die Jacke aus dickem, dunkelblauem Barchent. Sein Bruder Jamie, der seit drei Jahren zur See fuhr, hatte sie ihm mit den Worten »Damit du mich nicht vergisst« vermacht. Im Sommer schwitzte er ganz schön darin, wagte es aber nicht, sie irgendwo abzulegen. Sie war Alfies kostbarster Besitz, und wer wie er in Schuppen und Kellern hauste, wurde schnell bestohlen.
Er schaute nicht nach links zum Queen’s Head Pub, durch dessen Fenster lautes Stimmengewirr und Gläserklirren drangen. Er mied die Stelle, seit ihn ein betrunkener Kahnführer dort verprügelt hatte. Der Mann hatte schwankend an der Hauswand gestanden und auf die Stufen gepisst und sich von Alfie belästigt gefühlt, der hinter ihm vorbeigegangen war. Zum Glück hatten der Wirt und andere Gäste eingegriffen. Einer hatte ihm sogar ein Taschentuch gereicht, aber die Erinnerung reichte aus, um seine Schritte zu beschleunigen.
Alfie schaute beschwörend auf den Fluss, als könnte er die Flut zwingen, sich zurückzuziehen und das Ufer freizugeben, mit dessen Hilfe er seinen Lebensunterhalt verdiente. Alfie kannte die Themse, ihre Gewohnheiten und Launen, als wäre sie ein lebendes Wesen. Das auflaufende Wasser brauchte vier bis fünf Stunden, bis es seinen höchsten Stand erreicht hatte, aber es dauerte sechs bis neun Stunden, bis die Ebbe am tiefsten Punkt angelangt war. Und den erwartete er ungeduldig.
Alfie war ein guter Schwimmer und stürzte sich zuweilen ins Wasser, wenn etwas vorbeitrieb, das er zu Geld machen konnte – Holz, Leinwand oder Stücke von Tauen und Seilen. Doch der Fluss war tückisch, selbst wenn man mit ihm vertraut war, und daher zog er es vor, im Uferschlick nach Schätzen zu suchen.
Er schaute sich um. Er war allein am Strand und würde es hoffentlich auch bleiben. Alfie wusste, dass themseabwärts, dort, wo sich die gewaltigen Docks wie eine bizarre, von eisernen Kränen beherrschte Stadt ausbreiteten, mehr zu verdienen war. Dort gab es Ladeplätze und Werften, in denen große Schiffe entladen und repariert wurden. Da fielen nicht nur Taue und Holzspäne herab, sondern auch Eisen und Kupfer, die man zu Geld machen konnte. Auch erzählte man sich, dass junge Strandsucher sich heimlich auf Schiffe und Kähne schlichen und ihre Beute ans Ufer warfen, um sie später abzuholen. Und wer besonders mutig war, stopfte sich gleich vor Ort die Taschen voll. Wenn Schiffer oder Polizei sie erwischten, sprangen die Jungen einfach in den Fluss und schwammen behände ans sichere Ufer.
Im Hafen gab es also viel zu holen. Darum drängten sich dort die Strandsucher, sodass die Konkurrenz größer und der Umgang rauer war. Alfie aber hatte seine Nische in Mortlake gefunden und in drei Jahren ein Häufchen Münzen an einem Ort versteckt, den niemand außer ihm kannte.
Jamie hatte von einem angesehenen Händler für Schiffsbedarf erzählt, der in jungen Jahren als Strandsucher angefangen und so viel Geld zurückgelegt hatte, dass er mit siebzehn einen eigenen Laden eröffnen konnte. Heute sei er mit der Tochter eines Rechtsanwalts verheiratet und ein gemachter Mann. Ob das stimmte, wusste Jamie nicht, aber Alfie hatte die Geschichte nicht vergessen. Die Anwaltstochter reizte ihn nicht so sehr, wohl aber der Gedanke, ein angesehener Kaufmann zu werden, der ein schönes Haus bewohnte und sich von niemandem etwas sagen lassen musste. Vorher wollte er aber selbst zur See fahren.
Eine Taube flatterte flügelschlagend neben ihm auf und riss ihn aus seinen Träumereien. Endlich – das Wasser war abgelaufen, das schlammige Ufer mit seinen Schätzen wartete auf ihn.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er fünf Kerzenstummel, die in der Erde steckten, umgeben von verwischten Fußabdrücken. Verkaufen konnte er sie nicht, aber sie waren nicht ganz heruntergebrannt – vermutlich hatte der Wind sie ausgeblasen – und würden ihm in seinem dunklen Schuppen ein wenig Licht spenden.
Alfie steckte sie in den Segeltuchbeutel, den er von seinem ersten Verdienst hatte nähen lassen und der praktischer war als die Körbe, die viele Strandsucher verwendeten. Er trug den Beutel mit dem breiten Träger quer vor dem Körper und hatte so die Hände frei, um in Schlamm und Schlick zu wühlen.
Weiter links ragte die Brauerei aus rötlich-braunem Backstein empor, wo er gelegentlich Holz und einmal sogar eine Flasche Bier erbeutet hatte; daneben standen die Schuppen des Kohlekais, wo immer etwas abfiel, kleine Stückchen, die er an Privatleute verkaufen konnte. Allerdings herrschte dort meist viel Betrieb, und er musste sich verstecken und den richtigen Moment abpassen, um etwas zu erwischen. Einmal hatte ihn ein Arbeiter bemerkt und mit einer unwirschen Handbewegung aufgefordert, seinen Beutel zu füllen und dann rasch zu verschwinden. Aber das kam selten vor. Zudem brachte Kohle nicht viel ein.
Heute wollte Alfie sein Glück flussabwärts versuchen, wo das Ufer grüner war und prächtige Häuser standen. Er schlenderte über den Strand, die Augen auf den Boden geheftet.
Etwas schimmerte auf, als sich die untergehende Sonne darin brach. Alfie bückte sich – ein Stückchen Kupfer, nicht groß, aber es brachte einen besseren Preis als Eisen. Er rieb es am Ärmel, bis es glänzte, und steckte es in seinen Beutel. Über ihm kreisten Möwen, ihr Krächzen klang um diese Tageszeit besonders laut.
Alfie nahm das Kupfer als gutes Zeichen. War dies der Tag, an dem er endlich mehr finden würde als nur Leinwandfetzen oder Kohlebrocken?
Nun, er fand tatsächlich mehr.
Doch waren es auch diesmal keine Schätze, sondern eine tote Frau.
Hätte sie auch nur ein bisschen weiter flussaufwärts gelegen, wären die Schauerleute, die die Kohle entluden, oder die Arbeiter aus der nahen Brauerei auf sie gestoßen. So aber lag sie verlassen und zusammengekrümmt da, ein Häufchen Mensch mit durchweichten Kleidern und nassen, verknoteten Haaren, die an einen Klumpen Tang erinnerten.
Alfie stand reglos vor ihr. Seine Kehle war so eng, dass er nicht schlucken konnte. Er arbeitete seit drei Jahren als Strandsucher, war allein auf der Welt und fürwahr nicht zimperlich, wenn es ums Überleben ging. Er hatte aus fremden Kellern Äpfel und Einmachgläser gestohlen und einmal sogar Stiefel, die ihm nicht passten und die er für einen guten Preis verkauft hatte. Er hatte schon mit sechs Jahren mehr über Männer und Frauen gewusst als andere mit dreizehn, nicht zuletzt, weil seine Mutter wechselnde »Freunde« bei sich beherbergte.
Auch hatte jeder, der am Fluss lebte, von Leichen gehört, die ans Ufer geschwemmt wurden, sich in Tauen und Ankerketten verfingen oder von Rudern und den Stangen der Stechkähne aufgestört und nach oben getrieben wurden. Alfie hatte mit einem wohligen Schauer gelauscht, wenn Jamie oder die Schauerleute die Geschichten blumig ausgeschmückt erzählten.
Aber es war etwas anderes, selbst einen toten Menschen zu finden.
Er suchte einen dicken Stock, legte seinen Beutel ab und trat vorsichtig näher. Mit bloßen Händen würde er sie nicht anfassen, auf gar keinen Fall. Also beugte er sich vor, schob den Stock unter den Körper, wollte ihn als Hebel nutzen, um die Tote umzudrehen.
Warum war sie so schwer?
Alfie geriet ins Schwitzen, zog die warme Jacke aus und warf sie über seinen Beutel. Er schob sich die Haare aus der Stirn und machte sich erneut ans Werk. Als er den Stock zur Hälfte unter die Frau geschoben hatte, drückte er aufs andere Ende und schaffte es, die Tote umzudrehen. Sie klatschte schwerfällig auf den Rücken, die Arme ausgebreitet wie die einer Lumpenpuppe.
Er richtete sich auf und kniff die Augen zu, weil er ihr nicht ins Gesicht sehen wollte. Er fürchtete, sie könnte ihn später im Traum verfolgen. Jamie hatte mal von einem Mann erzählt, dem Krebse alle Finger und Zehen und noch Schlimmeres abgefressen hatten.
Er fragte sich, ob sie aus Versehen ins Wasser gefallen war oder ob sie sich womöglich umgebracht hatte. Die Bibel kannte er nicht gut, aber er wusste, dass es eine Sünde war, sich selbst zu töten. Doch so, wie sie dalag, konnte er nicht erkennen, warum sie gestorben war.
Alfies Herz schlug heftig. In der Bibel stand auch, dass Gott die Menschen prüfte, selbst wenn er das nicht recht verstanden hatte. Sollte das hier eine Prüfung sein? Wäre es besser, die Tote nicht weiter anzurühren und Hilfe zu holen? Sollte er für sie beten? Ihm fiel kein Gebet ein. Und außerdem … wenn sie ohnehin schon gesündigt hatte, konnte er ihr nicht mehr helfen. Dann war es sicher nicht verboten, sie genauer anzusehen – nicht das Gesicht, aber die Hände. Nur für den Fall, dass sie Ringe trug. So konnte man vielleicht herausfinden, wer sie war, und ihre Familie verständigen.
Dann gab er sich einen Ruck. Mach dir nichts vor, Alfie Clark. Du scherst dich gar nicht um ihr Seelenheil. Du willst nur wissen, ob bei ihr etwas zu holen ist.
Beruhigt von so viel Ehrlichkeit, kniete er sich hin und griff vorsichtig nach ihrer linken Hand. Alle Finger waren da. Der Handrücken war abgeschürft, die unversehrte Haut weiß, runzlig und aufgequollen. Kein Ring. Kurze Nägel.
Die rechte Hand sah ähnlich aus.
Alfie war mehr als einmal in der Themse geschwommen und wusste um die Kraft der Strömung. Vermutlich war die Tote über das raue Flussbett geschleift worden.
Mit seiner linken Hand deckte er ihr Gesicht ab und betrachtete dann den Körper. Sie war gut gekleidet, soweit er das erkennen konnte. Von dem hellblauen Kleid waren einige Knöpfe abgerissen, Korsett und Hemd lugten durch den Stoff. Alfies Augen wanderten verstohlen nach oben – und dann sah er es.
Etwas schimmerte am Hals, in der kleinen Vertiefung zwischen den Schlüsselbeinen. Der oberste Kragenknopf fehlte, und wo der Stoff aufklaffte, lag ein goldgefasster grüner Stein.
Da hörte er Stimmen.
Alfie blickte auf und entdeckte zwei Männer mit einem großen Hund, die auf ihn zukamen. Sie waren noch etwa hundert Meter entfernt.
Er überlegte rasch, dachte an Gott und die Frau, die tot vor ihm auf dem Strand lag und der er nicht mehr helfen konnte. Aber sich selbst konnte er helfen.
Rasch überwand er seinen Ekel und tastete auf der kalten, feuchten Haut mit beiden Händen nach der Schließe. Er löste die Kette, zog sie unter dem Hals der Frau hervor und steckte sie rasch in seinen Beutel.
Dann stand er auf, hängte sich den Beutel um und rannte mit rudernden Armen auf die beiden Männer zu.
»Hilfe! Zu Hilfe! Hier liegt eine tote Frau!«
6
»Endlich sehen wir uns einmal wieder – Louisa, Gabriel, Valentine, Marcus, nicht so übermütig!«, rief Georgia Osborne, lachte aber dabei, sodass die Ermahnung ungehört verhallte. »Verzeihen Sie, meine Liebe, hier fehlt noch immer Ihre energische Hand.«
»Ich habe mich nie als besonders energisch empfunden«, sagte Charlotte lächelnd.
»Oh, doch, Sie besitzen eine sanfte Bestimmtheit, wie eine stählerne Klinge, die mit Samt umhüllt ist. Genau daran fehlt es mir. Natürlich habe ich eine neue Gouvernante – die dritte nach Ihnen, um ehrlich zu sein –, aber sie sind entweder zu nachgiebig oder allzu hart mit meinen Kindern. Beides kann ich nicht dulden.«
Charlotte hatte eineinhalb Jahre bei den Osbornes gearbeitet, nachdem sie ihre erste Stelle in England aufgegeben hatte. Ihre damalige Schülerin, die kleine Emily Clayworth, hatte mit ihrem Vater eine lange Auslandsreise angetreten, auf der sie die beiden nicht begleiten konnte. Sie war verzweifelt gewesen, weil sie befürchtet hatte, sie müsse nach Deutschland zurückkehren und ihrer Mutter eingestehen, dass sie es nicht geschafft hatte, sich in England ein neues Leben aufzubauen.
Dann aber hatte Tom Ashdown sie zum Abendessen ausgeführt, sie aus seinen unergründlich dunklen Augen angeschaut und ihr wortlos eine Visitenkarte über den Tisch geschoben.
Mrs. Georgia Osborne
51, Belgrave Square
London SW1
»Wer ist das?«
»Eine alte Bekannte aus der Zeit, als sie noch nicht Mrs. Osborne war.« Dabei hatte er verschmitzt gelächelt.
Wie sich herausstellte, hatte Mrs. Osborne früher Georgia de Vere geheißen und große Erfolge auf der Bühne gefeiert. Ihr Haus war mit Theaterplakaten geschmückt, und in einer Vitrine standen Fotografien, die Mrs. Osborne in jüngeren Jahren und einer Vielzahl von historischen und exotischen Kostümen zeigten.
»Sie sind ja ganz in Gedanken, liebe Charlotte. Bedrückt Sie etwas?«
Sie blickte hoch. »Mir fiel nur gerade ein, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Nachdem ich Ihr Haus verlassen hatte, wusste ich sofort, dass es für mich nur diese eine Stelle gab.«
Mrs. Osborne sah sie mit gespielter Entrüstung an. »Und doch haben Sie sie so schnell wieder aufgegeben.«
»Es gab nur eine einzige Aufgabe in London, die mich noch mehr gereizt hat.«
»Ach, nun werden Sie nicht rot. Tom ist ein wunderbarer Mann. Er kommt hinter meinem Geoffrey gleich an zweiter Stelle.« Sie hielt inne. »Gut, er ist natürlich nicht so reich, aber äußerst amüsant.«
Charlotte lächelte. Bei einer anderen Frau hätten die unverblümten Worte unmöglich gewirkt, doch Georgia Osborne war in jeder Hinsicht außergewöhnlich und überaus charmant. »Ja, das ist er«, sagte sie. »Mit ihm verheiratet zu sein ist niemals langweilig.«
»Das glaube ich gern. Zumal Sie noch keine Kinder haben, die Ihnen die Langeweile vertreiben. Marcus, wie oft soll ich dir sagen, dass die Rosen kein gegnerischer Ritter sind?« Sie seufzte. »Ich muss mich wohl doch um eine neue Gouvernante bemühen, das Kindermädchen ist überfordert.«
Sie plauderten über die letzte Theatersaison und dass die verhassten Tournüren endgültig aus der Mode waren. »Ich habe meiner Schneiderin gesagt, sie solle bei den Keulen-Ärmeln nicht übertreiben. Mit dem, was sie fabriziert hatte, sah ich aus wie ein Preisboxer.«
Charlotte nickte verständnisvoll. »Manchmal wünsche ich mir, es gäbe Kleider ganz ohne Korsett, die einfach an mir herabfließen wie ein Nachthemd. So wie zu Napoleons Zeit. In denen konnte man sogar atmen.«
Georgia grinste anzüglich. »Und sie verbargen fast nichts, was den Herren sehr gefallen haben dürfte. Leider kam man auf die Idee, Frauen wieder in Rüstungen zu stecken. Aber ich prophezeie Ihnen, selbst im übertragenen Sinne wird das nicht so bleiben. In Neuseeland dürfen Frauen seit dem letzten Jahr wählen. Die Zeiten ändern sich.« Dann hielt sie inne und schaute ihre Freundin prüfend an. »Hoffentlich habe ich Sie mit meiner Bemerkung über Kinder nicht gekränkt. Sie kennen mich ja, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist.«
»Seien Sie unbesorgt, es hat mich nicht verletzt. Bei manchen Paaren dauert es eben etwas länger. Tom und ich sind glücklich miteinander.«
Sie hätte es nicht ernster meinen können.
Tom begab sich nach dem Essen ins Arbeitszimmer.
»Darf ich mich dazusetzen?«, fragte Charlotte. »Ich soll für Georgia eine Liste deutscher Märchen zusammenstellen. Sie sucht eine neue Gouvernante, ihre ist schon wieder weggelaufen.«
Er nickte, wenn auch nicht so freudig, wie sie erwartet hatte. Es kam ihr vor, als wollte er lieber allein sein, sie aber nicht kränken, indem er es offen sagte.
Sie lehnte sich zurück und schloss für einen Moment die Augen. Tom und ich sind glücklich miteinander, hatte sie zu Georgia gesagt, und das waren sie. Aber es gab auch jene Momente, in denen sie spürte, dass etwas zwischen ihnen stand, in denen Tom still wurde und sich zurückzog, statt ihr anzuvertrauen, was ihn bewegte. Sie erinnerte sich an den sonderbaren Augenblick bei ihrem Fest, als er sie mit den Gästen durchs Haus geschickt hatte und allein im Wohnzimmer geblieben war. Er hatte nie erklärt, was damals mit ihm geschehen war.
»Ich habe Karten für Samstagabend, das neue Stück von Jones«, sagte Tom unvermittelt. »Wollen wir gemeinsam hingehen?«
»O ja, sehr gern. Ist das der, über den Wilde gesagt hat, es gäbe drei Regeln fürs Stückeschreiben? Die erste bestünde darin, nicht wie Henry Arthur Jones zu schreiben, und Regel zwei und drei ebenfalls?«
Tom drehte sich lachend zu ihr um. »Genau der.«
Charlotte wurde von innen warm. Die seltsame Stimmung, die sie vorhin gespürt hatte, war verflogen. »Bei Georgia ging es wieder wild zu«, sagte sie amüsiert. »Ich frage mich, wie sie so gelassen bleiben kann, wenn um sie herum vier Kinder toben. Demnächst sogar fünf.«
Sie wusste nicht, was sie aufblicken ließ, es war kein Geräusch, eher eine Ahnung. Tom saß steif da, den Rücken ganz gerade, den Federhalter reglos in der Hand, ohne etwas zu schreiben. Sie wollte etwas sagen, doch sein ganzer Körper schien sie zurückzuweisen. Das Feuer wärmte sie nicht mehr, und so stand sie auf und verließ lautlos den Raum.
Er schämte sich, weil er Charlotte zurückwies, statt mit ihr zu sprechen. Doch er wusste nicht, wie er das, was in ihm vorging, in Worte fassen sollte.
Er erinnerte sich an das Gespräch über König Lear, das eine seltsame Unruhe in ihm ausgelöst hatte. Seither schien ihn das Thema zu verfolgen. Charlotte war sichtlich verstört vom Tee bei der Nachbarin gekommen, die sie in taktloser Weise auf ihre Kinderlosigkeit angesprochen hatte. Und vorhin hatte sie erwähnt, wie munter es bei Georgia Osborne zuging und dass sie ihr fünftes Kind erwartete. Hatte Sehnsucht in ihrer Stimme mitgeschwungen, oder bildete er sich das nur ein?
Etwas schnürte ihm den Atem ab, und er wollte lieber nicht daran denken, was der Grund dafür sein mochte. Denn es gab Fragen und Ängste, die sich, einmal freigesetzt, nicht mehr einfangen ließen.
7
Alfie fühlte sich unwohl und rutschte auf dem glatten Holzstuhl hin und her. Er hätte davonlaufen sollen, statt den beiden Männern, die an der Themse spazieren gingen, von seinem Fund zu berichten. Er hätte einfach kehrtmachen sollen, von hinten hätten sie ihn nicht erkannt. Und die tote Frau hätte sie abgelenkt, bis er verschwunden war. Aber da war natürlich noch der Hund. Er war nicht an der Leine gewesen. Der hätte ihn jagen und beißen können, und dann wäre er verdächtig und verletzt gewesen. Nein, es war wohl besser so.
Dennoch gefiel es ihm nicht, dass er jetzt auf der Polizeiwache saß. Der Sergeant hatte seinen Namen aufgeschrieben und wollte wissen, wie alt er war und wo seine Eltern seien.
»Zwölf. Und meine Eltern sind gestorben.«
»Du bist also ganz allein auf der Welt?«
»Nein, ich hab einen großen Bruder, der zur See fährt. Wenn er zurückkommt, nimmt er mich mit auf sein Schiff. Das hat er mir versprochen.«
»Wo wohnst du denn?«
Als er den Schuppen erwähnte, sah ihn der Sergeant zweifelnd an. »Eigentlich müsste ich dich ins Waisenhaus bringen.« Doch dann bemerkte er Alfies erschrockenes Gesicht und fügte hinzu: »Na schön, ich werde ein Auge zudrücken. Du bist also Strandsucher?«
»Ja, Sir. Ich sorge für mich«, erwiderte er stolz.
»Dann erzähl mir mal, was geschehen ist. Von Anfang an. Ich will genau wissen, was du gefunden und wen du gesehen hast, verstanden?«
Er nickte. »Ich hab bei der Treppe am Queen’s Head angefangen. Ich lauf mal flussaufwärts in Richtung Brauerei, dann wieder flussabwärts. Diesmal bin ich in Richtung Barnes gegangen.«
»Und ist dir unterwegs was aufgefallen? Bevor du die Tote entdeckt hast?«
»Hm, nichts Besonderes. Ein Stück Kupfer habe ich gefunden. Ach ja, und die Kerzen, aber die sind nichts wert. Die habe ich für mich behalten.«
»Welche Kerzen?«
»Na ja, da waren fünf Kerzenstummel am Ufer, die steckten in der Erde. Zwei oder drei konnte man noch gebrauchen.«
»Findest du öfter Kerzen?«
»Nein, nie. Wer geht schon mit Kerzen an den Fluss? Da weht immer ein Wind und bläst sie aus.«
»Und du hast niemanden gesehen, der sie dort gelassen haben könnte?«
Alfie verstand nicht, was der Sergeant daran so interessant fand. Die tote Frau war doch wohl wichtiger.
»Nein. Da waren Fußabdrücke, aber die waren ganz verwischt. Da laufen immer Leute rum.«
»Dann erzähl mir, wie du die Frau gefunden hast.«