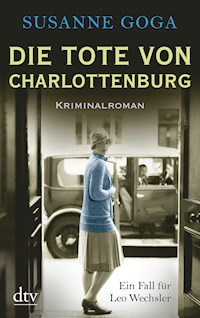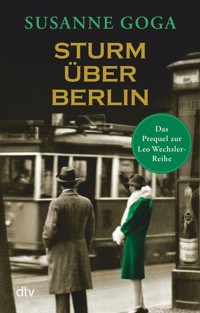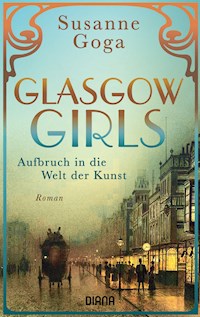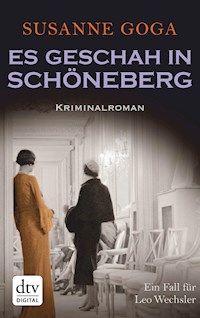9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leo Wechsler
- Sprache: Deutsch
Der neunte Fall für Kommissar Leo Wechsler Februar 1929: In einer Grünanlage am Ufer des Gewässers Blanke Hölle wird ein Mann ermordet aufgefunden. Man identifiziert ihn als Dr. Ferdinand Clasen, der in der Nähe in einem Haus wohnte, das im Volksmund Spukvilla genannt wird. Es finden sich Hinweise darauf, dass Dr. Clasen sehr freigiebig mit der Verordnung von Medikamenten war, solange das Honorar stimmte. Ein Mordmotiv? Die Erfolgsserie im Berlin der 1920er-Jahre geht weiter: Leo Wechslers bisher kniffligster Fall. Eine weitere Spur führt Oberkommissar Leo Wechsler zum Kloster vom Guten Hirten im benachbarten Marienfelde, das ein Erziehungsheim für Mädchen unterhält. Clasen hatte dort einen Kollegen bei der ärztlichen Versorgung unterstützt. Gerade ist die junge Erika von dort verschwunden, die von ihm behandelt werden sollte. Doch wo ist das Mädchen jetzt und könnte sie eine Mörderin sein? Glamourös, historisch, atmosphärisch! Alle Bände der Leo Wechsler-Reihe: Band 1: Leo Berlin Band 2: Tod in Blau Band 3: Die Tote von Charlottenburg Band 4: Mord in Babelsberg Band 5: Es geschah in Schöneberg Band 6: Nachts am Askanischen Platz Band 7: Der Ballhausmörder Band 8: Schatten in der Friedrichstadt Band 9: Der Teufel von Tempelhof
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Februar 1929. Die Blanke Hölle ist ein Gewässer am Rande von Tempelhof, um das sich unheimliche Legenden ranken. Es hat hier schon viele Todesfälle gegeben. Jetzt wird der Arzt Ferdinand Clasen ermordet dort aufgefunden – er bewohnte in der Nähe ein Haus, das im Volksmund »Spukvilla« genannt wird. Doch Oberkommissar Leo Wechsler hält nichts von Geistererzählungen und konzentriert sich lieber auf die Realität. Der Arzt scheint seltsame Heilmethoden angewandt zu haben. Und es gibt eine Spur, die zum Kloster Vom Guten Hirten im benachbarten Marienfelde führt, das ein Erziehungsheim für Mädchen unterhält. Gerade ist die junge Erika von dort verschwunden. Hat sie etwas mit dem Mordfall zu tun?
Von Susanne Goga sind bei dtv außerdem erschienen:
Leo Berlin
Tod in Blau
Die Tote von Charlottenburg
Mord in Babelsberg
Es geschah in Schöneberg
Nachts am Askanischen Platz
Der Ballhausmörder
Schatten in der Friedrichstadt
Susanne Goga
Der Teufel von Tempelhof
Für Axel, Felix und Lena – ihr seid die Besten
Prolog
Ferdinand Clasen war ein Mann mit Prinzipien. Als Arzt hielt er viel von körperlicher Ertüchtigung, die er nicht nur seinen Patienten empfahl, sondern der er sich auch selbst unterzog. Jeden Abend und bei jedem Wetter unternahm er Punkt sieben einen Spaziergang, vielmehr einen strammen Marsch, bei dem er unbeirrt seine Runden drehte. Kam ihm jemand entgegen, lüpfte er den Hut und grüßte, ohne jedoch stehen zu bleiben. Für Plaudereien auf offener Straße hatte er nichts übrig, er zog es vor, seinen Patienten nur in der Praxis zu begegnen.
Er ließ sich von der feuchtkalten Februarluft nicht abschrecken, schlang einen Kaschmirschal um den Hals, setzte seinen Hut auf, zog den Kamelhaarmantel über und verließ das Haus.
Clasen war ein Gewohnheitsmensch und wich selten von seiner bevorzugten Strecke ab. Auch an diesem Abend schritt er auf vertrauten Wegen durch die wenig belebte Gegend. Es war Freitag, und wer seinen Spaß haben wollte, trieb sich nicht in den Wohnstraßen von Tempelhof herum, sondern in einem jener Amüsierbetriebe, die Clasen prinzipiell nicht aufsuchte.
Er liebte das Theater und die Oper, die Vergnügungen des einfachen Volkes waren ihm schon immer zuwider gewesen. Wildes Herumgehopse zu atonaler Musik auf kreischenden Instrumenten, wie es heutzutage modern war, entsprach nicht seinem Geschmack.
Clasen schritt kräftig aus, um die Kälte zu vertreiben, und bog in die Albionstraße ein. Er musste immer schmunzeln, wenn er das Straßenschild sah, weil dem ach so unfehlbaren preußischen Staat hier ein peinlicher Fehler unterlaufen war. Es hieß, man habe die Straße ursprünglich nach Alboin, König der Langobarden, benennen wollen, dabei aber zwei Vokale verwechselt. Vor allem während des Krieges hatte man verzweifelt versucht, den Namen zu ändern, da Albion eine alte Bezeichnung für Großbritannien war, die so gar nicht in die von Patriotismus durchdrungene Reichshauptstadt passte. Vergeblich, die Straße hieß bis heute so.
Als Clasen sich dem verwilderten Platz Q näherte – Namen waren wirklich nicht die Stärke der preußischen Verwaltung –, herrschte rundum Stille. Hier standen keine Häuser, in die Gegend verirrte sich abends kaum jemand. Es hieß, die Ostseite des Platzes solle demnächst mit städtischen Wohnungen bebaut werden, aber bisher war davon nichts zu sehen.
Tagsüber spielten hier bisweilen Kinder, suchten Frösche oder warfen Steine in den »Pfuhl«, einen Teich, der wie ein dunkel glänzendes Loch inmitten der Wiese lag. Doch um diese Zeit war kein Kind mehr auf der Straße. Nicht im Winter, nicht bei Dunkelheit, nicht an diesem Ort, um den sich alte Legenden rankten, die den einfachen Leuten Angst einjagten. Nicht umsonst hieß der Pfuhl im Volksmund »Blanke Hölle«.
Clasen beschäftigte sich mit germanischer Mythologie und hatte einige Bücher darüber zusammengetragen, wäre aber nie so weit gegangen zu glauben, dass dieses Gewässer Menschenopfer forderte, wie alteingesessene Tempelhofer munkelten. Allerdings wünschte er sich bisweilen, die Gegend um den Pfuhl trüge einen weniger prosaischen Namen als Platz Q. Welcher Bürokrat dachte sich so etwas aus? Das besaß keine Romantik, atmete nicht den Zauber der Geschichte. »Germanenplatz« fände er da schon passender.
Er blieb stehen, die Hände in den Manteltaschen vergraben, und atmete tief. Dann fühlte er seinen Puls, der langsam und regelmäßig ging. Er war nicht mehr der Jüngste, aber streng darauf bedacht, sich seine körperliche Frische zu bewahren. Darum trank er nur in Maßen Alkohol, schlief ausreichend und bewegte sich. Irgendwo bellte ein Hund, anderenfalls hätte er glauben können, er sei allein auf der Welt.
Er ging zufrieden weiter, war in Gedanken schon bei dem Gläschen alten Kognaks, das er sich an kalten Abenden als Stärkung gönnte. Kurz bevor er seine Villa am Friedensplatz erreichte, hörte er ein Geräusch hinter sich. Er blieb stehen und drehte sich um, konnte aber niemanden sehen. Er horchte kurz und ging kopfschüttelnd weiter. Sollte ihn der Pfuhl mit seinen Legenden tatsächlich nervös gemacht haben? Höchste Zeit für einen guten Tropfen.
Lächelnd steckte Clasen den Schlüssel ins Türschloss und schaute noch einmal auf den runden Friedensplatz mit seinen Beeten und Bäumen, der im Sommer einen hübschen Anblick bot. Nun aber lag er dunkel und verlassen da. Nur eine Katze huschte im Laternenlicht durchs Gebüsch.
1
»Ilse, das Geld kannst du dir sparen«, hatte Leo Wechsler zu seiner Schwester gesagt. »Macht euch lieber ein nettes Wochenende an der Ostsee. Also im Frühjahr, wenn das Wetter besser ist.«
Inzwischen bereute er seine Worte. Obwohl Ilse die meisten Möbel weggegeben hatte, war immer noch genug zu schleppen übrig. Und da nun der Handkarren statt eines teuren Umzugsunternehmens zum Einsatz kam, musste er kräftig mit anpacken. Sein Schwager Richard hatte geholfen, gab aber am Abend ein Konzert mit der Staatskapelle und war vorhin mitsamt seinem Cello in Richtung Unter den Linden verschwunden.
»Brauchst du die Kommode wirklich noch?«, fragte er Ilse, die neben der Wohnungstür stand. Sie nickte entschlossen.
»Die ist von unseren Eltern, Leo. Eines der wenigen Stücke aus der alten Wohnung, die wir behalten haben.«
Seufzend gab er Georg ein Zeichen. Sein Sohn war ebenfalls als Möbelpacker rekrutiert worden. Sie schleppten das gute Stück die drei Etagen hinunter und hievten es auf den Karren, der vor der Haustür stand. Der Weg von Alt-Moabit, wo Ilse bis jetzt gewohnt hatte, über die Kirchstraße und die Brücke zum Holsteiner Ufer war nicht weit, aber Leo hatte unterschätzt, wie schwer der Karren beladen sein würde. Und nun fiel ihm siedend heiß ein, dass Richard im zweiten Stock wohnte, was weitere Treppen bedeutete.
»Na, tut’s dir schon leid?«, fragte Clara, die mit einer Kiste hinter ihm aus dem Haus kam. »Ich hab dir ja gesagt, es ist mehr, als du glaubst.«
Er schnitt eine Grimasse. »Das ist Teil unseres Hochzeitsgeschenks. Da kann ich schlecht einen Rückzieher machen.«
Sie hob die Kiste auf den Karren, lehnte sich dagegen und lachte.
»Was ist denn jetzt schon wieder?« Leo wurde allmählich ungehalten.
»Ich zitiere meinen Ehemann: ›Ilse und Richard, ich schenke euch zwei Dinge zur Hochzeit – den Umzug und dass ich nicht auf der Blockflöte spiele.‹«
Jetzt musste auch Leo lachen. Natürlich war das nicht alles gewesen, sie hatten auch ein »ordentliches« Hochzeitsgeschenk in Form eines silbernen Sektkühlers für Ilse und Richard gehabt, aber seine Ankündigung war mit großem Beifall aufgenommen worden. Die Hochzeit war leicht und fröhlich gewesen, alle hatten viel gegessen und getrunken und getanzt, es wurden Reden gehalten, Kollegen von Richard hatten ihre Instrumente dabei und gaben ein hübsches Ständchen. Leo hatte befürchtet, die Jahreszeit könnte ein wenig auf die Stimmung drücken – doch alle schienen umso bemühter, sich so gut wie möglich zu amüsieren und die Tatsache auszugleichen, dass im Februar statt im Mai gefeiert wurde.
Er warf einen Blick auf Ilse, die mit einem Butterbrot aus der Haustür kam und es ihm reichte. »Du siehst aus, als könntest du nach der Kommode eine Stärkung gebrauchen.«
Er nahm das Brot dankbar entgegen und biss hinein. »Nun, Frau Dohm, jetzt beginnt ein neues Leben.«
Seine Schwester stieß ihm gutmütig gegen den Arm. »Du hörst dich an wie eine alte Tante am letzten Schultag.«
Leo wurde ernst. »Ehrlich, Ilse – ich freue mich für euch.«
Sie lächelte ihn an. »Deine Rede war sehr schön.«
»Ich hab auch seit Weihnachten dran gesessen«, sagte Leo grinsend, schob sich das restliche Brot in den Mund und gab Georg ein Zeichen. Dann zog er die Pulloverärmel herunter, setzte seine alte Schirmmütze auf und packte einen der Schubkarrengriffe.
Als der Karren losrollte, sagte Ilse: »Der Herr Oberkommissar als Möbelpacker, dass ich das noch erleben darf.«
Leo drehte sich um und rief über die Schulter: »Nimm lieber dein Rad und fahr los, damit du vor uns da bist und die Türen aufmachen kannst!«
In der Kirchstraße hupte ein Auto, weil sie den Verkehr aufhielten, doch Leo ließ sich nicht beirren. Der Karren rumpelte über das Kopfsteinpflaster, einmal musste er hastig nach einer Kiste greifen, die herunterzurutschen drohte. Aber das störte ihn nicht, weil er es für Ilse tat.
»Wäre es dir peinlich, wenn dich jemand erkennt?«, fragte Georg unvermittelt, und Leo sah ihn überrascht an.
»Warum sollte es?«
»Na ja, du bist doch Beamter, ein Oberkommissar, die machen so was doch sonst nicht.«
Leo seufzte. »Weißt du, Georg, es hat mich nie gekümmert, ob irgendwer irgendwas macht, weil es sich so gehört oder man es von ihm erwartet. Ich mache, was ich für richtig halte. Und es erscheint mir richtig, Ilse und Richard Geld zu sparen, von dem sie sich was Schönes gönnen können. Umzugsunternehmen sind reichlich teuer.«
»Hm. Verstehe.« Ganz überzeugt wirkte Georg nicht.
»Oder wäre es dir peinlich, wenn uns jemand sieht?«
Sein Sohn zuckte mit den Schultern. »Eigentlich nicht. Aber ein paar Jungs reden immer so groß daher, von wegen Dienstboten und dass ihre Mütter nicht im Haushalt arbeiten müssen.«
Das wurde ja immer besser. »Lass uns mal eine Pause machen.«
Sie hatten die Moabiter Brücke mit ihren Bronzebären erreicht und konnten das große rote Wohnhaus am anderen Ufer der Spree schon sehen. Sie hätten es auch ohne Rast geschafft, aber für manche Gespräche blieb man besser stehen.
Leo lehnte sich gegen die Brüstung und schaute Georg an. »Es ist mitunter schwer, nichts auf das zu geben, was andere sagen. Das geht mir auch so, das kannst du mir glauben. Aber letzten Endes musst du mit dir selbst zufrieden sein.«
Georg schaute auf seine Füße. »Ja, Vati, ich weiß. Nur fühle ich mich manchmal ein bisschen dazwischen.«
Leo wusste genau, was er meinte. Georg war ein Beamtensohn, der das Gymnasium besuchte, aber in einer Arbeitergegend wohnte. Einer der besten Freunde seines Vaters war überzeugter Kommunist. Seine Stiefmutter führte ein eigenes Geschäft und hielt Vorträge bei der SPD. »Das kenne ich. Als ich bei der Kripo angefangen habe, gab es dort viele Aristokraten, ›Adelsklub‹ nannten sie es. Und mittendrin der Sohn eines Gemüsehändlers. Da habe ich mich manchmal ziemlich außen vor gefühlt.«
Georg grinste. »Kannst du darum so gut Karren schieben?«
Die leichte Stimmung war zurückgekehrt.
»Klar, und als Enkel eines Gemüsehändlers musst du das auch können, das ist Tradition bei uns. Na los, das sind die letzten Meter.«
Erika hasste die Arbeit im Plättsaal. Die Bügeleisen, die in Kohleöfen erhitzt wurden, waren schwer und heiß, und sie hatte sich mehr als einmal daran verbrannt. Sie und die anderen Mädchen in der Erziehungsanstalt arbeiteten hart beim Waschen, Plätten und Nähen. Da sie in Handarbeiten ganz und gar unbegabt war, wurde sie hier beschäftigt, wo sie, wie die Nonnen meinten, nicht viel kaputtmachen konnte. Dennoch lebte sie in der ständigen Angst, einen zarten Kragen oder die Manschetten eines eleganten Oberhemdes anzusengen.
Sie wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Wie so oft schaute sie zum Fenster und stellte sich vor, einfach davonzulaufen, weg aus dem Kloster mit seinen engen Mauern, zurück zu Mutti, in die vertraute Welt, in der sie aufgewachsen war und die inzwischen so fern schien.
»Nicht träumen, Erika!«
Sie zuckte zusammen, als Gertrud, eines der älteren Mädchen, neben sie trat. Sie trug ein Abzeichen an ihrer Schürze, mit dem sie unerträglich angab, als hätte sie die Aufsicht über den ganzen Plättsaal. Sie führte sich auf, als wäre sie eine der Ordensschwestern, und ließ die anderen gern ihre Macht spüren.
»Schau mal, wie voll dein Korb noch ist. Wenn du nicht schneller arbeitest, muss ich dich melden.«
Erika bedachte sie im Geist mit den schlimmsten Schimpfwörtern, die ihr einfielen, schwieg aber, um einer Strafe zu entgehen. Außerdem war unnützes Reden bei der Arbeit streng verboten.
Als sie eine Ewigkeit später fertig war, warf Gertrud einen missbilligenden Blick auf den Korb, in dem die säuberlich gefaltete Wäsche lag.
»Den bringst du jetzt noch zur Pforte, der wird gleich abgeholt. Eine wichtige Kundin.«
Erika wollte protestieren. Eigentlich war Gertrud selbst dafür verantwortlich, doch sie sparte sich gern Arbeit und überließ sie den Jüngeren, die sich nicht wehren konnten. Erika wusste, dass Widerspruch ihr nicht gut bekommen würde. Sie ergriff den schweren Korb und machte sich auf den Weg durch die Wäscherei und den Küchentrakt zum Schwesternhaus.
Dann hörte sie plötzlich ihren Namen und blieb abrupt im Korridor stehen. Sie stellte lautlos den Korb ab und horchte mit klopfendem Herzen auf das, was hinter der angelehnten Tür gesprochen wurde. Eigentlich lauschte sie nicht, auch das wurde streng bestraft, aber wenn die Schwestern von ihr redeten, musste sie erfahren, worum es ging.
»Erika ist nun mal ein Mädchen, das es nicht einfach gehabt hat«, sagte Schwester Bonifatia, die immer in allen das Gute sehen wollte und die Netteste von allen war.
»Nein«, widersprach Schwester Augustina barsch, »sie ist ein Mädchen, dessen Mutter bereits gesündigt hat und das sich nicht einmal bemüht, Gott zu gefallen.«
»Ich fürchte, sie kann ihre schlechten Anlagen nicht überwinden. Sie brechen sich immer wieder Bahn, sosehr wir uns um sie bemühen«, fügte Schwester Bernharda hinzu. Es sollte mitleidig klingen, tat es aber nicht.
Erika wollte schon weitergehen. Sie kannte das alles. Bis auf die Sache mit Gott war es genau das, was die Frau von der Fürsorge gesagt hatte, als sie plötzlich vor der Tür gestanden und sie von ihrer Mutti weggeholt hatte.
Dabei hatte Erika nur eine Apfelsine geklaut, als Geschenk für Mutti, als es ihr nicht gut ging. Sie hatte Frau Weigel, der das Geschäft gehörte und die sie erwischt hatte, angefleht, es keinem zu sagen, aber die hatte natürlich die Fürsorge gerufen. Wer sonst sollte es gewesen sein?
Im Heim hatte es Schläge gegeben und wenig Essen. Erika hatte jede Nacht nach ihrer Mutti geweint, dann gab es noch mehr Schläge, und die anderen Kinder boxten sie, damit sie endlich leise war. Irgendwann hatte man ihr erzählt, die Mutti wäre umgezogen und wollte nichts mehr von ihr wissen. Erika wusste, dass das nicht stimmte, und hatte diese Gewissheit tief in ihrem Inneren bewahrt wie einen Schatz.
Sie hatte sich gefreut, als es auf einmal hieß, das Heim wäre überfüllt, sie käme woandershin, zu Ordensschwestern, am Rand der Stadt, doch bald hatte sie begriffen, dass man sie auch hier anders machen wollte, als sie war.
Zuerst hatten sie es mit Beten in der Klosterkirche versucht und auch noch für sie mit gebetet. Sie hatte nicht verstanden, was das helfen sollte. Aber die Schwestern wussten ganz genau, wie ein braves junges Mädchen zu sein hatte. Und sie passte nicht in dieses Bild.
Als Nächstes schickte man sie zur Beichte. Erika wusste gar nicht, was das war. Sie hatten ihr den komischen Holzkasten mit den Vorhängen gezeigt und gesagt, darin warte der Pfarrer, dem solle sie ihre Sünden beichten. Irgendwas von unkeuschen Gedanken und dass sie ihre Sünden bereuen und sie danach vergessen könne, weil sie dann bei Gott seien. Also hatte Erika ihm von der Apfelsine erzählt. Doch damit war er nicht zufrieden gewesen und hatte immer weiter gebohrt.
Dann hatte er gesagt, sie solle in sich gehen, drei Vaterunser beten und in der nächsten Woche wiederkommen. Es hatte nichts genützt.
Erika wollte gerade den Korb aufheben und weitergehen, als Schwester Augustina, die Oberin, sagte: »Darum erwäge ich, den Arzt zu verständigen.«
Erika schrak zusammen. Sie hatte Angst vor Ärzten, immer schon. Sie war selten bei einem gewesen, weil sie ein gesundes Kind gewesen war, aber einmal war es ihr richtig schlecht gegangen nach einer Spritze. Und sie hatte schreckliche Dinge von schlimmen Medikamenten und Operationen gehört.
Sie schluckte mühsam, ihr Hals war auf einmal ganz eng.
»Sie ist unbelehrbar«, fuhr die Oberin fort. »Sät Unfrieden und Unzucht. Gebete allein werden kein anständiges Mädchen aus ihr machen. Wir müssen schwerere Geschütze auffahren und dürfen auch vor strenger Züchtigung nicht zurückschrecken.«
»Sollten wir es nicht erst im Guten versuchen?«, fragte Schwester Bonifatia so leise, dass Erika sie kaum verstand.
»Das haben wir lange genug getan«, erwiderte Schwester Augustina ungeduldig. »Sie soll doch nicht enden wie ihre Mutter.«
Erika hob den Korb auf und lief davon, so schnell die schwere Last es zuließ.
Sie wollte schon lange weg, hatte immer mit dem Gedanken an Flucht gespielt und sich nie getraut, aber jetzt war es so weit. Sie konnte nicht länger hierbleiben.
Als sie vor dem schönen Haus mit der rot-weißen Fassade ankamen, wartete Ilse mit dem Fahrrad auf sie und hatte ein seltsames Lächeln im Gesicht. »Georg, du kannst gehen, du wolltest doch zum Fußball«, sagte sie, und Leo wollte schon protestieren, doch dann trat Robert Walther aus dem Hausflur.
Er war auch auf der Hochzeit gewesen. Ilse hatte es so entschieden, und Leo war froh, dass seine Schwester die Sache in die Hand genommen hatte. Seit dem Fall Graf im letzten November hatten er und Robert versucht, ihre Freundschaft zu kitten. Es war nicht einfach, aber sie hatten sich ab und an auf ein Bier getroffen. Ein guter Anfang. Und das gemeinsame Feiern hatte auch geholfen. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass Robert bei Ilses Umzug auftauchen würde.
»Ich habe gehört, ihr könnt zwei kräftige Arme gebrauchen«, sagte dieser statt einer Begrüßung.
Leo klopfte ihm auf die Schulter. »Danke, da hast du recht. Richard braucht seine gerade fürs Cello.«
Zu dritt kamen sie schnell voran und hatten die zwei weiteren Fuhren, die nötig waren, in kurzer Zeit erledigt. Richard Dohms Wohnung war geräumig und eher sparsam eingerichtet, sodass es nicht weiter schwierig war, Ilses Lieblingsstücke unterzubringen.
Als sie fertig waren, setzten sich die beiden Männer auf die Stufen vor der Haustür und tranken Fassbrause. Robert war im Dienst, daher kam Bier nicht infrage. Ilse war nach Moabit zurückgeradelt, um mit Clara die letzten Sachen zu packen.
Nun hätten sie in Ruhe ein paar Worte reden können, saßen aber schweigend da. Es fiel Leo noch immer nicht ganz leicht, unbeschwert mit Robert zu reden.
»Ich bin dir noch eine Antwort schuldig«, sagte Robert schließlich.
Leo sah ihn überrascht an. »Ich habe doch gar nichts gefragt.«
»Ist schon länger her. Erinnerst du dich an den Artikel in der Nachtausgabe, beim Fall Graf letztes Jahr?«
Leo wurde hellhörig. »Natürlich. Ich war der Meinung, dass die Information aus eurem Polizeiamt kam. Und bin es bis heute.«
Robert biss sich auf die Lippe und nickte. »Du hast recht. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher. Neulich habe ich gehört, wie jemand mit der Presse telefonierte, in einer anderen Sache. Und ich vermute, derselbe hat es auch der Nachtausgabe gesteckt.«
»Und wer war das?«
»Richter. Mein Vorgesetzter.« Er zögerte. »Er trifft sich mit Leuten, die … rechts stehen. Ich – ich war ein paarmal dabei. Hab mir angehört, was sie zu sagen haben. Manches hat mir gefallen, anderes nicht. Ich war wütend damals, auf dich, auf Gennat, auf Jenny, vor allem auf mich selbst.« Er zuckte mit den Schultern. »Aber ich fühle mich nicht mehr wohl da. Die reden immer wilder daher. Und dass er Sachen an die Presse gibt, unter der Hand, das … Jedenfalls wollte ich, dass du das weißt.«
Leo nickte. »Danke. Ich habe dir auch etwas zu sagen. Gennat hat mich gefragt, was ich davon halte, wenn du in die Inspektion A zurückkommst. Ich habe mich dafür ausgesprochen. Es wäre schön, dich wieder dabeizuhaben.«
Statt einer Antwort drückte Robert seinen Arm.
2
Obschon der Februarabend ungemütlich feuchtkalt war, zog es Ludwig Bönisch nach draußen. Er versäumte es nie, bei Vollmond zur Blanken Hölle zu gehen. Andere mochten es sonderbar oder abergläubisch finden, aber Heimatforschung war nun mal sein Steckenpferd. Und nichts reizte ihn mehr als der von Wiesen und Büschen umgebene Pfuhl, in dem sich nach einer alten Sage das Tor zur Unterwelt verbarg.
Bönisch hatte eine lange Unterhose angezogen, dazu seinen wärmsten Pullover, Mantel und Strickschal und eine Mütze mit Ohrenschützern. So stapfte er nun durch die verlassenen Straßen in Richtung Blanke Hölle. Wer nicht nach draußen musste, blieb am warmen Herd, aber er hoffte auf einen wolkenlosen Moment, denn er hatte es so gern, wenn das Mondlicht auf die nassglitzernden Wiesen und die dunkle Fläche des Gewässers fiel.
Dessen eigentlicher Name »Blanke Helle« wurde auf die germanische Totengöttin Hel zurückgeführt, und seit Bönisch als Junge die Sage von Hel und ihren Stieren gehört hatte, war sie ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
Demnach hatte in vorzeitlichen Tagen ein Priester in einer Hütte gelebt, die am Rande des Wassers stand. Jedes Jahr schickte ihm die Göttin zwei Stiere, die das Ufer pflügten. Noch am selben Tag ging dort die Saat auf, und der Priester konnte das Getreide ernten. Zum Dank opferte er der Göttin einige Garben auf einem Stein.
Das Unheil hatte begonnen, als ein christlicher Mönch sich an den Pfuhl verirrte. Der Priester nahm ihn in seiner Hütte auf und bat den Mönch, seine Aufgabe fortzuführen, wenn er starb. Der Mönch war von der Bitte wenig angetan, da er mit dem heidnischen Heiligtum nichts zu tun haben wollte. Folglich kümmerte er sich nicht um die Opferstätte, nachdem der Priester gestorben war.
Wenn Bönisch an Vollmondabenden ganz still dastand, meinte er bisweilen, die Hufe der Stiere auf der Erde donnern zu hören. Seine Frau Auguste hatte ihn argwöhnisch angesehen, als er das einmal erwähnte, und kopfschüttelnd »Ludwig, du bist verrückt« gesagt. Egal, er mochte die Geschichte.
Sein Atem bildete eine Wolke, und er verkroch sich tiefer im Mantel, der schon feucht vom Regen war. Vor ihm tauchten die ersten Büsche des Platzes auf, verschwommene Umrisse im Licht der wenigen Straßenlaternen. Da hier niemand wohnte, hielt die Stadt es für vertretbar, die Gegend nur unzureichend zu beleuchten.
Bönisch war am Rande der grünen Wildnis angekommen. Das Gras, von Reif überzogen, knirschte unter seinen Stiefeln, als würden die Halme einzeln brechen. Er vergrub die Hände noch tiefer in den Taschen, sie waren trotz der Wollhandschuhe eiskalt. Er schaute zum Himmel, wo sich eine Wolke vor den Mond geschoben hatte. Nur ein Augenblick, sie wäre gleich vorbeigezogen, und dann –
Das fahle Licht ergoss sich über die Landschaft, schimmerte auf dem unbewegten Wasser, ließ den Frost auf Gras und Büschen wie Juwelen glitzern. Bönisch stand da und genoss ehrfürchtig den Anblick, der ihm allein gehörte. Einen Moment lang stellte er sich vor, er wäre jener Priester und wartete, dass die Stiere in einem wilden Wirbel aus dem Wasser emporstiegen.
Das Ende der Geschichte war eher unerfreulich.
Der Mönch hungerte, weil die Stiere nicht mehr gekommen waren, um das Feld zu pflügen. Also flehte er Gott um ein gnädiges Ende an, worauf sich das Wasser teilte und die Tiere zurückkehrten. Dann rannten sie stampfend im Kreis um den Pfuhl, und wo sie gerannt waren, senkte sich der Boden immer tiefer und wurde überflutet. Zuletzt verschlang das Wasser Stiere und Mönch, Hütte und Opferstein.
Es gab noch ein allerletztes Kapitel – den Aberglauben, der Pfuhl fordere jedes Jahr ein Menschenopfer. Bönisch wusste, dass mehr als ein Mensch hier ertrunken war, so harmlos die Blanke Hölle auch aussehen mochte. Natürlich war es nur eine Geschichte, und doch spürte er an solchen mondhellen Abenden, dass vielleicht ein Fünkchen Wahrheit darin lag.
Er wollte gerade kehrtmachen und nach Hause gehen, um sich gründlich aufzuwärmen, als er in Ufernähe einen dunklen Fleck bemerkte. Er stand unschlüssig da, hin- und hergerissen zwischen Neugier und dem dringenden Wunsch, seine Hände und Füße aufzutauen.
Schließlich gab er sich einen Ruck und eilte, so schnell er konnte, über die reifbedeckte Wiese zum Pfuhl.
Der Mond verdunkelte sich erneut, und er wäre beinahe über einen Stein gestolpert, konnte sich aber gerade noch fangen. Er tastete sich weiter. Dann war die Wolke vorübergezogen, und um ihn herum wurde es heller.
Hell genug, um die Gestalt zu sehen, die zusammengesunken am Ufer lag, eine Hand zum Wasser ausgestreckt.
Erika hockte eingezwängt hinter einem hohen Kistenstapel, die Knie fast unter dem Kinn. Es roch trocken und staubig, nach Öl und Holz und anderen Dingen, die sie nicht kannte.
Sie hatte sich freiwillig gemeldet, um den Müll nach draußen zu tragen. Es war eine unbeliebte Arbeit, und sie hatte ausgenutzt, dass die Schwestern wegen des Geruchs ungern dabei Aufsicht führten. Unter ihrem Kleid hatte sie ein Bündel mit ihren wenigen Habseligkeiten verborgen und gehofft, dass die Schwestern es nicht bemerkten. Sie hatte die Eimer ausgeleert und abgestellt, sich rasch umgesehen und war zum Gartenschuppen gelaufen.
Darin hing eine alte Hose des Gärtners an einem Haken. Die hatte sie angezogen, mit einer Kordel enger geschnürt, die verhasste Anstaltskleidung – graues Kleid, weißes Häubchen, weiße Schürze – in eine Ecke geworfen und den alten Pullover übergestreift, den sie im ersten Heim bekommen hatte.
Dann war sie zu der hohen Mauer gerannt, die das Klostergelände umgab. Sie wusste, wo ein Holzstapel lag, und kletterte dank ihrer festen Schuhe und der Hose mühelos hinauf. Noch ein letzter Blick zu den erleuchteten Fenstern, dann sprang sie auf der anderen Seite hinunter und lief davon, vorbei am Klosterteich, hinein ins Gewirr der Straßen. Sie kannte sich nicht aus, wollte einfach nur weg von hier.
Und nun saß sie hier in diesem Lagerhaus und konnte endlich nachdenken. Aber sie fürchtete sich davor, ihren Gedanken zu begegnen. Sie wusste nicht, was sie jetzt anfangen, wohin sie gehen sollte. Zur Mutti? Aber wenn sie wirklich umgezogen war, würde Erika sie womöglich nicht finden. Und falls sie noch in der Wriezener Straße wohnte, würde man sie dort zuallererst suchen. Sicher würden die Schwestern die Polizei rufen, und die wusste natürlich, wo Mutti wohnte. Sie wollte sich gar nicht ausmalen, was passierte, wenn man sie erwischte und zurückbrachte. Sie konnte es nicht ertragen, eingesperrt zu sein. Das war das Allerschlimmste am Kloster.
Eine Stelle in einem feinen Geschäft würde ihr gefallen. So etwas hatte sie mal in einer Zeitung gesehen, große Fenster, viel Licht und schöne Dinge, die man kaufen konnte. Und die Verkäuferinnen trugen schicke Kleider. Aber das war nur ein Traum.
Als Erstes musste sie Mutti finden, sich nach fünf Jahren endlich wieder an sie drücken und ihre raue Hand auf dem Kopf spüren. Dann könnte sie in Ruhe überlegen, wie es weitergehen sollte.
Erika legte sich auf den Boden, rollte sich zusammen und schloss die Augen. Ihr fiel wieder die seltsame Sache ein, die sie unterwegs beobachtet hatte, an dem kleinen Teich, der im Mondlicht geglitzert hatte. Erika wusste nicht, was genau da geschehen war, aber sie hatte eine unbestimmbare Furcht gespürt. Doch nun überfiel sie eine ungeheure Müdigkeit, als die Anstrengungen des Tages sie einholten, und sie schlief trotz der unbequemen Haltung ein.
Schon fast halb neun. Auguste Bönisch wurde allmählich unruhig. Meist blieb sie geduldig, wenn Ludwig seinem Steckenpferd nachging, und hatte auch nichts dagegen, dass er abends durch Tempelhof streifte und sich den Mond anschaute. Doch es war wirklich spät, und er sollte noch Kohlen aus dem Keller holen, das hatte er versprochen. Sie sah nicht ein, sich mit dem Eimer abzuschleppen, wenn sie einen Mann mit starken Armen im Haus hatte.
Sie wischte noch einmal den tadellos sauberen Küchentisch ab, rückte die Stühle noch ein bisschen gerader, warf einen Blick auf den leeren Kohleneimer. Das Einzige, was vor dem Schlafengehen zu tun blieb.
Was trieb er bei dem ungemütlichen Wetter da draußen? Sie war froh, dass sie nicht mehr vor die Tür musste, doch er lief um den komischen Tümpel herum und schwelgte wieder in seinen Sagen von Stieren und Göttinnen. Sicher, ein Mann brauchte ein Hobby, und Auguste war froh, dass ihr Ludwig nicht trank oder auf Pferde wettete. Er brauchte nur Stift und Papier und gute Schuhsohlen, weil er oft zu Fuß unterwegs war.
Sie durfte sich also nicht beschweren –
Es klingelte. Hatte Ludwig den Schlüssel vergessen?
Auguste machte auf und sah sich einem etwa zwölfjährigen Jungen mit Schirmmütze und dickem Schal gegenüber. Seine Ohren waren von der Kälte ganz rot, und er war ziemlich außer Atem. »Sind Sie Frau Bönisch?«
»Ja. Was willst du hier?«
»Ick soll Ihnen sagen, Ihr Mann ist auf dem Polizeirevier in der Berliner Straße.«
Sie tastete nach dem Türrahmen. »Ist ihm was passiert?«, stieß sie hervor.
»Nee, dem nicht. Dem andern.«
»Was redest du da?«
Der Junge holte tief Luft und kniff konzentriert die Augen zusammen. »Er hat wen jefunden, an der Blanken Hölle. ’nen Toten.«
Auguste wurde ganz blümerant. »Einen Toten? Hast du dir das ausgedacht?«
»Nee«, sagte der Junge empört. »Dit is wahr. Er hat ihn jefunden und ist zur Polizei und muss jetzt aussagen. Und damit Se sich keene Sorjen machen, hat er mir losjeschickt. Dit is die reine Wahrheit, ehrlich.«
Auguste überlegte rasch. Dann zog sie Hut und Mantel über, wickelte sich einen Schal um den Hals und sagte zu dem Jungen: »Du bringst mich jetzt auf dieses Revier, zu meinem Mann. Und danach bekommst du einen Groschen.«
»Im Sommer können wir wieder Gartenfeste bei mir feiern«, sagte Pauline Caspary, als hätte sie die Gedanken des Mannes gelesen, der mit einem Champagnerglas neben sie getreten war.
»Du bist spät dran heute«, sagte Ernst Haldensleben. »Aber schön, dass du gekommen bist. Und ich hoffe, dass wir im Sommer dann im Schein der Glühwürmchen spazieren gehen.«
Pauline lächelte und warf lässig die zu einem Pagenkopf geschnittenen Haare nach hinten. Sie hielt eine Zigarettenspitze in den schlanken, manikürten Fingern und sah ihn provozierend an. »Spazieren gehen? Wie langweilig.«
Er trank von seinem Champagner, ohne sie über das Glas hinweg aus den Augen zu lassen, sein Blick wanderte tastend an ihrem Körper hinunter. Pauline war nicht die Frau, die dabei rot wurde; eine Reaktion zeigte sie dennoch. Ihre Zungenspitze schob sich zwischen die Lippen, blassrot und glänzend, ein Versprechen, das bei nächster Gelegenheit eingelöst würde. Er berührte wie beiläufig ihre Hand und sah sie mit hochgezogener Augenbraue an.
»Du solltest dir morgen unbedingt meine Neuerwerbung anschauen, einen Sascha Wiederhold. Du kennst ja seinen Stil, ein hinreißend bunter Wirbel aus Farben und Formen, der einen förmlich einsaugt. Aber das machen wir nicht heute Abend, sondern lieber ganz in Ruhe. Und danach können wir essen gehen.«
»Oder wir essen im Bett. Ich habe den ganzen Tag Zeit, Emil ist verreist.«
Ernst und Pauline liebten einander nicht, was beide wussten und keinen von ihnen störte. Er hätte schlecht beschreiben können, was genau ihn an ihr fesselte. Der Sex allein war es nicht, den hatte er mit vielen Frauen gehabt, und Pauline war apart, aber bei weitem nicht die Hübscheste. Vielleicht war es die absolute Sorglosigkeit, mit der sie ihren Mann betrog, sich keinerlei Gedanken machte, nicht einmal besondere Vorkehrungen traf. Sie schien sich überhaupt nicht zu fürchten. Sie aß und trank ebenso unbekümmert, wie sie mit ihm ins Bett ging, und schien dabei nie satt zu werden. Womöglich war es dieser nie zu stillende Hunger, der ihn zu ihr hinzog.
Sie wandte sich zum Saal. »Du darfst deine Pflichten als Gastgeber nicht vernachlässigen.« Dann tippte sie ihm mit dem Zeigefinger an die Wange. »Morgen um zwei hier bei dir? Ich werde mir deinen Sascha Wiederhold nicht entgehen lassen.« Mit diesen Worten war sie im Gedränge der Gäste verschwunden.
»Eine hinreißende Frau«, sagte eine Stimme neben ihm, und Ernst Haldensleben schaute überrascht zur Seite.
»Herr Marold, guten Abend. Es freut mich, dass Sie kommen konnten.«
Marold bekleidete einen hohen Posten im Hugenberg-Konzern. Vergangenes Jahr hatte es ziemliches Gerede gegeben, als sich eine Frau, die mit Marold bekannt gewesen war, umgebracht hatte. Doch er war unbeschadet aus dem Skandal hervorgegangen. Ernst Haldensleben bewunderte Menschen, die sich durchs Leben bewegten wie durch einen Fluss, der sich für sie teilte, statt ein Hindernis für sie zu sein.
»Wirklich hinreißend«, wiederholte Marold und hob sein Glas.
Ludwig Bönisch hatte die Hände auf die Knie gestützt. »Hören Sie, wie sollte ich denn ahnen, dass da einer liegt? Ich hab nichts damit zu tun!«
Der Mann, der sich als Kriminalpolizeirat Nitschke vorgestellt hatte, sah ihn durchdringend an. »Herr Bönisch, Sie müssen zugeben, dass ein Spaziergang bei diesem Wetter ungewöhnlich ist.«
»Na, der andere war doch auch unterwegs«, entfuhr es ihm.
Der Polizist runzelte die Stirn. »War er Ihnen bekannt?«
»Ich weiß nicht … also, ich hab mir sein Gesicht nicht angesehen. Aber die Haare und wie er gekleidet war – er erinnerte mich an einen Herrn, mit dem ich mal geredet habe. Über die Geschichten, die es zur Blanken Hölle gibt. Er kannte sich aus. Aber ich weiß nicht, wie er heißt, und ob er das wirklich war.«
»Wie haben Sie den Toten vorgefunden?«
»Er lag da an der Blanken Hölle, auf der Wiese. Als wäre er da spazieren gegangen. Im Übrigen war ich selbst gar nicht spazieren. Ich habe mir nur den Pfuhl angesehen. Bei Mondlicht.«
Der Kriminalbeamte sah ihn an, als zweifelte er an seinem Verstand. »Bei Mondlicht? Den Pfuhl?«
Worauf Bönisch eine Kurzfassung der Sage lieferte. »Ist so eine Angewohnheit von mir. Bei Vollmond hingehen, meine ich. Gewöhnlich bin ich allein, jedenfalls um diese Jahreszeit. Im Sommer sind schon mal Liebespaare unterwegs, denen gehe ich aus dem Weg. Will ja nicht stören. Aber wenn es kalt oder nass ist, geht niemand außer mir da hin.«
Nitschke schien nicht überzeugt. »Sie wollen mir also weismachen, dass sich bei diesem unwirtlichen Wetter gleich zwei Männer an diesem verlassenen Ort aufhalten und nichts miteinander zu tun haben? Dass Sie den Toten schon früher gesehen und sogar mit ihm gesprochen haben, aber nichts über ihn wissen?«
»So ist es«, beteuerte Bönisch, dem ganz flau im Magen wurde. Wie war er bloß in diese missliche Lage geraten?
»Nach einer flüchtigen Beschau des Leichnams gehen wir davon aus, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen ist. Sie müssen sich auf weitere Befragungen einstellen«, verkündete Nitschke gewichtig.
Entsetzt schaute Bönisch den Polizisten an. »Gewaltsam? Ich hab das Blut gesehen, aber ich dachte, der ist mit dem Kopf irgendwo draufgefallen. Dass er vielleicht betrunken war.«
»Dazu kann ich mich nicht äußern«, sagte Nitschke und griff nach dem Hörer.
»Aber Herr Polizeirat, wenn ich was Schlimmes gemacht hätte, würde ich doch nicht die Polizei rufen, sondern weglaufen. Ich hätte einfach heimgehen können, aber ich hab mich bei Ihnen gemeldet und –«
»Hier Polizeiamt 13. Verbinden Sie mich mit der Inspektion A.«
3
Am Abend hatten Leo und Clara es sich im Wohnzimmer bequem gemacht, froh, dass sie nach dem anstrengenden Umzug die Beine ausstrecken konnten.
»Ich hatte ein etwas schlechtes Gewissen, Ilse mit den Kisten allein zu lassen«, sagte Clara.
»Ich nicht«, erwiderte Leo unbekümmert. »Sie weiß am besten, wo alles hingehört. Und wenn Richard heimkommt, wollen die beiden sowieso allein sein.« Er grinste. »Dann kann er sie endlich feierlich über die Schwelle tragen, jetzt, wo sie auch offiziell bei ihm wohnt.«
Clara lachte. »Was hat Robert denn erzählt?«
Er sagte es ihr, und sie sah ihn forschend an. »Möchtest du wieder mit ihm zusammenarbeiten?«
Leo zuckte mit den Schultern. »Ich will es zumindest versuchen. Die Geschichte im letzten Jahr war ein Bruch, da gibt es einiges zu reparieren. Und er muss sich damit abfinden, dass Neufeld jetzt fest bei uns arbeitet. Aber ja, ich könnte ihn gut gebrauchen. Und ich habe seine Freundschaft vermisst.«
Clara hatte gespürt, dass Leo immer wieder an seinen Freund und Kollegen gedacht hatte. Robert kannte ihren Mann länger als sie selbst. Er hatte ihm beigestanden, als Leos erste Frau gestorben war, ihm bei Auseinandersetzungen mit Kollegen und Vorgesetzten den Rücken gestärkt. Robert hatte eine Lücke hinterlassen, als man ihn nach Tiergarten strafversetzt hatte. Vielleicht wäre es möglich, sie wieder zu schließen.
»Ich weiß. Ich hoffe, ihr kommt wieder miteinander aus, in der Inspektion A und überhaupt.« Sie wollte gerade in die Küche gehen und ein Bier holen, als das Telefon klingelte. »Ich geh schon.«
Kurz darauf steckte Clara den Kopf durch die Tür. »Das war Jakob. Ihr habt einen neuen Fall. Die anderen Kommissionen sind im Einsatz, ihr müsst los.«
Seufzend stemmte Leo sich aus dem Sessel hoch.
Sonnenschein wartete im Glashof des Präsidiums und hielt Leo den Autoschlüssel hin. »Platz Q in Tempelhof. Ein Toter in einer Grünanlage«, sagte er und stieg auf der Beifahrerseite ein.
»Was ist das für ein seltsamer Name?«, fragte Leo verwundert, als er den Wagen in Richtung Kreuzberg steuerte, wo sie den Kollegen Oskar Neufeld abholen würden, der Bereitschaft hatte. Leo hatte allerdings einen gründlichen Blick auf den Stadtplan werfen müssen, so genau kannte er sich im Berliner Straßengewirr dann doch nicht aus.
Sonnenschein zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Platz noch unbebaut ist.«
»Was wissen wir sonst noch?«
Der Kollege blätterte im Notizbuch. »Der Tote wurde von einem Spaziergänger heute Abend um Viertel vor acht auf dem Platz gefunden. Dabei handelt es sich um eine Grünfläche mit einem kleinen Gewässer in der Mitte. Die Gegend um den Platz ist als Baufläche ausgewiesen, bisher aber unbebaut und recht einsam. Bei dem Toten handelt es sich um einen älteren Mann, schätzungsweise Mitte sechzig bis siebzig Jahre alt. Schwere Kopfverletzung, die vermutlich zum Tode führte.«
»Den Spaziergänger haben sie hoffentlich auf dem Revier behalten«, sagte Leo. Sie hatten schon unerfreuliche Überraschungen mit Polizeiämtern erlebt, in denen man sich nicht an die Regeln hielt, die in der Inspektion selbstverständlich waren. Sie überquerten den Landwehrkanal, der zu ihrer Linken ins eisig-schwarze Wasser des Urban-Hafens mündete. Leo vergaß oft, dass es in Berlin viel Schifffahrt gab, und war manchmal ganz überrascht, wenn er auf Ladekräne und Hafenbecken stieß. Sie passierten die dunklen Bäume der Friedhöfe vor dem Halleschen Tor, die wie eine schwarze Wand neben ihnen aufragten. »Heute habe ich übrigens mit Robert gesprochen. Er vermutet, sein Chef im Polizeiamt 2 könnte die undichte Stelle sein, du weißt schon, damals beim Fall Graf.«
Sonnenschein sah ihn überrascht an. »Sein Chef?«
»Der Mann heißt Richter, unterhält Verbindungen mit rechts. Er scheint tatsächlich der Einzige zu sein, der dafür infrage kommt.« Er seufzte. »Gennat ist bereit, sich für Roberts Rückkehr einzusetzen, und ich habe zugestimmt. Wir könnten ihn brauchen. Und außerdem …«
»Ich weiß«, sagte Sonnenschein ruhig. »Aber wird das nicht schwierig mit Neufeld?«
Leo winkte ab. »An den wird er sich gewöhnen müssen. Es ist Zeit, die alten Geschichten zu vergessen. Neid und Eifersucht haben keinen Platz bei uns, wir müssen Verbrechen aufklären.« Natürlich wusste er nur zu gut, dass menschliche Eigenheiten in ihre Arbeit hineinspielten, sosehr sie sich um Sachlichkeit bemühen mochten. Er bog nach links in die Fürbringerstraße ein und spähte zu den Hausnummern, die im trüben Laternenlicht kaum zu erkennen waren.
Schließlich hielt er an und stellte den Motor ab. »Ich geh schon«, sagte er, bevor Sonnenschein aussteigen konnte.
Leo trat durchs Tor in den Durchgang und ging hinauf in den zweiten Stock. O. Neufeld stand auf dem blank polierten Schild, und er drückte die Klingel.
Stille, dann Schritte. Als die Tür aufging, hörte Leo Musik im Hintergrund. Jazz.
»Oh, Herr Oberkommissar«, sagte Oskar Neufeld, dem die sonst so akkurat frisierten Haare wirr ins Gesicht hingen. Er sah ausgesprochen verlegen aus und räusperte sich.
»Verzeihung, ich hätte wohl besser anrufen sollen, aber wir haben einen Fall in Tempelhof. Ihre Wohnung liegt auf dem Weg, daher –«
Leo verstummte, als jemand hinter Neufeld aus der Wohnzimmertür trat und sofort wieder zurückwich. Der flüchtige Blick verriet ihm, dass es ein hochgewachsener dunkelhäutiger Mann war, dessen weißes Hemd bis unter die Brust aufgeknöpft war.
Neufeld wurde rot. »Ja, sicher, ich komme sofort. Einen Moment, bitte.« Er verschwand im Wohnzimmer, Leo hörte leise Stimmen.
Der Mann kam ihm bekannt vor, und er musste nicht lange überlegen, bis es ihm einfiel. Der Musiker, mit dem Moritz Graf befreundet gewesen war – Watson hatte er geheißen, nein, Watkins. Was allerdings nicht erklärte, weshalb sich dieser Mann in leicht derangiertem Zustand im Wohnzimmer seines Kollegen aufhielt.
»Ich warte unten im Wagen, Neufeld«, sagte er durch die angelehnte Wohnzimmertür und machte, dass er die Treppe hinunterkam. Unten im Flur blieb er einen Moment stehen, um seine Gedanken zu ordnen. Wenn dort oben vorging, was er vermutete, vermuten musste, würde er es mit keinem Wort erwähnen, auch nicht Jakob gegenüber. Vielleicht hatten die beiden Männer ja nur gemeinsam Musik gehört. Aber falls Neufeld ein homosexuelles Verhältnis unterhielt, durfte niemand davon erfahren.
Berlin war eine Stadt, in der Menschen mit abweichenden sexuellen Bedürfnissen ziemlich frei leben konnten, solange sie sich einigermaßen diskret verhielten. Es gab zahllose Lokale und andere Treffpunkte, die allgemein bekannt waren, auch bei der Polizei. Solange man sich nicht zu öffentlich darstellte oder provozierte, wurde man weitgehend in Ruhe gelassen, Paragraph 175 hin oder her. Bei einem Polizisten, zudem einem Kriminalbeamten, sah das allerdings anders aus.
Leo atmete tief durch, bevor er auf die Straße trat und zum Wagen hinüberging.
Als er ins Auto stieg, sah er auf die Uhr. Mittlerweile war es kurz nach zehn. Hoffentlich hatten die Kollegen vernünftige Scheinwerfer mitgebracht, sonst bekämen sie Probleme bei der Spurensicherung in der Grünanlage. »Unbebaute Gegend« klang nicht gerade, als könnte man sich auf die Straßenbeleuchtung verlassen.
Dann wurde die hintere Wagentür geöffnet, und Neufeld stieg ein. Leo ließ den Motor an, wendete und fuhr los. »Würdest du den Kollegen auf den neuesten Stand bringen, Jakob?« Er hoffte, dass seine Stimme neutral klang. Jedenfalls musste er sich erst einmal in Ruhe überlegen, wie er vorgehen und ob er Neufeld auf den Zwischenfall ansprechen sollte.
Sonnenschein fasste alles kurz zusammen.
»Weiß man schon, wer der Tote ist?«
»Nein, die Informationen, die man mir durchgegeben hat, waren recht dürftig. Die Kollegen vom Erkennungsdienst sind schon vor Ort, mitsamt ordentlicher Beleuchtung, wie ich hoffe«, sagte Sonnenschein, als hätte er Leos Gedanken gelesen.
Sie fuhren über die breite Belle-Alliance-Straße in Richtung Tempelhof. Links lag der Flughafen mit seinen hölzernen Hallen und den weithin sichtbaren Scheinwerfer- und Funktürmen. Leo hatte gelesen, dass in diesem Frühjahr der nächste Bauabschnitt begonnen werden sollte – mitsamt einem Hotel und Flughafenrestaurant mit Besucherterrasse. Vielleicht könnten sie mal einen Ausflug dorthin machen, Georg wäre sicher begeistert.
Wann immer er in Tempelhof zu tun gehabt hatte, war ihm der Stadtteil seltsam zusammengewürfelt erschienen – das weitläufige Flughafengelände, Wohngebiete, aber auch das sogenannte Nansenheim, eine Barackensiedlung, in der russische Flüchtlinge lebten und in der er letztes Jahr ermittelt hatte.
Nach einigen Minuten bog Leo von der Berliner Straße nach rechts in die baumbestandene Kaiserin-Augusta-Straße ab, deren stattliche Wohnhäuser um diese späte Stunde dunkel waren.
Scheinwerferlicht wies ihnen den Weg zum Platz Q, der weit und verlassen wirkte. Jenseits der künstlich erhellten Fläche war es dunkel, fern zeichneten sich die Bäume der benachbarten Friedhöfe wie Schattenrisse ab. Leo stieg aus und sah sich um. Keine Häuser in direkter Nähe, also vermutlich kaum Zeugen.
Ein älterer Mann mit dichtem Schnurrbart kam auf ihn zu und stellte sich als Kriminalpolizeirat Nitschke vor. Mit diesem Dienstgrad war er streng genommen Leos Vorgesetzter, doch es galt die unausgesprochene Regel, dass die Beamten vom Alexanderplatz das Sagen hatten, wenn sie an einen Tatort gerufen wurden.
Leo stellte sich und die Kollegen vor.
»’n Abend, die Herren«, sagte Nitschke. »Unerfreuliche Geschichte. Der Kopf ist reichlich zerschmettert. Ihre Kollegen sind schon dabei, die Spuren zu sichern. Der Arzt ist auch da. Der Zeuge, der den Toten gefunden hat, wartet bei uns im Polizeiamt. Sie können ihn gleich befragen, wenn Sie hier fertig sind.«
Sie begaben sich zu der Fundstelle, die sich in der Nähe eines kleinen Teichs befand. In dieser verlassenen Gegend gab es keine Schaulustigen, wofür Leo dankbar war. Immerhin mussten sie nichts absperren oder sich mit Mühe die Presse vom Hals halten.
Raureif knisterte unter ihren Füßen, als sie durchs Gras gingen, und Dr. Lehnbach, der neben dem Toten gekniet hatte, erhob sich und nickte zur Begrüßung. »Eins kann ich Ihnen schon sagen: Die Todesursache ist kein Geheimnis. Er starb an einem oder mehreren Schlägen gegen den Kopf, stumpfer Gegenstand, starke Kraftausübung, was übrigens keinen Schluss auf die Person des Täters zulässt. Ich schätze den Toten auf Mitte sechzig bis Anfang siebzig. Er ist etwa drei, vier Stunden tot.«
Leo sah ihn überrascht an. So schnell war Lehnbach gewöhnlich nicht mit seinen Äußerungen. Der Arzt schien seine Verwunderung zu bemerken. »Ich kenne Ihre Fragestellung mittlerweile in- und auswendig, Herr Wechsler. Darum sage ich es gleich: Mit der richtigen Waffe und dem nötigen Überraschungsmoment kann fast jede erwachsene Person eine andere erschlagen. Wie Sie sehen, ist die Blutung aufgrund einer oder mehrerer Platzwunden beträchtlich, aber das eigentlich Entscheidende ist die eingedrückte Schädeldecke. Die hat zum Tod geführt, nicht der Blutverlust.«
Leo beugte sich vor und betrachtete das Gesicht des Mannes. Gepflegter Schnurr- und Kinnbart, dicht und eisengrau. Geplatzte Äderchen an der Nase, aber eher altersbedingt, sie sahen nicht nach einer typischen Trinkernase aus. Die Blutlache unter seinem Kopf hatte den Raureif rosa gefärbt, und die Delle im Schädel war deutlich zu erkennen. Sie befand sich auf der rechten Kopfseite. Also hatte der Täter – oder die Täterin – entweder hinter dem Mann gestanden und war rechtshändig gewesen, oder man hatte ihn von vorn angegriffen, dann müsste es sich eher um eine linkshändige Person handeln.
Sein Blick wanderte zu den Händen, die in Lederhandschuhen steckten. Mantel mit Pelzkragen. Teure Schuhe, vermutlich maßgefertigt. Konnte es sich um einen Raubmord handeln?
»Haben Sie Papiere bei ihm gefunden? Oder Geld?«, erkundigte er sich bei Nitschke.
»Er hat nur einen Hausschlüssel, ein paar Geldscheine und eine nicht gerauchte Zigarre bei sich. Als hätte er gemerkt, dass die bei feuchtkaltem Wetter nicht schmecken, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Außerdem eine Taschenuhr, ohne Monogramm, und auch sonst nichts, was eine Identifizierung zuließe.«