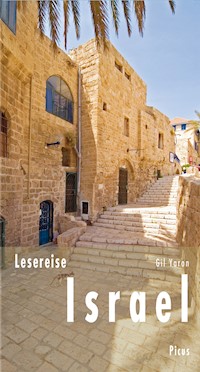
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Picus Lesereisen
- Sprache: Deutsch
Israel, die Wiege der drei monotheistischen Religionen, ist nicht bloß einer der unruhigsten Orte der Welt, sondern auch ein lebendiger, jugendlicher Mikrokosmos, in dem Moderne und Tradition, Abendland und Morgenland mit- und nebeneinander bestehen. Ein arabischer Siedler, humorvolle ultraorthodoxe Juden und ein israelischer Elitesoldat, der für einen Palästinenserstaat demonstriert, sind einige der Beispiele dafür, wie Gil Yaron mit verbreiteten Stereotypen über Israel aufräumt. Stein für Stein legt der Autor ein facettenreiches, farbenfrohes Mosaik dieser vielschichtigen Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Copyright © 2011 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wienumfassend überarbeitete Neuausgabe 2020
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: PhotoStock-Israel © agefotostock
ISBN 978-3-7117-1102-1
eISBN 978-3-7117-5424-0
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Gil Yaron wurde 1973 in Haifa geboren. In Düsseldorf aufgewachsen, kehrte er nach dem Abitur nach Israel zurück. Heute arbeitet der ehemalige Molekularbiologe als Nahost-Korrespondent für zahlreiche Zeitungen, Magazine und Radiosender in Deutschland und Kanada, darunter die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« und der »FOCUS«. Im Picus Verlag erschienen seine Lesereisen Israel, Israel/Palästina und Jerusalem. www.info-middle-east.com
Gil Yaron
Lesereise Israel
Party, Zwist und Klagemauer
Picus Verlag Wien
Inhalt
Ein Vorwort
Die israelischsten Fragen
Zwei Fragen gelten als typisch israelisch. Die erste: »Wo hast du in der Armee gedient?« ist recht harmlos. Die zweite hat jedoch manchmal schwerwiegende Konsequenzen
Wie der Holocaust nach Israel kam
Der Holocaust ist ein entscheidender Bestandteil der israelischen Psyche. Das war nicht immer so
Vom Kaffee zum Krieg in einer Stunde
Wehrdienst gehört immer noch für die meisten Israelis zum Alltag. Der Kampfpilot Assaf hat in der Uniform ein Alter Ego
Der Kibbuz, der wieder die Welt verändern will
Der Kibbuz Hatzerim, der die Wüste zum Blühen gebracht hat, will mit Jojobaöl die Kosmetikindustrie revolutionieren
Sommer in Israel
Israels heißeste Jahreszeit ist besonders für europäische Besucher gewöhnungsbedürftig
Der echte Alexanderplatz steht gar nicht in Berlin
Der Traum deutscher Architekten, der Moderne mitten in Berlin ein Wahrzeichen zu errichten, wurde in Tel Aviv Wirklichkeit
Heiße Miezen
Straßenkatzen gehören zum Stadtbild jedes israelischen Wohnorts. Ihre Vorzüge erkennt man nicht immer gleich
Auferstanden aus Ruinen
Die Zukunft des Judenstaats, so scheint es, gehört den Ultraorthodoxen, die pro Haushalt dreimal mehr Kinder haben als der Landesdurchschnitt
Der Mossad für jedermann
Ehemalige Geheimdienstagenten bieten das Know-how des Mossad heute auf dem freien Markt für Wirtschaftsspionage an
Alltag in Jerusalem
Jerusalem ist für viele Menschen in der Welt mehr ein Symbol als eine Postanschrift
Ständig auf dem Hut
Vielen erscheinen ultraorthodoxe Juden nur als ein schwarzes Meer identisch gekleideter Personen. Im Hutgeschäft Ferster in Mea Schearim weiß man es besser
Eine Revolution zergeht auf der Zunge
Seitdem Israelis Geld in den Taschen haben und regelmäßig ins Ausland fahren, haben sie auch gutes Essen ins Land geholt
Toskana im Wilden Westen
Jenseits der Grenzanlagen im Westjordanland leben Hunderttausende israelische Siedler. Manche sehen sie als das größte Hindernis auf dem Weg zum Frieden
Kämpfen für Geschlechtertrennung
Die Aktivistin Leah Aharoni setzt sich für Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum ein. Die soll Männer und Frauen nämlich nicht einschränken, sondern befreien
Erstklassige Zweite-Klasse-Bürger
Vor dem Gesetz mögen alle Bürger gleich sein, trotzdem fühlen sich Israels Araber bis heute benachteiligt
Falsch gelaufen
Ein israelischer Archäologe will den wahren Ort entdeckt haben, an dem Pilatus Jesus den Prozess machte
Zwischen allen Stühlen
Die Christen im Heiligen Land wissen nicht, wohin sie gehören. Deswegen wandern die meisten von ihnen aus
Der Schmelztiegel
Im Verhältnis zu seiner Größe hat Israel mehr Einwanderer aufgenommen als jedes andere Land der Welt
Kosher Sex in Tel Aviv
Ein neues Geschäft in Tel Aviv will Israelis koscheren Sex nahebringen. Der soll nämlich besonders viel Spaß machen
Ein Vorwort
Es scheint fast unmöglich, Israel in einem einzelnen Buch zu vermitteln. Wie soll man ein Land definieren, in dem eines der ältesten Kulturvölker der Welt einen der jüngsten modernen Staaten der Erde gegründet hat? Wo moderner Nationalismus mit Bibelromantik verquickt wird und Hochtechnologie dazu dient, jahrtausendealte Bräuche zu praktizieren? Was ist typisch für ein Land, in dem die Kulturen von Einwanderern aus mehr als siebzig Ländern miteinander verschmelzen? Für einen Europäer ist Israel verwirrend vielfältig, faszinierend und facettenreich: Auf engstem Raum stößt Ost auf West, Alt auf Neu, Arm auf Reich, Religion auf Agnostiker. Moderne Wohnungen stehen auf zweitausend Jahre alten Fundamenten, grüne Weinberge sprießen mitten in der Wüste, junge Paare verlieben sich an der Klagemauer, und ja, Araber und Juden schließen manchmal tiefe Freundschaften.
Ebenso wie sich kaum erklären lässt, was eigentlich jüdische Identität ausmacht, genauso schwierig lässt sich das Phänomen erklären, das die Presse gern den »Judenstaat« nennt. Ist Judentum Religion oder Tradition, Volkszugehörigkeit oder Weltanschauung, eine Frage der Geburt oder der Überzeugung? Und ebenso fragt man nach der Quintessenz des Judenstaats: Ist er ein kolonialistischer Staat oder die Wiedergeburt eines unterdrückten Volkes, Demokratie oder Ethnokratie, Befreier oder Besatzer? Wie der ermordete Premierminister Jitzchak Rabin (der ehemalige Generalstabschef, der zum Friedensnobelpreisträger wurde) ist der Judenstaat in erster Linie ein Paradox. Kaum etwas kann stellvertretend für dieses eigensinnige, einzigartige Mischmasch stehen, das man Israel nennt. Der schludrige Kibbuznik hat als Stereotyp des neuen Israel längst ausgedient, genau wie der heldenhafte Fallschirmjäger, dem einst als Verkörperung des kleinen David im Kampf gegen den arabischen Goliath die Sympathien der Welt entgegenschlugen. Israel ist ein Land, das der Welt Computerchips und modernste Kommunikationstechnologie schenkt und gleichzeitig debattiert, wie jahrtausendealte biblische Gesetze heute angewandt werden sollten. So kann jeder Bericht immer nur einen Aspekt dieses kunterbunten Mosaiks beleuchten, dem Gesamtbild wird er nie gerecht.
Als Beobachter ist man ständig auf der Suche nach dem definierenden Moment, dem alles aussagenden Schnappschuss, der, ohne mit ermüdenden Erklärungen weit ausholen zu müssen, dieses Land intuitiv fassbar macht. Für mich ist dieser Augenblick der Übergang vom Gedenktag an die gefallenen Soldaten zu den direkt darauf folgenden Feiern zum Unabhängigkeitstag. Dieser dramatische Übergang ist charakteristisch für die Dilemmata und Debatten, die in Israel seit seiner Gründung jedes Jahr aufs Neue ausgetragen werden, und nirgends sind die Konsequenzen dieser Debatten deutlicher spürbar als in Tel Aviv.
Tel Aviv gilt als die Vergnügungsmetropole Israels. Rund um die Uhr wird hier gefeiert, gegessen und getanzt, fast das ganze Jahr hindurch. Wer einmal mittags durch die Straßen marschiert, in denen Kaffeehäuser vor lauter Andrang sogar in kleine Kioske mitten auf den Bürgersteigen ausweichen, könnte meinen, in dieser Stadt arbeiteten einzig die Kellnerinnen. Zweimal im Jahr jedoch hält selbst Tel Aviv den Atem an und versinkt für vierundzwanzig Stunden in tiefe Trauer. Wo sonst Bässe aus Diskotheken dröhnen und junge Menschen auf ihren Mopeds ausgelassen durch die Nacht knattern, herrscht plötzlich buchstäblich Totenstille. Der erste solche Tag ist Jom Haschoa, der Gedenktag für die Opfer des Holocaust, an dem man dem Andenken an den Völkermord der Nazis nicht entfliehen kann. Restaurants und Bars haben geschlossen und bieten keine Ablenkung, Fernsehen und Radio strahlen Dokumentarsendungen aus oder spielen melancholische Musik.
Während die Ereignisse des Holocaust-Gedenktags jedoch an Aktualität verlieren, behält der zweite Trauertag des Jahres seine Bedeutung. Jom Hasikaron, der Gedenktag für die gefallenen Soldaten und Terroropfer, und der direkt darauffolgende Unabhängigkeitstag Jom Haatzmaut sind die israelischsten aller Feiertage. Dafür sorgen nicht nur die im nationalen Blau-Weiß geschmückten Straßen und Autos, an deren Fenstern kleine Israelflaggen patriotisch im Fahrtwind flattern. Ja, schon die Debatten darüber, wann denn überhaupt der Unabhängigkeitstag begangen werden soll, dürften für Israel einzigartig sein. Im Jahr 2008 beispielsweise legte die Regierung den 8. Mai als Stichtag für die Feiern zum sechzigsten Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung fest, obschon David Ben-Gurion, der erste Premier, im Jahr 1948 den Staat doch fast eine Woche später, am 14. Mai, ausrief. Jüdische Feiertage richten sich aber nicht nach dem gregorianischen Sonnenkalender, sondern nach dem hebräischen Mondkalender. Derselbe Kalendertag, im Falle der Unabhängigkeitserklärung Israels der 5. Iyar, fällt jedoch nur selten zusammen. Im Jahr 2008 wurde der Unabhängigkeitstag aber auch nicht am 5. Iyar gefeiert. Der wäre auf Samstag, den 10. Mai gefallen. Der Sabbat ist Juden bekanntlich heilig, und viele festliche Aktivitäten wie öffentliche Konzerte hätten deshalb nicht stattfinden dürfen. Also wurde der Geburtstag Israels ganz einfach um zwei Tage auf den 3. Iyar vorgezogen, um religiösen Juden die Teilnahme an den Feiern zu ermöglichen.
Noch typischer als die Debatte über das Datum der Feiern ist der schwindelerregende Übergang von tiefster Trauer zu ausgelassener Freude. Am Morgen von Jom Hasikaron, dem Gedenktag für die gefallenen Soldaten, heulen für zwei Minuten die Luftschutzsirenen auf. Fast das ganze Land steht still. Autos auf den Autobahnen halten, Fahrer steigen aus und senken ihr Haupt in Andacht an die mehr als dreiundzwanzigtausendsiebenhundertein- undvierzig Gefallenen. Auf Bürgersteigen und in Supermärkten gedenkt man derjenigen, die für die Unabhängigkeit des Staates mit ihrem Leben bezahlten. Auf zig Friedhöfen weinen Väter an den Gräbern ihrer Söhne, Kinder am Grab von Vater oder Mutter. Viele Israelis haben Familienangehörige, Freunde oder Bekannte, die in einem Krieg gefallen sind.
Dann, am Abend, ist schlagartig alles vorbei. In einer kurzen Zeremonie wird noch einmal an die Opfer und Helden erinnert, dann wird die Flagge mit dem Davidstern auf Vollmast gehisst, fröhliche Märsche und Popsongs tönen aus dem Radio. Der Himmel, am Vortag noch mit Schwermut erfüllt, wird nun mit bunten Feuerwerken erhellt. Kinder strömen auf die Straßen und sprühen jauchzend Rasierschaum auf Passanten. Die erhabene Stille des Vormittags ist vergessen. Bis in die Morgenstunden fliegen Musikstars in Helikoptern von einer Freilichtbühne zur nächsten. Menschen tanzen, singen und trinken im Freien. Israel geht innerhalb weniger Minuten von Schmerz zu ekstatischer Freude über.
Das Fest der Freiheit der Israelis bedeutet für Palästinenser meist Ausgangssperre: Den Unabhängigkeitstag Israels nennen sie den Yaum an-Naqba, den Tag ihrer Katastrophe. Für sie war die Gründung Israels der Beginn ihres Leides. Nicht nur jenseits, auch diesseits der grünen Linie ist das eigenartige Gedenk- und Feiertagspaar problematisch: In arabischen Dörfern Israels heulen die Sirenen erst gar nicht auf. Für die Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit, immerhin ein Fünftel der Bevölkerung, sind diese nationalen Feiertage Momente schwerer Identitätskrisen, wenn ihnen deutlich wird, wie sehr ihre Loyalität zwischen ihrer Staats- und ihrer Volkszugehörigkeit gespalten ist. Doch nicht nur sie haben ein zwiespältiges Verhältnis zu ihrem Staat: Jahr für Jahr empören sich die Medien von Neuem über Juden in ultraorthodoxen Stadtvierteln, die während der Sirene nicht stehen bleiben, weil sie die Gedenkminute und die Feiern am Tag danach für heidnische Bräuche halten. Dass selbst diese Augenblicke den Staat nicht einen, ist vor allem für junge Israelis, die kurz vor ihrem Wehrdienst stehen und dieses paradoxe Gemisch verschiedenster Bevölkerungsgruppen bald mit ihrem Leben verteidigen sollen, problematisch.
Jedes Jahr diskutieren Israelis über dieses schizophrene Wechselbad der Gefühle. Doch genau dieser jähe Umschwung, das gelebte Paradox und die leidenschaftlichen offenen Debatten darüber, wie man es richtig macht, sind in meinen Augen für dieses Land typisch. Temperament, die Bereitschaft und Fähigkeit, Ungewissheit zu ertragen und mit ihr offen und konstruktiv umzugehen, machen für mich den Reiz Israels aus. Ein Land, auf das jede Definition passt, und dem doch keine gerecht werden kann.
Die israelischsten Fragen
Zwei Fragen gelten als typisch israelisch. Die erste: »Wo hast du in der Armee gedient?« ist recht harmlos. Die zweite hat jedoch manchmal schwerwiegende Konsequenzen
»Wo sind wir zu den Feiertagen?« ist die Frage, die sich junge Paare alle paar Wochen zu einem der zahlreichen jüdischen Feiertage stellen. Das Dilemma ist einfach beschrieben: »Bei deinen oder bei meinen Eltern?«, lautet die Frage, über die tagelang gestritten wird, bestimmt sie doch häufig nicht nur über das persönliche Wohlbefinden, sondern auch über den Einstellwinkel eines schiefen oder wohl justierten Haussegens. (Übrigens: Der deutsche Ausdruck »da hängt der Haussegen schief« ist eng mit dem jüdischen Brauch verbunden, eine Mesusa, eine kleine Kapsel mit einem Gebet, am Türpfosten anzubringen. Dies nutzten Christen in der Vergangenheit dazu, um an der geraden Kapsel einen kleinen Querbalken anzubringen -– machten daraus also ein Kreuz. Um dies zu verhindern, begannen Juden, die Kapsel schief anzubringen. So bedeutete der Ausdruck: Bei denen hängt der Haussegen schief eigentlich: Da wohnen Juden.)
In Israel wird der Jahresrhythmus von den religiösen Feiertagen diktiert. Eigentlich begehen alle die gleichen Feste. Oberflächlich betrachtet haben die Juden aus mehr als siebzig Herkunftsländern ähnliche Traditionen. Zu den hohen Feiertagen, dem Neujahr und dem Versöhnungstag Jom Kippur, tragen die meisten ein feierliches Weiß. Lederschuhe sind verpönt. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail, und wie genau die Feiertage begangen werden, hängt ganz davon ab, aus welchem Land die Eltern ursprünglich stammen.
Böse Zungen behaupten, dass man alle jüdischen Feiertage mit einem kurzen Motto erklären kann: »Sie wollten uns töten, wir haben überlebt, was gibt’s jetzt zu essen?« Tatsächlich sind die gemeinsamen Gelage meist Hauptprogrammpunkt, und hier scheiden sich die Geister. Nehmen wir den gefillten Fisch zum Beispiel: eine glorifizierte gesüßte und kalt gereichte Fischfrikadelle, die meistens mit einem wacklig-glibberigen Film von Gelatine und zerkochten Möhrchen überzogen wird. Für eine aschkenasische Großmutter, also eine Jüdin, deren Vorfahren aus Osteuropa stammen, ist der meist fade gefillte Fisch ein Eckpfeiler des Festtagsessens. Dabei ist es ihr völlig gleichgültig, dass das Exil bereits vor Jahrzehnten endete und der israelische Markt ihr eine Vielzahl exotischer Gewürze bieten kann, um der Fischbulette Geschmack zu verleihen.
Ein Mizrahi, also ein Jude, dessen Eltern aus arabischen Ländern einwanderten, reagiert nicht selten mit Entsetzen, wenn ihm dieses graue schwabbelnde Etwas an einer aschkenasischen Tafel als Vorspeise serviert wird. Schließlich wurde seine Zunge ja nicht von Kindesbeinen an darauf trainiert, sich den Geschmack des Essens selbst dazu zu denken. Umgekehrt lösen die deftig gewürzten Speisen der Mizrahim bei Aschkenasen nicht nur ein Feuer im Schlund, sondern auch anhaltendes Sodbrennen aus, das so manchem die Pein des Fasttags Jom Kippur wie einen Genuss erscheinen lässt.
Und das ist nur die Vorspeise! Gelangweilten Hausfrauen fielen in den Jahrhunderten allerlei ausgefallene Gerichte ein. Dass ein Apfel in Honig getaucht wird, um ein süßes neues Jahr zu symbolisieren, ist dabei noch der appetitlichste Brauch. Aber wenn Rinderlungen gereicht werden, um die Hoffnung zu versinnbildlichen, dass man künftig nur noch »Sünden so leicht wie Luft« begehen möge, oder wenn ein Tierkopf auf der Tafel erscheint, damit man immer am Anfang und nicht am Ende stehen möge, vergeht vielen der Appetit.
Die Antwort auf die Frage: »Wo sind wir zu den Feiertagen?« entscheidet also nicht nur, wessen Eltern denn nun dieses Jahr beleidigt sein werden, sondern oft auch, welcher Partner nach dem Feiertag hungrig ins Bett steigt. Kein Wunder, dass immer mehr israelische Paare versuchen, sich diesem Dilemma zu entziehen. Nicht umsonst verlässt an den wichtigsten Feiertagen alle fünfzig Sekunden ein Flugzeug das Land. Die Lieblingsantwort auf die israelischste aller Fragen lautet neuerdings: »Gott sei Dank, im Ausland!«
Wie der Holocaust nach Israel kam
Der Holocaust ist ein entscheidender Bestandteil der israelischen Psyche. Das war nicht immer so
Beruhigend tickt die große Standuhr im Hintergrund und passt so gar nicht zu der Geschwindigkeit, in der dieser agile dreiundachtzig Jahre alte Mann sein ereignisreiches Leben Revue passieren lässt. »Es ist vielleicht nur eine Nebensache«, sagt Gabriel Bach. »Aber jedes Mal, wenn ich ein Kind in einem roten Mantel sehe, bekomme ich Herzklopfen. Dieser Anblick erinnert mich mehr an den Prozess als alles andere.« Selbst bei jemandem, der so abgebrüht und erfahren ist wie Gabriel Bach, hinterlässt es schmerzvolle Narben, einen der größten Mörder des 20. Jahrhunderts anzuklagen. Das Aktenzeichen 40/61 mag harmlos klingen. Hinter diesen Ziffern versteckt sich jedoch einer der wichtigsten Prozesse in Israels Staatsgeschichte. Kein anderes Gerichtsverfahren prägte die israelische Gesellschaft so nachhaltig wie der Prozess gegen SS-Obersturmbannführer Otto Adolf Eichmann, der als Leiter des Referats IV D4 im Reichssicherheitshauptamt maßgeblich für die Deportation und Ermordung von Millionen Juden verantwortlich war. Bach hat als Staatsanwalt und später als Richter am Höchsten Gerichtshof an mehreren spektakulären Prozessen mitgewirkt. Kein Ereignis prägte sein Leben jedoch so wie die Monate, in denen er als stellvertretender Chefankläger im Eichmann-Prozess fungierte.
Als israelische Geheimdienstagenten den Obersturmbannführer 1960 in Buenos Aires aufgriffen und nach Jerusalem vor Gericht brachten, begann für Bach und den ganzen Staat Israel ein neues Kapitel. Am 11. Mai 1960 versetzte Israels Premier David Ben-Gurion das Land in Aufregung. In trockenen Worten verkündete er vor der Knesset





























