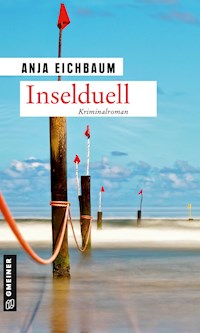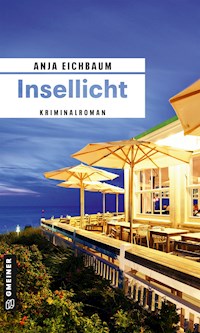Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ruth Keiser und Martin Ziegler
- Sprache: Deutsch
Ironie des Schicksals: Marie Hafen glaubt, von ihrer Krebserkrankung geheilt zu sein, als sie ermordet wird. Nicht nur die behandelnde Privatklinik, sondern die gesamte Ostsee-Region ist erschüttert. Passt der Mord in das Schema zweier ähnlicher Fälle? Die Schweriner Mordkommission ist sich uneinig. Gut, dass der neue Ermittler Dr. Ernst Bender auf Polizeipsychologin Ruth Keiser und den Norderneyer Polizisten Martin Ziegler trifft. Gelingt es ihnen gemeinsam, den Fall zu lösen oder geraten die Ermittlungen nun erst recht außer Kontrolle?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Eichbaum
Letzte Hoffnung Meer
KRIMINALROMAN
Zum Buch
Heilsversprechen Drei Morde im Zuständigkeitsbereich der Kripo Schwerin versetzen die Urlaubsregion in helle Aufregung. Besonders der Tod von Marie Hafen, Krebspatientin in einer Privatklinik, löst Betroffenheit aus. Derweil kommt es innerhalb der Mordkommission zu einem Kompetenzgerangel rund um den neuen Ermittler Dr. Ernst Bender. Tiefsitzende Vorbehalte brechen hervor. Dass Bender mit der Polizeipsychologin Ruth Keiser und dem Norderneyer Polizisten Martin Ziegler alte Bekannte an der Ostsee trifft, mutet wie Zufall an, verhilft Bender aber zu Unterstützern vor Ort. Schon bald haben Ruth und Martin die „Strandbude 20“ als ihren Treffpunkt ausgemacht. Denn dort gibt es nicht nur den besten Kaffee, sondern auch örtliches Insiderwissen und die neuesten Infos, die ihnen helfen, die vielen ungewöhnlichen Ereignisse zu verstehen. Stück für Stück gelingt es dem inoffiziellen Ermittlerteam, das Puzzle rund um die Mordfälle zusammenzusetzen …
Anja Eichbaum stammt aus dem Rheinland, wo sie bis heute mit ihrer Familie lebt. Als Diplom-Sozialarbeiterin ist sie seit vielen Jahren leitend in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Frühere biografische Stationen wie eine Krankenpflegeausbildung und ein „halbes“ Germanistikstudium bildeten zugleich Grundlage und Füllhorn für ihr literarisches Arbeiten. Seit 2015 geht sie mit ihren Werken an die Öffentlichkeit. Aus ihrer Liebe zum Meer entstand ihr erster Norderney-Krimi, denn ihre Bücher verortet sie gern dort, wo sie selbst am liebsten ist: am Strand mit einem Kaffee in der Hand. Auf Eichbaums erfolgreiches Debüt »Inselcocktail« (2017) folgt nun ein Ostsee-Krimi.
Alle bisherigen Veröffentlichungen der Autorin finden Sie bei uns im Internet!
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Volker / fotolia.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5914-6
Personenregister
Ruth Keiser, Polizeipsychologin
Martin Ziegler, Dienststellenleiter Polizei Norderney
Anne Wagner, Ärztin im Krankenhaus Norderney
*
Kriminalpolizeiinspektion Schwerin:
Doktor Ernst Bender
Jürgen Hofmann
Wolfgang Markow (Vorgesetzter)
Doktor Lorenz, Rechtsmediziner
u.a.
*
Polizeistation Boltenhagen:
Bernd Schulz
*
Seeadlerklinik:
Doktor Leonhard Schwab, Chefarzt
Elena Makowski, Patientin
Gerda, Patientin
Kerstin, Patientin
Peter, Patient
Jasmin, Krankenschwester
*
Rosensanatorium:
Dr. Gisela Baltrup, Chefärztin
Verena Wegner, Krankenschwester
Tom Jansen, Krankenpfleger
Simone, Krankenschwester
Sabrina, Krankenpflegehelferin
Marie Hafen, Patientin
Marion Heckel, Patientin
Ohlsen, Portier
*
Dr. Rolf Schimmer, Internist und Belegarzt
Charlotte Schimmer, seine Frau
Juliana, die Tochter
*
Jakob Behrends, Apotheker
Susanne Behrends, seine Ex-Frau
Ronja, die Tochter
*
Evelyn Jasper, »Dorfhexe«
Norbert Rother, Sargmacherstraße
*
Steiner, Pharmareferent
*
Strandbude 20
Georg und Hella, Besitzer
Jens, Angestellter
*
Ingeborg Bruch, Taxifahrerin in Wismar
Mona, medizinische Fachangestellte
*
Café Glücklich, Wismar
Café Sinnenreich, Wismar
Prolog
Schimmer starrte auf den Bildschirm. Seine Hand bewegte unruhig die Maus, an der er sich festzuhalten versuchte. Er ahnte, in welch fassungslose Gesichter er sähe, wenn er den Blick hob. Er versuchte den Moment so lange wie möglich hinauszuzögern.
Wie er diese Augenblicke hasste. Der Fluchtgedanke ergriff ihn nahezu jedes Mal. Alles stehen und liegen lassen. Jetzt gleich. Wie es vor Jahren schon in der Politik passiert war. Einfach gehen. Ohne erkennbaren Anlass. Aus dem laufenden Geschäft heraus, den weißen Kittel ausziehen, den Kollegen mal eben zunicken – bin gleich zurück, würde das heißen – und im Foyer durch die große Schiebetür nach draußen treten. Tief durchatmen, die Freiheit spüren.
Genau an dieser Stelle seiner Gedanken verließ ihn jedes Mal die Fantasie. Es gab in seinem Leben keinen Plan B. Es gab nur diesen einen, seit Generationen vorbestimmten Weg. Alternativen waren für Spinner, aber nicht für Dr. med. Rolf Schimmer gedacht. Welches Leben sollte das auch sein? Alles aufzugeben, dazu war er nicht bereit. Sein Lebensweg war alternativlos.
Die Worte des Mannes drangen wie aus weiter Ferne zu ihm. »Was heißt das jetzt genau? Raumfordernder Prozess? Was bedeutet das für meine Frau?«
Er hörte genau, wie die Stimme des Mannes bei den letzten Silben in ungewöhnliche Höhen kippte. Wahrscheinlich hatte er schon eine Ahnung dessen, was er gleich hören würde.
Er hob den Kopf und erfasste mit einem Blick das Ehepaar, das mit großen, schon jetzt fassungslosen Augen vor ihm saß. In seinem Alter, gut gekleidet, keine dieser Patienten, bei denen man sofort eine Erklärung zur Hand hatte: Raucher. Übergewichtig. Zu wenig Bewegung.
Mit gesenktem Kopf nahm er ein weiteres Mal die Maus zur Hilfe, umkreiste mit dem Cursor das betroffene Gebiet, nachdem er den Bildschirm noch einmal etwas weiter in ihre Richtung gedreht hatte.
Er räusperte sich. »Natürlich können wir erst mit einer Gewebeprobe letztendliche Aussagen treffen. Aber alles, was sich uns hier heute darstellt, spricht für einen unaufhaltsamen Prozess, den wir verlangsamen, aber nicht stoppen können.«
Das Schweigen im Raum war schlicht nicht auszuhalten. Hatten die beiden verstanden, was er ihnen mitteilte? Musste er etwa noch deutlicher werden? Worauf warteten sie? Er schluckte. »Wenn Sie einverstanden sind, planen wir als Erstes die Operation und stellen dann den Behandlungsplan auf. Wünschen Sie eine psychoonkologische Begleitung?« Er hörte selbst, wie hohl und auswendig gelernt seine Ausführungen klangen. Er ahnte, dass er damit nicht durchkommen würde.
Tatsächlich schienen seine vorherigen Worte erst jetzt bei der Patientin angekommen zu sein. »Nicht stoppen können? Was heißt das? Es muss doch irgendetwas geben?« Ihre Stimme klang tonlos, er wusste, wie sehr sie damit die aufkommende Panik zu unterdrücken versuchte.
Der Schweiß brach ihm unter seinem weißen, gestärkten Baumwollkittel aus. Wieder streifte sein Blick nur ihr Gesicht und heftete sich dann an die Wand hinter der Patientin, wo ein Fotodruck der mallorquinischen Finca hing, die er zusammen mit seinem besten Freund gekauft hatte und in der er jedes Jahr die besten Wochen seines Lebens verbrachte. Aber nur weil er sie sich hier verdiente. Alternativlos. Ohne internistische Praxis kein privilegiertes Leben. Das eine war nicht ohne das andere denkbar.
»Sie sollten beginnen, Ihr Leben zu ordnen. Wir werden Sie nicht heilen können.«
Sie stöhnte auf. Ein Stöhnen, das tief aus ihrem Bauch zu kommen schien. Gleichzeitig sackte ihr Oberkörper ein.
»Welche Möglichkeiten haben wir?« Der schnelle Griff ihres Ehemanns hielt sie. Der Arzt konnte über den Schreibtisch hinweg die Kraft spüren, die die beiden verband. »Wir sind bereit, alles zu tun, was medizinisch indiziert ist.«
Doktor Schimmer nickte. Da war jemand gewohnt, die Dinge in die Hand zu nehmen. Nach schnellen und pragmatischen Lösungen zu suchen. Kommunikation auf Augenhöhe und mit Sachverstand. Er würde das alles nicht anbieten können. Es gab keine Lösung. Am Ende würde wieder nur die Emotion stehen.
»Wie lange?«
Er hatte auf die Frage gewartet. Er durfte nicht lügen. Er durfte keine Hoffnung machen, wo es keine gab.
»Wir haben kleine Kinder.« Sie hatte sein Zögern genutzt, um den Satz hinterherzuschieben.
Als wenn es etwas an den Tatsachen ändern könnte. Als wenn die Beurteilung der Faktenlage dadurch eine andere würde. Er konnte doch nichts dafür. Er war nur der Überbringer von Nachrichten. Ein hervorragender Diagnostiker. Aber kein Heiler. Kein Seelenretter.
»Stellen Sie sich auf maximal ein Jahr ein. Es tut mir leid.«
3 Jahre später
5. August
Sie kamen immer im Morgengrauen. Wenn die meisten noch schliefen. Sie wollten nicht gesehen werden, weil das die Stimmung im Haus sofort verschlechterte. Elena war realistisch genug, um das zu wissen. Sie hatte das Sterben ihrer Mutter begleitet, damals im Hospiz und viel zu viel von dem aufgeschnappt, was sie heute am liebsten nicht wüsste.
Auch zu nachtschlafender Zeit trugen die Bestatter die schwarzen Anzüge. Ob sie es wirklich aus Respekt vor den Toten taten oder um für sich selbst dadurch eine feierliche Distanz zu schaffen? Sie wusste es nicht. War es nicht auch egal? Ab wann würde alles egal sein? Erst mit dem Tod oder dann, wenn man endgültig kapitulierte?
Elena erschrak, als sie im Fenster der gegenüberliegenden Privatklinik eine weißgekleidete Person stehen sah. Sie kniff die Augen zusammen. Nein, kein Engel, wie ihr eine Stimme im ersten Augenblick einflüstern wollte. Dort stand ein Krankenpfleger. Blödsinn, maßregelte sie sich, Gesundheitspfleger hieß es heutzutage. Als wenn das etwas daran änderte, womit sie es zu tun hatten. Herr Jansen hieß der Mann, sie hatte ihn eher durch Zufall kennengelernt, als sie zu einer privaten Laboruntersuchung in der Arztpraxis nebenan war. Er hatte einen Mann begleitet, dem man von Weitem das Stadium seiner Erkrankung ansehen konnte. Elena hatte sich erschrocken und dennoch nicht den Blick abwenden können. Das waren die Momente, vor denen sie sich schon vor Antritt der Rehabilitation gesorgt hatte. Was, wenn sie hier alles noch mehr belasten, noch mehr herunterziehen würde? Sie hatte sich in eine ausliegende Zeitschrift vertieft, aber dann hatte die freundliche Stimme des Pflegers sie erneut aufmerken lassen. Was für ein mitfühlender junger Mann. Er war ihr sympathisch, weil er nicht so ein übertriebenes Getue gemacht hatte, wie sie es in den letzten Monaten viel zu oft erlebt hatte.
Seltsam, wie dieser Jansen jetzt dort zu dem Leichenwagen sah. Das würde nicht das erste Mal sein, dass er den letzten Abtransport beobachtete. Sollte ihm so etwas immer noch nahegehen?
Elena wandte sich ab. Es war morbide und selbstzerstörerisch, was sie hier machte. Schlimm genug, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Aber sie hatte sich geschworen, ihre Energie den positiven Dingen zuzuwenden. Die positiven Dinge waren das Meer. Die Ostsee, die sie schon als Kind so geliebt hatte. Und ihre Strandbude. Die der Himmel hierhin gesetzt haben mochte. Ein Ort, an dem sich die Gesunden und Kranken trafen, einander beäugten, als kämen sie von unterschiedlichen Planeten. Ein Ort, an dem die Urlauber demütig wurden. An dem die Kranken manchmal verzweifelten, aber genauso oft Hoffnung schöpften. Mal sehen, ob es dort schon einen Kaffee gab.
*
Toms Nachtdienst war schon längst zu Ende. Trotzdem saß er noch immer im Stationszimmer. Der Tagdienst wuselte um ihn herum. Von Zeit zu Zeit forderte ihn jemand auf, doch nach Hause zu gehen. Aber Tom hatte abgelehnt.
»Lasst mal. Ich bin topfit. Ich koche euch allen einen Kaffee und mache noch die Apothekenbestellung.«
»Das kann doch der Spätdienst machen. Du solltest jetzt nach Hause gehen.« Schwester Verena schaute Tom prüfend ins Gesicht. »Ist etwas nicht in Ordnung?«
»Was, bitte, soll daran nicht in Ordnung sein, dass ich euch helfen will?«
Verena biss sich einen Moment auf die Lippen. Tom ahnte, wie sie ihre Worte abwägte. Sie konnte sich nicht leisten, jemanden aus dem Pflegedienst zu verprellen. Stellen gab es wie Sand am Meer. In vielen Krankenhäusern wurden mittlerweile Erfolgsprämien für die Vermittlung von Pflegepersonal ausgelobt. Verena würde nicht zu weit gehen. Da war sich Tom sicher. Ganz sicher.
»Also? In Ordnung, wenn ich noch helfe?«
Verena senkte den Blick. »Na ja, von mir aus. Ich verstehe zwar nicht, was dich umtreibt. Jeder andere will hier nach seinem Dienst nur raus.«
»Vielleicht bin ich ja in einen der Ärzte verliebt?« Tom hatte die Stimme in die Höhe geschraubt und deutete mit seiner Hand das Tragen einer Handtasche an.
»Du bist sowas von daneben.« Verena schien jetzt doch sauer zu werden. »Dass Schwulsein nichts Schlimmes ist, scheint bei dir ja noch nicht angekommen zu sein. Wie retro bist du eigentlich?«
»Ach komm, machst wieder einen auf liberale Wessie-Emanze. Bloß, weil ihr mal sowas wie eine Hippiezeit hattet, müsst ihr euch nicht so aufspielen. So, wie die Leute hier ticken, ist das schon ganz in Ordnung.«
»Hauptsache, du bist dir ganz sicher, dass du richtig tickst: Tom Jansen, der Checker. Wenn du so an deinen alten Zeiten hängst, dann nenn dich doch weiter Thomas. Aber nein, so retro darf es dann wohl nicht sein.«
Verena drehte sich von ihm weg und Tom ahnte, dass sie ihm verdeckt den Mittelfinger zeigte. Offen durfte sie es nicht. Schließlich war sie seine Vorgesetzte. Dumme, arrogante Gutmensch-Lesbe, die sich hier als Stationschefin aufspielte.
Tom grinste. Sie würde schon sehen. Er hatte Zeit.
*
Marie war überzeugt davon, dass der verdammte Krebs ihr nicht das Leben nehmen würde. Wenn sie eins wusste, dann das.
Sie hörte, wie sehr ihr Atem sich durch die Luftröhre nach außen quälte. Das Einatmen gelang ihr erstaunlich gut. Besser, als sie gedacht hatte. Es waren Momente wie diese, die sie hoffen ließen. Hoffnung beim Luftholen. Entsetzen und Angst beim Ausatmen. Als gäbe es einen Mechanismus, der ihre Trachea dehnte und wieder verschloss und das im Rhythmus ihres Atmens.
Trachea. Noch vor wenigen Monaten hätte sie mit dem Wort nichts anfangen können. Hätte abgelehnt, sich damit zu beschäftigen. Sie machte einen Bogen um all die Möchtegernmediziner, die sich um sie herum ausbreiteten. Wie sie es überhaupt hasste, wie mittlerweile jeder glaubte, alles zu wissen, alles zu verstehen, alles kommentieren zu müssen.
Marie hatte weder Lust noch Zeit, zu jeder Frage ihren Wikipedia-Joker zu zücken. Und doch konnte man sich kaum entziehen.
Hieß es nicht, die Ärzte verabscheuten die Patienten, die zur Behandlung kamen, nachdem sie sich bei Dr. Google die Erstdiagnose geholt hatten? Marie hatte den Eindruck gewonnen, dass die Ärzte im Gegenteil erwarteten, vom Patienten in die richtige Richtung geführt zu werden. Nicht nur das. Sie ließen die Patienten auch nach den Diagnosen reihenweise allein. Die Menschen, die auf den fachlichen Rat vertrauten, die die Meinung des Arztes schätzten und ihr vertrauten, waren auf sich selbst gestellt.
Was war schon davon zu halten, wenn aus dem Munde des Arztes die Empfehlung kam, sich eine Zweitmeinung einzuholen und die Informationsbroschüren der Deutschen Krebsgesellschaft mit nach Hause zu nehmen?
Fuck off!
Marie keuchte. Sie hatte sich tatsächlich in Rage gerannt. Wobei gerannt nicht der Ausdruck war, der Gesunden einfallen würde, wenn sie ihr zusähen. Ihr Atem arbeitete sich geräuschvoll wie der Dampf einer alten Maschine aus ihrem Mund. Marie war froh, dass sie diese nachtschlafende Zeit gewählt hatte, um das Laufen zu testen. Seit einer Woche steigerte sie von Tag zu Tag den Wechsel zwischen Gehen und Laufen. Dafür brauchte sie kein Publikum. Sie wollte es wissen: Was war noch möglich? Hatte sie eine Chance?
Ihre Wut steigerte die Kraft, die sie trotz der Atemnot in ihre Beine legte. Sie stampfte und drückte jedes einzelne Sandkorn in den weichen, torfigen Boden der Strandpromenade, bevor sie auf Höhe des Hundestrandes auf das abgelegene Ruinengrundstück abbog, das den Wendepunkt ihrer Laufstrecke markierte.
Maries Wut richtete sich gegen ihre eigene Korrektheit. Gegen ihre Fachlichkeit. Wie ernst hatte sie ihren Job doch genommen. Als Bankerin das Vermögen ihrer Kunden verantwortlich verwaltet. Nicht die Kunden angerufen: Holen Sie sich zu der Aktie lieber eine Zweitmeinung ein und vergessen Sie bitte nicht den Prospekt neben dem Bankschalter, der Sie über Anlagerisiken berät.
Sie hatte ihren Job gemacht und nun verlangte sie das, und nur das, von ihren Ärzten. Fachliche und kompetente Aufklärung. Eine klare Behandlungsempfehlung.
Aber das schien dieser Schimmer nicht leisten zu können. Nicht leisten zu wollen. Wenn Marie sich umhörte, zweifelte sie daran, dass irgendwer es leisten wollte. Jedenfalls nicht so, wie sie es sich vorstellte. Wie sie es brauchte. Ja, sie sollte dankbar sein. Hatte jeden Hoffnungszipfel ergriffen, der sich ihr bot. Alle sprachen von einem Wunder. Spontanremission. Das Wort, auf das alle hofften. Aber umso wichtiger war es doch, den Erfolg bei ihr öffentlich zu machen. Die Geheimniskrämerei würde sie jedenfalls nicht mitmachen. Da musste es doch eine Fachaufsicht geben. Das musste doch noch jemanden außer ihr interessieren. Und das hatte sie diesem Doktor Schimmer auch ins Gesicht gesagt.
Maries Atem wurde rasselnder. Sie blieb stehen, beugte sich zurück und stützte mit den Händen ihren Rücken. Das Einatmen bereitete ihr nun auch Schmerzen.
Nur mit Willenskraft würde sich der Feind in ihrem Körper nicht besiegen lassen. Aber letztendlich würde sie es schaffen. Das schwor sie sich. Der erste Erfolg war da. Was für ein Sieg.
Sie beugte sich nach vorne und legte ihre Hände quer auf die zitternden Oberschenkel. Luft holen, zu Atem kommen. Sie blickte auf. Zwischen den Bäumen sah sie das Meer. Wie ein ruhiges hellblaues Band zog es sich um die geschwungene Küste, legte sich geschmeidig in die Bucht, die links von einer Steilküste begrenzt wurde. Als wäre das Meer schwanger und schöbe die Auswölbung seines Bauches immer weiter Richtung Land. Marie spürte eine machtvolle Sehnsucht nach der klaren Wasseroberfläche. Sich hineingeben, sich hingeben. Aufgeben. Zurückkehren, von wo sie einst gekommen war.
Sie schüttelte sich. Nein, sie musste solche Gedanken radikal verdrängen. Durfte sich nicht schwächen lassen.
Als sie das Knacken hinter sich hörte, hatte sie sich gerade wieder zu voller Größe aufgerichtet. Natürlich würde sie es schaffen. Wie sie bisher im Leben alles geschafft hatte. Da würde sie sich von diesem Krebs doch nicht reinpfuschen lassen.
Langsam drehte sie sich um. Sie hätte nicht sagen können, mit was sie gerechnet hatte. Ganz sicherlich nicht mit dem, was sie sah.
Der Schrei erstarb ihr im Mund. Die Gedanken rasten. Die Füße wollten laufen, aber sie hatte schon alle Kraft verbraucht.
Hinter ihr stieg die Sonne gerade auf und legte einen goldenen Schleier über seine schwarze Gestalt. Im Messer verfing sich ein Sonnenstrahl wie ein geplantes Beleuchtungsszenario.
Er keuchte, als er näher kam. Wie sonderbar, dass ihr Atem sich nun gänzlich beruhigt hatte.
»Was ist?«, stieß sie hervor.
Die Gedanken ratterten. Es war ein Traum, ein Alp, aus dem sie jeden Moment erwachen musste. Das Schreckgespenst der Krankheit hatte sich im Schlaf verkleidet, wollte ihr Botschaften schicken. Das war nicht real. Das konnte nicht sein.
Erst, als das Messer auf sie zuraste, stieß sie den Schrei aus, der gurgelnd verhallte, als die kalte Spitze in ihre Kehle drang.
*
Ruth Keiser sprang mit einem Satz aus dem Bett. Ein Geräusch, das sie nicht zuordnen konnte, hatte sie geweckt. Einen Moment lang drehte sich alles um sie, sodass sie wieder zurücksank. Ruth hatte keine Ahnung, wo sie sich befand und erst nach und nach sortierten sich die Farben, die Holzwände, die Möbel, das Zimmer und die Laute, die von draußen hineindrangen, zu einem erklärenden Ganzen. Ruth ließ sich wieder auf das Bett sinken. Sie registrierte die fast leere Flasche Chardonnay auf dem Nachttisch, daneben ein Glas, in dem sich ein letzter Rest befand und über dem sie eingeschlafen sein musste. Ohne Zähneputzen, schoss ihr durch den Kopf. Ach, shut up, ließ sie den nächsten Gedanken ungewohnt drastisch folgen. Sie war nicht ihre eigene Erziehungsberechtigte und ihr Zahnarzt war mehr als zufrieden mit dem Zustand ihres Gebisses. An ihnen werde ich nicht reich, pflegte er zu scherzen, was er bedaure, weil sie doch privat versichert sei. Er wäre der Erste, der ihr das vergessene Zähneputzen nachsehen würde. Erst recht, wenn sie ihm erklärte, was dazu geführt hatte. Er konnte das gut. Sich interessieren und verstehen. Zahnheilkunde muss dem ganzheitlichen Ansatz folgen, war seine Devise und sie lächelte bei dem Gedanken. Manchmal hatte sie den Eindruck, dass er damit einfach besser bei den Patientinnen punkten konnte und er dem ein oder anderen Flirt durchaus nicht abgeneigt war. Aber es ging auch das Gerücht, dass er sich nicht einfangen ließe und das wiederum gefiel Ruth, die nach ihrer gescheiterten Ehe nicht noch einmal vorhatte, sich auf ein Konstrukt einzulassen, das am Ende nur Verletzungen und Enttäuschungen bereithielt. Mochte eine Heirat nach wie vor eine tragfähige Basis sein, um gemeinsam Kinder zu erziehen, so griff dieses Argument bei ihr nicht mehr. Sie war ihrem Ex-Mann Michael mehr als dankbar, dass sie es allen Zerwürfnissen zum Trotz geschafft hatten, ihre gemeinsame Tochter aus den Scheidungsstreitigkeiten herauszuhalten. Jetzt war Lisa-Marie erwachsen, stand auf eigenen studentischen Füßen und sie, Ruth, hatte eindeutig die Grenze überschritten, noch einmal Mutter und Ehefrau werden zu wollen. Tatsächlich war alles gut so, wie es war. Meistens jedenfalls. Und besonders nach einem harmlosen Flirt mit ihrem Zahnarzt.
Aber dass sie hier heute Morgen mit schalem Weingeschmack erwachte, war eindeutig ein Zeichen, dass zumindest gerade jetzt doch nicht alles in Ordnung war.
Sie stöhnte auf. Was hatte sie sich da nur eingebrockt?
Sie richtete sich erneut auf. Langsamer als vorhin. Blieb erst einmal gerade stehen und streckte die Arme über den Kopf. Dann beugte sie sich mit Schwung nach vorne und hob die Arme über die Seiten wieder an, um die Hände anschließend gefaltet vor ihrer Brust zum Ruhen zu bringen. Sich wenigstens kurz fokussieren, ab morgen würde sie dann mit dem gewohnten Sonnengruß in den Tag starten.
Ruth gähnte, während sie auf dem Weg ins Bad überlegte, ob sie erst die Kaffeemaschine anstellen sollte. Aber sie wusste nicht, welche Art von Maschine sie in der Küche erwartete und verwarf den Gedanken wieder. Erst für einen klaren Kopf zu sorgen, schien ihr angebrachter.
Im Badezimmerspiegel verwuschelte sie bei ihrem Anblick ihre blonden, kräftigen Locken. Immerhin ließen sich ihre Haare nicht aus der Ruhe bringen, das war schon was. Die Falten in ihrem Gesicht allerdings erzählten eine ganz andere Geschichte und Ruth schüttelte sich kurz. Bisher war das Älterwerden ziemlich spurlos an ihr vorbeigegangen, aber heute Morgen war sie mehr als dankbar, dass niemand außer ihr Zeuge eines nun deutlichen Verfalls wurde. Sie hatte immer abgetan, dass ihr das Älterwerden etwas ausmachte, daran begann sie gerade gehörig zu zweifeln.
Was soll’s, dachte sie im gleichen Augenblick. Es war sowieso nicht zu ändern, und alles andere war derzeit wichtiger. Sie seufzte tief, drehte das Wasser auf kalt und schüttete sich mit den hohlen Händen die kühle Nässe ins Gesicht.
»Schon viel besser«, sagte sie laut zu ihrem Spiegelbild und griff zu den bunten Handtüchern auf der Ablage. Hier schien jemand zu wissen, dass sie Farben dringend nötig hatte.
Sie zog T-Shirt und Slip aus, ließ beides auf dem Boden liegen und schlüpfte im Schlafzimmer in frische Wäsche. Die Jeans von gestern und ein frisches Shirt aus der achtlos in die Ecke gestellten Reisetasche würden vorläufig reichen. Sie schloss die Gürtelschnalle und steckte dann beide Hände in die Taschen, um den Hosenbund bis auf die Hüfte hinunterzudrücken. Sofort fühlte sie sich besser. Du und deine Jeans, hatte ihr Ex immer gemeckert. Es war ihre Uniform, ihr Schutz, ihre zweite Haut.
Ruth tapste auf nackten Füßen zum Fenster. Gestern Abend war sie so spät und übermüdet angekommen, dass sie froh über die zugezogenen Vorhänge vor den Fenstern war. Nichts war ihr lieber gewesen, als die Welt auszusperren. In der lauen Sommernacht hatten viele Familien draußen gesessen, und der ganze Ferienpark war erfüllt gewesen von sommerlicher Heiterkeit. Sie alle hatten Ruth verwundert betrachtet, die allein mit ihrem Mini-Cabrio vorgefahren war und mit nichts anderem als einer abgewetzten ledernen Reisetasche und einem schweren Rucksack das Haus betreten hatte. Kurz danach hatte sie noch eine Kiste mit Büchern und Ordnern vom Beifahrersitz gewuchtet. Sie hatte die Blicke, die sie ins Ferienhaus begleiteten, gespürt und die Gedanken der anderen erraten. Es war auch zu verwunderlich, was jemand mit dieser Ausstattung hier im Ferienpark suchte. Bullshit, hatte Ruth gedacht, als sie mit der Kiste in den Händen die weiße Holztür mit der Hacke zustieß. Denen da draußen war sie keine Rechenschaft schuldig und sie würde ihnen wenig Gelegenheit für Begegnungen bieten. Schließlich hatte sie sich ein volles Arbeitsprogramm verordnet.
Mit Schwung riss sie nun den gelben Vorhang zur Seite. Ihr Schlafzimmer befand sich vis-à-vis zum Fenster eines roten Schwedenhauses. Nett hier, schoss es Ruth durch den Kopf, vielleicht würde die Umgebung sowohl inspirierend als auch beruhigend auf sie wirken. Alles war jedenfalls besser als ihr Zuhause, wo sie derzeit weder zur Ruhe noch zum Arbeiten kam.
Sie öffnete das große Sprossenfenster und atmete mit geschlossenen Augen tief durch. Doch eben als sie sich vom Fenster abwenden wollte, fing ihr Blick etwas ein, das sie in der Bewegung verharren ließ. Sie starrte hinüber zum benachbarten Ferienhaus. Wollte es nicht glauben. Konnte es nicht glauben. Dort drüben stand Martin. Martin Ziegler. Ihr alter Freund und Kollege. Der Inselsheriff von Norderney.
*
Misstrauisch meldete sie sich am Telefon. Nur ein schon fast abweisendes: »Ja, bitte?« Dann hörte sie zu. Meist erkannte sie schon an der Stimme, ob es Sinn machte, weiterzuplanen. Ihre Fragen, die sie stellte, waren knapp, präzise und wohlüberlegt. Sie wollte wissen, wer den Kontakt vermittelt hatte, welche Aussagen und Prognosen es gab und ob es eine generelle Offenheit gegenüber ihrer Vorgehensweise gebe. Spätestens anhand dieser Antworten konnte sie beurteilen, wo sie das Treffen stattfinden lassen würde.
Jemanden sofort abzuweisen, würde nur böse Geister heraufbeschwören. Für die Menschen, mit denen sie in Kontakt kam, gab es nur noch zwei Seiten, zwei Farben, zwei Welten. Wenn sie ihnen vermeintlich und willentlich die Tür zum Guten, zum Weiß, zum Licht verschloss, stände sie auf der Seite der Gegner.
Nein, wenn der Kontakt eingefädelt worden war, musste sie tätig werden. Alles andere würde sie sich selbst nicht verzeihen. Und sei es nur, um ein persönliches Gespräch zu führen. Ein Gespräch an einem neutralen Ort, bei dem sie zumindest ein wenig Mitgefühl und Verständnis, gute Wünsche und die ein oder andere Empfehlung mit auf den Weg geben würde, denn das war es, was den meisten derer, die sie um Hilfe baten, fehlte. Ein gutes Wort. Ein wenig Zuversicht, an die sie sich klammern konnten. Eine allerletzte Hoffnung. Sie konnte nicht allen helfen. So schwer es ihr fiel. Auch sie musste abwägen und Grenzen ziehen. Schon weil sie selbst nicht mehr ausreichend Kräfte hatte. Es ging immer um Konzentration in der Heilung, nie um wahlloses Bedienen. Aber sie musste die richtigen Worte finden und dann war es oft schon genug. Mehr zumindest, als die Ärzte geben konnten oder wollten. Und wenn sie danach an der Garderobe wieder in ihr Cape schlüpfte, wusste sie, dass sie selbst in aussichtslosen Fällen etwas bewirkt haben würde.
Überhaupt: das Cape, ihr Schutzschild, das die Blicke der Dorfbewohner immer noch mehr auf sie lenkte. Aber es war ihr egal, oder besser, sie war selbstbewusst genug, um diese Blicke auszuhalten. In Wirklichkeit genoss sie sie. Sie mochte, wie die Leute über sie dachten, was sie munkelten und unterstellten, weil es ihr Macht gab und gleichzeitig die Distanz schaffte, die für ihr Tun unabdingbar war. Wenn sie deswegen als »Dorfhexe« bezeichnet wurde, fühlte sie sich mehr geschmeichelt als ausgestoßen.
Der Anrufer hatte ihre Fragen ausführlich beantwortet. Mit einem alten Bleistiftstumpen hatte Evelyn die wenigen Notizen, die für sie relevant waren, auf die zerrissenen Altpapierblätter geschrieben, die sie in der alten Zigarrenkiste, die noch von ihrem Vater stammte, sammelte.
Sie nahm nun mit der linken Hand die runde Nickelbrille ab und legte sie auf den alten Kirschbaum-Sekretär.
Nun, diese Leute würde sie nicht in das Café in der Stadt bestellen müssen. Hier lag ganz klar auf der Hand, dass es sich um genau einen dieser Fälle handelte, für die sie zu kämpfen bereit war. Alle Voraussetzungen waren gegeben. Sie war die letzte Rettung.
»Kommen Sie morgen um 15.00 Uhr zur Deichstraße. An der Ecke zum Dünenweg können Sie parken. Ich warte dort auf Sie.«
Zum Ende war ihre Stimme mit jedem Wort weicher und wärmer geworden. Als sie aufgelegt hatte, lächelte sie. Ihr Golden Retriever, der in der Tür zum Wintergarten gelegen hatte, blickte auf.
»Komm, Florence, wir machen uns einen Tee und dann lassen wir uns den Wind noch einmal um die Nase wehen. Was meinst du?«
Sie beugte sich im Vorbeigehen zu der Hündin hinunter und schaute ihr fest in die Augen.
»Das kriegen wir hin. Meinst du nicht auch?«
*
»Ruth? Ruth, bist du das wirklich?« Martin rieb sich übertrieben die Augen, als er über die Veranda zu Ruths Ferienhaus gelaufen kam. »Was, um Himmels willen, machst du hier?«
»Das kann ich dich genauso fragen. Was machst du an der Ostsee? Wer bewacht denn nun die Insel?« Ruth lachte etwas angestrengt, was ihr sofort einen kritischen Blick von Martin einbrachte.
»Alles in Ordnung bei dir? Du siehst ziemlich überarbeitet aus.«
»Oh, danke für das Kompliment am frühen Morgen.«
»Sorry, war nicht so gemeint. Du kennst mich doch. Ich bin nicht so ein Süßholzraspler.«
»Weiß ich doch.« Ruth nickte. »Aber du hast meine Frage nicht beantwortet.«
»Auch ein Inselsheriff hat mal Urlaub. Da sitzt jetzt ein anderer den sommerlichen Ansturm auf die Insel aus.«
»Und dann fährst du ausgerechnet an die Ostsee? Einfach nur so an das andere Meer? Tauschst Nordsee-Strandkorb gegen Ostsee-Strandkorb? Sowas habe ich noch nie verstanden.« Ruth schüttelte den Kopf.
»Na ja. Das hat schon einen besonderen Grund. Ich bin – ach, weißt du, ich koche uns jetzt erstmal einen Kaffee bei mir drüben. Kommst du gleich auf unsere Veranda, ich decke da den Frühstückstisch.«
»Eure Veranda? Du bist nicht allein?«
»Ähm, ja, das wollte ich dir beim Kaffee erzählen. Ich bin mit Anne Wagner hier. Ihren Eltern gehört das Haus.«
»Mit Anne Wagner? Der Ärztin aus dem Norderneyer Krankenhaus?«
»Genau. Ihr kennt euch ja schon. Anne holt gerade Brötchen und Croissants im Biomarkt ein Stück weit die Straße runter. Sie wird sich freuen, dich zu sehen.«
»Dann seid ihr also …« Ruth stockte. »Dann bist du also jetzt mit Anne zusammen.«
»Ja, kann man so sagen.« Martin wirkte verlegen, aber gleichzeitig strahlte er über das ganze Gesicht. »Noch nicht so lange, aber im letzten Herbst hat sich das so ganz langsam angebahnt.«
»Verstehe.« Ruth nickte und kam sich selbst hölzern und steif vor. Warum konnte sie sich jetzt nicht einfach freuen? Schließlich hatte sie Anne richtig sympathisch gefunden. Auch wenn sie selbst Martin schon lange gut kannte, mehr hatte sie da nie erwartet. Eifersucht konnte es also nicht sein, das nagende Gefühl, das sie in ihrem Inneren spürte.
»Also, abgemacht? Gleich zum Kaffee? Annes Eltern haben eine Hightech-Kaffeemaschine in ihrem Ferienhaus. Ich zaubere dir den besten Latte macchiato weit und breit.«
»Besser als der von der Milchbar?« Jetzt lächelte Ruth doch, als die Erinnerung an das traumhafte Café mit Meerblick auf Norderney in ihr aufstieg.
»Viel besser.« Martin zwinkerte. »Nur, so hervorragende Cocktails kann ich dir nicht bieten.«
Jetzt lachte Ruth ihr altes herzhaftes Lachen. »Okay, die brauche ich tatsächlich am frühen Morgen noch nicht. Also bis gleich, ich freue mich.«
*
»Herr Doktor Schimmer?« Die junge Arzthelferin, die so verschüchtert wirkte, sobald sie ihn ansprechen musste, steckte ihren Kopf zur Tür hinein, nachdem sie zaghaft angeklopft hatte.
Rolf Schimmer schloss die Immobilienseite, die er gerade auf neue Angebote hin abgesucht hatte.
»Was gibt’s?«, raunzte er unwirsch.
Die Arzthelferin zuckte zusammen. »Es ist nur, hier draußen steht ein Pharmareferent.« Ihre Stimme wurde mit jedem Wort leiser. Schimmer ahnte schon, warum. Für die jungen Damen war es schwierig zu unterscheiden, wen er sehen wollte und wer abgewiesen werden sollte. Das wechselte selbst bei ihm und entsprechend uneindeutig waren seine Anweisungen an das Personal. Auch heute war er zaghaft. Ein anderes Gespräch würde ihm jetzt guttun. Er musste unbedingt auf andere Gedanken kommen, bevor er den nächsten Patienten vor sich sitzen hatte.
»Wer ist es denn?«, fragte er nach.
Die Stimme der Arzthelferin wurde immer leiser. »Herr Steiner, Sie wissen schon.«
Ausgerechnet Steiner. Er konnte es sich nicht leisten, ihn schon wieder abzuweisen. Das war nun das dritte Mal, das er vorsprechen wollte. Ausgerechnet heute. Schimmer rieb sich mit der Hand über das Gesicht. Es half nichts.
»Schicken Sie ihn rein. Und bringen Sie uns bitte zwei Kaffee.«
Ohne Kaffee würde es heute nicht weitergehen.
*
Kurz hatte Ruth überlegt, barfuß oder in Flipflops hinüber zum anderen Ferienhaus zu laufen. Ein Blick auf ihre Zehen jedoch riet dann doch dringend zu einer vorherigen Pediküre. Zumindest mochte sie sich so nicht den Blicken von Anne aussetzen. Sie wusste, es war albern, besonders, wenn man einen Strandurlaub plante, aber die Zehen empfand sie selbst als einen der intimsten Körperbereiche. Am Strand wären ihr die Blicke anderer noch egal, aber in der Nähe von Anne und Martin? Die Psychologin in ihr räusperte sich. Okay, sie würde in einer ruhigen Minute einmal darüber nachdenken, was genau das über sie aussagte. Aber jetzt lockte der Café Latte. Deswegen holte sie schnell ein Paar Socken aus der Reisetasche und schlüpfte in ihre neuen weißen Tennisschuhe, die sie sich gegönnt hatte.
»Kommt alles wieder«, hatte sie zu der jungen, aufgebrezelten Verkäuferin gesagt, die aussah, als wollte sie zum nächsten Modelcasting und wäre nur aus Versehen beim Schuhkauf gelandet. »Sowas war schon mal richtig modern. Karotte, Sweatshirt und weiße Tennisschuhe. Da war ich 15 und habe die Klamotten von meiner Cousine geerbt. Als keiner sie mehr trug. Aber jetzt bin ich wohl gerade richtig hip.«
Ruth hatte sich auf die Lippen gebissen, als sie den verständnislosen Blick des Mädchens auffing. Sie wusste selbst nicht, was mit ihr los war. Sonst redete sie doch auch nicht so drauflos, schon gar nicht so ein belangloses Zeug. Als Ruth jetzt an diesen Moment zurückdachte, schüttelte sie nur den Kopf. Ob sie zu viel Zeit mit sich allein verbrachte und anfing, wunderlich zu werden? Umso besser, dass sie jetzt mit Martin und Anne frühstücken konnte.
Anne stand schon auf der Veranda und strahlte sie an. Sie sah so jung, frisch und entspannt aus, dass sich Ruth vor lauter Verlegenheit mit der Hand durch die blonden Locken fuhr. Seltsam fühlte es sich an zu wissen, dass Anne mit Martin zusammen war.
»Ruth! Ich habe gedacht, Martin macht Scherze. Du bist tatsächlich nebenan im Ferienhaus? Das gibt es doch gar nicht.«
»Ich habe auch gedacht, ich sehe Gespenster, als Martin da so stand.«
»Hallo? Gespenster?« Martins dröhnende Stimme drang zu ihnen nach draußen. »Nur weil ich nicht so schnell braun werde, musst du mich nicht gleich beleidigen. Aber macht mal Platz, hier kommt der Kaffee.« Martin balancierte vorsichtig ein blaues Tablett mit drei Latte macchiato in der Hand. Instinktiv zog er den Kopf an der Holztür ein Stück ein. Die Sommerhäuser wirkten wie kleine Puppenhäuser und Martin schien hierfür nicht unbedingt proportioniert. Er grinste Ruth an, nachdem er das Tablett abgesetzt hatte und sich einmal zu voller Größe räkelte.
»Ach komm, du warst doch genauso erschrocken, mich zu sehen«, erwiderte Ruth.
»Erschrocken nicht, aber mehr als erstaunt. Und das bin ich immer noch. Bist du unter die Tennisspielerinnen gegangen?« Er deutete auf Ruths Schuhe.
»Blödsinn, du läufst doch auch das ganze Jahr in Sportschuhen herum.«
»Ja, aber ausgerechnet Tennisschuhe. Ich hätte es cool gefunden. Schau mal, dort drüben sind Plätze und die gehören zur Ferienanlage. Kannst also jederzeit hier spielen.«
»Jetzt setz dich doch erstmal.« Anne winkte Ruth zu sich. »Ich habe genug vom Bäcker mitgebracht, weil wir heute ein Picknick machen wollten. Komm, greif zu.«
Ruth ließ sich an dem bunt gedeckten Tisch nieder. Eine in Sommerfarben gestreifte Tischdecke, ein weißer Brotkorb mit Brötchen und Croissants, verschiedene Marmeladen, Honig, Quark und Nusscreme beschworen vor den Schwedenhäusern eine Landhausromantik herauf, von der Ruth immer gedacht hatte, es gäbe sie nicht in Wirklichkeit.
Sie griff nach ihrem Latte-Glas und umklammerte es mit beiden Händen. »Macht ihr nur mal mit eurem Frühstück, ich esse morgens nichts. Aber trotzdem danke.«
»Ach komm, wenigstens ein halbes Croissant. Ich teile gerne mit dir.« Schon hielt Anne ihr eine Hälfte hin und Ruth nahm sie instinktiv an, während Anne lachend bemerkte: »Bei der Kalorienzahl der Croissants ist es keine schlechte Idee, sie nur in Hälften zu essen.«
»Das läufst du doch gleich auf dem Platz wieder runter, wenn du mich von Ecke zu Ecke jagst«, brummte Martin dazwischen, während er auf seinem Körnerbrötchen kaute.
Ruth schaute beide ungläubig an. »Ihr spielt Tennis?«
»Schon von Kind an«, bestätigte Anne. »Deswegen war dieses Ferienhaus für meine Familie so ideal. Keine fünfhundert Meter zum Meer und den Sandplatz gleich vor der Tür.«
»Aber Martin? Du hast doch noch nie Tennis gespielt. Oder habe ich da etwas verpasst?«
Martin nickte. »Stimmt schon. Hatte auch immer Vorbehalte. Von wegen elitär und versnobt. Aber das ist jetzt anders.« Martin strahlte Anne an.
»Ich habe Martin überredet, es einmal auszuprobieren. Wir sind zuhause frühmorgens auf den Platz, wenn noch kein anderer spielt, damit er sich nicht so wie auf dem Präsentierteller fühlt. Als es anfing ihm Spaß zu machen, hat er sich Trainerstunden dazugebucht.«
»Gibt es auf Norderney Tennisplätze?«
»Klar. Ganz früher waren die sogar mal am Deich in der Nähe der Milchbar. Das kann man auf ganz alten Schwarz-Weiß-Fotografien sehen. Mittlerweile sind die Plätze gut versteckt bei den Sportanlagen hinter der Mühle.«
Ruth war mehr als erstaunt. Als sie im Herbst auf der ostfriesischen Insel war, hatte sie Martin wiedergetroffen, der sich nach einem Burnout dorthin hatte versetzen lassen. Sie hatte sich Sorgen gemacht, ob der Rückzug aus der gewohnten Welt das Richtige für ihn war. Aber so wie sie ihn jetzt erlebte, konnte sie nur sagen, dass es wohl die beste Entscheidung seines Lebens war.
Anne hielt Ruth den Brotkorb hin: »Doch noch etwas? Ich freue mich so, dass wir uns hier wiedersehen. Das war im Oktober viel zu kurz und ja auch einigermaßen anstrengend.«
Ja, das war es. Vor Ruths Augen ploppten szeneartig die Bilder des herbstlichen Norderneys auf, sie erinnerte sich des Orkans, der über die Insel gefegt war und der Mordserie, in die sie so unvermittelt mit Martin und Anne hineingeschlittert war. Gerade mal ein Dreivierteljahr und alles lag schon wieder weit hinter ihr. Und nun saß dieses verliebte Paar vor ihr und es schien, als wäre aus Martin in den vergangenen zehn Monaten ein neuer Mensch geworden.
»Was machst du nun eigentlich hier?« Martin musterte Ruth eindringlich. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du nicht als Sommerfrischlerin hier aufgelaufen bist. Oder täuscht mich meine kriminalistische Spürnase?«
Ruth hob abwehrend beide Hände. »Also tatsächlich habe ich nur nach einem ruhigen Platz für die nächsten drei Wochen gesucht. Mach das mal kurzfristig im Sommer. Wenn alles ausgebucht ist.«
»Wieso ein ruhiger Platz? Du hast doch eine Wohnung ganz für dich alleine.«
»Dachte ich auch. Aber es gibt eine größere Renovierungsmaßnahme in unserer Hausanlage und ich habe das genau 48 Stunden ausgehalten.« Ruth fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. »Danach bin ich ins nächste Reisebüro gestürmt.«
Sie sah Annes verwunderten Blick. »Ich arbeite ja mehr oder weniger freiberuflich und habe mein Büro deswegen zuhause. Über den Sommer bin ich nicht für Vorträge und Coachings gebucht und die Vorlesungen an den Hochschulen und Akademien entfallen. Deshalb hatte ich zugesagt, weil das zeitlich so passte, mehrere Fachartikel zu schreiben und über die Inhalte der Fortbildungsreihe ein Fachbuch zu schreiben.«
»Und dann kamen die Bauarbeiter?« Anne schaute verständnisvoll.
»Ja.« Ruth nickte. »Tagsüber die Bauarbeiter und abends Freunde, die sich freuten, dass ich mal am Ort war und nicht auf Fortbildungstour. Und dann stand meine Tochter mit Liebeskummer vor der Tür.«
»Ist doch schön, wenn Lisa-Marie mal wieder zuhause aufschlägt, oder nicht?« Martin schaute sie erneut nachdenklich an. Er kannte ihre ganze private Misere, die zwar schon viele Jahre zurücklag, aber Spuren hinterlassen hatte.
»Klar. Ich freue mich ja, dass sie Zuflucht bei mir nimmt. Aber helfen kann ich nicht. Dazu kommt, dass ich fürs Buch eine Deadline habe und einfach nicht mehr zum Arbeiten gekommen bin. Letztendlich ist ihr mehr damit gedient, dass ich ihr die Wohnung für die nächsten Wochen überlasse.«
»Und dann hat das Reisebüro dir dieses Ferienhaus angedreht? Das war aber ein Geschäft. Kommt mir etwas überdimensioniert vor, um mal eben vor den Bauarbeitern zu flüchten.« Martin lachte trocken.
»Nein. Nein. So war es nicht. Als ich dort saß, dachte ich, wenn schon, denn schon. Weil es Sommer ist und ich ans Meer wollte, wo es in der Hochsaison aber nicht so einfach etwas gibt. Da sind wir auf eine Stornierung für dieses Haus gestoßen. War gerade reingekommen. Ein Todesfall in der Familie. Ziemlich makaber, aber für mich ein Segen.«
»Und du hast zugegriffen?«
»Ja. Ich habe nicht lange gezögert. Ich hatte auf einmal Sehnsucht nach der Ostsee. Ich stelle mir das schön vor, meine Arbeitsmaterialien überall ausbreiten zu können. Wie eine große Mindmap oder ein Storyboard alles verteilen und beim Schreiben die einzelnen Quellen nutzen können. Dabei trotzdem Urlaub zu haben, schwimmen zu gehen, das Fahrrad im Schuppen zu nutzen. Wenn ich Lust habe, nach Lübeck, Wismar oder Schwerin zu fahren und Stadtluft und Kultur zu tanken.«
»Nun stößt du ausgerechnet hier auf uns. Das glaubt doch kein Mensch. Zufälle gibt es, die sind keine. Oder, was meint ihr?« Martin schaute in die Runde.
Anne deutete wie wild auf Ruths Füße. »Ich glaube, dass es kein Zufall ist. Deswegen sind auch deine Tennisschuhe ein Zeichen. Da kommst du jetzt nicht dran vorbei. Du musst mit uns auf den Platz.«
*
Ruth hatte nach dem Frühstück keine Lust mehr, sich an ihren Laptop zu setzen. Immerhin hatte sie, um das aufkeimende schlechte Gewissen zu beruhigen, ihre Schreibmaterialien aus den Kisten im Haus verteilt. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, an die Ostsee zu fahren. Sie hatte sich das so reizvoll ausgemalt: in der Nähe des Meeres zu sein, nach eigenem Rhythmus zu arbeiten, zu schlafen, den Sommer zu genießen. Bei der Buchung hatte sie ein kleines freistehendes Haus vor Augen gehabt, und war nur kurz ins Zweifeln geraten, als Worte wie Tennisanlage, Kiosk und Restauration in Ferienparknähe gefallen waren. Doch sie war nur glücklich gewesen, überhaupt etwas gefunden zu haben und der Wunsch nach Urlaub und Erholung war vielleicht doch größer gewesen als die Hoffnung, in Ruhe schreiben zu können.
Überhaupt, sie war jetzt schon Monate mit dieser Fortbildungsreihe auf Tour gewesen. »Auf Tour«, wie sich das anhörte. Sie lachte bei dem Gedanken an einen Tourbus und Groupies, die sie begleiteten. Zwar wurde sie gerne gebucht, aber vom Pop- und Rockgeschäft war sie mit ihren Themen denkbar weit weg. Als ehemalige Kriminalerin, die anschließend Psychologie studiert hatte, war sie als Dozentin deutschlandweit gefragt. Sie war fast mehr unterwegs als in ihrer Wohnung, die sie sich damals nach der Scheidung gekauft hatte. Die groß genug war, dass Lisa-Marie die Hälfte der Zeit bei ihr verbringen konnte. Aber nicht so groß, dass Ruth sie nicht allein füllen konnte, wenn ihre Tochter bei Michael war.
Ruth hatte die Fachartikel, die sie in den letzten Jahren publiziert hatte, in Ordnern gesammelt und mitgebracht. Natürlich würde das auch alles digital gehen, hatte sie zu Lisa-Marie gesagt, die kopfschüttelnd geholfen hatte, die Kiste mit den Ordnern und Fachbüchern ins Auto zu tragen.
»Aber du weißt doch, ich bin nun mal der haptische Typ«, hatte Ruth augenzwinkernd bemerkt. »Ich muss alles anfassen und berühren können.«
Gleichzeitig hatte sie ihrer Tochter über den Kopf gestrichen, wie sie es seit Lisa-Maries Geburt immer wieder gemacht hatte, zunehmend unter dem halb gespielten Protest der größer werdenden Tochter.
»Mach das bloß nie, wenn meine Freundinnen dabei sind«, hatte Lisa-Marie als Teenager gesagt, sich aber meist gleichzeitig an Ruth angelehnt. Mehr an Emotionalität war ihnen beiden schwergefallen, aber es waren diese Momente gewesen, in denen sie sich gegenseitig ihrer Liebe versichert hatten.
Seit Lisa-Marie erwachsen war, nahm sie die Berührungen der Mutter gelassener hin. Sie sahen sich nicht mehr oft. Aber Lisa-Marie wusste, dass sie auf beide Elternteile immer zählen konnte.
»Das rechne ich euch beiden hoch an«, hatte sie erst vor kurzem zu Ruth gesagt, »dass ihr es geschafft habt, mich aus eurer Scheidung herauszuhalten.«
Ruth hatte genickt. Klar, ihr als Psychologin hätte man alles andere auch mehr als anderen angekreidet. Doch aus ihrem Berufsalltag wusste sie, dass es tatsächlich etwas Besonderes gewesen war, wie sie damit umgegangen waren. Wem hätte es denn genützt, wenn es anders verlaufen wäre? Michael und sie hatten sich nicht gegenseitig verletzt, nicht betrogen, nicht verflucht – sie hatten sich einfach von gemeinsamen Zielen verabschiedet. Weil das Leben anders verlief, als sie es sich in jungen Jahren ausgemalt hatten.
In jungen Jahren. Ruth spürte die aufsteigende Melancholie, die sie die letzten Tage und Wochen immer mehr erfasst hatte. Sie war wirklich urlaubsreif.
Sie schaute sich in dem holzgetäfelten Erdgeschossraum um. Die Sitzmöbel waren in maritimem Blau gehalten. An der Längswand stand ein großes weißes Bücherregal, das mit regionaler Urlaubslektüre, Krimis und älteren Bestsellern bestückt war. Reiseprospekte und Landhausmagazine waren in zwei Stapeln geschichtet. Es gab ein ganzes Regalbrett voller Gesellschaftsspiele.
Langweilig würde es ihr hier nicht werden, so viel stand fest. Aber erst einmal wollte sie sich die Ostseeluft um die Nase wehen lassen.
*
Georg drückte die Taste des Kaffeevollautomaten. Diese Gastronomiemaschine in die kleine Bude am Strandaufgang zu stellen, war anfangs von vielen belächelt worden. Wie er zu Beginn überhaupt nur Kopfschütteln geerntet hatte. Neumodisch fanden die anderen Budenbesitzer das, was er hier anbot. Das war allerdings nur die offizielle Version dessen, was sie dachten und hinter vorgehaltener Hand miteinander besprachen. Georg grinste in sich hinein. Da hatte keiner mit gerechnet, dass er so einen Erfolg haben würde. Mittlerweile war das Kopfschütteln schon dem ein oder anderen anerkennenden Kopfnicken gewichen. Besonders die Kurverwaltung schaute sich sein Marketing-Konzept sehr genau an. Nachdem letztens das Fernsehen da war, hatte man ihn sogar in einen der Ausschüsse geladen. Aber Georg war klar, dass er seine Kollegen noch längst nicht überzeugt hatte. Manchmal schien aus dem Kopfschütteln purer Neid geworden zu sein. Er musste vorsichtig sein. Die anderen mitnehmen. Sie überzeugen. Das konnte bei Menschen dieses Schlags hier ganz schön lange dauern.
Er probierte den Kaffee in kleinen Schlucken. Perfekt. Die teurere Röstung einzukaufen, würde sich bezahlt machen. Seine Gäste wussten so etwas zu schätzen.
»Kann ich schon einen Kaffee bestellen?«
Eine weibliche und zaghafte Stimme ließ Georg herumfahren. Vor ihm stand Elena. Eine seiner Stammkundinnen auf Zeit.
»Klar doch. Ich warte schon seit Stunden, dass langsam etwas mehr Leben an den Strand kommt.«
Elena verschränkte die Arme und zog die Schultern hoch. »Ein bisschen kühl heute Morgen. Da habe ich lieber mit den anderen gefrühstückt.«
»Genau 21 Grad Lufttemperatur. Aber du hast recht. Gefühlt ist es weniger. Warte mal, wenn die Sonne gleich richtig Kraft gewinnt.«
»Ja, ich habe deine Wetterprognose schon auf dem Handy gesehen.« Elena lächelte. »Ein Superservice, den ihr hier bietet.«
Georg lächelte. »Macht halt Spaß. Alles, was ich hier mache. Es soll genau so sein, wie ich es im Urlaub selbst gerne hätte.« Er schob Elena den Kaffee in der himmelblauen Tasse hinüber.
»Ich glaube, alles, was ihr hier macht, ist viel mehr als nur Spaß an der Sache haben. Das ist was ganz Besonderes. Für mich auf jeden Fall.«
Georg sah eine feine Röte auf dem sonst eher blassen Gesicht. Diese Elena war keine der Lauten und Taffen, die versuchten, über all das, was die Krankheit mit ihnen machte, hinwegzutäuschen. Umso mehr freute ihn das Lob aus ihrem Mund.
»Danke, Elena. Lob mich nicht zu früh am Morgen. Das sieht nicht jeder so.«
»Das glaube ich nicht. Ich bin zwar erst seit vorletzter Woche hier. Aber eure Strandbude ist das Beste, was mir in der Kur passieren konnte. Ich fühle mich hier einfach wieder …«, sie stockte und suchte nach dem passenden Wort. »So normal«, fuhr sie leise fort. »Fast schon gesund.«
Georg spürte ihre Verlegenheit und freute sich umso mehr, dass sie ihre Gefühle in Worte gepackt hatte. Er lächelte, polterte dann aber gespielt empört: »Na, da frage ich mich aber, warum heute hier noch so gut wie gar nichts los ist?« Georg deutete auf die Strandkörbe und die am Dünenrand aufgereihten Stand-up-Paddle-Bretter. »So schlecht ist das Wetter ja nicht.«
Elena trat zwei Schritte vom Tresen seiner Strandbude nach hinten weg und schaute mit der Hand vor der Stirn den schmalen Weg hoch. »Keine Ahnung, aber da oben scheint etwas passiert zu sein. Polizei und jede Menge Schaulustige.«
»Polizei? An der Strandpromenade?«
Elena nickte. »Ja, vorhin schon. Ich habe mich aber nicht darum gekümmert. Ich mag nun mal keine Aufregungen. Kannst du doch verstehen.«
Georg schaute Elena nachdenklich an. Ließ den Blick über das leicht aufgedunsene Gesicht gleiten. Die Augen wirkten ohne Wimpern und mit den nachgezogenen Brauen nackt und verletzlich, worüber auch die bunte Beanie auf ihrem Kopf nicht hinwegtäuschen konnte. »Klar, verstehe ich. Trotzdem merkwürdig. Polizei, sagst du?«
*
Ruth hatte ihren Badeanzug und ein Handtuch in den olivfarbenen Rucksack gestopft und sich dann von den Fahrrädern im Schuppen das Rote mit den dicken Reifen ausgesucht, weil es am gemütlichsten aussah und damit am ehesten zu ihrer heutigen Stimmung passte. Sie würde die drei Kilometer bis zum Zentrum des Ferienortes die Strandpromenade entlang radeln, die Gegend auf sich wirken lassen, dort vor Ort ein Buch oder eine Zeitschrift kaufen und sich einen schönen Strandplatz suchen, an dem sie ein wenig zur Ruhe kommen wollte. Einfach nichts tun. Gedanken schweifen lassen.
Martin und Anne hatten ihr von dem besonders schönen Strandabschnitt erzählt, an dem die Strandkörbe der Ferienanlage ständen und an dessen Strandbude es den besten Kaffee gäbe. Nun, das könnte sie später noch ausprobieren. Sie hatte Scheu, jetzt bei Schritt und Tritt dem verliebten Pärchen über die Füße zu laufen. Für heute Abend hatten sie sich schon zu einem Glas Wein vor dem Ferienhaus verabredet und morgen wollten die beiden Ruth die ersten Grundlagen des Tennisspiels nahebringen. Ruth lachte bei dem Gedanken auf. Sie und Tennis, das hatte der Welt noch gefehlt. Andererseits – warum nicht? So unsportlich war sie nicht und gab es da nicht einen Standardsatz ihrer Berufskollegen? »Raus aus der Komfortzone!« Einer der Motivationssätze für die Postkarte und das Glückstagebuch. Psychologie light, wie Ruth es gerne nannte. Aber warum nicht? Jeder nach seiner Façon.
Ruth würde es auf sich zukommen lassen, wie sich das Nebeneinander mit Martin und Anne entwickelte. Schließlich war sie ja nicht nur zu ihrem Spaß hier. Der Verlag wartete auf ihr Manuskript, hatte schon mit der anstehenden Veröffentlichung geworben, sie musste also ran ans Schreiben, ob sie wollte oder nicht.
Ruth schob das Fahrrad durch die Parkanlage, in der ungefähr zwanzig rote und blaue Ferienhäuser wie vom Himmel gefallen ihren Platz gefunden hatten. Es gab keine einheitliche Ausrichtung und die Farbverteilung schien keinem System zu folgen. Ruth grinste. Das gefiel ihr. Die Anlage schien sich an eine solvente Mittelschicht zu richten. Die Autos neben den Ferienhäusern waren fast durchweg höherpreisige Kombis, Minivans und SUVs. Viele trugen auf dem Dach einen dieser üblichen Kindersärge, wie sie boshaft die Dachgepäckkoffer nannte. Das ließ vermuten, dass in den meisten Häusern Familien Urlaub machten, was angesichts der Größe der Häuser nahe lag. Allerdings schienen sowohl die Häuser wie die gesamte Parkanlage unnatürlich ruhig und unbelebt. Ruth zog aus ihrer linken Hosentasche eine alte zerkratzte Armbanduhr. Kurz nach zehn. Entweder schlief hier noch alles, oder die meisten waren schon Richtung Strand aufgebrochen. Von den Tennisplätzen, die sich hinter den letzten Häusern Richtung freiliegender Felder erstreckten, hörte sie das gedämpfte Ploppen der Bälle. Es war ein sattes, warmes Geräusch, das ihr gefiel. Vielleicht war es gar keine so schlechte Idee, es mal auf dem Platz zu versuchen.
Als sie sich der Straße näherte, war die Terrasse vor dem kleinen Gastronomiebetrieb, in dem sie gestern bei ihrer Ankunft den Schlüssel erhalten hatte, gut besetzt. Anscheinend war es eine gute Alternative, hier das Frühstück einzunehmen. Das könnte ihr gefallen, stellte Ruth fest und nahm sich vor, es in den nächsten Tagen auszuprobieren. Sie hörte nun auch die Kinderstimmen, die sie bisher vermisst hatte. Ein großer Spielplatz lag in Sichtweite des Cafés, sodass Kinder und Eltern gemeinsam zu ihrem Recht kamen.
Sie blieb einen Moment stehen und schaute dem Treiben zu. Im Mittelpunkt des Ganzen stand ein großes Piratenschiff auf einem künstlichen gummierten Hügel. Rundherum verteilten sich Schaukeln, eine Wippe, ein in den Boden eingelassenes Trampolin und am äußeren Rand eine Seilbahn, vor der sich schon zu beiden Seiten eine Schlange gebildet hatte. Wenn Ruth selbst nie so ein ausgeprägter Familienmensch gewesen war, sie mochte es einfach, ein Leben, in dem Kinder wichtig waren.
Das Kinderlachen erinnerte sie an ihr Manuskript zum Thema Kindeswohl. Energisch drehte Ruth das Fahrrad Richtung Straße. Wenn sie in dem Tempo weitermachte, gäbe es heute weder was mit Strand noch mit Schreiben. Ob sie dann den Wein mit Anne und Martin genießen konnte?
Auf jeden Fall wollte sie sich heute ein Bild von dem beschaulichen Ferienort machen, dessen bunte Häuser am Kurpark mit den unverwechselbaren Zipfelmützendächern ein beliebtes Kalendermotiv waren. Die Seebrücke wollte sie sehen, und wenn sie den Lesestoff ausgesucht hätte, an einer der Strandbuden ihr Fahrrad abstellen, um mindestens den dicken Zeh in die Ostsee zu stecken und ein Sonnenbad zu nehmen. Was für schöne Aussichten.
*
Elena war bewusst den Weg nicht zurückgegangen. Noch während sie bei Georg an der Strandbude stand, hatte der tägliche Zug der Feriengäste an den Strand begonnen. Die DLRG hatte in Vollbesetzung ihren gegenüberliegenden Turm bezogen, um einen ganzen langen Sommertag unentwegt auf das Meer zu schauen, immer zwei Rettungsschwimmer oben, die sich abwechselnd das Fernglas reichten, und einer unten.
Neue Gäste erkannten Georg und die Rettungsschwimmer immer daran, wie orientierungslos sie mit ihrer Kurkarte zwischen den beiden Buden hin- und herschauten. Sie waren unschlüssig, weil der weiße Holzturm viel offizieller wirkte, obwohl er gleichzeitig den Charme eines Spielplatz-Kletterturms ausstrahlte, während sich die Naturholzhütte von Georg regelrecht geduckt und farblos daneben ausnahm. Nur die bunten Wassersportboards unterstützten auf den ersten Blick das maritime Flair.
Mehr als einmal machte sich Georg zusammen mit Jens, seinem Angestellten, einen Spaß daraus, böse zu schauen, die Kurausweise gründlicher zu studieren als nötig und in strengem preußischen Tonfall die Gäste zu belehren, dass ein vergessener Ausweis unweigerlich das Betreten des Strandabschnitts verhinderte. Wenn er dann in die erschrockenen Gesichter sah, zog ein einseitiges Grinsen über sein Gesicht, er hob den Daumen zu den Rettungsschwimmern, wie um zu signalisieren: Hat mal wieder geklappt. Dabei kontrollierte er bei jedem Gast nur ein einziges Mal, weil er jedes Gesicht sofort abspeichern konnte. Ab dem zweiten Tag begrüßte er die Urlauber dann wie ein galanter Gastgeber, dem nichts mehr am Herzen liegt, als das Wohl seiner Gäste. Auch heute beobachtete Elena, wie wohl Georg sich in der Rolle des Strandwächters fühlte. Er war hier nicht nur der Herr über seinen 200 Meter langen Strandabschnitt, sondern auch der Vermieter der Strandkörbe, der beste Strand-Barista, den sie sich vorstellen konnte mit seiner glänzenden Hightech-Kaffeestation und dem besten Kaffee weit und breit. Er war der Wettergott, der mit seinen Prognosen immer recht behielt und der Social-Media-Man, der seine Fans auch nach ihrem Aufenthalt an seinem Strand tagtäglich informierte, Bilder postete, die Erinnerung frisch hielt, Sehnsucht weckte und Hoffnungen machte.
Vor allen Dingen Hoffnungen machte. Sie gehörte nämlich zu den ankommenden Gästen, mit denen er die Begrüßungsscherze nicht spielte. Bei ihr und ihresgleichen wollte er nicht zanken, wie er erklärte. Nur freundlich sein. Freundlich und normal. Normal, wie sonst keiner mehr mit ihnen umging.
Auch heute hatte er sofort verstanden, warum sie nicht wissen wollte, was es mit der Polizei auf sich hatte. Als die ersten Urlauber voller Aufregung den Weg herunterkamen und einer der Jungs von der Rettungswacht sich aufgemacht hatte, um sich mal umzuhören, hatte Georg sie in die Ecke mit den gemütlichen Sitzbänken bugsiert.
»Trink mal in Ruhe deinen Kaffee hier. Da vorne ist jetzt einfach zu viel Trubel. Ich hör mir das mal an und erzähle dir später, was los ist.«
Sie hatte dankbar genickt und sich ganz auf den Kaffee und das Meer konzentriert. Wenn sie eins gelernt hatte in den letzten Monaten, dann war es das Abschalten. Das Ganz-in-sich-Hineinkriechen, das Zurückziehen aus der Außenwelt. Gut so, hatten ihr alle gesagt. Eine hilfreiche Strategie. Sie wäre sonst verrückt geworden. Hatte genug mit sich selbst zu tun und hätte das Leid und Elend all der anderen nicht auch noch tragen können.
Andere hatten es anders gemacht. Hatten in dieser Situation neue Freunde gefunden. Hatten sich verbündet: Gemeinsam sind wir stark.
Oder waren an die Öffentlichkeit gegangen. Hatten, wann immer ihr Körper es zuließ, gebloggt, gepostet, berichtet.
So war es nun mal. Sie alle waren unterschiedlich. Nur in einem waren sie sich einig: Krebs ist ein Arschloch.
Hier an der Ostsee begann Elena etwas ihre Schutzhülle abzustreifen. Noch vorsichtig, um gewappnet zu sein. Um schnell zurück zu können. Wenn es erforderlich war. Aber eigentlich wurde es jeden Tag besser, seit sie hier war. Auch wenn sie sich anfangs nicht hatte vorstellen können, mit ihrer sichtbaren Erkrankung unter lauter Sommerfrischlern am Strand zu sitzen, war es gerade dieses Absurde, das ihr guttat. Sie gehörte zu den Lebenden. Und da wollte sie verdammt nochmal lange bleiben.
Georg war irgendwann zu ihr gekommen. »Geh nicht oben herum. Das ist nichts für dich.«
»Ein Unfall? Habe ich mir direkt gedacht.«
Georg hatte genickt, mit einem solch seltsamen Blick, dass Elena die Warnung ernst nahm. Sie war am Meer entlang bis zur nächsten Strandbude gelaufen, war dort auf die Strandpromenade gelangt und ging dann außen um das Gelände zurück zur Klinik. Auf dem Weg vor der Seeadlerklinik war sie stehen geblieben. Linker Hand lag inmitten eines kleinen Parks eine verwinkelte Villa, die zu einer Privatklinik umgebaut worden war. Trotz der wenigen Kontakte, die Elena bisher hatte, war das ein oder andere schon an ihr Ohr gedrungen. Dass man es sich leisten können musste, sich dort drüben behandeln zu lassen. Dass es für manchen aussichtslosen Fall die letzte Hoffnung war. Wenn auch nicht für alle, dachte sie, als sie sich an den Leichenwagen von heute Morgen erinnerte. Elena seufzte und wich einigen Fahrradfahrern aus, die mit lautem Klingeln an ihr vorbeifuhren. So unbeschwert wie diese wäre sie gerne mal wieder.
Durch ein grünes Gartentor betrat sie das Gelände der Reha-Klinik. Der Haupteingang befand sich noch ein Stück weiter rechts, aber nähme sie den offiziellen Weg, würde sie wieder der Unfallstelle zu nahe kommen. So wählte sie den Weg, der vor allem von Mitarbeitern des kleinen medizinischen Versorgungszentrums genutzt wurde, das sich genau zwischen den beiden Kliniken angesiedelt hatte. In dem flachen Bungalow waren eine internistische Praxis und eine Apotheke untergebracht.
Als Elena sich durch den Garten dem Haupteingang näherte, blickte sie an der hellen Fassade des dreistöckigen Klinikgeländes hoch. Zu ihrem Erstaunen sah sie an fast jedem Fenster Patienten stehen, Hände und Stirn an die Scheibe gelegt. Von dort konnten sie wohl bis zur Unfallstelle sehen, zumindest aber bis dorthin, wo eben die Polizeiwagen standen. Wie anziehend das Leid anderer Menschen doch war. Elena schüttelte sich. Sie wollte lieber nichts davon hören und sehen. Hoffentlich hielt sie niemand auf dem Weg in ihr Zimmer auf.
*
Doktor Ernst Bender war schlecht gelaunt. Sehr schlecht gelaunt. Nicht nur wegen der Tatsache, dass er von seiner alten Dienststelle in Kiel weggelobt worden war. Nicht nur, weil er sich in Schwerin noch lange nicht zurechtfand und sich noch im Aufwärmmodus wähnte. Nicht, weil das Kriminalkommissariat während der Sommerferienzeit noch unterbesetzter war, als er vermutet hatte. Auch nicht, weil er mit seinen teuren braunen Budapestern nun in einer Mischung aus schlecht getrocknetem Matsch, Hundekot und einer riesigen Blutlache stand. Das gehörte, so bedauerlich es nun mal war, durchaus zu seinem Beruf. Was ihn nicht hinderte, an seinem bevorzugten Kleidungsstil festzuhalten. Das alles also waren keineswegs alleinige Gründe für seine abgrundtiefe Laune. Nein, es war die Tatsache, dass hier innerhalb weniger Wochen in einem Radius von knapp 40 km jetzt bereits die dritte junge Frau ermordet aufgefunden worden war. Schon die beiden ersten Fälle hatten für heftigste Spekulationen und Angriffe gesorgt. Die Zeiten waren nicht die besten für ein besonnenes und überlegtes Ermitteln. Viel schneller, als es bei den kriminalistischen Fachleuten möglich war, war der Kreis der Verdächtigen benannt. »Sucht doch in den Flüchtlingsunterkünften«, und der Vorwurf an die Kriminalpolizei mit der »Lügenpresse« gemeinsame Sache zu machen, führte zu Nervosität auf allen Seiten.
Er hasste solche oberflächlichen Anschuldigungen, die mit der Digitalisierung der Medien in einer Geschwindigkeit um sich griffen, dass jeder Versuch dagegenzuhalten, hoffnungslos war.
Bender zog ein großes weißes Taschentuch aus seiner Jacketttasche und wischte sich damit über die Stirn. Er sah die Blicke der Kollegen, die ihn auch heute wie so oft musterten. Er wusste, dass sie ihn für aus der Zeit gefallen hielten mit seinem Auftreten, auf das er äußersten Wert legte. Wie übrigens auch auf seinen Doktortitel. Die lässigen Umgangsformen und aufgeweichten Hierarchien waren seine Sache nicht, auch wenn er mit seinen 48 Jahren ansonsten durchaus noch nicht der alten Garde zuzurechnen war.
»Gibt es schon erste Erkenntnisse?« Bender sprach mehr ins Ungefähre als jemanden gezielt anzusehen. Es wimmelte am Tatort nur so von Polizisten und Rettungspersonal und er tat sich schwer, die richtigen Ansprechpersonen herauszugreifen. Sowohl die Kollegen des Kriminalkommissariats aus Schwerin wie auch die Bereitschaftspolizei der örtlichen und umliegenden Dienststellen waren informiert worden und hatten die Absperrung und die erkennungsdienstlichen Untersuchungen in die Wege geleitet.