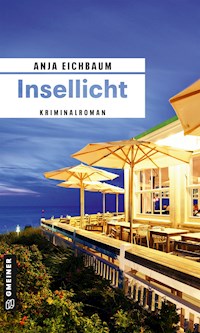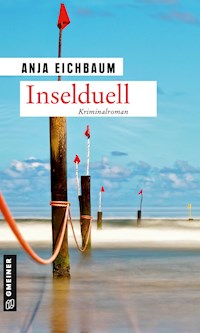
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ruth Keiser und Martin Ziegler
- Sprache: Deutsch
Umweltbewusst, modern, alleinerziehend. So präsentiert sich Petra Mertens bei der anstehenden Norderneyer Bürgermeisterwahl. Doch noch bevor der Wahlkampf an Fahrt aufnimmt, wird die Kandidatin tot am Planetenweg gefunden. Steckt ein politisches Motiv dahinter? Oder lassen sich die Gründe für die Tat in der Vergangenheit finden? Und was hat es mit den mystischen Zeichen am Tatort auf sich? Der Täter scheint ein perfides Spiel zu spielen. Atemlos verfolgt Inselpolizist Martin Ziegler eine Spur nach der anderen. Ob die Polizeipsychologin Ruth Keiser ihm helfen kann?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Anja Eichbaum
Inselduell
Kriminalroman
Zum Buch
Puppentanz Wer übernimmt das Amt des Bürgermeisters auf Norderney? Umweltbewusst, modern, alleinerziehend – so präsentiert sich die Kandidatin Petra Mertens bei der anstehenden Wahl. Doch noch bevor der Wahlkampf seinen Höhepunkt erreicht hat, wird sie tot am Planetenweg aufgefunden. Mystische Zeichen am Tatort wirken wie eine Visitenkarte des Täters, der ein perfides Spiel mit den Ermittlern zu spielen scheint. Atemlos verfolgt Inselpolizist Martin Ziegler eine Spur nach der anderen und fühlt sich doch immer wieder an der Nase herumgeführt. Ob die Polizeipsychologin Ruth Keiser ihm helfen kann? Sie besucht im Rheinland ihren Freund, der als Journalist nur zu gerne in die Recherchen düsterer Familiengeheimnisse einsteigt. Aber ist das wirklich der richtige Weg oder werden auch sie nur zum Narren gehalten? Die Ermittler sind ratlos. Liegen die Antworten schließlich doch in den Sternen?
Anja Eichbaum stammt aus dem Rheinland, wo sie bis heute mit ihrer Familie lebt. Als Diplom-Sozialarbeiterin ist sie seit vielen Jahren leitend in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Frühere biographische Stationen wie eine Krankenpflegeausbildung und ein »halbes« Germanistikstudium bildeten Grundlage und Füllhorn zugleich für ihr literarisches Arbeiten. Aus ihrer Liebe zum Meer entstand ihr erster Norderney-Krimi, denn ihre Bücher verortet sie gern dort, wo sie selbst am liebsten ist: am Strand mit einem Kaffee in der Hand. Nach Ermittlungen auf Norderney und an der Ostseeküste, agieren ihre Protagonisten diesmal sowohl auf der ostfriesischen Insel als auch in der Heimat der Autorin.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © brndtung / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-6756-1
Personenregister
Gert Schneyder, Mordkommission Aurich
Martin Ziegler, Dienststellenleiter Norderney, lebt mit Anne Wagner zusammen.
Nicole Ennert, Olaf Maternus, Silke Habicht, Ronnie Heitbrink und Lars Sellin, Polizisten
*
Ruth Keiser, Polizeipsychologin
Oskar Schirmeier, Journalist
*
Joseph Thies, Bürgermeister
Petra Mertens, Kandidatin
Klaas Wilko Kroll, Kandidat
Malte Häusler, Kandidat
*
Mattis und Klara Mertens, Kinder
Elisabeth von Möwitz, Schwägerin
Britta Merlenbusch, Patentante
*
Daniela Prinzen, geb. Rick
Frank Prinzen
Marthe Dirkens
Anne Wagner
*
Sabine Hollstein, Sozialarbeiterin
Theresa Westerkamp, Rechtsmedizinerin
Thorsten und Christel Henkel, Dauercamper
Will Reimers, Sternwarte
Mechtild und Hubertus Stock, Bereitschaftspflege
Hendrikje van Hasseln, Tarotlegerin
Dagmar Thies, Ehefrau
Gundula Kroll, Ehefrau
Alexandra Häusler, Ehefrau
Roland Merlenbusch, Ehemann
u. a.
Mittwoch, 20.03.
Hochmut
»Und Sie sind sich sicher, dass Sie eine Chance haben? Zum Bürgermeister gewählt zu werden, ist selbst für einen Insulaner eine Herausforderung und kein Selbstläufer. Sie aber«, er machte eine Pause, und Petra Mertens war versucht, für einen Augenblick die Augen zu schließen, weil sie genau wusste, was kommen würde, »Sie als Zugezogene, als Frau und als alleinerziehende Mutter, das nenne ich mal Chuzpe.«
Petra knipste das routinierte Lächeln an, das sie schon viele Jahrzehnte beherrschte. Nie hätte sie für möglich gehalten, dass ihr ausgerechnet die Erfahrungen als Weinkönigin vor über 20 Jahren von Nutzen wären. Wenn sie etwas konnte, dann war es Repräsentieren, auf Knopfdruck eine fotogene Haltung einnehmen, einen gewinnenden Gesichtsausdruck aufsetzen.
»Herr …« Nun war es an Petra Mertens, eine Pause einzulegen. So grässlich sie diese Psychospielchen fand, sie waren ein Teil des Konstrukts. Solange sie nicht an den Schalthebeln saß, tat sie gut daran, sich wenigstens teilweise den Konventionen zu beugen. Nach der Wahl würde sie alle Möglichkeiten nutzen, um Kommunikation und Transparenz zu verbessern. Nur, dass ihre Gegner und die konservativen Wähler genau das befürchteten. Deswegen hielt sie in dem Punkt die Füße stiller, als es ihre Art war. Sie hatte schon zu viele Lasten im Gepäck, die immer und immer wieder auf den Tisch gepackt wurden, wie der vor ihr sitzende Journalist bewiesen hatte.
»Klöne«, antwortete er nach einer sekundenlangen Verzögerung und mit einem süffisanten Grinsen.
Ja, sie wussten beide, was für ein Spiel hier stattfand.
»Herr Klöne, stimmt. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen. Ihren Artikel in Ihrem Internetblog über die Insel habe ich durchaus zur Kenntnis genommen.«
»Das freut mich, Frau Mertens. Es dürfte für Sie ja nicht uninteressant sein, was auf der Insel passiert und gedacht wird. Und das lässt sich in einem Blog etwas differenzierter, oder sagen wir sogar unverfälschter darstellen als in einem offiziellen Presseorgan.«
Petra seufzte. So wie Klöne es formulierte, hörte es sich an, als lebten sie in einer Welt der manipulierten Meinungsmache. Weit davon entfernt waren sie sicherlich nicht immer, aber hier in Ostfriesland bezweifelte sie absichtliche Fake News der Presse.
»Zu Ihrer Ausgangsfrage. Die übrigens die x-te Variante der einzigen Frage zu sein scheint, die alle interessiert. Wenn ich mir keine Chancen ausrechnete, träte ich nicht an. Ich bin keine Freundin davon, Energien sinnlos zu verschleudern. Ich habe etwas zu sagen. Ich kann Probleme erkennen und analysieren. Ich arbeite lösungsorientiert. Vielleicht gerade, weil ich eine Frau bin. Ganz sicher aufgrund der Zukunftsperspektive und der Managementkompetenzen einer alleinerziehenden Mutter. Und insbesondere mit meinem Blick von außen. Das alles ist wichtig für die Weiterentwicklung der Insel.«
»Die Weiterentwicklung der Insel? Haben Sie diese nicht vor kurzer Zeit noch als Ihren Lieblingsort bezeichnet? Wie passt das zusammen?«
»Auch das, was man liebt, darf sich weiterentwickeln. Sehen Sie, ich liebe meine Kinder über alles. Sollte ich deswegen nicht alles dafür tun, dass sie zu der bestmöglichen Version ihrer Selbst werden können? Oder glauben Sie daran, dass alles aus der eigenen Persönlichkeit allein heranwächst?«
Klöne strich über seine Bartstoppeln und schaute sie nicht an, während er mit seinem Bleistift auf dem Block herumkritzelte. Sie ahnte schon, was er aus ihren Worten machen würde, aber was sollte sie tun? Sie konnte immer nur wiederholen, wie sie die Dinge sah und wofür sie stand. Dass es schwer werden würde, war klar. Bei Leuten wie Klöne hatte sie keine Chance. Aber die Insel war im Wandel. Es gab genug Menschen, die sich wünschten, dass jemand käme und die Dinge einmal bei der Wurzel packte, statt immer nur dabei zuzusehen, wie alles schlechter wurde. Wer zuhörte und hinsah, wusste, dass sie genau die Richtige dafür war. Von nichts anderem ließ sie sich Bange machen.
*
»Frühlingsanfang?«, reagierte Ruth fahrig, weil sie von einer Mail abgelenkt wurde, die auf ihrem Bildschirm aufploppte.
»Ja, Frühlingsanfang.« Ruth hörte die Mischung aus Genervtsein und Belustigung durch den Hörer. »Liebe Frau Keiser, was treiben Sie denn da schon wieder? Ich merke doch, dass etwas wichtiger ist als ich, oder täusche ich mich?«
»Sorry.« Ruth drehte sich auf ihrem Schemel, der vor dem schmalen Schreibtisch stand, vom Laptop weg. Sie wusste als Psychologin, dass feinfühlige Menschen es sofort merkten, wenn man beim Telefonieren nicht bei der Sache war. Und erst recht lehnte sie ein solches Verhalten ab. Theoretisch zumindest. Bei anderen. Oder gefragt nach ihren Wertvorstellungen für zwischenmenschliche Kommunikation. Schuldbewusst senkte sie ihre Stimme. »Ich habe es verstanden. Wenn du mich siezt …«
»Ach, das ist die einzige Art, mir deine Aufmerksamkeit zu sichern? Hätte ich das mal geahnt. Niemals wäre das Du über meine Lippen gekommen.«
»Quatschkopf«, entfuhr es ihr.
Er lachte. »Meine liebe Ruth, wie gehst du bloß mit meinem Sehnen nach dir um? Ich spreche von Frühlingsgefühlen – und du?«
»He! Halt. Stopp. Von Frühlingsgefühlen war bisher keine Rede. Frühlingsanfang war das Stichwort.«
»Oh, wie schade. Für mich ist das fast gleichbedeutend. Wenn du das anders siehst. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle …«
»Jetzt ist aber gut. Bleib doch mal ernst. Wo ich dir endlich zuhöre.«
Oskar seufzte theatralisch. »Wie gut, dass mir das gelungen ist. Also, dann noch einmal von vorne. Bis wann hattest du mir zugehört?«
»Fang lieber von vorne an.«
»Oha, mit der Begrüßung also.«
»Nein, mit dem Frühlingsanfang. Manchmal raubst du mir den letzten Nerv.« Ruth lachte auf. »Aber du weißt schon, dass das ein Kompliment ist?«
»Tatsächlich hast du mir in den letzten Monaten ausreichend Gelegenheit gegeben, das festzustellen, ja. Also gut, jetzt mal ernsthaft. Ich dachte über ein gemeinsames Wochenende bei mir nach. Was hältst du davon? Bei uns am Rhein gibt das Frühjahr schon Gas. Es ist herrliches Wetter gemeldet. Über 20 Grad. Ich hätte ein paar gute Ideen, wie wir uns die Zeit vertreiben könnten.«
Ruth lachte erneut. »Letzteres glaube ich dir sofort. Das hast du bei meinen letzten Besuchen eindringlich bewiesen, auch bei schlechtem Wetter.«
»Klingst nicht so, als wärst du unzufrieden gewesen.«
»Das stimmt. Das war ich ganz und gar nicht.«
»Ich wette, du lächelst gerade.«
»Tue ich. Du bist ein Hellseher.«
»Das ist meine Spezialität. Deswegen kenne ich auch die Antwort. Du kommst.«
»Vielleicht musst du an deinem wahrsagerischen Feintuning noch etwas arbeiten. Ich komme. Aber nicht erst am Wochenende, sondern schon Donnerstag. Wenn du magst. Freitag fällt mein Termin aus.«
»Das ist großartig.« Oskar hatte nur einen Moment gestutzt. Nun konnte Ruth die Freude aus seiner Stimme heraushören. »Das ist mehr, als ich zu hoffen gewagt habe.«
»Passt es auch für dich?«
»Ich muss Freitag arbeiten. Aber ich habe keine Sorge, dass du dich nicht auch alleine amüsierst. Hauptsache, eine gemeinsame Nacht mehr. Das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann.«
Ruth merkte, dass sie wie ein Honigkuchenpferd grinste. Wer hätte gedacht, dass es sie so erwischte. Am liebsten würde sie sofort ihre Reisetasche ins Cabrio schmeißen. Aber was waren schon 24 Stunden? »Finde ich auch, mein kleiner, großer Quatschkopf. Ich freue mich riesig auf dich.«
*
Petra Mertens verabschiedete das Kindermädchen betont fröhlich und ließ sich dann mit dem Rücken zur Tür langsam zu Boden sinken. Aus dem Wohnzimmer dröhnten die Stimmen einer Wissenschaftssendung aus dem Kika-Fernsehprogramm. Etwas, was sie ihren Kindern erlaubte, während sie über andere Sendungen heftig diskutierten. Heute war sie, wie wahrscheinlich die Mehrzahl aller Eltern, nur froh, dass ihre Kinder für die nächste halbe Stunde abgelenkt waren. Zeit für eine kleine Verschnaufpause, bevor sie den morgigen Tag vorbereiten musste. Die Müdigkeit saß ihr seit dem unbefriedigenden Interview am Nachmittag in Nacken und Schläfe. Auch wenn sie wusste, dass die Fragen von Klöne Teil des Spiels waren, machten sie trotzdem an Tagen wie diesen mürbe. An Tagen wie diesen, an denen sie sich die gleichen Fragen selbst stellte, an denen sie zuließ, dass die Zweifel sich über den Verstand legten und alle guten Argumente beiseite fegten. Die sie durchaus hatte. Das wusste sie, das wussten ihre Unterstützer, ihre Gegner und nicht zuletzt ein immer größerer potenzieller Wählerkreis. Wenn man den Umfragen Glauben schenkte, hatte sie verdammt gute Karten, die Bürgermeisterwahl zu gewinnen.
War sie bereit, den Preis zu zahlen, fragte die Stimme, die sich zwar in ihrem eng getakteten Alltag unterdrücken ließ, die aber seit drei Stunden einfach nicht mehr die Klappe hielt. Petra hatte es mit allen Coachingtipps versucht. Sie hatte »Stopp« gemurmelt, hatte ihren Gedankenfluss umgekehrt, sich abgelenkt und ein paar halbherzige Entspannungsübungen durchgeführt. Für mehr war keine Zeit gewesen. Das Interview, ein Treffen mit der Umweltgruppe und ein Fototermin an der Baustelle eines neuen Personalwohnheims hatten sich nahtlos aneinandergereiht. Was die Stimme noch gefüttert hatte. Petra fasste sich an die Schläfen. Sie sollte aufhören, ihre Gedanken als ›die Stimme‹ zu betiteln. Wenn einer das mitbekäme, könnte sie einpacken. Das wäre das Ende ihrer kommunalpolitischen Karriere, von der sie doch hoffte, dass sie erst am Anfang stand.
Sie stemmte sich hoch und zog die Tür zum Wohnzimmer zu. In der Küche hatte das Kindermädchen schon klar Schiff gemacht, sodass sie gleich nur dafür sorgen musste, dass die Kinder in die Betten kamen. »Nur«, murmelte sie vor sich hin. Dabei war es meist die größte Herausforderung des Tages. Wenn ihr Ruhebedürfnis auf das Nichtschlafenwollen der Kinder prallte. Wobei sie die Zeit an guten Abenden mochte. Wenn alle im Flow waren, wenn es keine besonderen Störungen gab. Dann genoss sie es, dass selbst der Zwölfjährige mit ins Bett der jüngeren Schwester huschte und die Geschwister mit Engelsaugen darum baten, eine Geschichte vorgelesen zu bekommen.
»Das darfst du niemandem erzählen«, hatten sich beide ausbedungen. Natürlich waren sie längst dem Vorlesealter entwachsen. Aber seit dem Tod ihres Mannes war es so etwas wie ein Heilmittel geworden, ein Festhalten an alten, zumindest für die Kinder glücklicheren Zeiten. Ihr schlechtes Erwachsenengewissen hatte die Gelegenheit gerne ergriffen. Schließlich tat es auch ihr gut. So eng beieinander. In Heile-Welt-Szenarien vertieft, die sie in der Wirklichkeit schon lange nicht mehr erlebt hatte. Sie schluckte. Ihr Mund wurde trocken. Nur nicht daran denken. Schnell öffnete sie die Kühlschranktür und goss sich ein Glas kaltes Wasser ein, das sie ohne Absetzen austrank.
Genauso häufig waren allerdings die Abende, an denen die Kinder eifersüchtig um ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung buhlten und jeglichen Streit vom Zaun brachen, der sich ihnen bot. Da ging es um geklaute Lieblingsdecken, um die Zeit des Zähneputzens, um verschwundene Handys, Bücher und CDs, um angebliche Missetaten am Tag. Haare ziehen, boxen, kneifen, treten – all das wurde eingesetzt, um das eigene Recht zu unterstreichen, und keine der Konfliktlösungen, auf die die Schule so großen Wert legte, konnte sie durchsetzen. Es waren die Abende, an denen sie schließlich alle schrien, nur um den anderen zu übertönen, und sie war in diesen Augenblicken keinen Deut besser als die Kinder. Dass einer das hören würde, war ihre größte Angst. Was Mattis mit seinen zwölf Jahren zu nutzen wusste. »Schreist du dann als Bürgermeisterin auch so rum?«, hatte er letztens gefragt. Sofort danach war eine unheimliche Stille eingetreten. Klara hatte erschrocken die Augen aufgerissen, Mattis war aus dem Zimmer gestürmt, hatte sich im Bad eingeschlossen und dort bitterlich geweint. Es war einer der Abende gewesen, an dem sie sich nach dem ersten Schreck laut zugesprochen hatte: »Aber nicht doch. Ich muss nicht perfekt sein, um dieses Amt anzutreten. Wer fragt danach, ob einer der männlichen Kandidaten zu Hause mit den Kindern brüllt?«
Trotzdem hatte sie seitdem oft Sorge wegen möglicher abendlicher Eskalationen. Dass sie deswegen nach und nach die Freiräume der Kinder etwas ausgeweitet hatte, wusste sie selbst. Andererseits bewegte sie sich immer noch in einem Bereich von Regeln und Grenzen, der in anderen Familien schon lange ausgehebelt war. Tatsächlich war sie sogar dazu übergegangen, das Thema Kinder und Familie immer mehr in ihre Wahlkampfveranstaltungen aufzunehmen. Obwohl es ihr anfangs als die größte Hürde erschienen war. Nach dem, was alles war. Weil sie Angst vor den Fragen gehabt hatte.
Nun aber erlebte sie, wie sehr sie Menschen emotional erreichen konnte. Wenn sie ihre eigenen Sorgen hinsichtlich der Kinder thematisierte, wenn sie Unsicherheiten äußerte und auf die Lebensbedingungen junger Familien einging. Gerade, weil es zu ihrem Schwerpunktthema passte. Umweltschutz. Erhaltung der Natur. Die Zeichen der Zeit standen gut für sie. Es tat sich was. Es war Bewegung in der Sache. Schon lange hatte niemand mehr so wie jetzt damit punkten können, wenn er zu einem Überdenken der eigenen Lebensweise aufrief. Hier war sie klar im Vorteil. Als vergleichsweise junge Kandidatin mit 39 Jahren nahm man ihr ab, wenn sie für die Zukunft ihrer Kinder die Stimme erhob.
Aus dem Wohnzimmer erklang gedämpft die Titelmusik von ›logo!‹, dem Nachrichtenmagazin für Kinder. Es blieben ihr zehn Minuten. Die Zeit für sich allein hatte ihr gutgetan. Sie würde den Abend nutzen, um den morgigen Vortrag vorzubereiten, bei dem sie über die Gleichstellung zwischen Mann und Frau in einer modernen Umweltpolitik sprechen würde. Sie holte ihren Laptop aus der Tasche an der Garderobe und stellte ihn auf den Küchentisch. Daneben das Wasserglas und ein Schälchen mit Gummibären. Genau abgezählt, damit es ihre Energiekalkulation nicht allzu durcheinanderbrachte. Aber als kleine Reminiszenz an ihre Heimat. Die rot-gelb-grün-weiß-orangen Zuckerportionen hatten sie schon durchs Abitur und alle ihre Uniprüfungen gebracht. Nun musste sie nur vermeiden, dass Mattis und Klara die Küche stürmten.
Was sie sofort vergaß, als sich ihr Handy meldete. Die schrille Klingel, die an einen alten Festnetzapparat erinnerte, ließ sich nicht ignorieren. Damit drangen nur die wichtigsten Anrufe zu ihr durch. Es blieb ihr nichts anderes übrig. Wahlkampfzeiten.
»Petra Mertens, hallo?«, meldete sie sich.
Als sie auflegte, hatten ihre Kinder die Süßigkeiten aus der Küche entführt und stritten sich lauthals um die Farben. Petra schaute irritiert auf ihren Laptop. Sie war verwirrt. Verstand nicht, was der Anruf zu bedeuten hatte. Wusste nur, dass sie handeln musste. Jetzt. Sofort. Heute Abend noch.
*
Daniela Prinzen sah sich zufrieden im Frühstücksraum um. Das Essen hatte allen geschmeckt, es war nur wenig übrig geblieben von dem Fingerfood, das sie zubereitet hatte. Der große Suppentopf war sogar komplett leer, wie sie eben bei einem Gang in die Küche festgestellt hatte.
»Möchte noch einer einen Kaffee?«, fragte sie in die Runde. Frank erhob sich. »Den mache ich. Du bleibst jetzt mal sitzen.«
Daniela grinste. Ihr Mann hatte seine guten Seiten nach der Hochzeit im letzten Jahr nicht abgelegt. Immer hatte er im Blick, wie er sie unterstützen konnte. Sie hatten sich ja nicht eben wenig vorgenommen mit einem Hostel auf einer der beliebtesten Ferieninseln der Nordsee.
»Nein. Nein.« Energisch setzte sich die Stimme von Frau Dirkens durch. »Das wollt ihr mir ja wohl nicht antun. Kaffee um diese Uhrzeit?«
»Nun ja, der ein oder andere vielleicht.« Daniela sah fragend in die Runde.
»Aber es ist mein Geburtstag. Liebe Kinder, so geht das nicht.«
Daniela schlug sich an die Stirn. Sie wusste, worauf die alte Dame hinauswollte. Die Teezeremonie fehlte. Frau Dirkens’ ganz spezielle, eigenwillige Version des ostfriesischen Brauchs.
»Aber selbstverständlich sind wir dabei.« Martin Zieglers dunkle Stimme übertönte die Gespräche und das Lachen der Tischrunde. »Wenn ich helfen kann? Soll ich die Flasche aus dem Giftschrank holen?«
Alle brachen in Gelächter aus. Bei Zieglers erster Begegnung mit Frau Dirkens’ Giftschrank war er keineswegs entspannt gewesen, befand er sich doch damals als Inselpolizist in der Ermittlung eines Todesfalls. Heute aber feierten sie privat den Geburtstag der alten Pensionswirtin.
»Nichts da, so weit ist es immer noch nicht. An meinen Schrank darf keiner ran. Auch wenn ich mich auf mein Altenteil zurückgezogen habe. Es hält mich übrigens jung, das Treppensteigen.« Und schon war sie aus dem Raum.
»Das Gefühl habe ich auch, dass es sie jung hält«, warf Anne Wagner ein. »Das ist wirklich ein gutes Konstrukt, das ihr hier gefunden habt.«
Daniela nickte. Sie hatte mit ihrem Mann die Pension von Frau Dirkens übernommen, während die alte Dame mit lebenslangem Wohnrecht in das oberste Stockwerk gezogen war. Nach und nach hatten sie begonnen, die in die Jahre gekommenen Zimmer zu renovieren und auf einen neuen Standard zu bringen. Dabei war eine Art Hostel entstanden, die günstiges und trotzdem modernes Ferienwohnen miteinander verband. Etwas, das mittlerweile selten auf der Insel war. Weshalb sie sich über eine mangelnde Nachfrage nicht beschweren konnten. Für Daniela war ein Traum wahr geworden. Ihren Umzug aus dem Rheinland bereute sie noch keinen Tag.
Frank, der in der Küche das Teewasser aufgesetzt hatte, betrat den Raum mit einem Tablett voller Porzellantassen »Ostfriesische Rose«, den Kluntjes und zwei Sahnekännchen. »Das kann man wohl sagen, Anne. Wirklich eine Win-win-Situation, wie sie im Buche steht. Dass es so glatt läuft, haben wir uns alle nicht vorstellen können.«
»Stimmt es denn, dass du zusätzlich wieder als Friseurin arbeiten willst?« Eine der älteren Freundinnen von Frau Dirkens beugte sich vor und hielt sich die Hand hinter das Ohr.
Daniela lachte. »In der Hinsicht unterscheidet sich Norderney nicht vom Rheinland. Gerüchte verbreiten sich in Windeseile.«
»Ach?« Enttäuscht ließ sich die Insulanerin zurückfallen. »Nur ein Gerücht.«
»Nein, das stimmt auch nicht.« Frank ergriff wieder das Wort, während er die Tassen verteilte. »Wir überlegen noch. Das war ja auch immer einer von Danielas Träumen. Sich selbstständig zu machen mit einem mobilen Friseurservice, stimmt doch, oder?«
»Allerdings. Als ich noch unverheiratet war, wollte ich meine Dienste ›Haarick‹ nennen, ein Wortspiel aus haarig und meinem Mädchennamen Rick. Das passt ja nun nicht mehr.«
»Und deswegen hast du den Traum begraben?« Anne schüttelte den Kopf. »Das sieht dir nicht ähnlich.«
»Natürlich nicht. War nur ein Spaß. Wir sind eher noch in der allgemeinen Findungsphase.«
Anne schaute skeptisch. »Ich könnte mir vorstellen, dass alles zusammen auch zu viel wird. Franks Vollzeitstelle, das Hostel, der Umbau. Und noch ein mobiler Friseurdienst?«
»Deswegen gehen wir das Schritt für Schritt an. Aber Pläne schmieden kostet ja nichts.« Daniela sah zu Frank. »Nur ein Wortspiel mit meinem neuen Namen habe ich als Frau Prinzen noch nicht gefunden.«
»Du wirst doch wohl nichts bereuen?« Frank drohte ihr mit dem Zeigefinger.
»Nach meiner Teezeremonie bereut niemand etwas. Hier ist das gute Stück.« Frau Dirkens stellte die Whiskeyflasche mit Schwung auf den Tisch. »Also los, Kluntjes in die Tassen, wir wollen loslegen.« Frank hatte den Tee in der Küche aufgebrüht und ihn in der Servierkanne auf den Tisch gestellt. Alle gaben sich nacheinander dem vertrauten Ritual hin. Die Kluntjes wurden mit dem heißen Tee übergossen und knisterten laut. Dann wurde die Sahne vorsichtig mit einem Löffel am Tassenrand eingetröpfelt, sodass die klassische Sahnewolke entstand. Nur – dass hier eben der Schuss Whiskey hinzugefügt wurde, der Frau Dirkens’ Tee erst zu der Besonderheit machte, von der alle schwärmten.
»Denn mal auf meinen Seligen, der uns den Whiskey nahegebracht hat.« Frau Dirkens hob die Tasse. »Wer hätte gedacht, dass ich ihn einmal so lange überlebe.«
»Da sollen auch noch viele Jahre dazukommen«, gab Daniela zurück. Ihre Kehle schnürte sich zusammen. Die Pensionswirtin war über viele Jahre zu einem Elternersatz für sie geworden.
»Da habe ich gar keine Sorge«, zwinkerte Anne Wagner.
Daniela lächelte sie erleichtert an. Anne musste es als Ärztin im Inselkrankenhaus schließlich wissen.
»Wie schön jedenfalls, dass ihr alle zu meinem Ehrentag zusammengekommen seid. Insulaner und Zugezogene, wo hat man das schon.« Marthe Dirkens nahm einen großen Schluck aus der Tasse, die sie grazil mit abgespreiztem kleinen Finger in der Hand hielt.
»Jo, Marthe, da bist du wirklich was Besonderes auf der Insel.« Eine der Damen aus Frau Dirkens’ Handarbeitskreis erhob die Stimme. »Eigentlich solltest du dich am besten für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen.«
Alle lachten und fingen an durcheinanderzureden.
Doch die Freundin war noch nicht zu Ende. Laut pochte sie auf den Holztisch. »Oder will mir hier irgendjemand weismachen, von den drei aufgestellten Kandidaten könnte man irgendjemanden wählen?« Sie verzog den Mund, als wolle sie gleich ausspeien. »Da kann man froh sein wegen seines Alters, dass man das nicht mehr allzu lange erleben muss.«
*
Klaas Wilko Kroll stellte sein Fahrrad windsicher an der Hauswand ab und öffnete die Tür seiner Stammwirtschaft. So einen neumodischen Kram wie ein Fahrradschloss brauchte er in diesem Teil der Insel glücklicherweise immer noch nicht. Hier war man unter sich. Insulaner und Ostfriesen. Kein Touri weit und breit. Und weil das so bleiben sollte, war es wichtig, heute Abend die Stammkneipe zu besuchen.
»He, KWK!«, schallte es ihm aus fast allen Mündern entgegen. Nicht laut, nicht euphorisch, sondern nüchtern friesisch, wie es hier als Landesart galt. KWK war sein Spitzname, seitdem er sich zur Wahl hatte aufstellen lassen. Das fanden einige eine witzige Anspielung auf die große Politik in Berlin. Wobei ›große Politik‹ von ihnen allen nur ironisch gedacht und ausgesprochen wurde.
Mit seinen 56 Jahren fand er es an der Zeit, sich noch einmal nach einer interessanten Herausforderung umzusehen. Seine Anwaltstätigkeit auf dem Festland langweilte ihn nach fast 30 Jahren und bot kein Weiterkommen. Das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters schien verlockender, als weiterhin Tag für Tag den Ruhestand herbeizusehnen. Das jedenfalls hatte seine Frau ihm klargemacht.
»Das wird auch mal wieder Zeit, dass du dich bei uns blicken lässt«, haute ihm einer der Thekensteher auf die Schulter. »Wirst ja wohl hoffentlich keiner von denen, die nicht mehr wissen, wo sie herkommen. Denk daran: Wir sind diejenigen, die dich wählen.«
»Weiß ich doch, weiß ich doch.« Mit dem Zeigefinger wies Kroll auf die acht Männer, die sich auf der hölzernen Theke abstützten, und signalisierte dem Wirt, allen einen Schnaps hinzustellen. »Aber noch bin ich nicht gewählt, wie ihr wisst.«
Die Männer tranken alle gleichzeitig und knallten die Gläser zurück auf den Tresen.
»Die Gefahr besteht«, stieß einer hervor.
Klaas Wilko lachte. »Was meinst du mit Gefahr? Dass ich gewählt werde oder nicht?«
Alle brachen in ein dumpfes Gelächter aus. Kroll wusste, wie er die Männer zu nehmen hatte.
»Na, aber ein Selbstläufer wird das nicht, so wie es aussieht«, ließ der Wirt sich vernehmen. Bedeutungsvoll zog er die Augenbrauen hoch. »Auch hier nicht, KWK, das lass dir mal gesagt sein.«
Kroll sah die Männer der Reihe nach an. »Und das soll was heißen? Mach es mal nicht zu spannend.«
Alle schauten auf ihre Hände, die einheitlich um die Biergläser vor ihnen lagen. Kneipenbesucher waren wie Kirchgänger, schoss es Kroll durch den Kopf. Rituale waren es, die die Menschen brauchten. Ob sie die Hände zum Gebet falteten oder das Glas umklammerten. Beides gab Halt. Und weil die Menschheit genau das suchte, deswegen würde er Bürgermeister werden. Bürgermeister seiner Heimatinsel.
Der Wirt polierte mit einem Handtuch die kupfernen Bierhähne. Er ließ sich Zeit. Kroll wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihn zu drängen, wenn er eine ehrliche Antwort bekommen wollte.
»Du bist ja nun mal nicht der einzige Kandidat«, ließ er ihn dann mit einem schnellen Seitenblick wissen.
»Das ist ja keine Neuigkeit.«
»Und die Themen, die uns hier umtreiben, die brennen nun mal. Wird Zeit, dass sich mal einer wirklich darum kümmert.«
»Genau dafür stehe ich.«
Der Wirt richtete sich ein Stück weit auf, drückte den Rücken durch und senkte seine Stimme noch mehr. »Die meisten von uns wissen das. Aber …«
»Aber was?«
»Was man sich so erzählt. Die beiden anderen kommen auch an.«
Kroll gab ein Schnaufen von sich. Er hatte nicht erwartet, dass über seine beiden Gegenkandidaten überhaupt ein Wort in dieser Kneipe verloren wurde.
»Womit denn?«, fragte er und verzog seinen Mund zu einem spöttischen Grinsen. »Mit Möpsen bei der einen und Pomade bei dem anderen? Da glaubt ihr, da könnte man auf unserer Insel was werden?«
Die meisten lachten bei seinen Worten, aber Kroll sah, dass es nicht alle waren. Irgendetwas hatte sich stimmungsmäßig verändert, seit er das letzte Mal hier war.
»Ich weiß nicht, ob man es sich noch so einfach machen kann.« Der Wirt zapfte ein neues Bier für Kroll und stellte es vor ihn hin. »Besonders die Mertens sammelt Befürworter und Unterstützer um sich. Weil sie Themen anspricht, die alle umtreiben. Wohnungsmarkt. Arbeitskräfte. Weiterentwicklung der Insel.«
»Die Themen stehen auch bei mir im Wahlprogramm.«
»Die Themen ja«, kam eine Stimme von der gegenüberliegenden Seite.
Kroll war es, als würde der ohnehin schon kleine Kneipenraum, der nur aus einem schmalen dreiseitigen Umlauf um die Zapfanlage bestand und keine weiteren Sitzgelegenheiten bot, noch enger.
»Mach noch eine Runde«, wies er an, um etwas Zeit zu gewinnen. Als die leeren Gläser wieder mit einem hellen Klirren zurückgestellt wurden, entgegnete er betont ruhig und besonnen: »So, so, und du glaubst also, dass ich nur Themen habe und keine Antworten.«
»Vielleicht.« Der Angesprochene zog den Kopf zwischen die Schultern. »So richtig eine Lösung habe ich jedenfalls noch nicht von dir gehört.«
»Dann kann ich es dir gerne erneut erklären.« Kroll wusste, er durfte sich nicht provozieren lassen. »Fakt ist doch, wir müssen dringend den ganzen neumodischen Erscheinungen Einhalt gebieten. Sonst ist die Insel weg. Perdu.« Es gefiel ihm, mit einem französischen Wort seine Haltung zu betonen.
Einstimmiges Brummen folgte.
»Unsere ganzen Werte, unsere Bräuche, die Traditionen. Da hat doch keiner der anderen Kandidaten auch nur eine Ahnung von.«
»Der Anzugträger schon. Er ist Ostfriese«, warf der Wirt ein.
»Ja. Stimmt. Er ist Ostfriese. Und ein Mann. Immerhin.« Alle lachten zustimmend. »Aber warum trägt er denn Anzüge und schmiert sich Gel in die Haare? Na? Das wisst ihr doch. Weil er ein Immobilienmakler ist. Und was macht ein Immobilienmakler, der Anzugträger ist, wohl auf Norderney? Für Wohnraum sorgen?«
»Stimmt. Von Luxussanierungen haben wir die Nase voll. Du stehst schon für die richtigen Sachen, KWK«, schlug ihm sein linker Nachbar auf die Schulter.
Kroll kam in Fahrt. Das war sein Metier. »Und warum will der wohl Bürgermeister werden? Weil er das Beste für die Insel will? Oder weil er dann an den Schalthebeln sitzt, um die Insel noch mehr dem Ausverkauf preiszugeben?«
Der Wirt schnalzte mit der Zunge. »Der Schnösel macht uns auch keine so großen Sorgen. Aber diese Mertens.«
Kroll sah ihn zweifelnd an. »Für sie rechnest du dir Chancen aus?«
»Na, wegen mir nicht. Aber hör dich doch mal um. Die wird ernst genommen.«
»Von wem denn?«
»Ich sag es nur ungern. So als Wirt soll man ja seinen eigenen Laden nicht runterreden. Aber schaut euch doch mal um. Wie viele Leute stehen denn abends noch bei mir an der Theke? Und wie viele waren das letztes Jahr, und vor drei oder vor fünf Jahren? Länger zurückschauen will ich gar nicht, dann nehme ich mir einen Strick. Wo sind sie denn, die Einheimischen? Die Insulaner, die dich wählen?«
Kroll zog betroffen den Barhocker an sich heran und setzte sich. »Das meinst du doch nicht ernst.«
»Doch. Das meine ich so. Und ich weiß, dass hier der eine oder andere auch mit der Mertens liebäugelt. Sie hat nämlich etwas drauf. Kann auf die Leute zugehen. Kennt die Sorgen der jungen Familien, weil sie selbst Kinder hat. Sie hat so etwas Modernes, Frisches. Und dann nimmt sie die Umwelt ernst. Unser Wattenmeer. Hat richtig Ahnung davon.«
»Ich fasse das nicht. Bist du ein Überläufer? Hat sie dich angebaggert? Versprichst du dir was von ihr?« Er zeichnete übertrieben eine weibliche Figur nach, weil er wusste, dass das bei den Männern immer gut ankam.
Diesmal schwiegen alle. In ihren Augen lag Gier. Sie wollten wissen, wie es weiterging. Ob er, Kroll, denn die passenden Antworten hätte.
Der Wirt zapfte in Ruhe ein Bier, das er kommentarlos vor Kroll abstellte, obwohl er keins bestellt hatte. Dann goss er zwei Schnäpse ein, reichte ihm eins und stieß mit ihm an. »Nichts für ungut, KWK, ich bin auf deiner Seite. Ich sage dir nur, was ich höre und sehe. Auch hier am Tresen.« Er blickte sich nach den Männern um. »Stell es dir nur nicht zu leicht vor.«
Auf seiner Schulter landete wieder die Hand seines Nebenmannes. »Wir stehen doch alle hinter dir. Du bist schon der Richtige – im Ganzen gesehen. Aber wir wollen wissen, wie es weitergeht mit der Insel. Ich setze auf dich: Du wirst dir doch von einem Weibsbild wie der Mertens nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Jag sie dahin, wo sie herkommt. Zurück ins Rheinland oder sonst wohin mit ihr. Wo kämen wir denn hin, wenn unser KWK gegen so eine die Wahl verlieren würde? Also: Mach was. Zeig uns, dass du die Fäden in der Hand hältst. Wir zählen auf dich, Klaas Wilko Kroll. Verstanden? Und jetzt eine Runde Schnaps auf mich.«
*
Donnerstag, 21.03.
Neid
Verdammt. Den Weg nahm er doch jeden Tag. Jeden gottverdammten Tag, den er auf Norderney verbrachte. Und das waren nicht wenige. Sondern zunehmend mehr. War es früher nur der Sommerfamilienurlaub gewesen, so waren sie später dazu übergegangen, alle Ferien auf der Insel zu verbringen. Dann, als die Kinder größer und selbstständiger wurden, kamen die Feiertage und langen Wochenenden hinzu. Es war ein Katzensprung auf die Insel von Nordhorn aus. Und trotzdem lebten sie hier in einer anderen Welt. Besonders, seit sie den festen Stellplatz gemietet hatten. Der Wohnwagen war eine Übernahme gewesen von einem freundlichen Ehepaar, das sie beim Campen über die Jahre kennengelernt hatten.
Heile Welt, nannten sie die kleine Parzelle. Das stand auch auf dem dicken Findling, den sie neben den Eingang gewuchtet hatten. Eine heile Welt, das war die Insel immer gewesen. Und wenn er den Planetenweg morgens mit dem Segway auf dem Weg zum Bäcker befuhr, dann war das Leben für ihn in Ordnung. Später am Tag waren die Wege zu oft von rücksichtslosen Spaziergängern und Fahrradfahrern verstopft, und das brachte ihn um den Genuss des selbstvergessenen Fahrens. Einzig das Damwild und die Kaninchen kreuzten in der Frühe seinen Weg, aber hieran war er gewöhnt.
Der Koffer lag mitten auf dem Weg. Unmöglich, daran vorbeizufahren. Nur deswegen hatte er so abrupt abgebremst. Ob er sonst an ihr vorbeigefahren wäre?
Thorsten Henkel drehte sich um, um sich zu vergewissern, dass sein Kopf ihm keinen Streich spielte. Dass er sich das nicht alles einbildete.
Er zog die Jacke enger, weil ihn fröstelte. Der Frühnebel über der Wattseite und den kleinen Binnenseen, an denen der Weg entlang führte, hatte sich noch nicht vollständig aufgelöst. Deswegen wäre es möglich gewesen, dass er sie nicht bemerkt hätte, wenn er nicht wegen des Koffers hätte halten müssen.
Wie lange es dauerte, bis die Rettungskräfte kamen. Angestrengt lauschte er. Nichts. Das Martinshorn war noch nicht zu hören. Dabei war das Krankenhaus doch gar nicht so weit entfernt. Wobei er sich sicher war, dass kein Notarzt und kein Rettungsassistent mehr helfen konnte. Das ahnte auch er als Laie. Da brauchte er gar nicht hin, um Puls und Atmung zu kontrollieren. Das sah er auf die Entfernung – und das war ihm recht. Schließlich wirkte es von hier aus gruselig genug. Weit aufgerissene Augen, der Mund heruntergeklappt, von den Mundwinkeln aus zogen sich wohl getrocknete dunkelrote, fast schwarze Blutspuren zum Unterkiefer.
Die Polizei, die war wichtig. Denn die Tote hatte eindeutig ein Einschussloch. In der Höhe des Herzens. Dort war die Kleidung zerfetzt, und eine Blutlache hatte sich kreisförmig ausgebreitet. So wie in den Western, die Thorsten als Kind so gerne gesehen hatte. Als er glaubte, der Tod sei ein temporärer Zustand wie der Schlaf. Später wusste er es besser und hatte jedes Zusammentreffen vermieden. Was sich nicht durchziehen ließ. Die Eltern starben. Der Onkel. Sein bester Freund. Was seinen Rückzug auf die kleine Parzelle nur attraktiver gemacht hatte. Seitdem schaute er keine blutrünstigen und tragischen Filme, las keine Thriller. Nichts. Happy Ends waren für sein Seelenheil das Beste. Nur das hier – da war ein Happy End nicht mehr möglich.
Noch einmal blickte er zurück. Die Frau, so verzerrt ihr Gesicht im Tod auch war, schien jung zu sein. Viel, viel jünger als er mit seinen nahezu 70 Jahren. 35 vielleicht, möglicherweise 40. Er war im Schätzen nicht so gut, und bei einer Leiche konnte man wahrscheinlich schnell danebenliegen. Nur gut, dass sie darüber nicht beleidigt sein konnte.
Thorsten Henkel schüttelte den Kopf über seine abstrusen Gedanken. Die Züge der Frau kamen ihm seltsam bekannt vor, aber das war etwas, was ihm mit zunehmendem Alter immer öfter passierte. Dass ihm Fremde vertraut vorkamen und er schneller Ähnlichkeiten zwischen Menschen entdeckte. Ihre kastanienbraunen Haare waren eine Allerweltsfarbe bei Frauen, so gut kannte er sich aus. Das war wie bei seiner Christel, die hatte diesen Grundton auch, mit Varianten in Richtung rot oder einer dunkleren Haselnuss.
Endlich. Aus weiter Ferne klang das Martinshorn durch den Nebel. Gedämpft, aber stetig lauter werdend. Er seufzte erleichtert auf. Gleich müsste er sich nicht mehr verantwortlich fühlen. Er würde eine Zeugenaussage machen und dann sein Segway drehen und zurück zu seiner Christel fahren. Brötchen brauchte er heute keine. Der Appetit war ihm vergangen. In seiner Parzelle würde er den Schrecken hoffentlich schnell vergessen. Am liebsten würde er gar nicht wissen, was aus der Sache würde. Warum, weshalb, wieso diese Frau hier lag. Was ging es ihn an? In seiner heilen Welt spielte das keine Rolle. Nur Christel würde sich wundern, wo er so lange blieb und warum er ohne Brötchen käme. Wenn er ihr etwas erzählte, wäre es aus mit der Ruhe. Da kannte er sie nur zu gut. Er hoffte einfach, dass die ganze Geschichte keine allzu großen Auswirkungen auf das Norderneyer Leben hatte. Wenn er Glück hatte, war es nur ein profaner Selbstmord. Schrecklich, ohne Frage. Besonders für die Frau. Doch die Aufregung würde sich nach ein oder zwei Tagen legen. Und das wäre ihm ehrlich gesagt am allerliebsten.
*
»Polizei Norderney. Olaf Maternus. Was liegt an?«
»Moin. Ich rufe an aus der Wohnung von Petra Mertens. Sie wissen schon. Der Bürgermeisterkandidatin.«
»Ja und?«
»Ich glaube, Sie müssen kommen. Frau Mertens ist nicht da.«
»Ich glaube, ich verstehe nicht, was Sie wollen. Das ist doch kein Anlass für die Polizei, wenn jemand nicht zu Hause ist. Überhaupt. Wieso sind Sie da, wenn Sie nicht die Wohnungsinhaberin sind? Das ist viel eher von Relevanz für uns. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen und den genauen Grund Ihres Anrufs.«
»Ich bin die Nachbarin. Und ich habe einen Schlüssel für die Wohnung von Frau Mertens. An Ihrer Stelle würde ich mich auf den Weg machen. Frau Mertens ist nicht in der Wohnung. Ihre Kinder sind es sehr wohl. Allein. Die Kinder sind aufgewacht, die Mutter war verschwunden. Das Bett nicht benutzt. Kein Zettel auf dem Küchentisch oder an der Wohnungstür. Keine Nachricht an mich. Das Handy ist ausgeschaltet. Sie ist nicht erreichbar. Kein Lebenszeichen. Nichts.«
Olaf Maternus runzelte die Stirn. Alle verfügbaren Kollegen einschließlich des Chefs waren ausgerückt. Fund einer weiblichen Leiche am Planetenweg. Die Haare an seinen Armen stellten sich auf. Es würde doch hoffentlich keinen Zusammenhang geben?
Mit aller Professionalität suchte er nach einer beruhigenden Antwort. »Dafür wird es sicher eine harmlose Erklärung geben. So jung sind die Kinder von Frau Mertens doch nicht, wenn ich das von ihrer Wahlvorstellung richtig in Erinnerung habe. Da darf man auch die Wohnung einmal verlassen.«
»Glauben Sie mir. Frau Mertens macht das nicht. Bitte kommen Sie her. Es muss sich einer um die Kinder kümmern.«
»Um die Kinder. Ja, natürlich.«
»Sagen Sie mal. Sie werden doch eine Kollegin vorbeischicken können, oder nicht? Bin ich überhaupt mit der Polizei verbunden?«
Maternus räusperte sich. »Selbstverständlich. Es ist nur so …« Er konnte ihr beileibe nicht sagen, weshalb alle diensthabenden Kollegen ausgerückt waren. »Ich denke, dass ich sicherheitshalber das Jugendamt benachrichtige.«
»Das Jugendamt? Wollen Sie aus der Tatsache eine politische Nummer machen? Weil Wahlkampf ist? Sie haben doch eben selbst gesagt, es könnte einen harmlosen Grund haben. Warum die Pferde scheu machen. Das Jugendamt.« Er konnte sich vorstellen, wie sie bei den Worten den Kopf schüttelte.
»Also gut. Ich kümmere mich. Bitte bleiben Sie bei den Kindern. Es kann etwas dauern, ja?«
Ratlos legte Olaf auf. Wen sollte er bloß zuerst benachrichtigen? Martin, seinen Vorgesetzten? Der da draußen am Fundort der Leiche genug zu tun hatte? Oder Norden um Unterstützung bitten? Das Jugendamt? Als Erstes würde er versuchen, eine der dienstfreien Kolleginnen zu erreichen. Und dann doch lieber Martin. Er hatte ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Das ließ sich nicht von der Hand weisen.
*
Martin Ziegler strich sich die Haare aus der Stirn. Wahrscheinlich würde er sie doch wieder kürzer tragen müssen. In Situationen wie diesen machte es ihn verrückt, dass sie ihm ständig die Sicht nahmen. Andererseits hatte er keinen größeren Wunsch, als die Augen vor dem zuzumachen, was er vorgefunden hatte.
Noch kniete der Notarzt auf einer Plastikunterlage neben dem toten Körper. Aber es gab keinerlei Reanimationsversuche. Das hatte er erwartet. Doch auf einen oberflächlichen Augenschein durfte sich kein Arzt verlassen.
Wenige Minuten waren das, in denen er, Martin Ziegler, leitender Inselpolizist, über das weitere Vorgehen nachdenken konnte. Vorausahnen konnte, was der nächste Anruf für Konsequenzen haben würde. Wenn er zugeben musste, dass es schon wieder einen Todesfall auf der beliebten Ferieninsel gab. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen unnatürlichen. Möglicherweise sogar Mord. Wenn er eingestehen musste, dass so etwas seit seinem Amtsantritt gang und gäbe war. Was man daraus bei der Kriminalpolizei in Aurich für Schlüsse zog, hatten sie ihm im letzten Jahr deutlich vermittelt. Die Stimme der zuständigen Kommissarin hatte er noch sehr gut im Ohr. Er stöhnte auf, als er daran dachte, dass sie in zwei, drei Stunden wieder vor ihm stehen würde. Es durfte nicht wahr sein. Als läge auf der Insel ein Fluch seit seinem Amtsantritt.
Der Arzt erhob sich und trat auf ihn zu. »Da kann ich nichts mehr ausrichten. Da müssen die Fachleute aus der Gerichtsmedizin ran. Tut mir leid.«
Er hörte das Mitgefühl in der Stimme des Arztes. Er war ein Kollege von Martins Lebensgefährtin. Ob Anne mit ihm über seine Zweifel und Sorgen gesprochen hatte? Ein unbehagliches Gefühl erfasste ihn. Schlimm genug, wenn Aurich nichts von ihm hielt. Mitleid war das Allerletzte, was er auf der Insel haben wollte. Ob auch Anne …?
Unwillig hob er die Hand. »Können Sie denn schon was sagen? Eine erste Einschätzung?«
Der Arzt zog eine Zigarettenpackung aus seiner Rettungsjacke und zündete sich eine an. »Sorry. Ich rauche nur nach Todesfällen. Aber das muss sein. Also: sieht für mich nach einer tödlichen Schussverletzung aus. Ich will mich nicht endgültig festlegen, ob es ein Suizid sein könnte. Sieht aber weniger danach aus. Auf den ersten Blick habe ich keine Waffe gesehen. Das Ganze hat eher den Charakter einer Inszenierung. Wenn Sie näher rangehen, werden Sie wissen, wovon ich spreche. Ich weiß nur: Wenn das ein Mord ist, dann aber gute Nacht, Norderney.«
»Wieso?« Martin fuhr ein kalter Schauder über den Rücken.
»Haben Sie sie noch nicht erkannt? Die Tote? Ich dachte, wo im Augenblick doch jeder …« Das laute Schrillen von Martins Diensthandy ließ den Notarzt stocken.
Fast wollte Martin den Anruf wegdrücken. Was würde Olaf Maternus schon Wichtiges wollen? Nichts konnte eine so hohe Priorität haben wie der Leichenfund. Doch dann nahm er das Telefonat an und spürte, wie ihm seine Züge entglitten. Sein Blick fiel auf die Frau, die dort hinten an der Stange des Jupiters lehnte. Das konnte doch unmöglich wahr sein. Er starrte den Notarzt an, der an seiner Zigarette zog und tief inhalierte.
Martin ließ das Handy sinken. Der Arzt sprach, als hätte es keine Unterbrechung gegeben, aus der Rauchwolke heraus, die seinen Mund wabernd verließ und sich mit dem Dunst des Morgens zu vermischen schien: »… das Wahlplakat kennt. Das ist eindeutig Petra Mertens, die Bürgermeisterkandidatin. Hundertpro würde ich sagen. Da möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken.«
*
Die Plakate waren beschmiert. Alle. Samt und sonders. Es gab kein einziges, das nicht betroffen war.
KWK hatte ein Hitlerbärtchen, und dem Kandidaten der Fortschrittspartei, Häusler, hatte jemand Dollarzeichen in die Augen gemalt. So weit – so banal, weil fantasielos. Am schlimmsten hatte es aus Anne Wagners Sicht die Kandidatin der Zukunfts- und Umweltpartei, der ZUP, erwischt. Und damit die einzige Frau. Die angedeutete Banane an ihren Lippen war eindeutig sexistisch und obszön gemeint. Anne machte so etwas wütend. Der Zustand der politischen Landschaft war ein Trauerspiel, egal, wohin sie sah. Weltweit, europaweit, deutschlandweit. Das brach sich bis in die kleinsten kommunalen Zellen runter. Ein unsäglicher Umgang miteinander. Manipulative Stimmungsmache und ein Toben des Mobs im Internet waren alltäglich geworden.
Bisher hatte sie Norderney für so etwas wie die Insel der Glückseligen gehalten. Klar gab es auch hier Probleme. Die waren ja zuletzt oft genug benannt worden. Stichwort: Ausverkauf der Insel. Auf der anderen Seite waren das doch Luxussorgen im Vergleich dazu, was anderswo abging. Oft hatte sie sogar ein schlechtes Gewissen, so weit vom Schuss zu sein.
Und trotzdem machte sich auf der Insel etwas breit, was ihr nicht gefiel. Der Respekt voreinander schwand, das Verständnis füreinander genauso. Jeder war sich selbst der Nächste, der Spruch galt mehr denn je. Das »first« reklamierte mittlerweile jedermann für sich.
Anne bremste ab, als ein paar Kaninchen hinter der Kurve ihren Weg blockierten. Die kühle, frische Luft auf der Strecke zum Krankenhaus tat ihr wie jeden Morgen gut. Am liebsten würde sie weiterfahren in die Dünen hinein Richtung Ostende der Insel. Doch dagegen sprach der Dienstbeginn. Wenn sie heute Nachmittag einmal pünktlich die Station verlassen konnte, würde sie eine ausgiebige Runde drehen. Schon seit Anfang des Monats lag Frühjahrsluft über der Insel. Die Tage wurden länger, spätestens in drei Wochen würde die Saison Fahrt aufnehmen, und am Ende des nächsten Monats begann die Tennissaison. Schade, dass Norderney keine Halle besaß. Vielleicht würde sich das ändern, wenn die Insel über die Wintermonate attraktiver wurde. Davon hätten sie doch alle etwas. Anne grinste. Bei der nächsten Wahlveranstaltung würde sie das einfach ansprechen. Mal sehen, was für wohltönende Argumente von den Kandidaten kämen. Schlichtweg Wählerwünsche abzulehnen, traute sich ja kein Kommunalpolitiker in der heißen Phase des Wettkampfs.
Wobei sie schon wusste, wem sie ihre Stimme geben würde. So etwas war mittlerweile eher ein Wählen des geringsten Übels. Aber im Fall von Petra Mertens war das anders. Die Frau überzeugte sie. Sie war authentisch, energiegeladen und lebte vieles von dem, was sie sagte, vor. Bei den beiden anderen hatte Anne das Gefühl, sie sorgten eher für das eigene Wohlergehen. Aber sie wollte nicht ungerecht sein. Sie würde den Job, der mit einigem Klinkenputzen verbunden war, nicht machen wollen. Die vielen unbezahlten Stunden hinter den Kulissen wollte kaum einer sehen, aber sie gehörten für jeden Politiker dazu. Anne wusste das. Ihre Eltern waren beide seit jeher kommunalpolitisch aktiv. Sie stand auf dem Standpunkt, wer nur meckert, muss es selbst machen. Und da sie das nicht wollte, zollte sie so manchem unliebsamen Kompromiss der Politik doch Anerkennung.
Das mit den Plakaten jedenfalls war eine Schweinerei. Anonymes, feiges Verhalten. Nur auf Randale und Zerstörung ausgerichtet. Was sollten denn das für Botschaften sein? Das war für sie nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil. Umso mehr empfand sie Sympathie selbst für die Kandidaten, die ihr politisch fernstanden. Plakative Urteile mochte sie nicht. Basta.
Anne bremste vor dem Krankenhaus scharf ab, weil sie in ihrem Gedankenfluss zu heftig in die Pedale getreten hatte. Fast wäre ihr Fahrrad zur Seite gerutscht, im letzten Moment konnte sie sich auffangen. Das wäre was gewesen, wenn sie sich statt im Arztkittel im Flügelhemdchen auf Station wiedergefunden hätte.
Im gleichen Augenblick hielt neben ihr der Notarztwagen. Ihr Kollege grüßte mit ernstem Gesicht.
»So schlimm?«, rief Anne zu ihm rüber.
»Schlimmer. Ich hatte schon ein Date mit deinem Mann.«
»Ja, ich weiß, dass er früh herausgerufen wurde. Kannst du etwas sagen?«
Der Notarzt zögerte. Zog eine Zigarettenpackung aus der Tasche, sah sie an und steckte sie zurück. »Frag ihn lieber selbst. Spätestens heute Mittag wird auf der Insel nichts mehr so sein, wie es war.«
*
Über die Identität der Toten bestand kein Zweifel. Da waren sie sich alle einig. Martin Ziegler drückte die Finger gegen seine Stirn, hinter der sich ein dumpfer Kopfschmerz eingetrommelt hatte. Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Zu viel der speziellen Teezeremonie und zu wenig Schlaf trafen auf scharfen Nordseewind und extremen Stress. Da würde auch das Einwerfen von Tabletten nichts gegen ausrichten. Ruhe wäre etwas, das helfen würde. Er lachte bitter auf. Ausgerechnet Ruhe.
Sein Kollege auf dem Beifahrersitz schaute ihn schräg von der Seite an. »Was ist los, Chef? Eine Idee?«
»Schön wär’s«, grummelte Ziegler. »Ich stelle mir gerade vor, was uns gleich, wenn die Kripo ankommt, an Sprüchen um die Ohren fliegen wird. Von wegen …« Er brach mitten im Satz ab. Es wäre für seine Autorität nicht förderlich, wenn er die abwertenden Einschätzungen von Aurich höchstpersönlich an seine Mitarbeiter weitergab.
Ronnie schien aber zu wissen, was er meinte, denn er nickte ernst vor sich hin. »Ja. Aurich. Ich erinnere mich an das letzte Mal. Braucht man eigentlich nicht.«
»Wer braucht schon Mord und Totschlag? Wir nicht und die Opfer ganz sicher nicht.«
»Schon klar, Chef, habe auch eher gemeint, dass die doch froh sein sollen, wie wir die Dinge regeln. Mit einem kollegialen Führungsstil. Sonst verliert unsereins doch schon nach kurzer Zeit die Lust am Polizeidienst.«
Martin Ziegler wusste das Kompliment zu schätzen, das in den Sätzen von Ronnie lag. Auf seine Truppe konnte er sich verlassen. Auch auf Olaf Maternus, der eine Zeit lang mit ihm als Vorgesetztem gehadert hatte. Der Feind befand sich in ihm selbst. Er war es, der unter zu großen Rechtfertigungsdruck geriet. Er war derjenige, den die Selbstzweifel immer wieder überfielen. Weshalb er auf Norderney gestrandet war, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, dass die Verbrechen ihn verfolgten, sich nicht darum scherten, was er sich erhofft hatte.
»Jedenfalls haben die von der Kripo und der KTU nichts zu meckern, von wegen unsachgemäßer Spurenvernichtung und so. Wir haben den Fundort abgesperrt und harren der Dinge, die da kommen. Alles richtig gemacht, Chef.«
Martin klappte die Sonnenblende herunter und betrachtete sein müdes Gesicht im Spiegel. »Mag sein. Wobei ich das kaum aushalten kann, tatenlos abzuwarten.«
»Hat Aurich aber extra betont.«
»In so einem Fall verfluche ich das Inseldasein. Was für ein Aufwand, bis der ganze Ermittlungstrupp vor Ort ist. Als wenn es nicht auch darauf ankäme, schnell zu sein. Ich mag gar nicht daran denken, wie viel Zeit ein Täter dadurch gewinnt.«
»Du meinst also, es war ein Mord?«
»Mir fehlt gerade die Fantasie, mir etwas anderes vorzustellen. Petra Mertens hat zwei Kinder. Mir dreht sich der Magen rum, wenn ich daran denke, dass die Kollegen gerade vollkommen handlungsunfähig auf das Jugendamt und die Ergebnisse warten müssen. Was das für die Kinder bedeutet, dass ihre Mutter tot aufgefunden wurde – wirklich, ich will das gar nicht zu Ende denken. Erst recht kann ich nicht daran glauben, dass eine Frau wie Petra Mertens ihre Kinder im Stich lassen würde, um sich selbst zu töten.«
Ronnie schwieg, und Martin konnte sich denken, dass er an die Fälle dachte, wo genau so etwas passiert war.
»Überhaupt – sie war ja voller Zukunftspläne«, unterstützte er eilig seine These weiter. »Wer strebt denn ein politisches Amt an, wenn er aus dem Leben scheiden will?«
»Und wenn es genau deswegen ist?« Ronnies Stimme klang gepresst, als traute er sich nicht, einen Gedanken zu äußern, der ihnen allen wahrscheinlich als Erstes gekommen war.
Martin hob abwehrend die Hände. »Ronnie, ich bitte dich. Wir sind in Ostfriesland. Auf Norderney. Weder im Wilden Westen noch bei der italienischen Camorra.«
»Da bin ich mir manchmal nicht so sicher, wenn ich den einen oder anderen Politiker reden höre.«
»Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Zwischen Wahlkampfreden und einem Mord liegen Welten. Das darf man nicht leichtfertig miteinander vermischen.« Es nervte ihn, wie lehrerhaft er klang. Deswegen schob er schnell hinterher: »Oder gibt’s was Konkretes, auf das du anspielst?«
Erstaunt stellte Martin fest, dass Ronnie statt einer prompten Antwort anfing, mit seinen Händen zu knacken, während er den Blick auf die Tote richtete. »Nö«, sagte er schließlich wenig überzeugend. »Nö, eigentlich nicht.«
»Sag mal, Ronnie, willst du mich verhohnepiepeln? Was weißt du?«
»Ach, du weißt doch, wie die Leute reden. Der eine dies, der andere das.«
»Ronnie!«
»Schon gut, Chef, schon gut. Na ja, der Ton gegenüber der Mertens ist nicht gerade freundlicher geworden zuletzt. Ich habe gehört, wie der ein oder andere sich darüber ausgelassen hat, was ihr wohl fehlen würde. Weißt doch, die alten Sprüche: Der muss es nur mal einer richtig besorgen. Die hat wohl lange keinen Mann mehr gehabt.«
»Zum Kotzen.«
»Stimmt. Irgendwie denkt man ja, das wächst sich irgendwann aus.«
»Glaube ich nicht.« Martin dachte an Anne, mit der er zuletzt über die ›Me too‹-Debatte diskutiert hatte. Und daran, dass auch Ronnie dazu neigte, den ein oder anderen Spruch rauszuhauen.
»Na ja, und wenn das wirklich so eine Geschichte wäre? Dass es eine Vergewaltigung war und der Täter Angst bekommen hat?«
»Und dann wüsstest du, wer so darüber gesprochen hat? Also, wer so etwas zumindest mal gedacht und geäußert hat?« Martin sah, wie Ronnie bei seinen Worten in den Sitz rutschte.
»Hm. Ja. Wenn es so was wäre, dann wüsste ich wohl, wer das geäußert hat.«
Martin hoffte nur, dass Ronnie sich nicht aktiv an diesen Sprüchen beteiligt hatte, sondern nur stillschweigend ertragen hatte, wie Freunde oder Nachbarn solche Zoten losgelassen hatten. Aber er war zu lange im Polizeidienst, um nicht genau zu wissen, wie so etwas unter Männern lief.
Schweigend starrte er nach draußen.
»Also gut«, sagte er schließlich. »Ich brauche dazu gar nichts von dir zu hören. Zumindest, solange nicht feststeht, dass der Fall sich tatsächlich in diese Richtung entwickelt. Das werden die Untersuchungen ja zeigen. Aber ich halte es schon für unwahrscheinlich, dass ein Vergewaltiger eine Pistole dabei hat. Letzteres klingt so viel mehr nach Absicht. Aber auszuschließen ist es nicht.«
Ronnie richtete sich erleichtert auf und fuhr sich durch seine stachelig gegelten Haare. »Nee, klar, Chef, dann würde ich auch etwas sagen, wenn das darauf hinausliefe. Aber wir warten ab, ja? Alles andere ist schließlich unseriöse Spekulation.«
Martin kannte seinen Mitarbeiter genug, um die Erleichterung hinter dem plappernden Tonfall zu erkennen. Ronnie war einer der Guten, auch wenn er sich nicht immer dem Gruppendruck entziehen konnte. Aber für ihn würde er seine Hand ins Feuer legen. »Schon gut. Abwarten ist genau richtig. Ich wüsste auch gar nicht, was das mit dem Koffer neben der Leiche sollte, wenn es denn ein Sexualdelikt wäre.«
»Der Koffer, ja«, entfuhr es Ronnie. »Stimmt. Ich möchte nur zu gern wissen, was es damit auf sich hat.«
*
Nicole war immer wieder überrascht, wie Kinder in Situationen reagierten, mit denen sie vollkommen überfordert sein mussten. Das Erscheinen von Olaf und ihr hatte zwar fragende Blicke ausgelöst, nachdem sie sich aber der Nachbarin und den Kindern vorgestellt hatten, war vor allem der Junge schnell in die Rolle des verantwortlichen Familienoberhauptes geschlüpft. Zuerst hatte er sich bei der Frau bedankt, danach die Arme schützend um seine kleine Schwester gelegt und gefragt, ob sie schon sagen könnte, wo seine Mutter sei.
Früher hatte Nicole geglaubt, dass Kinder schrien und weinten, wenn sie in Sorge um ihre Eltern waren, aber die Erfahrung hatte sie anderes gelehrt. Als wäre es ein magischer Glaube, der sie stark machte, um sich damit vor Unvorstellbarem zu schützen. Trotzdem wusste sie, dass der Junge und das Mädchen mit unheilvoller Angst darauf warteten, was die Polizei sagen würde.
Dass Nicole nun im Kinderzimmer auf dem Boden lag, während Olaf sich aus der Küche einen Stuhl dazugestellt hatte und mit ihnen Lego und Playmobil spielte, schien ihr schon fast abstrus.
»Kommt Mama gleich wieder?«, hatte das Mädchen vorhin gefragt und sie mit ernsten braunen Augen angeschaut.Bevor sie antworten konnte, hatte Mattis, der Junge, geantwortet: »Was denkst du denn? Klar, kommt sie gleich. Die Polizei passt nur auf, weil kein anderer Zeit hatte.«
»Aber wo soll Mama denn sein, ohne uns Bescheid zu sagen? Das macht sie doch nie. Immer will sie, dass einer bei uns ist.«
»Deswegen ist ja die Polizei da. Mama musste bestimmt wegen der Wahl weg. Du weißt doch: Damit sie Bürgermeisterin wird. Da müssen wir sie unbedingt unterstützen.« Der Junge hatte mit einem schrägen Blick zu Nicole und Olaf geblickt, wahrscheinlich in der Sorge, sie könnten einen Einwand gegen seine Theorie erheben. Aber sie war erleichtert, dass er die Antworten fand, die für den Augenblick beruhigten. Ihr wäre das nicht gelungen.
Stattdessen baute sie nun einen pinken Hundesalon neben der Piratenbucht auf.
»Eigentlich spielt Mattis so was gar nicht mehr«, ließ Klara sie wissen, die langsam Zutrauen zu ihr gewann. »Mattis spielt immer nur an der Playstation.«
»Und du an deinem Handy.« Der Junge klang sauer.
»Ich schaue mir nur meine Serien an. Aber Mama will nicht, dass du so viel Fortnite spielst.«
»Mache ich ja gar nicht.«
»Jetzt nicht. Mama wird sich freuen, wenn sie heimkommt, dass wir mal wieder zusammen spielen.«
»Hm«, antwortete Mattis nur, und Nicole war sich sicher, dass seine Angst mit jeder Minute, die verstrich, größer wurde.
Nicole schnürte es die Kehle zusammen, wenn sie an das kurze Gespräch mit Martin dachte. Mit aller Macht versuchte sie, den Gedanken auszublenden, dass die Leiche, an deren Fundort ihr Vorgesetzter auf die Kripo wartete, etwas mit der verschwundenen Mutter der beiden Kinder zu tun hatte. Selbst wenn das, was Martin gesagt hatte, wenig Zweifel an der Situation ließ.
Bis jetzt hatte Nicole sich nicht dazu hinreißen lassen, allzu viel zu fragen. Wenn es sich bei der Toten tatsächlich um Frau Mertens handelte, dann taten sie gut daran, die Kinder nicht durch Fragestellungen zu beeinflussen. Dann wäre jede Erinnerung wichtig, ohne dass sie jetzt durch Gespräche überlagert wurden.
Trotzdem rutschte es ihr irgendwann heraus: »Und euer Papa? Den seht ihr doch bestimmt auch ab und an. Vielleicht können wir ihn ja anrufen.«
Sie merkte sofort, dass sie einen Riesenfehler begangen hatte. Idiotin, beschimpfte sie sich selbst. Wie eine Anfängerin. Mit ihrem Heile-Welt-Denken von Komplettfamilien. Sie wusste ja, dass Frau Mertens alleinerziehend war. Trotzdem hatte sie dem Familiensystem sofort einen existenten Vater angedichtet. Als wenn sie es nicht kennen würde, die Sorgerechtsstreitigkeiten, die Umgangsverbote von Seiten der Mütter, die abgetauchten Väter, die nicht zahlen wollten. Natürlich kannte sie das. Die ganze Palette. Bis hin zu Gewalttaten und Frauenhaus. Nur hier war sie wohl reingefallen mit ihrer fatalen Neigung zu Friede, Freude, Eierkuchen. Als wenn es das Komplementärprogramm zu ihrem Job wäre.
Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass die Kinder sie immer noch entsetzt anschauten und nicht antworteten. Verlegen griff sie zu der Kanone und richtete sie auf die herumstehenden Piraten. »Na, ist ja auch egal, da können wir uns später drum kümmern«, versuchte sie, mit Gemurmel ihre Frage abzuschwächen. »Spielt ihr weiter mit, oder wollt ihr lieber etwas anderes machen?«
Nicole schielte auf ihre Armbanduhr. Hoffentlich war das Jugendamt bald da und konnte übernehmen. Sie hatten doch Erfahrung in solchen Dingen. Es ging ja diesmal um deutlich mehr als um ein am Strand verloren gegangenes Kind, mit dem sie sich auf Norderney manchmal beschäftigen mussten.
Die Geschwister rührten sich immer noch nicht.
Dann räusperte sich Mattis. Täuschte sie sich oder klang die Stimme des Jungen deutlich tiefer als vor wenigen Minuten? Erwachsener sah er auf jeden Fall aus, als er sich halb aufrichtete und sich zwischen seine Schwester und Nicole schob. »Unser Vater? Unser Vater lebt doch nicht mehr. Schon lange.«
*
»Gert Schneyder, guten Tag, Herr Ziegler. Wir kennen uns dem Namen nach, oder?«
Martin Ziegler hatte sich neben dem Polizeiwagen ausgestreckt und den Kopf im Nacken rollen lassen, als sich hinter dem Pritschenwagen ihrer Dienststelle eine Kolonne von Einsatzwagen näherte. Er bereute nach wie vor jeden Schluck der ostfriesischen Teezeremonie von gestern Abend und die fehlenden Stunden Schlaf, weil er lange mit Anne bei Daniela und Frank geblieben war, auch, als Frau Dirkens sich schon in ihre Wohnung unter dem Dach zurückgezogen hatte. Die Aussicht auf die Mordkommission vom Festland ließ seine Laune in den Keller sinken. Wenn er an das letzte Mal dachte, wünschte er sich nichts lieber als einen klaren Kopf.
Umso erstaunter reagierte er auf den Kollegen. Irritiert schaute er hinter ihn, in der Erwartung, dass ein blonder Haarschopf auftauchte, der ihm in unliebsamer Erinnerung geblieben war.
Der Mann grinste: »Falls sie Frau Lichterfeld vermissen, da muss ich Sie enttäuschen. Sie ist leider im Urlaub. Dieses Mal müssen Sie mit mir vorliebnehmen.«
Martin sah, wie sich das Grinsen verstärkte, als er hörbar ausatmete. Wenigstens das blieb ihm erspart. Alles andere konnte nur besser sein, als der despektierliche Blick, dem er beim letzten Mordfall ausgesetzt war. Die Reaktion des Hauptkommissars, der heute im Einsatz war, deutete darauf hin, dass die Unstimmigkeiten zwischen Aurich und Norderney durchaus nicht unbemerkt geblieben waren. Mit welcher Bewertung wollte er lieber gar nicht so genau wissen.
»Also, was gibt’s denn?«, fragte dieser Schneyder und schien sich nicht zu wundern, dass Martin ihm nur wortlos die Hand gereicht hatte. »Eine weibliche Leiche? Wissen Sie schon mehr?« Er blickte zur Fundstelle herüber, hob den Daumen und lobte: »Vorbildlich. Soweit ich sehen kann, habt ihr nur abgesichert und keine Spuren vernichtet.«
Der joviale Ton entspannte Martin sofort. Kein Vorwurf, keine Skepsis in den ersten Sätzen. Er straffte seine Schultern und gab in wenigen Worten wieder, was sie wussten: »Ein Dauercamper ist heute Morgen mit dem Segway hier entlanggekommen. Er hat die Frau gefunden und sowohl den Notarzt als auch uns verständigt. Eine Reanimation war nicht mehr möglich. Auf den ersten Blick sieht es nach einer Schussverletzung aus. Eine Waffe ist allerdings bisher nicht sichtbar. Wir wollten nicht …«
»Vollkommen richtig.« Der Kripobeamte klopfte auf Martins Schulter, was selten jemand wegen seiner Größe tat. Aber Schneyder, der sicher an der Zwei-Meter-Marke schrappte, überragte ihn noch. »Alles richtig gemacht. Vielleicht liegt sie unter dem Körper oder in den Gräsern. Je nachdem, wie stark der Rückstoß war.«
»Wenn es ein Suizid sein sollte, ist das Aufgebot groß, aber angesichts der Brisanz wollen wir auf Nummer sicher gehen.«
»Der Brisanz? Was genau ist damit gemeint?« Schneyder sprach unaufgeregt und gelangweilt. Martin war sich nicht sicher, ob er das mochte oder nicht. Seltsam fand er es auf alle Fälle.
»Ich dachte, wir hätten es am Telefon erwähnt.«
»Was?«
»Nun, wir gehen davon aus, dass es sich bei der Toten um unsere Bürgermeisterkandidatin handelt. Petra Mertens. Gebürtige Rheinländerin, lebt aber schon einige Jahre in Norddeutschland. Seit drei Jahren auf Norderney. Hat in einer Forschungseinheit gearbeitet.«