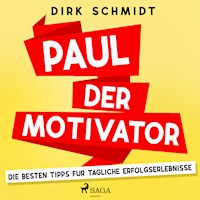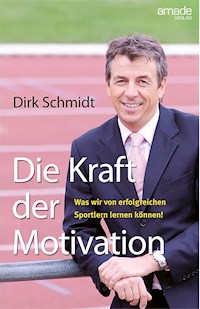10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julia ist weg, und daran ist wohl nichts mehr zu ändern. Was bleibt eigentlich, wenn man zu zweit nach New York geht und, ehe man es sich versieht, alleine ist? Zunächst einmal gibt es Jazz, um den Schmerz zu lindern. Und was zu lachen über den Italo-Amerikaner Dominik. Dann sind da noch Ausflüge zu Arnaldo, dem Lehrer aus Portugal, der Warmwasserboiler repariert, und Abende mit Theo aus Polen, der gern Football gespielt hätte und stattdessen Scherzartikel verkauft. Die Arbeit im Fast-Food-Restaurant von Dave Davis, dem König der Cowboys, wo man sein Geld wie im Albtraum verdient. Und so sind Träume das Einzige, was einem wirklich noch bleibt: Träume von Julia, von einem ganz neuen Leben oder von einem ganz großen Coup mit ganz großem Geld. Der junge Schwarze Richmond teilt diese Träume und ist bereit, dafür zu bezahlen. Aber mit Raubüberfällen ist es wie mit der Liebe: schwierig zu planen, unvorhersehbar im Ausgang und ziemlich gefährlich für Leib und Leben. Sehnsüchtig und humorvoll beschreibt Dirk Schmidt in seinem Debütroman das wahre Leben in der Millionenstadt New York jenseits des Glamours von Tiffany's, dem Chic von SoHo und der längst verblassten Erinnerung an den amerikanischen Traum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Dirk Schmidt
Letzte Nacht in Queens
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Julia ist weg, und daran ist wohl nichts mehr zu ändern. Was bleibt eigentlich, wenn man zu zweit nach New York geht und, ehe man es sich versieht, alleine ist? Zunächst einmal gibt es Jazz, um den Schmerz zu lindern. Und was zu lachen über den Italo-Amerikaner Dominik. Dann sind da noch Ausflüge zu Arnaldo, dem Lehrer aus Portugal, der Warmwasserboiler repariert, und Abende mit Theo aus Polen, der gern Football gespielt hätte und stattdessen Scherzartikel verkauft. Die Arbeit im Fast-Food-Restaurant von Dave Davis, dem König der Cowboys, wo man sein Geld wie im Albtraum verdient.
Und so sind Träume das Einzige, was einem wirklich noch bleibt: Träume von Julia, von einem ganz neuen Leben oder von einem ganz großen Coup mit ganz großem Geld.
Der junge Schwarze Richmond teilt diese Träume und ist bereit, dafür zu bezahlen. Aber mit Raubüberfällen ist es wie mit der Liebe: schwierig zu planen, unvorhersehbar im Ausgang und ziemlich gefährlich für Leib und Leben.
Sehnsüchtig und humorvoll beschreibt Dirk Schmidt in seinem Debütroman das wahre Leben in der Millionenstadt New York jenseits des Glamours von Tiffany’s, dem Chic von SoHo und der längst verblassten Erinnerung an den amerikanischen Traum.
Über Dirk Schmidt
DIRK SCHMIDT, geboren 1964 in Essen, hat nach dem Studium der Geschichte und der Filmwissenschaft Hörspiele und Drehbücher geschrieben und war freier Lektor. Nach einem kurzen Intermezzo in New York arbeitete er in Hamburg als Werbetexter. Nun lebt Dirk Schmidt mit seiner Frau und seiner Tochter im Ruhrgebiet.
Inhaltsübersicht
Julia
Meine Wohnung in New York ist leicht zu finden. Am besten fragt man sich erst mal zum Plaza Hotel durch. Das Plaza liegt am Central Park South an der Ecke zur 5th Avenue.
Die 5th Avenue ist ziemlich bekannt, und wenn man doch an jemanden gerät, der nicht so gut Bescheid weiß, fragt man eben nach dem Plaza Hotel oder dem Central Park (wobei der ziemlich groß ist und man an einer ganz falschen Ecke landen kann), oder man fragt nach Tiffanys, dem Juwelier gleich gegenüber dem Plaza, den kennen auch viele. Wenn man also das Plaza gefunden hat, ist es nicht mehr schwer, zu meiner Wohnung zu kommen. Man überquert die 5th Avenue und wendet sich nordwärts in Richtung Sherry Netherland Hotel und Metropolitan Museum. Nach nur zwei Blocks geht man nach rechts in die 62nd Street, und da ist dann gleich der Eingang zur U-Bahn.
Mit der Linie G Richtung «Eastbound» sind es nur ein paar Minuten über die Queensboro Bridge zur Queens Plaza Station. Von dort aus nimmt man die Linie 7 und fährt weiter bis zur Station Roosevelt Avenue/Jackson Heights. Die Station hat nur einen Ausgang, man geht ein kurzes Stück nach links, bis man zur 74. Straße kommt. Da wohne ich: 346 74th Street, Queens, New York City, New York. New York City, sagt man, ist deshalb so faszinierend, weil alle Rassen und Nationen hier vertreten sind und sich mischen, sich austauschen, befruchten und beeinflussen. In Jackson Heights zum Beispiel wohnen ausschließlich Polen und Griechen. Das hört sich nicht sonderlich weltstädtisch an, ist aber schon mal ein Anfang. Die Polen hier sind nette Leute, ich habe auch schon ein paar Brocken Polnisch gelernt, damit ich mich besser verständigen kann. Die Griechen in Jackson Heights bleiben lieber unter sich. Sie wollen ihre kulturelle Identität bewahren und achten darauf, sich nicht mit den anderen Nationalitäten zu vermischen. Trotzdem droht ihnen natürlich das Los aller Einwanderer. Sie bekommen Kinder und stellen eines Tages fest, dass die Bälger sich zu original kleinen Amis entwickeln, die auch nicht viel besser Griechisch sprechen als zum Beispiel ich. Sobald die Kleinen groß werden, beginnen sie Knicks-Jacken zu tragen, Ken Griffey Jr. und Deion Sanders zu verehren und essen lieber Cheeseburger als Musaka. Das ist nicht mein Problem, ich halt mich an meine Kumpels, die Polen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, bin ich in Queens eher geduldet als willkommen. Mit Julia war das etwas anderes. Julia konnte jedem x-Beliebigen in die Augen blicken und sein Herz öffnen. Sie kam über die Menschen wie ein Engel, und ich konnte mich hinter ihren großen Flügeln verstecken, den Mürrischen rauskehren, auf unnahbar machen und trotzdem gut klarkommen. Julia wickelt jeden um den Finger, manchmal ohne es zu wollen.
Mit mir ist das anders, mein Charme ist begrenzt. Ich merke das jeden Tag bei der Arbeit, ich werde kritischer betrachtet als Leute, die mit mehr Ausstrahlung gesegnet wurden. Auch wenn ich denselben Witz genauso witzig erzähle, dieselbe Arbeit genauso gut erledige, den meisten Leuten kann ich es doch nicht recht machen. Entsprechend kurz ist die Liste der Menschen, die ich meine Freunde nennen kann. Die Liste enthält jene Hand voll Leute, die, wenn die Bullen vor ihrer Tür stünden, nicht den Mut haben dürften, die Bekanntschaft mit mir abzustreiten. Theo wäre auf der Liste und wahrscheinlich Salvatore, Arnaldo steht drauf und vielleicht noch Richmond. Aber das mit Richmond ist eine andere Geschichte, uns trennten Welten, und die Zeit hat nicht gereicht, eine Brücke zu bauen. Jetzt ist es zu spät, und ich werde Richmond nie mehr wieder sehen.
Der Rest ist mir einigermaßen egal, mit Melissa hätte ich gerne mal geschlafen, und das Fußballspielen mit Dominik hat Spaß gemacht, aber das war es auch schon.
Meine Wohnung liegt im oberen Stockwerk einer zweistöckigen Ladenzeile, und unter mir ist der Geschenkeladen von Theo Krasnowski. Ab sieben, wenn Theo zuschließt, kann ich so laut sein, wie ich will. Außerdem habe ich meinen eigenen Eingang, ein echter Luxus, auch wenn die Treppe so steil ist, dass ich mich wie bei einer Leiter an den oberen Stufen festhalten kann, wenn ich betrunken bin. Theo ist tatsächlich aus Lodz, aber er würde einen Witz darüber und das komische Lied aus den Siebzigern nie verstehen. Ich lass es jedenfalls nicht drauf ankommen. Ich habe sowieso nie kapiert, warum das so lustig ist, wenn ein Theo nach Lodz fährt. Was macht der da? Ich kenne aber nicht den ganzen Text, vielleicht gibt es da ja irgendwas zu erledigen für Theo in Lodz. Ich weiß nur, dass, wenn damals irgendein Depp namens Theo nach Lodz gekommen wäre und wer weiß was für ein Aufhebens darum gemacht hätte, weil das so unglaublich komisch ist, dann hätte sein Namensvetter Theo Krasnowski, der jetzt in Queens wohnt, ihm die Augäpfel ins Hirn gedrückt, bis es spritzt, und ob das dann so komisch angekommen wäre, bleibt dahingestellt.
Theo verkauft in seinem Laden lustige Geschenke, lustige Postkarten und Scherzartikel. Es ist erstaunlich, dass jemand, der keinen Funken Humor im Leib hat und nur das Nötigste spricht, in einem Business arbeitet, wo es eigentlich nur darum geht, für gute Laune zu sorgen, koste es, was es wolle. Theo hat eine ganz eigene, sehr persönliche Art, seine Kunden zu beraten, die möglicherweise noch aus der Zeit stammt, als er in Lodz in einer Metzgerei gearbeitet hat. Wenn ihn, was allerdings selten vorkommt, ein Kunde fragt, welchen von zwei Scherzartikeln er lustiger findet, dann antwortet Theo etwas in der Art von …
«Das da kostet 2.99 und das da kostet 4.49. Wenn Sie beide nehmen, lass ich Ihnen fünfzig Cent nach.»
Eigentlich müsste der Kunde dann wissen, woran er ist, aber Theo ist aufgefallen, dass die Mehrheit in einem solchen Fall beschließt, etwas ganz anderes zu kaufen. Ich glaube, Theo ist nicht dumm, im Grunde hat er das Scherzartikelbusiness gut begriffen. Man muss sich mal vorstellen, Theo würde sich jedes Mal schlapp lachen, wenn jemand ein witziges Geschenk haben will. Soll Theo sich biegen vor Belustigung, wenn jemand einen falschen Köttel hochhält, oder Lachtränen weinen, wenn ihm jemand einen abgeschnittenen Plastikdaumen entgegenhält? Theo sagt lieber wenig. Ich denke, das ist das Beste, was er tun kann, um glaubwürdig zu bleiben.
Auf der anderen Seite hat Theo auch wirklich nicht viel zu lachen. Er ist fast fünfzig, und er hat keine Frau. Er ist schon ziemlich lange in Amerika und hat nicht mehr erreicht als einen kleinen Laden. Und dieser ist so klein, dass er Schwierigkeiten kriegt, wenn er mehr als drei Kunden hat (was ohnehin selten vorkommt). Die Wände sind voll gestopft mit Scherzartikeln, und auf der ohnehin schmalen Verkaufsfläche steht in der Mitte eine langes Kartenregal, das den Laden quasi in zwei enge Gänge aufteilt.
Das Regal ist Eigentum der Hallmark Corporation, und Theo hat sich verpflichtet, in seinem Sortiment ausschließlich die mäßig gelungenen Grußkarten von Hallmark zu führen. Gleich wenn man reinkommt rechts befindet sich Theos Ladentheke. Er sitzt da den ganzen Tag und kann auf die Straße schauen, wenn er sich langweilt. Außerdem hat er da den Überblick und kann Ladendiebstahl verhindern, denn Theo hasst Ladendiebe. Theo ist ziemlich groß und ziemlich breit und guckt für sein Leben gern Football. Er wäre sicher ein brauchbarer Linebacker geworden, an Theo kommt keiner vorbei, auch kein Ladendieb. Natürlich sind das Spekulationen, Theo war schon Ende dreißig, als er nach Amerika kam, da war es ohnehin zu spät für das Linebacken.
Unter der Theke liegt Theos abgesägter Baseballknüppel, und vor ein paar Monaten hat er sich auch noch den «Elektroschock-Zauberstab» aus einem Katalog für Sicherheitsequipment bestellt, «… mit dem die Cowboys in Wyoming sich die gefährlichsten Stiere gefügig machen. Anlegen, abdrücken, und Ihre Probleme haben ein Ende.»
In Ermangelung gefährlicher Stiere hat Theo seinen Zauberstab an der Katze ausprobiert, die ihm nachts immer auf sein Fensterbrett gepinkelt hat. Sie ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Theo hat jedenfalls keine Sorgen mit Ladendieben, obwohl er sich trotzdem ständig welche macht; er sagt, die Griechen klauen wie die Raben. Meine Wohnung liegt also genau über Theos Laden, ist aber noch etwas kleiner, weil ja noch die Fläche für das Treppenhaus abgeht. Ursprünglich war sie als Lager für den Laden gedacht, der hier ursprünglich mal war. Aber Theo hat keinen Bedarf für ein Lager, und deshalb hat es der Hausbesitzer zu einem Apartment ausgebaut. Ich habe ein Bad und eine kleine Küchenzeile, außerdem ist die Miete nicht sehr hoch, und darauf kommt es an. Als Julia weg war, ist mir unsere Wohnung am Broadway zu groß und zu teuer geworden, also hab ich sie mit einem jungen polnischen Paar getauscht, entfernte Bekannte von Theo, den ich damals allerdings noch nicht kannte.
Die Wohnung am Broadway war klasse. Wir hatten ein großes Zimmer zum Wohnen und Schlafen, eine große, helle Küche und ein kleineres Zimmer, in dem ich malen konnte. Wir schrieben nach Hause, dass wir jetzt eine schöne Wohnung am Broadway hatten. Die Tatsache, dass es in New York eine ganze Menge Broadways gibt und dass es sich bei unserem um den in Astoria, Queens, handelte, der ungefähr so glamourös ist wie Theos Laden, haben wir nicht erwähnt. Damals waren wir so glücklich wie noch nie in unserem Leben. Damals hatten wir allerdings keine Ahnung, wie glücklich wir waren, wahrscheinlich weiß man das nie und merkt es erst später. Wir waren glücklich, weil wir eine Zukunft hatten, weil unsere Hoffnungen noch keinen Tritt gekriegt hatten und die beste Zeit noch vor uns zu liegen schien.
Theo
Es ist 11 Uhr 34 nachts. Mein alter Radiowecker mit dem quietschenden Drehwerk quält sich der Nacht entgegen, und ich frage mich, wie viel Zeit ich noch habe. Wie gesagt, meine Wohnung ist ziemlich leicht zu finden, und falls es so weit kommt, dass die Bullen eins und eins zusammenzählen, morgen früh, habe ich ein Problem. Im Moment ist alles ruhig. Ich sehe gerade aus dem Fenster auf die leere Straße, und für einen Moment habe ich das Gefühl, die Straße würde schlafen. Sie stöhnt und ächzt, sie scheint schlechte Träume zu haben, und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich schwören, ich könnte ihre Atemzüge spüren. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich vollkommen fertig bin und dringend Schlaf brauche. Aber ich denke nicht daran, jetzt schlafen zu gehen. Ich will das jetzt alles aufschreiben, und ich werde so lange schreiben, bis mir der Stift aus der Hand fällt.
Kurz nachdem Julia ausgezogen ist, habe ich unsere Broadway-Wohnung dem polnischen Paar überlassen und bin Theos Nachbar geworden. Übrigens haben sich die beiden Polen ebenfalls schon bald nach dem Einzug getrennt, weil die Frau kurz darauf einen anderen Mann kennen gelernt hat, einen Griechen aus der 82. Straße. Vielleicht bringt die Wohnung kein Glück, wobei man allerdings sagen muss, dass der Pole unheimlich gesoffen hat. Als ich ihm die Schlüssel um 12 Uhr mittags übergeben habe, war der Typ schon dicht. Ob meine jetzige Wohnung Glück bringt, habe ich noch nicht rausgefunden, jedenfalls habe ich auf diesem Weg Theo kennen gelernt, und es ist immer gut, Freunde zu haben. Der größte Vorteil der Wohnung ist die Feuerleiter an der Rückfront, über die man jederzeit hoch aufs Dach klettern kann. Manchmal sitzen Theo und ich im Sommer auf dem Dach, trinken Bier und gucken uns auf meinem Portable Footballspiele an. Wenn es um Football geht, kennt Theo kein Pardon, sodass wir ab und an aneinander geraten. Ein paar Mal habe ich auch schon Angst gehabt, wenn Theo sich zu sehr ereiferte.
Der Streit hat immer dieselbe Ursache, es handelt sich um eine Art Generationskonflikt, der allerdings mit dem echten Geburtsdatum nichts zu tun hat. Ein Immigrant wird zweimal geboren, einmal zu Hause und das zweite Mal, wenn er nach Amerika kommt. Manche Immigranten nehmen den Tag ihrer Ankunft wichtiger als jedes andere Jubiläum. Das ist allerdings in der Regel die Sorte der Überangepassten, die den Star Spangled Banner im Vorgarten ihrer Fünfunddreißig-Quadratmeter-Schuhschachtel in Fort Lee hissen oder aus dem Fenster ihrer Sozialwohnung im 17. Stock irgendeines Sozialbaus in der Bronx hängen. Die Sorte, die sich Uncle Sam auf den Unterarm tätowieren lässt und sich amerikanischer aufführt, als es dem borniertesten Cape-Cod-WASP einfallen würde. Theo und ich haben nur Spott übrig für diese Idioten.
Selbstverständlich macht Theo einen guten Schnitt, wenn er ihnen Flaggen in allen Größen verkauft, aber wir beide haben die stillschweigende Übereinkunft, dass wir im Grunde staatenlos sind. Trotz dieser Tatsache sind wir nicht vollkommen unbeeinflusst von unserem zweiten Geburtstag, auch wenn es schwer fällt, das zuzugeben. In meinem Fall ist es allerdings angebracht, von einer schweren Geburt zu sprechen. Es hat gute drei Monate gedauert, bis ich eines Morgens aufwachte und mir von einem zum anderen Moment klar wurde: Ich bin angekommen. Ich erinnere mich noch, dass es Sonntag war und ein Sturm über Queens zog. Aber auch ohne den Sturm wäre es der richtige Tag für das erste Heimweh gewesen, einer dieser eigentümlichen, mittelgrauen Herbsttage, an denen man das Gefühl hat, es würde nie wieder hell. Julia kniete auf dem roten Stuhl in der Küche und hatte die New York Times über die gesamte Fläche des Küchentischs ausgebreitet. Draußen war es so windig, dass die Küchenbeleuchtung manchmal flackerte, und in diesem seltsam diffusen Licht hatte ich das Gefühl, plötzlich in eine dieser Sechzigerjahre-Familienserien zu treten, wo es immer Unmengen von Rührei, Pfannkuchen und gebratenem Speck zum Frühstück gibt und trotzdem alle ganz gesund aussehen. Oder wie in einem Comic von Tex Avery: Papa Pferd und Mama Pferd beim Frühstück, kurz bevor Carl der Coyote auf der Jagd nach dem Roadrunner die Küche in Schutt und Asche legt. Alles an diesem Morgen war amerikanisch, auch wenn im Wohnzimmer ein halber Koffer voll Erinnerungen lag und ein kurzer Blick in den Kleiderschrank genügt hätte, um zu verraten, woher wir kamen. Unsere Küche war glasklar Midtown-USA, die Maxwell House-Kaffeedose, Barnabys English Muffins, der Prosciutto Italiano (in Lizenz zusammengepresst in New Jersey), Sweet Butter und in den Kaffee einen Schuss Welsh Farms Half and Half. Und am amerikanischsten war Julia. Julia, das Chamäleon, Venedig war ihr so fern wie der Mond. Julia las eifrig in der Times, und zwar die Stellenanzeigen. Sie hatte nach drei Monaten schon den Glauben an die Zukunft, wie wir sie uns vorgestellt hatten, verloren und suchte einen hübschen gut bezahlten Job für mich. Wenn ich wirklich in einem Comic war, dann nicht in einem von Tex Avery, sondern in einem Horrorstreifen. Gleich würde sie so tun, als wolle sie mir einen Gutenmorgenkuss geben, ihre Augen würden zu leuchten beginnen, und sie würde mir ein paar rot-weiß-blaue Schneidezähne in die Halsschlagader jagen. Sie würde mein Blut durch eine Mischung aus Rootbeer und Coca-Cola ersetzen, und ich wäre für den Rest meines armseligen Lebens dazu verdammt, das Leben eines Untoten zu führen. Ich würde jeden Morgen mit der Geister-U-Bahn ins Schloss des Grafen General Motors, des Barons AT&T oder des Vicomte Johnson & Johnson fahren, mit den anderen Leichen durch Manhattan schlurfen und jeden verfluchten Tag (die übrigens allesamt so aussehen würden wie dieser beschissene dunkle Abend in Queens) ein weiteres Stück meiner Seele für ein paar grüne Dollar verkaufen. Ich würde, bevor die Nacht kommt, zurück durch den dunklen Schacht zu einem Four Bedroom/Two Bathroom-Pappsarg in Ridgewood, Rego Park oder Union City eilen, wo meine Meisterin bereits irgendein totes Tier in der Mikrowelle essbar gemacht hätte und mir anböte, mir am Wochenende einen zu blasen, wenn ich noch heute Abend den Rasen mähte.
Das Leben hatte solche Albträume mit Leichtigkeit eingeholt. Ich war in Amerika angekommen, und es war angezeigt, sich mit dieser Tatsache auseinander zu setzen. Im Laufe der Zeit sind mir zwei Möglichkeiten aufgefallen, mit der die Mehrzahl der Einwanderer den Schock des Ankommens zu mildern versucht. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass man für den Rest seines Lebens so tut, als würde man übermorgen, spätestens aber nächste Woche wieder abhauen. Man verfolgt die Nachrichten aus der Heimat, schreibt endlose Briefe nach Hause und bricht in Tränen aus, wenn der ehemalige Nachbar zehntausend Kilometer weit weg einen Autounfall hatte. Aber das ist kein Leben. Die Eltern von Dominik, meinem Dave Davis-Unit-Manager, leben so ähnlich, und ich kann es nur wiederholen, das ist kein Leben.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, einigermaßen genau herauszufinden, was Amerika überhaupt ist und was man damit anfangen kann. Das war, nebenbei bemerkt, die von Julia favorisierte Lösung. Bei ihr hatte ich schon nach zwei Wochen das Gefühl, als wüsste sie gar nicht mehr genau, wo Deutschland liegt. Das Seltsamste an Julias Schwindel erregend hastiger Transformation habe ich erst viel später herausgefunden. Julia verwandelte sich nicht etwa in eine Amerikanerin, sie übersprang eine Entwicklungsstufe und wurde gleich eine waschechte New Yorkerin. Bei ihr hat es ziemlich genau einen Monat gedauert. Selbst die Amigirls aus Ohio oder Virginia brauchen länger, um sich in eine New Yorker Stadtpflanze zu verwandeln. Julia war schon immer etwas schneller, und sie hatte natürlich den Vorteil, dass der Weg von Düsseldorf nach New York nicht ganz so weit ist wie der von Kentucky oder Vermont. Für uns normale Menschen aber, wenn wir zudem auch noch männlichen Geschlechts sind, gibt es nur einen Weg, Ami zu werden: Sport. Zuerst wird man Sportfan. Es ist die einfachste Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen und mitzukriegen, was läuft. Beim allerersten U-Bahn-Gespräch, das ich belauschte, ging es um irgendwelche Isländer, die tierisch was auf die Fresse gekriegt hatten. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie groß die isländische Kolonie in New York wohl sein mag, wo es die Isländer wohl hinverschlagen haben mag, kalauertechnisch bestimmt nach Staten Island oder in den hohen Norden der Bronx. Als ich nach ein paar Tagen in New York die erste Baustelle sah und die Arbeiter ein Rohr öffneten und heißer Dampf ausströmte, dachte ich an die Isländer, die sich bei diesem Anblick immer an ihre Heimat erinnert fühlen mussten, so wie ich oft an München denke, wenn ich mir zum Frühstück eine Brezel kaufe. Erst Monate später habe ich herausbekommen, dass die beiden Typen, die ich in der U-Bahn belauschte, über ein Eishockeyspiel sprachen. Ich kam mir ganz schön blöd vor und habe bis heute noch keinen Isländer in New York getroffen.
Der Neuankömmling macht sich also erst mal auf die Suche nach einem Sport und einem Team. Bei Ersterem ist maßgeblich, wie gut der Einstieg in das neue Leben gelungen ist. Nehmen wir an, dass man sich beispielsweise für Football entscheidet und es einen nach Florida verschlagen hat, man glücklich und zufrieden ist und Amerika sich tatsächlich als das Paradies herausstellt, von dem man immer träumte. Wenn dieser sehr unwahrscheinliche Fall wirklich eintreten sollte, wird der Neue so schnell wie möglich versuchen, Fan der Miami Dolphins zu werden. Er wird Dan Marino für eins der größten Genies seit Leonardo da Vinci halten, seine neue Liebe durch ein T-Shirt mit dem Aufdruck Don’t mess with Dan the man kundtun und schon lauthals neue Spieler und einen Trainerwechsel fordern, auch wenn die Tinte auf der Green Card noch nicht getrocknet ist. Im umgekehrten Fall, wenn es nicht so klasse läuft und man langsam, aber sicher einsieht, dass es ein Riesenfehler war, den Kontinent zu wechseln, sucht man sich gerade nicht das Hometeam aus, sondern jenes, das den Lokalmatadoren und somit allen ansässigen Fans so richtig in den Arsch tritt. Dann hat man eine Weile lang Spaß und erlebt irgendwann das amerikanische Grundgesetz des «What goes up, must come down» aus nächster Nähe mit und wechselt entweder die Sportart oder findet sich auf einem Dach in Queens mit einem Haufen Steelers im Radio wieder, die nicht in der Lage wären, einen Kleiderständer umzuhauen, geschweige denn Scheiß-Rodney-Hampton von den New-York-Scheiß-Giants. Damit wir uns richtig verstehen, ich rede von Theo, der das Pech hatte, in die Staaten zu kommen, als die Steelers die große Nummer waren und einen Superbowl-Ring nach dem anderen über ihre klobigen Finger streiften. Die Steelers spielten so, dass Theo sie nur gut finden konnte: hart, unfair. Selbst Theo, der frisch aus einer LOT-Maschine gekrochen war, hatte im Verlauf seiner ersten Saison als frisch gebackener Football-Fan mehr Spielzüge drauf als der damalige Spielmacher der Steelers, Terry Bradshaw, dem schon beim Versuch, seinen Namen zu schreiben, wichtige Gehirnkapazitäten den Dienst verweigerten. Aber Theo liebt seine Steelers. Ich glaube nicht, dass er genau weiß, wo Pittsburgh liegt, aber er weiß, dass sie dort Stahl machen, und das erinnert ihn an Polen. Viele Polen leben in Pittsburgh, sind glücklich und zufrieden, tanzen, wenn sie aus dem Stahlwerk kommen, Mazurka auf den Straßen und helfen sich gegenseitig, wo sie nur können. Überhaupt sind alle Polen so: die in Cleveland, Gary Indiana und überall, wo es Stahlwerke gibt. Selbst in South Chicago sind die Polen eine einzige verschworene Gemeinschaft, nur nicht in Jackson Heights, Queens. Ich achte Theos polnisches Gemeinschaftsgefühl und tue, wenn möglich, nichts, was es ihm kaputtmachen könnte.
Als Julia und ich kamen, waren die San Francisco 49ers groß. Es dauerte drei Monate, und ich war verliebt. Ich wusste, wo ich hingehen konnte, wenn ich New York hinter mir hatte. Ich würde das Gold der Westküste suchen, finden und glücklich sein. Wenn wider Erwarten mal etwas schief gehen sollte, blieben immer noch Julia, Sommer voller Liebe und goldene Winter mit endlosen Play-Off-Siegen.
Es ist aber alles ganz anders gekommen, und es ist Zeit, sich zu fragen, ob es so kommen musste. Theo hat mal gesagt, dass Leute wie wir es in diesem Land nur mit kriminellen Mitteln zu etwas bringen. Und Julia, wenn sie traurig war und nicht weiterwusste und weinte und mir Bauchschmerzen machte, hat sich fast genauso angehört. Ich könnte vor jeden Richter treten und sagen, Theo und Julia haben mich zu meiner Tat angestiftet. Wahrscheinlich brächte das einen Strafnachlass. Ich habe nur noch ein paar Stunden Zeit, bis die Bullen kommen, und eigentlich möchte ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen, welche schrecklichen Sachen mich noch erwarten. Bis jetzt bestand mein Leben aus Fehlern und unglücklichen Zufällen, mein Schürfen im Sand hat nur Dreck und Schmerzen gebracht. Außer natürlich Julia: Julia, wie sie die New York Times liest, Julia mein Gold, lichtes Puder in meinen verkrusteten Händen. Ich wollte meinen Goldstaub für immer festhalten, aber er ist mir durch die Finger geronnen und weggeweht.
Queens
Fast jeder, der in Queens wohnt, arbeitet in Manhattan. Dafür scheint Queens da zu sein, das ist die Bestimmung dieses Ortes. Brooklyn hat Anfang des Jahrhunderts immerhin versucht, dem Schicksal der Schlafstadt zu entgehen: Sie haben den Prospect Park, der vom selben Architekten entworfen wurde wie der Central Park. Er ist tausendmal schöner, und am Haupteingang steht dazu noch eine astreine Kopie des Arc de Triomphe, dagegen nimmt sich der Mickerling am Ende der 5th