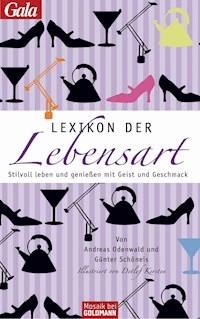Inhaltsverzeichnis
Widmung
A
ABNEHMEN
ADEL
ADLON
ALESSI
ANREDE
ANTI-AGING
APERITIF
ARABISCHER EDELTOURISMUS
ARMANI, GIORGIO
ASPIRIN
AUKTION
AUSLESE
AUSTERN
AYURVEDA
B
BAR
BH
BIENNALE
BIER
BIKINI
BLAHNIK, MANOLO
BLÄSSE
BOCUSE, PAUL
BOLLINGER
BORDEAUX
BRIONI
BULGARI
BURBERRY
BURGUND
BUSSI BUSSI
C
CABRIOLET
CARDIN, PIERRE
CARTIER
CASHMERE
CHAMPAGNER
CHANEL, COCO
CHÂTEAU D’YQUEM
CHÂTEAUX-WEINE
CHILLEN
CHOPARD
CHRISTOFLE
CLUB 55
COCKTAIL
COFFEE-BAR/CAFÉ
COGNAC
COOL
CROSS-DRESSING
D
DAMENRUNDEN
DANDY
DANKBARKEIT
DAVIDOFF, ZINO
DELIKATESSEN
DIAMANTEN
DIGESTIF
DIGITAL
DIGITALE FOTOGRAFIE
DIOR, CHRISTIAN
DISKRETION
DOLCE VITA
DOM PÉRIGNON
DUCASSE, ALAIN
DUCATI MONSTER
DUNHILL
DUPONT
DUZEN
E
EBAY
EBEL
EHENAMEN
EITELKEIT
EROTISCHE ROMANE
ESPRESSOMASCHINE
EXISTENZIALIST
F
FABERGÉ
FÄLSCHUNGEN
FAULHEIT
FENG-SHUI
FERRARI
FINK’S
FLASCHEN
FLIRTEN
FREIZEIT
FREMDSPRACHEN
FREUNDSCHAFT
FRISEUR
G
GARAGENWEINE
GELIEBTE
GEMÜTLICHKEIT
GENTLEMAN
GESCHENK
GESCHMACK
GIGOLO
GIN
GOLD
GOLF
GOURMET
GRANDHOTEL
GUCCI
GUERLAIN
H
HANDKUSS
HARLEY DAVIDSON
HARROD’S
HASCHISCH/MARIHUANA
HAUTE COUTURE
HAVANNA
HERMÈS
HEROIN CHIC
HERRENHÜTE
HOMOSEXUALITÄT
HUMMER
I
IMAGE
INTELLIGENZ
INTERNET
J
JAEGERLECOULTRE
JARGON
JAZZ (DIE ERSTE AUFNAHME)
JUGENDSTIL
JUGENDWAHN
K
KADEWE
KÄFER
KAFFEE
KAVIAR
KITON
KLATSCHREPORTER
KLEINES SCHWARZES
KNIGGE
KNIZE
KOBE-RIND
KÖCHE
KRAWATTE
KREUZFAHRT
KRUG
KULT
KULTMARKEN
KUSS
L
LACHEN
LACHS
LACOSTE
LAUDER, ESTÉE
LEICA
LIEDER MIT EWIGKEITSWERT
LIMOUSINE (STRETCH)
LIPPENSTIFT
LOBB
L’ORÉAL
LVMH
M
MAHAGONI
MAÎTRE
MALLORCA UND IBIZA
MALT WHISKY
MANUFACTUM
MARMOR
MARTHA’S VINEYARD
MINIROCK
MITSUKOSHI
MITTAGSSCHLAF
MONTBLANC
MUSEUMSHOPS
N
NEIMAN MARCUS
O
OBERHEMD
OPER
ORDEN
P
PARFÜM
PATRIOTISMUS
PERFORMANCE
PERSONAL TRAINER
PFERDESPORT
PICKNICK
PILATES
PLAYBOY
POLITICAL CORRECTNESS
POLO
PORSCHE
PORTWEIN
PORZELLAN
PRACHTSTRASSEN
PROVENCE
PROVINZ
PÜNKTLICHKEIT
Q
QUEEN MARY 2
R
RESTAURANTFÜHRER
RIVA-BOOT
ROCK’N’ ROLL
ROLEX
ROLLS-ROYCE
ROSE
ROUTE 66
RUM
S
SAMSONITE
SANSIBAR
SAXOFON
SCHICKERIA
SCHICKIMICKI
SCHINKEN
SCHUMANN’S
SEIDE
SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND
SHERRY
SINGLE
SMALLTALK
SMOKING, FRACK & CO.
SNOB
SOMMELIER
SONNENBRILLE
SONY
STEELDRUM
STEINWAY
SWAROVSKI
SYLT
T
TAKE FIVE
TAPAS
TEA-TIME
TIFFANY
TISCHORDNUNG
TREUE
TRINKGELD
TRÜFFEL
TÜRSTEHER
U
UNTREUE
V
VACHERON CONSTANTIN
VERLOBUNG
VERMOUTH
VESPA
VIAGRA
VORNAMEN
VUITTON, LOUIS
W
WASSER
WEINE AUS DER NEUEN WELT
WEINGLÄSER
WELTRAUMTOURISMUS
WHISKY, WHISKEY
WINE-BAR
WITZIGMANN, ECKART
WOHLFAHRT, HARALD
WOHLTÄTIGKEIT
WWW.ASMALLWORLD.NET
Z
ZEGNA
ZIGARRE
ZUCHTPERLEN
Danksagung
REGISTER
Copyright
Für Smadar und Gudrun,speziell das Stichwort auf Seite 313
A
ABNEHMEN
Der Wunsch abzunehmen, »abzuspecken«, schlanker zu werden, ist einer der größten gemeinsamen Nenner in der erwachsenen Bevölkerung. Es passiert zwar immer mal wieder, dass eine mit schwellenden Formen gesegnete prominente Filmoder Theaterschauspielerin den übergewichtigen Frauen im Publikum wenigstens vorübergehend die Komplexe vertreibt. Und ein wohlbeleibter Bonvivant strahlt nach wie vor mehr Lebensfreude und Genialität aus als ein spindeldürrer, asketischer Marathonläufer. Doch der Trend lässt sich wohl nicht mehr umkehren: Die Schlankheit ist das dominierende Körperideal. Und das bei beiden Geschlechtern. Barocke Formen werden heute allenfalls noch auf einem Gemälde von Peter Paul Rubens (1577-1640) oder bei der Wiederaufführung von Marco Ferreris berühmter Filmsatire »Das große Fressen« (1973) als reizvoll oder zumindest amüsant empfunden. Von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, gelten solide Leibesfülle und mollige Figur beinahe schon als ungehörig, anstößig.
Wonnekörper und Waschbrettbäuche Wohin man auch blickt, schlanke Gestalten: Die Filmschönheiten aus Hollywood und Babelsberg. Die Sportler und die Models sowieso. Die Fernsehprominenz auf allen Kanälen. Die zarten verhuschten Rocksängerinnen und deren männliche Kollegen nebst dazugehörigen Musikanten, die oft derart abgemagert sind, dass man ihnen am liebsten ein Butterbrot zustecken möchte. Die fröhlichen Zeitgenossen, die man in der Bar oder in der Diskothek sieht. Die atemberaubenden Stromlinienkörper in den Annoncen der Lifestyleblätter. Die Waschbrettbäuche und die Wespentaillen, die in den Fitnessstudios um die Wette strampeln. Die Banker und Manager, die zum Frühstück im Speisewagen ein Knäckebrot und ein Glas Wasser bestellen. Und die Operndiven sind auch nicht mehr, was sie mal waren.
Irgendwann ist es dann so weit. Man mag sich selber nicht mehr. Man möchte auch so gertenschlank sein, leicht und, ohne aus der Puste zu kommen, die Treppen hinaufschweben. Wie erreicht man nun möglichst schnell dieses Ziel? Die Crux an der Sache ist die, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert. Es kann Monate dauern, manchmal sogar Jahre. Ungeduld verbietet sich also. Doch vertrackterweise ist gerade dieser Wesenszug bei allen »Abnehmern« besonders ausgeprägt. Jeden Tag mehrmals auf die Waage und bei jedem Gang am Wandspiegel vorbei der prüfende Blick: Schlabbert er schon ein bisschen, der früher eng anliegende Pulli?
FdH oder Sport? Der Methoden gibt es viele: hunderte Diätvarianten, wie religiöse Lehren angepriesene Fastenkuren, Selbstkasteiungen. Manche schwören darauf, die Speisemenge zu halbieren, was unter dem Kürzel »FdH« (»Friss die Hälfte!«) in den Sprachschatz eingegangen ist. Andere empfehlen regelmäßigen Sport bis an die Grenze der Erschöpfung, damit möglichst viele Kalorien »verbrennen«. Den Appetit mit starkem Tabakgenuss zu dämpfen, wie das früher unter klammen Studenten üblich war, ist völlig aus der Mode gekommen.
Zwei ernsthafte Empfehlungen. Erstens: Wer es wirklich tun will (wir reden hier nicht von drei oder vier Kilogramm), möge sich vorher schlau machen über die Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten der Ernährung im Allgemeinen und die Gegebenheiten des eigenen Körpers im Besonderen. Sich mit einem Fachmann im weißen Kittel zu beraten bringt dabei erheblich mehr, als den 43. »todsicheren Tipp zum A.« zu befolgen.
Zweitens: Man lässt es.
ADEL
Soziologisch gesehen birgt unsere Gesellschaft kaum noch Rätsel. So gut wie jeder Bereich ist vermessen, ausgezählt, abgefragt. Nur eine einzige Gruppe existiert noch, über der zumindest der Schleier eines Geheimnisses liegt: der Adel. Das ist eigentlich paradox, denn die öffentliche Neugier ist gerade, was diese Gruppe betrifft, besonders groß. Doch das Gros der Bevölkerung weiß über den A. wenig, hat allenfalls einige verschwommene Vorstellungen. Man kennt vielleicht jemanden mit einem »von« im Namen, ist aber bereits bei der Frage überfordert, wie ein Graf korrekt anzusprechen ist (➛ Anrede).
So ist es kein Wunder, dass zahllose Legenden ins Kraut schießen. Über nichts wird in den Boulevardzeitungen und Regenbogenblättern so blumig geschrieben wie über »blaues Blut«. Bevorzugt wird dabei die faktenarme bis faktenfreie Berichterstattung über die Mitglieder von ehemaligen und verbliebenen Herrscherhäusern. Auch was den übrigen A. betrifft, bedienen die kolportierten Geschichten kaum mehr als die abgegriffensten Klischees. Danach sind Adelige immer noch steinreich, leben in prächtigen Schlössern, in denen sie rauschende Feste geben, und gebieten über Scharen von Dienstboten. Ihr Liebesleben scheint überaus feurig und zügellos zu sein, weshalb Sexgeschichten aus ihren Kreisen mit besonderer Süffisanz genüsslich ausgebreitet werden – unter so ansprechenden Überschriften wie »Der geile Prinz und die schöne Arztwitwe«. Wenn sie betrunken sind (jedenfalls die männlichen Mitglieder des Standes), neigen sie zum Randalieren, zum Verprügeln von Fotografen oder ganz allgemein zu unflätigem Benehmen. Sie laden sich gegenseitig auf ihre Feste und Jubiläen ein, kennen sich allesamt untereinander, sind häufig verwandt und verschwägert.
Solche meist kräftig verzerrten Bilder prägen die Vorstellung einer verschworenen, fast geheimbündelnden Macht im Staate, in der – allen demokratischen Tendenzen des vergangenen Jahrhunderts zum Trotz – immer noch die Gesetze des Blutes, der Aristokratie, der selbstherrlichen Willkür und der Feudalherrschaft dominieren. Dabei ist es nun schon bald ein Jahrhundert her, dass dem A. in Deutschland und Österreich sämtliche Privilegien genommen wurden. 1919 war das, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Seitdem ist ein Adelstitel offiziell nicht mehr als der Bestandteil eines Namens.
Kaiser Wilhelm am Bahnhof Heute leben in Deutschland kaum mehr als 60 000 Adelige unterschiedlichster Abkunft. Der Varianten des A. sind viele: Uradel, Hochadel, niederer Adel, Briefadel – und der so genannte Bahnhofsadel, wie Hochwohlgeborene verächtlich zischen, wenn die Rede auf Kaiser Wilhelm II. und dessen finale Amtshandlungen in buchstäblich letzter Minute kommt. Der Krieg war bereits verloren, doch der Kaiser fuhr unverdrossen von einer Stadt zur anderen und überreichte auf dem jeweiligen Bahnhof, ehe der Zug weiterfuhr, verdienten Bürgern noch schnell ein Adelsprädikat.
Solange menschliche Gemeinschaften bestehen, hat es – im weiteren Sinne – Adelige gegeben: eine zahlenmäßig kleine Gruppe, »geadelt« durch verliehene oder an sich gerissene Privilegien. Aus denen leitete sie den Status der Herrschaftsschicht und, damit verbunden, ihren Führungsanspruch ab. Die Weitergabe der Vorrechte erfolgte in der Regel durch Geburt. Im germanischen Bereich bildeten im frühen Mittelalter die »Edelfreien« mit großem Besitz und Hoheitsrechten den A. Alle vor 1350 urkundlich als adelig nachweisbare Familien gehörten zum Uradel.
Der Begriff »blaues Blut« geht historisch noch weiter zurück und hat seinen Ursprung bei den Westgoten, deren König Roderich in der berühmten Schlacht von Jerez de la Frontera im Jahre 711 den Mauren unterlag. Besonders auffällig an ihnen war ihre helle Haut. Sie wirkte so weiß und fein, dass die bläulich schimmernden Blutgefäße an den Schläfen und den Handrücken deutlich hervortraten. Dies galt als ausgesprochen edel, und so kam es zur Kopplung der Begriffe edel (Adel) und blaublütig.
Keine Vorbildfunktion mehr Dass sie heute weder Vorrechte genießen noch eine Vorbildfunktion ausüben, hindert viele Adelige freilich nicht, weiterhin alten Bräuchen und Riten anzuhängen, sich lustvoll Überlegenheitsillusionen hinzugeben und in der Kommunikation untereinander eine teilweise bizarre Exklusivität vorzutäuschen. Sie führt beispielsweise dazu, dass sich selbst bis dato unbekannte Adelige schon bei der ersten Begegnung oder beim ersten Telefongespräch duzen. Obskure Zirkel und seltsame Vereinigungen blühen im Verborgenen. Eingeweihte studieren ihren »Gotha« und das »Adelsblatt«. Ein ominöser »gelber Kreis« informiert über die Anliegen seiner Mitglieder.
Kritik oder ironische Kommentare von außen tun dem A. meistens nicht besonders weh. Da scheint wohl noch etwas vom alten Elitedenken übrig geblieben zu sein: Was kümmert uns das Gekläff des gemeinen Volkes? Sehr empfindlich aber reagieren Adelige, wenn jemand aus den eigenen Reihen es wagt, den jahrhundertealten, mühsam bewahrten Konsens aufzukündigen. So galt vor einem Vierteljahrhundert die adelige Schriftstellerin Elisabeth von Plessen als Nestbeschmutzerin. Sie hatte in dem Bestseller »Mitteilungen an den Adel« schonungslos mit ihrem Stand abgerechnet.
ADLON
Die deutsche Hotellegende »Adlon« ist eigentlich ein Nachzügler unter den europäischen ➛ Grandhotels. Und auch der Gründer war schon über 50 Jahre alt, als er mit Unterstützung des deutschen Kaisers und Königs von Preußen, Wilhelm II., den Bau eines Luxushotels am Brandenburger Tor gegen viele Widerstände durchsetzte. Der Mainzer Lorenz Adlon hatte eine Tischlerlehre absolviert, fühlte sich jedoch nach der Gesellenprüfung zur Gastronomie hingezogen und wurde zunächst in seiner Heimatstadt ein erfolgreicher Gastwirt. Schon bald beteiligte er sich an der Ausrichtung des Mainzer Karnevals. Beim Deutschen Schützenfest 1878 in Düsseldorf und 1883 bei der Weltausstellung in Amsterdam oblag ihm die Gastronomie.
In Amsterdam betrieb er auch sein erstes Hotel. Bald danach kaufte er das Berliner Restaurant »Hiller«, das er zur damals einzigen Adresse für Feinschmecker in der Reichshauptstadt entwickelte. Mit der Anpachtung des »Continental« am Bahnhof Friedrichstraße fasste er dann erstmals in der Berliner Hotelbranche Fuß.
»Ein Mensch ist nicht mehr als ein anderer, wenn er nicht mehr als ein anderer tut«, war sein Leitspruch. Mittlerweile hoch geachtet und wohlhabend, beschloss er, das beste, luxuriöseste und modernste Hotel Berlins zu bauen: am Pariser Platz, der feinsten Ecke der Stadt. Und so konnte Kaiser Wilhelm am 23. Oktober 1907 an der Adresse Unter den Linden 1 das erste wirkliche Berliner Grandhotel besichtigen: 305 Zimmer, alle mit regulierbarer Heizung, Telefon und elektrischer Uhr. Das war ein Luxus, der jenen im Berliner Schloss bei weitem übertraf. Außer der prunkvollen Halle, dem Wintergarten, dem Bankettsaal und der American Bar sollen dem Monarchen besonders die 140 Privatbäder in den Zimmern imponiert haben.
Aristokratischer Glanz Als sich im Mai 1913 Prinzessin Viktoria Luise mit dem Herzog von Braunschweig vermählte, diente das A. als standesgemäße Unterkunft für die angereisten gekrönten Häupter, allen voran der russische Zar Nikolaus II. und der englische König Georg V. Fortan war das A. für Weltreisende die Adresse in Berlin. Amerikaner schätzten das Haus als das modernste in Europa. Gerhart Hauptmann feierte hier, kurz nach seiner Auszeichnung mit dem Nobelpreis, seinen 50. Geburtstag. Enrico Caruso, Hugo von Hofmannsthal oder Richard Strauss halfen, dem Haus die unvergleichliche Mischung aus aristokratischem Glanz, gepflegter Internationalität, eleganter Geselligkeit und künstlerischem Esprit zu geben, die das A. zur Legende werden ließ. Leinwandstars wie Greta Garbo, Marlene Dietrich, Mary Pickford, Douglas Fairbanks und Josephine Baker gehörten zu den Stammgästen.
Dann kam der Zweite Weltkrieg und mit ihm das Ende der glanzvollen Ära. In den Bombennächten gewährte das Hotel der Prominenz ein letztes Mal Geborgenheit: in seinen unterirdischen Geschossen. Als die Rote Armee Berlin besetzt hatte, war das A. nur wenig beschädigt. Es diente noch als Lazarett und Offiziersunterkunft. Doch wenig später brach ein Feuer aus, und das Prachthotel brannte völlig nieder. Ein Wiederaufbau war für den Ostberliner Magistrat kein Thema. So war es ein halbes Jahrhundert nur noch der Mythos A., der weiterlebte. Erst nach Mauerfall und Wiedervereinigung entstanden die Pläne, den Pariser Platz und damit das Hotel A. wiedererstehen zu lassen. Im August 1997 erlebte es im Beisein des Bundespräsidenten seine Wiedereröffnung, diesmal als Flaggschiff der Kempinski-Hotelgruppe. Schon bald gelang es dem neuen A., sich seinen Platz in der Riege der Berliner Spitzenhotels zurückzuerobern. Im Herbst 2005 wurde das Fünf-Sterne-Haus am Brandenburger Tor von der Vereinigung »The Leading Hotels of the World« zum »besten Hotel in Europa« gekürt.
ALESSI
Bei Ausstellungen eigener Produkte vergleicht sich das Unternehmen schon mal mit Hollywood: Alessi, die Traumfabrik. Alberto Alessi ist ein Mann mit Visionen und reicht diese munter weiter, wobei er auch zu seinen Flops steht. Ja, er ist sogar der Meinung, dass er gelegentliche Misserfolge braucht, als Markierungen für den richtigen Weg zwischen mutigen Designvisionen und Praktikabilität. Denn eigentlich produziert das Unternehmen Haushaltsgeräte, und manchmal eben auch solche, die im Haushalt nur bedingt geeignet sind, wie etwa die postmoderne unpraktische Orangenpresse von Philippe Starck.
Das Unternehmen wurde 1921 von Giovanni Alessi gegründet. Es war zunächst eine Gießerei und Metallwerkstatt. 1924 entstand die erste Kollektion. Inzwischen umfasst das Sortiment an die 1500 Produkte, und A. gilt als Inbegriff italienischen Designs. Der Firmenchef Alberto lässt keinen Zweifel, dass er nicht danach sucht, was der Verbraucher eventuell benötigen könnte: Auf die Träume, nicht auf die Bedürfnisse kommt es an, lautet seine Devise.
Mit den größten Designern arbeitet das Unternehmen zusammen. Vor allem Altmeister Stefano Giovannoni hat mit seinen fließenden Linien und gerundeten Ecken einen unverwechselbaren Alessi-Stil bei Küchen- und Haushaltsobjekten geprägt. Er verantwortet auch die von A. vorgestellte Komplettausstattung für das Bad.
Da Alberto Alessi sein Unternehmen als »Forschungslabor im Bereich der angewandten Kunst« oder »Vervielfältigung von Kunst« versteht, hat man den engeren Haushaltsbereich längst verlassen und entwirft beispielsweise eine bunte Uhrenkollektion oder – gemeinsam mit Siemens – ein Telefon. Noch nicht realisiert hat Alberto Alessi seinen Traum von einem Auto: dem »Alessimobil«.
ANREDE
Ein Feld mit zahlreichen Fallgruben. Nicht immer ganz einfach, hier keinen Fehler zu machen. Man kann sich leicht blamieren, und um das zu vermeiden, drucksen viele herum und umgehen die konkrete Anrede. Gerne genommen wird in solchen Fällen beim Guten-Tag-Sagen die Floskel »Ich grüße Sie«, mit der man nichts falsch machen kann, die gleichwohl etwas mager ist, vor allem, wenn man selbst vom Gegenüber mit ollem Namen angesprochen wird. uch volkstümliche, regionaltypiche Formeln wie »Grüß Gott« oder Moin moin«, die zwar grundsätzlich hne Namenszusatz funktionieren, könen den Eindruck erwecken, man habe den Namen des zu Begrüßenden vergessen. Liebenswert und zur Kaschierung des Nichtwissens bestens geeignet ist der bayerische und österreichische Brauch, ein zwischen Unterwürfigkeit und Ironie oszillierendes »Habe die Ehre« zu säuseln. Das ist natürlich nur aus männlichem Munde passend. Der Wiener fügt manchmal noch an: »… Herr Hofrat«. Ist das Gegenüber eine Dame, lässt sich auch mit dem guten alten »Gnä’ Frau« trefflich arbeiten.
Ein deutscher Akademiker legt nach wie vor Wert darauf, mit seinem Titel angesprochen zu werden – auch wenn er es einem bei wiederholten Begegnungen irgendwann großzügig erlässt. »Herr Doktor« allein klingt freilich immer etwas servil – außer beim Arzt -, dann lieber nur »Doktor« oder, noch besser, die italienische Variante »Dottore«. Dazu gehört aber schon eine gewisse Vertrautheit. Am besten und höflichsten ist es, den Namen mitzunennen. Beim Professor hingegen, vor allem, wenn man selber sein Student ist, lässt man den Namen meistens weg: »Herr Professor« ist immer gut. Erstaunlicherweise reden zwei einander nicht sehr vertraute Professoren, die ja eigentlich wegen der gemeinsamen sozialen Augenhöhe den Titel weglassen könnten, sich gern mit »Herr Professor« plus Nachnamen an. Da schwingt vermutlich eine gute Portion Ergriffenheit vor der Bedeutung des eigenen Standes mit.
Vorsicht vor »Frau Gräfin« In der Welt des blauen Blutes (➛ Adel) ist Vorsicht geboten bei der A. »Herr« und »Frau«, es sei denn, man entschließt sich zum kleinsten gemeinsamen Nenner aller Adelsnamen: dem »von«. Dann kann man mit »Guten Tag, Frau von Bismarck!« oder »Wie geht’s, Herr von Schulenburg?« nichts falsch machen. Will man aber auf die Adelstitel explizit eingehen, dann um Gottes willen nicht »Frau Gräfin« oder »Herr Baron«! So werden die Herrschaften nämlich nur von ihren Dienstboten angeredet. Man sagt: »Guten Tag, Graf!« Bei Prinzen und Herzögen nennt man den Titel, mal ohne, mal mit Namen. Zum Beispiel: »Prinzessin, meine Verehrung!«, aber auch: »Guten Abend, Prinz Rupert!« Oder man ist supervornehm und sagt »Hoheit« – sofern es sich um eine handelt. Nur schwer geht einem bürgerlichen Menschen von heute die früher gebräuchliche Anrede »Euer Durchlaucht« für Fürsten und Fürstinnen, Prinzen und Prinzessinnen von den Lippen. Selbst »Durchlaucht« allein oder auch »Erlaucht« wird in der Alltagskommunikation kaum noch benutzt – wenngleich es immer noch Hochwohlgeborene gibt, die Wert darauf legen. Dem Schreiber dieser Zeilen widerfuhr in der Wartehalle eines amerikanischen Flughafens einst die Ehre, Prinz Leopold von Bayern vorgestellt zu werden; der streckte die Hand aus und sagte nur »Bayern«. Umgekehrt hätte es sich zweifellos etwas ärmlich angehört, ihn – immerhin eine »Königliche Hoheit« – »Herrn von Bayern« zu nennen. Bei einer späteren Gelegenheit, auf einer Party in München, wählte er übrigens die sympathischste aller Varianten: »Ich bin der Poldi.«
Einen Offizier in Uniform mit seinem Dienstgrad anzusprechen verrät den Gedienten, der anhand der Schulterklappen zwischen einem Major und einem Generalmajor zu unterscheiden weiß. Zwingend nötig ist es aber nicht, allenfalls im förmlichen Brief mag es angebracht sein. Hohe Zivilbeamte mit ihrem Titel anzusprechen (»Herr Oberregierungsrat«) ist ein wenig aus der Mode gekommen. »Herr Direktor« sagt man zwar noch zum Schulleiter, als Kind ohne, als Elternteil mit Namen. Außerdem wird diese A. gern von Bettlern benutzt, um dem Passanten einen halben Euro abzuluchsen, und der Österreicher sagt es sowieso zu jedem Zweiten, den er begrüßt. Im förmlichen Behördenverkehr braucht man es kaum noch. Schreibt man an eine Dienststelle, empfiehlt sich das allgemeine »Sehr geehrte Damen und Herren«. Bei Polizisten weiß man ohnehin meistens gar nicht, welchen Rang sie bekleiden. Ein »Herr Wachtmeister« wirkt beleidigend, wenn der Angesprochene möglicherweise schon Hauptwachtmeister oder noch mehr ist. Und einen echten Wachtmeister mit »Herr Polizeipräsident« anzusprechen, das war zu Kaisers Zeiten mal die Masche von Berliner Freudenmädchen, die gut Wetter machen wollten, ist jedoch ebenfalls nicht mehr unbedingt en vogue.
Sollte man auf einem Empfang mit einem Botschafter oder einem ausländischen Regierungsmitglied ins Gespräch kommen, wählt man als korrekte A. »Exzellenz«. Dass man »Herr Bundespräsident«, »Herr Bundeskanzler« und »Herr Ministerpräsident« sagt, ist klar. Unterschiedliche Varianten werden bei Politikerinnen angewandt. Es gibt Befürworter sowohl der doppelten wie der einfachen Weiblichkeitsform, also »Frau Bundeskanzler«, aber auch »Frau Ministerpräsidentin«. Dass hier noch Lernbedarf herrscht, ist nach jahrhundertelangen ausschließlich männlichen Herrschaftsstrukturen verständlich.
»Grüß Gott, Heiliger Vater!« Bei kirchlichen Würdenträgern arbeitet man sich folgendermaßen aufwärts: »Schwester« plus Vorname für die Nonne, »Pater« plus Vorname für den Mönch, »Herr Erzbischof«, »Mutter Äbtissin«, »Eminenz« für den Kardinal. Der Papst, bekanntlich ein Bayer, wurde bei seiner Amtseinführung von Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber mit einem gleichzeitig demütigen und kameradschaftlichen »Grüß Gott, Heiliger Vater« angesprochen; solche Saloppheiten ziemen dem normalen Gläubigen freilich nicht; er sagt nur »Heiliger Vater«. Und wenn er ihn schriftlich bitten möchte, beim lieben Gott ein gutes Wort einzulegen, adressiert er das Schreiben an »Seine Heiligkeit, Papst Benedikt XVI.«.
Sollte sich’s mal ergeben: Königin Elisabeth II. von England als »Queen« anzusprechen zieht zwar keine Einzelhaft im Tower of London nach sich, die weitere höfische Karriere kann man allerdings mit Sicherheit abschreiben. Die korrekte A. lautet »Your Majesty«.
ANTI-AGING
Die hippsten Klamotten, die ausgeflippteste Frisur, der abgefahrenste Szenejargon sind im Bemühen, jugendlich zu wirken, nutzlose Instrumente, wenn eines nicht stimmt: die Haut. Mag der Körper noch so durchtrainiert sein – dem Eindruck faltiger, schlaffer Haut hat er letztlich wenig entgegenzusetzen.
Seit der Antike versuchen die Menschen, ihre Haut jung zu halten. Öl und Eselsmilch, Wässerchen und Cremes sollen seit jeher die Falten glätten. Einige tausend Varianten sind in den vergangenen Jahrzehnten hinzugekommen – oft nur mit mäßiger Erfolgsgarantie. An die zwei Milliarden Euro geben die Deutschen heute pro Jahr für Kosmetik aus – nur für Shampoos bezahlen sie noch mehr. »Nichts an ihrem Körper ist den Menschen mehr wert als Haut und Haare«, hat der »Spiegel« beobachtet.
»Forever Young« Der Mensch will nun mal nicht alt werden. Bob Dylans berühmter Song »Forever Young« ist vielen eine Art Glaubensbekenntnis (➛ Jugendwahn). Da kommt die noch relativ neue magische Formel »Anti-Aging« gerade recht. Was ist das eigentlich genau? Fragt man zehn echte oder selbst ernannte Fachleute, bekommt man zehn verschiedene Antworten. Einen großen Raum nehmen allgemeine Entspannungs- und Wellness-Anwendungen ein, verbunden mit hautpflegenden Rezepturen. Eine andere Denkschule beschäftigt sich mit Hormonen und entsprechenden Behandlungen. Die Angebotspalette auf diesem nur verwaschen definierten Gebiet ist von verwirrender Vielfalt.
Bleiben wir deshalb bei der Kosmetik. Immer intelligentere Konzepte bieten die Firmen an, um den ewigen Wunsch nach Jung- und Schönsein zu unterstützen. Da gibt es – ein charmanter Tritt ans Schienbein der Schönheitsoperateure – Slogans wie »Liften ohne Skalpell«, auch umschrieben als »Straffen und Festigen auf die sanfte Art«. Bewerkstelligen sollen das die neuen so genannten Hightech-Cremes mit ihren wahren Super-Inhaltsstoffen. Ungewöhnliche, sicherlich nicht ganz unwirksame luxuriöse Substanzen wie Algen, Seide und Gold sind in diesen Anti-Aging-Cremes enthalten. Dass sie sündhaft teuer sind, hält die Kundschaft nicht ab, und tatsäch lich liegt der Qualitätsanspruch hier auch um ei niges höher als bei den üblichen Produkten.
APERITIF
Der vom lateinischen Wort aperire (öffnen) abgeleitete Begriff stammt aus Frankreich. Mit ihm bezeichnet man den Magenöffner, den Appetitanreger, in der Barsprache: den Before-Dinner- bzw. den Before-Lunch-Drink.
In allen romanischen Ländern füllten sich früher am späten Vormittag die Plätze an der Bar und die Tische auf den Caféterrassen: Es war die Zeit des Aperitifs. In Italien oder in Frankreich war dieses Zeremoniell eine Selbstverständlichkeit. So viel Zeit musste sein! Es dominierten die leicht bitteren Getränke, oft auf Weinbasis. Cynar oder Dubonnet, Campari oder Vermouthgetränke waren die Klassiker. In Südfrankreich kam der Pastis, ein A. auf Anisbasis, als regionale Spezialität hinzu. Eine andere Spezialität, die in Burgund beheimatet war, aber bald ganz Frankreich und zeitweise auch Deutschland eroberte, war der Kir: Ein Schuss Crème de Cassis, Likör aus schwarzen Johannisbeeren, wurde mit trockenem Weißwein aufgefüllt. In den »besseren Kreisen« wurde der Weißwein durch Champagner ersetzt und Kir Royal genannt.
Als das 20. Jahrhundert amerikanischer wurde, verdrängten Cocktails diese Klassiker. Highballs, Sidecars, Whiskey Sours und immer wieder Dry Martini waren die angesagten A. Viele von ihnen besaßen allerdings den Nachteil, dass sie die Geschmacksknospen verschlossen und somit die eigentliche Funktion des A. zumindest stark verminderten. Denn ein A. sollte anregend wirken, ohne zu sättigen, sollte leicht alkoholisch sein, ohne den Alkoholpegel schon vor dem ersten Glas Wein unnötig hochzuschrauben. Der Schriftsteller Gregor von Rezzori hatte mit einem oder zwei Glas trockenem Sherry, also einem Fino, seinen idealen A. gefunden und widmete ihm sogar ein Buch. Nicht wenige bevorzugen auch ein frisch gezapftes Pils als A., und in der Tat ist ein Bier nicht nur ein idealer Durstlöscher, sondern durchaus auch appetitanregend. Verstärkt durchgesetzt hat sich in den letzten Jahren das Glas Champagner vor dem Essen, vor allem in guten Restaurants. Hier sollte man allerdings darauf bestehen, das Glas am Tisch eingeschenkt zu bekommen, um sicherzugehen, für den zu zahlenden Preis nicht irgendeinen Supermarktchampagner oder gar einen Prosecco untergejubelt zu bekommen.
ARABISCHER EDELTOURISMUS
In nicht allzu weiter Ferne toben Kriege und Aufstände. Der Irak ist stellenweise nur tausendundeinen Kilometer entfernt. Doch hier merkt man nichts von den Kämpfen und Krisen der von Terror geschüttelten Region, die wir den Nahen Osten nennen. Wenn der Hotelgast in seiner geräumigen Edelsuite den Fernseher einschaltet, wirken die in den Nachrichten gezeigten Gemetzel und Selbstmordattentate noch irrealer und weiter entfernt, als wenn in Deutschland die Tagesschau darüber informiert. Denn hier, so scheint es, hat das Böse grundsätzlich keinen Zutritt. Hier locken Oasen des Friedens, der Behaglichkeit und des Luxus.
Die meisten Urlauber, die aus den neuen Ferienparadiesen im Südosten der arabischen Halbinsel zurückkehren, berichten euphorisch vom ultimativen Reiseerlebnis ihres Lebens. Gleichzeitig bekennen sie, leicht verlegen, von Land und Leuten nur relativ wenig mitgekriegt zu haben. Zu großen Ausflügen, anstrengenden Exkursionen, Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten, Bekanntschaften mit Einheimischen sei man gar nicht gekommen. Zu überwältigend sei allein das Hotelerlebnis gewesen. Man habe sich gefühlt wie in einem Märchen, sei behandelt worden wie ein leibhaftiger Sultan oder Emir.
Draußen Wüste, innen Komfort Tatsächlich stellt der Komfort in den morgenländischen Luxushotels alles in den Schatten, was ein Europäer gewöhnt ist. Jedes Jahr kommen neue Paläste hinzu, die sich an teurer Ausstattung, exquisiter Lage und ausgefallenen Anlagen gegenseitig übertreffen. Oft locken die sündhaft teuren Ressorts mit einem faszinierenden Doppelerlebnis: vor der Haustür die Wüste, aber drinnen größtmöglicher Komfort, vom Wellness- und Fitnesscenter gigantischen Ausmaßes bis zur Kinoleinwand in der Suite. Von den kulinarischen Genüssen an fürstlich gedeckten Tafeln gar nicht zu reden. Und auch nicht vom Butler, der den Bewohnern einer Suite rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Drei Destinationen sind es vor allem, die in den vergangenen Jahren den Ruf dieses Teils von Arabien als touristisches Traumland gefestigt haben: Dubai, Abu Dhabi und Oman. Die beiden Erstgenannten, auf die auch der Begriff Schlaraffenland zutrifft, gehören zu dem politischen Verbund Vereinigte Arabische Emirate (V.A.E.), zu dem sich 1971, infolge der Unabhängigkeit von Großbritannien, sieben Wüstenstaaten zusammenschlossen. Alle drei sind über ihre internationalen Flughäfen mühelos zu erreichen.
Dubai: höchstes Hotel der Welt Der Aufschwung des einst eher verschlafenen Wüstenstaates Dubai, der hauptsächlich vom Fischfang und von der Perlentaucherei an seiner Küste lebte, begann 1966. Da wurden erstmals Ölvorkommen entdeckt. Heute gilt Dubai-Stadt als die Perle der V.A.E.: kosmopolitisch, lebhaft, modern und traditionell zugleich, Umsteigeplatz für Reisende nach Fernost, Ziel für Geschäftsreisende aus aller Welt und eben Touristen. Das Emirat ist anderthalb mal so groß wie das Saarland, das ganze Jahr über scheint die Sonne, ein siebzig Kilometer langer Sandstrand erstreckt sich. Manche behaupten, Dubai sei das reichste Land der Erde, dem gegenüber steht aber die Statistik der V.A.E., wonach Abu Dhabi die reichste Region der Gemeinschaft ist. Wie auch immer, von den über eine halbe Million arabischen Bewohnern braucht kaum jemand geregelter Arbeit nachzugehen. Zum Arbeiten – das gilt auch für die übrigen Emirate – hat man asiatische und afrikanische Gastarbeiter. Das große Geld bringen die Gäste der vielen First-Class-Hotels. Jährlich sind es über drei Millionen, davon über 150 000 Deutsche. Der Luxustourismus beschert dem Emirat inzwischen mehr Einnahmen als die Ölförderung. Verantwortlich für diesen Boom ist die als besonders geschäftstüchtig bekannte Herrschersippe der al-Maktum, die das Land schon seit vielen Generationen regiert. So kam aus dem königlichen Haus nicht nur die ursprüngliche Idee, sondern auch eine Milliardenspritze, um den Bau des mit 321 Metern höchsten Hotels der Welt zu ermöglichen, des »Burj al Arab« (übersetzt: Arabischer Turm). 1999 wurde das »strahlende Symbol der Extravaganz« (»Welt am Sonntag«) eröffnet. Der weithin sichtbare, vor die Küste Dubais gesetzte Bau sieht aus wie ein riesiges, vom Wind gebogenes Segel. Das Wahrzeichen der Stadt schmückt sich mit dem Etikett »Einziges Sieben-Sterne-Hotel der Welt« – bis fünf wird in der Branche eigentlich nur gezählt. Schwellenderen Luxus als im »Burj al Arab« gibt es wohl weltweit nicht – was freilich nicht automatisch bedeutet, dass Gourmets und Weinkenner hier ihr Paradies ansiedeln. Unterdessen arbeiten die Planer des Emirats schon an einem neuen, kaum minder gigantischen Prestigeprojekt: »Hydropolis«, das erste Unterwasserhotel der Welt.
Abu Dhabi: Öl und Oasen V.A.E.-Nachbar Abu Dhabi ist das größte der sieben Scheichtümer. Die Einnahmequellen sprudeln hier genau andersherum als in Dubai: Erst kommt das Öl, dann der Tourismus. Doch der hat in den vergangenen Jahren kräftig dazugelegt, was kein Wunder ist angesichts der Schönheit des Landes. Hinter der flachen Küste erstreckt sich ein riesig breiter Streifen Sandwüste. Im Osten reicht das Emirat bis an das Oman-Gebirge. Auf einer Insel im Golf und durch eine Brücke mit dem Festland verbunden, liegt die gleichnamige Hauptstadt (nicht nur des Emirats, sondern auch der gesamten V.A.E.) mit herrlichen Alleen und der einladenden Promenade Corniche. Zum Emirat gehört auch die Oase Al Ain im Osten des Landes, nahe der Grenze zum Oman: eine prächtige, grüne Stadt mit ihrem in ganz Arabien berühmten Kamelmarkt. Hier wie dort: erstklassige Hotels. Das Prunkstück ist das 2005 eröffnete »Emirate Palace«, das zur Kempinski-Gruppe gehört und angetreten ist, dem »Burj al Arab« die Stirn zu bieten. Es liegt direkt am 1,3 Kilometer langen Sandstrand, unweit vom Stadtzentrum Abu Dhabis. Weithin sichtbarer Blickfang sind die 60 Meter hohe Kuppel des Hauptgebäudes und 114 weitere Kuppeln in der gesamten Anlage, allesamt mit reichlich Blattgold veredelt. Das Haus verfügt über zwei Helikopterlandeplätze und einen eigenen Yachthafen.
Oman: Morgenland in Reinkultur Zwischen den V.A.E. im Nordwesten, Saudi-Arabien und dem Jemen, die sich von Nordwesten bis hinunter nach Südwesten ziehen, und dem arabischen Meer auf der Ostseite liegt der Oman. Das Sultanat ist etwa viermal so groß wie die V.A.E., allerdings nicht ganz so unverschämt reich. Immerhin: Das Öl sprudelt auch hier kräftig, und wenn das, wie an so vielen Quellen weltweit erwartet, in etwa 15 Jahren schwächer werden sollte, will man in Sachen Tourismus zur Weltspitze aufgeschlossen haben.
Falls man sich aus der Kindheitslektüre sowohl der »Märchen aus 1001 Nacht« wie der kaum weniger schönen Erzählungen des schwäbischen Dichters Wilhelm Hauff (»Die Karawane«) eine Vorstellung vom Morgenland bewahrt hat – hier kommt sie der Realität ansatzweise nahe, sofern man gewillt ist, einige hundert Jahre zu überspringen. Stolz berufen sich die Omaner auf Sindbad, den Seefahrer. Moscheen mit schlanken Minaretten und goldenen Kuppeln vermitteln ein Islam-Bild, das man angesichts der aktuellen Terror- und Kriegsszenarios schon fast vergessen hatte. Eine Reporterin des »Rheinischen Merkurs« beobachtete: »Weiß gekleidete Männer saugen an ihren Wasserpfeifen, plaudern mit Fischverkäufern, lenken Luxus-Limousinen. In den Souks gibt es feinstziselierten Silberschmuck, Seidenschals, Goldketten, Myrrhe und Weihrauch, das flüchtige Gold der Antike. (…) Reich verschnörkelte Villen erzählen vom Glanz alter Handelsdynastien, verfallende Lehmdörfer vom Schweiß der Bauern. Bombastische Hochhäuser und langweilige Wohnblöcke bleiben einem ebenso erspart wie Taschendiebe und bettelnde Kinder. Straßen und Plätze sind noch sauberer als in der Schweiz. Kein einziger Zigarettenstummel weit und breit.«
Rund ein Drittel der 2,6 Millionen Omaner lebt in der Hauptstadt Maskat, einer schneeweißen Stadtlandschaft zwischen rotbraunen Bergen und blauem Meer. Funkelnagelneue Geschäfts- und Wohnviertel, erstklassige Hotels, Banken – es fehlt an nichts. Zu einem der beeindruckendsten Erlebnisse innerhalb der arabischen Welt gehört der Besuch der Großen Sultan-Kabus-Moschee mit ihren weitläufigen Wandelgängen, der Eleganz ihrer mächtigen Kuppel und dem größten Teppich der Welt. Vieles kann man in dem Staat unternehmen: auf eigene Faust durch eine Sahara im Kleinformat chauffieren, durch pittoreske Canyons, schroffe Felsenlandschaften wandern, 3000 Meter hohe Berge hinaufstaunen oder den Rennkamelen beim Training zuschauen. Auf der Meerseite locken betörend schöne Küstenabschnitte mit unbelebten, fantastischen Badestränden. Manche sind regelrecht umgegraben von den Spuren der Meeresschildkröten, die hier das ganze Jahr hindurch nachts ihre Eier ablegen. Mag der Luxus in den V.A.E. Dimensionen annehmen, die man als braver Mitteleuropäer nicht für möglich gehalten hat – das Abenteuer Reisen wartet dafür eher im Oman, auch nicht gerade ein Armenhaus.
ARMANI, GIORGIO
Giorgio Armani zählt zu den erfolgreichsten, populärsten Modeschöpfern Italiens und der Welt. Der ehemalige Medizinstudent, der sein Studium nach vier Semestern an den Nagel hängte, begann als Schaufensterdekorateur im Mailänder Kaufhaus »Rinascente« eine neue Karriere. Sie ließ ihn bald zum Einkäufer für Mode und danach zum Leiter der Abteilung Herrenmode des Hauses aufsteigen. Dort lernte er Nino Cerruti kennen, der den talentierten jungen Mann als Designer engagierte. Neun Jahre sammelte Armani Erfahrungen, bevor er 1974, mit 40, den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Gemeinsam mit seinem Freund Sergio Galeotti gründete er das Modelabel »Giorgio Armani«, zunächst für Herren, ein Jahr später auch für Damen. Eine wahrlich fantastische Erfolgsgeschichte nahm ihren Anfang.
Seinen internationalen Durchbruch schaffte Armani, der stets in einem legeren schwarzen oder blauen T-Shirt auftritt, mit der Ausstattung bekannter Hollywoodgrößen. So kleidete er Richard Gere in den Filmen »American Gigolo« (»Ein Mann für gewisse Stunden«) und »Pretty Woman« ein. Es war ein ganz eigener, unspektakulärer Modestil, den er kreierte. Sein Credo: »Die Herrenmode soll so sein, dass man sich weder wie ein Yuppie noch wie ein Bankangestellter fühlen muss.« Jedoch verkauft der smarte, stets braun gebrannte Designer längst nicht mehr nur Edelklamotten. Parfüms, Lederwaren, Accessoires aller Art, Brillen oder Uhren kommen unter dem Label Armani auf den Markt. Daneben entwirft er Autos und sogar Hotels. In allem, was er schafft, verfolgt Armani unbeirrt seine ganz eigenen Vorstellungen von reduzierter Eleganz und Qualität. Der Erfolg gibt ihm Recht: 5000 Mitarbeiter weltweit und ein Umsatz von weit über einer Milliarde Euro sind die beachtliche Lebensbilanz des über Siebzigjährigen. Dennoch weigert er sich beharrlich, sich bei einem Bummel durch Mailand oder New York von einem Bodyguard beschützen zu lassen. Und: Er ist der Einzige seiner Branche, der sich nicht von einem der großen Konzerne aufkaufen ließ.
ASPIRIN
Jährlich werden rund um den Globus mehr als 12 000 Tonnen Aspirin produziert, das nicht nur zur Bekämpfung eines Katers Einsatz findet. Es ist das meistgenutzte Medikament der Welt. Die amerikanischen Kosmonauten haben es mit auf den Mond genommen, um ihre Muskelschmerzen zu bekämpfen.
Seine Vorgeschichte beginnt schon vor fast 4000 Jahren. Erste Hinweise auf die Vorläufer des A. finden sich in einer ägyptischen Papyrusrolle von 1550 v. Chr., wo von einem aus Weidenblättern gewonne nen Schmerzmittel die Rede ist. Auc der griechische Arzt Hippokrates nutzte zur Behandlung von Fieber und Schmerzen einen Absud aus Blättern und der Rinde des Weidenbaums. Anfang des 19. Jahrhunderts stieß der französische Apotheker P. J. Leroux durch Einkochen von Weidenrinde auf Kristalle, die er in Anlehnung an den lateinischen Namen der Weide, salix, Salicin nannte.
1897 entwickelte dann Felix Hoffmann, ein Chemiker in den Diensten des Unternehmens Bayer, die reine Form von Acetylsalicylsäure (ASS). Das Mittel war ursprünglich zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen vorgesehen. Hoffmann wollte damit seinen kranken Vater behandeln. Da sich aber bald herausstellte, dass der neue Stoff auch andere Schmerzen linderte, meldete Bayer das neue Mittel unter der Marke A. an. Der Name entstand aus der Kombination von Acetyl und Spirsäure (die mit Salicylsäure identisch ist). Zunächst nur als Pulver in kleinen Fläschchen vertrieben, war A. bald eines der ersten in Tablettenform angebotenen Medikamente – ab 1904 mit dem eingestanzten Bayer-Kreuz.
Nicht nur Schmerzmittel Seine Funktion als Schmerzmittel war allerdings nur der Anfang der Geschichte. In regelmäßigen Abständen hat die Medizin immer neue Einsatzmöglichkeiten für dieses Wundermittel entdeckt: Zur Schmerzbekämpfung und Fiebersenkung kam die in höheren Dosen bewirkte Entzündungshemmung. Dann entdeckten Forscher, dass durch regelmäßige Einnahme von A. das Risiko der Alzheimer-Erkrankung vermindert wurde. Da A. auch das Blut verflüssigt, wird es seit Jahren zur Infarktvorbeugung eingesetzt. Schließlich haben amerikanische Forscher vor einigen Jahren begonnen, bestimmten Krebsarten mit der Verordnung von A. vorzubeugen. Das Einsatzspektrum scheint unbegrenzt, weit über die Hausapotheke hinausgehend.
Das Unternehmen Bayer, heute der wohl bekannteste Name in der Pharmawelt, war 1863 von Friedrich Bayer in Wuppertal-Barmen gegründet worden und produzierte zunächst ausschließlich Farbstoffe. Doch schon sehr bald wurde Bayer auch bei pharmazeutischen Produkten zu dem, was man heute einen Global Player nennt. Diese Entwicklung wurde durch den Ersten Weltkrieg abrupt unterbrochen. Einerseits war Bayer von seinen wichtigsten Absatzmärkten abgeschnitten, andererseits ab 1914 stark in die Kriegsindustrie involviert. Im Versailler Vertrag wurde dieses Engagement mit einer Konfiszierung von Markenrechten bestraft. Daraufhin verlieh die US-Regierung der amerikanischen Firma Sterling Drug die Lizenz, A. zu produzieren und zu vertreiben. Sehr viel später konnte Bayer die Markenrechte wieder zurückkaufen, dennoch hält die Mehrzahl der Amerikaner A. auch heute noch für ein amerikanisches Produkt. Dafür gehört ein echtes US-Produkt seit 1978 zum Portefeuille des Bayer-Konzerns: die Anti-Kater-Brausetablette Alka Seltzer, ein Mittel, das ebenfalls auf Hoffmanns Erfindung ASS basiert.
AUKTION
Das Wort kommt vom lateinischen augere, was »erhöhen« bedeutet. Erhöht wird bei der Auktion der Preis einer Ware durch gegenseitiges Überbieten. Der deutsche Begriff für diesen öffentlichen Vorgang ist die Versteigerung. Es ist ein alter Brauch. Bereits 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung wurden in Babylon auf den jährlichen Heiratsmärkten Frauen versteigert. Später im alten Griechenland waren es Sklaven. Im atrium auctionarium versteigerten römische Soldaten regelmäßig ihre Kriegsbeute. Ende des 15. Jahrhunderts waren in England die so genannten Kerzenauktionen beliebt: Nach dem Anzünden einer ca. 2,5 Zentimeter hohen Kerze wurden die Gebote entgegengenommen. Das letzte Gebot vor dem Erlöschen der Flamme erhielt den Zuschlag. Auf diesem Wege wurden sogar Schiffe versteigert.
Die Versteigerungen nach noch heute bekannter Art gehen auf einen gewissen Samuel Baker in London zurück. Am 11. März 1744 bot er die Bibliothek von Sir John Stanley zum Verkauf, die aus hunderten von Büchern bestand. Der Erlös betrug wenige 100 Pfund Sterling. Zwei Jahrhunderte später versteigerte Bakers Unternehmen, das inzwischen den Namen seines Neffen John Sotheby trug, ein einzelnes Buch mit dem Titel »The Gospels of Henry the Lion« für acht Millionen Pfund. Doch auch Baker hatte noch eine Reihe von bibliophilen Kostbarkeiten erfolgreich unter den Hammer gebracht, so nach Napoleons Tod alle Bücher, die dieser in sein Exil nach St. Helena mitgenommen hatte.
Kunsthändler aus aller Welt Die Nachfolger erkannten rechtzeitig, dass dem Haus neben Büchern ein weiteres Standbein nützlich sein würde, und öffneten ihre Räume in der New Bond Street für Zeichnungen und alte Meister. In die Annalen von Sotheby’s ging die Versteigerung (1958) der Goldschmidt Collection ein, die sieben der berühmtesten Werke des Impressionismus beinhaltete. Hierfür wurde erstmals eine Abendauktion angesetzt; die Einladung schrieb ausdrücklich vor: evening dress. 1400 Personen kamen, unter ihnen William Somerset Maugham, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Lady Churchill und natürlich hunderte von Kunsthändlern aus aller Welt. Die sieben Bilder waren innerhalb von genau 21 Minuten verkauft – für 781 000 Pfund, die höchste bis dahin erzielte Summe für eine Kunstsammlung.
1955 eröffnete Sotheby’s eine Filiale in New York, neun Jahre später übernahm es das größte amerikanische Kunstauktionshaus Parke-Bernet. Auch in anderen Kunstmetropolen der Welt wurden Niederlassungen eröffnet, so in Genf. Hier stand 1987 der Schmuck der Herzogin von Windsor zum Verkauf: eine historische A. Über Satellit waren Bieter aus New York zugeschaltet und per Telefon Interessenten aus aller Welt. Insgesamt 50 Millionen Dollar wurden erzielt, das Fünffache dessen, was Sotheby’s erwartet hatte.
Auch das zweite große Londoner Auktionshaus Christie’s schrieb im 18. und 19. Jahrhundert Kunstgeschichte. Von James Christie am 5. Dezember 1766 gegründet, handelte das Unternehmen schon bald mit Kunstwerken der englischen Hocharistokratie und des Königshauses. Für die Zarin Katharina die Große ersteigerte Christie’s die Gemäldesammlung von Sir Walter Walpole, die später Grundausstattung der St. Petersburger Eremitage wurde.
Ein Picasso mit Rekordergebnis Dabei begann auch bei Christie’s alles sehr bescheiden: In der allerersten A. wurden angeboten: 2 Nachttöpfe, 1 Bettlaken, 4 Bügeleisen. Dann, im Jahre 1900, konnte man immerhin schon mit einer Locke von Napoleon I. aufwarten. Doch die großen Sensationsversteigerungen mit reger Anteilnahme der internationalen Öffentlichkeit und immer höheren Rekorderlösen kamen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Meilensteine waren 1970 ein Velàzquez (»St. Rufina«) für rund vier Millionen, 1987 van Goghs »Sonnenblumen« für 39,9 und 1990 noch ein Van Gogh (»Porträt des Doktor Gachet«) für 82,5 Millionen Dollar. Den bislang höchsten Preis für ein Gemälde erzielte 2004 bei Sotheby’s New York Picassos »Junge mit Pfeife«: 104 Millionen Dollar.
Ein in der Fachwelt ebenso geschätztes Auktionshaus, das größte in Mitteleuropa, ist das Wiener Dorotheum. Es wurde 1707 von Kaiser Joseph I. gegründet und zog 70 Jahre später in das ehemalige Kloster in der Dorotheengasse um. Das frühere Pfandhaus hat sich gerade im Bereich der bildenden Künste mit seinen regelmäßigen Versteigerungen einen erstklassigen Ruf erworben. Für ausgefallene Immobilien und antike Möbel ist das Pariser Hotel »Drouot« bekannt.
Das mittlerweile umsatzstärkste Versteigerungshaus der Welt ist ein virtuelles. Man betritt es nicht durch eine vornehme Eingangshalle und kann sich auch nicht telefonisch mit ihm verbinden lassen, um aus der Fern mitzubieten. Der Zugang erfolg per Internet. ➛ Ebay ist eine der erfolgreichsten Gründungen der New Economy.
AUSLESE
Eine Auslese ist immer eine »Auswahl der Besten«. Im Weinbau ist gemeint: die von Hand vorgenommene Lese (Ernte) aller vollreifen oder edelfaulen Beeren einer Traube sowie der daraus produzierte Wein. Da es sich um einen Begriff aus dem deutschen Sprachraum handelt, findet man die A. vor allem in Deutschland und Österreich, in Ausnahmefällen auch in der Schweiz.
Eine besondere Spezialität ist die Trockenbeerenauslese, eine der höchsten Prädikatsstufen unter den deutschen und österreichischen Qualitätsweinen. Diese Weine, die an ein bestimmtes Mindestmostgewicht gebunden sind, das in Deutschland in Oechslegraden, in Österreich in KMW (Klosterneuburger Mostwaage) gemessen wird, gibt es fast nur in überdurchschnittlichen Weinjahren. Trockenbeerenauslesen werden aus edelfaulen Beeren bereitet, die so lange am Rebstock hängen gelassen werden, bis sie fast zu Rosinen geschrumpft und eingetrocknet sind. Diese liefern äußerst geringe Mengen eines sehr süßen, aber ebenso alkoholarmen Nobelweins, der mit Recht von Weinkennern hoch geschätzt wird. Da sie meist auch ein hohes Alter erreichen, sind Preise von über 100 Euro keine Seltenheit. Trockenbeerenauslesen entstanden zuerst im Rheingau und sind noch heute eine Spezialität dieses Weinbaugebiets.
Eine Kuriosität unter den A. ist der so genannte Eiswein. Bei diesem müssen die Trauben zum Zeitpunkt der Lese und Kelterung gefroren sein, und zwar bei mindestens minus sieben Grad Celsius. Die Beeren werden meist zu nächtlicher Zeit gelesen. Da durch den Frost Wasser gebunden wird, erhält man einen sehr konzentrierten Most, der allerdings eine hohe Süße mit einer gleichfalls hohen Säure verbindet. Auch in Österreich ist Eiswein als eigenständiges Prädikat anerkannt. Manche Eisweine erinnern in Duft und Geschmack an einen Spaziergang durch einen Obstgarten im späten Sommer, wenn Quitten, Birnen, Äpfel und Trauben ihre volle Reife erlangen. Andere wiederum changieren zwischen Limonen und Aprikosen.
AUSTERN
Carl Friedrich von Rumohr (1785-1843), der bedeutendste gastronomische Autor deutscher Sprache, beschrieb den Geschmack der Auster in seinem Buch »Geist der Kochkunst« als »eine Welt für sich, kühl, tief, gedankenvoll, eine harmonische, ungegliederte, gegensatzlose Einheit«. Und er fuhr fort: »Mit jeder Auster, die du schlürfst, schlürfst du auch deinen Anteil an Ozean. Ein Denkmal dem Wohltäter der Menschheit, der als Erster die Auster genießbar fand!«
Lebend frisch, wie sie zu 80 Prozent verzehrt wird, oder gekocht, gebraten oder geräuchert, bringt die A. Gourmets in aller Welt zum Schwärmen. Neben Hummer, Kaviar und Trüffel gehört sie zum Inbegriff der höheren Genüsse; und das seit den Zeiten der Römer, die 100 Jahre v. Chr. die Austernzucht begründeten.
Seit jeher wird der A. eine besonders durchschlagende Wirkung auf die Potenz nachgesagt – Ludwig XIV. soll am Tage seiner Hochzeit mit Maria Theresia von Spanien 400 davon hinuntergeschluckt haben. Die Vorstellung speist sich einerseits aus dem hohen Eiweißgehalt und wurzelt wohl auch in dem eigenartigen, transsexuellen Verhalten dieser Muschel: Je nach Wassertemperatur und Nahrungsbedingungen wechselt die A. nämlich mehrfach ihr Geschlecht. In den Monaten Juli und August produziert die A. bis zu zwei Millionen Eier, die zunächst als Larven im Plankton schwimmen und anderen Meeresbewohnern als Nahrung dienen; nur ein Dutzend Nachkommen einer A. schaffen es, die ersten Wochen zu überleben. Sie suchen dann festen Halt, eine Art Ankerplatz, und diesen verschafft ihnen der Austernzüchter, der an besonders günstigen Stellen Ziegel, Dachschindeln, heute mehr und mehr Plastikrohre aufstellt. Die Larven klammern sich daran fest und beginnen sofort, ihre Schale zu entwickeln. Nach acht Monaten werden die heranwachsenden A. dann in Parks mit planktonreicherem Wasser gebracht, wo sie während der nächsten drei bis vier Jahre zu der Größe heranwachsen, die der Feinschmecker kennt.
Begehrt: die »Sylt Royal« Man unterscheidet vier Austernarten: die (inzwischen selten gewordene) Europäische Auster, die Portugiesische oder Felsenauster, die Pazifische und schließlich die Amerikanische Auster. Bei uns werden vor allem die beiden erstgenannten Sorten angeboten. Sie stammen überwiegend aus den französischen Austernparks an der bretonischen Atlantikküste (Belon), aus Arcachon und der Charente (Marennes). Aus niederländischen Aquakulturen kommen die Imperiales, aus Irland die Galway, aus England die Colchester, aus Dänemark die Limfjord, und auch Sylt hat eine kleine, aber außerordentlich begehrte Produktion aufzuweisen: »Sylt Royal«, eine pazifische Felsenauster.
Ebenso hartnäckig wie ihr Ruf der gesteigerten Liebeskraft hält sich das offenbar unausrottbare Vorurteil, dass die A. nur in den Monaten mit »r« genießbar sei. Richtig ist, dass sich die Qualität von Oktober bis zum Mai kontinuierlich steigert. Vor Oktober ist die A. vom Laichen geschwächt und noch etwas wabbelig. Jedoch spricht nichts dagegen, auch im Sommer – wenn einen die Lust überkommt – A. zu verzehren, vorausgesetzt, sie waren bei der richtigen Temperatur (2 bis 7 °C) gelagert. Dann kann man sie sogar noch nach drei Wochen mit Genuss und ohne Bedenken schlürfen. Wichtig ist allerdings, dass die Schalen fest geschlossen sind; nur so kann man sicher sein, dass die A. das umschlossene Meerwasser nicht verloren hat. Die geschmackliche Frische einer A. hängt direkt damit zusammen: In einer Stunde lässt sie sich von mehreren Litern Meerwasser durchspülen!
Am besten schmeckt die A., wenn man sie roh und frisch, mit einem Spritzer Zitronensaft und allenfalls ein ganz wenig Pfeffer, mit ihrem eigenen Wasser aus der Schale schlürft. Ob man die A. kaut oder im Ganzen hinunterschluckt, bleibt jedem Genießer selbst überlassen. Man reicht etwas Vollkornbrot oder Pumpernickel mit Cheddarkäse in kleinen Würfeln dazu. Als Getränk empfiehlt sich Champagner, Chablis oder Meursault. Wahrhaft königlich mundet ein Dutzend A. mit einer Flasche Coulée de Serrant von der Loire.
AYURVEDA
Zu den diversen kosmetischen, medizinischen, psychologischen und sportlichen Heilslehren, die im Zuge der Wellnesswelle über uns gekommen sind, hat sich ein hierzulande vor kurzem noch weitgehend unbekannter Begriff gesellt: Ayurveda. Man hört immer wieder aus dem Munde gestresster, regenerierungshungriger, meist weiblicher Zeitgenossen, sie wollten »mal’ne Runde Ayurveda« machen oder hätten in Bad Soundso »zwei Wochen Ayurveda« gebucht. Auf die Nachfrage, worum genau es sich bei dieser Methode handle, bekommt man erstaunlicherweise nur ziemlich verschwommene Antworten. Viel mehr, als dass es »etwas mit Fernost« zu tun hat, erfährt man in der Regel nicht. Dieses bei uns noch weit verbreitete Unwissen korrespondiert mit dem Unwesen, das etliche Scharlatane treiben. Denn nach einem Crashkurs, der manchmal nicht länger als ein Wochenende dauert, darf man sich bereits Ayurveda-Therapeut nennen. Der Begriff ist nicht geschützt.
Im Ursprungsland Indien muss ein Ayurveda-Arzt studiert haben, genauso wie ein Schulmediziner. An etwa 40 Universitäten wird diese traditionelle indische Heilkunst gelehrt, deren erste Anwendungen (beispielsweise in der Zahnmedizin) schon aus dem Jahre 9000 vor unserer Zeitrechnung überliefert sind. Der Name stammt aus dem Sanskrit und leitet sich von den Wörtern ayus (Leben) und veda (Wissen) ab.
Energien im Organismus A. ist eine Kombination aus Naturlehre und Philosophie. Das Hauptaugenmerk liegt auf den für die Gesundheit wichtigen physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Aspekten, aber ebenso auf der Kehrseite: der Frage nach den Krankheitsursachen. Diese doppelte Betrachtungsweise verleiht dem A. seinen ganzheitlichen Charakter. Eine der zentralen Auffassungen der Lehre ist das Wirken dreier verschiedener Temperamente/Energien (Doshas) im Organismus. Bei jedem Menschen sind sie unterschiedlich stark ausgeprägt. Eine Balance aller drei Kräfte wird als Idealzustand betrachtet. Die verschieden starken Abweichungen von diesem Ideal erfordern ebenso verschiedene Methoden der Behandlung. Und der Vorsorge. Denn neben der Heilung ist das Vermeiden von ernsthaften Erkrankungen das Ziel der ayurvedischen Heilkunst. Zu diesem Zweck gibt es eine Reihe von Behandlungen und Anwendungen, beispielsweise diverse Ölmassagen und das so genannte Panchakarma, ein aus fünf Stadien bestehendes Entschlackungs- und Reinigungsprogramm.
Inwieweit die sich heftig ausbreitende deutsche Ayurveda-Szene mit der echten indischen Lehre zu tun hat, lässt sich generell schwer beantworten. Die Bandbreite reicht vom religiös indoktrinierten über den pseudoesoterisch angehauchten bis zum sich an die Urlehre anlehnenden seriösen Anbieter. Kritisches Infragestellen ist auch bei manchen ayurvedischen Medikamenten angebracht. Wiederholt wurde bereits der Vorwurf erhoben, dass einige Hersteller ihre Präparate nicht gründlich genug auf Belastungen mit Schwermetallen prüfen. So hat man beispielsweise in Weihrauchpillen gegen chronische Polyarthritis eine gefährlich starke Bleikonzentration festgestellt.
B
BAR
Den Ursprüngen und Verästelungen dieses englischen Wortes nachzuspüren ist so amüsant wie lehrreich. Die unterschiedlichsten Lebensbereiche streift man bei dieser Wanderung. So bezeichnet bar im Englischen den Takt in der Musik; aber wenn jemand sagt: »I read for the bar«, heißt das, er studiert Jura. Der Bedeutungen sind viele. Alle lassen sich zurückführen auf das französische la barre: die Stange, aus der die Barriere wurde, das Trennende, Unterteilende. Mittels einer Stange wurde einst im Gerichtssaal der Abstand zum Richtertisch gesichert, woraus sich wiederum der Beruf des barristers ableitete, des Anwalts, der, um sein Plädoyer vorzutragen, an eben diese Stange trat.
Eine starke Stange war gleichfalls nötig, um in öffentlichen Lokalen das Publikum davon abzuhalten, sich an den Getränkeflaschen dahinter kostenlos zu bedienen. Zur Sicherung des Ganzen wurde ein Mann abgestellt, der allein befugt war, einen Drink auszuschenken und dafür zu kassieren. Und damit sind wir endlich beim Thema, lassen uns an der B. nieder, nicken dem bartender freundlich zu. Das Risiko, dass hinter uns einer den Colt zückt und, wie einst im Wildwest-Saloon, auf die gefüllten Whisky-, Brandy- oder Ginflaschen schießt, ist heute eher gering. Die klassische B. ist es, die uns hier interessiert, nicht zu verwechseln mit der Tanzbar, Nachtbar, Animierbar. Es gibt sie als Hotel- oder Restaurantbar und in ihrer reinsten Form: der American Bar.
Cocktails im Ritz Viele Hotelbars sind zur Legende geworden, wie etwa die des Pariser »Ritz«, in der der britische Kronprinz Edward, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald oder Louis Bromfield Stammgäste waren. Der amerikanische Zeitungskolumnist und Satiriker Art Buchwald nannte sie »eine der berühmtesten Trink-Institutionen Frankreichs«. Vor allem waren es die Barchefs im »Ritz«, die in einschlägigen Kreisen Berühmtheit für ihre ➛ Cocktails genossen. Allen voran Frank Meier, Autor des Standardwerks »The Artistry of Mixing Cocktails«, und sein Nachfolger von 1926 bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg, der legendäre Monsieur Bertin.
Einen ähnlichen Ruf behauptet die »Oak Bar« im New Yorker Hotel »Plaza« neben dem Central Park. Der Filmemacher Luis Buñuel, der hier seine Martinis zu sich nahm, pflegte seinen Freunden zu sagen: »Wenn ihr in New York seid und wissen wollt, ob ich da bin, geht mittags in die Oak Bar!« Ähnlich wie in der »Cumberland Bar« am Londoner Hyde Park braucht man allerdings auch in der »Oak Bar« einen Blindenhund, um seinen Platz zu finden; so stockduster erscheint sie im ersten Moment. Weiblichen Gästen war übrigens bis Anfang der 1960er Jahre der Zutritt verwehrt, ob allein oder in Begleitung. Dies hatte die B. mit den meisten englischen Clubs gemein.
Die Restaurantbar kann hier kurz gestreift werden: Ihre wesentliche Funktion ist es, dem Gast die Wartezeit so angenehm wie möglich zu gestalten, bis sein Tisch frei geworden ist.
Die Sehnsucht der Poeten Die American Bar ähnelt nur äußerlich einem irischen oder englischen Pub. Der war und ist zuallererst eine Stätte des Biergenusses. Die American Bar dagegen hat sich dem Genuss von alkoholischen Getränken in jeglicher Form verschrieben, allen voran Cocktails. Und sie ist Kultstätte zahlreicher Geschichten und Legenden, verbreitet in Filmen, Büchern und modernen Wandersagen. Sie beflügelte die Sehnsüchte von zahllosen Poeten und Essayisten. Einer, der sich um das kulturelle Erbe vieler B. ausnehmend verdient gemacht hat, ist Ernest Hemingway. Sowohl die legendäre »Harry’s New York Bar« in Venedig wurde durch ihn berühmt als auch deren Namensvetter in Paris.
Eine echte B. lebt von ihrem Stammpublikum, in Frankreich pilliers de bar (Bar-Säulen), in England und den USA barflies (Bar-Fliegen) genannt. Sie braucht keine protzige Leuchtreklame draußen, keine Neonbeleuchtung drinnen. Eine Musikbox ist entbehrlich, allenfalls ein Sound à la Miles Davis ist angebracht, einsame leise Töne im Hintergrund. Das Klirren der Eiswürfel in den Gläsern ist Musik genug. Die aufgereihten bunten Flaschen hinter dem Barkeeper sind das passende Gemälde. Und er, der Barkeeper, der diesen Namen wirklich verdient, muss seinen Beruf natürlich beherrschen, über Mischungsverhältnisse und Zutaten bei den verschiedenen Drinks schlafwandlerisch Bescheid wissen. Und er sollte leise sein, aufmerksam, keineswegs aufdringlich: Psychologe, Beichtvater und Diplomat in einer Person.
Und der Gast? Es gibt ihn in unzähligen Varianten: redselig, in sich gekehrt, auf Kontakt aus, fröhlich, pessimistisch (meist aber nur bis zum dritten Glas). In einer guten B. wird jeder Typ akzeptiert, sowohl vom Barkeeper wie vom Gast auf dem Nachbarhocker. Nur zwei Dinge sind nicht unbedingt angesagt: Arbeit mit in die B. nehmen und in Akten blättern, endlose Handygespräche führen.
»Eine Bar nimmt einem die Ängste – sogar die vorm Leben«, formulierte unnachahmlich der Schriftsteller Alexander Mai.
BH
Das Kleidungsstück, das den Frauen in vielerlei Beziehung eine unentbehrliche Stütze ist und Jünglingsfantasien seit Generationen angeheizt hat wie kein zweites, wurde von einer Französin erfunden. 1889 meldete Herminie Cadolle (1845-1926) den »Bien-être« (frei übersetzt: Wohlfühler) zum Patent an. Elf Jahre später präsentierte sie ihre Kreation auf der Weltausstellung in Paris. Ihr Trick bestand im Grunde genommen darin, das bisher übliche Korsett in zwei Teile zerlegt zu haben. Jetzt wurde der Busen nicht mehr von unten gestützt, sondern von oben gehalten, mit Seidenbändern und -trägern an Schultern und Rücken befestigt. Das war das revolutionär Neue. Der untere Part war eine Art Korsage für Hüften und Po. An unseren heutigen Maßstäben gemessen, sah das Ganze aus wie ein noch etwas altertümlicher Vorgriff auf den ➛ Bikini. Für damalige Verhältnisse jedoch unerhört und noch nie da gewesen – kein Wunder, dass der »Bien-être« in der Pariser Damen- und Modewelt auf Jahre für Gesprächsstoff sorgte.
Noch heute gibt es das Pariser Modehaus »Cadolle«, Top-Adresse für Lingerie, so das charmante englische und französische Wort für zarte Damenunterwäsche. Speziell für BHs ist es immer erste Wahl geblieben. Der schönen Spionin Mata Hari wurde hier eine Spezialanfertigung aus Metall angepasst, die Modeschöpferin Coco ➛ Chanel verlangte nach einem Modell, das ihren Busen kleiner wirken ließ. Die Herzogin von Windsor, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve – die Namen der Kundinnen lesen sich wie ein »Who’s who« der eleganten Welt. Geführt wird das Haus von Poupie Cadolle, der Ururenkelin der Gründerin. Ende der 90er Jahre wurde sie zur Unternehmerin des Jahres gewählt. Über ihre einfallsreiche, kluge und in unternehmerischer Hinsicht stets wagemutige Ururgroßmutter spricht sie mit dem allergrößten Respekt: »Ihre Tat war eine wahrhaftige Revolution für die Frauen.«
»Brusthalter« und »Frauenleibchen« Auch in Deutschland gab es Bestrebungen, der weiblichen Brust mehr Anmut und Haltung zu verschaffen. 1891 meldete ein gewisser Hugo Schindler sein Patent für den »Brusthalter« an. Dieser hatte zwei an einem Gürtel befestigte Kappen, die oben mit Bändern gehalten wurden. Vier Jahre später präsentierte in Dresden Christine Hardt ihre Erfindung: das »Frauenleibchen als Brustträger«. Es bestand aus zusammengeknüpften Taschentüchern und Männerhosenträgern. Die waren bereits verstellbar. Dann, 1904, trat der Schwabe Wilhelm Meyer-Ilschen auf den Plan. Anonym, weil er sich nicht zum Gespött machen wollte, meldete er eine »Bruststütze ohne Unterteil« zum Patent an. Erst neun Jahre später bekannte er sich zu seinem Werk. So löste das Kleidungsstück peu à peu das unbequeme Korsett ab. Die frühen Exemplare bestanden aus Leinen. Ab den 20er Jahren wurden sie auch aus Seide, Musselin oder Batist hergestellt.
Das erste große Geschäft freilich sollte einer Amerikanerin vorbehalten sein: Etwa zeitgleich mit Hugo Schindler hatte in den USA Mary Phelps-Jacobs einen Ersatz für das beengende Mieder ersonnen: Au zwei Taschentüchern und einigen ge schickt verknüpften Bändern fertigte sie ein Wäschestück, um ihre Brüs te zu bedecken. 1914 ließ sie sich diese Erfindung patentieren und verkaufte das Patent anschließend für die damals sagenhafte Summe von 15 000 Dollar an die Warner Brothers Corset Company. Aufgrund dieser auch von der Presse beachteten Transaktion galt sie lange Zeit als die Erfinderin des bra, wie das zarte Stück in der englischen Sprache heißt. In Deutschland setzte sich etwa ab 1937 das Wortungetüm »Büstenhalter« im Sprachschatz fest; die alsbald häufig benutzte Abkürzung BH klingt wenigstens nicht ganz so unerotisch sperrig.
Spezialanfertigung für Jane Russell Anfang der 40er Jahre kam der berühmteste BH der Filmgeschichte ins Gespräch: Der milliardenschwere Erfinder Howard Hughes drehte als Regisseur den Film »Geächtet« mit Jane Russell. Seinen Konstrukteuren, so die Legende, ordnete er an, einen Spezial-BH für die mit übergroßen Brüsten gesegnete Schauspielerin zu entwickeln. »Wahr an der Geschichte«, so die Russell vor ein paar Jahren in einem »Stern«-Interview, sei aber nur gewesen, »dass er den Garderobenschneider gebeten hat, einen BH zu nähen. Er mochte nämlich meinen nicht, weil man unter dem engen Trikot, das ich dauernd tragen musste, die Nähte sah. Getragen habe ich das Ding nie, das er bauen ließ. Es war viel zu unbequem. Ich habe mir einfach zwei Lagen Kleenex über meinen BH gelegt und damit gespielt. Howard hat es nie bemerkt.«
1947 hatte der BH endgültig über das Mieder gesiegt. Es gab ihn dann in allen Varianten: mit verstärkten Körbchen (erst mit Fischbein-, später mit Metallbügeln unterhalb der Schalen), wattiert, verstärkt, als »Push-up«, ohne Verschluss, mit Verschluss vorne oder hinten. 1952 verkaufte das Unternehmen Triumph als größter Miederwarenhersteller Europas 13 Millionen BHs. Neun Jahre später wurden in Deutschland jährlich 41 Millionen Stück produziert. Ab dem Jahre 1968 ist dann ein vorübergehender Durchhänger zu verzeichnen: Studentenrevolte, Flower-Power- und Frauenbewegung wehrten sich bekanntlich gegen jede Art der Unterdrückung – so auch gegen die Repression und Manipulation der weiblichen Brust. Das hatte erstens öffentliche BH-Verbrennungen zur Folge und zweitens einen erkennbaren Rückgang der Attraktivität des revoltierenden weiblichen Oberkörpers. Dankenswerterweise war diese Phase nur von kurzer Dauer. Ab 1994, mit dem Aufkommen des »Wonderbra«, 105 Jahre nach der Erfindung von Madame Cadolle, ist der BH mehr als nur ein »Bien-être«. Er kann jetzt sogar Wunder vollbringen.
BIENNALE
Die Biennale di Venezia ist ein kulturelles Weltereignis und findet – wie der Name schon sagt – alle zwei Jahre statt. Von der Stadt Venedig Ende des vorletzten Jahrhunderts ins Leben gerufen, ist sie im Lauf der Zeit immer bedeutsamer und internationaler geworden. Die erste »Internationale Kunstausstellung der Stadt Venedig« im Jahre 1895 lockte bereits 224 000 Besucher in die Lagunenstadt. Zunächst standen die bildenden Künste im Vordergrund. 1907 dann begannen einige Länder, im Rahmen der Ausstellung ihre eigenen Pavillons einzurichten. Heute wird ein »Goldener Löwe« für den schönsten Pavillon vergeben. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde die Biennale das Forum für moderne Kunst. Zahlreiche bedeutende Künstler stellten – und stellen – sich in Venedig erstmals einem internationalen Publikum vor. 1931 wechselte die Kontrolle der B. vom venezianischen Stadtrat zur faschistischen Landesregierung in Rom. Sie erweiterte die B. um weitere Kulturbereiche: 1930 das Musik-Festival, 1932 das Internationale Film-Festival und 1934 das Theater-Festival. Nach vierjähriger Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs nahm die B. 1948 ihre Aktivitäten wieder auf und richtete sich mehr und mehr an die Avantgarde. So stand 1950 die abstrakte Malerei im Mittelpunkt, in den 60ern war es die Pop-Art. Bei der Neugestaltung der Ausstellungsflächen zwischen 1948 und 1972 setzte der italienische Architekt Carlo Scapa bemerkenswerte Akzente.
Die 68er-Protestbewegung ließ auch die B. nicht unberührt und stürzte sie in ihre tiefste Krise. Die bislang verliehenen »Großen Preise« wurden abgeschafft. Thematische Schwerpunkte bestimmten die Veranstaltung. Die B. von 1974 beispielsweise widmete sich ganz dem Thema »Chile«, als kulturelles Aufbegehren gegen die Diktatur Pinochets. Neue Preise wie die in verschiedenen Kategorien verliehenen »Goldenen Löwen« wurden ins Leben gerufen, und immer mehr Ausstellerländer beteiligten sich an der B. Auf der 51. Edition im Jahre 2005 präsentierten sich bereits 70 Länderpavillons, viele von so genannten Debütantennationen wie Albanien, Afghanistan, Kasachstan oder Usbekistan. Sechs kulturelle Bereiche stecken heute den Rahmen: Film, Architektur, Musik, Theater, Tanz und zeitgenössische Kunst. Die B., jeweils von Juni bis November, ist alle zwei Jahre ein »Must« im Kalender kulturbegeisterter Menschen.
BIER
Auch wer diesem Getränk mit einer gewissen Distanz gegenübersteht, wird zugeben müssen, dass als Durstlöscher nichts wirkungsvoller ist als ein kühles, frisches Bier. Selbst überzeugteste Weintrinker setzen häufig ein Pils als Schlusspunkt hinter eine ausgiebige Weinprobe. Und für einen Bayern ist B. schlicht ein Nahrungsmittel, was es früher in der Tat einmal war.
Die Geschichte des B. geht auf die Sumerer und Babylonier zurück. Die Germanen haben das B. also keineswegs erfunden, wie das Klischee es will. In römischen Geschichtsbüchern kann man jedoch nachlesen, dass sie die Braukunst mit Hingabe übernahmen. In diesen Vorzeiten wurde B. generell aus Brot hergestellt, das eingeweicht, gekocht und anschließend vergoren wurde. Tacitus erwähnt in seiner »Germania« aber bereits einen Aufguss aus Gerste und Korn. Anfangs existierten die unterschiedlichsten Rezepturen für die Herstellung von Bier; erst zur Zeit Karls des Großen wurden feste Regeln erlassen.
Wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Braukunst gaben zunächst die Klöster. Im 14. Jahrhundert übernahmen die Städte die Vorreiterrolle. So wurde Hamburg 1350 das Brauzentrum für einen großen Teil Norddeutschlands. 1516 bestimmte der Herzog von Bayern, dass für die Herstellung von B. »allein Gersten, Hopfen und Wasser genomen und gepraucht sölle werden«. Dieses zuerst auf Bayern begrenzte so genannte Reinheitsgebot wurde 1871 vom ganzen Deutschen Reich übernommen. Es ist somit das älteste noch heute gültige Lebensmittelgesetz.
Die Iren liegen vorn