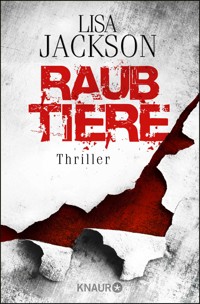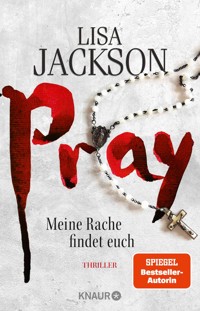9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein San-Francisco-Thriller
- Sprache: Deutsch
Eine skandalumwitterte Familie, eine verhängnisvolle Affäre und ein mörderischer Plan: Bestseller-Autorin Lisa Jackson begeistert mit einem dramatischen Thriller voller unvorhersehbarer Wendungen. Nach einem bösen Streit mit ihrem schwerreichen, notorisch untreuen Freund James Cahill will Megan Travers nur noch weg von dessen Ranch in den Cascade Mountains. Völlig aufgewühlt macht sie sich auf den Weg zu ihrer Schwester, doch dort kommt sie nie an. Als die Detectives Brett Rivers und Wynonna Mendoza James befragen wollen, finden sie ihn mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus vor. James sagt aus, er könne sich an nichts erinnern, weder an Megan noch an seine zahlreichen Affären. Kurz darauf bringen die Morde an zwei Frauen aus seinem Umfeld den Herzensbrecher in Erklärungsnöte … Hochspannung, eine Prise Romantik, jede Menge zwischenmenschliche Verwicklungen und kaltblütige Morde – all das bietet dieser Thriller von Bestseller-Autorin Lisa Jackson. Liar - Tödlicher Verrat ist unabhängig lesbar. Entdecken Sie auch die anderen Thriller von Lisa Jackson, z.B. Showdown - Ich bin dein Tod um zwei Schwestern, die erbitterte Rivalinnen sind, oder Paranoid, worin es um späte Rache in einer ehemaligen Highschool-Clique geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lisa Jackson
LIAR
Tödlicher Verrat
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach einem heftigen Streit mit ihrem untreuen Freund James Cahill will Megan Travers nur noch weg von dessen Ranch in den Cascade Mountains. Völlig aufgewühlt macht sie sich auf den Weg zu ihrer Schwester. Doch dort kommt sie nie an.
Als die Detectives Brett Rivers und Wynonna Mendoza James befragen wollen, finden sie ihn mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus vor. James sagt aus, er könne sich an nichts erinnern, weder an Megan noch an seine zahlreichen Affären. Kurz darauf bringen die Morde an zwei Frauen aus seinem Umfeld den Herzensbrecher in Erklärungsnöte …
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Epilog
Lisa Jacksons Romane bei Knaur
Kapitel 1
Eine abgeschiedene Hütte in den Cascade Mountains, Washington State
10. Dezember
Ich lebe!
Ich lebe noch!
Ich blinzele. Ungläubig. Starre an die Decke, die über mir zu tanzen und zu kreisen scheint.
Mein Körper liegt zitternd auf dem Fußboden.
Zuckend.
Meine Arme und Beine rudern unkontrolliert.
Speichel läuft aus meinem Mund.
Aber man hat mich nicht umgebracht.
Zumindest noch nicht.
Die zwei kleinen Brandmale in meinem Nacken schmerzen. Sie erinnern mich daran, dass ich genauso gut hätte tot sein können, hätte man mir die Mündung einer Pistole auf die Haut gedrückt anstelle der kalten Metallkontakte des Elektroschockers. Dann würde ich jetzt in meiner eigenen Blutlache liegen, mausetot.
Das ist nur eine Frage der Zeit, mahnt mich mein Verstand.
Ich versuche, meinen Blick zu fokussieren. Stöhnend liege ich auf dem Boden des Minihauses, zucke und blinzele. Die gewölbte Decke über dem kleinen Wohnbereich erscheint mir unendlich hoch. Sie schwankt, als ich die Augen darauf hefte.
Ich fixiere die eingebaute Couch mit ihren farbenfrohen Dekokissen, dann betrachte ich die Leiter, die zu der Schlafkoje unter dem Dach führt, aber alles wankt und schwankt und will einfach nicht aufhören, sich zu bewegen. Ich versuche, mich auf eine Sache zu konzentrieren: die Tür, die nach draußen führt. Meine einzige Chance zu entkommen, aber die Tür ist geschlossen und wackelt ebenfalls.
Lieber Gott, bitte steh mir bei.
Für eine Sekunde schließe ich die Augen, versuche, das Zittern zu unterdrücken, doch es gelingt mir nicht, meinen Körper unter Kontrolle zu bringen.
Klack, klack, klack.
Schritte! Die Dielen vibrieren. Stiefelabsätze auf dem Hartholzboden erinnern mich daran, dass ich nicht allein bin.
Es kostet mich große Anstrengung, meinen zitternden Hals anzuheben und den Kopf zur Seite zu drehen, damit ich meinen Entführer sehen kann, der etwas in den kleinen Kühlschrank stellt.
»Warum?«, versuche ich hervorzustoßen, aber über meine Lippen dringt nur ein gequältes Stöhnen. »Warum?« Ich probiere es noch einmal, aber die Person, die mich in die Falle gelockt hat, antwortet nicht. Stattdessen knallt sie die Kühlschranktür zu, wirft einen letzten Blick auf meinen bebenden Körper, steigt über mich hinweg und öffnet die Hüttentür.
Ein Schwall winterkalter Luft weht herein, begleitet von ein paar Schneeflocken. Nein!, möchte ich schreien, doch heraus kommt ein lang gezogenes »Nnniiiööö!«. Es klingt wie ein Schrei der Verzweiflung, ein animalischer Laut, unverständlich.
Aber mein Entführer versteht ihn.
Zögert für den Bruchteil einer Sekunde.
Dann tritt er zur Tür hinaus und zieht sie fest hinter sich zu.
Wumm!
Ich versuche, darauf zuzukriechen.
Klick!
Das Schloss rastet ein.
Hat mich mein Entführer wirklich hier eingeschlossen? Oder habe ich mich verhört? So grausam kann doch niemand sein!
Verlass mich nicht!, flehe ich stumm, während ich den Mund öffne und schließe wie ein Barsch auf dem Trockenen. Wie kannst du das nur tun? Hast du nicht geschworen, dass du mich liebst? Wie kannst du mich hier zurücklassen?
Der Verrat zerreißt mir das Herz. Ich spüre Galle in meiner Kehle. Verzweifelt unternehme ich einen weiteren Versuch, das unablässige Muskelzittern unter Kontrolle zu bekommen.
Reiß dich zusammen! Tu etwas!
Ich versuche aufzustehen. Es gelingt mir, die Füße anzuziehen, doch als ich mich hochrappeln will, rutschen meine Schuhsohlen weg, und ich sacke zurück auf den Fußboden.
Über das panische Hämmern meines Herzens hinweg höre ich knirschende Schritte im vereisten Schnee, dann das Piepen einer Autofernbedienung.
Tu’s nicht! Bleib!
Ich robbe zur Tür, strecke den Arm aus und gebe mir große Mühe, den Knauf zu erreichen. Vergeblich.
Mit all der Kraft, die ich aufbringen kann, versuche ich es erneut, und diesmal gehorchen meine Muskeln, ich bekomme das kalte Metall zu fassen. Ächzend ziehe ich mich hoch und lehne mich schwer atmend gegen den Türrahmen.
Als ich mich anschicke, den Knauf zu drehen, erwacht draußen ein Motor zum Leben. Der Knauf bewegt sich nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Tatsächlich. Ich habe mich nicht verhört. Wirklich abgeschlossen.
Verdammt!
Tränen schießen mir in die Augen. Ich schleppe mich zur Leiter. Für eine Sekunde gerate ich ins Wanken. Meine Muskeln zucken. Ich beiße die Zähne zusammen. Vorsichtig einen Fuß nach dem anderen setzen. Ich rutsche aus. Halte mich an der Leiter fest. Presse die Kiefer zusammen, damit meine Zähne nicht so heftig klappern, dann steige ich langsam Sprosse für Sprosse hinauf, bis ich durch eines der fünf schmalen Fenster direkt unterhalb der Decke blicken kann.
Hinter der Scheibe sehe ich in den Scheinwerferkegeln die tief verschneite Lichtung, umgeben von hohen Tannen, deren Zweige schwer sind von Eis und Schnee. Ich sehe das Auto, das die einspurige, unbefestigte Zufahrt hinunterfährt, die Rücklichter zwei leuchtend rote Punkte vor der in Dunkelheit gehüllten weißen Landschaft.
Tieftraurig und verletzt blicke ich dem Wagen hinterher.
Hör auf damit! Diese Person hat es nicht verdient, dass du ihretwegen traurig bist. Du solltest lieber wütend werden, verdammt noch mal!
Endlich lässt das Zittern ein wenig nach, und prompt fühle ich, wie Zorn in mir aufsteigt. Meine Finger umschließen die oberste Leitersprosse so fest, dass die Knöchel weiß hervortreten. Das Motorengeräusch wird leiser.
»Ich kriege dich«, schwöre ich. Meine Worte klingen heiser, aber zumindest verständlich. Der Wagen verschwindet zwischen den Bäumen, die Heckleuchten blinken noch einmal zwischen den Ästen auf, zeichnen blutrote Pfützen in den Schnee. »Damit kommst du nicht davon.«
Dafür werde ich sorgen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Kapitel 2
Cascade Mountains
1. Dezember
Du Mistkerl!« Mühsam gegen die Tränen ankämpfend, hämmerte Megan aufs Lenkrad ihres kleinen Toyotas, dann gab sie Gas. Die Reifen drehten durch, Schnee und Kies spritzten auf, als sie ruckartig zurücksetzte, den Gang einlegte und die lange Zufahrt entlangraste, die von James Cahills Farmhaus zur Straße führte. Die Lichtkegel ihrer Scheinwerfer glitten über die schneebedeckte Landschaft. Dieser verfluchte Betrüger! Und als säße er neben ihr auf dem Beifahrersitz, tobte sie weiter: »Wie konntest du nur? Wie zur Hölle konntest du mir das antun?«
Sie hätte nicht überrascht sein dürfen.
Einmal ein Betrüger, immer ein Betrüger.
Warum hatte sie erwartet, dass er zu ihr stehen würde, der Mann, den sie für die Liebe ihres Lebens gehalten hatte, für ihren Seelenverwandten, für den »Einen«, wenn man denn an diesen romantischen Unsinn glaubte? War doch klar, dass er früher oder später sein wahres Gesicht zeigen und sich als untreues Arschloch entpuppen würde.
Energisch blinzelte sie gegen die Tränen an, die ihre Wangen hinabrollten. Sie erreichte die Landstraße, bog knapp vor einem Schneepflug auf die rechte Spur ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch den dunklen Abend Richtung Stadt, mit dem Handrücken immer wieder über ihr nasses Gesicht wischend. Zaunpfosten und Felder, umhüllt von einer weißen Decke, zogen verschwommen an ihr vorbei. Vor einem Stoppschild bremste sie ab, riss das Lenkrad herum und raste nach Westen, um das Zentrum von Riggs Crossing zu umfahren und sich durch die nahezu menschenleeren Nebenstraßen dieser verschlafenen Kleinstadt zu schlängeln. Hier lebten lauter brave, gottgefällige Einwohner, aber Megan wusste so gut wie jeder andere, dass der äußere Schein nicht selten trog.
Aus dem Augenwinkel bemerkte sie eine ältere Dame, die einen kleinen schwarzen Scottish-Terrier mit Pullover Gassi führte. Unter ihrer roten Baskenmütze schauten graue Löckchen hervor. Als Megan an ihr vorbeizischte, blieb sie unter einer Straßenlaterne stehen, schüttelte den Kopf und drohte ihr mit dem Finger. Gleichzeitig machte sie mit der anderen Hand eine beschwichtigende Geste, um ihr zu bedeuten, dass sie langsamer fahren solle.
Megan interessierte das nicht. Im Gegenteil – sie musste sich große Mühe geben, der Frau nicht den Mittelfinger zu zeigen. Es gelang ihr gerade noch, sich zu beherrschen.
Kein Grund, so auszuflippen.
Auch wenn ihr Herz gebrochen war und in ihrem Inneren ein absolutes Gefühlschaos herrschte.
Warum, warum, warum war sie so dumm gewesen, sich in James Cahill zu verlieben? Sie hätte es doch besser wissen müssen. »Unsinn.« Sie hatte es besser gewusst. Im Rückspiegel sah sie, wie die ältere Dame ihr Handy aus der Tasche zog, vermutlich um die Neun-eins-eins zu wählen und eine unberechenbare Autofahrerin zu melden, die die für gewöhnlich so ruhigen, idyllischen Sträßchen von Riggs Crossing, der gemütlichen Kleinstadt inmitten der Berge im Bundesland Washington, unsicher machte.
Pech.
Trotzdem nahm sie den Fuß vom Gas.
Wollte keinen Strafzettel riskieren. Durfte keinen Strafzettel riskieren.
Sie war nicht blind, sie hatte gesehen, wie James die Neue im Café angestarrt hatte. Genau so hatte er einst sie angeschaut. Was hatte sie erwartet? Wusste sie nicht aus persönlicher Erfahrung, wie leicht man James den Kopf verdrehen konnte? Die Frauen flogen nur so auf ihn, einen hochgewachsenen, gut aussehenden Kerl mit einem draufgängerischen Lächeln, das selbst das argwöhnischste Herz erobern konnte. Auch wenn sie nicht mal ahnten, wie reich er war und wie reich er sein würde, wenn er den Rest seines Anteils am gigantischen Familienvermögen erbte, verliebten sie sich reihenweise in ihn.
Genau wie sie selbst.
»Du bist so ein Dummkopf«, schalt sie sich nicht zum ersten Mal.
Oh, sie konnte es kaum erwarten, zu ihrer Schwester nach Seattle zu kommen. In Rebeccas Wohnung würde sie sich eine Flasche Wodka zu Gemüte führen und den Bastard vergessen.
»Verlogener Weiberheld«, knurrte sie.
Er gehörte zu ihr!
Kapierte er das denn nicht?
Vielleicht noch nicht.
Aber er würde es kapieren, und zwar schon bald, dafür wollte sie sorgen.
Doch dazu musste sie erst einmal verschwinden.
Damit er sie vermisste.
Damit er zutiefst bereute, dass er sie betrogen hatte.
Ja, das war das Geschickteste.
Das würde sie tun. Für eine Weile untertauchen, bei ihrer Schwester.
Schniefend wischte sie sich erneut die Tränen ab, dann umfasste sie das Lenkrad noch fester. So fest, dass ihre Finger schmerzten, als sie aus der Stadt hinausfuhr und die umliegenden Berge ansteuerte. Es schneite heftiger. Megan stellte die Scheibenwischer an.
Rebecca erwartete sie.
Ihre Schwester. Gott sei Dank. Sie konnte sich kaum noch vorstellen, dass James sich zuerst für Rebecca interessiert hatte. Und – wer hätte das gedacht? – auch Rebecca, die Eiskönigin, hatte sich in ihn verliebt.
Zum Glück war sie über ihn hinweg.
Schon lange.
Oder etwa nicht?
Egal, redete Megan sich ein und blinzelte mit trotzig vorgerecktem Kinn durch die Windschutzscheibe. Schneeflocken wirbelten und tanzten im Scheinwerferlicht. Ihre Schwester hatte den Verlust bestimmt schon verschmerzt. Sie war schon immer hart im Nehmen gewesen.
Rebecca.
Ihre große Schwester. Sie würde wissen, was zu tun war.
Das wusste sie immer. Und wie immer würde Rebecca Megan mit eiserner Entschlossenheit helfen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Rebecca war Megans Fels in der Brandung. Ganz gleich, welche Gefühle ihre Schwester für James auch hegen mochte.
Megan verspürte einen Anflug von schlechtem Gewissen. Wie oft hatte sie sich schon auf ihre Schwester verlassen? Wie oft war sie heulend zu Rebecca gerannt, und wie oft hatte ihr diese schon geholfen? Sogar als …
Das schlechte Gewissen wuchs, wenngleich es vermutlich sogar noch um einiges größer hätte sein sollen. Sehr viel größer. Sie betrachtete ihr Konterfei im Rückspiegel.
Rot geränderte blaue Augen, die nicht unbedingt reuevoll dreinblickten. Wenn sie noch einmal hätte entscheiden, das Unrecht hätte wiedergutmachen können – sie hätte es nicht getan. Megan biss sich auf die Unterlippe und verbannte die Vorstellung aus ihrem Kopf. Ihr kleiner Wagen kämpfte mit der Steigung. Sie war kein schlechter Mensch. Nicht wirklich. Und James … Ach Gott, James …
Ein Kloß bildete sich in ihrer Kehle. Der Corolla legte Meter um Meter bergauf zurück. Je höher sie kam, desto dichter wurde der Schneefall, eine weiße Schicht bedeckte den Asphalt, am Straßenrand türmten sich Schneehaufen, die ein Schneepflug dorthin geschoben hatte. Megan stellte die Heizung höher und schaltete die Scheibenlüftung ein, weil die Fenster beschlugen.
Nichts tat sich.
Die Lüftung war defekt. Seit Wochen schon.
»Verdammt.« Sie nahm die gebrauchte Serviette aus dem Coffeeshop aus dem Becherhalter und wischte den Beschlag weg, so gut sie konnte, dann spähte sie angestrengt hinaus in die Dunkelheit.
So spät am Abend herrschte nur wenig Verkehr. Bald darauf war sie allein auf der kurvigen Bergstraße und schraubte sich mit jaulendem Motor immer höher in die tief verschneiten Cascade Mountains hinauf. »Komm schon«, feuerte sie ihren Corolla mit zusammengebissenen Zähnen an und trat fester aufs Gas. »Komm schon!« Die Sicht war inzwischen gleich null. Nichts als ein Vorhang aus Schneeflocken vor der beschlagenen Scheibe. Sie griff erneut nach der Serviette. Anscheinend war sie mitten in einen Schneesturm geraten.
»Großartig.«
Sie dachte wieder an James, und ihr Herz zog sich schmerzerfüllt zusammen. Eine Flut von Erinnerungen überrollte sie, und abermals flossen Tränen. Sie gab Gas, um auf der steilen Straße die nächste scharfe Kurve zu nehmen.
Ihre Reifen drehten durch.
Der Wagen geriet ins Rutschen.
Hastig nahm sie den Fuß vom Pedal. »Reiß dich zusammen«, murmelte sie, als sie den Wagen wieder unter Kontrolle hatte und sich weiter bergauf kämpfte. Millionen Flocken wirbelten vor ihr im Scheinwerferlicht.
Ihre letzte Auseinandersetzung war die schlimmste gewesen. Noch nie zuvor waren Zorn und hässliche Worte in körperliche Gewalt umgeschlagen, doch heute Abend war ihre Wut außer Kontrolle geraten.
Weitere Tränen.
Tränen, die sie blind machten, genau wie ihr Zorn.
Sie schüttelte den Kopf, um die Erinnerung zu vertreiben, und wischte noch einmal über die beschlagene Scheibe. Plötzlich ging es steil bergab.
»Herrje!«
Sie erstarrte.
Sah eine weitere Kurve auf sich zukommen, eng wie eine Serpentine.
Automatisch trat sie auf die Bremse.
Die Hinterreifen drehten durch.
Der Corolla traf auf Eis und fing an, langsam, aber stetig zu kreisen.
»Nein … nein, nein, nein!« Sie befand sich hoch oben in den Bergen, auf einer Seite die steile Felswand, auf der anderen die Gipfel der riesigen Tannen, die an den Abhängen der tiefen Schlucht neben ihr emporwuchsen. »O Gott!« Sie nahm den Fuß von der Bremse, gab auch kein Gas, lenkte nicht, machte gar nichts … So reagierte man doch in einer solchen Situation, oder? Sollte man sich nicht einfach drehen lassen, ohne dagegen anzulenken? Ihr Herzschlag dröhnte in ihren Ohren.
Wie in Zeitlupe sah sie den Straßenrand auf sich zukommen, die hohen Schneehaufen, die die Leitplanke verdeckten, sofern es denn eine gab.
Bleib ruhig, Megan. Keine Panik. KEINE Panik!
Ein Schrei löste sich aus ihrer Kehle.
Auf einmal fanden alle vier Räder gleichzeitig Halt, und sie hatte wieder Kontrolle über den Wagen.
Halleluja!
Nervös leckte sie ihre trockenen Lippen. Das war knapp gewesen! Verdammt knapp! Erleichtert stieß sie die Luft aus, konzentrierte sich auf die Straße vor ihr und verbannte den Streit mit James aus dem Kopf. Sie musste jetzt kurz vor dem Gipfel sein. Noch ein paar Meilen, dann ginge es bergab.
Raus aus dem Schneesturm.
Nach Seattle.
Zu Rebecca.
Dort konnte sie zur Ruhe kommen.
Als sie den höchsten Punkt der Straße hinter sich hatte, nahm der kleine Wagen Geschwindigkeit auf.
Megan trat auf die Bremse und umklammerte das Lenkrad.
Konzentrier dich!
Noch eine Kurve. Der Corolla wurde immer schneller.
Brems!
Doch der Wagen raste bergab, wie angezogen von der Schwerkraft. Die beschlagene Windschutzscheibe sah aus, als wäre sie aus Milchglas.
Megan trat fester auf die Bremse und nahm schlitternd eine Kurve.
Nur noch ein paar Meilen, dann hätte sie es geschafft.
O Mist, was ist das? Mitten auf der Straße? In der nächsten Kurve? Nein!
Mit zusammengekniffenen Augen spähte sie durch den schmalen Spalt, den sie mit der Serviette freigewischt hatte.
Auf der Straße vor ihr bewegte sich etwas.
Etwas, das sich groß und dunkel von dem weißen Vorhang aus Schneeflocken abhob.
Ein Reh? Ein Elch? Ein anderes Wildtier?
Die Kreatur sprang zur Seite.
Auf zwei Beinen?
»Verdammt!«
Ein Mann? Eine Frau? Ein Bigfoot?
Jetzt trat der Schemen wieder auf die Straße.
Ein Mensch. Definitiv ein Mensch.
Was zum Teufel …?
»He!«, schrie Megan und trat auf die Bremse. »Idiot!«
Der Wagen geriet ins Rutschen.
Nein!
Begann, sich zu drehen.
Schneller und schneller.
Sie schaltete in einen niedrigeren Gang.
Doch es war zu spät. Der Toyota brach zur Seite aus. Durch die Windschutzscheibe sah sie, wie der Straßenrand mit dem steilen Abgrund dahinter auf sie zukam. Und mitten auf der Straße stand noch immer die dunkle Gestalt. Ein hirnverbrannter Spinner. »Scheiße, Scheiße, Scheiße!« Sie versuchte zu lenken, vergeblich. Die vordere Stoßstange streifte die Felswand, und der Wagen kreiselte wieder in Richtung Schlucht.
Es war vorbei.
Durch das beschlagene Glas sah sie, wie die verschneiten Baumwipfel im Scheinwerferlicht auftauchten, dahinter lauerten die schwarzen Tiefen des Canyons.
So würde sie also sterben – durch die Luft geschleudert in ihrem kleinen Auto, über die Baumwipfel, bis sie schließlich im eisigen Wasser des Flusses am Grund der Schlucht mehr als hundert Meter unter ihr landete.
Du lieber Gott!
Eines der Räder fand Halt.
Entgegen allen Ratschlägen, befeuert von Adrenalin, riss Megan am Steuer und lenkte gegen.
Weg vom Abgrund.
Der Wagen drehte sich. Nun zeigte die Front direkt auf die massive Felswand.
Auf der Straße war niemand zu sehen.
Wo war die finstere Gestalt?
Ihr blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt ging es nur darum, den Toyota gerade zu ziehen und – wenn möglich – die Geschwindigkeit zu verringern.
Die graue Wand aus Eis und Stein raste unaufhörlich auf sie zu.
Megan wappnete sich.
Bamm!
Der Corolla prallte gegen den Felsen.
Der Sicherheitsgurt straffte sich.
Sie schloss die Augen.
Hörte, wie die Stoßstange zerknautschte, dann das grässliche Ächzen von sich zusammenschiebendem Metall und berstendem Plastik. Die Windschutzscheibe zersprang.
Etwas flog nach vorn und zerschmetterte den Rückspiegel.
Gleich würde der Airbag aufgehen.
Der Wagen kam schlingernd zum Stehen.
Megan flog nicht durch die Luft. Wurde auch nicht vom Airbag in den Sitz gedrückt.
Stattdessen senkte sich Stille auf sie herab.
Eine plötzliche, ohrenbetäubende Stille.
Sie war am Leben.
Auf wundersame Weise unverletzt.
Ungläubig starrte sie auf ihre Finger, die noch immer das Lenkrad festhielten. Sie löste vorsichtig einen nach dem anderen und atmete tief aus. Ihre Hände zitterten, ihr ganzer Körper bebte.
Nimm dich zusammen. Es geht dir gut.
Sie blickte durch die zersprungene Scheibe und versuchte, ihr wild galoppierendes Herz zu beruhigen, sich zu konzentrieren.
Der Wagen. Kann er noch fahren?
War es möglich, dass sie so viel Glück hatte?
Sie drehte den Schlüssel, hörte den Anlasser. »Komm schon, na los.« Wenn sie den Toyota zum Laufen brachte, konnte sie ihn zumindest so zurücksetzen, dass er nicht mehr quer auf der Straße stand. Vielleicht konnte sie sogar in den Leerlauf schalten und bergab rollen, vorausgesetzt, die Bremsen funktionierten. So lange, bis sie sich wieder in der Zivilisation befand. Sie würde ihre Schwester anrufen …
Anrufen? Wo war eigentlich ihr Handy? Ihr Blick schweifte durchs Wageninnere, doch dann fiel ihr ein, dass etwas gegen den Rückspiegel gesegelt war. Ihr Smartphone? Verzweifelt tastete sie den Beifahrersitz ab, der nass war von verschüttetem Kaffee, doch außer ihrem Rucksack und ein paar Sachen, die sie hastig in den Wagen geworfen hatte, fand sie nichts.
Kein Handy.
Nervös bückte sie sich und suchte den Fußraum ab. Abfall und zwei Paar Schuhe und …
Verdammter Mist!
Egal. Erst einmal solltest du den Wagen von der Fahrbahn steuern, damit dir nicht irgendwer in die Seite fährt. Ein Schneepflug oder ein anderer Wahnsinniger, der nachts bei diesem Schneesturm in den Bergen unterwegs war.
Sie drehte den Zündschlüssel erneut. Der Anlasser leierte, aber nichts passierte.
»Nun komm schon!«
Ein weiterer Versuch, und der Motor sprang tatsächlich an. Im selben Moment nahm sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Im zersplitterten Glas des Rückspiegels sah sie eine verzerrte dunkle Gestalt wie in einem Spinnennetz.
Ihre Kehle wurde knochentrocken.
O Gott. Die Person, die sie vorhin gesehen hatte.
Der Grund für ihren Unfall.
Sie starrte in den Spiegel und versuchte zu erkennen, welcher Idiot für dieses Desaster verantwortlich war. Der dämliche Spinner war jetzt hinter dem Wagen – kaum zu erkennen, aber er war definitiv da. Jetzt ging er zur Straßenmitte.
Als wolle er ihr erneut den Weg verstellen.
Erneut ihrer beider Leben in Gefahr bringen.
Zorn stieg in Megan auf. Welcher Schwachkopf würde …
Jegliche Vorsicht in den Wind schlagend, stieß sie die Tür auf. »Bist du verrückt geworden?«, schrie sie und verrenkte sich beinahe den Hals, um ihn besser sehen zu können. »Geh aus dem Weg! Was zum Teufel stimmt nicht mit dir?«
Keine Reaktion.
Eiskalter Wind schlug Megan entgegen.
Nichts regte sich, bis auf die wirbelnden Schneeflocken.
Die Gestalt war nirgendwo zu sehen.
Megan erstarrte. Sie lauschte angestrengt, doch außer dem Heulen des Windes und dem angestrengten Rasseln des Motors war nichts zu hören.
Ihre Nackenhärchen sträubten sich.
Hatte sie sich das alles etwa nur eingebildet?
Nein, das konnte nicht sein.
Sie zog die Tür zu und wollte gerade zurücksetzen, als sie die Gestalt wieder erblickte. Mitten auf der Straße … abermals. Beinahe so, als wolle sie sie verspotten.
Wer um alles auf der Welt mochte das sein?
Es ist doch völlig egal, wer das ist. Auf alle Fälle ist das Ganze schrecklich unheimlich. Und ganz bestimmt nicht gut. Sieh zu, dass du dich aus dem Staub machst, und zwar schnell!
Sie kämpfte gegen die Furcht an, die immer stärker in ihr aufwallte.
Was, wenn die Person mitgenommen werden möchte? Wer weiß, ob sie hier in der Nähe stecken geblieben ist, bei diesem Sturm war alles möglich …
»Wen interessiert’s?«, murmelte sie. Zumal es nicht danach aussah, als würde der Spinner Hilfe benötigen.
Sie tippte mit der Stiefelspitze aufs Gas.
Der demolierte Wagen machte einen Satz nach vorn, die Reifen drehten durch.
»Bitte nicht«, murmelte sie und verspürte einen neuerlichen Anflug von Panik. Sie musste hier weg, sofort.
Im Seitenspiegel sah sie, wie die Gestalt auf sie zukam. Definitiv ein Mensch, ganz in Schwarz gekleidet.
Sie drückte das Gaspedal durch. »Nun mach schon!«
Die Person kam näher. Jetzt konnte sie die Skikleidung erkennen, inklusive Maske und Mütze.
Megan ging vom Gas, dann trat sie das Pedal erneut durch. Das Heck fing an zu rutschen, aber die Reifen fanden keinen Halt.
Die Gestalt in Schwarz stand nun direkt an der Fahrertür. Megan wollte soeben losbrüllen und dem Schwachkopf die Leviten lesen, als sie die Waffe sah – eine schwarze Pistole in einer schwarz behandschuhten Hand.
Ach du liebe Güte!
Sie schüttelte den Kopf, hoffte verzweifelt, der Wagen würde endlich losrollen, doch nichts tat sich.
Megans Herz hämmerte vor Furcht.
»Steig aus!«, hörte sie den Angreifer knurren.
Megan erstarrte.
Die Stimme!
Sie kam ihr bekannt vor. War sie diesem Irren etwa schon einmal begegnet?
Sie wusste es nicht, wusste nur, dass sie in die Mündung seiner Pistole blickte.
Schwarz.
Tödlich.
Und direkt auf ihr Herz gerichtet.
Kapitel 3
Valley General Hospital, Riggs Crossing, Washington
4. Dezember
Ich muss hier weg.« James Cahill warf der Krankenschwester, die seinen Infusionsbeutel herrichtete, einen durchdringenden Blick zu. Es gefiel ihm gar nicht, im Bett zu liegen und zum Nichtstun verdonnert zu sein. Die Krankenhauswände schienen ihn zu erdrücken. Hinzu kam, dass er sich an nichts erinnern konnte, und das brachte ihn schier um.
»Sie werden zu gegebener Zeit entlassen«, versicherte ihm die Schwester freundlich und lächelte ihn aufmunternd an. »Sonja Rictor, examinierte Fachpflegekraft« stand auf dem Namensschild an dem Schlüsselband, das sie um den Hals trug. Schlank, um die vierzig, ein wissendes Lächeln auf den Lippen, die roten, lockigen Haare von einer Spange aus dem Gesicht gehalten, ein paar Sommersprossen auf der Stupsnase. Sie war eine durchaus attraktive Frau. Und, so vermutete er, ausgestattet mit einem eisernen Willen, der sich hinter ihrem einfühlsamen Gesichtsausdruck verbarg.
»Ich denke, die gegebene Zeit ist jetzt.« Er musste sich alle Mühe geben, sie nicht beim Handgelenk zu packen und zu schütteln, um zu unterstreichen, dass er es ernst meinte. Er war immer schon ein wenig klaustrophobisch gewesen, dazu voller Energie, zumindest daran erinnerte er sich. Wobei er nicht klar sagen konnte, ob Letzteres ein Fluch oder ein Segen war. In ein Krankenzimmer eingesperrt zu sein, war definitiv nicht sein Ding.
»Ich verstehe.«
»Tatsächlich?«
Sie warf ihm einen »Es gibt nichts, was ich nicht schon gehört habe«-Blick zu, der ihn vermutlich zum Schweigen bringen sollte, auch wenn sie damit das genaue Gegenteil bewirkte.
»Mr Cahill …«
»James. Nennen Sie mich James«, sagte er, wenig interessiert an Formalitäten.
»Ich werde mit dem Arzt reden, James.«
Er spürte ein kurzes Piksen, als sie die Nadel erneuerte, aber er zuckte nicht zusammen, wollte nicht wirken wie ein Waschlappen.
»Er wird Sie entlassen, sobald Sie so weit sind.« Sie schüttelte den Kopf. »Glauben Sie mir, wir behalten die Patienten nicht länger da als unbedingt nötig.« Sie trat ein paar Schritte vom Bett zurück und fragte: »Wie sieht es mit den Schmerzen aus?«
»Es geht schon.«
»Wo würden Sie Ihren Schmerz auf einer Skala von null bis zehn ansiedeln, wenn zehn die höchste Stufe ist?« Sie deutete auf die Wand, an der ein Schaubild mit zehn verschiedenen Gesichtern hing. Neben der Null sah James ein grinsendes Gesicht, neben der Zehn eine knallrote, schmerzverzerrte Grimasse. »Wenn Sie sagen, ›Es geht schon‹, meinen Sie damit, dass Sie sich so fühlen?« Sie deutete auf das ruhige, entspannt dreinblickende Gesicht neben der Nummer zwei. »Oder eher so?« Sie tippte mit ihrem in medizinischen Plastikhandschuhen steckenden Zeigefinger auf ein schwitzendes Gesicht mit in tiefe Falten gelegter Stirn neben der Acht.
James setzte sich im Bett auf und verspürte ein heftiges Stechen in der Schulter. Verdammt. »Es geht mir gut.«
»Selbstverständlich.« Ungläubig.
»Doch, ganz bestimmt. Es ist alles okay.«
»Das wage ich zu bezweifeln.« Ihre Augenbrauen schossen in die Höhe. »Und? Wie hoch schätzen Sie nun Ihre Schmerzstufe ein?«
»Fünf … vielleicht sieben. Ja, eine Sieben.« In Wirklichkeit höher, aber er wollte sich nicht eingestehen, wie schlecht es ihm tatsächlich ging. Hasste es, wenn er nicht alles unter Kontrolle hatte.
»Hm.« Sie kaufte ihm seine vorgetäuschte Tapferkeit nicht ab, so viel stand fest. »Es gibt keinen Grund, den Helden zu spielen.«
»Ein Held bin ich ganz bestimmt nicht«, versicherte er ihr. Das war nicht gelogen, sondern eine der Sachen, die er mit Bestimmtheit über sich wusste – etwas, woran er sich erinnerte, auch wenn alles andere weg zu sein schien, vor allem das, was vor Kurzem passiert war.
»Ich werde Ihnen etwas geben, was die Schmerzen erträglicher macht«, versprach sie, streifte ihre Handschuhe ab und warf sie in den Mülleimer neben der Tür.
»Warten Sie!«, sagte er, als sie nach dem Knauf griff. »Wie lange bin ich schon hier?«
»Heute ist Sonntag. Sie wurden am Donnerstagabend eingeliefert.«
Ich bin schon seit drei Tagen hier? Er hatte nicht gemerkt, wie die Zeit verstrichen war, erinnerte sich lediglich daran, dass immer wieder Leute sein Zimmer betreten und wieder verlassen hatten, was ihn nervte, weil sie ihn nicht schlafen ließen, sich ständig erkundigten, wie es ihm ging, ihm Nadeln in die Venen stachen oder sonst wie quälten.
Jetzt verriet ihm ein Blick auf die Digitaluhr über der Tür, dass es kurz nach zwei Uhr am Nachmittag war. Der Himmel hinter der Fensterscheibe war trüb und grau.
»Ich werde mit Dr. Monroe reden«, versprach Sonja Rictor, bevor sie das Zimmer verließ. »Er hat an diesem Wochenende Dienst.«
Zweieinhalb Tage seines Lebens – einfach weg. Verschwunden im schwarzen Loch seiner Erinnerung. Was war passiert? James hatte keinen blassen Schimmer, warum er hier war, auch wenn er davon ausging, dass man ihm das mitgeteilt hatte. Er meinte, sich vage zu erinnern, dass ein Arzt mit ihm gesprochen hatte, doch der Name wollte ihm partout nicht einfallen, genauso wenig wie die Diagnose. Wenn das Gespräch überhaupt stattgefunden hatte.
Anscheinend hatte er sich an der Schulter verletzt. Sie schmerzte höllisch, ganz gleich, was er der Schwester erzählt hatte. Auch seine Brust tat weh – ein scharfer, stechender Schmerz, sobald er sich bewegte, vermutlich gequetschte oder gebrochene Rippen. Und dann war da noch der ominöse Verband um seinen Kopf. Wange und Kinn schmerzten ebenfalls, wenn er darüber strich.
Er sah sich um.
Das Krankenzimmer war klein – ein Bett, ein Fernseher oben an der Wand, ein Plastikstuhl neben der Heizung unter dem Fenster. Die Aussicht war nicht gerade berauschend – freier Blick auf einen Parkplatz. Ein paar Fahrzeuge standen auf der großen Fläche verstreut, auf allen sammelte sich der Schnee, der unablässig vom Himmel fiel. Auch auf dem Asphalt lag eine dicke, weiße Decke, durchbrochen von vereinzelten Reifenspuren.
War er in einen Autounfall verwickelt gewesen? In eine Kneipenschlägerei? War er gestürzt? Was war geschehen? Er veränderte seine Liegeposition, zuckte zusammen und versuchte, sich zu erinnern, aber es ging nicht. Was nicht zuletzt mit der einsetzenden Wirkung des Schmerzmittels zusammenhing, das ihm die Schwester in den Tropf getan hatte.
Egal.
Er musste hier raus. So oder so. Musste nach Hause in sein altes Farmhaus. Er besaß eine Farm für Weihnachtsbäume und ein Hotel, das wusste er, außerdem einen Laden für Weihnachtsartikel und ein Café – »Cahills Weihnachtswelt« –, dazu eine Fertigungsfirma für Tiny Houses, und das alles auf seinem Land hinter der Stadtgrenze.
Er rieb sich die Augen.
Fühlte sich, als hätte er keinen klaren Kopf mehr gehabt seit … seit … Herrgott, warum konnte er sich nicht erinnern? Er drückte auf einen Knopf am Bettgestell und fuhr die Rückenlehne so weit hoch, dass er sich im Spiegel über dem kleinen Waschbecken sehen konnte. Er erkannte sich kaum wieder. »Herrje«, flüsterte er erschrocken. Sein für gewöhnlich wettergebräuntes Gesicht war bleich und wirkte ausgemergelt unter dem Drei-, wenn nicht gar Viertagebart. Die Augen lagen tief in den Höhlen, die braunen Haare standen dort, wo sie nicht unter dem Verband verschwunden waren, wirr von seinem Kopf ab. Auf der linken Wange entdeckte er tiefe Kratzspuren wie von einer Raubtierkralle. Als hätte er den Kampf mit einem Puma verloren …
Die alte Pointe, Du solltest erst mal den anderen Kerl sehen, ging ihm durch den Kopf, doch er brachte nicht einmal ein schiefes Grinsen zustande. Denn er wusste, dass es keinen anderen Kerl gab. James wusste, dass Kampfspuren wie diese für gewöhnlich von Frauen stammten. Das war gar nicht gut.
»Verdammt noch mal, Cahill«, stöhnte er und ließ sich zurück in die Kissen fallen.
Hatte er wirklich mit einer Frau gekämpft?
Er schloss die Augen.
Eine Erinnerung, glühend heiß und finster, drängte an die Oberfläche: Das zornverzerrte Gesicht einer Frau tauchte aus den Tiefen seines Gedächtnisses auf, dann verschwand es wieder.
Das alles war völlig daneben.
Verkehrt.
Er beschloss, aufzustehen, und schlug gerade die Bettdecke zurück, als die Tür aufging und ein glatzköpfiger Mann jenseits der vierzig und mit einem gepflegten, grau melierten Kinnbart den Raum betrat: Dr. med. Grant P. Monroe, wie James auf seinem Namensschild lesen konnte. Seine Augen hinter der randlosen Brille begegneten denen von James. Er stellte sich vor und fügte hinzu: »Wir kennen uns bereits.«
Ach? Tun wir das?
»Es ist möglich, dass Sie sich nicht daran erinnern.«
James schüttelte den Kopf. »Ich erinnere mich tatsächlich nicht.«
»Hm.« Unverbindlich, doch seine Augen verengten sich kaum merklich.
»Ich weiß noch nicht einmal, wie und warum ich hierhergekommen bin.«
»Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas.« Er zog eine Stablampe aus der Kitteltasche und leuchtete in James’ rechtes Auge. »Sollten in ein paar Tagen vorüber sein.«
»Sollten?«
Dr. Monroe zuckte die Achseln. »Manchmal dauert es länger. Es gibt Fälle, da kehrt alles auf einmal zurück, wie aus heiterem Himmel, doch meistens kommt die Erinnerung in klitzekleinen Stückchen, wenn man etwas Bestimmtes sieht oder hört und das Gehirn eine Verbindung herstellt. Mit der Zeit können Sie hoffentlich alles wieder zusammensetzen.« Er nahm sich das linke Auge vor.
»Hoffentlich?«
»Das kann niemand mit Bestimmtheit vorhersagen.«
»Wie tröstlich.«
Der Anflug eines Lächelns. Offenbar gefiel ihm James’ Sarkasmus. »Lassen Sie sich Zeit.«
»Bleibt mir eine Wahl?«, knurrte James.
Der Arzt gab keine Antwort, stattdessen erklärte er, dass James nicht nur ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, sondern noch dazu drei gebrochene Rippen sowie einen Bänderriss in der rechten Schulter davongetragen hatte, außerdem diverse Schürfwunden und Quetschungen.
»Sie haben trotzdem Glück gehabt«, schloss Dr. Monroe. »Die Sache hätte viel schlimmer ausgehen können.«
»Inwiefern?«
»Nun, die Kopfverletzung hätte Sie umbringen können.«
»Hat man mich niedergeschlagen?«
»Sie sind gestürzt.«
»Ich bin gestürzt?«, wiederholte James ungläubig. Wie konnte ein einfacher Sturz einen solchen Schaden anrichten?
»Oder wurden gestoßen«, sagte Schwester Rictor, die soeben ins Zimmer zurückkehrte, um etwas in den Injektionsbeutel zu füllen, während der Arzt James’ Schulter untersuchte.
Dr. Monroe hob James’ rechten Arm an, drehte ihn vorsichtig, und James zog scharf die Luft ein und spürte, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich. »Schlimm?«, wollte der Arzt wissen.
»Ich werde es überleben.«
»Gut.« Dr. Monroe legte James’ Arm zurück in die Schlinge. »Die Schulter ist nicht gebrochen«, erklärte er dann. »Wie ich schon sagte: Sie hatten Glück.«
James schnaubte ungläubig. »Noch einmal«, wandte er sich an die Krankenschwester. »Was ist passiert?«
Bevor diese antworten konnte, sagte der Arzt: »Die Polizei möchte mit Ihnen reden. Man hat uns angewiesen, nicht auf Ihre Fragen zu antworten.«
»Wie bitte? Warum nicht?«
Trotz Dr. Monroes warnenden Blicks antwortete Schwester Rictor: »Wegen der Ermittlungen.«
»Welche Ermittlungen?« Das klang ja immer ominöser.
»Das müssen Sie die Polizei fragen.«
»Na schön.« James konnte sich zwar nicht erinnern, was in den letzten Tagen, wenn nicht gar Wochen passiert war, aber er wusste, dass er eine instinktive Abneigung gegen die Cops hegte. »Dürfen Sie mir wenigstens verraten, was wohl der Grund für diesen Sturz oder Stoß war?«
»Sie waren in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt«, teilte die Schwester ihm mit. Der Arzt sah sie streng an, was sie jedoch nicht davon abhielt, hinzuzufügen: »Er hat ein Recht darauf, das zu erfahren.«
»Eine Auseinandersetzung?« Mein Gott, er war doch viel zu alt für Kneipenschlägereien oder sonstige Prügeleien, hatte schon vor Jahren gelernt, sein aufbrausendes Temperament unter Kontrolle zu halten!
»In eine häusliche Auseinandersetzung.«
Das konnte sie nicht ernst meinen. »Mit wem?«
»Das wissen wir nicht«, schaltete sich Dr. Monroe ein. Schwester Rictor verdrehte genervt die Augen.
»Die Polizei hat uns nicht viel mitgeteilt«, sagte sie. »Nur dass es bei Ihnen zu Hause passiert ist. Jemand hat den Notruf gewählt, die Sanitäter haben Sie gefunden und hierhergebracht. Offenbar sind Sie gestürzt – vielleicht wurden Sie auch gestoßen – und mit dem Kopf gegen die Kante des Kamins geprallt.«
James setzte sich etwas aufrechter und versuchte wieder einmal, sich zu erinnern. Vor seinem inneren Auge sah er die gemauerte Feuerstelle vor sich, sah, wie er zurücktaumelte, stolperte, fiel, als er … wovor auswich? Oder vielmehr, vor wem?
Einer Frau.
Unwillkürlich fasste er an seine Wange.
Eine verschwommene Erinnerung tauchte auf …
Du wirst mich niemals wiedersehen!
Die Worte trafen ihn wie Dolchstöße.
Wer hatte sie ihm so brutal entgegengeschleudert?
Das müsste er doch wissen.
Aber er wusste es nicht.
»Wer hat mich gestoßen?«, fragte er, an die Schwester gewandt.
»Keine Ahnung«, gab sie zu.
Er sah, wie ein Schatten über Dr. Monroes Gesicht huschte. »Das weiß anscheinend keiner. Die Polizei möchte mit Ihnen reden, um Ihre Version der Geschichte zu erfahren.«
»Diese andere Person – er … sie ist also nicht hier? Wurde nicht ins Krankenhaus eingeliefert?«, hakte er nach. Müsste sein Gegner … seine Gegnerin nicht ebenfalls verletzt sein?
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Sie könnte auch woanders hingebracht worden sein«, überlegte die Schwester.
»Sie?«, fragte James, der seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt sah. »Wer ist es?«
Sonja Rictor schüttelte den Kopf. »Niemand weiß, was genau passiert ist. Noch nicht.«
»Aber fest steht, dass ich in eine Auseinandersetzung mit einer Frau verwickelt war und hier gelandet bin«, stellte er aufgewühlt klar. »Geht es ihr gut?« Er setzte sich richtig auf und ignorierte den Schmerz.
»Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Ihre Freundin handelt.«
Ein mulmiges Gefühl machte sich in James’ Magengrube breit. Vor seinem inneren Auge zogen die Gesichter von Frauen vorbei, mit denen er sich in der Vergangenheit getroffen hatte – Gesichter, zu denen er keine Namen fand.
»Megan Travers.«
»Megan«, wiederholte er bedächtig und spürte die neugierigen Blicke des Arztes und der Schwester auf sich ruhen, als er versuchte, den Namen zuzuordnen. Das Bild von einem Gesicht flackerte in seinem Gehirn auf, aber es war dunkel und verschwommen, die Züge so gut wie nicht zu erkennen. Langsam schüttelte er den Kopf, dann kam ihm plötzlich ein entsetzlicher Gedanke. Was, wenn sie es nicht überlebt hatte? Was, wenn Dr. Monroe und Schwester Rictor so zurückhaltend waren und die Polizisten so versessen darauf, mit ihm zu sprechen, weil sie tot war … O Gott … Hatte er sie umgebracht? Es musste sich um einen Unfall gehandelt haben, da war er sich ganz sicher. »Die Frau … Megan … geht es ihr gut?«, fragte er erneut.
»Darüber weiß ich nichts.« Dr. Monroe wich James’ Blick aus. Ein schlechter Lügner. »Sie werden den Detective danach fragen müssen.«
Den Detective? Nicht einfach einen Cop, den man wegen Ruhestörung gerufen hatte? Die Schwester hatte von »Ermittlungen« gesprochen. Da ergab es Sinn, dass Detectives eingeschaltet waren.
»Aber sie ist nicht gestorben, oder?«, presste James angespannt hervor. Mein Gott, was war passiert?
Die Schwester öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch der Blick von Dr. Monroe brachte sie zum Schweigen.
James fasste sie am Arm.
»Ich muss es wissen«, drängte er. Seine Stimme war kaum mehr als ein heiseres Flüstern. Sie schaute ostentativ auf seine Finger. Er bemerkte ihren Blick und zog die Hand zurück.
»Das kann Ihnen nur die Polizei sagen«, erklärte der Arzt mit Nachdruck.
»Scheiß auf die Polizei! Ich muss es wissen! Jetzt!« Er schwang die Beine über die Bettkante und spürte einen reißenden Schmerz in seinem Brustkorb.
»Mr Cahill, ich rate Ihnen dringend, sich zu beruhigen. Und wagen Sie es ja nicht noch einmal, Schwester Rictor oder irgendwen aus meinem Team anzufassen. Die Polizei wird Ihnen mitteilen, was Sie wissen möchten.«
»Dann rufen Sie sie!«, blaffte James.
Der Arzt nickte. »Das habe ich bereits getan.«
James’ Furcht wurde noch größer. Er presste die Kiefer zusammen, um sich zu wappnen, zwang sich, sich auf die letzten Tage zu konzentrieren, auf das, woran er sich erinnern konnte: Es hatte geschneit, und auch jetzt fielen dicke, weiße Flocken von Himmel, wie ein Blick aus seinem Zimmerfenster bestätigte. Im Moment herrschte in der Weihnachtswelt Hochsaison, die Feiertage standen unmittelbar bevor.
Die Schwester hatte gesagt, man habe ihn am Donnerstag eingeliefert. Was hatte er gemacht? Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, dass er an einem der Minihäuser gearbeitet hatte … richtig? Es hatte irgendeine Verzögerung gegeben, welcher Art genau, konnte er nicht sagen. Nach der Arbeit war er zum Hotel gefahren, hatte sich im Restaurant etwas zum Abendessen geholt und … und … und sich auf den Heimweg gemacht. Er erinnerte sich, die Haustür aufgesperrt und den Hund begrüßt zu haben. Kurz darauf hatte er auf der Auffahrt Scheinwerferlicht gesehen. Und dann?
Verdammt noch mal, er konnte sich nicht erinnern!
Dr. Monroes Handy klingelte, was James abrupt in die Gegenwart zurückholte. Der Arzt nahm das Gespräch an, sagte ein paar Worte und legte auf.
»Detective Rivers ist unterwegs«, teilte er James mit.
»Der Cop, mit dem ich reden soll?«, fragte James.
»Ja.«
Okay, das war’s. James wusste, dass er gegen Wände anrennen würde, ganz gleich, wie sehr er sich noch bemühen würde, etwas herauszubekommen. Es lag auf der Hand, dass der Arzt die Antworten entweder nicht kannte oder aber angewiesen worden war, den Mund zu halten. Auch Sonja Rictor hatte dichtgemacht. Sie am Arm zu packen, war ein Fehler gewesen. Sie gab sich jetzt genauso zugeknöpft wie Dr. Monroe und sagte lediglich: »Ich bin mir sicher, Sie werden die Situation klären können, sobald Ihr Gedächtnis zurückkehrt.« Sie sah noch einmal nach seinem Tropf und legte einen weiteren Infusionsbeutel parat. »Das hilft gegen die Schmerzen.«
»Ich muss hier raus«, beharrte er.
»Heute Abend nicht mehr.« Dr. Monroe ließ sich nicht umstimmen, und James hatte Probleme, sich zu konzentrieren, vermutlich wegen des neuen Schmerzmittels, das nun in seine Vene tropfte.
»Wenn Sie mich nicht rauslassen …«
Der Arzt legte den Kopf schief, als wolle er fragen: Was dann? Wohin wollen Sie in Ihrem Zustand schon gehen?
»Dann geben Sie mir wenigstens mein Telefon.«
»Das haben wir nicht«, sagte Monroe. Schwester Rictor nickte.
James blinzelte gegen die plötzliche Müdigkeit an. »Es muss noch zu Hause liegen …«
»Ich sehe morgen wieder nach Ihnen.« Dr. Monroe wandte sich zum Gehen. James schaute ihm nach, als er das Krankenzimmer verließ, gefolgt von Schwester Rictor.
Benommen legte er sich zurück in die Kissen. Die Medikamente zeigten ihre Wirkung. Seine Augenlider wurden schwer, und plötzlich war es ihm gleich, dass er hier im Krankenhaus festgehalten wurde und dass er sein Handy nicht bei sich hatte. Er meinte, das Geräusch der sich öffnenden Zimmertür zu hören, und versuchte angestrengt, wach zu bleiben, aber es wurde immer schwerer. Es gelang ihm, wenigstens ein Auge einen Spalt offen zu halten. Kurz darauf nahm er eine Bewegung wahr, dann sah er den Rücken von jemandem, den er nicht kannte. Von jemandem in Klinikkleidung, mit einem langen, geflochtenen, pechschwarzen Zopf. Er blinzelte. Die Frau mit dem Zopf war verschwunden. Hatte das Zimmer offenbar schon wieder verlassen. Er war allein.
War wirklich jemand bei ihm gewesen?
Oder spielte ihm sein Verstand einen Streich, und er hatte es sich nur eingebildet?
Aber hing da nicht ein Hauch von Parfüm in der Luft?
Egal. Es war nicht wichtig, zumindest nicht im Moment. Nicht, wenn er so verdammt müde war und dankbar für den Schlaf, der ihn mehr und mehr übermannte.
Kurz bevor er eindämmerte, sah er das Gesicht einer Frau vor sich – einer schönen Frau mit gleichmäßigen Zügen, einem ironischen Lächeln, kastanienbraunem Haar und einem misstrauischen Funkeln in den goldenen Augen, aber er konnte nicht sagen, ob sie echt war oder lediglich ein Trugbild seiner Fantasie. Nein, es musste jemand sein, den er kannte, möglicherweise nur flüchtig. Ihr Name – konnte er sich an ihren Namen erinnern? Kannte er ihn überhaupt? Schwester Rictor hatte gesagt, seine Freundin heiße Megan, aber das klang irgendwie nicht richtig. Er zog die Augenbrauen zusammen und dachte angestrengt nach. Wer zum Teufel war die Frau, die er da gerade vor sich gesehen hatte?, fragte er sich. Und dann schlief er endgültig ein.
Kapitel 4
Amnesie? Bist du sicher?« Detective Brett Rivers glaubte es nicht. Nicht für eine Sekunde. Er warf seiner Partnerin über die schneebedeckte Motorhaube seines Jeep Cherokee einen skeptischen Blick zu, bevor er einstieg. Stunden zuvor war er schlecht gelaunt aufgewacht, und seine Stimmung hatte sich im Laufe des Tages nicht sonderlich gebessert.
Wynonna Mendoza glitt auf den Beifahrersitz und schnallte sich an. Rivers’ Partnerin war eine zierliche Frau Mitte zwanzig, mit glatter, weicher Haut, die völlig ohne Make-up auskam, und unbändigen schwarzen Haaren, die sie für gewöhnlich zu einem festen Knoten am Hinterkopf zusammenzwirbelte, was ihre riesigen Kreolen hervorragend zur Geltung brachte. Zudem war sie blitzgescheit und dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihre hellgrünen Augen sprühten vor Intelligenz, ihr Humor hatte einen starken Hang zum Sarkasmus. Genau wie seiner. Mendoza warf ihm einen Seitenblick zu. »Der Arzt sagt, das ist durchaus möglich.«
»Möglich oder wahrscheinlich?«
»Möglich.« Ihr Handy piepte. Sie zog es aus ihrer Jackentasche und warf einen Blick aufs Display.
»Verdammt praktisch, wenn du mich fragst.« Er setzte rückwärts aus der Parklücke, dann rollte er über den Platz zur Straße. Noch immer fielen die Schneeflocken wie ein dichter, gleichmäßiger Vorhang vom Himmel. Rivers stellte die Scheibenwischer an, reihte sich in den Verkehr ein und hielt auf die erste Kreuzung Richtung Stadtzentrum zu. »Das kaufe ich dem Kerl nicht ab.«
»Schädel-Hirn-Trauma.«
»Jaja.«
Sie fuhren an den Ladenfronten der hundert Jahre alten Gebäude vorbei, die meisten davon mit Westernfassaden und Markisen. Fußgänger in dicken Jacken mit Kapuzen oder warmen Wollmützen eilten von einem Geschäft ins nächste. Mendoza, die ganz auf ihr Smartphone konzentriert war, beantwortete eine Textnachricht und erwiderte nur: »Das kommt vor.«
»Wenn du das sagst.«
»Das sage nicht ich, das sagt der Arzt.« Eine Pause. Dann: »Willst du wirklich noch mal zum Tatort?« Sie blickte von dem kleinen Display auf.
»Hm.« Er hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Jetzt schon festzustecken. Ohne neue Antworten, und das, obwohl er schon zweimal im Krankenhaus gewesen war. Keine Chance, Cahill zu befragen. Beide Male hatte er geschlafen, und der diensthabende Arzt wollte nicht, dass sie den Patienten störten.
Scheiß drauf.
»Es ist deine Show.«
»Fall«, erinnerte er sie. »Mein Fall.«
»Wie auch immer.« Sie klang gelangweilt, doch sie warf ihm einen weiteren verstohlenen Seitenblick zu. Er wusste, dass sie ihn piesackte. Ganz schön nervend für einen Grünschnabel. Aber es lockerte zumindest die Stimmung auf.
Außerdem war er selbst nicht unbedingt der älteste Hase im Department, dachte er, als er aus dem Stadtzentrum hinausfuhr. Hier wichen die Ladenfronten Einkaufszentren, Tankstellen und Parkplätzen. Er hatte jahrelang beim San Francisco Police Department – kurz SFPD – gearbeitet, bevor ein Führungswechsel mit seiner Scheidung zusammenfiel und er beschloss, alles hinter sich zu lassen, in einen anderen Bundesstaat zu ziehen, fernab vom Trubel der Großstadt.
Er hatte dieses County mitten im Nirgendwo ausgesucht, im Westen des Bundesstaats Washington, weit weg von Astrid und ihrem neuen Ehemann, weit weg von dem Lärm, den Kopfschmerzen und den wimmelnden Menschenmassen.
Keine Schwerverbrechen mehr.
Wenigstens hatte er das gedacht.
Aber jetzt hatte er es mit einer vermissten Person zu tun, die möglicherweise entführt, vielleicht sogar ermordet worden war.
Und James Cahill war in den Fall involviert. Der Mann ohne Gedächtnis.
Der ständig schlief, benebelt von Schmerzmitteln.
Rivers spähte durch die vereiste Windschutzscheibe seines Jeeps. Hier, am Stadtrand, standen nur noch vereinzelt ein paar Häuser am Fluss, dessen verschneite Ufer sich weiß von dem dunklen, schnell fließenden Wasser abhoben. Er fuhr über die Brücke. Am anderen Ufer gab es gar keine Häuser mehr, nichts als die unberührte, weiße Landschaft, Morgen um Morgen Farmland, durchbrochen von kleinen, immergrünen Wäldchen und Viehzäunen. Die Straße führte an langen Zufahrten vorbei, ab und an sah man in der Ferne Licht aufblitzen, dort, wo sich landwirtschaftliche Gebäude, Farm- oder Ranchhäuser befanden.
Rivers achtete nicht darauf, stattdessen konzentrierte er sich auf die Straße vor ihm. Die Scheibenwischer kratzten die dicken Schneeflocken von der Windschutzscheibe, Mendoza hatte sich wieder in ihr Smartphone vertieft. Keine Ahnung, was sie da derart fesselte. Der Motor brummte, die Heizung blies angenehm warme Luft ins Wageninnere, und Rivers’ Gedanken schweiften wieder einmal zu James Cahill.
Als Rivers noch bei der Polizei von San Francisco gearbeitet hatte, waren ihm Gerüchte über die Familie Cahill zu Ohren gekommen – Klatsch und Tratsch, wie man ihn nicht nur auf dem Revier hörte. Der Reichtum der Cahills, ihre Menschenfreundlichkeit und ihre Skandale waren legendär und sorgten immer wieder für Schlagzeilen in den Nachrichten und für Kopfschmerzen im Department. Immer wieder traten in der Familie schwere psychische Erkrankungen auf, und das seit Generationen. James, der in diesem Kaff am Ende der Welt lebte, trug die Cahill-Gene in sich. Die ihm als Erben zu einem gewaltigen Vermögen verhelfen würden, das ebenfalls seit Generationen existierte.
»Altes Geld« aus San Francisco.
Und nun steckte der Goldjunge bis über beide Ohren in Schwierigkeiten.
Das musste man sich mal vorstellen.
Rivers’ Finger schlossen sich ums Lenkrad.
»Nett hier draußen.« Mendoza hatte sich von ihrem Smartphone losgerissen und schaute aus dem Beifahrerfenster. Ein paar Pferde trabten übermütig mit flatternden Mähnen und wehenden Schweifen durch die Schneewehen, gefolgt von einer Wolke aus aufgewirbeltem Schnee.
»Klar.«
»Entspann dich.«
Doch er entspannte sich nicht. Seine Gedanken waren so finster wie der sich herabsenkende Abend, als er die ansteigende Straße zum Cahill-Anwesen in den Ausläufern der Cascade Mountains entlangfuhr. Ein riesiges Gelände mit fast vierhundert Morgen Land, auf dem sich ein Farmhaus, eine Weihnachtsbaumfarm mit Hotel, Restaurant, Laden und Café sowie mehrere neuere, scheunenähnliche Gebäude befanden, in denen Cahill die derzeit so angesagten, megateuren Tiny Houses entwarf und bauen ließ. Alberne Modulhütten, nicht selten auf Rädern, Luxustrailer, in denen man sich kaum umdrehen konnte und neben denen jedes Apartment in New York City geräumig wirkte.
Die Gegend war dicht bewaldet. Hier einen Leichnam zu finden war wie die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Sämtliche Fahndungsaufrufe nach Megan Travers’ Toyota Corolla waren im Sande verlaufen. Dabei hätte die Polizei nicht einmal nach ihr gesucht, hätte ihre Schwester, Rebecca Travers, nicht eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Rebecca gab an, Megan habe sie völlig aufgelöst angerufen und ihr von einer Auseinandersetzung mit James Cahill erzählt, anschließend sei sie in ihren kleinen Wagen gesprungen und durch den heftigen Schneesturm zu ihr nach Seattle aufgebrochen.
Wo sie nie angekommen war.
Mittlerweile war Megan Travers seit mehreren Tagen vom Radar verschwunden.
James Cahill wiederum war, offenbar nach einer häuslichen Auseinandersetzung, bewusstlos und verletzt in seinem Wohnzimmer entdeckt worden. Jemand – vermutlich die verschwundene Megan – hatte ihm eine Nachricht hinterlassen, in der sie ihm mitteilte, dass sie ihn verlassen würde.
»Wir haben Knowltons Aussage doch schon«, erinnerte Mendoza ihn und drehte am Temperaturregler der Heizung. Sie verstand nicht, warum sie noch einmal zum Cahill-Anwesen fahren mussten.
Robert »Bobby« Knowlton, Vorarbeiter für die Minihausfertigung und Verantwortlicher für Cahills Weihnachtswelt – »Mädchen für alles«, wie er sich selbst nannte –, hatte Cahill gefunden und den Notruf gewählt.
»Vielleicht ist ihm noch etwas eingefallen.«
»O-kay.«
»Außerdem würde ich mir gern noch einmal den Tatort ansehen, wenn keine Kriminaltechniker, Deputys und Rettungssanitäter durch die Gegend trampeln.« Rivers wusste selbst nicht, warum er sich rechtfertigte, immerhin war es sein Fall, wie Mendoza vorhin richtig bemerkt hatte. Er bremste vor einer Kurve ab, gerade als ein entgegenkommender Pick-up, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ins Schlingern geriet und über die Fahrbahnmitte rutschte.
»Pass auf!«, schrie sie.
Rivers ruckte am Lenkrad. Sein SUV machte einen Schlenker, einer der Reifen holperte über den Rand einer schneebedeckten Böschung.
Der Pick-up verfehlte den Dienstjeep nur um Haaresbreite.
Mendoza stieß die Luft aus. »Heilige …«
»Idiot«, murmelte Rivers.
Mendoza drehte sich um und versuchte, mit ihrer Handykamera Aufnahmen durchs Rückfenster zu machen. »Du solltest umdrehen und dem Kerl nachfahren! Der hätte uns umbringen können!«
»Jaja.«
»Ich meine es ernst, Rivers! Das Arschloch ist gefährlich! Den schnappe ich mir, darauf kannst du wetten.«
Rivers warf einen Blick in den Rückspiegel, aber der Pick-up war bereits außer Sichtweite, verschwunden hinter einer Kurve und dem dichten Schneevorhang.
Mendoza drückte ihr Handy ans Ohr und beschrieb jemandem am anderen Ende der Leitung den Pick-up. »Keine Ahnung … Chevy, ein älteres Modell …«
»Ein Ford«, korrigierte Rivers sie. Sie warf ihm einen genervten Blick zu.
»Rivers meint, es war ein Ford. Weiß, glaube ich.«
»Silber.«
Ein weiterer finsterer Blick in seine Richtung. »Silber. Mit … Nummernschildern aus Washington. Glaube ich. Ich konnte sie nicht richtig erkennen. Und nein, ich habe mir das Kennzeichen nicht notiert.«
Als sie dem Officer in der Zentrale die GPS-Daten durchgab, unterbrach er sie nicht erneut. Er wusste, dass das Ganze ein aussichtsloses Unterfangen war, aber Hauptsache, Mendoza konnte Dampf ablassen. Sie wischte das Gespräch weg.
»Er ist wahrscheinlich auf eine Eisplatte geraten und auf unsere Spur geschlittert.«
Sie runzelte die Stirn. »Egal. Entweder man weiß, wie man bei diesem verdammten Schnee zu fahren hat, oder man bleibt zu Hause.« Sie verrenkte sich erneut den Hals, um aus dem Heckfenster zu starren, als erwarte sie, dass der Pick-up wieder auftauchte. Was er nicht tat. »Wie dem auch sei«, murmelte sie, atmete tief durch und machte es sich wieder auf dem Beifahrersitz bequem, »die Kollegen von der Verkehrspolizei werden nach dem Wagen Ausschau halten. Ich hoffe, sie schnappen den Spinner.«
»Vielleicht haben sie Glück.«
Mendoza schnaubte. »Das scheint dich ja herzlich wenig zu interessieren.«
»Ich habe andere Dinge im Kopf.«
»Größere Probleme, als wegen dieses Bekloppten einen Spontantermin bei Petrus zu bekommen?« Sie klang immer noch aufgebracht.
»Ja.«
»Wir sind ohnehin da«, sagte sie. Im selben Moment entdeckte auch Rivers das rustikale Inn, James Cahills Weihnachtswelt-Hotel. Von der Landstraße führte eine asphaltierte Zufahrt dorthin ab. »Und wir sind nicht allein«, fügte sie hinzu, als Rivers an der langen Schlange von Fahrzeugen vorbeifuhr, die langsam auf den Parkplatz vor dem Cahill Inn rollten. Wie die meisten gewerblich genutzten Gebäude hatte auch das zweigeschossige Hotel die für diese Gegend typische Westernfassade aus verwittertem Zedernholz und eine überdachte Veranda, die rund um das Gebäude führte. Außerdem sorgten Pferdestangen und Viehtränken neben den breiten Stufen zum Eingang für ein authentisches Flair.
»Wie ein Hollywood-Filmset«, bemerkte Mendoza. »Du weißt schon, wie die Kulisse eines alten Westerns. Rauchende Colts. Oder Westlich von Santa Fé.«Als rechne sie mit einer Frage, fügte sie hinzu: »Mein Großvater ist ein großer Westernfan. Auf Kabel gibt es einen eigenen Kanal, und wenn er nicht gerade Sport schaut, sieht er sich alte Schwarz-Weiß-Streifen an. Maverick ist seine Lieblingsserie.«
Rivers, der gerade die Abzweigung zum Wohnhaus entdeckte, hörte nicht genau hin. Stattdessen setzte er den Blinker und bog ab. Ein breiter Grünstreifen mit Tannen und Fichten trennte die private Zufahrt vom kommerziell genutzten Teil des Geländes. Von hier aus konnte man die Rückseite des Cahill Inn sehen. Ein zusätzlicher Parkplatz lag zwischen dem Hotel nebst Restaurant und einem Café mit angrenzendem Laden, dahinter entdeckte Rivers den Eingang zur Weihnachtsbaumfarm. »Cahills Weihnachtswelt« stand in großen Lettern auf einem holzgeschnitzten Bogen, hinter dem sich zahlreiche gekieste, vom Schnee freigeräumte Wege durch die Flächen mit dicht gepflanzten Nadelbäumen schlängelten. Am Rand des Parkplatzes standen festlich geschmückte Buden und Verkaufsstände, es wimmelte nur so von Leuten in Skikleidung, dicken Winterjacken, Handschuhen und Mützen. Junge Paare zogen Kinder auf Schlitten hinter sich her. Angestellte in roten Jacken zurrten frisch geschlagene Weihnachtsbäume auf Autodächern fest.
Der Cherokee holperte über eine Wurzel unter der Asphaltdecke, dann kam ein Tor mit einem Schild in Sicht. »Privat«, las er.
»Ich kümmere mich darum«, sagte Mendoza und zog ihre Handschuhe an.
Noch bevor Rivers widersprechen konnte, war sie aus dem Wagen gestiegen und drückte das Tor auf, wobei sie einen kleinen Schneehaufen zusammenschob. Er fuhr hindurch, und sie machte das Tor wieder zu und sprang auf den Beifahrersitz, begleitet von einem Schwall eisiger Luft.
»Mein Gott, ist das kalt«, sagte sie bibbernd.
»Winter eben.«
»Ich hasse den Winter.«
»Dann bist du definitiv an den falschen Ort gezogen.«
»Vermutlich hast du recht.« Sie ging nicht näher auf seine Bemerkung ein, und er hakte nicht nach. Die Wahrheit war, dass er nicht viel über sie wusste, nur dass sie sich aus einem Department in der Gegend von Albuquerque in New Mexiko hierher hatte versetzen lassen. Ihre Akte war sauber, sogar mustergültig, und als er sich einmal nach den Umständen für ihren Wechsel erkundigt hatte, hatte sie nur geantwortet: »Es wurde Zeit.« Er hatte sie nicht weiter bedrängt, denn er hatte schließlich auch seine eigenen Gründe für den Umzug nach Riggs Crossing. Persönliche Gründe.
Er folgte der Zufahrt etwa eine Viertelmeile durch Tannen-, Fichten- und Lärchengruppen, die sich nach einer lang gestreckten Kurve zu einer großen Lichtung öffneten. Ein weißes Farmhaus mit einem grünen Giebeldach, umgeben von einer breiten Veranda, stand auf einer kleinen Anhöhe, dahinter befanden sich mehrere Nebengebäude, unter anderem ein Pumpenhaus, ein Schuppen und eine Scheune.
»Sieht genauso aus wie neulich Abend«, bemerkte Mendoza, als Rivers den Motor abstellte. Sie betrachtete das Haus, das leer, beinahe verlassen wirkte.
»Nur dass jetzt nicht ein Dutzend Deputys, Sanitäter, Feuerwehrleute und Spurensicherer herumwuseln. Das Nachrichtenteam ist weg, und auch die üblichen Schaulustigen sind verschwunden.«
»Zusammen mit sämtlichen Beweismitteln.«
»Ja, möglich.«
»Was es zu finden gab, ist doch längst im Labor.«
Das wollte er nicht bestreiten, doch er musste den Ort noch einmal mit eigenen Augen sehen, ohne sich ständig von seinen Kollegen ablenken zu lassen. Was zum Teufel war hier passiert? Warum war James Cahill im Krankenhaus gelandet, seine Freundin verschwunden?
Rivers würde es niemals offen sagen, weil es verrückt klang, aber wann immer er einen Tatort betrat, konnte er sich vorstellen, was passiert war, konnte in seinem Kopf eine Art Video abspielen, »sehen«, wie das Verbrechen stattgefunden hatte.
Dabei handelte es sich nicht um eine außersinnliche Wahrnehmung. Und auch nicht um das »Bauchgefühl«, das man Cops im Allgemeinen nachsagte.
Es war eher eine Art Intuition, die ihm half, die Vorgänge zu rekonstruieren. Er hatte bislang nur einem einzigen Menschen davon erzählt – seiner Ex-Frau Astrid, als sie noch verheiratet gewesen waren. Und sie hatte ihm ins Gesicht gelacht, wie immer.
»O Gott, Brett, dann bist du also unter die Hellseher gegangen?«, hatte sie mit funkelnden Augen gefragt und ihm gegenüber am Küchentisch Platz genommen. »Oder ist das etwas Psychotisches? Nun mach aber mal halblang!« Sie hatte kopfschüttelnd einen Schluck Wein getrunken. »Ich würde nicht allzu vielen Leuten davon erzählen, schon gar nicht im Department. Deine Kollegen könnten denken, du hättest nicht alle Tassen im Schrank.«
An diesen einen Rat hatte er sich gehalten. Er wusste, dass dieser »sechste Sinn« auf andere verrückt wirken musste, also sprach er nicht mehr darüber und behielt seine außergewöhnliche Fähigkeit für sich.
Mendoza stieg bereits aus dem Cherokee. Rivers zog den Zündschlüssel ab und trat hinaus in den knöchelhohen Schnee. Ein eisiger Wind peitschte ihm ins Gesicht.
Die Kapuze über den Kopf gezogen, eilte Mendoza aufs Haus zu. »Wir treffen uns hier mit Knowlton, richtig?«
»Ja.«
»Und du hoffst wirklich, dass er seiner Aussage noch etwas hinzufügt, was uns weiterhelfen könnte?«
»He, ich weiß, dass du denkst, wir würden hier bloß unsere Zeit verschwenden, aber mir ist das wichtig«, sagte er, nachdem er zu ihr aufgeschlossen hatte.
Sie stiegen die rutschigen Stufen zur Haustür hinauf, wo das Polizeiband, das die Kollegen gespannt hatten, im Wind flatterte. Über das Heulen der Böen in den Ästen der umstehenden Bäume hinweg hörte Rivers das Motorengeräusch eines sich nähernden Fahrzeugs.
»Da ist er ja«, sagte Mendoza und reckte das Kinn in Richtung Zufahrt.
Rivers sah einen alten Pick-up durch die Bäume auf die Lichtung zukommen.
Bobby Knowlton.
Er war es gewesen, der die Neun-eins-eins angerufen hatte.
Gerade noch rechtzeitig.
Kapitel 5
James? Kannst du mich hören? James?«
Die Stimme drang aus weiter Ferne zu ihm durch. Sanft. Weiblich.
James tauchte aus den Tiefen des Schlafs auf und öffnete blinzelnd ein Auge. Für eine Sekunde wusste er nicht, wo er sich befand, dann fiel ihm ein, dass er in einem Einzelzimmer im Krankenhaus lag. Sein Blick wanderte zum Fenster. Es schneite. Eine Frau – eine umwerfende Frau – stand neben seinem Bett und schaute mit besorgten blauen Augen auf ihn herab.
Er fühlte sich benommen, was an den Medikamenten liegen musste, und hatte den Eindruck, neben sich zu stehen wie bei einer außerkörperlichen Erfahrung.
»Ich bin’s«, flüsterte die umwerfende Frau und warf einen nervösen Blick auf die Tür. »Sophia.«
Keine Krankenschwester.
Feine, blonde Ponyfransen schauten unter der fellbesetzten Kapuze ihres langen, schwarzen Mantels hervor – vielleicht war es auch Kunstfell, das konnte er nicht sagen. Sie hatte einen dicken Schal um den Hals gebunden. Ihre Nase war klein und gerade, die Wangen gerötet, als wäre sie gerade von draußen aus der Kälte gekommen.
Er blinzelte erneut und versuchte, sich zu konzentrieren. Sophia?
Ihr Blick suchte seinen. Hoffnungsvoll. »Erinnerst du dich?«
Er erinnerte sich nicht.
»Gott sei Dank geht es dir halbwegs gut«, sagte sie. Ihre Mundwinkel zuckten nach oben. »Das hätte auch schlimmer ausgehen können.«
Sie hatte ein wunderschönes Lächeln. Ihre vollen Lippen mit dem rosa Lipgloss öffneten sich leicht und enthüllten eine Reihe gerader weißer Zähne.
»Ja«, erwiderte er gedehnt. Verdammt, warum konnte er sie nicht einordnen?
Das war nicht die Frau, die er vor sich gesehen hatte. Nicht die Frau mit dem kastanienbraunen Haar und dem misstrauischen Blick, die aus den Tiefen seines benebelten Gehirns aufgetaucht war.
»Du erkennst mich doch, oder?«
»Klar«, log er. Sie kam ihm tatsächlich bekannt vor. Wo hatte er sie schon einmal gesehen?