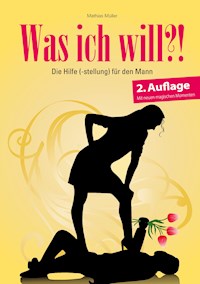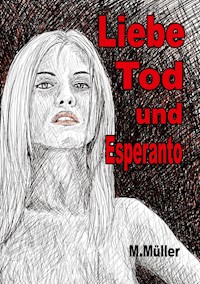
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2005 erhält Adrian Schlayer unerwartet Besuch von Vigdis, einer Schönheit aus Island. Sie spricht für ihn völlig unverständlich. Eine Stunde später stehen er und seine Besucherin vor zwei übel zugerichteten Leichen. Damit beginnt für Adrian eine Jagd um den halben Globus. Er lernt dabei die Welt des Esperanto kennen. Mitglieder eines weltumspannenden Netzwerkes dieser Kunstsprache helfen ihm und seiner Begleiterin weiter. Nur knapp entrinnen Adrian und Vigdis dem Tod unter anderem auch deshalb, weil Adrian rasend schnell Downhill fährt. Beim Show-Down auf Island steht Adrian mit seinem Mountainbike vor der steilsten Abfahrt seines Lebens. Unter ihm im Tal läuft Vigdis, seine große Liebe, in den Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Jahr 2005 erhält Adrian Schlayer unerwartet Besuch von einer nordischen Schönheit, die völlig unverständlich spricht. Eine Stunde später stehen er und seine Besucherin vor zwei übel zugerichteten Leichen. Damit beginnt für Adrian eine Jagd um den halben Globus. Dank des Esperanto-Netzwerkes seiner Begleiterin kommt Adrian bis zum Show-Down auf Island.
Wer die Geschichte liest, muss sich einlassen auf eine Liebesgeschichte voller Sex und Leidenschaft, eine Mörderjagd voller Gewalt und Action und auf eine lebendige Plansprache.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Fremde
Blut I
Polizei I
Rückblick Island
Polizei II
Rückblick Frankreich
Stuttgart I
Polizei III
Stuttgart II
Esperanto I
Périgueux
Esperanto II
Stuttgart III
Blut II
Spuren I
Liebe I
Marokko
Liebe II
Tanger
Thailand
Kongress
Blut III
Suche
Spuren II
Bangkok
Ablenkung
Liebe III
Hart und dreckig
Reykjavik
Spuren III
Abrechnung
Blut IV
Polizei IV
Heimfahrt
Abschied
Liebe IV
Übersetzung Esperanto – Deutsch
Prolog
Im 18. Jahrhundert v. Chr. wollte der Herrscher in Babel einen hohen Turm haben. Für den Bau ließ er billige Arbeitskräfte aus allen Teilen seines Reiches heranschaffen. Die Arbeiter waren wenig motiviert, außerdem verstanden sie sich untereinander schlecht, denn der König von Babel herrschte über viele Völker. Es kam, wie es kommen musste: Der Bau kam nicht voran, die Kosten explodierten. Aber die Bauleiter fanden einen Ausweg, um von ihrer eigenen Unfähigkeit abzulenken. Sie schoben die Verantwortung für das Misslingen Gott in die Schuhe. Er hätte die Arbeiter mit unverständlichen Sprachen verhext und deshalb wäre es nichts geworden, mit der Kommunikation untereinander und mit dem Turmbau bis zum Himmel.
Im Jahr 753 v. Chr. wurde in Italien eine kleine Stadt gegründet. Kaum waren 750 Jahre vergangen, herrschte die Stadt über die gesamte damals bekannte Welt rund ums Mittelmeer. Der Dialekt der mittlerweile groß gewordenen Stadt wurde zur Umgangssprache im ganzen Imperium. Latein überdauerte das Römische Reich. Es wurde zur Sprache der Wissenschaft. Bis weit in die Neuzeit galt: Wer etwas darstellen will, muss seinen Cäsar, Cicero und Quintilian beherrschen.
Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschten die europäischen Völker über große Teile der Welt. Ihre Sprachen lagen im Wettstreit miteinander: Welche soll die Weltsprache werden, die überall verstanden wird? Die Europäer konnten sich nicht einigen. Sie führten lieber Kriege gegeneinander. Solange, bis nichts mehr von ihrer Weltgeltung übrig geblieben war.
In den 80ern des 19. Jahrhunderts entwickelten Idealisten Plansprachen. Die hatten komische Namen. Deshalb erlebten diese Kunstsprachen auch nur eine kurze Blütezeit.
In den 90ern des 20. Jahrhunderts brach der real existierende Sozialismus zusammen. Seitdem regiert die angelsächsische Wirtschaftsordnung die Welt. Englisch wurde zur Weltsprache. Beides zusammen hat schlimme Folgen in Deutschland. Denn nun kommunizieren deutsche Marketingexperten nur noch auf Denglisch.
1998 wurde der letzte Handywitz erzählt. Seitdem sind Handys keine Statussymbole mehr, sondern Gebrauchsgegenstände.
2001 hält das Mittelalter Einzug in die moderne Welt. Am 11. September flogen Selbstmordattentäter mit Flugzeugen in das World Trade Center in New York. Religion wird ab nun wieder als legitimer Grund gesehen, um mit gutem Gewissen Massenmörder zu werden.
2003 stellte ein gewisser Mark Zuckerberg eine Website ins Netz, auf der Studentinnen bewertet wurden, ob sie „hot“ seien. Die Seite war bald wieder offline. Ein Mann sollte sich nicht mit zu vielen intelligenten Frauen auf einmal anlegen. Ein Jahr später kam Mark Zuckerberg auf eine andere Idee.
Wieder ein Jahr später, 2005, erhält Adrian Schlayer den Besuch einer Schönheitskönigin, die völlig unverständlich spricht. Und so beginnt diese Geschichte. Wer sie liest, muss sich einlassen auf Tod und Liebe, Gewalt und Sex sowie eine lebendige Plansprache.
Die Geschichte ist frei erfunden. Alle Personen darin sind fiktiv. Nur Ludwik Zamenhof (1859 – 1917), der Erfinder der Kunstsprache Esperanto (1887 von ihm begründet) und Johann Martin Schleyer (1831 – 1912), der Erfinder der Plansprache Volapük (1879/80 von ihm veröffentlicht), haben tatsächlich gelebt. Selbstverständlich gab es KEINE Korrespondenz zwischen Schleyer und dem fiktiven Friedrich Bergmann in dieser Geschichte.
Mein Dank gilt Alois Eder vom Esperanto Landesverband Baden-Württemberg (BAVELO), Ralph Glomp vom Esperanto Hamburg e.V. und Heinz-Wilhelm Sprick von der Esperanto-Gruppe Hameln. Sie haben die Esperanto-Sätze für diese Ausgabe korrigiert und auch sonst noch Fehler im Text gefunden. Alois war der Leiter eines Esperanto-Kurses, den ich 1998 besucht habe. Alois ist noch genauso voller Ideen wie damals. Er zeigt: Esperanto hält jung. Ralph hat vorurteilsfrei wie Esperanto-Freunde nun einmal sind, mich Süddeutschen sofort an seinen Hamburger Zoom-Meetings teilnehmen lassen und bei Heinz lerne ich jetzt wieder Esperanto. Es lohnt sich!
Die Fremde
„Saluton kaj bonan tagon. Mia nomo estas Vigdis. Ĉu vi estas Adrian Schleyer?“1)
Adrian Schlayer starrte die Fremde an, die vor seiner Tür stand. Er verstand kein Wort außer seinem Namen. War das Spanisch … oder Portugiesisch, was sie sprach?
Ihr Aussehen war nicht südländisch. Sie sah aus wie eine nordische Schönheitskönigin. Hellblondes, glattes Haar bis über die Schultern. Augen blau und klar wie das Eiswasser der Fjorde, die Adrian in Norwegen gesehen hatte. Eine gerade kräftige Nase zeigte, dass alles an ihr echt war. Der Schwung ihrer Oberlippe ließ ihre weißen Zähne sehen und gab ihrem Gesicht zusammen mit der vollen Unterlippe und dem angehobenen Kinn einen verächtlichen Ausdruck. Sie war sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst.
Das Blut schoss Adrian vom Gehirn in den Unterleib. Bewegung hilft manchmal gegen eine Erektion. Adrian öffnete die Tür und hinkte zu dem langen, schmalen Holztisch, der in der Mitte seines Lofts stand. Er setzte sich auf einen der Stühle und während er seine verschwitzten Sportsachen von dem Stuhl daneben auf den Boden schob, winkte er ihr herein und sagte: „Yes, I am Adrian Schlayer. Come in.“
Er war nicht in der Verfassung, eine Schönheitskönigin zu empfangen. Seine Schulter war grün und blau. Auf seinem Rücken zogen tiefe Kratzer ihre blutigen Spuren. In seinen Haaren klebte getrocknetes Blut. Sein einziges Kleidungsstück war eine verdreckte, zerrissene Radlerhose.
Er roch nach Schweiß und Dreck. Er war im Degerlocher Wald im Stuttgarter Süden Downhill gefahren. Und er war außer sich vor Wut. Wer in Stuttgart Downhill fährt, hat keine Freunde bei den Naturschützern. Die hetzen die Bullen auf uns. Warten am Ende der Strecke. Beschimpfen uns Radfahrer als Umweltschädlinge. Ich schlag dem Nächsten die Zähne aus. Einer hat mir vor einer Woche den Reifen zerstochen. Der Mistkerl in der Zahnradbahn. Jetzt ziehen grüne Taliban Drahtfallen in die Strecke. Ist neu, ist heimtückisch. Ist feig. … Wie das ganze Umweltpack.
Adrian hatte den Draht nicht gesehen, der etwa einen halben Meter über dem Boden gezogen gewesen war. So war Adrian dagegen gefahren und hatte einen Salto über den Lenker geschlagen. Er war den Hang hinunter geschlittert, hatte sich hinabgekugelt, sich Arme und Beine aufgerissen, hatte sich überschlagen, versucht auf die Beine zu kommen, hatte sich nochmals überschlagen, war schneller und schneller geworden. Dann hatte eine alte Eiche seiner Talfahrt ein schnelles und hartes Ende bereitet. Sein Helm hatte ihn vor noch größeren Schäden bewahrt.
Adrian war wieder hochgeklettert und hatte den Draht mit bloßen Händen abgemacht, um dann mit seinem verbogenen Rad nach Hause zu laufen. Es war heiß gewesen und er hatte Durst gehabt. Er hatte sich auf ein Bier und eine Dusche gefreut. Aber dann hatte es geklingelt. Er hatte gedacht, es wäre die Polizei. Denn natürlich hatte er mit seinen Freunden telefoniert. Und die hatten bestimmt nicht lange gefackelt mit dem nächsten Umweltschützer, dem sie habhaft werden konnten.
Aber nun stand eine Schönheitskönigin vor seiner Tür. … Und das beruhigte ihn … ein wenig.
Die Königin hatte sich nicht bewegt. Sie sagte: „Tio estis angla. Mi rifuzas la anglan. Mi parolas Esperanton kaj se vi estas Adrian Schleyer, vi ankaŭ komprenos tion.“2)
„Angla“, das sollte wohl „Englisch“ bedeuten. Ihrer Körpersprache nach und so verächtlich, wie sie dieses Wort hervorzischte, war Adrian sofort klar, dass die Fremde für Englisch nicht viel übrig hatte. Gab es das heutzutage noch? Jemand, der kein Englisch sprach? Na dann eben Französisch: „Qui, je suis Adrian Schlayer. Entrez,“ und mit einem kurzen Lächeln: „s'il te plaît.“
Immerhin. Jetzt lächelte sie. Adrian grinste. Er fühlte sich im Vorteil. Er war zweisprachig aufgewachsen. Mama aus dem Norden Frankreichs, Papa aus dem Süden Deutschlands. Er, Adrian, das Ergebnis dieser im Fall seiner Eltern, wie er selber fand, gelungenen Melange.
Die Schönheitskönigin lächelte zwar, aber sie sprach weiter in dieser seltsamen Sprache, die Adrian nicht kannte, die ihm aber doch irgendwie vertraut vorkam: „Tio estis probable franca, mi komprenis: Do vi estas Adrian Schleyer. Sed kial ni ne parolas Esperanton kune? Ni devas klarigi tion. Ĉu mi rajtas eniri?“3)
Sie trat in das Loft, setzte sich auf den freigeräumten Stuhl und erfüllte den Raum. Adrian sog ihren Duft mit beiden Nüstern ein. Ihre Präsenz, ihr Duft … schweres Parfum, Frauenkörper, … jung, erhitzt.
Adrian konnte nicht fassen, was da auf ihn einströmte. Ihre Bluse: altmodisch, bunt. Der Rock: seltsam, mit Falten. Der Lederrucksack: noch älter als die Bluse, abgeschabt. Sie war gekleidet wie eine Vertreterin seiner Feinde, die Ökotaliban. Aber das machte nichts. Auch unter Ökos können ja prima Leute sein. So wie die hier.
Sie stellte den Rucksack auf den Boden. Dabei taxierte sie Adrian mit ihren glasklaren Augen, zog die Oberlippe noch höher und legte dann ihre Beine auf die Werkzeugkiste, die neben dem Tisch stand.
Adrian schnappte nach Luft. Der seltsame Rock war nicht altmodisch. Er hatte einen Schlitz bis zur Hüfte und ließ ein Bein von makelloser Schönheit frei. Schneeweiß mit einer Haut, die noch nie von der Sonne gegerbt worden war, unglaublich lang.
Adrian zählte in Gedanken auf zehn. Dann gelang es ihm, die Augenbrauen zu heben und den Mund zu schließen. Er räusperte sich: „Hrrm ... Möchtest du etwas … trinken? Ich habe Bier oder Wasser. … Oh pardon: tu veux boire quelque chose? – J'ai de la bière ou de l'eau.“
Sie verzog den Mund, dann blitzte es kurz, nur ganz kurz in ihren Augen und sie sagte: „Mi prenas bieron.“
Adrian wusste zwar immer noch nicht, in welcher Sprache sie sprach, aber er verstand: Die Schönheit wollte Bier. Adrian lief zu dem frei stehenden Kühlschrank. Zuerst stellte er ein Wasserglas in den Eiswürfelspender, drückte auf die Taste und während knackend crushed ice in das Glas fiel, holte er eine eiskalte Flasche Bier und stellte sie vor seiner Besucherin auf den Tisch. Er wollte eben nach einem Öffner schauen, da hörte er das bekannte Zischen, wenn ein Kronenkorken geöffnet wird. Sie hatte die Flasche an der Werkzeugkiste aufgemacht. Adrian bevorzugte in dieser Situation eiskaltes Wasser. Er füllte das Glas, das halb voll mit Eis war, mit kaltem Wasser aus der Leitung auf und kam wieder zum Tisch. Adrian nahm einen Schluck und grinste. Zeit für ein wenig Konversation.
Sie aber nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche, schaute ihn verächtlich an, deutete lässig mit der Flasche zur Dusche und sagte: „Vi devus duŝi vin.“4)
Dann drehte sie den Stuhl zur Tür und sagte: „Mi turnas min.“5)
Das war deutlich.
„Du weißt nicht, was dir entgeht“, sagte Adrian, zog die Radlerhose aus und stellte sich unter die Dusche, die freistehend im Badezimmerbereich seines Lofts stand. Das kühle Wasser ließ die Risswunden in seiner Haut wieder aufbrechen. Unter seinen Füßen floss es rot in den Abfluss. Die frischen Wunden brannten, aber darum konnte sich Adrian jetzt nicht kümmern. Er musste nachdenken. Ziemlich schnell kam er auf die Lösung, was ihm den unerwarteten Besuch verschafft hatte: Es gab außer ihm einen zweiten Adrian Schleyer in Stuttgart. Nur schrieb der sich mit einem e statt wie er mit einem a im Namen. Dieser Adrian wohnte in Feuerbach, einem anderen Stadtteil von Stuttgart. Zudem konnte ein Fremder die Straßen, an denen sie beide wohnten, leicht verwechseln. Adrian wohnte an der Weilheimer Straße. Sein Fast-Namensvetter an der Walheimer Straße. Als Adrian das bald nach seinem Umzug nach Stuttgart herausgefunden hatte, hatte er mit seinem Fast-Namensvetter telefoniert. Er hatte ihn besucht und sie hatten sich danach auch einige Male getroffen. Aber ihre Interessen waren zu unterschiedlich gewesen, sodass der Kontakt bald wieder eingeschlafen war. Der Adrian Schleyer mit e war nur ein paar Jahre älter als er, aber hauptsächlich an klassischer Musik, Schach, alten Sprachen und noch älteren Büchern interessiert. Bücher interessierten Adrian auch, aber nicht so alte. Schach und Latein hatte Adrian ebenfalls gelernt. Und er hatte gedacht, er würde gut Schach spielen. Bis er seinen Fast-Namensvetter kennengelernt hatte. Schach spielte der andere Adrian so viel besser als er, dass es den bald langweilte, sich mit ihm an ein Brett zu setzen. Obere Erste Liga gegen abstiegsgefährdeten Drittligisten eben. Und Latein gab als Unterhaltungsstoff auch nicht viel her.
Adrian war Sportstudent. Er fuhr Downhill. Er verdiente sich als Stuntman und als Model seinen Lebensunterhalt. Tagessatz in beiden Branchen mindestens 1.000 Euro. Das Geld war er offensichtlich wert. Er hatte mehr Anfragen, als er annehmen wollte. In den vergangenen drei Jahren, seit der Einführung des Euros, hatte Adrian immer über 100.000 Euro Jahreseinkommen erzielt. Maximal 120 Arbeitstage im Jahr hatte er sich als Limit gesetzt, – genau ein Drittel eines Jahres. Er musste ja auch noch sein Studium beenden und seine Freiheit genießen. Freiheit, das bedeutete für ihn vor allem, selbst über seine Zeit verfügen zu können. Wenn es sein musste, war er durchgetaktet bis auf die letzte Minute eines Tages. Damit wiederum war der andere Adrian überfordert. Also trennten sich ihre Wege wieder.
Adrian lebte intensiv. Ob Arbeit oder Freizeit, für ihn gab es da keinen Unterschied. Er liebte, was er tat. Das Geld, das er verdiente, gab er gerne aus: Die Miete für das Loft, 150 Quadratmeter im Stadtgebiet von Stuttgart? – Kein Problem. Eine Raumpflegerin für das Loft? – Selbstverständlich! Der kleine Porsche Boxster in der Garage der Villa seiner Eltern in Freiburg? – verstaubte, war aus einer Laune heraus angeschafft worden. Ein exzentrisches Fahrrad, das ihm gefiel? – wurde sofort gekauft.
Frauen hielten Adrians Lebensstil nicht lange aus. Die letzte längere Beziehung hatte er mit einem Groupie aus der Downhill-Szene gehabt. Die wollte unbedingt mit ihm ins Bett, nachdem er – extra zu diesem Zweck – vor ihrer Nase einen Fünf-Meter-Drop gelandet hatte. Nichts Besonderes für jemand, der es kann, … aber eindrucksvoll. Adrian beherrschte Downhill. Zuvor hatte er Fußball und Handball gespielt, Kampfsport und Tennis trainiert. Dann war er das erste Mal auf ein Rennrad gestiegen und hatte gewusst: Radfahren, das war sein Sport. Am liebsten Mountainbike und Downhill. Da hatte er gefunden, nach dem er immer gesucht hatte. Hier war er sich selbst sein Gegner. Es interessierte ihn nicht, wie schnell andere fuhren. Wenn er seine Ideallinie im Gelände gefunden hatte, dann war er ganz bei sich. Vollkommen im Hier und Jetzt. In jeder Sekunde der rasenden Fahrt das Richtige tun. Er war fit, optimal auf der Strecke. Jeden Moment das ultimative Leben spüren. … Das hatte natürlich auch dann gegolten, als er in die Drahtfalle gefahren war. In jeder Sekunde des Sturzes hatte er richtig reagiert. Die rettende Bewegung gemacht. Mein Instinkt, Körperbeherrschung und Helm: Deshalb habe ich überlebt. … Mit ein paar tiefen Kratzern.
Adrian runzelte die Stirn. Und jetzt? Jetzt war diese Fremde in seiner Wohnung. Und sie hatte ihm seine Selbstsicherheit genommen. Er zählte erneut in Gedanken bis zehn und drehte dann den Wasserhahn zu. Auch wenn sie ihn vom ersten Moment an umgehauen hatte: Aufgeben kam hier nicht infrage. Er holte tief Luft und öffnete den Duschvorhang.
Mit einem schiefen Grinsen, weil ihm noch immer viele Körperteile wehtaten, trat Adrian aus der Dusche, legte sich ein Handtuch um die Hüften und lief auf die Fremde zu. Wie ein kaputter Boxer, der nach der Pause seinem Gegner vorspielt, der Niederschlag in der vorigen Runde hätte ihm nichts ausgemacht. Dabei war ihm klar, dass seine Chancen gering waren, ihr etwas vorzumachen. Aber er hatte einen Trumpf. Er wusste ja, welchen Adrian Schleyer sie suchte. Er konnte sie zu ihm bringen und dann, so stellte er sich das vor, würde sie wieder mit ihm zurückfahren. Bei dem Bücherwurm-Adrian wird die Schönheit sicher nicht lange bleiben.
Er sagte ihr, dass er sie zu ihm bringen könne, auf Französisch … natürlich:
„Je sais maintenant qui tu cherches. Je peux t’emmener chez lui.“
Sie schaute ihn mit ihren eisblauen Augen an. Dann sagte sie: „Vi sangas.“6)
Dann öffnete sie den Erste-Hilfe-Kasten, den Adrian nach seiner Heimkehr hervorgesucht und auf den Tisch gestellt hatte. Sie sage: „Mi bandaĝas viajn vundojn.“7)
Konnte es sein, dass sie seine schlechte Verfassung auf seine Verletzungen bezog und nicht auf ihre eigene Wirkung auf ihn? Adrian begann zu hoffen.
Sie legte eine Kompresse auf die Risswunde in seinem Nacken und befestigte sie straff mit einem Heftpflaster. Dann kamen die anderen Risse und Kratzer auf seinem Rücken dran. Sie arbeitete kühl und sachlich, dabei mit leichter Hand und einfühlsam wie Hana in „der englische Patient“.
Adrian hätte beinahe angefangen zu schnurren. Ist schon geil, dass ich so in Form bin. Gefällt ihr, was sie sieht, … ist offensichtlich. Aber Mist, … ich hätte besser aufräumen können.
Adrians schaute auf den Werkzeugkasten, den aufgebauten Fahrradreparaturständer, auf die zu Boden geworfene dreckige Kleidung, den kaputten Fahrradhelm. Immerhin: Die Blutstropfen fallen auf meinem dunklen Industrieboden kaum auf.
Sein Blick schweifte durch sein Loft. Er hatte es von einer Architekturstudentin, die ein halbes Jahr lang seine Freundin gewesen war, einrichten lassen. In der Mitte des Raumes stand der lange Esstisch mit acht Stühlen. Durch die Original-Fabrik-Fenster mit Metallsprossen leuchtete hell die Sonne in den Raum. Glastüren, ebenfalls mit schwarzen Metallrahmen und Sprossen führten zu einer großen Terrasse, wo sich Adrian mit Kübelpflanzen, Loungesesseln und Außenwhirlpool ein Freiluftparadies geschaffen hatte. In der Flucht des Esstisches befand sich die Kücheninsel. Dahinter in der gleichen Flucht, mittig im Raum, die große, runde Dusche. Adrian hatte sie als Messe-Ausstellungsstück von einem großen Badausstatter bekommen, der ihn für ein Messe-Event gebucht hatte.
Die Installation des bodenebenen Abflusses und der akkuraten Installation hatte den Handwerker fast zur Verzweiflung gebracht. Erst beim dritten Versuch hatte er die Duschinstallation technisch und optisch nach Adrians Zufriedenheit gelöst. Wenn es ihm wichtig war, konnte Adrian ein sehr hartnäckiger und schwieriger Kunde sein.
An der anderen Schmalseite des großen Raumes führte eine Metalltreppe hoch zum Schlafbereich. Unter der Treppe hatte Adrians Schreibtisch Platz gefunden. Leer bis auf Flachbildschirm, Tastatur, Maus und zwei Ablageschalen. Eine war gefüllt mit etwas Papier. In der anderen lagen ein gespitzter Bleistift und ein schmaler Lamy-Kugelschreiber.
Adrian hatte so viel Platz in seinem Loft, dass er ungehindert mit dem Fahrrad um den Esstisch fahren konnte. „Freie Fläche ist Luxus“, hatte seine damalige Freundin, die Architekturstudentin, gesagt.
Platz für Deko hatte Adrian nicht. An der Wand gegenüber der Fensterfront hing echte Kunst. Vier Bilder, jeweils im Format ein Meter mal ein Meter. Gemalt von seinem schwulen Freund Milan Schmidt. Künstlername Raz Biran, angelehnt an das mazedonische Wort „Erkenntnis“. Milan war mittlerweile Meisterschüler im Weißenhof-Programm der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Milan war sehr verliebt in ihn gewesen, bis Adrian ihm klargemacht hatte, dass er keine Chance bei ihm hatte, weil Adrian hetero war. „Wir können ja gute Freunde bleiben“, hatte Adrian damals zu Milan gesagt. So wie es eine Frau zu einem lieben netten Mann sagt, der sich monatelang für sie zum Affen gemacht hat und endlich zum Zug kommen will. Mit diesem Satz macht sie ihm klar, dass sie nie mit ihm ins Bett gehen wird. Meist hat sie dann in der gleichen Nacht einen One-Night-Stand mit einem Macho wie mir.
Das hatte auch Milan gewusst und eingesehen, dass er keine Chance bei Adrian hatte. Er hatte sich dann mit einem Galeristen getröstet. Milan war tatsächlich Adrians Freund geblieben. Er wollte Adrian die Bilder schenken. Aber Adrian hatte sie ihm abgekauft zu einem Preis, wie sie jetzt, ein Jahr später, in der Galerie des Liebhabers von Milan gehandelt wurden.
In Adrians Loft herrschte purer Minimalismus. Sehr stilvoll, wenn da nicht die vielen Räder gewesen wären, die unter seinem Schlafpodest Platz gefunden hatten. Manche Besucher sagten, sie würden sich fühlen wie in einer Fahrradhandlung mit Privatanschluss zum Besitzer. Immerhin trennte ein Designersofa, freischwebend wirkend auf seinen runden schlanken Stahlfüßen, den Fahrradparkplatz von der übrigen Wohnung.
Adrian hatte eine Menge Räder in seinem Loft. Die unterschiedlichsten Räder und alle waren sie gepflegt. Nur das verbeulte Downhill nicht. Das war am Morgen noch 4.500 Euro wert gewesen. Daneben ein Fully, vor drei Monaten gebraucht gekauft für 1.200 Euro, dann ein Enduro, gebraucht für 2.800 Euro bekommen. Dann ein klassisches Rennrad aus den 80ern, Stahlrahmen, Rahmenschaltung, Marke Peugeot, ein Geschenk seiner Mutter. Danach ein Originalrad der Express-Werke, von seinem Großvater, noch mit dem Windhund auf dem vorderen Schutzblech. Dann ein modernes Rennrad. Dann seine weiße Göttin, ein Trekkingrad, T-700 von der Fahrradmanufaktur, weiß lackiert, mit neuester Nabenschaltung, Hydraulikbremsen, Stahlrahmen, robust und schnell. Dahinter das Steherrad, das er zweimal beim Sechstage-Rennen von Stuttgart gefahren hatte und ganz hinten an der Wand ein Tandem.
Adrian überlegte. Er schaute seiner Besucherin prüfend in die Augen. Dann hatte er sich entschieden. Er zeigte auf das Tandem und sagte: „Wir fahren mit dem.“
Ihr Blick wurde spöttisch. Sie zeigte auf den kaputten Fahrradhelm, die zerrissene Radlerkleidung, das verbogene Downhill und sagte zu ihm: „Vi antaŭe falis de via biciklo. Nun vi volas bicikli kun mi? Mi esperas, ke ĉi tio iros bone.“8)
Sie verstaute Schere und restliches Verbandsmaterial im Erste-Hilfe-Kasten. Dann nahm sie aus ihrem Rucksack eine blaue Leinenhose hervor und zog sie unter ihrem Rock an. Anschließend öffnete sie ihren Ledergürtel, zog den Rock aus, faltete ihn zusammen und legte ihn in ihren Rucksack. Als sie sich bückte, offenbarte die leichte Leinenhose die makellose Form ihres Hinterns. Adrian schnappte wieder nach Luft.
Sie richtete sich auf und fragte: „Kion vi atendas?“9)
Das war für Adrian deutlich. „Atendas“, das hörte sich an wie „warten“ auf Französisch: „attendre“.
Sie wollte offensichtlich los und hatte ihn gefragt, auf was er noch wartete. Adrian zog das Tandem aus der Ecke. Er überprüfte den Luftdruck der Reifen und pumpte beide noch etwas auf. Seine Besucherin hatte sich unterdessen wieder auf den Stuhl gesetzt und trommelte ungeduldig mit den Fingerspitzen auf die Tischplatte. Als Adrian jedoch das Rad zur Tür hinausschob, war sie zur Stelle. Sie half ihm, das Tandem die sieben Stufen bis zur Haustür hinunterzutragen. Auch unten wusste sie sofort, was zu tun war. Sie hob das Hinterrad über die letzte Treppenstufe in die Nische im Flur und wartete, bis Adrian die Wohnungstür geschlossen und die Haustür geöffnet hatte. Dann schob sie das sperrige Tandem auf die Straße, während Adrian die Haustüre aufhielt. Er schaute auf die Fremde und auf das Rad und er war sicher, dass er die richtige Wahl getroffen hatte.
Blut I
Wer zum ersten Mal als Team Tandem fährt, sollte das am besten auf einer verkehrsarmen Fläche testen. Dazu war jetzt keine Zeit. Eine kurze Einweisung musste genügen.
Adrian schwang das Bein über die Stange und stellte sich hinter den Lenker. Er bedeutete seiner künftigen Co-Pilotin, es ihm nachzumachen. Als sie vor dem hinteren Sattel stand, blickte Adrian über die rechte Schulter nach hinten, hob den rechten Arm zur Seite und beugte sich nach rechts. Dann sagte er laut: „Rechts.“
Die gleiche Prozedur auf der linken Seite. Dann schaute er wieder über die rechte Schulter und machte mit dem rechten Arm Vorwärtsbewegungen: „Los“. Dann einige Bewegungen mit dem rechten Arm nach unten: „Stopp“.
Erwartungsvoll schaute er die Fremde an. Die verdrehte kurz und ungeduldig die Augen nach oben. Dann sagte sie: „Mi komprenis.“10) Sie sagte „rechts“ und beugte sich nach rechts. Sie sagte „links“ und beugte sich nach links. Sie sagte „stopp“ beugte sich nach hinten und dann sagte sie „los“ und trat ins Pedal.
„Du hast gar nichts kapiert!“, schrie Adrian und konnte gerade noch rechtzeitig den Fuß aufs Pedal setzen, bevor ihn das in die Ferse gehauen hätte. Dann ging es los.
Die Seitenstraßen im Stuttgarter Osten sind nicht geeignet für ein Tandem-Anfängerteam. Auf beiden Seiten parkende Autos. Lieferwagen in der zweiten Reihe, Schlaglöcher, nur notdürftig geflickt, Baustellen. Es war staubig und heiß. Adrian fuhr langsamer als gewöhnlich. Ständig musste er Hindernisse umkurven, den Gegenverkehr einschätzen, mal bremsen, mal antreten. Er konnte seiner Co-Pilotin keine Hinweise geben. Sie reagierte ordentlich, aber eben oft erst ein oder zwei Tritte versetzt. Dadurch kamen sie immer wieder aus dem Rhythmus. Das kostete sie in der Hitze noch mehr Kraft als üblich. Auf Gangwechsel verzichtete Adrian weitgehend, um nicht unnötig Unruhe in die Trittfrequenz zu bringen. Immerhin schafften sie den Weg, ohne ein parkendes Auto zu streifen. Nach der Unterführung im Schlossgarten ging es besser. Sie hatten mehr Platz und Adrian konnte vorausschauender fahren.
Stuttgart ist keine Stadt für Gelegenheitsradler. Eher etwas für Fahrer mit Ambitionen auf das rot-gepunktete Trikot. Die Fahrt führte Adrian und seine Begleiterin über das grüne U zum Löwentor, dann zum Weißenhof. Von da aus ging es hinüber ins Feuerbacher Tal bis zum Friedhof. Bergauf und bergab, mehr bergauf als bergab. Eine Strecke für Bergspezialisten die in die Beine ging und den Kreislauf belastete. Es wurde für das Tandemteam mühsam und ihre Tritte wurden langsamer, schwerer und unkoordinierter. Die Sonne stand hoch über ihnen am wolkenlosen Himmel und heizte unbarmherzig die Temperatur auf weit über 30 Grad. Im Talkessel stand die Luft und das heiße, schwüle Stadtklima mit Smog und hoher Luftfeuchtigkeit machte vor allem der nordischen Besucherin zu schaffen. Von den Häusern gab es keinen Schatten mehr, der Asphalt reflektierte gnadenlos die Hitze und die Luft flimmerte in der Nachmittagsglut. Das Tandemteam mühten sich immer langsamer voran und seine Koordination kam wieder und wieder aus dem Tritt. Die Fahrt wurde zäher und schweißtreibender und saugte ihnen die letzte Kraft aus den Beinen.
Schließlich rief Adrian: „Stopp“ und machte die vereinbarte Bewegung mit dem Arm nach unten. Sie rollten aus. Die Fremde keuchte und schnappte nach Luft. Adrian wischte sich den Schweiß aus der Stirn, deutete nach vorn und sagte: „Da müssen wir hoch.“
Die Walheimer Straße ist eine der längsten Straßen in Feuerbach und die steilste. Adrian Schleyer wohnte ganz oben, direkt am Waldrand.
Adrian schaute in das Gesicht seiner Begleiterin. Ihr Kopf war hochrot und, was ihm Sorgen machte, um die Nase und unter den Augen war ihre Haut blass.
„Wir schieben“, entschied er. Sie schaute ihn aus großen Augen an und nickte leicht. Jetzt war keine Arroganz mehr in ihrem Blick. Nur noch mühsam aufrechterhaltene Standfestigkeit. Auch sie wollte offensichtlich keine Schwäche zugeben.
Während sie das Tandem die Straße hochschoben, zeigte Adrian auf einige Dinge am Weg. Er wollte sie von der Anstrengung ablenken. Er zeigte auf ein Haus und sagte: „Haus“ auf einen Zaun und sagte: „Zaun“ und auf Hundekot und sagte: „Scheiße.“
Da lachte sie kurz und sagte: „feko.“
Es schien ihr wieder besser zu gehen. Er deutete auf sich und sagte: „Adrian“ dann auf sie und schaute sie fragend an. Sie sagte: „Vigdis“ und lächelte ein kurzes, feines Lächeln. Richtig, er erinnerte sich. In dem Kauderwelsch, das sie zur Begrüßung gesagt hatte, hatte er auch „Vigdis“ gehört. Das war also ihr Name. Adrian schaute sie an. Werde ich nicht mehr vergessen.
Sie schwiegen beide. Adrian trabte wieder los, stetig steil bergauf. Es dauerte Minuten bis sie am Ende der langen Straße waren und die letzten Häuser hinter sich gelassen hatten. Die Straße war nun nicht mehr geteert. Sie liefen über einen breiten Kopfsteinpflasterweg immer weiter in der prallen Sonne den Berg hoch. Das Sträßchen wurde schmaler. Manchmal gab es Ausweichstellen, so knapp bemessen, dass zwei Fahrzeuge nur mit Mühe aneinander vorbei kamen.
Alte, traditionelle Trockenmauern säumten den Weg, immer wieder unterbrochen von schnell hochgezogenen Betonwänden oder Gabionenstützmauern. Meist grenzte entweder ein hoher Drahtzaun oder eine dichte Hecke den Privatbesitz zum Weg und zu den Nachbargrundstücken ab. Zwischen den Grundstücken führten schmale Steintreppen hoch zu den Gärten, Obstwiesen und Weinbergen. In der Regel stand auch eine kleine Hütte auf der Parzelle. Feuerstelle, Regenfass und Gartenbank vervollständigten das kleine Glück der schwäbischen und mittlerweile auch vielen türkischen, griechischen und italienischen Gütlesbesitzer.
Adrian und Vigdis liefen an den letzten Gartengrundstücken vorbei bis zur Wendeplatte und dem Waldparkplatz. Hier oben am Waldrand war der Verkehrslärm der Stadt nur noch leise zu hören. Es war still und heiß und es war kein Mensch zu sehen. Auf dem Parkplatz standen einige Autos. Ihre Besitzer waren entweder im Wald spazieren oder joggen oder hielten ein spätes Mittagsschläfchen in ihren Gärten. Adrian und Vigdis liefen an den Autos vorbei. Einige Schritte noch und sie hatten ihr Ziel erreicht.
Die Villa aus den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts stand mitten in einem verwilderten Garten. Vor zehn Jahren war sie noch ein beliebtes Ausflugslokal gewesen. Aus dieser Zeit stammten die verfallenen Biergarnituren und Gartenstühle, die neben der Hauswand im Vorgarten gestapelt waren. Die Apfelbäume, in deren Schatten früher die Gäste saßen, waren seit Jahren nicht mehr geschnitten worden. Steil wuchsen ihre Asttriebe nach oben. Das Eintrittstor aus rostigem Metall war noch immer gekrönt von dem Wirtshausschild, das ehemals beleuchtet gewesen war. „Wirtshaus zum Hohen Berg“ konnte darauf noch entziffert werden. Jetzt war das Frontglas an einer Ecke eingeschlagen und links und rechts wuchsen Rosen an den Metallstreben hoch.
Adrian blieb stehen. Es war still, sehr still. Keine Vögel zwitscherten, keine Insekten summten … nichts. Adrian schaute sich um, runzelte die Stirn. Was er sah und dass er keine Geräusche hörte, gefiel ihm nicht. Das Gartentor stand halb offen und ebenso die Haustür. Adrian merkte, wie ihm der Schweiß den Rücken hinablief. Was war hier los? Vorsichtig drückte er das Gartentor auf und schob das Tandem durch. Noch immer war nichts zu hören. Adrian lehnte das Tandem an den alten Jägerzaun. Das Geräusch, als der Lenker an dem Holz ein Stückchen entlangschabte, drang wie aus weiter Ferne an sein Ohr.
Er schaute auf Vigdis. Sie zögerte, durch das Tor zu gehen und blickte ihn mit weitgeöffneten Augen an. Als er Richtung Haus lief, kam sie ihm nach und fasste ihn am Oberarm, so als ob sie ihn zurückhalten wollte. Adrian spürte, wie es in seinem Bauch kribbelte. Was stimmte hier nicht? Das offene Tor, die angelehnte Haustür, aber niemand war weit und breit zu sehen oder zu hören. Das Kribbeln wurde stärker. Adrian merkte, wie es in seine Arme und in seine Beine kroch, wie es machte, dass er zitterte, wie sein Herz anfing zu hämmern. Dies war das Gefühl, wenn er mit seinem Rad vor dem Abgrund stand, kurz bevor er antrat. Adrenalin schoss in seine Adern und machte ihn hellwach.
Leise und gespannt wie eine Stahlfeder lief er durch den Vorgarten. Vor der Eingangstür blieb er stehen, drückte sie vorsichtig mit den Fingerspitzen auf und versuchte, durch den Spalt etwas in dem dunklen Flur des Hauses zu erkennen. Nichts regte sich. Er drückte die Tür weiter auf, doch ein Keil verhinderte, dass er die Tür ganz öffnen konnte. Adrian zwängte sich durch den Spalt, trat den Türkeil zur Seite und winkte Vigdis, ihm zu folgen. Die zögerte wieder einen Moment, kam ihm dann aber nach.
Adrian trat in den dunklen Flur. Alter Steinfußboden mit schwarzen und weißen Fliesen im Schachbrettmuster von denen die meisten Risse hatten. Der Geruch von feuchtem Haus und langsamen Verfall lastete schon seit Jahren im Treppenhaus. Da half auch kein Lüften mehr. Eine steile Holztreppe führte in den oberen Stock. Ein widerlicher Geruch stieg ihm in die Nase. Das war nicht nur der übliche Mief eines alten Hauses. Von fern war ein leises Sirren zu hören, unangenehm wie das Summen einer Schnake im Schlafzimmer kurz vor dem Einschlafen. Die Zimmertür am Flurende stand offen. Tageslicht fiel durch den Spalt auf den dunklen Flur.
„Adrian, bist du da? Adrian, Besuch!“, rief Adrian. … War da ein Geräusch?
„Adrian, hallo, Besuch!“, rief Adrian noch einmal und lief zu der Tür. Er öffnete sie. Dann traf es ihn mit voller Wucht.
Blut. Überall im Zimmer. Hell ins Licht getaucht von der heißen Nachmittagssonne. Blut an der Wand, Blut an der Decke und Blut in dicken trägen Schlieren an der Fensterscheibe. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann. Oder das, was von ihm übrig geblieben war. Der halbe Kopf war weggerissen. Ein Auge glotzte Adrian tot an. Es baumelte am Sehnerv unter der Augenhöhle. Ein Brei aus Hirn, Blut, Knochensplittern und Haaren war auf die Schulter gelaufen. In der Brust klaffte ein großes Loch. Adrian sah in dem blutigen Matsch, wie das Herz noch vibrierte, wie das Blut in kleinen Rinnsalen aus dem zerfetzten Brustkorb lief, weniger und weniger.
Vor dem Tisch: die Reste eine junge Frau. Die Leiche war fast zweigeteilt. Unter ihr eine Lache aus Blut, Urin und Kot. Die Soße verbreitete sich, wuchs langsam und nichts hielt sie auf. Sie sickerte in die Spalten des alten Parkettfußbodens, lief direkt auf Adrian zu. Der Kopf der Frau war blutiger Brei aus langen blonden Haaren und grauer Hirnmasse, durchzogen von schwarzen und roten Äderchen. Weiße, scharf gesplitterte Knochen stachen wie Speerspitzen aus der grauenvollen Pampe heraus. Aus den Mundwinkeln troff Spucke und Blut. Die Zunge hing blaurot heraus.
Die ersten dicken, metallisch schimmernden Fliegen hatten sich eingefunden und krabbelten mit ihren schwarzen, haarigen Füßen auf dem Matsch. Sie hatten dieses ekelhafte Sirren verursacht, wenn sie mit ihren kleinen Flügeln hochsummten, um eine noch bessere Stelle auf dem warmen Brei zu finden. Dumpf lag die Luft in dem Raum. Wie eine schwere Masse, die alles erstickte.
Adrian tastete nach dem Smartphone in seiner Gürteltasche. Seine Hand zitterte. Sein Mund war trocken. Die Luft in dem Raum nahm ihm den Atmen. Er würgte und hörte das widerliche Summen der Schmeißfliegen, wie wenn er Wasser in den Ohren hätte. Er sank langsam mit dem Rücken am Türrahmen zu Boden.
Vigdis drängte sich an ihm vorbei. Er sah sie wie in Zeitlupe. Wie durch ein altes, schlieriges Fensterglas. Sie nähert sich dem Schreibtisch. … Tritt mit ihren Sandalen in die Pfütze bei der Frauenleiche. … Der Saft saugt und pappt. … Zieht den Fuß wieder hoch. … Lange Fäden zwischen Fußboden und Schuhsohle.
Adrian kämpfte um seinen klaren Verstand. Seine Sehwahrnehmung wechselte hin und her wie der Autofokus einer Spiegelreflexkamera, der ein Objekt zum Scharfstellen sucht. Scharf, unscharf, scharf, unscharf. Dann … endlich: Schärfe eingestellt, Blick wieder klar, überdeutlich. Adrian wurde zum Wissenschaftler, der in einem sicheren Labor sitzt und etwas Interessantes beobachtet: Vigdis quetscht noch einen weiteren nassen, klebrigen Schuhabdruck auf den Dielenboden. Jetzt bleibt sie vor dem Schreibtisch stehen. Da liegt eine schwarze Ledermappe. Die dreht sie zu sich her. Eine Inschrift in goldenen Lettern auf dem Einband, geprägt.
Er hörte, wie Vigdis laut vorlas: „Penéds bevin Johann Martin Schleyer e Friedrich Bergmann.“11)
Sie blickte auf und sagte: „Ĉi tio estas Volapuko.“12)
Dann öffnete sie die Mappe. Sie war leer.
Jetzt war es Adrian wieder voll bewusst, wo er war: mitten in einer entsetzlichen Wirklichkeit. Ich sitze in einer Blutlache auf dem Fußboden in einem Horrorhaus.
In seinem Kopf begann es wieder zu kreiseln. Aber er schaffte es, sein Handy hervorzuziehen und die 110 zu wählen. Er wusste nicht, wie lange er das Freizeichen hörte. Es erschien ihm unendlich lang. Dann endlich: „Polizei, Notrufzentrale.“
„Mord … zwei Tote … Walheimer Straße in Feuerbach … ganz oben … die alte Villa am Wald ...“
Mehr konnte Adrian nicht mehr sagen.
Ein lautes Geräusch war an seine Ohren gedrungen. Es schoss bis in die Gehirnregion, in der es nur ums Überleben geht: Ein Poltern auf der Treppe! Adrian war hochgeschnellt, bis in die Haarspitzen überschwemmt mit Adrenalin, alle Instinkte geweckt, alle Sinne scharf, geweiteter Blick, Muskelspannung bis zum Anschlag.
Eine Waffe … Wo ist eine Waffe? Da: die Figur auf dem Tischchen! Die Eingangstür knallte zu. Adrian schaltete von Angst auf Angriff.
Der Mörder flieht. Ich muss ihn fassen.
Kein Gedanke an Konsequenzen. Adrian war blitzschnell bei der Tür. In der rechten Hand die Bronzefigur eines griechischen Philosophen. Vigdis folgte ihm dicht hinterher.
Der Mörder hatte die Tür zugeschlagen. Adrian drückte auf die Klinke und wollte die Tür öffnen. Er zog daran, aber sie ging nur einen kleinen Spalt auf. Adrian war aus Versehen beim Vorwärtsrennen mit dem Fuß gegen den Türkeil gestoßen und hatte den Keil dabei in den Türspalt gekickt. Nun blockierte der Keil die Tür und dann stand auch noch Vigdis so dicht hinter ihm, sodass er sich nicht richtig bücken konnte, um den Keil zu entfernen. Also musste er sich wieder aufrichten und sich zu ihr umdrehen und ihr bedeuten, einen Schritt zurückgehen. Dann zog er mit aller Kraft an dem Keil, bis er ihn schließlich unter der alten, schweren Eichentür gelöst hatte. Nun endlich kam er nach draußen.
Der Mörder hatte das Tandem auf den Weg geworfen. Es hatte sich in den Rosen am Torbogen verhakt und lag quer zum Tor. Adrian konnte nicht einfach darüber springen. Er musste vorsichtig über das Rad steigen und dabei aufpassen, dass er nicht in die Speichen trat oder von den Rosendornen gestochen wurde. Der Mörder hatte das Tor zugeworfen. Auch das klemmte, und auch das ging nach innen auf. Bis Adrian endlich sein Tandem aus dem Weg geschoben und das Tor geöffnet hatte, hörte er nur noch, wie eine Autotür zugeschlagen wurde und ein Motor ansprang.
Adrian rannte auf dem Weg bis zum Parkplatz. Er sah kein Auto mehr auf der Zufahrt. Konnte er das Auto mit dem Tandem verfolgen? Nein, das war zwecklos. Bis er auf der Straße war, war der Mörder schon längst im allgemeinen Verkehr untergetaucht. Wieder wählte Adrian die 110. Wieder schien es ihm endlos zu dauern, bis abgenommen wurde und als er sagte, dass ein Mord passiert wäre und dass schnell die Polizei kommen solle, sagte der Mensch am anderen Ende der Leitung: „Schon wieder ein Mord“ und fragte „wo ist der passiert?“
Adrian drückte auf „Beenden“ und lief den Kopfsteinpflasterweg nach unten Richtung Stadt. Auch von dort aus sah er kein fahrendes Auto auf dem Weg. Adrian schaute zu dem Parkplatz. Er erinnerte sich nicht mehr, welche Automarken dort gestanden hatten und welches Auto fehlte. Er war viel zu sehr mit Vigdis beschäftigt gewesen, als dass er sich solche Details gemerkt hätte.
Wann kam denn nun endlich die Polizei? Er lief zur Villa hoch. Dort stand Vigdis am Gartentor. Sie hielt sich an dem Jägerzaun daneben fest. Er schaute sie an. Sie schwiegen, warteten. Beide gefangen in dem Grauen, das sie gesehen hatten.
Es dauerte und dauerte, bis Adrian endlich ganz unten in der Stadt ein Blaulicht blitzen sah, und es schien ihm noch unendlich viel Zeit zu dauern, bis die Polizei bei ihnen war.
Polizei I
Adrian kam sich vor wie in einem Käfig. Er saß in einem kahlen Büro der Polizeistation. Die in hellgrün gestrichenen Wände hätten dringend einen neuen Anstrich gebraucht. Auf dem Fensterbrett standen ein verstaubter Kaktus und eine grüne Lilie, die offensichtlich wusste, wie man hier überlebt: Mit einem mitleiderregenden Eindruck, sodass Besucher sich genötigt sahen, ihr immer mal wieder einen Schluck Wasser zu reichen. Der eigentliche Bewohner des Büros kam augenscheinlich nur selten auf diese Idee. Das sparsame Mobiliar stammte aus den frühen 60er-Jahren, vielleicht auch aus einer noch älteren Epoche. Adrian beugte sich vor und begutachtete den hölzernen Aktenrollschrank. Der hat sicher schon die Weltwirtschaftskrise überlebt. Adrian rüttelte an dem Griff. Der Schrank war abgeschlossen. Adrian rüttelte stärker. Stabil. Keine Chance, ihn aufzubekommen. Der überlebt auch noch das Internetzeitalter.
Anfangs war Adrian froh gewesen, dass die Polizisten ihn in diesen kühlen Raum geführt hatten. Immerhin: Da war die eine Polizeibeamtin, die hatte ihm eine Flasche Mineralwasser auf den Tisch gestellt. Die Flasche hatte er in wenigen Sekunden geleert. Die Polizistin im Vorzimmer. Die ist nett. Die wusste sofort, was zu tun war. Vom Aussehen her ein ganz anderer Typ wie Vigdis. … Aber auch sehr attraktiv. … Vor allem der Busen. Der ist ordentlich.
Leider hatte die Beamtin ihm nichts zu essen gebracht. Wäre ja auch zu viel verlangt gewesen. Den Sprudel hat sie ja schon aus ihrem eigenen Korb unter ihrem Schreibtisch geholt. Es gibt demnach auch unter Polizisten prima Menschen.
Adrian hatte seit dem Frühstück nichts mehr in den Magen bekommen. Mittlerweile hatte er den Schock mit den Leichen verdaut. Bei dem Gedanken an die Toten fühlte er aber sofort wieder, wie die Magensäure die Speiseröhre hochkroch. Sein Magen schmerzte. Wie lange das alles dauert.
Durch die Glastür hörte er Stimmen, aber die Tür dämpfte den Schall. So konnte er die einzelnen Worte nicht unterscheiden. Ohnehin hätte er Schwierigkeiten gehabt, dem Gespräch zu folgen, denn seine schöne Begleiterin erzählte in ihrer seltsamen Sprache ihre Geschichte. Es war Esperanto, was die junge Schönheit sprach. Und nun war ein großer, grauhaariger Mann mit Silberbrille bei ihr und übersetzte, was sie sagte. Adrian stauchte zornig gegen das Tischbein. Schmieriger, notgeiler Typ, dieser Esperantonkel. Hat gleich seinen Arm um ihre Schulter gelegt und sie bei jeder Gelegenheit angegrabscht.
Adrian hatte es genau beobachtet: Vigdis hatte sich gegen das Berührtwerden gewehrt. Das hatte den Esperanto-Papst aber wenig beeindruckt. Er hatte einfach weitergemacht. Adrian ärgerte sich. Je länger er wartete, desto mehr. Und jetzt war er richtig wütend und ungeduldig. Er trat erneut gegen das Tischbein. Nikolaus Groß, der Esperanto-Oberguru! Drecks-Professoren-Typ. Der Esperantoguru hat es einfach nötig. Hat jeden Busen angestarrt. Natürlich auch den der netten Polizistin, die hier alles organisiert. … Na ja, der ist ja auch nicht zu übersehen. Aber so wie der Espi geguckt hat, reduziert der sie nur auf ihren Busen.
Adrian hatte das Bild noch genau im Kopf: Nikolaus Groß hatte erst dann von den großen Polizistinnen-Brüsten weggesehen, als die Polizistin ihm ein Foto von der Briefmappe gezeigt hatte, die auch Vigdis bereits so interessiert am Tatort besichtigt hatte. Erst als die Polizistin ihn gefragt hatte, was die Worte bedeuteten, hatte Groß von der üppigen Oberweite weggeschaut und einen noch gierigeren Blick bekommen.
Groß hatte gelesen: „Penéds bevin Johann Martin Schleyer e Friedrich Bergmann.“
Und dann hatte Groß gesagt: „Das ist gar nicht Esperanto. Das ist Volapük, ebenfalls eine Kunstsprache, die Ende des 19. Jahrhunderts eine kurze Blütezeit erleben durfte. Auf der Mappe steht: Briefe zwischen Johann Martin Schleyer und Friedrich Bergmann.“
Adrian hatte gesehen, wie nervös Groß wurde, als er dann gefragt hatte: „Und, wo sind die Briefe?“
„Das möchten wir auch gerne wissen“, hatte ihm die Polizistin geantwortet und die Tür geschlossen, sodass Adrian nichts mehr von der Unterhaltung hatte hören können.
Im Raum nebenan saßen Vigdis, der leitende Polizeibeamte und als Dolmetscher Nikolaus Groß. Vigdis war erleichtert, sich mit jemand auf Esperanto unterhalten zu können. Sie war Teil des weltweiten Esperanto-Netzwerkes. Auch sie war froh, bei der Polizei zu sein. Noch immer stand ihr der Schweiß auf der Stirn. Von der Hitze und von dem Schock, der gekommen war, nachdem sie nicht mehr nur funktionieren musste, sondern wieder denken konnte. Sie zitterte. Was wäre geschehen, wenn sie gleich die richtige Adresse gefunden hätte? Läge sie dann ebenfalls tot vor dem Schreibtisch in der alten Villa? Sie und Adrian waren ja nur Minuten nach dem Mord in die Villa gekommen. Warum ist der Mörder geflohen? Er hätte uns doch auch noch umbringen können ...
„Nun bonvolu diri al mi de la komenco. Kial vi venis al Stuttgarto?“13)
Der bärtige Esperantist beließ es nicht bei den Worten. Er tätschelte Vigdis, es sollte wohl nur freundschaftlich sein, mit der Hand mehrmals auf ihr Knie. Das brachte Vigdis wieder in die Gegenwart. Sie schob die Hand beiseite und rückte ein wenig von dem Alten ab.
Sie rekapitulierte: Die Polizisten hatten sie und ihren Begleiter schnell vom Tatort weggefahren. Das Tandem hatten sie zur Spurensicherung beschlagnahmt. Vigdis musste lächeln, als sie daran dachte, wie empört der Radfahrer-Adrian darüber gewesen war. Nun war sie also in diesem Polizeirevier in Stuttgart.
Die Beamten hatten versucht, auf Deutsch und auf Englisch mit ihr zu sprechen. Sie hatte nicht geantwortet. Stattdessen hatte sie einen Kugelschreiber und ein Blatt Papier vom Schreibtisch genommen und in Großbuchstaben ESPERANTO darauf geschrieben. Das hatte gereicht. Die Polizisten hatten ein paar Telefonate geführt und hatten dann auch schnell jemanden gefunden, der für sie dolmetschen konnte. Es hatte keine zwanzig Minuten gedauert, bis er da war: Nikolaus Groß, einer der nicht nur von der Statur und vom Namen her ganz Großen in der deutschen Esperantoszene. Typischer Professorentyp. Die grauen Haare waren gelockt und schon ein wenig zu lang. Ein dünner, weißer an der Kinnlinie entlanggezogener Bartstreifen und die goldene Brille gaben ihm den perfekten professoralen Habitus. Er trug trotz der Hitze einen grauen altmodischen Anzug mit weißem Hemd und blau-brauner Paisley-Krawatte. Die Schuhe waren sicher einmal teuer gewesen, jetzt aber vorne abgestoßen. Am Handgelenk trug er eine Stahl-Daytona. Der Herr Professor roch ein wenig nach Staub, Mottenpulver und altem Schweiß, vermischt mit schnell aufgesprühtem Herrenparfüm. Er hatte sie gerade aufgefordert, alles von Anfang an zu erzählen, warum sie nach Stuttgart gekommen war.
Vigdis kam mit seinem Erscheinungsbild nicht richtig klar. Hat der sich absichtlich so gekleidet? Oder ist ihm das nicht bewusst, wie er wirkt? … Ich habe mich ja auch bewusst als Hippiefrau angezogen. Wollte ein wenig wie aus der Zeit gefallen wirken. Das passt vermutlich für viele mit Esperanto zusammen. Hat ja jetzt auch bei den Polizisten geklappt. Die halten mich für ein wenig seltsam und machen alles für mich. So wie der Radfahrer-Adrian. … Na ja, der ist natürlich auch scharf auf mich. Ich habe schon gewusst, warum ich Bein gezeigt habe.
Sie lächelte. Na ja, er hat ja auch viel von sich gezeigt. Hat mir gefallen, was ich gesehen habe – über 180 groß, breite Schultern, schmaler Knackarsch, Muskeln, Sixpack, durchtrainiert. … Der hat sicher an jedem Finger zehn Frauen. … Na ja, mir hat bisher auch noch jeder Mann aus der Hand gefressen, … wenn ich das wollte.
Sie kam in die Gegenwart zurück und schaute wieder zu Groß. Der Mann war schwer einzuordnen. Sie rückte vorsichtshalber noch ein Stück weiter von ihm weg, bevor sie begann: „Estis“14), sagte Vigdis und sie erinnerte sich an den Tag vor einem Monat auf Island, als ihre Schwester Finbogi ihr zugerufen hatte, auf den Dachboden zu kommen.
Rückblick Island
„Vigdis, komm schnell. Ich bin auf dem Dachboden. Ich habe etwas gefunden, das uns reich machen kann!“
Vigdis hörte die Stimme von Finbogi und verdrehte die Augen. Immer war ihre ältere Schwester auf der Suche nach dem schnellen Geld. Wie konnte ein Mensch nur so seine Seele daran hängen? Finbogi, die ist so geldgierig, … hat ja auch Buchhaltung gelernt. Zeigt mir immer wieder die Abrechnungen von unserem gemeinsamen Konto und wie sie das Geld hin und her geschoben hat. Heischt dann um Beifall, wenn sie mir zeigt, wie sie wieder irgendwo einen halben Prozentpunkt mehr herausgeschlagen hat. … Ich lob sie ja dann auch und sag immer, dass ich nichts davon verstehe. Tu ich ja auch nicht. Interessiert mich nicht. Haushalten ist ganz einfach. Du musst nur weniger ausgeben, als du einnimmst. Dann musst du dich nicht mehr um Prozente und Geldanlagen kümmern, sondern kannst in dieser Zeit Schöneres tun.
Vigdis legte ein Lesezeichen in das Buch, das sie gerade gelesen hatte und legte das Buch dann auf den kleinen Tisch vor ihrem Sessel. Natürlich sehe ich, dass sie mehr Geld verbraucht als ich. So weit kann ich rechnen. Soll sie doch auf meine Kosten leben, wenn es sie glücklich macht.
„Ich komme!“, schrie Vigdis zurück. Sie saß in der Bibliothek des Herrenhauses ihres Onkels. Die war in den vergangenen Jahren zu ihrem Lieblingsplatz geworden. Bücherschränke aus altem Nussbaumholz säumten drei Seiten des großen Raumes. In die Schranktüren waren Sprossenfenster mit geschliffenen Gläsern eingelassen. So waren die Schätze dahinter vor Staub geschützt. Sparsame Intarsien-Arbeiten im Jugendstil-Dekor zierten die Möbel. Wertvolle Orientteppiche, zum Teil überlappend, dämpften die Schritte der Besucher. In den Ecken des Raumes standen Lesesessel. Daneben entweder ein kleiner Ablagetisch mit Tiffany-Lampe oder an Vigdis Lieblingsplatz, eine Stehlampe und davor ein kleiner runder Tisch, wo sie eine Wasserkaraffe, ein Glas und eine Schale mit Gebäck stehen hatte. Die Steh-Lampe mit ihrem bunten Glasschirm strahlte ihr Licht direkt über den Kopf der Leserin.
Die erhob sich jetzt widerwillig aus dem alten Ledersessel und genoss noch einmal die Atmosphäre des Raumes. Eine Deckenleuchte, ebenfalls Tiffany in geometrischem Dekor, tauchte den Raum in ein warmes Licht. Oberhalb der Terrassentür schien die Sonne durch ein Fries farbiger Jugendstilfenster, das sich über die gesamte Außenwand zog. Schwäne, Seerosen und Lilien wechselten sich ab. Abgeschlossen wurde das Fries links und rechts von zwei schmalen hohen Fenstern in gleichem Stil. Links ein Flussgott mit Bart und Dreizack, rechts eine zarte Wassernixe, nur mit langem Haar bekleidet. Diese Abschlussfenster reichten bis fast zur Bauchhöhe nach unten.
Neben der Terrassentür, deren Glasfüllung nur mit geometrischen Formen gestaltet war, stand ein großer Schreibtisch und auf der anderen Seite der Tür befand sich eine Sitzecke mit Sofa und niederem Couchtisch. An der einen Schmalseite des Raumes war ein offener Kamin, an der anderen stand ein Schrank mit Ablagefläche. Im unteren Teil, der durch zwei Türen verschlossenen war, waren hochwertige Spirituosen untergebracht. Armagnac, Cognac, schottischer und irischer Whisky, Gin … Im oberen Teil standen geschliffene Trinkgläser hinter zierlichen Sprossenfenstern. Die gesamte Einrichtung stammte aus der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Die Spirituosen waren nur unwesentlich jünger. Die Bücher nicht. Hier war die gesamte Weltliteratur von den Klassikern bis zu den aktuellen Bestsellern versammelt. Werke auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch, auf Dänisch, die meisten auf Isländisch. Jeder Sprache war mindestens ein Bücherschrank gewidmet. An der prominentesten Stelle direkt neben dem Eingang, stand ein Schrank voll mit Büchern in Esperanto.