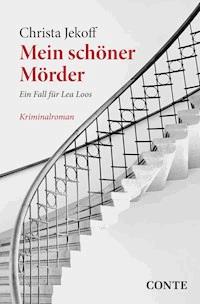Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Johanna ist Studentin, jung, verführerisch, selbstbewusst – und sie liebt das Spiel mit der Liebe. Als sie Richard Lorentz begegnet, befindet sich der verheiratete Schriftsteller in einer Schreibkrise. Doch ihre Affäre ist nicht von Dauer. Krank vor Eifersucht beginnt Lorentz einen neuen Roman: er bringt den erfolgreichen Geschäftsmann Philipp Urban mit Johanna zusammen und schreibt die Geschichte der Liebenden nieder. Doch die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen. Als Urban Opfer eines Mordanschlags wird und Lorentz seine Romanfigur ebenfalls sterben lässt, beginnt ein spannendes Verwirrspiel in der Mainmetropole Frankfurt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Fiktion entspringt dem Verlangen nach Wahrheit.«
Connie Palmen, I.M.
»In der Liebe ist alles wahr, alles falsch. Sie ist das einzige Ding, über das man nichts Absurdes sagen kann.«
Nicolas Chamfort, Aphorismen
Prolog
Er hatte jegliche Orientierung verloren.
Es herrschte dichter Nebel, und der Boden unter seinen Füßen war weich. Manchmal lichteten sich die Schwaden ein wenig, und dann glaubte er, einen nackten Frauenkörper zu erkennen, einen eher knabenhaften Frauenkörper.
»Johanna?«, rief er fragend, denn das Gesicht war von Nebel verhüllt.
Er bekam keine Antwort, und immer, wenn er versuchte, sich der Gestalt zu nähern, versanken seine Füße im schlammigen Boden. Er versuchte, sich zu befreien, doch der Morast hielt ihn fest, und er sank immer tiefer. Die Gestalt blieb unerreichbar.
Plötzlich sah er sich von vielen Menschen umringt. Sie trugen Bücher bei sich, und er erkannte seinen Namen auf dem Einband. Er bat sie, ihn aus dem Morast herauszuziehen, doch stattdessen begannen sie, ihn zu beschimpfen.
Sie riefen: »Mörder, Mörder!«, und warfen mit den Büchern nach ihm.
Er versuchte, ihnen zu erklären, dass er nur der Autor des Romans sei, doch sie hörten ihm nicht zu. Die Bücher begruben ihn unter sich und er drohte, in dem Morast unterzugehen. Er schrie und versuchte verzweifelt, sich an den Büchern festzuhalten, doch sie versanken mit ihm.
Noch immer schreiend wachte er auf. Keuchend umklammerte er den kühlen Messingrahmen des Ehebettes.
»Beruhige dich, Liebling, du hast wieder geträumt«, sagte seine Frau. »Es ist alles gut, mein Schatz.«
Kapitel 1
Der Mann in dem dunklen Anzug stand gleich neben der Eingangstür.
Wahrscheinlich war er später gekommen und hatte in der überfüllten Buchhandlung in Frankfurt-Sachsenhausen keinen Platz mehr gefunden. So etwas passierte häufiger, wenn Richard las. Anders als sonst war, dass Richard glaubte, den Mann zu kennen und dass ihn das ängstigte. Besonders weil er nicht wusste, wo sie sich begegnet waren.
Anfangs hatte er kaum gewagt, Lesungen zu halten, weil er fürchtete, jemand von damals könnte auftauchen, oder das Publikum könnte aggressiv reagieren. Doch das Publikum, in der Hauptsache Frauen, war stets auf seiner Seite gewesen.
Die meisten kamen wohl aus Neugier. Vermutlich hatten sie ihn sich anders vorgestellt, mehr wie ein Ungeheuer vielleicht, weniger sympathisch. Doch sie ließen sich von seiner angenehmen Stimme gefangen nehmen. Er wirkte fast schüchtern, wenn er etwas über die Gefühle seines Helden vorlas, sich die dunklen Haare aus dem ansehnlich geschnittenen Gesicht strich und ein wenig unsicher lächelnd aufblickte.
Am Ende einer Lesung jedenfalls glänzten die Augen seiner weiblichen Fans, ihre Lippen waren leicht geöffnet, und mit der Zeit hatte Richard den Eindruck gewonnen, der Albtraum sei vorbei – bis er nun den Mann im dunklen Anzug sah, klein, schmächtig, mit einer dicken, randlosen Brille und einer bedrohlichen Aura.
Richard kam nicht dagegen an. Er begann zu schwitzen und als er umblätterte, sah man, dass seine Hände zitterten. Er merkte, dass seine Stimme nicht mehr trug, überschlug ein paar Seiten und kam zum Schluss.
»Ich wusste, ich würde nicht mehr von ihr loskommen«, las er mit deutlicher Anstrengung.
Einen Moment lang herrschte atemlose Stille. Dann brach frenetischer Beifall los. Die unverhüllte Bewegtheit des Autors gefiel den Leuten.
Eine junge Journalistin schoss mehrere Fotos. Das Blitzlicht blendete Richard und für ein paar Sekunden gab er dem Bedürfnis nach, die Augen zu schließen – wie ein Tier, das sich totstellt.
»Und nun«, hob der Buchhändler an, sobald der Applaus abebbte, »wenn Sie Fragen haben, steht Ihnen Herr Lorentz gern zur Verfügung.«
Es waren immer die gleichen Fragen. Sie kreisten um die Authentizität seiner Figuren. War er nun identisch mit dem Schriftsteller in seinem Roman oder war er es nicht?
Normalerweise setzte Richard eine geheimnisvolle Miene auf, sprach über die »Wirklichkeit« aller guten Geschichten und verwickelte sein Publikum in ein Spiel von Dichtung und Wahrheit. Seine Leser liebten den Flirt mit der Vorstellung vom leibhaftigen Bösen.
Doch in Gegenwart des Mannes in dem dunklen Anzug war es ihm nicht möglich, den Funken zu entfachen. Er zwang sich, nicht zu ihm hinzusehen.
»Nun, manches ist Fiktion, manches hat man erlebt. Das vermischt sich …«, sagte er steif.
»Ist die Hanna aus Ihrem Buch dieselbe Person wie das vermisste Mädchen?«, wollte jemand wissen.
»Laut Medien heißt das Mädchen in Wirklichkeit Johanna und ist unauffindbar«, warf ein anderer ein.
Bald redeten mehrere Personen durcheinander.
»Wie schlimm war es für Sie, gleich nach dem Erscheinen des Buches verhaftet zu werden?«
»Hat man Sie laufen lassen, weil Ihre Unschuld erwiesen ist?«
Richard räusperte sich, kam aber nicht zu Wort.
Eine intellektuell wirkende Dame verschaffte sich Gehör. »Merken Sie denn nicht, wie sensibel dieser Mann ist?«, fragte sie streng in die Runde und fügte energisch hinzu: »Er kommt doch als Täter überhaupt nicht in Frage. Schriftsteller bewältigen ihre Obsessionen bekanntlich beim Schreiben!»
»Außerdem hat er das Buch geschrieben, bevor der Mord geschehen ist«, fiel ein blasses Mädchen ein.
Zustimmendes Murmeln erfüllte die Buchhandlung.
»Dies könnte ebenso gut ein Zeichen besonderer Raffinesse sein«, sagte eine männliche Stimme.
Ohne hinzusehen, wusste Richard, dass die Stimme dem Mann in dem dunklen Anzug gehörte.
»Zuerst beschreibt man die geplante Tat in einem Roman«, sprach der Mann weiter, »dann begeht man sie – gewissermaßen im Schutz der Öffentlichkeit – und präsentiert sie anschließend in Lesungen, vergleichbar einem Täter, den es ständig an den Ort des Verbrechens zurücktreibt.«
Der Mann hatte freundlich und unaufgeregt gesprochen, so wie man eben ganz unpersönlich eine interessante Theorie zur Diskussion stellt, nichts weiter. Doch seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Leute waren verstummt.
Richards letzte Hoffnung, das Auftauchen des Mannes könnte vielleicht doch ein Zufall sein, schwand. Übelkeit stieg in ihm auf. Er hatte wieder den süßlichen Geruch in der Nase – wie damals, als seine Hände und Kleidung voll mit Blut waren. Sein Konterfei, das ihn von Plakaten aus jedem Winkel der Buchhandlung anblickte, darunter der Titel des Buches Liebe und andere Lügen, verschwamm vor seinen Augen zu einer höhnischen Fratze. Und plötzlich wusste er, wo ihm der Mann bereits begegnet war.
Wie von weit her hörte er jemanden lachen. Es war ein junger Mann, der sich offenbar nicht so leicht beeindrucken ließ.
»Ach, was«, rief er forsch, »das ist doch alles bloß eine Verkaufsmasche: Ein Schriftsteller outet sich in seinem eigenen Buch als Monster, und wir fallen prompt darauf herein.«
Der junge Mann erntete allseits befreites Gelächter.
Der Buchhändler ergriff die Gelegenheit, den Verkauf einzuläuten.
Danach – Richard hatte wie in Trance die verkauften Exemplare signiert – war der Mann im dunklen Anzug verschwunden.
Markus Engel, sein Lektor, der es sich nicht nehmen ließ, an den Lesungen seines Autors teilzunehmen, legte ihm besorgt die Hand auf die Schulter. Der Verlag war sein Leben und die Figuren in den Büchern waren, je nach dem, seine Freunde oder Feinde, über deren Schicksal er wachte wie ein Gott. Er hatte Richards Nervosität bemerkt.
»Was war los, bist du krank?«, fragte er leise.
»Nein, es ist alles okay«, log Richard.
Zum Glück belegte ihn das Publikum mit Beschlag und ersparte ihm weitere Erklärungen. Engel zuliebe trank Richard schließlich mit sogenannten wichtigen Leuten ein Glas Sekt. Die Leiterin des Kulturamtes bedrängte ihn, bei der Veranstaltung Literatur im Park zu lesen, und ein Redakteur bestand darauf, ihm seine Freundin vorzustellen, die Gedichte schrieb. Gott sei Dank genügte sich die kulturelle Elite bald selbst, und Richard gelang es, ins Freie zu entkommen.
Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt, und bis auf ein Pärchen, das vor der Kneipe gegenüber in ein Taxi stieg, war niemand auf der Straße. Für die Nachtschwärmer war es noch zu früh.
Erschöpft lehnte sich Richard an die Schaufensterscheibe der Buchhandlung und zündete sich eine Zigarette an.
»Haben Sie auch eine für mich?«, hörte er eine junge, weibliche Stimme fragen.
Im Schein der Straßenlaterne erkannte er die Journalistin mit dem Blitzlicht. Sie hatte Sommersprossen und sehr kurze rote Haare, die wie Stacheln eines Igels in Abwehrhaltung abstanden.
Wenig begeistert hielt er ihr die Packung hin.
»Feuer auch?«, fragte sie.
Seine Hand, die das Feuerzeug hielt, zitterte noch immer. Sie schien es zu bemerken.
»Ihre Nerven scheinen nicht die besten zu sein.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«, entgegnete er gereizt, was er im selben Moment bereute.
»Na ja, Sie wirken ziemlich mitgenommen. Hat Sie der Mann mit seiner Theorie so aus der Fassung gebracht?«
»Unsinn.« Richard zwang sich zu einem Lachen. »Meine Nerven sind ganz in Ordnung. Wenn Sie wüssten, mit wie vielen Spinnern ich in der letzten Zeit zu tun hatte …«
Die Journalistin zog die Brauen hoch. »Ein Spinner ist der jedenfalls nicht.«
»Sie kennen ihn?« Die Frage war viel zu schnell gekommen, und Richard wusste es.
Die Journalistin hatte es offenbar auch bemerkt. »Kann schon sein«, antwortete sie herausfordernd.
Wachsam taxierten sie einander.
»Ist ja auch egal«, sagte Richard mit gespielter Gleichgültigkeit.
Die Medien waren nicht eben schonend mit ihm umgegangen, und er fürchtete neue Spekulationen. Er trat die Zigarette aus und machte Anstalten, in die Buchhandlung zurückzugehen.
»So cool auf einmal?« Die Journalistin lachte leise. »Bei Gericht ist die Meinung dieses Herrn jedenfalls sehr gefragt.«
Wie unter Zwang wandte Richard sich ihr wieder zu. Er konnte das Räderwerk in ihrem Kopf arbeiten hören.
»Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft«, sagte sie und entnahm ihrer Tasche eine Visitenkarte. »Den Namen des Mannes gegen eine Homestory. Unsere Leser wollen doch wissen, wie der Autor von Liebe und andereLügen lebt. Denken Sie darüber nach.«
Damit ließ sie ihn stehen und ging zu ihrem Mini, der schwarz wie die Nacht auf einem Parkplatz am Main stand.
Wütend drehte Richard am nächsten Tag die Karte zwischen seinen Fingern. Cora West stand darauf, und dass sie für das City-Journal arbeitete. Gerissene rothaarige Hexe! Sie hatte seine Panik gespürt und gleich eine Story gewittert. In der Nacht hatte er kaum geschlafen. Dreimal hatte er bereits an diesem Morgen den Hörer in die Hand genommen und ihn, ohne zu wählen, wieder aufgelegt.
Er kam sich vor wie ein Hampelmann.
Rief er an, bestärkte er sie darin, dass er etwas zu verbergen hatte. Rief er nicht an, sprach sie womöglich mit diesem Mann – und möglicherweise fing alles wieder von vorne an. Er musste unbedingt herausfinden, was der Kerl von ihm wollte.
Richard war sicher, den Mann zuvor nur ein einziges Mal gesehen zu haben, und zwar an dem Tag, an dem Johanna in die Wohnung unter ihm eingezogen war.
Es war ein heißer Tag gewesen, und Richard hatte sich darüber gewundert, dass der Mann trotz der Hitze diesen dunklen Anzug trug. Er dirigierte zwei junge Kerle, die einen Schrank schleppten.
Richard hatte die ungeheure Dominanz des kleinen Mannes gespürt. Sie rührte vermutlich von den Augen, die durch die Brille fast ins Groteske vergrößert wurden. Richard hatte den Eindruck gehabt, dass sie eine Art Eigenleben führten. Er hatte den Mann für Johannas Vater gehalten. Später, als er einmal mit ihr darüber sprach, hatte sie gelacht, sich aber geweigert, ihm zu sagen, wer er wirklich war.
Das war zu der Zeit gewesen, als Richard sie bereits mit seiner ständigen Eifersucht quälte und Johanna seinen Verhören auswich. Da der Mann nicht mehr aufgetaucht war, hatte Richard die Begebenheit wohl verdrängt und ihn schließlich vergessen.
Er griff noch einmal zum Telefon. Cora West war seine einzige Chance.
Kapitel 2
Cora West war wie meistens die Erste in der Redaktion, was nicht nur an ihrem Ehrgeiz, sondern auch an der Bescheidenheit ihrer Wohnung lag – sofern die winzige Mansarde in einem etwas heruntergekommenen Altbau in Bockenheim, in der sie lebte, überhaupt als Wohnung zu bezeichnen war. Seit sie sich die Haare abgeschnitten und alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte, entsprach diese Art Unterkunft allerdings ihrem Lebensgefühl. Immer auf der Durchreise, lautete ihre Devise. Aber das war eine andere Geschichte.
An diesem Morgen hatte sie voller Spannung auf den Anruf von Richard Lorentz gewartet. Auch sie hatte in der Nacht kaum geschlafen. Sie war noch einmal alles durchgegangen, was über ihn und seinen neuen Roman bekannt geworden war. Entweder es war tatsächlich das Werk eines Ungeheuers oder es handelte sich um ein merkwürdiges Zusammenspiel zwischen einem genialen Plot und einem dummen Zufall.
Cora West wollte Karriere machen und dafür brauchte sie eine Sensation, eine Enthüllungsstory, die ihren Namen trug. Zum Beispiel, wenn es ihr gelänge, das Mädchen zu finden oder die Schuld des Autors zu beweisen.
Als ihr Telefon klingelte, wusste sie, sie hatte sich nicht getäuscht. Richard Lorentz hatte kalte Füße bekommen. Ohne Umschweife kam er zur Sache.
»Sie sagten, er ist bei Gericht tätig?«
Cora West antwortete mit einem kehligen Lachen. »Was die bloße Erwähnung dieses Ortes doch bewirkt.«
»Er ist also Richter?«
»Kalt«, antwortete Cora bedauernd.
»Dann eben Anwalt.«
»Eiskalt.«
Cora konnte es an Richards Stimme hören, wie seine mühsame Beherrschung ins Wanken geriet.
»Veranstalten wir hier ein Quiz?«, protestierte er.
»Sie haben doch mit dem Raten angefangen.«
»Seinen Namen«, sagte Richard scharf.
»Den gibt es, wie gesagt, nicht zum Nulltarif.«
Richard atmete hörbar. Sein Privatleben war bisher immer tabu gewesen.
»Okay. Ich bin einverstanden«, sagte er schließlich.
Nach dem Telefonat studierte Cora noch einmal das Gesicht von Richard Lorentz auf dem Cover seines Romans, ohne eine Antwort darin zu finden. Ein attraktives Gesicht, dem man zwar ansah, dass er einiges erlebt hatte, doch konnte sie weder Brutalität noch Gemeinheit darin finden. Eher Verletzlichkeit und ein Anflug von Traurigkeit. Es würde schwer werden zu beweisen, dass sich hinter der Maske des sympathischen Poeten ein Krimineller, ein berechnender Killer verbarg.
Sie war so vertieft in ihre Betrachtungen, dass sie es kaum bemerkte, als der Volontär des City-Journals – ein langer schlaksiger Kerl namens Benjamin, den alle, weil er der Jüngste in der Redaktion war, den Kleinen nannten – kauend an ihren Schreibtisch trat. Er kaute ständig Kaugummi und behauptete, es fördere die Intelligenz.
»Gefällt er Ihnen?«, feixte er.
Cora überhörte die Bemerkung. Derlei Anzüglichkeiten waren in der Redaktion an der Tagesordnung. Cora West galt als männerfeindlich, nachdem alle, die es bei ihr versucht hatten, abgeblitzt waren, und der Volontär wollte nur mit den Kollegen mithalten. Ansonsten war er ein lieber Kerl. Trotz seiner kleinen Respektlosigkeiten himmelte er sie ziemlich offensichtlich an und wollte ernst genommen werden.
Cora griff nach einer Zigarette, doch die Packung war leer. Manchmal vergaß sie, dass in den Räumen der Redaktion Rauchverbot herrschte.
»Moment!« Benjamin angelte ein Päckchen ihrer Marke aus seiner Hemdtasche. Obwohl er Nichtraucher war, hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, immer Zigaretten für sie dabei zu haben, denn ihre Packung war häufig leer.
Benjamin nahm das Buch in die Hand, das neben ihrem Laptop lag. »Tolle PR, so zu tun, als hätte sich alles so zugetragen wie im Roman, finden Sie nicht?«
»Hm.« Cora wollte das Thema nicht weiter vertiefen, aber sie hatte nicht mit dem Feuereifer gerechnet, mit dem der Kleine bei der Sache war.
Er sah sie neugierig an. »Halten Sie ihn denn für fähig, einen Mord zu begehen?«
Cora zwang sich zur Geduld. Sie musste vorsichtig zu Werke gehen. Nicht dass ihr jemand die Story vor der Nase wegschnappte.
»Der? Ein Mörder? Sehen Sie ihn sich doch an! Ein Ästhet, viel zu intellektuell. Der geborene Schreibtischtäter.«
Gehorsam betrachtete der Kleine Richards Gesichtszüge.
»Ein Wolf im Schafspelz vielleicht?«, schlug er vor.
»Nun, wenn Sie sich so für den Schriftsteller interessieren«, sagte Cora mit gespielter Leichtigkeit, »dann begleiten Sie mich doch in seine Wohnung. Dabei können Sie lernen, wie man eine Homestory macht.«
Die Idee war gut: Wenn sie ihn einbezog, hielt sie ihn an der kurzen Leine.
Kapitel 3
Lofts am Main prangte auf einer riesigen Tafel, der außerdem zu entnehmen war, dass noch Lofts zu verkaufen waren. Darunter stand die Telefonnummer eines Immobilienbüros.
In einem der Lofts wohnte Richard Lorentz, gemeinsam mit seiner Frau Lili, einer erfolgreichen Stadtpolitikerin.
»Nobel«, konstatierte Benjamin, als sie in der marmorgefliesten Halle auf den Fahrstuhl warteten.
Cora sagte nichts. Sie versuchte, sich daran zu erinnern, in welchem Zusammenhang sie etwas über ein spektakuläres Bauprojekt hier am Fluss im Frankfurter Osten gelesen hatte, aber es wollte ihr nicht einfallen.
Auf der Etage des Schriftstellers war ebenfalls nicht mit Marmor gegeizt worden. An den Türen zu den Appartements gab es keine Namen, nur Nummern.
Der Portier hatte sie angemeldet, und Lorentz empfing sie vor dem Eingang zu seinem Loft. Die Arme vor der Brust verschränkt stand er da und unternahm nicht einmal den Versuch, freundlich zu sein.
Cora West gab sich locker. »Guten Tag. Wir stören Sie hoffentlich nicht bei der Arbeit.«
Richard demonstrierte Gleichgültigkeit, indem er nur kurz grüßte und die beiden hereinbat.
Cora ließ sich nicht beirren und stellte kurz ihren Begleiter vor. »Am besten, Sie führen uns erst einmal herum, und wir machen ein paar Fotos. Vielleicht gleich hier das erste? Bitte, bleiben Sie so.«
Richard stand jetzt vor der langen Fensterfront, mit Aussicht auf den Main. Er zuckte gelangweilt die Achseln.
Benjamin sah sich mit ungenierter Bewunderung um. Er hatte sogar vorübergehend das Kauen vergessen. Auch Coras Sinne erkundeten jeden Winkel des weitläufigen Raumes, jedoch unmerklich und professionell. Diese Vornehmheit passte nicht zu Lorentz. Nicht zu dem Schriftsteller in seinem Roman. Außerdem verriet das Ambiente die Handschrift einer Frau.
»Inspiriert Sie der Fluss?«, fragte Cora, um ein Gespräch in Gang zu setzen.
»Der Fluss?« Der Schriftsteller sah sie an, als würde er sich zum ersten Mal der Existenz des Mains bewusst oder hätte Mühe, sich auf die Frage zu konzentrieren.
»Beim Schreiben«, erläuterte Cora.
»Der Fluss«, wiederholte er noch einmal. »Nein«, sagte er dann mit plötzlicher Heftigkeit, »nein, überhaupt nicht.«
Cora war sich über die Klischeehaftigkeit ihrer Frage im Klaren, doch die Reaktion des Schriftstellers war in jeder Hinsicht überzogen.
Sie wechselte das Thema. »Ich würde natürlich gern auch Ihren Arbeitsplatz fotografieren.«
Der Schriftsteller zuckte wiederum die Achseln. Er schien sich beruhigt zu haben.
Den Fluss sah man von seinem Arbeitszimmer aus nicht. Der Schreibtisch wirkte verwaist, und auf dem zugeklappten Laptop hatte sich eine Staubschicht gebildet. Richard schien sich für einen Moment unbeobachtet zu fühlen, jedenfalls wischte er den Staub mit dem Ärmel weg; der Journalistin war es jedoch nicht entgangen.
»Woran arbeiten Sie eigentlich zurzeit?«, fragte sie.
»Darüber möchte ich nicht sprechen«, antwortete er zugeknöpft.
»An einer Fortsetzung von Liebe und andere Lügen möglicherweise?«
»Wie stellen Sie sich diese Fortsetzung denn vor?«
»Nun, es ergeben sich neue Gesichtspunkte. Der Fall wird noch einmal aufgerollt. Keine Ahnung, Sie sind der Autor.«
»Interessante Idee«, sagte Lorentz, »ich werde darüber nachdenken. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Meine Frau lässt immer eine volle Thermokanne stehen.«
Cora tat erfreut. Innerlich fluchte sie. Lorentz war ein harter Brocken. Offenbar ließ er sich auf ihr Spiel nicht ein. Sie folgte ihm in die Küche.
»Ihre Frau ist sehr fürsorglich. Hilft Ihnen das bei der Arbeit?«, probierte sie es erneut, um etwas mehr aus ihm herauszubekommen.
Die Einrichtung aus Stahl und Marmor blitzte, und außer Kaffee schien hier noch nie etwas gekocht worden zu sein. Lorentz stellte Tassen, Milch und Zucker auf ein Tablett. Dabei bewegte er sich in seinen eigenen vier Wänden wie ein Fremder.
»Unbedingt«, antwortete er. »Dank meiner Frau fühle ich mich hier sehr wohl. Als das Haus, in dem ich zuvor gewohnt hatte, abgerissen wurde – meine Frau und ich haben eine Weile getrennt gelebt, ich benötige manchmal etwas Abstand für meine Arbeit, Sie verstehen –, war Lili gerade hier eingezogen. Es hat sich wie von selbst ergeben, dass ich jetzt hier lebe.«
Und wenn sie nicht gestorben sind, dachte Cora. Sie nahm ihm das Harmoniegedudel nicht ab. Diesem Zuhause fehlte einfach die Wärme. Aber vielleicht war sie auch nur neidisch auf eine glückliche Zweisamkeit.
»Kommen Sie!«, bat Richard Lorentz. Er trug das Tablett zu einer Sitzgruppe von Le Corbusier.
Benjamin, den die Journalistin völlig vergessen hatte, stand vor einem Regal und studierte die Titel der Plattensammlung. Dabei kaute er auffallend langsam.
»Cole Porter, At Long Last Love, 1938«, sagte er bewundernd und zog eine Langspielplatte in einer abgegriffenen Hülle aus dem Regal.
»Lassen Sie das, bitte!«, sagte Lorentz. Sein Ton war ungewöhnlich scharf.
Benjamin entschuldigte sich und stellte die Platte zurück.
»Spielt diese Musik von Cole Porter nicht eine Rolle in Ihrem Buch?«, fragte er harmlos.
»Möglich«, antwortete der Schriftsteller zerstreut, doch als er den Kaffee eingoss, konnte er ein Zittern seiner Hände nicht unterdrücken.
Cora hätte ihm auch ohne dieses Zeichen emotionaler Erregung nicht geglaubt, dass er sich nicht ganz genau an diese Stelle in seinem Roman erinnerte. Immerhin begleitete dieses Lied die erste Nacht des Protagonisten mit Hanna. Es war die Melodie seiner Liebe.
Aber die Journalistin ließ sich ihre Zweifel nicht anmerken. Unbefangen stellte sie im weiteren Verlauf Fragen, die man allen Prominenten stellt.
Als Cora später mit Benjamin im Fahrstuhl nach unten fuhr, war sie in Gedanken versunken. Einiges an Lorentz’ Verhalten sprach dafür, dass sie auf dem richtigen Weg war. Doch in ihrem Job zählten Fakten. Sie beschloss, sich als nächstes ein Bild von der liebevollen Gattin zu machen.
Benjamin räusperte sich. »Haben Sie bemerkt, wie nervös er wegen Cole Porter wurde? Wenn das mit der Platte in dem Buch wahr ist, stimmt alles andere vielleicht auch. Ich meine, wenn die Musik authentisch ist …«
Cora schnitt ihm das Wort ab. »Ich weiß, was Sie meinen, aber glauben Sie mir, Lorentz ist ein Biedermann. Ehefrau, schickes Appartement, alte Schallplatten, die keiner anfassen darf – wahrscheinlich ist die Monsterlegende wirklich nichts weiter als PR.«
»Oder er spielt die Rolle des Biedermannes nur«, entgegnete Benjamin.
Und zwar schlecht, hätte Cora am liebsten geantwortet, aber das behielt sie besser für sich.
Sie hatte den Kleinen unterschätzt. Nie hätte sie vermutet, dass er den Roman so gründlich gelesen hatte. Offenbar hatte er gezielt nach der Platte gesucht, um den Schriftsteller zu provozieren.
»Mich interessiert viel mehr, was früher hier auf diesem Grundstück passiert ist«, sagte sie, um ihn abzulenken. »Ich möchte alles darüber wissen. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Bauprojekt durch die Medien ging. Kümmern Sie sich darum?«
Damit würde er erst einmal beschäftigt sein.
Kapitel 4
Der Mann hieß Georg Sandmann und war Professor der Psychologie. Er war als Gutachter zu einigen Prozessen hinzugezogen worden, über die Cora West berichtet hatte.
Richard war zusammengezuckt, als die Journalistin den Namen nannte.
»Sandmann?«, hatte er erschrocken nachgefragt und im selben Atemzug gehofft, die Hexe möge seine Unsicherheit nicht bemerken.
Der Name erinnerte ihn an eine traumatische Geschichte aus seiner Kindheit. Lange Zeit hatte ihn die Angst vor dem Sandmann gequält, der zu den Kindern kommt, die nicht brav zu Bett gehen wollen, und ihnen Hände voll Sand in die Augen wirft, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Mit klopfendem Herzen hatte er jeden Abend in die Dunkelheit seines Zimmers gestarrt und darauf gewartet, dass er kam und ihm die Augen stahl.
Und nun erschien es ihm wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass dieser Mann, der heute seine Ängste schürte, ausgerechnet Sandmann hieß.
Der Schriftsteller gab sich einen Ruck. Schließlich war er erwachsen.
Er fand die Adresse im Telefonbuch.
Es war eine stille, vornehme Straße am Stadtwald. Das Haus war von Efeu überwuchert und machte einen verwunschenen Eindruck. Auf Richard wirkte es geradezu unheimlich.
Der Türöffner summte, kaum dass er geläutet hatte. Umso seltsamer war, dass ihn niemand empfing. Eine Weile wartete er in einem dämmrigen Flur, dann wurde es ihm zu dumm. Er räusperte sich und ging auf eine Tür zu, die nur angelehnt war. Als auf sein Klopfen hin keine Reaktion erfolgte, schob er die Tür langsam auf. Es war niemand im Raum.
Ein großer Schreibtisch und überfüllte Bücherregale vom Boden bis zur Decke ließen vermuten, dass es sich um das Arbeitszimmer des Professors handelte. Unschlüssig schaute Richard sich um.
Ein Glasbehälter auf einer Seite des Schreibtischs, sorgfältig mit Fliegengitter abgedeckt, weckte sein Interesse. Zwischen allerlei Blattwerk entdeckte Richard zwei reglose große Heuschrecken. Unwillkürlich trommelte er mit den Fingern an das Glas, um ihnen ein Lebenszeichen zu entlocken.
»Mantis religiosa, Gottesanbeterin zu Deutsch«, hörte er hinter sich eine ihm bekannte Stimme sagen.
Der Professor stand plötzlich mitten im Raum. Er trug Filzpantoffeln, weshalb Richard ihn nicht hatte kommen hören.
»Verzeihen Sie mein Eindringen«, entschuldigte der Schriftsteller sich hastig.
»Ganz im Gegenteil, ich muss Sie um Verzeihung bitten, schließlich habe ich Sie warten lassen.«
Der Professor machte ein zerknirschtes Gesicht, doch Richard hatte das Gefühl, dass er es darauf angelegt hatte, ihn zu überraschen. Die großen Augen schienen ihn zu durchdringen. Unwillkürlich fühlte er sich schuldig, was ihn ärgerte.
»Umso mehr freut es mich, dass Sie sich ein wenig umgesehen haben«, fuhr der Professor indes freundlich fort, »im Vertrauen, ich habe Sie erwartet. Vielleicht nicht so schnell, aber ich habe Sie erwartet.«
Richard bereute jetzt, dass er nicht ein paar Tage abgewartet hatte, aber das Bedürfnis, den Mann kennenzulernen, war wie ein Sog gewesen.
»Darf ich rauchen?«, fragte er gereizt.
»Aber ja, wenn es Ihnen hilft. Setzen Sie sich doch, dann plaudert es sich angenehmer.« Der Professor wies auf einen Sessel. »Meine Gottesanbeterinnen können Sie später noch bewundern. Faszinierende Geschöpfe übrigens, eine Freundin hat sie mir geschenkt.«
Die Erinnerung daran schien ihn zu bedrücken, jedenfalls verdüsterte sich seine Miene. Doch dann lächelte er maliziös.
»Wissen Sie eigentlich, dass bisweilen das Weibchen das Männchen nach dem Liebesakt auffrisst? Manchmal sogar während der Kopulation.«
Der Professor kicherte, als er den Ekel in Richards Gesicht sah.
»Ja, es ist unappetitlich. Das Weibchen beginnt vom Kopf aus zu fressen. Der Torso des Männchens kann so weiter kopulieren, denn während des Wegfressens des Kopfes wird das im Abdomenende gelegene nervöse Zentrum für die Kopulationsbewegungen enthemmt. In Gefangenschaft soll dieses Verhalten schon häufig beobachtet worden sein. Du meine Güte, ich gerate ins Dozieren! Eine Berufskrankheit, ich wollte Sie keinesfalls langweilen. Möglicherweise aber« – der Professor rieb sich die Hände, so als hätte er gerade einen kuriosen Einfall – »sehen Sie in diesem sexuellen Kannibalismus ja eine Allegorie auf Ihre Geschichte. Ich beschäftige mich schon fast mein Leben lang mit dem Verhalten der Kreaturen. Mein Spezialgebiet ist, wie Sie vielleicht wissen, das sogenannte Böse. Es hat viele Facetten. Und die Mechanismen sind nicht allzu unterschiedlich. Unsere sind bloß zivilisierter, aber deshalb nicht weniger grausam. Vermutlich hat Johanna Ihnen von meinen Forschungen berichtet. Immerhin war sie meine begabteste Studentin. Von Ihnen hat sie übrigens sehr häufig gesprochen.«
Richard spürte, wie ihm heiß wurde. Allein die Vorstellung verursachte ihm eine unsägliche Pein. Er wich dem Blick des Professors aus. Es war ein Fehler gewesen, nur Männer in Johannas Umgebung ernst zu nehmen, die als Rivalen in Frage kamen, dachte er bitter. Er hätte nicht lockerlassen dürfen, bis sie ihm alles über diesen Mann erzählt hätte.
Richard merkte, wie der Professor ihn belauerte.
»Sie sehen schlecht aus«, stellte Sandmann fest, »vermutlich quält Sie die Erinnerung. Nun, das ist erst der Anfang. Noch überwiegt die Euphorie Ihres Erfolges, aber bald wird Sie das Vergangene immer stärker belasten. Es wird sich in Ihrem Kopf ständig wiederholen, und Sie werden vergeblich versuchen, Ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben. Sie werden weder arbeiten noch schlafen und zu viel trinken. Sie werden sich danach verzehren, mit jemandem reden zu können.«
In Richards Ohren klangen Sandmanns Worte wie eine Beschwörung, der er sich nicht entziehen konnte.
»Sie sollten sich mir anvertrauen«, hörte er ihn sagen, »ich schlage vor, für den Anfang eine Sitzung täglich – oder haben Sie Angst vor einer Analyse?«
Richard fehlte die Kraft, zu protestieren. Außerdem fürchtete er, eine Weigerung könnte wie ein Eingeständnis seiner Schuld wirken.
»Ich interessiere mich nicht sonderlich für mich selbst«, sagte er daher so gleichgültig wie möglich. »Ich beschäftige mich mehr mit den Figuren meiner Romane.«
Der Professor lächelte überlegen. »Sind Sie nicht selbst eine Figur Ihres Romans?«
Richard fühlte sich überrumpelt. »Was versprechen Sie sich davon?«
»Das Böse in der Zivilisation ist fast immer situativ bedingt. Bei der Gottesanbeterin ist es die Enge des Käfigs. Mich beschäftigt die Frage, was Menschen dazu bewegt, sich über alle Skrupel hinwegzusetzen. Ich habe nur einen kleinen Kreis von Patienten. Die moralische oder rechtliche Seite interessiert mich nicht. Ebenso wenig der Durchschnittsneurotiker. Was Sie betrifft, fehlen mir ein paar wesentliche Details, um Ihre Handlungsweise erklären zu können. Was war der Anlass für Ihr Experiment? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Fangen wir damit an: Wann stand Ihr Plan fest?«
Endlich fand Richard eine Gelegenheit, aufbegehren zu können. »Was soll diese Frage? Ich hatte keinen Plan, ich war betrunken! Sie sollten die Axiome – so sagt man ja wohl in Ihrer Terminologie – genauer überprüfen, Herr Professor!»
»Warum so förmlich? Sagen Sie einfach Herr Sandmann. Meine Studenten nennen mich nur ›Der Sandmann‹.«
Der böse Sandmann!, dachte Richard.
»Vielleicht haben sie gemerkt, dass Sie Ihnen mit Ihren Theorien Sand in die Augen streuen«, antwortete er bissig.
Doch die Spitze schien dem Professor nichts auszumachen.
»Sehr gut«, sagte er mit einem mokanten Lächeln.
Richard wurde schlagartig klar, dass er Sandmann einen Gefallen getan hatte. Er hatte angefangen zu reden.
Kapitel 5
»Alles fing damit an, dass ich auf der Suche nach einem Stoff war«, begann Richard leise. »Johanna erschien mir wie eine Offenbarung. Ich war so fasziniert von ihrem Lebenshunger, ihrem Spiel mit der Liebe und den Männern, dass sie mein Thema wurde. Doch es ging nicht. Ich war unfähig, über sie zu schreiben.«
»Sie haben den Fehler gemacht, sich in sie zu verlieben. Jeder ist verloren, der sich in Johanna verliebt.«
»Bis mir Philipp Urban über den Weg lief«, fuhr Richard fort, ohne auf die Bemerkung des Professors einzugehen, der begonnen hatte, sich Notizen zu machen. »Es passierte Ende August. Seit Tagen lag eine brütende Hitze über der Stadt, was mir als Vorwand diente, schon am Nachmittag in der Kneipe gegenüber das erste Bier zu trinken. Von dort konnte ich Hannas Fenster beobachten. Das war weniger würdelos als am Schreibtisch auf die Geräusche in ihrer Wohnung zu lauschen.«
»Sie hatten keine gute Zeit damals«, warf der Professor ein, um das Gespräch in Gang zu halten, denn Richard Lorentz hatte eine Pause gemacht.
»Es war das Warten, das alles beherrschende Warten auf Johanna, das mich auslaugte«, sprach er endlich weiter. »Markus Engel, mein Lektor, war in Sorge, ob er jemals wieder ein Manuskript von mir bekommen würde, ständig musste ich irgendetwas erfinden, um ihn zu beruhigen, zudem war ich völlig pleite und von der Hilfe meiner Frau abhängig.«
»In dieser Situation begegnete Ihnen also Philipp Urban«, wiederholte Sandmann, doch der Schriftsteller brauchte keinen Anstoß mehr. Er war in der Vergangenheit angekommen – und obwohl sich alles in ihm dagegen sträubte, sich ausgerechnet diesem Menschen anzuvertrauen, folgte er einem unerklärlichen Zwang, ihm von seiner ersten Begegnung mit Urban zu berichten.
Ein Gewitter war gerade heraufgezogen, und als die ersten Tropfen fielen, verlangsamte vor dem Lokal ein nagelneuer Roadster seine Geschwindigkeit. Richard sah zu, wie sich das automatische Verdeck langsam zu schließen begann. Auf halbem Wege geriet die Bewegung jedoch plötzlich ins Stocken und der Wagen begann zu rucken. Der Fahrer drehte vergeblich am Zündschlüssel, dabei ließ er den Wagen geistesgegenwärtig in eine Parklücke rollen. Er sprang heraus und zog das Verdeck zu. Im selben Moment ging ein Platzregen nieder. Lachend hielt der Mann dem Regen das Gesicht entgegen. Ein Ausdruck unbändiger Lebensfreude lag in diesem Lachen und erfüllte den Schriftsteller mit Neid. Das war der erste Eindruck, den Richard von Philipp Urban hatte.
Der Professor schaute von seinem Notizblock auf.
»Und dafür wollten Sie ihn bestrafen?«
»Unsinn«, sagte Richard entschieden, »ich habe Urban sogar geholfen, denn seit das Viertel im Ostend ausverkauft wurde, stießen reiche Typen wie er dort auf Ablehnung, und Leo, der Wirt, machte keinen Hehl daraus, dass er etwas gegen ihn hatte.«
Philipp Urban war also in das Lokal gestürmt und schüttelte sich. Man sah ihm an, dass er normalerweise nicht in Vorstadtkneipen verkehrte. Das Hemd, das nass an seinen Schultern klebte, war teuer, sein Gesicht gebräunt und glattrasiert – kein schlechtes Gesicht übrigens. Die beginnende Stirnglatze betonte die hohe Stirn und machte es männlicher, zumal sein Mund etwas feminin war. Das beste aber waren die Augen, lebendige Augen, die lachen oder sich verfinstern konnten, in denen Leidenschaft funkelte.
Er lehnte am Tresen und spielte mit dem Schlüssel seines Roadsters. Das Lokal war nahezu leer. An einem der Tische spielten ein paar dunkelhäutige Männer Backgammon. Mit einer angenehm volltönenden Stimme verlangte er zum wiederholten Mal ein Bier, doch der Wirt ignorierte ihn einfach.
Und dann entdeckte er Richard in einer Fensternische. Erleichtert ging er zu ihm hinüber und bat darum, sich an seinen Tisch setzen zu dürfen.
»Wie kommt man hier an so was?«, fragte er und deutete auf Richards Bierglas. »Ich fürchte, der Wirt versteht kein Deutsch.«
Der Schriftsteller bestellte problemlos in deutscher Sprache zwei Bier, und der Wirt brummte: »Gleich.«
Philipp Urban zuckte die Achseln und grinste. Dann begann er mit Smalltalk.
»Entweder es regnet wochenlang überhaupt nicht, oder es gießt wie aus Eimern«, begann er.
Richard reagierte einsilbig. Damals sprach er kaum mit Leuten und hatte auch wenig Lust, mit diesem Fremden zu reden. Er konzentrierte sich wieder auf das gegenüberliegende Haus, ein hässliches Haus, von dem schmutziger rosa Putz abblätterte. Johannas Rollläden waren noch immer heruntergelassen.
Urbans Augen waren seinem Blick gefolgt.
»Ziemliche Bruchbude, was?«
Richard konnte sich ein bitteres Lachen nicht verkneifen.
»Hast du gehört?«, fragte er den Wirt, der gerade mit dem Bier kam.
»Ein echtes Herzchen«, murmelte der nur grinsend.
Urban trank in großen Schlucken. Dann straffte er sich.
»Was ist so komisch?«, fragte er herausfordernd.
»Du bist komisch«, sagte der Wirt. Der drohende Unterton war unüberhörbar.
Es bereitete Richard zwar eine Art Genugtuung, aber an einer Auseinandersetzung hatte er kein Interesse. Deshalb bedeutete er dem Wirt, den Fremden in Ruhe zu lassen, und Philipp Urban erklärte er, dass das Haus demnächst abgerissen würde. Damit hielt er das Thema für erledigt.
Doch sein Tischgenosse ließ nicht locker. Ob das für ihn ein Problem sei, was mit dieser Bruchbude geschehe, wollte er wissen.
Der Schriftsteller antwortete nicht gleich. Sollte er diesem Fremden erklären, dass diese Bruchbude sein Zuhause war und außerdem eine Lebensnotwendigkeit, weil auch Johanna dort wohnte?
Vielleicht lag es an seinem Selbstmitleid oder an seiner Einsamkeit, jedenfalls hörte er sich zu seiner Verwunderung sagen: »Man muss sich davor hüten, Wurzeln zu schlagen. Jedes Ende ist ein Anfang. Das behauptet jedenfalls Johanna.«
Er bereute sofort, von Johanna gesprochen zu haben, aber es war zu spät.
»Ist Johanna Ihre Frau?«, fragte Urban prompt.
Richard verneinte schroff, aber Urban ließ sich nicht abschrecken.
»Schadet nichts«, sagte er feixend, »es geht auch ohne Trauschein, oder?«
Dazu machte er eine obszöne Geste, die Richard rasend machte. Er bestellte einen Ouzo, den er sofort kippte.