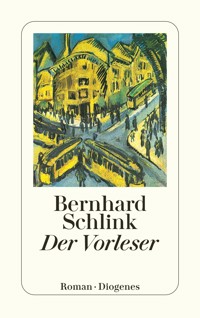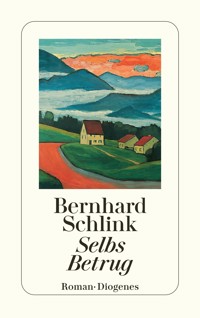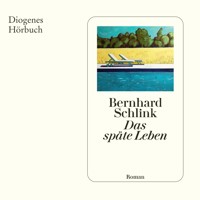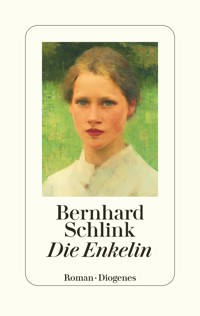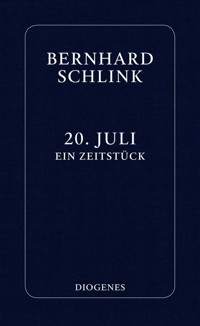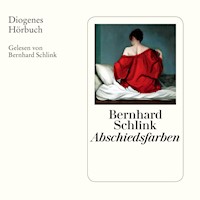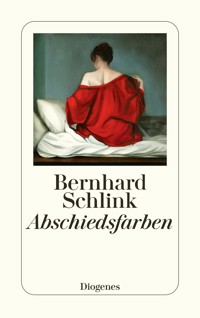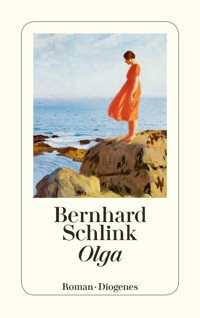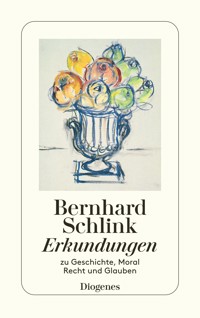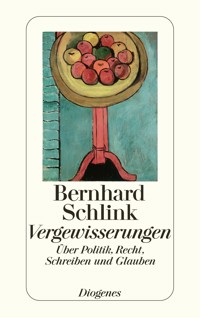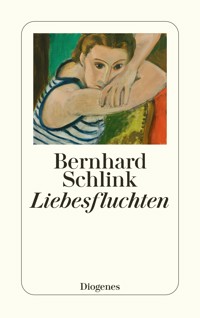
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Flucht in die Liebe, Flucht vor der Liebe – vor sich selbst, dem andern, dem Leben, der Geschichte. Sieben erotische, subtile, tragikomische Geschichten über Sehnsüchte und Verwirrungen, Nähe und Einsamkeit, Verstrickung und Schuld, Lebensentwürfe und Lebensverantwortung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bernhard Schlink
Liebesfluchten
Geschichten
Die Erstausgabe
erschien 2000 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Henri Matisse, ›Les yeux bleus‹, 1935
Copyright © Succession H. Matisse;
ProLitteris, Zürich 2013
Foto: Baltimore Museum of Art;
The Cone Collection formed by Dr.Claribel Cone
and Miss Etta Cone of Baltimore, Maryland
BMA 1950.259
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23299 8 (21.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60038 4
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Inhalt
Das Mädchen mit der Eidechse [7]
Der Seitensprung [55]
Der Andere [97]
Zuckererbsen [151]
Die Beschneidung [199]
Der Sohn [257]
Die Frau an der Tankstelle [283]
[7] Das Mädchen mit der Eidechse
1
Das Bild zeigte ein Mädchen mit einer Eidechse. Sie sahen einander an und sahen einander nicht an, das Mädchen die Eidechse mit verträumtem Blick, die Eidechse das Mädchen mit blicklosem, glänzenden Auge. Weil das Mädchen mit seinen Gedanken anderswo war, hielt es so still, daß auch die Eidechse auf dem moosbewachsenen Felsbrocken, an dem das Mädchen bäuchlings halb lehnte und halb lag, innegehalten hatte. Die Eidechse hob den Kopf und züngelte.
»Judenmädchen« sagte die Mutter des Jungen, wenn sie von dem Mädchen auf dem Bild sprach. Wenn die Eltern stritten und der Vater aufstand und sich in sein Arbeitszimmer zurückzog, wo das Bild hing, rief sie ihm nach: »Geh doch zu deinem Judenmädchen!«, oder sie fragte: »Muß das Bild mit dem Judenmädchen da hängen? Muß der Junge unter dem Bild mit dem Judenmädchen schlafen?« Das Bild hing über der Couch, auf der der Junge Mittagsschlaf zu halten hatte, während der Vater Zeitung las.
Er hatte den Vater der Mutter mehr als einmal erklären hören, daß das Mädchen kein Judenmädchen sei. Daß die rote Samtkappe, die es auf dem Kopf trug, fest in die vollen, braunen Locken gedrückt und von ihnen fast verdeckt, kein religiöses, kein folkloristisches, sondern ein [8] modisches Attribut sei. »So waren Mädchen damals eben gekleidet. Außerdem haben bei den Juden die Männer die Käppchen auf, nicht die Frauen.«
Das Mädchen trug einen dunkelroten Rock und über einem hellgelben Hemd ein dunkelgelbes Oberteil, wie ein Mieder mit Bändern am Rücken locker geschnürt. Viel von der Kleidung und vom Körper ließ der Felsbrocken nicht sehen, auf den das Mädchen seine rundlichen Kinderarme gelegt und sein Kinn gestützt hatte. Es mochte acht Jahre alt sein. Das Gesicht war ein Kindergesicht. Aber der Blick, die vollen Lippen, das sich in die Stirn kräuselnde und auf Rücken und Schultern fallende Haar waren nicht kindlich, sondern weiblich. Der Schatten, den das Haar auf Wange und Schläfe warf, war ein Geheimnis, und das Dunkel des bauschenden Ärmels, in dem der nackte Oberarm verschwand, eine Versuchung. Das Meer, das sich hinter dem Felsbrocken und einem kleinen Stück Strand bis zum Horizont streckte, rollte mit schweren Wellen an, und durch dunkle Wolken brach Sonnenlicht und ließ einen Teil des Meeres glänzen und Gesicht und Arme des Mädchens scheinen. Die Natur atmete Leidenschaft.
Oder war alles Ironie? Die Leidenschaft, die Versuchung, das Geheimnis und das Weib im Kind? War die Ironie der Grund, daß das Bild den Jungen nicht nur faszinierte, sondern auch verwirrte? Er war oft verwirrt. Er war verwirrt, wenn die Eltern stritten, wenn die Mutter spitze Fragen stellte und wenn der Vater Zigarre rauchte, Zeitung las und entspannt und überlegen wirken wollte, während die Luft im Arbeitszimmer so geladen war, daß der Junge sich nicht zu bewegen und kaum zu atmen getraute. Und [9] das höhnische Reden der Mutter vom Judenmädchen war verwirrend. Der Junge hatte keine Ahnung, was ein Judenmädchen war.
2
Von einem Tag auf den anderen hörte seine Mutter auf, vom Judenmädchen zu reden, und sein Vater, ihn zum Mittagsschlaf ins Arbeitszimmer zu holen. Eine Weile mußte er mittags in dem Zimmer und Bett schlafen, in dem er auch nachts schlief. Dann war die Zeit des Mittagsschlafs überhaupt vorbei. Er war froh. Er war neun und hatte länger mittags liegen müssen als irgendein Klassen- oder Spielkamerad.
Aber das Mädchen mit der Eidechse fehlte ihm. Immer wieder stahl er sich in das Arbeitszimmer des Vaters, um einen Blick auf das Bild zu werfen und einen Augenblick mit dem Mädchen Zwiesprache zu halten. Er wuchs rasch in jenem Jahr; zuerst waren seine Augen auf der Höhe des dicken goldenen Rahmens, dann auf der des Felsens und später gleichauf mit den Augen des Mädchens.
Er war ein kräftiger Junge, breit gebaut und mit großknochigen Gliedmaßen. Als er in die Höhe schoß, hatte seine Ungelenkheit nichts Rührendes, sondern etwas Bedrohliches. Seine Kameraden hatten Angst vor ihm, selbst wenn er ihnen beim Spielen, Streiten und Kämpfen half. Er war ein Außenseiter. Er wußte es selbst. Allerdings wußte er nicht, daß sein Äußeres, seine Größe, Breite und Kraft, ihn zum Außenseiter machte. Er dachte, es sei die innere [10] Welt, mit und in der er lebte. Kein Kamerad teilte sie. Allerdings lud er auch keinen dazu ein. Wäre er ein zartes Kind gewesen, hätte er vielleicht unter den anderen zarten Kindern Spiel- und Seelengefährten gefunden. Aber gerade sie waren von ihm besonders eingeschüchtert.
Seine innere Welt war nicht nur von Gestalten bevölkert, von denen er las und die er von Bildern oder aus Filmen kannte, sondern auch von Personen aus der äußeren Welt, allerdings in variierter Gestalt. Er spürte, wenn hinter dem, was die äußere Welt zeigte, noch etwas anderes war, das sie nicht zeigte. Daß seine Klavierlehrerin etwas zurückhielt, daß die Freundlichkeit des beliebten Hausarztes nicht echt war, daß ein Nachbarskind, mit dem er gelegentlich spielte, etwas verbarg – er spürte es, lange bevor die Diebereien des Kindes oder die Liebe des Arztes zu kleinen Jungen oder die Krankheit der Lehrerin offenbar wurden. Was es war, das nicht zutage trat, spürte er freilich auch nicht besser und schneller als andere. Er spürte ihm auch nicht nach. Er dachte sich lieber etwas aus, und das Ausgedachte war stets farbiger und aufregender als die Wirklichkeit.
Der Distanz seiner inneren Welt zu seiner äußeren entsprach eine Distanz, die der Junge zwischen seiner Familie und den anderen Menschen wahrnahm. Zwar stand der Vater, ein Richter am Gericht der Stadt, mit beiden Beinen im Leben. Der Junge bekam mit, daß der Vater sich an der Wichtigkeit und Sichtbarkeit seiner Stellung freute, gerne zum Stammtisch der Honoratioren ging, Einfluß auf die Politik der Stadt nahm und sich in der Kirchengemeinde zum Presbyter wählen ließ. Die Eltern nahmen auch am gesellschaftlichen Leben der Stadt teil. Sie gingen zum [11] Faschings- und zum Sommerball, wurden zum Essen eingeladen und luden zum Essen ein. Die Geburtstage des Jungen wurden gefeiert, wie es sich gehörte, mit fünf Gästen zum fünften Geburtstag, sechs zum sechsten und so fort. Überhaupt war alles, wie es sich gehörte, und also in den fünfziger Jahren von der gebotenen Förmlichkeit und Distanziertheit. Was der Junge als Distanz zwischen seiner Familie und den anderen Menschen wahrnahm, war nicht diese Förmlichkeit und Distanziertheit, sondern etwas anderes. Es hatte damit zu tun, daß auch die Eltern etwas zurückzuhalten oder zu verbergen schienen. Sie waren auf der Hut. Wenn ein Witz erzählt wurde, lachten sie nicht sofort, sondern warteten, bis die anderen lachten. Im Konzert und Theater klatschten sie erst, wenn die anderen klatschten. Bei Gesprächen mit Gästen hielten sie mit ihrer Meinung zurück, bis andere dieselbe Meinung äußerten und sie sekundieren konnten. Manchmal kam der Vater nicht umhin, Positionen zu beziehen und Meinungen zu äußern. Dann wirkte er angestrengt.
Oder war der Vater nur taktvoll und wollte sich nicht einmischen und aufdrängen? Der Junge stellte sich die Frage, als er älter wurde und die Vorsicht seiner Eltern bewußter wahrnahm. Er fragte sich auch, was es mit dem Insistieren der Eltern auf ihrem eigenen, privaten Raum auf sich hatte. Er durfte das Schlafzimmer der Eltern nicht betreten, hatte es schon als kleines Kind nicht betreten dürfen. Zwar schlossen die Eltern das Schlafzimmer nicht ab. Aber ihr Verbot war unmißverständlich und ihre Autorität unangefochten – jedenfalls bis der Junge dreizehn war und eines Tags, als die Eltern weg waren, die Tür öffnete und [12] zwei getrennt stehende Betten, zwei Nachttische, zwei Stühle, einen Holz- und einen Metallschrank sah. Wollten die Eltern verbergen, daß sie das Bett nicht miteinander teilten? Wollten sie ihm Sinn für Privatheit und Respekt davor beibringen? Immerhin betraten sie auch sein Zimmer nie, ohne anzuklopfen und auf seine Aufforderung zum Eintreten zu warten.
3
Das Arbeitszimmer des Vaters zu betreten war dem Jungen nicht verboten. Obwohl es mit dem Bild vom Mädchen mit der Eidechse ein Geheimnis barg.
Als er in der Quarta, im dritten Jahr auf dem Gymnasium, war, gab der Lehrer als Hausarbeit eine Bildbeschreibung auf. Die Wahl des Bildes stellte er frei. »Muß ich das Bild, das ich beschreibe, mitbringen?« fragte ein Schüler. Der Lehrer winkte ab. »Ihr sollt das Bild so gut beschreiben, daß wir’s beim Lesen vor uns sehen.« Für den Jungen verstand sich, daß er das Bild vom Mädchen mit der Eidechse beschreiben würde. Er freute sich darauf. Auf das genaue Betrachten des Bildes, das Übersetzen des Bildes in Worte und Sätze, das Vorführen des von ihm beschriebenen Bildes vor Lehrer und Mitschülern. Er freute sich auch darauf, im Arbeitszimmer des Vaters zu sitzen. Es ging auf einen engen Hof, das Licht des Tages und die Geräusche der Straße waren gedämpft, die Wände standen voll mit Regalen und Büchern, und der Geruch der gerauchten Zigarren hing würzig und streng im Raum.
[13] Der Vater war zum Mittagessen nicht nach Hause gekommen, die Mutter gleich danach in die Stadt gegangen. So fragte der Junge niemanden um Erlaubnis, setzte sich ins väterliche Arbeitszimmer, schaute und schrieb. »Auf dem Bild ist das Meer zu sehen, davor der Strand, davor ein Felsen oder eine Düne und darauf ein Mädchen und eine Eidechse.« Nein, der Lehrer hatte gesagt, eine Bildbeschreibung geht vom Vordergrund über den Mittelgrund zum Hintergrund. »Im Vordergrund des Bildes sind ein Mädchen und eine Eidechse auf einem Felsen oder einer Düne, im Mittelgrund ist ein Strand, und vom Mittel- zum Hintergrund ist das Meer.« Ist das Meer? Wogt das Meer? Aber das Meer wogt nicht vom Mittel- zum Hintergrund, sondern vom Hinter- zum Mittelgrund. Außerdem klingt Mittelgrund häßlich, und Vorder- und Hintergrund klingen nicht viel besser. Und das Mädchen – ist es? Ist das alles, was über das Mädchen zu sagen ist?
Der Junge fing neu an. »Auf dem Bild ist ein Mädchen. Es sieht eine Eidechse.« Auch das war noch nicht alles, was über das Mädchen zu sagen war. Der Junge fuhr fort. »Das Mädchen hat ein blasses Gesicht und blasse Arme, braune Haare, trägt oben etwas Helles und unten einen dunklen Rock.« Aber auch damit war er nicht zufrieden. Er setzte noch mal an. »Auf dem Bild sieht ein Mädchen einer Eidechse zu, wie sie sich sonnt.« Stimmt das? Sieht das Mädchen der Eidechse zu und nicht vielmehr über sie hinweg, durch sie hindurch? Der Junge zögerte. Aber dann war es ihm egal. Denn an den ersten schloß der zweite Satz an: »Das Mädchen ist wunderschön.« Der Satz stimmte, und mit ihm begann auch die Beschreibung zu stimmen.
[14] »Auf dem Bild sieht ein Mädchen einer Eidechse zu, wie sie sich sonnt. Das Mädchen ist wunderschön. Es hat ein feines Gesicht mit einer glatten Stirn, einer geraden Nase und einer Kerbe in der Oberlippe. Es hat braune Augen und braune Locken. Eigentlich ist das Bild nur der Kopf des Mädchens. Alles andere ist nicht so wichtig. Als da sind die Eidechse, der Felsen oder die Düne, der Strand und das Meer.«
Der Junge war zufrieden. Jetzt mußte er alles nur noch in den Vorder-, Mittel-, und Hintergrund rücken. Er war stolz auf »als da sind«. Es klang elegant und erwachsen. Er war stolz auf die Schönheit des Mädchens.
Als er seinen Vater die Wohnungstür aufschließen hörte, blieb er sitzen. Er hörte ihn die Aktentasche abstellen, den Mantel ausziehen und aufhängen, in die Küche und ins Wohnzimmer schauen und an seine Tür klopfen.
»Ich bin hier«, rief er und legte die Sudelblätter paßgenau auf das Heft und den Füllhalter daneben. So lagen die Akten, Blätter und Stifte auf Vaters Schreibtisch.
»Ich sitze hier, weil wir eine Bildbeschreibung aufhaben und ich das Bild hier beschreibe.« Kaum ging die Tür auf, redete er los.
Der Vater brauchte einen Moment. »Welches Bild? Was machst du?«
Der Junge erklärte noch mal. Daran, wie der Vater stand, auf das Bild und auf ihn sah und die Stirn runzelte, merkte er, daß er etwas falsch gemacht hatte. »Weil du nicht da warst, habe ich gedacht …«
»Du hast …« Der Vater redete mit gepreßter Stimme, und der Junge dachte, gleich würde die Stimme kippen und [15] brüllen, und duckte sich weg. Aber der Vater brüllte nicht. Er schüttelte den Kopf und setzte sich auf den Drehstuhl zwischen dem Schreibtisch und dem Tisch, der ihm als Ablage für seine Akten diente und an dessen anderer Seite der Junge saß. Hinter dem Vater, neben dem Schreibtisch hing das Bild. Sich an den Schreibtisch zu setzen hatte der Junge nicht gewagt. »Magst du mir vorlesen, was du geschrieben hast?«
Der Junge las vor, stolz und ängstlich zugleich.
»Das hast du sehr schön geschrieben, mein Junge. Ich habe das Bild genau vor mir gesehen. Aber …«, er zögerte, »es ist nichts für die anderen. Für die anderen solltest du ein anderes Bild beschreiben.«
Der Junge war so froh, daß der Vater ihn nicht anbrüllte, sondern vertrauens- und liebevoll mit ihm redete, daß er zu allem bereit war. Aber er verstand nicht. »Warum ist das Bild nichts für die anderen?«
»Behältst du nicht auch manchmal Sachen für dich? Willst du uns oder deine Freunde bei allem, was du tust, dabeihaben? Schon weil die anderen neidisch sind, soll man ihnen seine Schätze nicht zeigen. Entweder sie werden traurig, weil sie nicht auch haben, was du hast, oder sie werden gierig und wollen es dir wegnehmen.«
»Ist das Bild ein Schatz?«
»Das weißt du selbst. Du hast es gerade so schön beschrieben, wie man nur einen Schatz beschreibt.«
»Ich meine, ist es so viel wert, daß die anderen neidisch werden?«
Der Vater drehte sich um und sah das Bild an. »Ja, es ist sehr viel wert, und ich weiß nicht, ob ich es beschützen [16] kann, wenn die anderen es stehlen wollen. Ist da nicht besser, sie wissen gar nicht, daß wir’s haben?«
Der Junge nickte.
»Komm, laß uns ein Buch mit Bildern anschauen, wir finden sicher eines, das dir gefällt.«
4
Als der Junge vierzehn war, gab der Vater das Richteramt auf und nahm eine Stelle bei einer Versicherung an. Er tat es nicht gerne – der Junge merkte es, obwohl der Vater sich nicht beklagte. Der Vater erklärte auch nicht, warum er wechselte. Erst Jahre später fand der Junge es heraus. Als Folge des Wechsels wurde die alte Wohnung für eine kleinere aufgegeben. Statt in der herrschaftlichen Etage eines viergeschossigen wilhelminischen Stadthauses wohnten sie in einer von vierundzwanzig Wohnungen eines Mietshauses am Stadtrand, von einem sozialen Wohnungsbauprogramm gefördert und nach dessen Normen gebaut. Die vier Zimmer waren klein, die Decke niedrig und die Geräusche und Gerüche der Nachbarwohnungen stets präsent. Immerhin waren es vier Zimmer; neben dem Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer behielt der Vater ein Arbeitszimmer. Dorthin zog er sich abends zurück, auch wenn er keine Akten mehr mitbrachte und bearbeitete.
»Du kannst auch im Wohnzimmer trinken«, hörte der Junge seine Mutter eines Abends zum Vater sagen, »und vielleicht trinkst du weniger, wenn du manchmal einen Satz mit mir redest.«
[17] Auch der Umgang der Eltern änderte sich. Die Essen und die Damen- und Herrenabende blieben aus, bei denen der Junge den Gästen die Tür aufgemacht und die Mäntel abgenommen hatte. Er vermißte die Atmosphäre, wenn im Eßzimmer der Tisch mit weißem Porzellan gedeckt und mit silbernen Leuchtern geschmückt war und die Eltern im Wohnzimmer Gläser, Gebäck, Zigarren und Aschenbecher richteten, schon auf das erste Klingeln lauschend. Er vermißte auch den einen und anderen Freund der Eltern. Manche hatten ihn nach seinem Ergehen in der Schule und nach seinen Interessen gefragt, beim nächsten Besuch noch gewußt, was er geantwortet hatte, und daran angeknüpft. Ein Chirurg hatte mit ihm die Operation von Stoffbären diskutiert und ein Geologe Vulkanausbrüche, Erdbeben und Wanderdünen. Er vermißte besonders eine Freundin der Eltern. Anders als seine schlanke, nervöse, fahrige Mutter war sie von rundlicher, fröhlicher Gemütlichkeit. Als kleinen Jungen hatte sie ihn im Winter unter ihren Pelzmantel genommen, in den streichelnden Glanz seines seidigen Futters und in den überwältigenden Geruch ihres Parfüms. Später hatte sie ihn mit Eroberungen, die er nicht machte, Freundinnen, die er nicht hatte, geneckt – es hatte ihn verlegen und zugleich stolz gemacht, und wenn sie ihn manchmal auch später noch spielerisch an sich gezogen und den Pelzmantel um sie beide gehüllt hatte, hatte er die Weiche ihres Körpers genossen.
Es dauerte lange, bis neue Gäste kamen. Es waren Nachbarn, Kollegen des Vaters aus der Versicherung und Kolleginnen der Mutter, die inzwischen als Schreibkraft in der Polizeidirektion arbeitete. Der Junge merkte, daß die [18] Eltern unsicher waren; sie wollten sich in ihre neue Welt hineinfinden, ohne die alte zu verleugnen, und waren entweder zu abweisend oder zu vertraulich.
Auch der Junge mußte sich umstellen. Die Eltern ließen ihn von dem alten Gymnasium, das wenige Schritte von der alten Wohnung entfernt lag, in ein neues wechseln, von der neuen Wohnung wieder nicht weit entfernt. So änderte sich auch sein Umgang. Der Ton in der neuen Klasse war rauher, und er war weniger ein Außenseiter als in der alten Klasse. Ein Jahr lang ging er noch zu seiner Klavierlehrerin in der Nähe der alten Wohnung. Dann fanden die Eltern seine Fortschritte im Klavierspiel so kläglich, daß sie den Unterricht beendeten und das Klavier verkauften. Ihm waren die Fahrten mit dem Rad zur Klavierlehrerin kostbar gewesen, weil sie ihn an der alten Wohnung und am Nachbarhaus vorbeiführten, wo ein Mädchen wohnte, mit dem er ab und zu gespielt hatte und ein Stück des Schulwegs gemeinsam gegangen war. Sie hatte dichte rote Locken bis auf die Schultern und ein Gesicht voller Sommersprossen. Er fuhr langsam an ihrem Haus vorbei und hoffte, sie würde heraustreten, sie würde ihn begrüßen, er würde sie begleiten, das Fahrrad neben sich schiebend, und ganz selbstverständlich würde sich ergeben, daß sie sich wiedersähen. Sie würden sich nicht eigentlich verabreden, sondern einfach verständigen, wo sie wann sein würde und er auch. Für eine Verabredung war sie viel zu jung.
Aber sie trat nie aus dem Haus, wenn er vorbeifuhr.
[19]5
Es ist ein Irrtum, zu glauben, Menschen würden Lebensentscheidungen erst treffen, wenn sie erwachsen werden oder sind. Kinder lassen sich mit der gleichen Entschiedenheit auf Handlungen und Lebensweisen ein wie Erwachsene. Sie bleiben nicht für immer bei ihren Entscheidungen, aber auch Erwachsene werfen ihre Lebensentscheidungen wieder über den Haufen.
Nach einem Jahr entschloß sich der Junge, in der neuen Klasse und Umgebung jemand zu sein. Es fiel ihm nicht schwer, sich mit seiner Kraft Respekt zu verschaffen, und da er auch gescheit und einfallsreich war, gehörte er in der Hierarchie, die in seiner wie in jeder Klasse über eine diffuse Mischung von Stärke, Frechheit, Witz und Vermögen der Eltern definiert war, bald zu denen, die zählten. Sie zählten auch bei den Mädchen, nicht in der eigenen Schule, in der es keine Mädchen gab, aber im Mädchengymnasium ein paar Straßen weiter.
Der Junge verliebte sich nicht. Er suchte sich eine aus, die etwas galt, von herausfordernder Attraktivität war, ein flottes Mundwerk hatte, sich Erfahrung mit Jungen nachsagen ließ, aber auch, daß sie schwer zu kriegen sei. Er imponierte ihr mit seiner Kraft, mit dem Respekt, den er genoß, und dadurch, daß das nicht alles war. Was da noch war, wußte sie nicht, aber es war etwas, was sie bei anderen nicht gefunden hatte und sehen und haben wollte. Er merkte es und ließ gelegentlich aufblitzen, daß er Schätze habe, die er nicht leichthin zeige, ihr aber vielleicht zeigen werde, wenn … Wenn sie mit ihm gehen würde? Schmusen [20] würde? Schlafen würde? Er wußte es selbst nicht genau. Das öffentliche Werben um sie, dem sie mehr und mehr nachgab, war interessanter, lohnender, prestigeträchtiger, als was zwischen ihnen beiden geschah. Mit den Freunden nach Schulschluß am Mädchengymnasium vorbeischlendern, wo sie mit ihren Freundinnen angelegentlich am eisernen Gitter lehnte, und selbstverständlich den Arm um sie legen oder, wenn sie mit ihrer Mannschaft ein Handballspiel hatte, ihr zuwinken und eine Kußhand zurückgeworfen bekommen oder mit ihr im Schwimmbad über den Rasen zum Becken gehen, bestaunt und bewundert – das war’s.
Als sie schließlich zusammen schliefen, war es eine Katastrophe. Sie hatte genug Erfahrung, um Erwartungen zu haben, und zu wenig, um mit seiner Unbeholfenheit umzugehen. Er hatte nicht die Sicherheit des Liebens, die die Unbeholfenheit des ersten Mals kompensiert. Als sie, nachdem das Schwimmbad geschlossen hatte und die Wärter ihre Runde gemacht hatten, hinter den Büschen am Zaun zusammen waren, kam ihm plötzlich alles falsch vor, die Küsse, die Zärtlichkeit, das Begehren. Nichts stimmte. Es war Verrat an allem, was er liebte und geliebt hatte – seine Mutter kam ihm in den Sinn, ihre Freundin mit dem Pelzmantel, das Nachbarskind mit den roten Locken und Sommersprossen und das Mädchen mit der Eidechse. Als alles vorbei war, die Peinlichkeiten des Umgangs mit dem Präservativ, sein viel zu schneller Orgasmus, seine ungeschickten, ihr nur lästigen Versuche, sie mit der Hand zu befriedigen, kuschelte er sich an sie – er suchte bei ihr Trost für sein Versagen. Sie stand auf, zog sich an und ging. Er [21] blieb zusammengekauert liegen und starrte auf den Stamm des Busches, unter dem er lag, auf das Laub vom Vorjahr, seine Wäsche und die Maschen des Zauns. Es wurde dunkel. Er blieb auch noch liegen, als ihm kalt wurde; ihm war, als könne er das Zusammensein mit ihr, das Werben um sie, die eitlen Kämpfe der letzten Monate ausfrieren, wie man eine Krankheit ausschwitzt. Schließlich stand er auf und schwamm ein paar Runden im großen Becken.
Als er um Mitternacht nach Hause kam, stand die Tür zum erleuchteten Arbeitszimmer auf. Der Vater lag auf der Couch, dünstete Alkohol aus und schnarchte. Ein Regal war umgestürzt, und die Schubladen des Schreibtisches waren ausgezogen und ausgeleert; der Boden war mit Büchern und Papieren übersät. Der Junge vergewisserte sich, daß das Bild unbeschädigt war, machte das Licht aus und die Tür zu.
6
Als er die Schule beinahe beendet hatte und nur noch auf die Aushändigung des Zeugnisses wartete, reiste er in die benachbarte große Stadt. Es war eine eineinhalbstündige Bahnfahrt, eine Reise, die er für einen Konzert-, Theater- oder Ausstellungsbesuch die ganzen Jahre hätte machen können und doch nie gemacht hatte. Seine Eltern hatten ihn als kleinen Jungen einmal mitgenommen und ihm die Kirchen, das Rathaus, das Gericht und den großen Park in der Mitte der Stadt gezeigt. Nach dem Umzug reisten die Eltern nicht mehr, nicht ohne ihn und nicht mit ihm, und [22] alleine zu reisen war ihm zunächst nicht eingefallen. Später konnte er es sich nicht leisten. Der Vater verlor wegen des Trinkens seine Stelle, und der Junge mußte neben der Schule arbeiten und Geld verdienen und zu Hause abgeben. Jetzt, wo er nach der Schule auch bald die Stadt verlassen würde, begann er innerlich, seine Eltern sich selbst zu überlassen. Und was er verdiente, wollte er jetzt auch ausgeben.
Er suchte das Museum mit neuer Kunst nicht, sondern fand es zufällig. Er ging hinein, weil ihn der Bau faszinierte, eine seltsame Mischung aus moderner Einfachheit an der einen Seite, abweisender Düsterkeit eines Höhlenbaus an den anderen Seiten und kitschiger Verspieltheit an Türen und Erkern. Die Sammlung reichte von den Impressionisten zu den neuen Wilden, und er sah alles mit gehöriger Aufmerksamkeit, aber geringer Anteilnahme an. Bis er auf das Bild von René Dalmann stieß.
»Am Strand« hieß es und zeigte einen Felsbrocken, Sandstrand und Meer, und auf dem Felsbrocken ein Mädchen beim Handstand, nackt und schön, aber das eine Bein war aus Holz, nicht ein Holzbein, sondern ein perfektes, holzgemasertes Frauenbein. Nein, weder erkannte er im Mädchen beim Handstand das Mädchen mit der Eidechse wieder, noch konnte er sagen, es handele sich um denselben Felsen, denselben Strand und dasselbe Meer. Aber alles erinnerte ihn so stark an das Bild zu Hause, daß er am Ausgang eine Postkarte kaufte und, wenn er mehr Geld gehabt hätte, einen Band über René Dalmann gekauft hätte. Als er zu Hause verglich, fielen ihm die Unterschiede zwischen Bild und Postkarte deutlich ins Auge. Und doch war da [23] etwas, das beide verband – war es nur in seinem betrachtenden Auge oder in den Bildern selbst?
»Was hast du da?« Sein Vater kam ins Zimmer und faßte nach der Postkarte.
Der Junge wich aus und ließ den Vater ins Leere greifen. »Wer hat das Bild gemalt?«
Der Blick des Vaters wurde vorsichtig. Er hatte getrunken, und es war dieselbe Vorsicht, mit der er auf die Ablehnung und Verachtung reagierte, die Frau und Sohn ihm im Suff offen zeigten. Angst hatten sie vor ihm schon lange nicht mehr. »Ich weiß nicht – warum?«
»Warum haben wir das Bild nicht verkauft, wenn es wertvoll ist?«
»Verkauft? Wir können das Bild nicht verkaufen!« Der Vater stellte sich vor das Bild, als müsse er es vor dem Sohn schützen.
»Warum können wir nicht?«
»Dann haben wir nichts mehr. Und du kriegst nichts, wenn ich nicht mehr bin. Für dich behalten wir das Bild, für dich.« Der Vater, glücklich über das Argument, das dem Sohn einleuchten mußte, wiederholte es noch mal und noch mal. »Mutter und ich legen uns quer, damit du eines Tags das Bild kriegst. Und was kriege ich von dir? Undank, nichts als Undank.«
Der Junge ließ den weinerlichen Vater stehen und vergaß den Vorfall, das Bild im Museum und René Dalmann. Er nahm zu dem Job im Lager der Traktorenfabrik noch einen weiteren als Kellner an, arbeitete, bis das Semester anfing, und ging dann zum Studium so weit weg, wie er nur konnte. Die Stadt an der Ostsee war häßlich und die Universität [24] mäßig. Aber nichts erinnerte ihn an seine Heimatstadt im Süden, und in den ersten Wochen des Studiums stellte er erleichtert fest, daß ihm in seinen juristischen Vorlesungen, in der Mensa oder auf den Gängen niemand begegnete, den er kannte. Er konnte ganz neu anfangen.
Auf der Reise hatte er Station gemacht. Er hatte nur ein paar Stunden, um durch die Stadt am Fluß zu laufen. Daß er sich vor dem Museum fand, war wieder Zufall. Im Museum überließ er sich nicht dem Zufall, sondern fragte sofort nach Bildern von René Dalmann und fand zwei. »Nach dem Krieg die Ordnung« war eineinhalb auf zwei Meter hoch und zeigte eine auf dem Boden sitzende Frau mit vorgebeugtem Kopf, angewinkelten Beinen und aufgestütztem linken Arm. Mit der rechten Hand schob sie sich eine Schublade in den Unterleib, und auch ihre Brust und ihr Bauch waren Schubladen, die eine mit den Brustwarzen und die andere mit dem Nabel als Griffen. Die Brust- und die Bauchschublade waren leicht herausgezogen und leer, in der Unterleibschublade lag verrenkt und verstümmelt ein toter Soldat. Das andere hieß »Selbstbildnis als Frau« und zeigte den Oberkörper eines lachenden jungen Mannes mit kahlem Schädel; unter seiner hochgeschlossenen schwarzen Jacke zeichneten sich Brüste ab, und mit der linken Hand hielt er eine Perücke mit blonden Locken hoch.
Diesmal kaufte er ein Buch über René Dalmann und las auf der Zugreise über die Kindheit und Jugend des 1894 in Straßburg geborenen Künstlers. Die Eltern, ein von Leipzig nach Straßburg gezogener Textilkaufmann und seine zwanzig Jahre jüngere elsässische Frau, hatten sich eine Tochter gewünscht; sie hatten bereits zwei Söhne, und eine [25] drittgeborene Tochter war zwei Jahre zuvor gestorben, nachdem der Vater sie auf einen winterlichen Ausritt mitgenommen und sie sich eine Lungenentzündung geholt hatte. René wuchs im Schatten dieser toten Schwester auf, bis 1902 die ersehnte zweite Tochter kam – Befreiung und Kränkung zugleich. Er zeichnete und malte früh, kam in der Schule nicht mit und bewarb sich mit sechzehn Jahren erfolgreich auf der Kunstakademie in Karlsruhe.
Dann war die Reise zu Ende. Er fand ein Zimmer, eine Mansarde mit Kohleofen und kleinem Fenster, das Klo mit winzigem Waschbecken einen halben Stock tiefer im Treppenhaus. Aber er war für sich. Er richtete sich ein und räumte das Buch über René Dalmann mit den mitgebrachten Lieblingsbüchern unten ins Regal. Oben sollte Platz für die neuen Bücher, das neue Leben sein. Nichts, was ihm teuer war, hatte er zu Hause gelassen.
7
Sein Vater starb im dritten Jahr seines Studiums. Er war, wie in den letzten Jahren immer öfter, zum Trinken in die Kneipe gegangen, war betrunken auf dem Heimweg gestolpert, die Böschung hinabgestürzt, liegengeblieben und erfroren. Die Teilnahme an der Beerdigung war nach der Abreise ins Studium der erste Besuch zu Hause. Es war Januar, der Wind war schneidend kalt, auf dem Weg von der Friedhofskapelle zum Grab waren die Pfützen gefroren, und nachdem die Mutter gerutscht und beinahe gefallen war, ließ sie ihren Sohn ihren Arm nehmen, was sie davor [26] abgelehnt hatte. Sie hatte ihm nicht verzeihen wollen, daß er sie so lange nicht besucht hatte.
Zu Hause hatte sie für die paar Nachbarn, die sie auf den Friedhof begleitet hatten, belegte Brote und Tee gerichtet. Als sie merkte, daß Gäste nach Alkoholischem Ausschau hielten, stand sie auf. »Wer gekränkt ist, weil ich ihm kein Bier anbiete oder keinen Schnaps, kann auf der Stelle gehen. In dieser Wohnung ist genug getrunken worden.«
Am Abend gingen Mutter und Sohn ins Arbeitszimmer des Vaters. »Ich glaube, es sind alles juristische Bücher. Willst du sie haben? Kannst du sie brauchen? Was du nicht nimmst, schmeiße ich weg.« Sie ließ ihn allein. Er schaute die Bibliothek an, um die sein Vater soviel Aufhebens gemacht hatte. Bücher, die es schon lange in neuen Auflagen gab, Zeitschriften, deren Bezug vor Jahren eingestellt worden war. Das einzige Bild war das vom Mädchen mit der Eidechse; anders als in der alten Wohnung, wo es die große Wand über der Couch für sich gehabt hatte, hing es zwischen Regalen und beherrschte doch den ganzen Raum. Er stieß mit dem Kopf fast an die tiefe Decke, sah auf das Mädchen herab und erinnerte sich, wie er ihm Auge in Auge gegenübergestanden hatte. Er dachte an die Weihnachtsbäume, die früher groß waren und heute klein sind. Aber dann dachte er, daß das Bild nicht kleiner geworden war, nichts von seiner Kraft verloren hatte, ihn nicht weniger bannte. Und er dachte an das kleine Mädchen in dem Haus, in dem er unter dem Dach wohnte, und wurde rot. »Prinzessin« nannte er sie, und sie flirteten miteinander, und wenn sie ihn fragte, ob er ihr nicht seine Mansarde zeigen wolle, bot er seine ganze Willensstärke auf und sagte nein. [27] Sie fragte in aller Unschuld. Aber weil sie kriegen wollte, was er nicht geben wollte, bot sie eine solche Koketterie, eine solche Verführung in Haltung und Blick und Stimme auf, daß er die Unschuld schier vergaß.
»Ich will Vaters Bücher nicht. Aber ich rufe morgen einen Antiquar an. Er wird dir ein paar hundert Mark oder einen Tausender zahlen.« Er setzte sich in der Küche zu seiner Mutter an den Tisch. »Was hast du mit dem Bild vor?«
Sie faltete die Zeitung zusammen, die sie gelesen hatte. Immer noch waren ihre Bewegungen nervös und fahrig und hatten darin etwas Jugendliches. Sie war nicht mehr schlank, sondern dürr, und die Haut spannte über den Knochen des Gesichts und der Hände. Ihr Haar war fast weiß.
Er war plötzlich voller Mitleid und Zärtlichkeit. »Was hast du mit dir vor?« Er fragte sanft und wollte seine Hand auf ihre legen, aber sie zog sie fort.
»Ich werde hier ausziehen. Am Hang haben sie ein paar Terrassenhäuser gebaut, und ich habe eine Einzimmerwohnung gekauft. Mehr als ein Zimmer brauche ich nicht.«
»Gekauft?«
Sie schaute ihn feindselig an. »Ich habe Vaters Rente und meinen Verdienst in eine gemeinsame Kasse getan, und was er fürs Trinken genommen hat, habe ich für mich genommen. Ist da was gegen zu sagen?«
»Nein.« Er lachte. »In zehn Jahren hat Vater eine Wohnung vertrunken?«
Die Mutter lachte mit. »Nicht ganz. Aber mehr als den Bausparvertrag, mit dem ich die Wohnung bezahlt habe.«
[28] Er zögerte. »Warum bist du bei Vater geblieben?«
»Was für eine Frage.« Sie schüttelte den Kopf. »Eine Weile kannst du wählen. Willst du dies tun oder das, mit diesem Menschen leben oder jenem. Aber eines Tages sind diese Tätigkeit und jener Mensch dein Leben geworden, und warum du bei deinem Leben bleibst, ist eine ziemlich dumme Frage. Aber du hast nach dem Bild gefragt. Nichts habe ich mit ihm vor. Du nimmst es mit oder bringst es zur Bank, wenn die so große Schließfächer hat.«
»Sagst du mir, was es mit dem Bild auf sich hat?«
»Ach, Kind …« Sie sah ihn traurig an. »Ich mag nicht. Ich glaube, Vater war stolz auf das Bild, bis zum Schluß.« Sie lächelte müde. »Er hätte dich so gerne besucht und gesehen, wie es dir mit dem juristischen Studium geht, aber er hat sich nicht getraut. Du hast uns nie eingeladen. Weißt du, ihr Kinder seid nicht weniger grausam, als wir Eltern es waren. Selbstgerechter seid ihr, das ist alles.«
Er wollte protestieren, wußte aber nicht, ob sie nicht recht hatte. »Es tut mir leid«, sagte er ausweichend.
Sie stand auf. »Schlaf gut, mein Junge. Ich bin morgen früh um sieben aus dem Haus. Wenn du ausgeschlafen hast und abreist, vergiß das Bild nicht.«
8
In seiner Mansarde hängte er das Bild übers Bett. Das Bett stand links an der Wand, rechts standen Schrank und Regal und vorne, unter der Dachluke, der Schreibtisch.
»Ich sehe ihr ähnlich. Wer ist sie?« Die ihn fragte, war [29] eine Studentin, die ihm seit dem ersten Semester gefallen hatte. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Mädchen? Er war sich dessen nicht bewußt gewesen.
»Ich weiß nicht, wer sie ist. Ob sie überhaupt jemand ist.« Er wollte fortfahren: »Du bist auf jeden Fall schöner.« Aber dann wollte er das Mädchen mit der Eidechse nicht verraten. Kann man ein Mädchen auf einem Bild verraten?
»Was denkst du?«
»Daß du schön bist.«
Sie war sehr schön. Er lag rücklings auf dem Bett, sie bäuchlings auf ihm. Die Arme auf seiner Brust und das Kinn auf den Armen sah sie ihn ruhig an. Oder sah sie über ihn hinweg, durch ihn hindurch? Die dunklen Augen und Locken, die hohe Stirn, das frische Rot der Wangen, der Schwung der Nasenflügel und Lippen – sie war in ihrer Schönheit ganz ihm zugewandt und doch eigentümlich für sich. Oder bildete er es sich nur ein? Wurde ihm die Frau, die er liebte, weil er sie liebte, zum Bild? Zugleich zugewandt und unerreichbar?
»Wer ist der Maler?«
»Ich weiß nicht.«
»Er muß sein Bild signiert haben.« Sie richtete sich auf und schaute den unteren Bildrand genau an. Dann sah sie ihn an. »Das ist ja ein Original!«
»Ja.«
»Weißt du, was es wert ist?«
»Nein.«
»Vielleicht ist es wertvoll. Von wem hast du’s?«
Er dachte an das Gespräch mit dem Vater vor vielen Jahren. »Komm her!« Er breitete die Arme aus. »Ich will nicht [30] wissen, ob es wertvoll ist. Wenn ich es gewußt und dir gesagt hätte und du es jetzt wüßtest, müßte ich mich immer fragen, ob du mich nur wegen meines Bilds liebst.«
Sie kam in seine Arme. »Sei nicht albern. Wenn es wertvoll ist, kannst du es nicht hier behalten. Hier ist es im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt, und außerdem setzt dein komischer Ofen eines Tages das Dach und das Haus in Brand, und du kannst vielleicht aufs Nachbardach flüchten, aber das Bild verbrennt. Ein wertvolles Bild braucht gleichmäßige Temperaturen und gleichmäßige Luftfeuchtigkeit und was weiß ich. Und weil du es nicht hierbehalten kannst, kannst du es auch gleich verkaufen. Du arbeitest und arbeitest und leistest dir nichts, weil du kein Geld hast. Das macht doch keinen Sinn.«
Er erzählte von seinem neuen Job und lenkte sie ab. Aber als sie ging, fragte sie: »Weißt du, was?«
»Was?«
»Mein Bruder studiert Kunstgeschichte. Er sollte das Bild anschauen.«
Er ließ es nicht dazu kommen. Als sie ihn das nächste Mal besuchte, hatte er das Bild unters Bett geschoben und sagte, seine Mutter habe es wiederhaben wollen. Sie redete dennoch mit ihrem Bruder, dem kein ähnliches Bild und kein passender Maler, aber die Zeitschrift »Lézard violet« einfiel, begründet in Paris im Übergang vom Dadaismus zum Surrealismus und zwischen 1924 und 1930 in zehn Heften erschienen. Dann vergaß sie das Bild.
Immer wenn sie gegangen war, hängte er es wieder übers Bett. Am Anfang war es ein Spiel; er nahm das Bild mit einem Lächeln ab und hängte es mit einem Lächeln auf, [31] verabschiedete sich vom Mädchen und begrüßte es mit einer scherzenden Bemerkung. Dann wurde ihm lästig, daß er das Bild abnehmen mußte, weil die andere kam, und dann, daß sie kam. Wenn sie zusammen geschlafen hatten und beieinander lagen, wartete er darauf, daß sie gehen, er das Bild wieder aufhängen und sein Leben wieder aufnehmen würde.
Schließlich verließ sie ihn. »Ich weiß nicht, was in deinem Kopf und in deinem Herzen vorgeht.« Sie tippte zuerst auf seine Stirn und dann auf seine Brust. »Irgendeinen Platz werde ich darin wohl haben. Aber er ist mir zu klein.«
9
Er litt stärker, als er erwartet hatte. Manchmal ärgerte er sich – vielleicht wäre ohne das Bild alles anders und besser gekommen. Aber der Ärger verband ihn auch mit dem Bild. Er sprach mit dem Mädchen. Daß er ohne sie besser dran wäre. Daß sie ihm ganz schön was eingebrockt habe. Daß sie ihn jetzt ruhig freundlicher anschauen könne. Ob sie stolz darauf sei, die Nebenbuhlerin erfolgreich aus dem Feld geschlagen zu haben? Sie brauche sich nichts einzubilden.
Eines Abends nahm er das Buch über René Dalmann und las weiter. Nach Abschluß der Kunstakademie lebte der junge Künstler im Haus einer reichen Karlsruher Witwe, die ihm ein Atelier eingerichtet hatte. Das war in der biederen Residenzstadt ein Skandal, den beide nach Auskunft des Biographen mehr genossen als ihre [32] schwierige Beziehung. Er versuchte sich als Porträtmaler zu etablieren, und seine ersten Porträts waren konventionell, bis er, eines skandalösen Lebens beschuldigt, auch skandalöse Porträts zu malen begann, den Beamtenschädel des Präsidenten des Karlsruher Oberlandesgerichts, als sei er aus Holz geschnitzt, und seinen Sohn, einen schneidigen Leutnant, mit Epauletten, Fangschnüren und Säbel im Gesicht. Der Oberlandesgerichtspräsident strengte einen Prozeß an, dem René Dalmann sich durch Abreise in die Bretagne entzog, wo der Familie seiner Mutter, deren größter Teil das Elsaß 1871 verlassen hatte, ein Haus gehörte. Hier, wo er mit Eltern und Geschwistern viele Ferien verbracht hatte, blieb er bis zum Ausbruch des Krieges, den er als freiwilliger französischer Sanitätssoldat verbrachte. Es waren seine Jahre der Skizze; zu anderem reichten weder Zeit noch Mittel. Neben verwundeten, verstümmelten und sterbenden Soldaten tauchten religiöse Motive auf, Adam und Eva, als seien sie ein Brautpaar, das sich in das Paradies der Schlachtfelder verirrt hat, und die Heilung eines verkrüppelten Soldaten durch einen verkrüppelten Christus. Nach Kriegsende lebte er in Paris und verbrachte viel Zeit im Café Certá, ohne zu den Dadaisten zu gehören, und mit André Breton, dem er in die kommunistische Partei folgte, von dem er sich aber nicht bei den Surrealisten organisieren ließ. Er hielt sich abseits, bis er mit ein paar Freunden den »Lézard violet« gründete. René Magritte schrieb darin über Malen als Denken, Salvador Dali über den Schnitt in das Auge des Mädchens, und von Max Beckmann druckte die Zeitschrift ohne dessen Erlaubnis eine englische Übersetzung eines kleinen, bei der Hochzeitsreise entstandenen [33] Essays über Kollektivismus. René Dalmann selbst schrieb über die Befreiung der Phantasie von der Willkür und gestaltete die Zeitschrift graphisch.
Das alles fand er nur mäßig interessant. Bis er nicht mehr las, sondern blätterte. Am Ende des Buches gab es ein paar Seiten mit den Lebensdaten René Dalmanns, eine Bibliographie mit Werken von ihm und über ihn und ein Verzeichnis seiner Ausstellungen. 1933 war die Ausstellung »Est-ce qu’il y a un surréalisme allemand?« in der Galerie Colle in Paris verzeichnet und vermerkt, daß der Katalogeinband »Die Echse und das Mädchen« von René Dalmann zeigte. Die Echse und das Mädchen.
Am nächsten Morgen ging er in das Kunsthistorische Institut der Universität und suchte vergebens nach einem Exemplar des Katalogs von 1933. Er versäumte seine Vorlesungen, entschuldigte sich in dem Restaurant, in dem er mittags als Kellner arbeiten sollte, mit einer Grippe und fuhr in die Stadt, in der er seinerzeit das Nachkriegsbild und das Selbstbildnis von René Dalmann gesehen und das Buch über ihn gekauft hatte. Auch hier gab es eine Universität und ein Kunsthistorisches Institut, aber auch hier fehlte der Katalog. Inzwischen war er in einem Zustand fiebriger Aufgeregtheit. Die Bibliothekarin merkte es und fragte ihn, was sei. Er erklärte, daß er auf der Suche nach René Dalmanns »Die Echse und das Mädchen« sei und den Katalog, auf dessen Einband das Bild wiedergegeben sei, nicht finde. Wo das nächste Kunsthistorische Institut sei.
»Warum muß es die Wiedergabe auf dem Katalog sein?«
Er schaute sie verständnislos an.
»Vermutlich hat schon er selbst sein Bild fotografiert, [34] dann sein Galerist, die Presse, das Museum, in dem es hängt.«
»Sie meinen, es hängt in einem Museum? Wo?«
»Wir haben ein Bildarchiv. Kommen Sie!«
Er folgte ihr über einen Korridor in einen Raum mit Projektor und Kartons, an denen Schildchen mit Namen klebten. Er wurde ruhiger. Er registrierte sogar, daß die Bibliothekarin eine hübsche Figur und einen leichten Gang hatte und ihn mit munteren, seine Aufgeregtheit freundlich verspottenden Augen ansah. Sie holte einen Karton aus dem Regal, studierte eine Liste, die in die Innenseite des Deckels geklebt war, griff ein Dia, fast postkartengroß und in schwarze Folie gefaßt, und steckte es in den Projektor. »Machen Sie das Licht aus?«
Er fand den Schalter und machte dunkel. Sie schaltete den Projektor ein.
»Mein Gott«, sagte er. Es war sein Bild. Das Mädchen, der Strand, der Felsen. Aber von links lehnte nicht das Mädchen ins Bild, sondern eine riesige Eidechse, und auf dem Fels sonnte sich nicht eine Eidechse, sondern ein winziges Mädchen, allerliebst mit dunklen Locken und blassem Gesicht, hellem Mieder und dunklem Rock. Es lag auf der Seite, den Kopf auf den Armen, halb verspieltes Kind und halb verführerisches Weib.
10
»In welchem Museum hängt das Bild?«
»Das müssen wir vorne schauen.« Die Bibliothekarin [35] schaltete den Projektor aus, räumte das Dia zurück und ging wieder in den Raum mit den Büchern. Er sah ihr zu, wie sie den einen und anderen Band aus den Regalen holte und darin blätterte. »Werde ich dafür wenigstens zum Essen eingeladen?« Sie blätterte weiter. »Oh!«
»Was ist?«
»Das Bild hängt in keinem Museum. Es ist verschollen. Verschollen und vielleicht zerstört. Letztmals war es 1937 auf der Ausstellung ›Entartete Kunst‹ in München zu sehen.« Er schaute verständnislos.
»Es wurde in Gruppe fünf ausgestellt. Dazu hieß es: ›Pornographie braucht keine Nacktheit, und Entartung braucht keine handwerkliche Verzerrung. Mit perfektem Pinselstrich kann der Jude den deutschen Unternehmer als kapitalistischen Wüstling und das deutsche Mädchen als seine lüsterne Dirne darstellen. Das Schweinische und die marxistische, klassenkämpferische Tendenz gehen für den Juden Hand in Hand. Wenn man daran denkt, daß auch deutsche Mütter und Frauen diese Schau besuchen …‹ Soll ich weiterlesen?«
»Gibt es von René Dalmann auch ein Bild ›Das Mädchen mit der Eidechse‹?«
Sie blätterte. »Wie steht’s mit dem Essen?«
»Wann sind Sie hier fertig?«
»Um vier.«
»Da gibt’s noch kein Essen.«
»Und hier gibt es kein Mädchen mit Eidechse. Sind Sie sicher, daß das Bild so heißt?«
»Nein.« Sein Vater und seine Mutter hatten das Bild so genannt und dann auch er selbst. René Dalmann mochte es [36] sonstwie genannt haben. »Aber es zeigt ein Mädchen und eine Eidechse, die Umkehrung dessen, was wir gerade gesehen haben.«
»Interessant. Wo haben Sie es gesehen?«