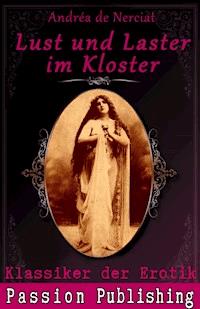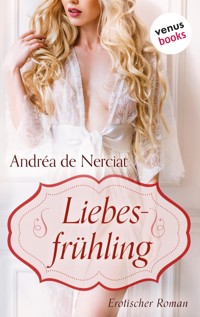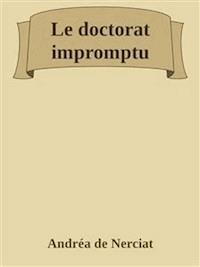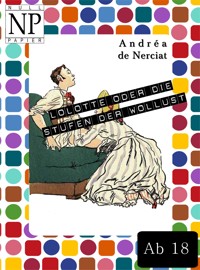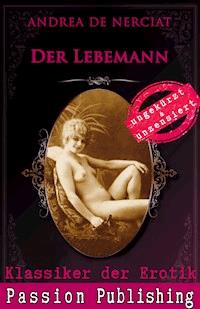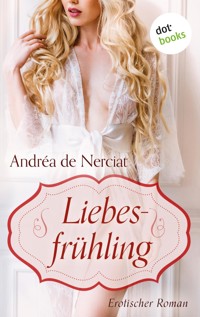
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sündiges Abenteuer jagt das nächste: Der erotische Klassiker "Liebesfrühling" von Andréa de Nerciat als eBook bei dotbooks. Frankreich, im 18. Jahrhundert: Die junge Lotte ist tief unglücklich, als es nach dem Tod ihres Vaters und Bankrott der Familie nur noch eine Zukunft für sie gibt: ein Leben im Kloster! Doch Lotte gelingt es, ein verbotenes Buch voller sündiger Zeichnungen in die heiligen Mauern zu schmuggeln – und findet in ihrer Zofe eine ebenso erfahrene wie willige Lehrmeisterin: Felicia hat die Geheimnisse und Unartigkeiten der Liebeskunst schon früh kennengelernt – als sie als Junge verkleidet mit einigen Burschen durch die Lande zog und schließlich einer Madame zu Diensten war, deren Verlangen keine Scham und keine Grenzen kannte … Zwei junge Frauen, unzählige erotische Fantasien: Genießen Sie diesen Klassiker der erotischen Literatur! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Liebesfrühling" – auch bekannt als erotischer Klassiker "Lolotte oder die Stufenleiter der Wolllust" – von Andréa de Nerciat. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag. Jugendschutzhinweis: Im realen Leben dürfen Erotik und sexuelle Handlungen jeder Art ausschließlich zwischen gleichberechtigten Partnern im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden. In diesem eBook werden fiktive erotische Phantasien geschildert, die in einigen Fällen weder den allgemeinen Moralvorstellungen noch den Gesetzen der Realität folgen. Der Inhalt dieses eBooks ist daher für Minderjährige nicht geeignet und das Lesen nur gestattet, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankreich, im 18. Jahrhundert: Die junge Lotte ist tief unglücklich, als es nach dem Tod ihres Vaters und Bankrott der Familie nur noch eine Zukunft für sie gibt: ein Leben im Kloster! Doch Lotte gelingt es, ein verbotenes Buch voller sündiger Zeichnungen in die heiligen Mauern zu schmuggeln – und findet in ihrer Zofe eine ebenso erfahrene wie willige Lehrmeisterin: Felicia hat die Geheimnisse und Unartigkeiten der Liebeskunst schon früh kennengelernt – als sie als Junge verkleidet mit einigen Burschen durch die Lande zog und schließlich einer Madame zu Diensten war, deren Verlangen keine Scham und keine Grenzen kannte …
Zwei junge Frauen, unzählige erotische Fantasien: Genießen Sie diesen Klassiker der erotischen Literatur!
Über den Autor:
Robert-André Andréa de Nerciat wurde 1739 in Dijon geboren und verstarb 1800 in Neapel. Er war ein französischer Schriftsteller, Soldat, Architekt und Bibliothekar. Als Mitglied der königlichen Garde Ludwigs XVI ging er am französischen Königshof ein und aus – dies inspirierte ihn zu zahlreichen Gedichten, Theaterstücken, Erzählungen und Romanen, in denen er den erotisch freizügigen und ausschweifenden Lebensstil der französischen Oberschicht beschrieb.
***
eBook-Lizenzausgabe April 2018
Die französische Originalausgabe erschien 1792 unter dem Titel Mon noviciat, ou les joies de Lolotte.
Unter dem Titel Mein Noviziat erschien 1797 die erste deutsche Übersetzung.
Copyright © der Neuausgabe 2018 venusbooks GmbH, München
Copyright © der Lizenzausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildabbildung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Galina Tcivina
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-302-0
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Liebesfrühling an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
Im realen Leben dürfen Erotik, Sinnlichkeit und sexuelle Handlungen jeder Art ausschließlich zwischen gleichberechtigten Partnern im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden. In diesem eBook werden erotische Phantasien geschildert, die vielleicht nicht jeder Leserin und jedem Leser gefallen und in einigen Fällen weder den allgemeinen Moralvorstellungen noch den Gesetzen der Realität folgen. Es handelt sich dabei um rein fiktive Geschichten; sämtliche Figuren und Begebenheiten sind frei erfunden. Der Inhalt dieses eBooks ist für Minderjährige nicht geeignet und das Lesen nur gestattet, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
Andréa de Nerciat
Liebesfrühling
Erotischer Roman
dotbooks.
1
Hier werde ich nun die Erlebnisse zu beschreiben versuchen, die ich in meinem ledigen Stand gehabt habe – das heißt, vom Beginn meines süßen Lebens voller Ausschweifungen bis zu meinem Eintritt in die Ehe: etwa drei Monate.
Verheiratet war ich allerdings nur kurz und auch währenddessen überhaupt nicht eingeschränkt, doch wenn ich alles andere ebenso detailliert schildern würde, müsste ich unzählige Bände füllen, und es gibt kaum Langweiligeres, als ständig sich wiederholende Abläufe zu lesen. Außerdem schreibe ich lange nicht mehr so fleißig wie früher. Heute mehre ich lieber meine Genüsse als meine Zeilen.
Junge Mädchen, die dies Buch in die Hand bekommen, seien gewarnt, es mir nachzutun. Diese Lebensart würde keine lange aushalten. Dabei will ich hier weder Reue heucheln noch mich auf die Sterne oder andere Personen ausreden, nein. Alles, was ich tat, tat ich aus freien Stücken und gerne. Und ich tue auch jetzt noch immer dasselbe, bloß, dass ich nun mehr auf mein Vermögen achte und auch mehr auf meinen guten Ruf bedacht bin. Und ich werde es tun, so lange ich es zu tun vermag. Doch folget nicht meinem Beispiel!
Vom lasterhaften Treiben lässt man meist erst dann wieder ab, wenn man es nicht mehr vermag. Doch hat man sich selbst erst einmal auf diese Weise entblößt, wird man mit Verachtung bestraft und ist rettungslos verloren. Durch eine Fügung des Schicksals hatte ich jedoch das Glück, dass ich inmitten des sinnlichsten Rausches erkannte, wie wichtig es ist, sich vor öffentlichen Beschimpfungen zu hüten. Von dieser Stunde an wurde ich – eine Heuchlerin.
Ihr sollt wissen, dass ich all das getan oder zumindest versucht habe, es zu tun, wozu einen überschäumendes Temperament und hingebungsvolles Ausleben wechselnder Liebesbeziehungen zu treiben imstande sind.
Und wer bist du? Bist du eine von denen, die doch noch mehr weiß als ich, kannst du mir vielleicht noch etwas beibringen? Dann komm, jetzt, still und schnell!
Ich selbst zähle kaum vierundzwanzig Lenze, bin groß und schlank, aber nicht zu dünn, hellhäutig und blond, aber weder fade noch kränklich. Schon so mancher ließ sich durch mein Äußeres täuschen und meinte, ich wäre so blass wie meine Haut. Doch wie sinnlich können meine Bisse, wie feurig meine Küsse sein! Komm und lasse dich umarmen und liebkosen und dann urteile selbst: Sind meine Hüften kernig? Ist mein Venushügel erhaben, meine Muschel eng und feucht, mein nicht weniger aktives Gesäß rund, fleischig und weich?
Ob du nun Prinz, Edelmann, Bürger, Mönch oder Dienstbote sein magst – wenn dich die Natur mit der Lanze eines Herkules ausgestattet hat und wenn dein Mannesbeutel jenen kostbaren Saft – Wieso hat unsere so schwerfällige, an unnützen Worten so reiche Sprache dafür bislang kein besseres Wort gefunden? – verschwenderisch verspritzen kann, so komm!
Du kannst aber auch kommen, wenn du nicht mit jener Steifheit gesegnet bist, die ich so leidenschaftlich liebe, solange du nur Finger aufzubieten hast, die kunstfertig Triller schlagen können, oder eine nicht minder wendige und fleißige Zunge. Hier ist mein Angebot: Ich will für dich Venus oder Ganymed sein, ganz wie du beliebst, und dir alle Gelüste erfüllen und dich nicht eher entlassen, als bis deine Kräfte auf Monate hinaus erschöpft sind.
Doch du musst verschwiegen sein! Denn wenn wir einander irgendwo treffen, ob wir nun noch eine Affäre miteinander unterhalten oder einander bereits überdrüssig geworden sind, so müssen wir doch so tun, als ob wir uns noch nie gesehen haben, denn obgleich ich die Liebe so heiß liebe, so will ich mich doch von den verstockten Sittenrichtern nicht tadeln lassen. Daher müssen meine Gespielen über unser wollüstiges Treiben schweigen und nicht einmal Freunde dürfen davon wissen. Die Liebesspiele schaden uns nicht. Nur die Art, wie wir sie spielen, kann uns der Kritik aussetzen.
Diese Einsicht kommt zwar relativ spät, doch seit ich mich an diese Regel halte, habe ich jene innere Ruhe gefunden, die mir vorher so oft ins Wanken geriet, und ich kann sie nur weiterempfehlen.
2
Meine Mutter wurde in ihrem siebzehnten Lebensjahr mit einem Baron verheiratet; und obwohl sie eine höchst andächtig wirkende Internatsschülerin war, ist es nicht gewiss, dass ich – geboren acht Monate und elf Tage nach der Hochzeit – wirklich die Frucht seiner Lenden bin.
Sie war die Tochter eines reichen Privatmannes und hatte rasch eingewilligt, ein Opfer zu bringen und den Baron zu ehelichen – was eine Ehre und ein Vergnügen für sie war, denn der Baron war ein hübscher Mann und etwa gleich alt wie sie.
Es kam damals öfter vor, dass sich ein Adeliger, der nichts mehr hatte außer Schulden und seinem Titel, dazu herabließ, irgendeinen Glückspilz mit Letzterem zu beehren, wenn dieser sein Töchterchen geadelt sehen wollte. Es floss meist eine größere Geldsumme, die der vornehme Herr so rasch wie möglich durchbrachte, währenddessen das Töchterchen seinerseits alles unternahm, um sich ihm immer verhasster zu machen.
Mit diesem Spiel hatten auch meine Eltern die ersten sechzehn Jahre meines Lebens verbracht – dann erfolgte der vollständige Bankrott, der auch bald die Ehescheidung nach sich zog.
Trotz allem war in all dem Durcheinander meine Erziehung nicht vernachlässigt worden. Sie umfasste Tanzen, Singen, Harfespielen, Zeichnen und Sticken.
Meine Mutter hatte sich entschlossen, sich in ein Bernhardinernonnenkloster in der Provinz zurückzuziehen, um dort von einem sehr bescheidenen Einkommen zu leben, und ich musste ihr folgen. Am meisten schmerzte mich dabei, dass ich mich von meinen geliebten Lehrern trennen musste.
Sie alle hatten mir nicht nur ihre Lehren, sondern auch eine gewisse Neigung zur Unabhängigkeit und lockerere Moralvorstellungen beigebracht. Zwar hatte noch keiner von ihnen versucht, die angedeuteten Ausschweifungen mit mir in die Tat umzusetzen, doch ich bin sicher, dass sie diese Absichten gehegt haben. Vielleicht meinten einige, mich später verführen zu können, wenn ich reifer oder älter oder verheiratet wäre.
Es gelang manchem von ihnen sogar trotz der wachsamen Augen, die man auf ihren Unterricht hatte, mir eine Reihe von Büchern zuzustecken, die man für gewöhnlich nicht offen weitergibt und deren Illustrationen allein bereits zu Unzucht zu verführen imstande sind.
In dieser Situation erreichte mich die Nachricht vom Niedergang meines Hauses und von unserer knapp bevorstehenden Abreise. Ich hatte nicht einmal mehr Zeit, meinem Italienisch-Lehrmeister die betreffenden Bücher zurückzugeben. Der gute Bandini! Lange quälte mich deshalb das schlechte Gewissen, und auch ein anderer Gedanke ließ sich nicht aus meinem Kopf vertreiben: dass ich ihm gerne durch eine gewisse Gefälligkeit für seinen Dienst gedankt hätte.
Ich muss mich wohl nicht deutlicher erklären! Ich brannte darauf, endlich von der Theorie zur Praxis überzugehen, und da mir Bandini als echter Italiener am meisten geschmeichelt hatte, war er es, dem ich das größte Zutrauen schenkte, obwohl er nicht mehr der Jüngste und auch wenig ansehnlich war. Wie gerne hätte ich ihn bedrängt, mich in die Geheimnisse der Liebe einzuweihen! Seine Anträge bestanden jedoch immer nur im züchtigen Wunsch, dass ich mich stets an die Gefahr erinnern möge, in die er sich für mich begeben hatte, und ihm stets wohlgesonnen sein möge. Zwei oder drei Tage hätte ich wohl noch gebraucht, dann hätte ich ihn so weit und er mich gehabt. Nur der plötzliche Fall meines Hauses hielt mich davon ab, mich in Schande an den ältlichen Kavalier zu verschenken.
Doch nun reisten wir ab und ich würde bald in klösterlichen Mauern eingeschlossen sein.
Bislang hatte ich das wollüstige Hilfsmittel, das mir meine Lehrer zuteil werden ließen, noch nicht verwendet, zu düster waren die Schilderungen, mit denen sie mir die einsame Wollust beschrieben hatten. Schlimme Folgen sollte es haben, dieses kitzelige Vergnügen, dem sie den erregenden Schauer nicht ganz absprechen konnten: Verlust von Gewicht und Schönheit, stattdessen Auszehrung und nicht zuletzt der Tod selbst würde mir drohen, noch bevor ich die wahren Freuden geteilter Liebeskunst erfahren hätte, für die ich in meiner Schönheit wie geschaffen wäre.
Als sich die Klostertüren jedoch hinter mir geschlossen hatten und ich mich unter einem Dach wiederfand, zu dem kein Mann Zutritt hatte, verliebte ich mich umso mehr in die herrlichen Geschöpfe, die die Seiten meiner besagten Bücher zierten, und ich begriff, dass nun bald Schluss sein würde mit meiner Enthaltsamkeit.
Unsere einzige Bedienstete war eine Kammerzofe, die mit mir in einem Bett schlief. Sie war fast ständig um mich, wenn meine Mutter nicht im gleichen Zimmer war. Eines Tages schickte meine Mutter meine Wächterin aus und besuchte selbst eine Nonne, mit der sie sich angefreundet hatte. Endlich war ich frei! Ich brannte vor Wollust und spürte schon im Vorhinein den Geschmack des frivolen Vergnügens, das ich mir selbst bereiten wollte.
Ich legte einen großen Spiegel auf den Boden, hob meine Kleider in die Höhe und betrachtete eine Weile verzückt meinen Venushügel, der bereits von samtigem Flaum bedeckt war. Aufgeregt öffnete ich ein wenig die rosigen Lippen meiner kleinen Purpurschnecke und versuchte, mit einem Finger einzudringen, doch der Schmerz gebot mir Einhalt. Besser gefiel mir aber ein sanftes, eiliges Kitzeln, es jagte mir feurige Schauer über den Körper und versetzte mich in Aufruhr. Der Instinkt trieb mich immer schneller und schneller an, bis ich dem Zauber der Natur verfiel – elektrisiert – verzehrt – ich sterbe ...
3
Man kann sich kaum vorstellen, welch Freude ich über den Fortgang meiner Erfahrungen empfand. Leider konnte ich mich dem süßen Vergnügen einige Zeit lang nur höchst selten hingeben, doch dann eröffnete mir der Zufall alle Möglichkeiten.
Die Zofe, mit der ich mein Bett teilte, war ein groß gewachsenes, robustes Mädchen von etwa zwanzig Jahren mit schwarzen Haaren und weißer Haut. Sie hatte einen gesunden Teint, war reinlich und so fein gekleidet, wie es ihr Stand nur erlaubte. Dabei war sie durchaus temperamentvoll und zeigte bisweilen offen, wie herzlich langweilig ihr das Klosterleben war.
Felicia, so hieß sie, war im Grunde ein guter Mensch und mochte mich sehr, doch ich fürchtete mich ein wenig vor ihrem aufbrausenden Gemüt, das sie infolge des faden Aufenthalts entwickelt hatte.
Eines Nachts hatte dieses feurige Wesen einen so heftigen Traum, dass ich davon erwachte. Mit auseinandergespreizten Beinen lag sie auf dem Rücken und zuckte mit ihren Lenden vor und zurück, vor und zurück, immer schneller, bis sie auf dem Gipfel der Leidenschaft ausrief: »Ja, stoß nur zu, mein geliebter Jonas! Spritz tief hinein, ja, zugleich mit mir, fertig, ja! Ah! Ah!« Jonas, so hieß ein Jäger meines Vaters.
Danach verfiel sie für kurze Zeit in eine vollkommene Starre. Dann schluchzte sie: »Was haben wir getan? Diesmal hast du mir bestimmt ein Kind gemacht, mein lieber Jonas, ich fühle deinen Liebessaft bis an mein Herz!«
Natürlich konnte ich mich über das Gehörte nur freuen, gab es mir doch bislang ungeahnte Macht über meine Wächterin in die Hand. Sie hatte sich so wild erregt, dass sie am ganzen Körper schwitzte und die Decke von sich gestrampelt hatte. Als ich sie zudeckte, erwachte sie.
»Sprichst du oft laut im Schlaf, Felicia?«, fragte ich.
»Wieso, Fräulein?«
»Weil du das ganze Bett verwüstet hast, während du dir eben im Traum von deinem geliebten Jonas ein Kind hast andrehen lassen!«
»Sie Grünschnabel, was erdreisten Sie sich, so zu sprechen?«
»Nun, so hör ruhig weiter!«
Sofort warf ich mich auf den Rücken, spreizte meine Beine und wiederholte die stoßenden Bewegungen, die ich soeben verfolgt hatte, vom Anfang bis zum Schluss. »Spritz tief hinein, zugleich mit mir, fertig, ja!«
Sie wollte mir den Mund zuhalten, doch erbarmungslos erließ ich ihr auch nicht den Rest ihres Monologs. »Was haben wir getan? Diesmal hast du mir bestimmt ein Kind gemacht, ich spüre deinen ...« Diesmal presste sie mir die Hand so hart auf den Mund, dass ich nicht weitersprechen konnte.
Ein Blitzschlag hätte die Arme nicht stärker treffen können. »Ich Unglückliche!«, schluchzte sie in ihr Kissen. »Habe ich das wirklich alles laut gesagt?«
»Jedes Wort! Fast hätte dich meine Mutter im Nebenzimmer hören können.«
»Dann hat mich wirklich das Unglück getroffen!«
Ich jedoch nahm sie, deren Körper nun ganz starr geworden war, in den Arm. »Wisse, dass ich es nicht böse meine mit dir. Was widerfährt einem oft im Traum!«
»Wenn Sie ein gutes Herz haben, dann werden Sie schweigen.«
»Ja, das schwöre ich dir, Felicia.«
»Das sind Sie mir auch schuldig, denn auch ich habe ihrer Mutter verschwiegen, dass ich in Ihrer Schublade zwei überaus ungehörige Bücher gefunden habe. Ich hätte Sie gescholten, wenn ich gedacht hätte, Sie verstünden ein Wort von dem, was darin steht!«
»Nun, so dumm bin ich allerdings nicht!«, entgegnete ich stolz. »Glaubst du, ich weiß nicht, dass du nur dann so einen heftigen Traum gehabt haben kannst, wenn du dergleichen nicht schon oft und oft in Fleisch und Blut getan hättest? Gestehe!«
Plötzlich ertönte die Betglocke des Klosters.
»Lass uns beten!«, sagte Felicia.
»Zum Teufel mit der Beterei! Lass uns lieber von Jonas reden, dessen Liebessaft bis in dein Herz dringt!«
»Gott im Himmel, es gibt keine Kinder mehr! Wie kann man mit sechzehn Jahren schon so viel wissen?«
Während unseres Gesprächs hatte ich ständig ihren derben Körper befühlt. Sie hatte sich nicht gewehrt, solange ich mich auf ihre Arme, ihre Hüften und sogar ihre üppigen Brüste beschränkte. Als sich meine Hand jedoch nun zu ihrem pelzbesetzten Liebeshügel vortastete, zuckten wir beide plötzlich zurück, Felicia vielleicht aus vorgeblicher Schamhaftigkeit und ich aus Schrecken über meinen Mut und aus Unerfahrenheit.
Der Schreck währte jedoch nur einen Augenblick. Ich stahl mich gleich wieder heran und meine neue Gespielin sah wohl ein, dass es keinen Sinn hatte, sich länger zu zieren. Ich betastete sie also eingehend und zeigte dabei offensichtlich eine instinktive Begabung, denn sie entspannte sich und gestattete meinem Finger eine ausführliche Entdeckungsreise in die von ihrem Traum noch immer herrlich schlüpfrige Liebesgrotte. Sie umschloss ihn fest, wenn er sich zurückziehen wollte und dirigierte ihn bald nach ihrem Wohlgefallen, sodass sie nach gar keiner langen Weile wieder voll in Flammen stand und schließlich unter zappelnden Bewegungen – etwas zurückhaltender als vorher und völlig lautlos diesmal – den Gipfel der höchsten Verzückung erreichte.
4
Nun wollte mir Felicia beweisen, dass auch sie die Tugend der Erkenntlichkeit beherrschte. Als sie sich erholt hatte, umschlang sie mich mit ihren Beinen, küsste mich überall und nannte mich ihren Engel. Sie befühlte meine jugendlichen Reize mit der Leidenschaft eines feurigen Liebhabers und rieb ihren dunklen Venushügel so fest an meinem, dass es mich fast schmerzte.
Schließlich bog sie überraschend schnell meine Beine auseinander und senkte ihre Lippen meinem bebenden rosa Spältchen entgegen. Sicherlich waren mir bei meiner Lektüre bereits ähnliche Dinge untergekommen, doch aus Unerfahrenheit und mangelnder Vorstellungskraft war meine Aufmerksamkeit darüber hinweggeglitten, da ich wenig Anziehendes daran finden konnte.
Wie rasch wurde ich jedoch bekehrt, nachdem die herrlich aktive Zunge der Zofe die obersten Winkel meiner jungfräulichen Liebeslippen zärtlich erkundet hatte! Ich versank so tief in diesem Vergnügen, dass ich keinen Gedanken dafür übrig hatte, wie sehr Felicia diese Tätigkeit gefallen könnte, doch sehr wohl bemerkte ich den heißen Atem, den sie mir mit Wohlgefallen gegen die Scham blies, um in mir unbeschreibliche Empfindungen auszulösen. – Oh edles Spiel des weiblichen Geschlechts, wie kommt es, dass du nicht überall auf der Welt in Heiligtümern gefeiert wirst?
Felicia beglückte mich so lange, bis ich es nicht mehr aushalten konnte. Es wurde eine glückliche, unvergessliche Nacht! Ein einziger Moment war mehr wert als jeder philosophische Diskurs über das Glück, das die Moralisten so sehr loben. Du holder Magnetismus der Gelüste, du allgemeines und doch stets neues Wunder, das die Sittenwächter so ungebührlich herabwürdigen, wenn sie dich als unanständig abstempeln!
Unsere Vergnügungen endeten jedenfalls mit dem Schwur, über alles zu schweigen, und wir versprachen uns unveränderliche Freundschaft. Von da an war Felicia für mich keine Kammerzofe mehr, sondern eine Freundin.
Als meine Mutter uns gegen neun Uhr weckte, war sie zum Glück nicht neugierig genug, um den Bettvorhang aufzuziehen. Sie hätte uns mit verschränkten Armen und Beinen vorgefunden und an unserer Lage unser schändliches Treiben sofort erkannt.
Mein Gott! Wie unerträglich werden gewisse alltägliche Kleinigkeiten und Handlungen, wenn man erst einmal von den verbotenen Früchten gekostet hat! Die Andacht, die tägliche Messe, die Beichte am Samstag, die Kommunion, die Stunden mit den Erbauungsbüchern meiner Mutter – all das wurde mir schnell zuwider.
Wenn ich nicht mit meiner lieben Freundin allein war, brannte an jener gewissen Stelle ein Feuer, und auch mit ihr war mein Glück nicht ungetrübt, weil sie sich der Erfüllung meiner Begierden häufig widersetzte. Sie war der Meinung, ich würde durch die täglichen, ja manchmal stündlichen Liebesspiele den Stachel der Wollust abstumpfen und jenen kostbaren Lebenssaft verschwenden, der für mein gutes Gedeihen unerlässlich wäre. Sie ließ mich also aus Sorge und Freundschaft darben.
***
So gingen zwei Monate dahin, in denen ich die meiste Zeit den aktiven Part übernehmen musste, denn ich war der Ansicht, dass ihr reifer, ach so robuster Leib durch unsere zahlreich wiederholten Liebesspiele keinen Schaden nehmen konnte. So tat ich ihr also Gutes, wie ich es nur vermochte, und war im siebten Himmel, wenn sie sich einmal dazu herabließ, es mir gleichzutun.
So wurde sie zur einzigen Spenderin meines Glücks, ein anderes wollte ich nicht kennen, und zugleich zu meiner Feindin, meinem Dämon, der mir meine Erfüllung vorenthielt. Bald betete ich sie an, bald verfluchte ich sie. Wenn ich ihr vorhielt, sie würde mich nicht lieben, lachte sie nur und brachte mich zur Verzweiflung, denn in ihrer Wachsamkeit beraubte sie mich auch all jener Gelegenheiten, bei denen ich mir selbst Genuss verschaffen hätte können.
»Du bringst mich noch um!«, warf ich ihr bei Zeiten vor, nur um gleich wieder um ihre Vergebung zu flehen sowie um die Erlaubnis, ihr die niedersten Dienste tun zu dürfen. So kam ich wenigstens alle zehn Mal einmal an die Reihe.
Als wir bereits die besten Freundinnen waren, setzte ich ihr zu, sie solle mir ihre Geschichte erzählen, die, wie sie bereits angedeutet hatte, recht merkwürdig wäre. Nach langem Zögern willigte sie endlich ein, und so gebe ich die Begebenheiten nun in den folgenden Kapiteln wieder.
5
Mein Vater hatte sich als Schornsteinfeger und Lastträger sein Geld verdient, meine Mutter mit Küchenarbeiten. Nachdem sie in Paris geheiratet und sich ein wenig erspart hatten, zogen sie aufs Land und lebten in einer Hütte, zu der ein kleines Stück Ackerland, ein Gärtchen und etwas Vieh gehörten – für einfache Leute ein hinreichendes Vermögen. Bald kam mein Bruder zur Welt, fünf Jahre danach ich. Mehr trugen sie zur Bevölkerung Savoyens nicht bei.
Als ich gerade acht Jahre alt war, wurden meine Eltern von einer Epidemie, der die halbe Gegend zum Opfer fiel, dahingerafft. Wir gelangten unter die Vormundschaft eines Oheims.
Aus einer merkwürdigen Laune heraus hatte mich meine Mutter als Knaben erzogen. Vielleicht befürchtete sie, ich würde, wenn ich mein eigentliches Geschlecht kannte, seine Früchte überreichlich genießen wollen, wie sie es sich selbst vermutlich vorzuwerfen hatte. Alle Menschen, einschließlich meines Oheims, hielten mich für einen Jungen.
Mit zwölf Jahren sollte ich mich einer Gruppe von Jugendlichen anschließen, die, wie es dort üblich war, aus ihrem Vaterland auswanderte. So kam ich nach Paris. Dort war ich drei Jahre lang als Schornsteinfeger, Schuhputzer, Taglöhner bei einem Schmied oder einer gnädigen Frau, die sich ein möbliertes Zimmer gemietet hatte, und vielen anderen tätig und diente bald in privaten Häusern, bald in Gasthöfen.
Meine Schlafstelle hatte ich unter dem Dach eines Hauses mit sieben Stockwerken, wo acht von uns untergebracht waren, und zwar jeweils zu zweit in gar scheußlichen Betten. Ich schlief also Seite an Seite mit einem männlichen Geschöpf, doch wir werden so einfach und schamhaft erzogen und unser Ansinnen so bald auf die beschwerliche Arbeit und einen kleinen Verdienst gelenkt, dass es uns Savoyarden nicht einfällt, des Nachts gelüstig aktiv zu werden. Jedenfalls passierte es mir in vier Jahren kein einziges Mal, dass einer meiner doch recht häufig wechselnden Schlafkameraden daran interessiert gewesen wäre, seine und meine Beschaffenheit zu vergleichen.
Jeden Morgen und jeden Abend kleideten wir uns mit Anstand und Schamhaftigkeit an, auch ich, obwohl ich mich später einmal über alle Regeln des Anstands hinwegsetzen würde, wenn die harte Schale, die meine triebhafte Wollust noch umschloss, dereinst aufbrechen würde.
Jeden Tag musste ich um neun Uhr zu einem überaus hübschen Freudenmädchen gehen, das ich fast immer im Bett und fast nie allein dort vorfand, doch auch verschloss ich schamhaft Augen und Ohren.
Eines Tages, als ich aus dem Kabinett, wo ich immer mein Geschäft verrichtete, in das Schlafzimmer kam, war es mir allerdings nicht mehr möglich, die Augen abzuwenden. Die frivole Kokotte stand völlig nackt neben dem Bett, wo sie von einem kurz geschorenen Burschen hergenommen wurde, der vermutlich nach mir gekommen war, da der Schlüssel noch im Schloss steckte. Ich wollte so tun, als ob nichts wäre, schlug aber ein Kreuzzeichen. Das reizte die zwei Liebesspielenden so sehr zum Lachen, dass sie auseinander fielen. Der Abbé wandte sich dabei mir auf eine Weise zu, dass sich seine von dem unterbrochenen Akt gerötete Liebeslanze meinem Blick darbot.
In diesem Moment fiel auch der Schleier, der bislang über meinem eigenen Wesen gelegen und meinen Irrtum verborgen hatte, von mir ab. Angesichts der gewaltigen Erkenntnis geriet ich ins Taumeln.
›Gib Acht, Felix‹, prustete das käufliche Fräulein, ›dass du mir nicht hinfällst. Hat dir diese prächtige Rute so einen Schrecken eingejagt?‹
Über solche und ähnliche Scherze amüsierten sich die beiden Unzüchtigen auf meine Kosten. Ich geriet in Panik und wusste weder ein noch aus, geschweige denn, was ich sagen sollte.
›Troll dich, du Einfaltspinsel!‹, rief der Abbé mir verächtlich zu. Und zu seiner Gespielin gewandt: ›Lassen Sie uns doch unsere Unterhaltung ohne den Esel fortsetzen, Madame!‹
Jedes Wort war wie ein Schlag mit der Peitsche für mich.
›Aber nein‹, entgegnete die Demoiselle. ›Nichts ist aufregender für mich, als mich vor einem Zeugen besteigen zu lassen. Außerdem soll er gerne etwas lernen: Ich will, dass er alles ganz genau sehen kann! Komm her jetzt, Felix!‹
Ein anderer hätte jetzt vermutlich auf dem Absatz kehrtgemacht und das Zimmer verlassen, doch ich – fasziniert und vielleicht schon unter dem Einfluss heimlicher Instinkte – gehorchte. Schritt um Schritt näherte ich mich mit glühenden Wangen zögernd dem Fräulein.
Sie reichte mir die Hand, umschlang mich um die Hüften und rief ihrem Kavalier zu: ›Komm jetzt und stich deinen Degen in meine Scheide, Abbé!‹
Gleichzeitig hob sie ihren Schoß, spreizte ihre Schenkel und lockte den gefährlichen Dolch, der auch gleich gnadenlos in sie eindrang. Kalte Schauer rieselten bei diesem Anblick über meinen Rücken und ich fürchtete, der lange Schaft würde das arme Mädchen ganz zerreißen, so wild und dick war er. Aber nein, sie verschlang ihn ganz und gar und in ihrem Gesicht spiegelte sich dabei nichts als Wonne. Sie warf sich herum, keuchte, biss, fluchte und hielt mich doch in all ihrer Ekstase fest umfasst und ließ mich nicht los.
Doch plötzlich, auf dem Höhepunkt des Genusses, riss sie sich geistesgegenwärtig los, sodass der Degen aus der Scheide rutschte, und erstaunt sah ich zu, wie der zuckende Speer eine weiße, dickliche Flüssigkeit verspritzte, weit, bis in das Gesicht der Demoiselle. Sie aber lachte nur darüber und schalt den Abbé allerdings wegen etwas anderem.
›Was treibst du mit mir, Lieber? Das war wirklich im letzten Augenblick! Es hätte nicht viel gefehlt und du hättest mir ein Kind angedreht, wenn du mir die ganze Ladung einverleibt hättest. Kannst du Lump denn überhaupt eines ernähren?‹
So lernte ich also innerhalb weniger Minuten, dass ich ein Weibsbild war; dass ein Mann so etwas besaß, wie ich soeben gesehen hatte; dass Frauenspersonen diesen Besitz in etwas aufnahmen, wie ich selbst es hatte und auch noch Vergnügen dabei empfanden; dass auf diese Weise Kinder gezeugt werden, wenn die Weibsperson es zulässt, dass sich der Liebessaft in ihrem Inneren ergießt; dass sie ihre Mutterschaft verhindern kann, wenn sie dergleichen vermeidet. So viele Lektionen in einem kurzen Moment!
Der Abbé ließ sich seine Laune nicht verderben und sich stattdessen von seiner Gespielin waschen und abtrocknen. Darüber hinaus lieh er sich auch noch einen Franc von ihr, den sie ihm gerne gab. Gleich darauf ging er davon, während sich die Demoiselle über ein Becken beugte, um sich ebenfalls zu reinigen, wobei sie darauf Bedacht nahm, all ihre Reize vor meinen Augen zu entfalten.
6
Kaum war das derbe Liebesgeplänkel beendet, geriet ich gleich neuerlich in Gefahr durch etwas, was mich mindestens ebenso verlegen machte.
Kaum war das Trillern des Abbé verklungen, lief das lüsterne Weibsbild zur Tür, schloss sie zweimal ab und legte den Schlüssel unter die Matratze. Dann stürzte sie sich, nackt wie sie war, auf mich, drückte sich an mich und überschüttete mich mit Küssen, während sie mir allerlei Zeug sagte.
›Du bist doch nicht böse über das, was du gesehen hast, mein lieber Junge, oder? So etwas wirst du doch schon öfter gesehen haben, da ist doch nichts Böses dabei! Die Jugend ist eben die Zeit der Liebe!‹
Dabei schaute sie mich unverwandt an. ›Spürst du denn noch nichts, Junge? In deinem Alter muss der Liebesstab doch gleich steif werden!‹
Unverschämt griff sie nach unten, um sich Klarheit über meinen Zustand zu verschaffen. Ich wich ihr nach Kräften aus, doch sie setzte mir nur umso lebhafter nach. ›Nun sag schon, Felix, hat dich das nicht angeregt, was du soeben erblickt hast? Soll ich dir nicht zur Belohnung dasselbe gestatten, was der Abbé tun durfte?‹
›Bitte lassen Sie mich, Madame!‹, flehte ich.
›Du brauchst dich nicht zu zieren, Felix, ich bin dir schon lange wohl gesonnen und wollte es dir schon lange anbieten. Stößt du mich weg?‹
›Um Gottes willen, lassen Sie mich bitte!‹
›Was, bin ich dir denn vielleicht nicht appetitlich genug?‹, fuhr sie mich an, wobei sie ihre Handgreiflichkeiten ständig fortsetzte. ›Sieh mich doch an! Küss mich!‹
Oh wie gern! Wenn ich doch gehabt hätte, was mir fehlte! So sehr sie mir glich, so verführerisch schien sie mir doch, und ich küsste sie.
›Da, fass meine Brüste an! Gib mir deine Hand – ich wette, du hast noch nie eine Spalte gefühlt. Eine hübschere wirst du so schnell nicht finden!‹
Sie stieg auf einen Stuhl und hielt mir ihre Scham dicht vor das Gesicht. ›Da, schau hin! Fass zu! Ist sie nicht niedlich und frisch? Jetzt bin aber ich dran!‹
Sie sprang vom Stuhl und umfasste mich so fest, dass ich kaum auskam. Vor Scham begann ich, mich zu wehren.
›Was, du willst nicht?‹
›Madame, ich kann nicht!‹
›Zeig ihn mir endlich!‹
›Ich beiße, ich schlage und schreie!‹
›Du Lump! Ich will auf der Stelle deinen Liebespfeil sehen!‹
Ich schlug die Beine kreuzweise übereinander und versuchte mich ihr zu entwinden und sie so müde zu machen, dass sie endlich von mir ablassen würde. Doch vergebens!
›Du frecher Hosenteufel! So ein Eigensinn! Ich will jetzt deinen Adamsstab sehen und du sollst ihn mir hineinstecken!‹
Dabei riss sie so heftig an meinem Hosengurt, dass er aufplatzte. und meiner Widersacherin den Weg freigab. Man stelle sich ihre Überraschung vor!
›Teufel auch! Und wozu war jetzt die ganze Mühe gut?‹ Als sie sich von ihrem Schreck erholt hatte, ging sie ruhig zu ihrem Bett zurück.
Ich brachte meine Kleider in Ordnung und wandte mich zur Tür, doch der Schlüssel steckte ja noch unter der Matratze.
Mittlerweile wurde die Demoiselle von der Neugier gepackt und sie wollte wissen, wie es kam, dass ich als Mädchen in Männerkleidern steckte. Völlig offen erzählte ich ihr die Wahrheit und dass ich bis eben nicht gewusst hatte, was ich selbst überhaupt war.
›Sechzehn Lenze! Schön wie ein Engel und weiß nicht, was sie ist!‹, rief sie aus. ›Auf keinen Fall kannst du noch länger mit dem Savoyardenpack zusammen schlafen. Bleibe hier bei mir und ich werde dir helfen, dein Glück zu machen! Es liegt nur an dir.‹
Sie sagte die angenehmsten Dinge zu mir und versuchte, mich mit schmeichelhaften Vorschlägen zu verlocken. Ich aber war noch von dem unverschämten Auftritt mit dem Abbé geschockt und schloss daraus, dass mir wohl, wenn ich hier bliebe, über kurz oder lang dasselbe Schicksal wie der Mamsell zuteil werden würde.
Listig ging ich jedoch auf ihren Vorschlag ein und gab ihr mein Wort mit dem festen Vorsatz, es nicht zu halten. Ich wollte nur hinaus hier und benutzte den Vorwand, meine Habseligkeiten holen zu wollen. In spätestens zwei Stunden, so sagte ich ihr, wollte ich wieder bei ihr sein.
Sie ließ mich gehen.
Wie froh ich war! Ich besuchte all meine Kunden und sammelte, wo man mich zu bezahlen imstande war, meinen geringen Lohn ein. Ich hatte allen Ernstes vor, Paris noch am selben Tag zu verlassen. Ich wollte an einen Ort, wo nicht gleich das erstbeste Freudenmädchen das Geheimnis meines Geschlechts aufdecken konnte.
Oh wie klug wäre es gewesen, wenn ich dies züchtige Vorhaben doch gleich in die Tat umgesetzt hätte! Doch dies war genau jene Nacht, in der dieser liederliche Teufel in mir zum Durchbruch gelangen sollte, der in Zukunft mein Leben so unbarmherzig beherrschen sollte.
7
Jener Kamerad, mit dem ich meine Bettstatt teilte, war ein dunkler, etwa achtzehnjähriger Geselle, der mir und dem Rest der Zimmergesellschaft mit seinem Schnarchen oft den Schlaf raubte. Auch in dieser Nacht konnte ich lange nicht einschlafen, denn mein Bettgefährte schnarchte nach Leibeskräften. Noch dazu war mir noch immer heiß und mein Inneres in Aufruhr.
Da kam mir die Idee, dass ich doch nachsehen konnte, ob Franz, so war sein Name, ebenfalls so einen Liebesstab wie der Abbé sein Eigen nannte. Also machte sich meine Hand auf die Reise und entdeckte etwas, das zwar verschieden von mir war, doch zugleich so weich und leblos, dass es auch mit dem Schaft des Abbé nicht viel gemeinsam hatte.
Doch unter meinen vorwitzig forschenden Fingern begann sich inzwischen etwas zu regen und lebendig zu werden, was mir außerordentlich große Freude bereitete. Ohne Rücksicht vertiefte ich mich darin, dies Wachstum zu fördern, das auch nach und nach zu höchster Größe erstand. Trotzdem, so stellte ich fest, bestand noch immer ein gewaltiger Unterschied zwischen der Ausdehnung dieser kleinen Liebesfackel und dem mächtigen Schaft, der mir am Vormittag zu Gesicht gekommen und so vollständig von der Grotte der Demoiselle aufgenommen worden war.
Doch die Lawine der Wollust war bereits ins Rollen geraten und daher war alles, was mir zu diesen Größenverhältnissen einfiel, der simple Gedanke: Welch glückliche Fügung, dass der gute Franz so einen bescheidenen Liebesstängel hat, da passt er viel besser für meine Beschaffenheit als die Herkuleskeule des Abbés. Für meine Demoiselle mag Ersterer wohl nicht gelangt haben, wenn ich nach dem Instrument des heutigen Vormittags ging, das mich sicherlich zerrissen hätte. Doch mit Franzens kleinem Schaft hätte ich allzu gerne Bekanntschaft geschlossen, selbst wenn er es merken würde! Er würde wohl nicht so dumm sein, mir mein Ansinnen übel zu nehmen! Frohgemut wollte ich es versuchen.
Er lag mit seinem Gesicht zu mir gedreht und schnarchte wieder einmal herzzerreißend, mir direkt unter die Nase. Doch wegen der Hitze in mir war ich vollends gewillt, ihm auch nicht seinen Knoblauchatem übel zu nehmen. Stattdessen schmiegte ich mich so dicht wie möglich an ihn, berührte ihn von Kopf bis Fuß und drückte meine Lenden gegen sein Gemächt und rieb meine kleine Muschel, so gut es ging, an seinem Austernmesser.
Welch neue Wonnen durchströmten mich, welch Feuer brannte in meinen Adern und durchfuhr meine Glieder! Allein schon diese zarte Berührung der samtenen Weichsel an meinen sensibelsten Teilen versprach mir höchste Glückseligkeit und löste in mir den Drang aus, sie ganz in mir aufzunehmen.
Wenn ich es nicht bereits gewusst hätte, dass mein Löchlein dafür geschaffen war, von diesem Pfahl durchbohrt zu werden, so wäre es mir durch die Natur und unsere Lage in diesem Moment klar geworden, dass unser Spielzeug füreinander gemacht war.
In meiner aktuellen Pose war es mir jedoch nicht möglich, meiner Spalte den ersehnten Docht einzuverleiben, der ja noch dazu kein Ausbund an Länge war. Also wandte ich ihm meine Kehrseite zu und reckte mein Hinterteil gegen seinen Stab. Ich öffnete meine Schenkel, um endlich unsere Vereinigung zu beginnen – doch da war mein Glück auch schon wieder zu Ende.
Franz, dieser zu meinem Unglück allzu keusche Tölpel, wachte auf. Er war älter und viel erfahrener als ich, daher erkannte er die Situation sofort als schändliches Vergehen: Sein Adamsstab befand sich unter meinen Händen in aufgerichtetem Zustand schon auf halbem Wege in die Sünde. Er schloss daraus, dass ihm hier eine Abscheulichkeit zugemutet würde, und begann sofort unter lautem Geschrei und Fausthieben, sich zornig und schamhaft zur Wehr zu setzen, da er ja noch dazu glaubte, neben einem Kameraden zu liegen.
Halb benommen vor Schmerzen und Furcht sprang ich aus dem Bett. Sogleich waren auch alle anderen auf den Beinen und riefen wild durcheinander, während sie nach dem Feuerzeug suchten.
›Schlagt den Hund tot!‹, rief einer. ›Nein, wir übergeben ihn der Justiz und lassen ihn verhaften!‹, meinte ein anderer. ›Hängen soll er!‹, schrie der Dritte, während ein Vierter meinte: ›Auf den Scheiterhaufen mit ihm!‹, und damit bewies, dass er als Ältester über den Strafenkatalog für sündige Vergehen am besten Bescheid wusste.
Nun endlich verbreitete die ärmliche Lampe ihr flackerndes Licht und gab mein Geheimnis preis. Als ich mich gegen die Handgreiflichkeiten und Schläge zur Wehr setzte, kam unleugbar und vor aller Augen das zum Vorschein, was mich ganz eindeutig zum Mädchen stempelte.
Die Jungen verstummten und sahen einander an. ›Ein Mädchen! Das ist etwas ganz anderes!‹, sagten sie und ließen mich los. Doch der Älteste warf sich in die Brust und meinte: ›Christlicher wird es dadurch auch nicht! Doch in diesem Fall ist noch auf Barmherzigkeit zu hoffen!‹
Damit legten sich alle wieder zu Bett. Doch sie vergnügten sich damit, mir weiterhin Schimpfworte zuzurufen, während sich der verwünschte Franz in eine Ecke zurückgezogen hatte und an seinen Nägeln kaute. Ich jedoch würdigte sie keines Blickes, sondern packte meine Siebensachen zusammen, kleidete mich an und verließ die Unterkunft unter allerlei grobem Spott dieser Kerle, die keine Ahnung vom Wert des Vergnügens hatten.
8
Da ich nun fürs Erste die sieben Bauernlümmel los war, meinte ich mich nun glücklich schätzen zu können. Leider war es mitten in der Nacht und ein leichter Nieselregen ging hernieder – ich brauchte also ein Dach über dem Kopf, denn das hatte ich nun nicht mehr. Doch wohin sollte ich mich wenden? Ich konnte doch die Nacht nicht auf der Straße zubringen!
Ich hätte also vielleicht doch an diesem Morgen zu meiner liederlichen Demoiselle zurückkehren sollen. Ich konnte es auch jetzt noch versuchen, denn bei einer wie ihr fand man wohl zu jeder Stunde Einlass, selbst wenn sie nicht allein war, wie ich ja bereits erlebt hatte. Doch ach, sie würde mich sicherlich wieder dazu zwingen wollen, ihr bei irgendeiner Schandtat zuzusehen!
Ganz in meinen Gedanken versunken stieß ich so heftig mit einem Passanten zusammen, dass wir beide fast zu Fall gekommen wären. In all seinem Gezeter erkannte ich einen Kunden von mir, den Schauspieler A., einen lustigen Verse- und Spaßmacher, der, obwohl er keinen Sou besaß, von morgens bis abends guter Dinge war, sang und lachte.
Obwohl er mich genauso wenig bezahlte wie seinen Vermieter, den Schuster, die Wäscherin oder seinen Koch, bediente ich ihn dennoch gern und lieber als so manch anderen. Alle gaben dem drolligen Gesellen gern Kredit, weil er sie, wenn er ihnen auch kein Geld gab, so doch bereitwillig mit seinen Possen unterhielt. Ein Spaß zeitigte bei den Gläubigern durchaus Wirkung.
Monsieur A. behandelte mich stets fast ebenbürtig. Wenn die Arbeit getan war, so spielte er gern noch eine Weile mit mir. Als er nun aus meinen Entschuldigungen heraushörte, dass ich es war, sprach er mich sogleich freundlich an. ›Oh, Felix, bist du das? Was treibst du denn hier so mutterseelenallein mitten in der Nacht? Wartest du auf jemanden?‹
›Nein, Monsieur.‹
›Aber ich sehe, du hast dein Bündel gepackt. Da stimmt doch etwas nicht? Los, heraus mit der Sprache!‹
Sogleich dachte ich mir eine Lüge aus und erzählte ihm in weinerlichem Ton, um den ich mich gar nicht erst bemühen musste, dass ich auf dem Weg in meine Unterkunft gewesen war, für die ich einige Monate Miete schuldig wäre, als meine Kameraden, die gehört hatten, dass der Vermieter mir Schande antun wollte, mir mein Bündel gebracht und mich überredet hätten, in einen anderen Stadtteil zu fliehen.
›Ach was, dieses Viertel sollst du nicht verlassen‹, meinte der Schauspieler entgegenkommend. ›Was ist denn schon dabei, bei ein paar Monaten Miete! Komm, mein lieber Junge, wisch dir die Tränen ab und dann komm mit mir!‹
Zuerst wollte ich mich noch weigern, doch er setzte mir nachdringlich zu. ›Komm doch, Junge. Du brauchst für heute erst mal ein Dach über dem Kopf. Morgen werde ich all deine Angelegenheiten schon regeln, keine Sorge! Ich habe zwar nur ein Bett, wie du weißt, doch eine Nacht ist darin schnell um!‹
Ich folgte ihm also zu seinem Haus, das wir ohne Licht betraten. Noch immer im Dunkeln stiegen wir in den fünften Stock hinauf, wo wir uns ohne lange Rede sogleich ins Bett legten.