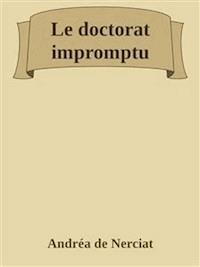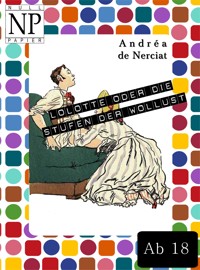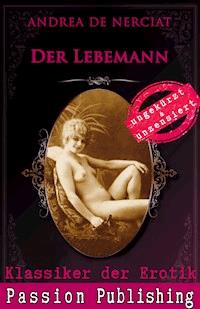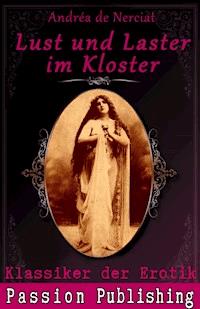
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassiker der Erotik
- Sprache: Deutsch
Frankreich im 18 Jahrhundert: Lolotte ist sechzehn und verzehrt sich im Kloster danach, endlich ihre Unschuld zu verlieren. Was ihr dank der kessen Kammerzofe Felicia und den "Liebesrittern", die des Nachts so manche Nonne beglücken, auch bald gelingen soll. Schon bald wird die durchtriebene Schülerin der Lust mithilfe zahlreicher Lehrer zur wahren Meisterin der Liebeskunst. Keine Stellung, kein Geschlecht, keine Verführung, die Lolotte nicht lustvoll erprobt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andréa de Nerciat
Lust und Laster im Kloster
Klassiker der Erotik
Passion Publishing
Impressum Hrsg.
Passion Publishing Ltd.
1
Ich will versuchen, die Erlebnisse zu beschreiben, die ich in meinem ledigen Stand gehabt habe, das heißt, vom ersten Tag meines Eintritts in die süße Laufbahn der Ausschweifungen bis zu dem Augenblick meiner Verheiratung. Ein Zeitraum von ungefähr drei Monaten.
Daraus wird man schon sehen, welch ein Leben ich geführt habe, als ich mit Erfahrungen in den Stand der völligen, größeren Freiheit kam; denn ich war nur kurze Zeit verheiratet und lebte in meinem Ehestande nicht im mindesten eingeschränkt.
Wollte ich alles Übrige ebenso ausführlich beschreiben, wie ich es für den kurzen Zeitraum verspreche, den ich hier schildern will, so müsste ich zehn dicke Bände schreiben. Auch verpflichte ich mich nicht, die Fortsetzung zu liefern; denn am Ende würden immer nur die gleichen Schilderungen vorkommen, und für einen unbefangenen Dritten lässt sich nichts Einförmigeres denken als das Leben eines Frauenzimmers von meinem Schlag, das nur für Vergnügen und Launen Sinn hat und den Leser nur mit etlichen Auftritten unterhalten kann, die sich kaum voneinander unterscheiden.
Überdies bin ich nicht mehr eine so fleißige Schreiberin wie sonst. In den ersten Monaten meines Freudengenusses wachte ich mit eifersüchtigem Geiz über den kleinen Vorrat meiner Erfahrungen und führte ein genaues Tagebuch über die allerkleinsten Umstände. Seitdem habe ich es süßer gefunden, meine Genüsse zu vermehren als ein Register darüber zu führen.
Sollte jemals ein junges Mädchen dieses Buch lesen, so mag es sich hüten, meinem Beispiel zu folgen. Keine würde meine Lebensart auf die Dauer aushalten.
Wenn ich meine Erlebnisse erzähle, so will ich dadurch weder eine Reue heucheln, die ich durch Stillschweigen und zurückgezogenes Leben viel besser beweisen könnte, noch die Schuld davon auf den Einfluss meines Gestirns schieben, oder zu beweisen suchen, dass ich unwillkürlich fortgerissen wurde. Nein, ich will offenherziger mit meinen Lesern umgehen und gestehen, dass ich alles, was geschehen ist, aus Wahl und Geschmack getan habe; dass ich noch jetzt alles tue, was ich vorher tat, nur dass ich mein Vermögen nicht gefährde und mehr Achtung vor dem guten Ruf habe, und endlich dass ich es noch immer mit Vergnügen tun werde, solange ich es nur immer kann. Aber ich wiederhole es, man lasse sich nicht gelüsten, meinem Beispiel zu folgen!
Nur noch einen kleinen Hinweis: Der Hang zu den Freuden der Liebe erstirbt meist mit dem Vermögen, sie genießen zu können. Dann kommt man wieder in das gewöhnliche Geleis. Hat man sich aber so weggeworfen, dass man mit Verachtung bestraft wird, so ist keine Rettung mehr möglich.
Durch ein wahres Wunder sah ich mitten im Rausch meiner glücklichen Schwelgereien ein, wie wichtig es sei, sich vor öffentlichen Beschimpfungen zu hüten. Von der Stunde an wurde ich eine Heuchlerin.
Schön, sagt hier irgendein strenger Leser, Madame gesteht, dass sie eine ganz entschiedene Anhängerin der Liebe ist, und um ihrer Lobrede die Krone aufzusetzen, hat sie das Herz hinzuzufügen, dass sie auch Heuchelei übt. Das heißt wahrlich, die Leser zwingen, viel Gutes von ihr zu denken!
Aber ich habe diese Geschichte meiner unzähligen Torheiten nicht für Sittenrichter geschrieben – andere Leser werden wahrscheinlich Vergnügen daran finden. Und nur diesen widme ich meine lustigen Streiche.
Wisst, dass ich alles getan oder wenigstens zu tun gestrebt habe, was ein überschäumendes Temperament eingeben und eine bis zur höchsten Vollkommenheit gebrachte Praxis abwechselnder Liebeskämpfe uns lehren kann. Wer bist du, der du eben jetzt deine Augen an meinen kühnen Schilderungen weidest? Bist du etwa eine von den noch mehr Ausgelernten? Kannst du mich vielleicht etwas lehren, was mir noch unbekannt geblieben ist? Dann komm, komm – aber ganz in der Stille!
Wisse, dass ich kaum vierundzwanzig Jahre alt, groß und schlank bin, ohne mager zu sein, weiß, ohne kränklich, blond, ohne fade auszusehen. Schon ließen sich manche feine Kenner durch meine Blondheit verleiten, mich für lau zu halten. Komm und empfinde die verliebten Bisse meiner perlengleichen Zähne! Komm und schmecke meine feurigen Küsse! Komm und lass dich in meine liebkosenden Arme drücken! Komm und urteile selbst, ob der Umriss meiner Hüften markig, mein Venusberg erhaben, meine Muschel eng und feurig und mein nicht minder tätiges Hinterteil fleischig, derb und weich ist. Seiest du Prinz oder Edelmann, Bürger, Mönch oder Lakai, komm, wenn die Natur dich mit der Lanze eines Herkules beschenkt hat, und wenn dein kraus zusammengezogener Haarbeutel jenen köstlichen Saft verschwenderisch spenden kann, für den unsere dumme, an unnützen Worten so armselig reiche Sprache bis jetzt noch keine erträglich anständige Benennung hat.
Auch dann kannst du kommen, wenn du, in Ermangelung jener Steifheit und Salbung, die ich so abgöttisch liebe, nur wenigstens zum Trillerschlagen geschickte Finger oder eine muntere und gelenkige Zunge hast. Hier hast du meine Herausforderung! Ich will dir, nach deinem Belieben, Venus oder Ganymed sein und dir, wenn du es verlangst, den Gefallen tun, dich nicht eher aus meinen Armen zu lassen, als bis du auf ein Jahr entnervt bist. Man sieht, dass ich nicht willens bin, die Katze im Sack zu verkaufen.
Aber: verschwiegen musst du sein! Und wenn wir einander irgendwo treffen, wir mögen noch im Liebesbündnis stehen oder uns schon aus Überdruss getrennt haben, so müssen wir uns so verhalten, als hätten wir uns noch nie gesehen, denn obgleich ich die Liebe so heiß liebe, mag ich mich von den Tadlern nicht steinigen lassen.
Für wen liebt man denn? Doch wohl am meisten für sich selbst – und ein klein wenig für seine guten Freunde. Was geht uns die übrige Welt an? Unsere Liebesdiener selbst müssen über unsere wollüstigen Spiele schweigen, und noch weniger dürfen Fremde davon wissen. Das Lieben schadet uns nicht. Die Art nur, wie wir es tun, stellt uns dem Tadel bloß.
Das ist eine Moral, die zwar etwas spät kommt, aber doch, seitdem ich sie angenommen habe, mir die Ruhe wiedergegeben hat, die ich sonst so oft aufs Spiel setzte. Nun weiche ich nicht mehr von dieser Vorschrift ab.
2
Obgleich die Mutter, der ich mein Dasein zu danken habe, eine Kostgängerin und noch dazu eine Andächtige war, als man sie in ihrem siebzehnten Jahr mit dem Baron verheiratete, ist es doch so ausgemacht noch nicht, dass ich, die ich acht Monate und elf Tage nach ihrer Hochzeit zum Vorschein kam, ein echter Sprössling gewesen bin.
Meine Mutter, die einzige Tochter eines reichen Privatmannes, der sich hatte adeln lassen, übrigens ein hübsches Mädchen, hatte sich, wie man sagte, nicht lange bedacht, ein kleines Opfer zu bringen, um die Ehre und das Vergnügen zu haben, den Baron von … zu heiraten, der ein allerliebster Mann war und mit ihr im gleichen Alter stand.
Damals kam es oft vor, dass ein vornehmer Mann, der sonst nichts hatte als Schulden, irgendeinen Glückspilz mit seiner Verschwägerung beehrte, der sein Töchterchen gern mit einem Titel geschmückt oder am Hof vorgestellt sehen wollte. Man schloss einen Kontrakt; eine große Summe Geldes wurde ausgezahlt, die der gnädige Herr so geschwind wie möglich verschwendete und dabei nicht unterließ, den eitlen Verwandten der gnädigen Frau allen Kummer zu machen, währenddessen Madame ihrerseits alles tat, was sie konnte, um sich je länger desto verhasster und unerträglicher zu machen. So hatten denn auch die lieben Urheber meines Daseins die ersten sechzehn Jahre meines Lebens hingebracht, und es erfolgte die gewöhnliche Entwicklung, nämlich ein vollständiger Bankrott, der die Ehescheidung nach sich zog.
Bei all dieser Unordnung war aber meine Erziehung nicht vernachlässigt worden. Ich tanzte, sang, spielte die Harfe, zeichnete, stickte. Indessen musste ich meiner Mutter in die Provinz folgen, wo sie sich entschlossen hatte, in einem Bernhardinernonnenkloster von einem sehr mäßigen Einkommen zu leben.
Am meisten schmerzte mich dabei die Trennung von meinen lieben Lehrern. Fast alle brachten mir neben dem eigentlichen Unterricht kleine Grundsätze von Unabhängigkeit, nachsichtsvoller Moral und beinahe zur Ausschweifung führende Lehren bei. Allerdings hatte noch keiner von ihnen den Versuch gemacht, diese Lehren in die Praxis umzusetzen. Da sie aber gleichsam einmütig darauf ausgingen, mich zu einem sogenannten galanten Frauenzimmer zu machen, so müssen sie wohl ihre besonderen Absichten gehabt haben.
Einige glaubten vielleicht, mich verführen zu können, wenn ich entweder reifer oder verheiratet wäre; die anderen rechneten schon auf den Gewinn, den sie sich dadurch verschaffen wollten, wenn sie mich in Liebeshändel verwickelten.
Obgleich man ein ziemlich wachsames Auge auf den Unterricht dieser Herren hatte, so bekam ich doch aus ihren Händen eine Menge von Büchern, die man einem unterm Mantel zuträgt, und die schon durch ihre verführerischen Illustrationen Unzucht predigen, als mich die schreckliche Nachricht von dem Fall unseres Hauses und von unserer auf die nächste Nacht festgesetzten Abreise wie ein Donner zu Boden schlug. Mein italienischer Sprachmeister hatte mir die gelehrten Einweihungsbücher in die Hand gegeben, und man ließ mir nicht einmal Zeit, sie ihm wieder zuzustellen.
Der gute Bandini! Lange quälte mich der Gewissensskrupel, dass ich ihm weder für diese Belehrung danken noch einen gewissen Anschlag ins Werk setzen konnte, der mir im Kopfe herumlief, nämlich ihn durch eine seltsame Gefälligkeit für den mir geleisteten wichtigen Dienst angenehm zu belohnen.
Muss ich mich deutlicher erklären? Ich brannte vor Begierde, je eher desto lieber von der Theorie zur Praxis überzugehen, und da Bandini, ein echter Italiener, unter meinen Lehrern mir am meisten schmeichelte, folglich sich meines Zutrauens am meisten bemächtigt hatte, so würde er sich, obgleich er nicht mehr jung und ziemlich hässlich war, in kurzer Zeit genötigt gesehen haben, mich in die Geheimnisse der Liebe einzuweihen. Ein Glück, das er sich gewiss nicht träumen ließ, denn sein Antrag bestand nur immer aus den Worten: «Ich hoffe, Mademoiselle, dass Sie sich dereinst erinnern werden, welch großer Gefahr Ihr Diener sich Ihretwegen ausgesetzt; ich rechne aber damit, dass Sie immer meine Gönnerin bleiben werden.»
Dies war wohl nicht die Rede eines Mannes, der etwa persönliche Absichten auf mich gehabt hätte. Aber es kam nur noch auf zwei oder drei Tage an, sonst hätte er mich gehabt. Nichts als unser plötzlicher Fall konnte mich vor der Schande retten, gegen einen Bandini die ersten liebenswürdigen Schritte zu tun.
Nun geht die Reise fort. Bald werden wir in die Mauern der andächtigen Klause eingeschlossen sein.
Wenn ich bis jetzt das wollüstige Hilfsmittel, womit sich die philosophische Therese wie eine Närrin so lange behalf, nicht nur vernachlässigt, sondern sogar gewissenhaft gemieden hatte, so kam das daher, dass alle meine Lehrer, gleichsam wie auf Verabredung, die einsame Wollust in schwärzesten Farben geschildert hatten.
Dem Vergnügen dieser kitzelnden Handlung, das sie ihr nicht absprechen konnten, setzten sie mit dem größten Eifer die schrecklichen Gefahren entgegen, die mir bei ihrer Ausübung drohten. Magerkeit, Abzehrung und der gänzliche Verlust meiner aufkeimenden Schönheit, der Tod sogar, noch ehe ich die wahren Glückseligkeiten, wozu ich geschaffen wäre, genießen könnte, mussten ihnen zum Gegengift dienen, wodurch sie mich auch umso leichter davon abhielten, da nach ihrer Behauptung das vor allem meiner Schönheit sowohl als meinen Vergnügungen die höchste Vollkommenheit geben müsste, wo von sie mir den leeren und gefährlichen Schatten nicht gönnen wollten.
Sobald ich indessen den Fuß über die Schwelle des traurigen Klosters gesetzt hatte, sobald ich mich mit Schrecken in einer Wohnung eingesperrt sah, von der alle Männer ausgeschlossen waren, und ich diese interessanten Geschöpfe nur noch in den Kupferstichen sehen konnte, womit meine beiden Bücher geziert waren, so begriff ich wohl, dass mich die Not zwingen würde, Theresens Beispiel zu befolgen, und ich war in diesem Punkt eine Philosophin wie sie.
Ein Kammermädchen, das unsere einzige Bedienerin war, schlief mit mir in einem Bett und war fast immer meine Gesellschafterin, wenn ich nicht in dem Zimmer meiner Mutter war.
Eines Tages schickte meine Mutter diese meine Wächterin aus und ging selbst zu einer Nonne, mit der sie bekannt geworden war. Ich war also frei. Nun wusste ich, dass es keine Zeugen meiner Handlungen gab. Ich brannte von wollüstigen Begierden, meine Nerven zitterten, und ich schmeckte schon im Voraus, nur durch die Stärke meiner Einbildungskraft, einen Teil des Vergnügens, das ich mir selbst verschaffen wollte. Ich lege also einen großen Toilettenspiegel auf die Erde und hebe meine Kleidung in die Höhe, lasse mit geizigem Wohlgefallen meine neugierigen Blicke eine Weile auf dem lieblichen Bild meines kleinen Venusberges ruhen, der mit seiner soeben hervorkeimenden Wolle Samt gleicht. Zappelnd vor Freude öffne ich ein wenig die rosigen Lippen meiner niedlichen Purpurschnecke, ich versuche, einen Finger hineinzubringen, aber der Schmerz hält mich zurück. Ein sanftes, regelmäßiges Kitzeln gelingt mir besser. Ein entzückendes Feuer ergreift mich, läuft mir durch alle Adern und bringt mich außer mir. Der Instinkt des Vergnügens treibt mich an, der Bewegung, die mich so glücklich macht, mehr Schnelligkeit zu geben – O Zaubermacht der Natur! Ich fühle mich elektrisiert, verzehrt, ich sterbe...
3
Ein armer Fähnrich, der von der Nachricht einer ihm zugefallenen großen Erbschaft überrascht wird, kann nicht halb soviel Freude empfinden, wie mir der gute Fortgang meiner Erfahrung verursachte.
Einige Wochen hindurch konnte ich diese süße Beschäftigung nur sehr selten wiederholen, dann aber öffnete mir ein besonders glücklicher Vorfall endlich eine Laufbahn ohne alle Schwierigkeiten.
Das Mädchen, mit dem ich in einem Bett schlief, war ein großes starkes Geschöpf von zwanzig Jahren, mit schwarzem Haar und weißer Haut, von gesunder Gesichtsfarbe, reinlich und so zierlich gekleidet wie es ihr Stand erlaubte; dabei lebhaft bis zum Mutwillen, auch scheute es sich nicht, mich merken zu lassen, dass es das Klosterleben von ganzem Herzen langweilig fand.
Obgleich Felicia, so hieß sie, ein gutes Mädchen war und mir sehr zugetan schien, so fürchtete ich mich doch vor ihrem auffahrenden Wesen, das ihr indessen, wie ich nachher erfuhr, nicht angeboren, sondern nur eine Wirkung des Überdrusses war, den ihr ein Aufenthalt verursachte, an den sie sich gar nicht gewöhnen konnte. Dieses feurige Geschöpf hatte nachts einen Traum mit so heftigen Bewegungen, dass ich davon erwachte.
Sie lag auf dem Rücken mit auseinandergespreizten Lenden. Ihre Hüften hoben und senkten sich von Zeit zu Zeit, und diese Bewegungen wurden immer geschwinder, bis sie endlich in ein zappelndes Zucken verfiel und dabei im Ausdruck der heftigsten Leidenschaft die Worte ausrief: «Stoß zu! Stoß zu, mein lieber Jonas!» So hieß der Jäger meines Vaters. «Stich alles hinein! Alles! Zugleich mit mir, zugleich fertig! Halt doch! Ah! Ah!» Auf diesen letzten Ausruf folgte eine vollkommene Erstarrung. Bald darauf setzte sie mit fast betrübtem Ton hinzu: «Was haben wir getan? O lieber Junge, ich bin angeführt. Diesmal hast du mir gewiss ein Kind gemacht, denn ich fühle deinen Liebesbalsam im Innersten meines Herzens.»
Ein so nachdrücklicher Monolog gab mir zu viel Gewalt über Felicia, als dass ich mich nicht darüber hätte freuen sollen, ihn gehört zu haben.
Das glückliche Geschöpf hatte sich so heftig aufgeregt, dass es über und über schwitzte. Ihre Bewegungen hatten die Bettdecke so verschoben, dass sie bloß dalag. Ich erzeigte ihr dabei den Liebesdienst, sie zuzudecken, als sie erwachte.
«Felicia», sagte ich, «widerfährt dir das oft, dass du im Schlaf so laut sprichst?»
«Wieso, Fräulein?»
«Ich sage, dass du im Traum sprichst und zappelst wie eine Besessene. Sieh nur, wie unser Bett verwüstet ist.» «Sie spaßen, lassen Sie uns lieber schlafen.»
«Warte ein wenig! Lass uns doch noch von Jonas reden und von dem Kind, das er dir soeben gemacht hat.» «Wie, kleiner Gelbschnabel! Sie unterstehen sich, von dergleichen Dingen zu sprechen?»
«So, den Ton schlägst du an? Nun wohlan, ich höre weiter.»
Sogleich werfe ich mich auf den Rücken, breite meine Lenden auseinander und in eben dem Ton und mit eben den hüpfenden Bewegungen wiederhole ich von Anfang bis Ende: «Stoß zu, stoß zu, mein lieber Jonas. Stich alles hinein! Alles! Zugleich mit mir, zugleich fertig!»
Hier wollte sie mir den Mund zuhalten, aber ich fuhr unter ihrer Hand fort, indem ich meinen Hintern noch feuriger bewegte: «Halt doch! Ah! Ah!» Auch hatte ich nicht einmal Großmut genug, ihr den Rest ihres Monologs zu erlassen, denn als sie glaubte, es wäre nun vorbei, setzte ich hinzu: «Was haben wir getan? O lieber Junge, ich bin angeführt! Diesmal hast du mir gewiss ein Kind gemacht, denn ich fühle deinen...»
Sie musste sich wohl aller dieser Umstände erinnern und in meiner Erzählung die genaueste Wahrheit anerkennen, denn nun hielt sie mir den Mund so fest zu, dass ich keine Silbe mehr hervorbringen konnte.
Übrigens hätte ein Donnerschlag die arme Schlafrednerin nicht ärger niederschlagen können.
«Ich Unglückliche!» rief sie aus und verbarg ihren Kopf in dem Kissen. «Habe ich denn wirklich alle diese Dinge gesprochen?»
«Ja, Wort für Wort.»
«Und das ganz laut?»
«O ja! So laut, dass meine Mutter dich hätte hören können.» Sie schlief im Nebenzimmer.
«Dann bin ich ein unglückliches Mädchen.»
«Nein, Felicia», erwiderte ich mit sanftem Ton, «höre mich an, meine Freundin.»
Zugleich nahm ich sie in meine Arme und glaubte eine
Statue zu umfassen, so starr war ihr Körper. Sie hörte mir stillschweigend zu.
«Glaube nur», fuhr ich fort, «dass ich es nicht böse mit dir meine und dass ich weit entfernt bin, zu glauben... Was widerfährt einem nicht oft im Traum!»
Allein hier hemmte eine unaufhaltsame Begierde zu lachen meine Worte und stürzte die Träumerin von neuem in die Verlegenheit, sich überzeugt zu sehen, dass ich mich in der Veranlassung zu ihrem unreinen Traum keineswegs irrte.
«Ach», sagte sie, «also gibt es heutzutage keine Kinder mehr!» Darauf wandte sie sich mit den Worten zu mir: «Wenn Sie ein gutes Herz haben, so werden Sie schweigen.»
«Ja, Felicia, das schwör ich dir.»
«Das sind Sie mir auch schuldig, denn ich habe es Ihrer Mutter auch nicht gesagt, dass ich in Ihrer Schublade zwei Bücher gefunden habe, wobei einem die Haare zu Berge stehen.»
Ich lächelte, denn war meine sittsame Bemerkung nicht herrlich angebracht nach dem, was soeben vorgegangen war?
«Was würde ich Sie gescholten haben, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass Sie es selbst nicht wüssten, diese Schriften unter Ihren Büchern zu haben, oder wenigstens gedacht hätte, dass Sie kein Wort davon verstehen könnten.»
«Nein, so dumm bin ich nicht», sagte ich voll Stolz, mich mit meinen Kenntnissen brüsten zu können. «Glaube nur, gutes Kind, dass ich alles weiß, was man wissen kann und dass ich nicht einmal so viel zu wissen brauchte, um überzeugt zu sein, dass du nicht einen so ausdrucksvollen Traum hättest haben können, wenn die Sache selbst dir nicht wirklich vorher, und zwar oft, widerfahren wäre. Gesteh es mir nur!»
Die Betglocke des Klosters wurde gezogen.
«Lass uns beten!» sagte sie.
«Geh zum Teufel mit deiner Betglocke! Sollte man nicht glauben, du wärst eine Heilige, lass uns lieber von Jonas reden, dessen Lebensbalsam bis ins Herz dringt.»
«Gott im Himmel, was ist das? Wie kann man mit sechzehn Jahren schon so viel wissen? Nun erst glaube ich wirklich noch zu träumen!»
Während unseres Gesprächs hatte ich beständig den derben und festen Körper des Mädchens betastet. Sie ließ mir meinen Willen, solange ich nur ihre Arme, ihre Lenden und selbst ihre ungemein starken und strotzenden Brüste befühlte. Als aber meine neugierige Hand endlich ihren brennenden, erhabenen und mit starken krausen Haaren reichlich besetzten Venusberg berührte, verursachte dieser rasche Angriff, dass wir beide zurückzuckten, Felicia vielleicht aus verstellter Schamhaftigkeit und ich vor Schrecken und Unerfahrenheit.
Dieser Rückzug war aber nur das Werk eines Augenblicks. Ich kam gleich wieder. Felicia sah wohl ein, dass es überflüssig war, sich länger zu zieren. Sie ließ sich also ungehindert befühlen, und ich tat dies instinktiv mit einer Zärtlichkeit, die ihr wohl gefallen musste, denn sie legte sich wieder auf den Rücken und erlaubte meinem Finger, der sich in ihre von den Wirkungen des glücklichen Traums noch schlüpfrige Liebesgrotte hineingeschlichen hatte, das schönste Spiel von der Welt. Sie klemmte ihn sogar mit Wohlgefallen darin ein, wenn ich ihn zurückziehen wollte. Und nun verließ er auch den Platz nicht eher, bis Felicia, die ihn selbst regierte und die sich nun gar keinen Zwang mehr antat, in vollen Flammen und unter zappelnden Bewegungen, aber diesmal ohne ein Wort zu sagen und mit etwas mehr Zurückhaltung als vorher im Traum, ihren lüsternen Geist den Entzückungen des höchsten Wollustgefühls ausgehaucht hatte.
4
Die Erkenntlichkeit ist doch eine schöne Tugend! Felicia wollte mir beweisen, dass diese Tugend ihr nicht unbekannt war.
Kaum hatte sie sich etwas erholt, als sie sich mit ihren Beinen an mich anklammerte, mich mit Küssen bedeckte und mich ihren Engel und ihren Gott nannte. Sie betastete meine jungen Reize mit soviel Hitze, wie nur immer ein feuriger Liebhaber sich erlauben kann, und rieb die schwarze Beschattung ihres Venusberges so stark auf die hervorkeimende Wolke des meinigen, dass es mich beinahe schmerzte.
Das Ende davon war, dass sie mit überraschender Schnelligkeit meine Lenden auseinanderbog und ihren Mund meiner jungfräulichen Spalte näherte.
Ich war wohl beim Lesen hin und wieder auf Stellen gestoßen, die mir eine dunkle Vorstellung von ähnlichen Dingen beigebracht hatten, aber ich gestehe, dass das Bild davon über meine Einbildungskraft hinweggeglitten war, weil ich nichts Anziehendes daran gefunden hatte; denn die Narrheit der Menschen, die Werkzeuge des Vergnügens mit dem Namen Schamglieder zu brandmarken und die Kinder daran zu gewöhnen, sich dabei nur den unreinen Gebrauch derselben zu denken, lässtuns erst spät die wesentlichen Eigenschaften dieser edelsten und interessantesten Teile des menschlichen Körpers erkennen.
Aber wie geschwind wurde ich nicht bekehrt, als die wohlunterrichtete Zunge des Mädchens zwei- oder dreimal den oberen Winkel meines Spältchens liebkosend berührt hatte! Diese Bewegung, die ich für ein Wunderwerk hielt, machte mir so viel Vergnügen, als dass ich mich dabei hätte aufhalten sollen, das Vergnügen zu berechnen, das sie etwa dabei haben könnte, doch fiel mir ihr leidenschaftliches Hauchen und der brennende Atem auf, den sie zuweilen mit Wohlgefallen mir in den Leib blies, um mir Empfindungen zu erregen, die ich einfach nicht beschreiben kann.
Erhabenes Spiel des weiblichen Geschlechtes, das nur Toren mit ihrem Spott verfolgen! Wie ist es möglich, dass du nicht überall auf Erden Altäre hast?
Felicia setzte dieses Spiel so lange fort, wie ich es aushalten konnte. Endlich aber stieg die übermäßige Spannung meiner Fibern und die Elektrizität meines Blutes auf einen so hohen Grad, dass ich des Todes sein oder sie bitten musste, aufzuhören.
Glückliche, ewig unvergessliche Nacht! Ein einziger deiner Augenblicke war mehr wert als zehn Jahre jenes philosophischen Glücks, das die Moralisten so sehr erheben und das vielleicht niemals vorhanden war. Erhabener Magnetismus der Eigenschaften des Geschlechts, du immer gleiches, allgemeines und immer neues Wunder, das undankbare Schwätzer herabwürdigen, wenn sie dich zu den zahlreichen Unanständigkeiten zählen, welche die Natur an den Stand des Menschen knüpfte! Wie wenig könnte ich dich verachten und beschimpfen.
Doch mein Glaubensbekenntnis mag lieber aus der Geschichte meiner Vergnügungen hervorgehen als aus müßigen Erklärungen.
Unsere Spiele endigten mit dem Schwur einer unverbrüchlichen Verschwiegenheit und einer Freundschaft, die jeder Veränderung trotzen sollte. Von dem Augenblick an war Felicia in meinen Augen kein Dienstmädchen mehr, sondern für mich, in Erwartung noch besserer Freuden, das Kostbarste, was ich haben konnte; mit einem Wort – meine Freundin.
Der Schlaf überfiel uns mit wechselseitig verschränkten Armen und Lenden. Es war neun Uhr, als meine Mutter uns weckte und zum Glück nicht neugierig genug war, unseren Bettvorhang zu öffnen: sie hätte sonst an unserer unanständigen Lage leicht die Wahrheit erraten. Lieber Himmel! Wie unschmackhaft und unerträglich werden nicht die kleinen Umstände und Verbindlichkeiten des Lebens, wenn man erst gewisse lebhafte Empfindungen kennengelernt hat. Die Andachtsübungen, die tägliche Messe, die Beichte alle Samstage, die Kommunion alle vierzehn Tage, das Lesen der Erbauungsbücher meiner Mutter - wie verhasst wurde mir das alles!
Mich brannte die Stelle, wenn ich nicht mit meiner lieben Felicia unter vier Augen war. Aber was sage ich? Auch mit ihr war ich noch nicht glücklich genug, denn sie war mir oft in meinen unvernünftigen Begierden zuwider. Sie wollte nicht zulassen, sagte sie, dass ich durch täglich und stündlich wiederholte Venusspiele den Stachel der Wollust abstumpfte und jenen kostbaren Lebenssaft verschwendete, der zu meinem Wachstum so unentbehrlich wäre. Sie ließ mich also aus Überlegung und aus Freundschaft darben.
So vergingen zwei Monate, in denen ich die meiste Zeit die Rolle der handelnden Person übernehmen musste. Denn Felicia, die bei völlig reifen Jahren von ungemein robuster Leibesbeschaffenheit war, glaubte, von den zahlreichen Wiederholungen der Liebeskrise nichts zu befürchten zu haben. Ihr also alles anzutun, was ich ihr tun konnte, war doch immer etwas für mich. Himmel, welches Entzücken, wenn sie sich einmal herabließ, mich ebenso zu behandeln!
So war sie also unaufhörlich die Spenderin des einzigen Glücks, das ich kennen wollte, oder mein verfolgender Dämon, die Feindin meiner Freuden, das Hindernis aller meiner Begierden. Bald betete ich sie an, bald schimpfte ich. Dann lachte sie, wenn ich ihr vorwarf, sie liebte mich nicht und brächte mich zur Verzweiflung. Denn ihre fatale Wachsamkeit ging so weit, dass sie mir alle Gelegenheit nahm, mich ohne Zeugen für die Enthaltsamkeit zu rächen, wozu sie mich zwang.
«Ich hatte wohl deiner sehr nötig», sagte ich, «um mir Vergnügen zu schaffen. Ich habe wahrlich viel gewonnen, dass ich dich zur Vertrauten meiner Freudengenüsse gemacht habe! Du glaubst mir einen wichtigen Dienst zu tun, kannst aber im Gegenteil davon überzeugt sein, dass du mich umbringst und schuld daran bist, dass ich je eher je lieber einen Geniestreich machen werde, worüber du lebenslang wirst zu seufzen haben.»
Gleich darauf vergoss ich wieder Tränen, bat um Verzeihung, suchte meine ungerechten Vorwürfe wieder gut zu machen, und flehte um die Erlaubnis, ihr die niedrigsten Gefälligkeiten erzeigen zu dürfen. Und so war unter zehnmal immer die Reihe an mir, die Rolle der Freudengeberin zu spielen.
Eines Tages, als wir die besten Freunde waren, drang ich mit Ungestüm in sie, ihre Geschichte zu erzählen, die, wie sie mir schon gesagt hatte, sehr sonderbar wäre. Nach langem Weigern war sie endlich so gefällig, mir zu erzählen, was in den folgenden Kapiteln zu lesen sein wird.
5
Ich bin in einer der unfruchtbarsten Gegenden des Landes geboren, das Frankreich mit Schornsteinfegern und Lastträgern versorgt. Mein Vater hatte sich in diesen beiden Handwerken hervorgetan und sich in Paris mit meiner Mutter verheiratet, die sich durch Küchenarbeiten und Leierspielen etwas Geld erworben hatte.
Mein Vater, ein ehrlicher und arbeitsamer Mann, hatte seinerseits auch etwas erspart, und so waren sie aus der Hauptstadt fortgezogen und lebten in einem Dorf bei Saint-Jean-de-Maurienne. Eine Hütte, ein Stück Acker, ein Gärtchen und etwas Vieh war für diese genügsamen Leute ein hinlängliches Vermögen. Gleich anfangs zeugten sie einen Sohn; fünf Jahre nachher kam ich zur Welt, und das war das ganze Ergebnis ihrer Arbeit zur Hebung der Bevölkerung von Savoyen.
Ich war acht Jahre alt, als eine epidemische Krankheit, welche die ganze Gegend entvölkerte, uns unserer Eltern beraubte. Ein Oheim wurde unser Vormund.
Ich weiß nicht, aus welcher Grille mich meine Mutter, mit Einwilligung meines Vaters, wie einen Knaben erzog. Vielleicht aus Furcht, ich möchte, wenn ich mein eigentliches Geschlecht kannte, auch früh die Vorrechte genießen wollen, deren zu zweit getriebenen Genuss sie sich wahrscheinlich vorzuwerfen hatte. Genug, ich galt bei allen Menschen, und sogar bei meinem Oheim, für einen Knaben und sollte in meinem zwölften Jahr einer Gruppe folgen, die, wie es dort gewöhnlich ist, aus ihrem Vaterland auswanderte.
So kam ich nach Paris. Drei Jahre lang war ich da Schorn¬steinfeger, Schuhputzer und Bedienter auf Taglohn bei einem Schmied oder einem Frauenzimmer, das sich eine möblierte Stube gemietet hatte, oder einem anderen Pflastertreter, und diente bald in Privathäusern, bald in Gasthöfen.
Unserer Gewohnheit nach hatte ich meine Schlafstelle unterm Dach eines Hauses von sieben Stockwerken. Da schliefen acht von unserer Gesellschaft, und zwar zwei und zwei in abscheulichen Betten, die uns gewiss nicht zur Üppigkeit reizten. Ich brachte also meine Nächte an der Seite eines männlichen Wesens zu; aber unsere Nation ist so schamhaft und wir werden so einfach erzogen, unsere beschränkte Einsicht wird so frühzeitig und so stark auf mühsame Arbeit und dadurch zu schaffenden kleinen Gewinn geleitet, dass es einem Savoyarden nie in den Sinn kommt, des Nachts lustig zu sein. Wenigstens war es mir in vier Jahren nicht ein einziges Mal begegnet, dass irgendein Schlafkamerad, die doch so oft bei mir wechselten, den Versuch gemacht hätte, einen Vergleich zwischen seiner Beschaffenheit und der meinigen anzustellen.
Morgens und abends kleidete sich ein jeder mit der gewissenhaftesten Anständigkeit an und aus, und ich, wie jeder andere, blieb den Pflichten der Schamhaftigkeit treu, obgleich ich dazu bestimmt war, dereinst mich über alle Enthaltsamkeit hinwegzusetzen. Eine dichte und harte Schale verschloss damals noch den Keim wollüstiger Schwelgerei, der sich einst mit solcher Gewalt bei mir entwickeln sollte.
Ich musste jeden Tag um neun Uhr zu einem sehr hübschen Freudenmädchen gehen, das sich lieber mit Taten als mit Betrachtungen abgab. Ich fand es immer im Bett und selten allein, aber in solchen Fällen haben wir Savoyarden weder Augen noch Ohren.
Da ich indessen eines Tages aus einem Kabinett, in dem ich meine kleinen Geschäfte besorgte, in das Schlafzimmer trat, war ich genötigt, mit meinen Augen zu sehen, wie meine saubere Demoiselle, außer dem Bett und völlig nackt, von einem lustigen Burschen mit abgestutzten Haaren zurechtgemacht wurde, der wahrscheinlich nach mir hereingekommen war, weil der Schlüssel in der Tür steckengeblieben war. Ich wollte tun, als sähe ich diesen Liebeskampf nicht, aber das Zeichen des Kreuzes, das ich für mich schlagen zu müssen glaubte, kam den beiden Kämpfern so lächerlich vor, dass sie sich voneinander losmachten, um ihre Lachlust desto bequemer befriedigen zu können.
Die Stellung, in welche der Abbé zufälligerweise geriet, um sich von seiner Schönen loszumachen, zeigte meinen Neulingsblicken das gerötete Werkzeug seines unterbrochenen Freudengenusses, und in dem Augenblick fiel auch die Binde von meinen Augen, die mir bisher den Irrtum verborgen hatte, in welchem ich über mich selbst lebte. Die auffallende Veränderung, die in mir vorging, hätte mich fast meiner Sinne beraubt. Ich fing an zu taumeln.
«Nimm dich in acht, Felix», sagte die Unzüchtige zu mir mit höhnischem Lachen, «sollte man doch glauben, du
würdest über deine eigenen Beine fallen. Steh doch fest! Hat dir dieser prächtige Liebeszapfen Furcht eingejagt? Wahr ist es, dass der Abbé vortrefflich ausgestattet ist.» Über diese und ähnliche Plattheiten lachten die beiden Narren aus Leibeskräften.
Ich kam aus aller Fassung und besann mich nicht einmal auf das Kabinett, wohin ich hätte flüchten können. Irgendeine Antwort zu geben, war ich gar nicht imstande.
«Lassen Sie den Schafskopf gehen», sagte der Abbé mit Verachtung, «und lassen Sie uns unser Gespräch fortsetzen.»
«Scher dich fort, verwünschter Lümmel!» sagte er zu mir. «Wie kann man so ein Esel sein und hier hereinkommen, wenn wir uns lieben.»
Jedes Wort dieser groben Rede war für mich schlimmer als ein Hieb mit der Peitsche.
«Nein, nein!» fiel die Demoiselle ein. «Felix soll nicht weggehen. Es gibt nichts Reizenderes für mich, als mich in Gegenwart von Zeugen zurechtmachen zu lassen. Komm her, Kleiner! Außerdem muss er ja auch was lernen; ich will, dass er alles recht genau sehen soll. Komm her, sage ich dir!»
Jeder andere an meiner Seite würde zum Zimmer hinausgegangen sein und dieses Weibsstück verwünscht haben. Aber ich - war es schon mein heimlicher Instinkt, der mich verriet? -, ich gehorche! Ich setze einen Fuß vor, das Mädchen lächelt und reicht mir die Hand. Der zweite Fuß folgt nach, mein Gesicht glüht, ich zittere, aber ich nähere mich dem Bett.
In diesem Augenblick ergreift mich das Mädchen, schlingt ihren niedlichen Arm um meine Hüften: «Nun»,
ruft sie dem Abbé zu, «nun komm und stich deinen Degen in meine Scheide!»
Zu gleicher Zeit hebt sie das Kreuz, spreizt die Lenden auseinander und fordert den fürchterlichen Dolch heraus, der nun auch ohne Mitleid hineinfährt, dass es mir kalt durch die Glieder läuft. Wie, dachte ich, er ist so lang und so wild; das arme Mädchen muss zerrissen werden. Aber nein, der drohende Schaft wird ganz und gar verschlungen, und auf dem Gesicht des Opfers entdeckte ich nur Zeichen der Wonne. Gleich darauf hüpfte sie, als wollte sie die Bettstelle unter sich zerbrechen, sie keucht, sie beißt, sie flucht, vergisst aber bei alledem nicht, mich festzuhalten und in alle ihre Bewegungen mit sich fortzureißen.
Und doch, auf dem höchsten Punkte dieses Ungestüms - welche Gegenwart des Geistes! - reißt sie sich plötzlich los, und ich sehe mit Erstaunen den feuchten Zylinder eine ganze Flut von weißem und seifenartigem Schaum weit von sich spritzen, wovon ein Teil derjenigen ins Gesicht fliegt, die sich ihm so unsanft entzogen hatte. Sie lachte über diesen unwillkürlichen Erguss, erhob aber eine ganz andere Klage.
«Du sollst mich nicht anführen, Schatz!» rief sie. «Es war wirklich höchste Zeit. Da wäre ich schön angekommen, wenn du mir das alles zu schlucken gegeben hättest. Das wäre sehr erbaulich gewesen, wenn du mir ein Kind angedreht hättest. Kannst du Lumpenhund denn eines ernähren?»
So lernte ich also in einer einzigen Lektion auf einmal, dass ich keine Mannsperson war; dass ein Mann hat, was ich jetzt eben gesehen hatte; dass ein Frauenzimmer dies Ding in ein solches Ding aufnimmt, wie ich selbst hatte;
dass sie Vergnügen dabei empfindet; dass so die Kinder gemacht werden, wenn sie zulässt, dass der Zeugungssaft sich innerlich ergießt; dass man aber, wenn man dies ver¬meidet, nicht Gefahr läuft, Mutter zu werden. Wie viel Entdeckungen in einem Augenblick!
Der Abbé, anstatt sich durch die Strafpredigt beleidigt zu finden, ließ sich ganz vergnügt von seiner Liebesgesellin abwaschen und abtrocknen. Ja, er borgte ihr sogar, in einem mehr fordernden als bittenden Tone einen Franc ab, den sie ihm gern zu bewilligen schien. Als sie sich darauf über eine Wanne bückte und sich auch reinigte, wobei sie sich ordentlich bemühte, alle ihre Reize vor meinen Augen zu entfalten, ging der tonsurierte Spitzbube davon.
6
Kaum war der Auftritt dieser gar nicht feinen Liebesbalgerei beendigt, als ich von etwas anderem bedroht wurde, was mich nicht weniger in Verlegenheit setzte.
Man hörte den Abbé noch trillern, als meine Messalina von ihrer Wanne nach der Zimmertür lief, sie doppelt abschloss und den Schlüssel unter das Bett steckte. Darauf kommt sie, noch immer nackt, auf mich zu, wirft ihren Arm um meinen Hals, drückt mich an ihre Brust und überhäuft mich mit Küssen, die sie mit allerhand ehrbaren Reden begleitet: «Nicht wahr, lieber Junge, du bist nicht böse über das, was du gesehen hast? In deiner Stadt wirst du dergleichen oft genug gesehen haben; aber was ist denn Böses dabei? Die Jugend, die Jahreszeit der Liebe», sagte sie und schaute mich an.
«Fühlst du noch nichts, lieber Junge?» fragte mich die Unverschämte. «In deinem Alter steht einem doch das Liebesglied.» Und ihre Hand suchte sich davon bei mir zu überzeugen. Ich wich ihr aus; sie setzte mir zu und richtete die Lebhaftigkeit ihres Angriffes nach meinem Widerstand ein. «Sage mir doch, Felix, hat dich das nicht in Erregung gebracht, was du uns vorher hast tun sehen? Soll ich dir zur Belohnung eben das erlauben, was der Abbé tat?» «Lassen Sie mich, Mamsell, ich bitte Sie.»
«Ei was, du musst nicht so dumm sein. Sieh, Felix, ich bin dir schon lange gut und habe es dir schon oft sagen wollen ... Du stoßest mich weg! Du wehrst dich? Oh, das muss ich sehen!»
«Um Himmels willen, Mamsell, lassen Sie mich!»
«Wie, findest du mich etwa nicht appetitlich genug?» Dabei fuhr sie immer mit ihren Handgriffen fort.
«Nun, Felix, sieh mich doch an!» Ja, wenn ich gehabt hätte, was mir fehlte! «Küss mich! Küss mich doch, sage ich.» Warum sollte ich sie nicht küssen? Sosehr ich auch ihresgleichen war, so fand ich sie doch so verführerisch; und tat mir meine Herrschaft nicht immer eine Ehre damit an? Ich küsste sie also.
«Da nimm meine Brüste und gib mir deine Hand - ich wette, du hast noch keine Bauchspalte gefühlt - eine hübschere wirst du nie zu sehen bekommen.» Sie steigt auf den Stuhl und hält sie mir dicht vor die Augen. «Sieh sie gut an! Greif zu! Nicht wahr? Sie ist frisch und niedlich? Nun ist die Reihe an mir.»
Sie springt herunter und fasst mich von vorn und von hinten so fest, dass ich mich nicht mehr loswinden kann. Halb aus Scham und halb wegen meiner Verkleidung fange ich an, mich zu wehren.
«Was? Du willst nicht?»
«Mamsell, noch einmal - ich kann nicht.»
«Ich will ihn sehen!»
«Ich schreie, ich beiße, ich schlage.»
«Du garstiger Grobian! Gib mir sofort deinen Liebespfeil her!»
Ich schlug meine Lenden kreuzweise übereinander und wand mich von allen Seiten, um meine Widersacherin so
müde zu machen, dass sie endlich ihren Vorsatz fahrenlassen sollte - aber vergebens. «Seht einmal den kleinen Hosenteufel! Welch ein Eigensinn! Und ich sollte mit meiner langen Nase abziehen! Nein, bei allen Wettern! Ich will deinen Adamsstengel sehen - und du sollst ihn mir hineinstecken oder hunderttausend Teufel...»
Mit diesen Worten platzt mir der Hosengurt und lässt meiner schamlosen Gegnerin freie Hand. Man stelle sich nun ihr Erstaunen vor!
«Hol dich der Teufel!» sagt sie, indem sie ihren Zauber gelöst sieht und ruhig zu ihrem Bett zurückkehrt, «das war auch gerade so vieler Mühe wert, um am Ende nichts zu finden.»
Ich brachte meinen Anzug wieder in Ordnung, so gut ich konnte, und ging zur Tür; aber der Schlüssel lag unter ihrem Bett und ich hatte nicht den Mut, ihn hervorzuholen.
Der Zorn meiner Mamsell wurde bald von einer ungezähmten Neugier verdrängt, um zu erfahren, aus welchen seltsamen Ursachen ich als Mädchen in männlicher Kleidung erschien. Ich sagte ihr ganz treuherzig die reine Wahrheit von meiner einförmigen Existenz, und sie rief einmal über das andere aus: «Sechzehn Jahr! Schön wie ein Engel! Und nicht zu wissen, was man ist! Und dass auch niemand so klug gewesen ist, sie zu unterrichten! Hör, liebe Kleine», setzte sie hinzu, «du bist nicht dazu gemacht, länger mit dem Savoyardenpack zusammenzuwohnen. Weißt du wohl, dass es nur von dir abhängt, dein Glück zu machen? Bleib bei mir; ich will für dein Fortkommen sorgen.»
Sie sagte mir die verbindlichsten Sachen und machte mir die schmeichelhaftesten Vorschläge. Aber der schamlose
Auftritt mit dem Abbé lag mir noch auf dem Herzen. Ich bedachte, dass jeden Augenblick etwas Ähnliches vorgehen könnte und mir, weil ich die Ehre hatte, zum schönen Geschlecht zu gehören, doch früh oder spät ebenso würde mitgespielt werden wie meiner Mamsell; und alle Bekanntschaften, bei dem Abbé anzufangen, waren meines Erachtens nicht wert, mir nahe zu kommen. Indessen bediente ich mich der kleinen List, als nähme ich anscheinend ihr Anerbieten mit Freuden an. Sie forderte mein Wort darauf, und ich gab es mit dem festen Vorsatz, es nicht zu halten. Aber für mich handelte es sich darum, aus dem Haus zu kommen, unter dem Vorwand wenigstens, meine kleinen Habseligkeiten zu holen. Ich versprach, wiederzukommen.
Himmel, wie froh war ich, mich in Freiheit zu sehen! Ich ging zu allen meinen Kunden und raffte bei denen, die bezahlen wollten oder konnten, das wenige zusammen, was ich zu fordern hatte; denn meine Absicht war im Ernst, Paris noch heute zu verlassen und mein Glück an irgendeinem Ort zu suchen, wo das Geheimnis meines Geschlechtes nicht Gefahr lief, von der ersten besten Lustjungfer aufgespürt zu werden.
Ach, wie glücklich wäre ich gewesen, wenn ich ein so vernünftiges Vorhaben auf der Stelle ausgeführt hätte! Aber dies war gerade der Tag, wo der Teufel aufwachen sollte, den ich in meinem Blut trug und von dem ich künftighin so unbarmherzig besessen sein und gepeinigt werden sollte. Den ersten Streich, den er mir spielte, war die Demütigung, die ich jetzt erzählen will und wegen der ich mich übrigens nicht über das Schicksal beschweren darf, weil ich selbst, ganz allein und von ganzem Herzen, die Urheberin dieses kleinen Unfalls war.
7
Der Kamerad, mit dem ich damals zusammen schlief, war ein großer schwarzbrauner Kerl von achtzehn bis neunzehn Jahren, der gewöhnlich schnarchte. Das störte mich und die ganze Stubengesellschaft oft im Schlaf. Es war also kein Wunder, da ich den Kopf noch von den Dingen voll hatte, die mir an diesem Tag begegnet waren, dass ich Mühe hatte, einzuschlafen.
Mein Bettgenosse schnarchte nach seiner Gewohnheit, ich konnte kein Auge zutun; mein Blut war in Wallung, und mir war ganz heiß.
Es kam mir also ein lustiger Einfall, nämlich zu wissen, ob Franz – so hieß er - auch so etwas hätte, das dem sonderbaren Schaft des wollüstigen Abbé ähnlich wäre. Meine Hand geht auf die Jagd – ich finde zwar etwas, das von meiner Beschaffenheit verschieden ist, eine kleine Probe der Mannheit; aber so weich, so erstorben, dass ich in Versuchung kam, zu glauben, dass zwischen einem Freudenmädchen und einem Abbé noch zwei Klassen von Menschen stehen, nämlich die Mädchen wie ich, die ganz anders beschaffen sind als meine Mamsell, und Mannspersonen wie Franz, die noch weniger Ähnlichkeit mit dem männlichen Geschlecht haben, dessen Beschaffenheit meine Blicke zuerst geblendet hatte.
Inzwischen fühle ich, dass unter meiner vorwitzig forschenden Hand, die sich noch immer bei ihrem Gegenstand aufhielt, etwas zu leben und sich zu bewegen anfängt. Diese Veränderung interessiert mich und schmeichelt mir. Ich werde sehr aufmerksam auf die fühlbaren Fortschritte dieser Auferstehung, aber ohne im Geringsten an den Anteil zu denken, den mein weiblicher Magnet an dieser Veränderung haben mochte. Stufenweise kommt das Wunder zu seiner Vollendung. Franzens Lie- besfackel strotzt endlich in ihrer höchstmöglichen Ausdehnung.