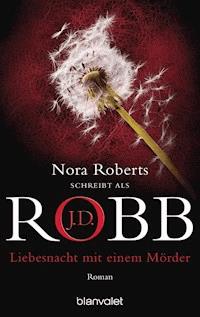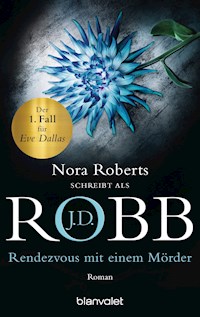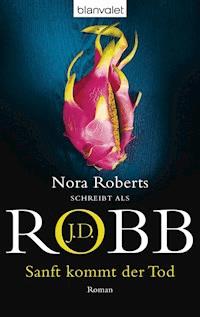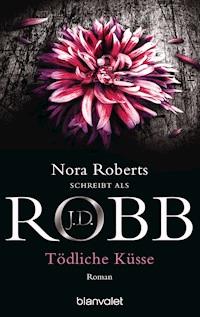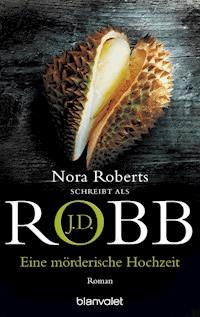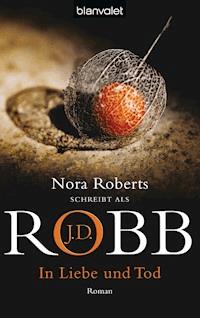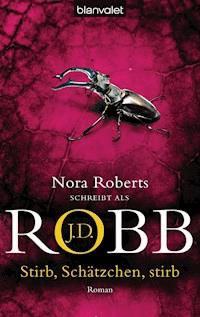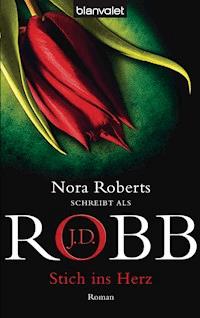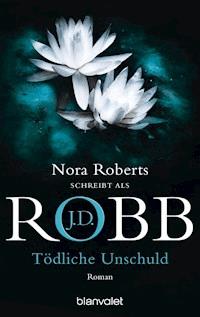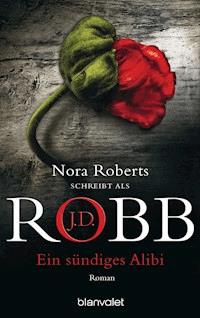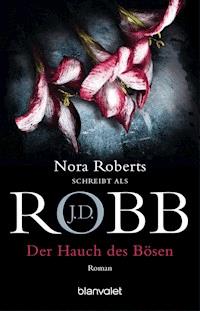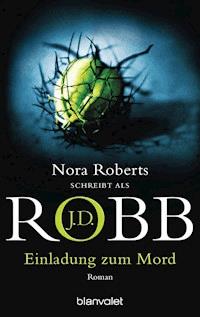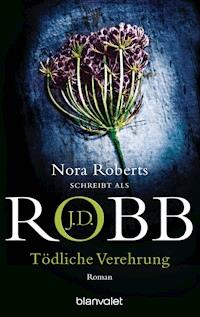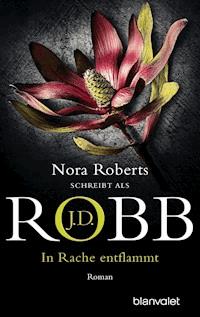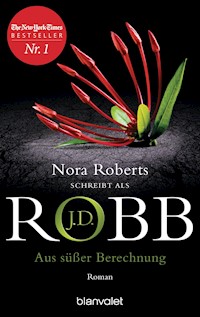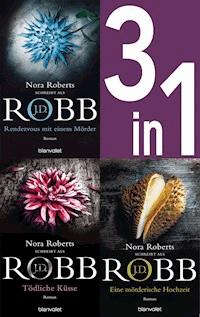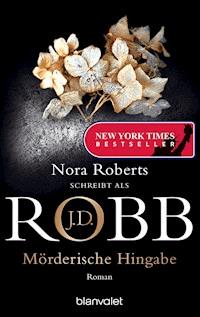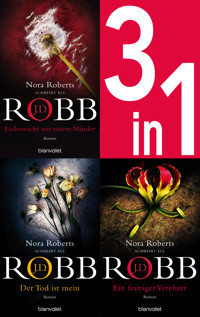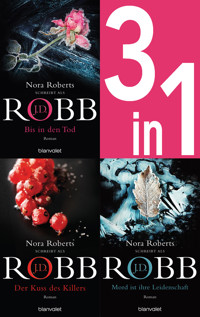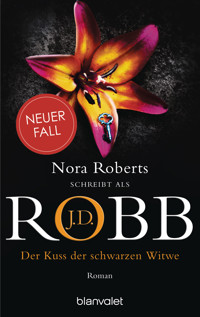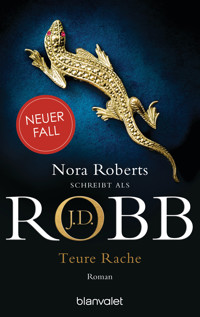Buch
Niemand ist gerne allein. Besonders an Weihnachten, der schlimmsten Zeit für einsame Herzen, ist Hochsaison für die guten Geschäfte der Partneragenturen. Lieutenant Eve Dallas allerdings hasst dieses Fest der Liebe, das sie an ihre schreckliche Kindheit erinnert. Lieber stürzt sie sich verbissen in ihre Arbeit: Sie ermittelt in einem besonders erschütternden Fall von Ritualmorden. Dabei macht sie eine erschreckende Entdeckung: Alle Opfer des Killers sind von einer angesehenen New Yorker Partneragentur vermittelt worden. Immer tiefer dringt Eve in diese schwer zugängliche Welt der Partnervermittlung ein, in der Business und wahre Liebe so nah beieinander liegen. Denn nur zu oft steckt hinter der angeblichen großen Liebe ein kleines schmutziges Geheimnis – und manchmal ist es mörderisch...
Autorin
J.D. Robb ist das Pseydonym der internationalen Bestsellerautorin Nora Roberts. Ihre überaus spannenden Kriminalromane mit der Heldin Eve Dallas wurden von den amerikanischen Lesern bereits mit größter Begeisterung aufgenommen und haben seit der Veröffentlichung von „Rendezvous mit einem Mörder” auch in Deutschland immer mehr Fans gewonnen. Vor rund 20 Jahren begann Nora Roberts zu schreiben und hoffte inständig, überhaupt veröffentlicht zu werden. Heute ist sie eine der meist verkauften Autorinnen der Welt und wird in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Weitere Romane von J.D. Robb sind bei Blanvalet bereits in Vorbereitung.
Von J.D. Robb ist bereits erschienen:
Rendezvous mit einem Mörder (1; 35450) · Tödliche Küsse (2; 35451) · Eine mörderische Hochzeit (3; 35452) · Bis in den Tod (4; 35632) · Der Kuss des Killers (5; 35633) · Mord ist ihre Leidenschaft (6; 35634) · Liebesnacht mit einem Mörder (7; 36026) · Der Tod ist mein (8; 36027) · Ein feuriger Verehrer (9; 36028) · Spiel mit dem Mörder (10; 36321) · Sündige Rache (11; 36332) · Symphonie des Todes (12; 36333) · Das Lächeln des Killers (13; 36334) · Einladung zum Mord (14; 36595) · Tödliche Unschuld (15; 36599)
Mörderspiele. Drei Fälle für Eve Dallas (36753)
Nora Roberts ist J. D. Robb: Ein gefährliches Geschenk (36384)
J. D. Robb
Liebesnacht mit einem Mörder
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Uta Hege
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Holiday in Death« bei Berkley Books, a member of The Penguin Group Inc., New York.
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Nora Roberts
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by arrangement with Eleanor Wilder.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, Garbsen.
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Gallery Stock/Mark Mattock
Redaktion: Petra Zimmermann
MD · Herstellung: Heidrun Nawrot
ISBN 978-3-641-02830-5V003
www.blanvalet.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches toward Bethlehem to be born?Und welches raue Biest kriecht, wenn seine Stunde endlich kommt, nach Bethlehem, um dort das Licht der Welt zu schaun?
- YEATS
Nobody shoots at Santa Claus.
1
Sie träumte vom Tod.
Das schmutzig-rote Licht des Neonschildes pulsierte wie ein zornbebendes Herz hinter dem verschmierten Fenster. Sein Blinken ließ den blutbefleckten Boden wechselweise hell und dunkel schimmern und zeigte in steter Regelmäßigkeit die Konturen des schmuddeligen kleinen Zimmers, ehe es wieder in totaler Finsternis versank.
Das magere kleine Mädchen mit dem wirren braunen Haar und den großen Augen in der Farbe des Whiskey, den er, wenn er ihn sich leisten konnte, allzu gerne trank, kauerte in einer Ecke. Schmerz und Schock hatten die Augen glasig werden lassen, und sie hatte eine totengleiche wächserngraue Haut. Hypnotisiert von dem blinkenden Licht, starrte sie auf die Wände, auf den Boden und immer wieder auf ihn.
Ihn, der in seinem eigenen Blut auf dem verkratzten Boden lag.
Aus ihrer Kehle drang ein leises Wimmern.
Und in der Hand hielt sie das bis zum Griff mit Blut getränkte Messer.
Er war tot. Sie wusste, er war tot. Der faulige Gestank der Eingeweide dieses Mannes vergiftete die Luft. Sie war ein Kind, ein kleines Kind, doch das Tier in ihrem Innern erkannte den Geruch, und er rief gleichermaßen Angst wie stumme Freude in ihr wach.
Sie spürte das Stechen ihres von ihm gebrochenen Arms und das Brennen zwischen ihren Beinen, das die Folge seiner letzten Vergewaltigung des eigenen Kindes war. Nicht alles Blut stammte von ihm.
Doch er war tot. Es war vorbei. Endlich war sie befreit.
Da drehte er langsam, wie eine Marionette, seinen Kopf, und das Grauen verdrängte ihren Schmerz.
Er glotzte sie an, während sie sich mit einem leisen Aufschrei tiefer in die Ecke drückte, um aus seiner Reichweite zu gelangen, und verzog den toten Mund zu einem widerlichen Grinsen.
Du wirst mir nie entkommen, kleines Mädchen. Ich bin ein Teil von dir. Für immer. Tief in deinem Inneren. Und das für alle Zeiten. So, und jetzt muss Daddy dich bestrafen.
Er stemmte sich mit den Händen und den Knien vom Boden ab. Blut troff in dicken Tropfen von seinem Gesicht, seinen Hals entlang, glitt obszön über seine Arme auf die Erde. Als er auf die Füße kam und anfing, durch das Blut auf seine Tochter zuzuwaten, schrie sie in nacktem Entsetzen auf.
Und wurde davon wach.
Sie verbarg das Gesicht zwischen den Händen, hielt sich, um den Schrei zu unterdrücken, der brennend aus ihrer Kehle drängte, fest den Mund zu und zuckte bei jedem Atemzug qualvoll zusammen.
Die Angst verfolgte sie, blies ihr eisig in den Nacken, doch sie kämpfte dagegen an. Sie war nicht mehr das hilflose Kind von damals. Sie war eine erwachsene Frau, eine Polizistin, die wusste, wie man schützte und verteidigte. Auch wenn sie selbst das Opfer war.
Sie war nicht allein in irgendeinem grässlichen, mickrigen Zimmer, sondern in ihrem eigenen Haus. Roarkes Haus. Roarke.
Indem sie sich auf diesen Namen konzentrierte, schaffte sie es, sich allmählich zu beruhigen.
Da er unterwegs war, hatte sie den Liegesessel in ihrem Arbeitszimmer als Schlafstätte gewählt. In ihrer beider Bett konnte sie nur schlafen, wenn er bei ihr war. Die Träume kamen so gut wie nie, wenn er neben ihr schlief. Wenn sie jedoch allein war, peinigten sie sie mit fürchterlicher Konstanz.
Sie hasste diese Abhängigkeit fast genauso wie sie diesen Menschen liebte.
Sie richtete sich auf und zog den äußerst gut genährten grauen Kater, der sie aus halb geöffneten, zweifarbigen Augen anblinzelte, Trost suchend an ihre Brust. Galahad war zwar ihre Alpträume gewöhnt, doch behagte es ihm gar nicht, wenn sie ihn deshalb um vier Uhr morgens weckte.
»Tut mir Leid«, murmelte sie und schmiegte ihr Gesicht in sein seidig weiches Fell. »Es ist wirklich dämlich. Er ist tot und kommt garantiert nicht zurück. Tote kehren nicht zurück.« Seufzend starrte sie ins Dunkel. »Das sollte mir allmählich klar sein.«
Sie lebte mit dem Tod, arbeitete mit ihm, watete Tag für Tag und Nacht für Nacht hindurch. Sie befanden sich in den letzten Wochen des Jahres 2058, und Schusswaffen waren schon lange verboten. Die Medizin hatte außerdem Methoden entwickelt, um das Leben weit über die Hundert-Jahres-Grenze zu verlängern.
Trotzdem brachten die Menschen einander hartnäckig weiter um.
Und es war ihr Job, für die Toten einzutreten.
Statt einen erneuten Alptraum zu riskieren, schaltete sie das Licht ein und kletterte entschieden aus dem Sessel. Sie stand sicher auf den Beinen, ihr Puls schlug fast wieder normal, und das Kopfweh und die Übelkeit, die die normale Folge ihrer Träume waren, würden sich, wie sie aus Erfahrung wusste, in wenigen Minuten legen.
In der Hoffnung auf ein vorgezogenes Frühstück sprang auch Galahad von seinem Platz und strich, als sie in die Küchenecke ging, schmeichelnd um ihre Beine.
»Ich zuerst, Kumpel.« Sie programmierte ihren Autochef auf starken, schwarzen Kaffee, stellte eine Schale mit Katzenfutter auf den Boden, und während sie müde aus dem Fenster blinzelte, begann das kleine Fellmonster mit einer Gier zu fressen, als würde man es ihm gleich klauen.
Statt auf die Straße blickte sie auf eine ausgedehnte Rasenfläche, und am Himmel herrschte keinerlei Verkehr. Es war, als wäre sie völlig alleine auf der Welt. Roarke hatte diese Abgeschiedenheit und Ruhe mit seinem Geld erkauft. Hinter der hohen Steinmauer jedoch, außerhalb des wunderbaren Grundstücks, pulsierte Tag und Nacht das Leben. Dicht gefolgt vom Tod.
Das war ihre Welt, dachte sie, während sie an dem starken Kaffee nippte und die noch nicht völlig verheilte Schulter, um die Steifheit daraus zu vertreiben, langsam kreisen ließ. Heimtückische Morde, hochfliegende Pläne, schmutzige Geschäfte und schreiende Verzweiflung. Sie kannte sich mit diesen Dingen besser aus als mit dem farbenfrohen Reichtum und der Macht, von der ihr Mann umgeben war.
In Momenten wie diesem, wenn sie allein und deprimiert war, fragte sie sich, wie sie beide einander je gefunden hatten – die gradlinige Polizistin, die an Gesetz und Ordnung glaubte, und der gerissene Ire, der diese Gesetze ständig übertrat.
Sie waren zwei verlorene Seelen, die entgegengesetzte Wege eingeschlagen hatten, um zu überleben. Und entgegen jeder Logik und jeglicher Vernunft hatte ein Mordfall sie nicht nur zusammenkommen lassen, sondern regelrecht miteinander verschweißt.
»Himmel, ich vermisse ihn. Das ist einfach absurd.« Wütend auf sich selbst, drehte sie sich, in der Absicht zu duschen und sich anzuziehen, entschlossen um, sah das Blinken ihres Tele-Links und lief, da sie wusste, wer sie um diese Uhrzeit anrief, rasch an den Apparat.
Sofort tauchte Roarkes Gesicht auf dem kleinen Bildschirm auf. Was für ein Gesicht, dachte sie, als er eine seiner dunklen Brauen hochzog. Er hatte lange, dichte, schwarze Haare, einen perfekt geformten Mund, fein gemeißelte Knochen und durchdringende, leuchtend blaue Augen.
Sie kannte ihn seit beinahe einem Jahr, und trotzdem weckte bereits der Anblick seines umwerfend attraktiven Gesichts heißes Verlangen in ihr.
»Meine liebste Eve.« Seine rauchig-weiche Stimme klang wie teurer, irischer Whiskey, auf dem ein Sahnehäubchen schwamm. »Warum schläfst du nicht?«
»Weil ich wach bin.«
Sie wusste, was er sah, als er sie eingehend studierte. Sie konnte nichts vor ihm verbergen. Er sah die Schatten unter ihren Augen und die Bleiche ihrer Haut. Unbehaglich zuckte sie mit den Schultern und fuhr sich mit der Hand durch das kurz geschnittene, zerzauste Haar. »Ich fahre heute etwas früher auf die Wache. Ich muss noch jede Menge Papierkram erledigen.«
Er sah mehr, als sie ahnte. Sah Stärke, Mut und Schmerz sowie eine Schönheit – in den hervortretenden Wangenknochen, dem vollen Mund und den brandyfarbenen Augen -, derer sie sich nicht annähernd bewusst war. Da jedoch auch ihre Erschöpfung ihm nicht verborgen blieb, änderte er spontan seine Pläne.
»Ich komme heute Abend heim.«
»Ich dachte, du bräuchtest noch ein paar Tage.«
»Ich komme heute Abend«, wiederholte er und betrachtete sie lächelnd. »Du fehlst mir, Lieutenant.«
»Ach ja?« Auch wenn sie die warme Freude, die diese Worte in ihr verursachten, eher idiotisch fand, grinste sie breit. »Ich schätze, dann muss ich mir ein bisschen Zeit für dich nehmen, oder?«
»Tu das.«
»Ist das der Grund, aus dem du angerufen hast – um mich wissen zu lassen, dass du früher als geplant wieder da bist?«
Eigentlich hatte er sie dazu bewegen wollen, ihn übers Wochenende im Olympus Resort zu besuchen, weil er erst ein, zwei Tage später hatte zurückkehren wollen. Nun jedoch erklärte er ihr lächelnd: »Ich wollte meine Frau lediglich über jeden meiner Schritte informieren. Du solltest noch ein wenig schlafen, Eve.«
»Ja, eventuell.« Doch sie beide wussten, dass der gut gemeinte Ratschlag ihres Gatten absolut vergeblich war. »Wir sehen uns dann heute Abend. Äh, Roarke?«
»Ja?«
Sie musste immer noch tief Luft holen, ehe sie zugeben konnte: »Du fehlst mir ebenfalls.« Während er sie liebevoll lächelnd ansah, brach sie die Übertragung hastig ab, ging mit ihrer Kaffeetasse in das angrenzende Bad und machte sich fit für den anbrechenden Tag.
Sie schlich sich zwar nicht gerade aus dem Haus, bewegte sich aber zumindest sehr leise. Trotz der frühen Stunde war sie der festen Überzeugung, dass auch Summerset längst auf den Beinen war, und sie ging Roarkes Hauptfeldwebel – oder wie immer man so einen Menschen nannte, der alles wusste, alles tat und seine Hakennase allzu oft in ihre Angelegenheiten steckte -, so gut es ging, aus dem Weg.
Seit sie beide einander während ihres letzten Falles näher gerückt waren, als ihnen beiden lieb gewesen war, gab er sich ebenfalls die größte Mühe, ihr nicht allzu häufig zu begegnen.
Bei der Erinnerung an ihren letzten Fall rieb sie sich geistesabwesend die Schulter. Morgens und am Ende eines langen Tages machte sie ihr noch etwas zu schaffen. Nie wieder würde sie von einem Schuss aus ihrer eigenen Waffe erwischt werden wollen. Weitaus schlimmer jedoch war die Tatsache gewesen, dass Summerset ihr danach, als sie zu schwach gewesen war, um ihm dafür einen Tritt in sein knochiges Hinterteil zu geben, literweise Medikamente in den Hals gegossen hatte.
Sie zog die Haustür behutsam hinter sich ins Schloss, sog die kalte Dezemberluft tief in ihre Lungen ein – und fluchte.
Sie hatte ihr Fahrzeug vor allem deshalb am Fuß der Treppe stehen lassen, um Summerset zu ärgern. Und er hatte es umgeparkt, weil er genau wusste, dass sie sich darüber aufregen würde. Da sie vergessen hatte, die Fernbedienung für die Garage und den Wagen mitzubringen, stapfte sie knurrend über den gefrorenen Rasen. Vor lauter Kälte brannten ihre Ohren und lief ihre Nase wie die eines kleinen Kindes.
Sie bleckte die Zähne, gab mit handschuhlosen Fingern den Zugangscode für die Garage ein und betrat den auf Hochglanz polierten, wohlig temperierten Raum.
Auf zwei Ebenen waren elegante PKWs, Motorräder, Sky-Scooter und ein zweisitziger Minicopter verteilt. Ihr erbsengrüner Dienstwagen wirkte im Vergleich zu den übrigen Modellen wie ein räudiger Straßenköter inmitten einer Rotte schlanker Rassehunde mit seidig schimmerndem Fell. Doch zumindest war er neu, sagte sie sich, als sie sich hinter das Lenkrad setzte. Und alles funktionierte.
Das Fahrzeug sprang problemlos an. Der Motor schnurrte wie ein Kätzchen. Auf ihren Befehl wehte aus den Lüftungsschlitzen herrlich warme Luft, die Lampen im Armaturenbrett machten ihr deutlich, dass es keinerlei Probleme mit der Technik gab, und zusätzlich erklärte eine ruhige Stimme, sämtliche Systeme wären betriebsbereit und sie könne fahren.
Eher hätte sie sich in der Hölle schmoren lassen, als offen zuzugeben, dass ihr die zahllosen Marotten ihres alten Fahrzeugs fehlten.
In gemessenem Tempo rollte sie aus der Garage und die gewundene Einfahrt hinunter in Richtung des lautlos für sie zur Seite gleitenden schmiedeeisernen Tors.
Die Straßen in dieser noblen Gegend waren ruhig und sauber, und die Bäume am Rand des großen Parks waren mit diamantglitzerndem Raureif überzogen. Tief im Inneren der Grünanlage brachten sicher irgendwelche Junkies und Knochenbrecher ihr nächtliches Treiben zu einem unglücklichen Abschluss. Hier jedoch gab es nur auf Hochglanz polierte, steinerne Gebäude, breite Alleen und das ruhige Dunkel vor Anbruch des morgendlichen Dämmers.
Sie fuhr unzählige Blocks, ehe sie die erste grell-bunte Anzeigetafel sah. Der rotwangige Weihnachtsmann, der mit seinem breiten Grinsen wirkte wie ein überdimensionaler Waldschrat auf Zeus, flog mit seinem von einer Herde Rentieren gezogenen Schlitten durch den Himmel, brüllte alle paar Sekunden Ho, ho, ho und erinnerte die Menschen daran, wie viele Einkaufstage ihnen bis zum Weihnachtsabend blieben.
»Ja, ja, du feister Hurensohn, ich habe es gehört.« Stirnrunzelnd bremste sie an einer Ampel. Nie zuvor hatte sie sich über Weihnachten Gedanken machen müssen. Es war einzig darum gegangen, irgendeinen Schwachsinn für Mavis aufzutreiben und möglicherweise etwas Essbares für Feeney.
Sonst hatte es in ihrem Leben niemanden gegeben, für den sie hätte Geschenke besorgen und einpacken müssen.
Was zum Teufel kaufte man für einen Mann, der nicht nur alles hatte, sondern obendrein die meisten Fabriken, in denen diese Dinge hergestellt wurden, besaß? Für eine Frau, die lieber in einer handfesten Auseinandersetzung siegte, statt einkaufen zu gehen, war das ein ernsthaftes Problem.
Weihnachten, beschloss sie, als der Weihnachtsmann begann, die verschiedenen Geschäfte in der New Yorker Sky Mall anzupreisen, war schlichtweg ätzend.
Trotzdem wurde ihre Laune besser, als sie am Broadway in den vorhersehbaren Stau geriet. Vierundzwanzig Stunden täglich, sieben Tage in der Woche, wurde hier gefeiert. Auf den Gleitbändern drängten sich Menschen, die fast ausnahmslos betrunken, stoned oder beides waren, und die Schwebegrillbesitzer standen vor Kälte zitternd hinter ihren qualmenden Grills. Hatte ein Verkäufer hier einen Platz ergattert, gab er ihn freiwillig garantiert nicht mehr her.
Sie öffnete das Fenster einen Spaltbreit und sog den Duft von gerösteten Kastanien, Soja-Dogs, Rauch und menschlichen Ausdünstungen in sich ein. Irgendjemand sang eine monotone Weise über den Untergang der Welt. Und als eine Horde Fußgänger bei Rot über die Straße strömte, hupte ein Taxifahrer deutlich lauter, als dem Gesetz zur Lärmvermeidung nach gestattet war. Von oben drang das gut gelaunte Furzen der Airbusse an ihr Ohr, und die ersten Werbeflieger priesen bereits lautstark irgendwelche Waren an.
Eve verfolgte, wie zwei Frauen, Straßendirnen, wie sie annahm, anfingen zu streiten. Die lizensierten Gesellschafterinnen mussten ihr jeweiliges Revier genauso vehement verteidigen wie die Verkäufer von Esswaren und Getränken. Sie überlegte, ob sie ihr Fahrzeug verlassen und dem Streit ein Ende machen sollte, doch in diesem Augenblick verpasste die kleine Blondine ihrer großen rothaarigen Konkurrentin einen gezielten Faustschlag und rannte, Haken schlagend wie ein Kaninchen, durch das Gewühl davon.
Wirklich clever, dachte Eve beifällig, als die Rothaarige sich mühsam wieder hochrappelte, den Kopf schüttelte und einfallsreiche Obszönitäten hinter der Rivalin herkreischte.
Das hier, überlegte Eve zufrieden, das hier ist mein New York.
Mit einem gewissen Bedauern erreichte sie die relativ ruhige Siebte und fuhr zügig weiter Richtung Zentrum. Sie brauchte endlich wieder etwas zu tun. Die Wochen der erzwungenen Ruhe machten sie gereizt. Sie kam sich schwach und nutzlos vor, deshalb hatte sie schon eine Woche früher als vom Arzt empfohlen den erforderlichen Gesundheits-check der Polizei über sich ergehen lassen …
... und gerade man so eben bestanden.
Doch sie hatte ihn bestanden und umgehend die Arbeit wieder aufgenommen. Wenn sie jetzt noch ihren Vorgesetzten davon überzeugen könnte, sie den Dienst am Schreibtisch gegen die Feldarbeit tauschen zu lassen, wäre sie ein rundum zufriedener Mensch.
Mit halbem Ohr lauschte sie auf die Meldung, die gerade aus dem Äther kam. Schließlich finge ihr Dienst ja erst in drei Stunden an.
An alle Einheiten in der Nähe der Siebten, 6843, Appartement 18B. Es wurde ein 1222 gemeldet, der bisher noch nicht bestätigt worden ist. Wenden Sie sich an den Mann in Appartement 2A. An alle Einheiten in der Nähe der...
Ehe die Zentrale die Meldung wiederholen konnte, klinkte Eve sich ein. »Zentrale, hier spricht Lieutenant Eve Dallas. Ich bin zwei Minuten von dem Haus entfernt und fahre sofort hin.«
Verstanden, Lieutenant Dallas. Bitte machen Sie bei Ankunft Meldung.
»Verstanden. Gesprächsende.«
Sie parkte am Straßenrand und musterte das stahlgraue Gebäude. Hinter einigen der Fenster brannten Lichter, in der achtzehnten Etage jedoch war es stockdunkel. Ein 1222 hieß, dass von einem anonymen Anrufer ein Familienstreit gemeldet worden war.
Eve stieg aus ihrem Wagen und legte geistesabwesend die Hand auf die Stelle unter ihrer Schulter, an der sie ihre Waffe trug. Es machte ihr nichts aus, den Tag mit Schwierigkeiten zu beginnen, doch gab es keinen Cop auf Erden, der einem Familienstreit nicht lieber aus dem Weg gegangen wäre.
Es schien nichts zu existieren, was erboste Eheleute lieber taten, als ihren Zorn gegen den armen Kerl zu richten, der versuchte, sie daran zu hindern, sich zum Beispiel wegen der Miete gegenseitig zu ermorden.
Die Tatsache, dass sie die Sache freiwillig übernommen hatte, zeigte, dass sie mit ihrer momentanen Schreibtischarbeit echt unzufrieden war.
Eve joggte die kurze Treppe hinauf zum Eingang und suchte Appartement 2A.
Als der Bewohner argwöhnisch durch den Spion sah, zückte sie ihren Ausweis und hielt ihn ihm, als er die Tür einen winzigen Spalt öffnete, dicht vor die zusammengekniffenen Augen. »Sie haben Probleme?«
»Keine Ahnung. Die Bullen haben bei mir angerufen. Ich bin nur der Hausverwalter. Ich weiß überhaupt nichts.«
»Das ist nicht zu übersehen.« Er roch nach schmutzigen Laken und komischerweise nach Käse. »Ich brauche Zugang zu Appartement 18B.«
»Haben Sie keinen Generalschlüssel dabei?«
»Ja, doch, in Ordnung.« Sie musterte den Mann: klein, mager, ungewaschen und total verängstigt. »Wie wäre es, wenn Sie mir, bevor ich gehe, sagen, wer in der Wohnung lebt?«
»Nur eine allein stehende Frau. Geschieden oder so. Sehr zurückhaltend.«
»Sind sie das nicht alle?«, murmelte Eve so leise, dass er sie nicht verstand. »Hat sie vielleicht auch einen Namen?«
»Hawley. Marianna. Anfang bis Mitte dreißig. Ziemlich hübsch. Lebt seit zirka sechs Jahren hier im Haus. Hat nie irgendwelche Schwierigkeiten gemacht. Hören Sie, ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Ich weiß nicht das Geringste. Es ist, verdammt noch mal, fünf Uhr dreißig morgens. Wenn sie was kaputtgemacht hat, will ich das natürlich wissen. Alles andere geht mich nichts an.«
»Ganz klar«, knurrte Eve, als ihr die Tür vor der Nase zugeknallt wurde. »Kehr zurück in deine Höhle, kleine Ratte.« Sie ließ erneut die Schultern kreisen und zog ihr Handy aus der Tasche. »Hier spricht Lieutenant Eve Dallas. Ich bin in dem Gebäude in der Siebten. Der Hausverwalter ist ein Idiot. Ich melde mich wieder nach dem Gespräch mit Marianna Hawley, der Bewohnerin von Appartement 18B.«
Brauchen Sie Verstärkung?
»Noch nicht. Ende des Gesprächs.«
Sie steckte das Handy ein, fuhr mit dem Fahrstuhl in die achtzehnte Etage, trat dort in den Flur und vergewisserte sich, dass der Korridor durch Überwachungskameras gesichert war. Es herrschte Totenstille. Der Lage und dem Stil des Hauses nach zu urteilen, waren die meisten Bewohner wohl irgendwelche Angestellten und stünden nicht vor sieben auf. Dann tränken sie verschlafen ihren morgendlichen Kaffee, machten sich auf den Weg zur nächsten Airbus- oder U-Bahn-Haltestelle oder klinkten sich von ihrem heimischen Computer aus in die Arbeit ein.
Einige hatten sicher Kinder, die in die Schule gehen müssten. Andere würden ihre Gatten mit einem Kuss verabschieden und sich bereitmachen für den Geliebten.
Lauter ganz normale Leben an einem ganz normalen Ort.
Ihr ging die Frage durch den Kopf, ob das verdammte Haus eventuell ihrem Mann gehörte. Dann jedoch schob sie den Gedanken beiseite und trat vor das Appartement 18B.
Das Sicherheitslicht blinkte grün. Es war also deaktiviert. Instinktiv stellte sich Eve, bevor sie klingelte, ein Stück neben die Tür. Das Fehlen eines Echos machte deutlich, dass die Wohnung schallisoliert war. Nichts von dem, was drin geschähe, dränge je nach außen. Leicht verärgert zog sie ihren Generalschlüssel hervor und schloss auf.
Ehe sie das Appartement betrat, rief sie: »Mrs. Hawley? Ich bin von der Polizei. Uns wurde gemeldet, dass es bei Ihnen einen Streit gegeben hat.« Schließlich wollte sie nicht irgendeine brave Bürgerin aus dem Schlaf jagen, die dann womöglich mit einem selbst gebastelten Stunner oder einem Küchenmesser in der Hand auftauchte.
»Licht«, befahl sie, und die Deckenlampe im Wohnzimmer flammte auf.
Es war ein durchaus hübscher Raum. Weiche Farben, schlichte Linien, und im Fernsehen lief ein alter Videofilm, in dem sich zwei unglaublich attraktive Menschen nackt auf einem mit Rosenblüten übersäten Laken wälzten und theatralisch stöhnten.
Auf dem Tisch vor dem langen, rauchig grünen Sofa standen neben einer mit bis zum Rand von gezuckertem Fruchtgummi gefüllten Schale silberne und rote, hübsch auf verschiedene Höhen abgebrannte Kerzen.
Es roch nach Moosbeere und Pinie.
Der Pinienduft stammte von einem kleinen, perfekt geformten Baum, der vor einem der Fenster auf der Seite lag. Die festliche Beleuchtung und die süßen Engelsornamente waren geborsten, die Schleifen zerrissen und die zahlreichen weihnachtlich verpackten Geschenkschachteln darunter zerdrückt.
Eve zückte ihre Waffe.
Im Wohnzimmer gab es keine weiteren Zeichen von Gewalt. Das Paar auf dem Bildschirm erreichte mit gleichzeitigem Stöhnen seinen Höhepunkt, und Eve schob sich mit gespitzten Ohren an dem Fernseher vorbei.
Von irgendwoher hörte sie Musik. Leise, fröhlich, gleichförmig. Sie kannte das Lied nicht, wusste aber, dass es eine der nervtötenden Weihnachtsweisen war, die es bereits seit Wochen allerorten zu ertragen galt.
Sie schwenkte ihre Waffe in Richtung eines kurzen Flurs. Zwei Türen, beide offen. Hinter einer sah sie ein Waschbecken, eine Toilette, den Rand einer Wanne, alles schimmernd weiß. Den Rücken an der Wand, glitt sie zu der zweiten Tür, hinter der noch immer dieselbe Melodie erklang.
Sie roch den frischen Tod. Fruchtig und gleichzeitig metallisch. Schob die Tür vorsichtig bis zum Anschlag auf und stand ihm direkt gegenüber.
Mit wachem Blick schwang sie ihre Waffe nach rechts, dann nach links und betrat danach erst den Raum. Sie wusste, sie war mit dem Wesen, das Marianna Hawley gewesen war, allein, und trotzdem sah sie in den Schrank, hinter die Vorhänge und durchsuchte auch den Rest der Wohnung, ehe sie den Stunner endlich sinken ließ und dichter an das Bett trat.
2A hatte Recht gehabt, war ihr erster Gedanke. Marianna war attraktiv gewesen. Keine auffallende Schönheit, doch eine hübsche Frau mit dunkelgrünen Augen und weichem braunem Haar. Noch hatte ihr der Tod das nette Aussehen nicht geraubt.
Wie die Augen allzu vieler Toter waren auch die ihren schreckgeweitet. Ihre bleichen Wangen waren dezent gepudert, die Wimpern nachgedunkelt und die Lippen in einem festlichen Kirschrot bemalt. Direkt über dem rechten Ohr war eine kleine Spange in ihrem Haar befestigt – ein kleiner glitzernder Baum, in dessen silbernem Geäst ein plumper vergoldeter Vogel saß.
Mit der kunstvoll um ihren nackten Körper geschlungenen silbernen Girlande hatte ihr Mörder sie offenbar erwürgt.
Doch nicht nur am Hals fanden sich Würgemale, sondern ebenso an beiden Handgelenken sowie an den Knöcheln, was vermuten ließ, dass Marianna noch genügend Zeit geblieben war, um sich zu wehren.
Aus der Stereoanlage direkt neben dem Bett wünschte ihnen ein gut gelaunter Sänger eine frohe Weihnacht.
Seufzend griff Eve nach ihrem Handy. »Zentrale, hier spricht Lieutenant Eve Dallas. Ich habe eine Tote.«
»Was für eine Art, den Tag zu beginnen.« Officer Peabody unterdrückte ein Gähnen, während sie das Opfer mit ihren dunklen Polizistinnenaugen maß. Trotz der frühen Stunde hatte ihre Uniform nirgends auch nur die kleinste Falte und war ihr dunkler Pagenschnitt tadellos frisiert.
Das Einzige, was darauf hinwies, dass sie unsanft aus dem Bett gerissen worden war, war ihre zerknitterte linke Wange.
»Was für eine Art, ihn zu beenden«, antwortete Eve. »Die erste Untersuchung deutet darauf hin, dass der Tod fast auf die Minute genau um vierundzwanzig Uhr eingetreten ist.« Sie trat einen Schritt zur Seite und ließ den Pathologen an sich vorbei. »Vermutlich Tod durch Strangulieren. Das Fehlen von Defensivverletzungen weist darauf hin, dass das Opfer, nachdem es gefesselt war, keine Gegenwehr mehr geleistet hat.«
Eve untersuchte sanft die abgeschabte Haut an Mariannas linkem Knöchel. »Vaginale und anale Abschürfungen legen die Vermutung nahe, dass sie vor ihrer Ermordung sexuell misshandelt worden ist. Die Wohnung ist schallisoliert. Sie hätte sich also die Lunge aus dem Hals schreien können, und niemand hätte es gehört.«
»Ich habe nirgends Anzeichen dafür gefunden, dass jemand gewaltsam in das Appartement eingedrungen ist, und der einzige Hinweis auf einen möglichen Kampf ist der umgestürzte Baum. Der meiner Meinung nach mit Absicht umgeworfen worden ist.«
Eve nickte. »Gut beobachtet, Peabody. Und jetzt gehen Sie zu dem Mann in Appartement 2A und besorgen sich die Überwachungsdisketten aus dieser Etage. Wollen wir doch mal sehen, wer gestern Abend hierher zu Besuch gekommen ist.«
»Sofort.«
»Schicken Sie außerdem ein paar Beamte los, die die übrigen Hausbewohner befragen«, fügte Eve hinzu und trat vor das Tele-Link neben dem Bett. »Und mach endlich jemand die verdammte Musik aus.«
»Klingt nicht gerade, als ob Sie in Weihnachtsstimmung wären.« Peabody drückte mit einem versiegelten Finger auf den Aus-Knopf der Stereoanlage. »Madam.«
»Weihnachten ist rundum ätzend. Sind Sie hier fertig?«, fragte sie den Pathologen. »Dann lassen Sie sie uns noch umdrehen, bevor sie eingetütet wird.«
Das Blut hatte sich in der tiefsten Körperstelle angesammelt, und so leuchtete Mariannas Hintern in einem widerlichen Rot. Im Sterben hatte sie noch Blase und Gedärm entleert.
Ebenfalls mit versiegelten Händen betastete Eve die wächsern graue Haut.
»Das hier sieht frisch aus«, murmelte sie leise. »Peabody, nehmen Sie das auf, bevor Sie runtergehen.« Sie studierte die leuchtende Tätowierung auf dem rechten Schulterblatt der Toten.
»Meine große Liebe.« Beim Anblick der leuchtend roten altmodischen Schrift auf dem kreidebleichen Fleisch spitzte Peabody die Lippen.
»Sieht aus wie eine dieser Tätowierungen, die sich wieder entfernen lassen.« Eve beugte sich so dicht über die Tote, dass sie beinahe mit der Nase gegen ihre Schulter stieß, und schnupperte. »Ziemlich frisch. Wir müssen überprüfen, ob sie vor kurzem in irgendeinem Schönheitssalon gewesen ist.«
»Rebhuhn im Birnbaum.«
Eve richtete sich auf und musterte ihre Assistentin mit hochgezogenen Brauen. »Was?«
»In ihren Haaren, die Spange in ihren Haaren. Am ersten Tag der Weihnacht.« Als Eve sie noch immer ratlos ansah, schüttelte Peabody den Kopf. »Das ist ein altes Weihnachtslied, Lieutenant. ›Die zwölf Tage der Weihnacht‹. Der Typ in dem Lied macht seiner großen Liebe jeden Tag ein anderes Geschenk, und das erste ist ein Rebhuhn im Birnbaum.«
»Was zum Teufel soll man mit einem Vogel, der in einem Baum sitzt? Schwachsinniges Geschenk.« Gleichzeitig jedoch kam ihr ein schrecklicher Verdacht. »Wollen wir nur hoffen, dass sie seine einzige große Liebe gewesen ist. Holen Sie mir die Disketten, und packen Sie sie ein«, befahl sie Peabody sowie dem Pathologen und bückte sich erneut über das Link.
Während man die Tote aus der Wohnung transportierte, rief sie sämtliche in den letzten vierundzwanzig Stunden geführten Telefongespräche ab.
Als Erstes hatte knapp nach achtzehn Uhr Mariannas Mutter angerufen, und die beiden hatten sich fröhlich unterhalten. Eve lauschte dem Gespräch, blickte in das lachende Gesicht der Mutter und dachte, wie dieses Gesicht aussehen würde, wenn sie anrief, um der Frau zu sagen, dass ihre Tochter nicht mehr lebte.
Das einzige andere Gespräch hatte Marianna von sich aus unternommen. Gut aussehender Knabe, dachte Eve, als das Bild auf dem Monitor erschien. Mitte dreißig, mit einem netten Lächeln und warmen, braunen Augen. Jerry hatte das Opfer ihn genannt. Oder Jer. Es hatte jede Menge sexueller Anspielungen gegeben, sie hatten viel miteinander gescherzt. Er war also ein Liebhaber gewesen. Vielleicht ihre große Liebe.
Eve nahm die Diskette aus dem Link, versiegelte sie, steckte sie in die Tasche, entdeckte auf dem Tisch unter dem Fenster neben Mariannas Handy und Terminkalender ein Adressbuch und machte nach kurzer Durchsicht den Namen Jeremy Vandoren darin aus.
Dann trat sie erneut vor das Bett. Das blutbefleckte Laken war am Fußende zerknüllt. Die Kleider, die dem Opfer sorgfältig vom Leib geschnitten und auf den Boden geworfen worden waren, steckten bereits in einem Sack.
In der Wohnung herrschte totale Stille.
Sie hatte ihn hereingelassen, überlegte Eve. Hatte ihm die Tür geöffnet. War sie freiwillig mit ihm ins Schlafzimmer gekommen oder hatte er sie hierher verschleppt? Die toxikologische Untersuchung würde zeigen, ob sie betäubt gewesen war.
Im Schlafzimmer hatte er sie an Händen und Füßen gefesselt, sie mit gespreizten Gliedern vor sich ausgebreitet und wahrscheinlich die Fesseln um die Bettpfosten geschlungen.
Dann hatte er ihre Kleider aufgeschnitten. Vorsichtig und ohne jede Eile. Weder im Zorn noch auch nur in irgendeinem verzweifelten Verlangen. Mit Berechnung, ordentlich, geplant. Dann hatte er sie vergewaltigt, einfach, weil er die Macht dazu besessen hatte, weil er dazu in der Lage gewesen war.
Sie hatte sich gewehrt, geschrien und wahrscheinlich gefleht. Er hatte es genossen, hatte sich daran ergötzt. Vergewaltiger genossen das Elend und die Ohnmacht ihrer Opfer, dachte sie und atmete, da ihre Gedanken zu ihrem Vater wandern wollten, so tief wie möglich durch.
Als er fertig gewesen war, hatte er sie erwürgt und ihr, während ihr die Augen aus dem Kopf gequollen waren, ins Gesicht gesehen. Dann hatte er sie gekämmt, geschminkt und die festliche Silbergirlande um ihren Leib drapiert. Hatte er die Spange mitgebracht oder hatte sie ihr gehört? Hatte sie sich die Tätowierung selbst aufmalen lassen oder hatte er ihren Körper dergestalt verziert?
2
»Haben Sie die Linknummer des Freundes überprüft?«
»Ja, Madam. Jeremy Vandoren, wohnhaft in der Zweiten, arbeitet bei Foster, Bride und Rumsey an der Wall Street.« Peabody spähte auf ihren Notizblock und fuhr entschlossen fort: »Geschieden, augenblicklich allein stehend, sechsunddreißig. Und obendrein ein äußerst attraktives Exemplar der Gattung Mann.«
»Hmm.« Eve schob die Überwachungsdiskette in den Schlitz ihres Computers. »Wollen wir doch mal sehen, ob dieses äußerst attraktive Exemplar gestern Abend bei seiner Freundin zu Besuch gewesen ist.«
»Kann ich Ihnen einen Kaffee holen, Lieutenant?«
»Was?«
»Ich habe gefragt, ob ich Ihnen einen Kaffee holen kann?«
Eve blickte mit zusammengekniffenen Augen auf den Bildschirm. »Wenn Sie einen Kaffee wollen, Peabody, dann brauchen Sie es bloß zu sagen.«
Hinter ihrem Rücken verdrehte Peabody die Augen. »Ich hätte gerne einen Kaffee.«
»Dann holen Sie sich einen – und bringen Sie mir, wenn Sie schon mal dabei sind, bitte einen mit. Das Opfer kam um sechzehn Uhr fünfundvierzig nach Hause. Pause«, befahl Eve ihrem Computer und sah sich Marianna Hawley an.
Schlank, hübsch, jung, mit einem leuchtend roten Beret auf den schimmernd braunen Haaren, das zu ihrem weich fließenden Mantel passte und zu den auf Hochglanz polierten Stiefeln.
»Sie war einkaufen«, bemerkte Peabody und stellte einen Kaffeebecher neben Eves Ellbogen auf den Schreibtisch.
»Ja. Bei Bloomingdale’s. Diskette weiter«, meinte Eve und verfolgte, wie Marianna ihre Tüten auf den Boden stellte und den Schlüssel in die Hand nahm. Sie bewegte ihre Lippen. Führte Selbstgespräche. Nein, erkannte Eve, sie sang. Dann schüttelte sich Marianna das Haar aus dem Gesicht, griff nach ihren Tüten, trat durch die Tür der Wohnung, warf sie hinter sich ins Schloss.
Und zum Zeichen dafür, dass sie abgeschlossen hatte, begann das rote Licht neben der Tür zu blinken.
Die Diskette lief weiter, und Eve sah andere Hausbewohner allein oder zu zweit kommen oder gehen. Lauter Zeugnisse ganz normaler Leben.
»Sie ist nicht noch einmal ausgegangen«, erklärte sie ihrer Assistentin und blickte mit ihrem geistigen Auge ins Innere der Wohnung.
Sie sah, wie Marianna in der schlichten marineblauen Hose und dem weißen Pullover, was ihr später alles vom Leib geschnitten werden würde, durch die Zimmer lief.
Sie schaltete das Fernsehen an, hängte ihren leuchtend roten Mantel in den Flurschrank, legte das Beret ins Regal, stellte die Stiefel auf den Boden, räumte die Einkäufe fort.
Sie war eine ordentliche Frau gewesen, die hübsche Dinge mochte, und sich auf einen ruhigen Abend zu Hause vorbereitet hatte.
»Hat sich ihrem AutoChef zufolge gegen sieben eine Suppe heiß gemacht.« Eve trommelte mit ihren kurzen, nicht lackierten Fingernägeln auf die Platte ihres Schreibtischs. »Wurde von ihrer Mutter angerufen und rief dann selbst bei ihrem Freund an.«
Während sie in Gedanken die Reihenfolge dieser Tätigkeiten durchging, sah sie, wie die Tür des Fahrstuhls aufglitt, und zog die Brauen derart hoch, dass sie unter ihrem Pony verschwanden. »Aber hallo, ho, ho, ho, wen haben wir denn da?«
»Den Weihnachtsmann.« Grinsend beugte sich Peabody über ihre Schulter. »Und er hat sogar Geschenke mitgebracht.«
Der Mann in dem roten Anzug und mit dem leuchtend weißen Bart hielt eine große, in Silberpapier gehüllte und mit einer grün-goldenen Schleife hübsch verzierte Schachtel in der Hand.
»Moment mal. Pause. Vergrößerung Abschnitte zehn bis fünfzig um dreißig Prozent.«
Der Bildschirm erwachte zu neuem Leben, und der von Eve genannte Abschnitt trat aus dem übrigen Bild hervor. In der hübschen Schleife steckte eine Spange – ein fetter vergoldeter Vogel auf einem versilberten Baum.
»Dieser Hurensohn. Verdammt, das ist das Ding, das Marianna in den Haaren hatte.«
»Aber... das ist der Weihnachtsmann.«
»Reißen Sie sich zusammen, Peabody. Diskette weiter. Er geht in Richtung ihrer Tür«, murmelte Eve und verfolgte, wie die fröhliche Gestalt mit ihrem schimmernden Paket vor Mariannas Wohnung trat. Dort legte sie einen behandschuhten Finger auf die Klingel, wartete einen Moment, warf den Kopf zurück und lachte. Eine Sekunde später kam Marianna mit glühenden Wangen an die Tür, sah den Besucher mit vor Freude blitzenden Augen an, strich sich die Haare aus der Stirn und trat einladend einen Schritt zur Seite.
Santa warf einen kurzen Blick über die Schulter, blickte direkt in die Kamera, verzog den Mund zu einem Lächeln und wandte sich dann zwinkernd wieder ab.
»Halt. Dieser Bastard. Dieser elendige Bastard. Computer, ich brauche einen Ausdruck von dem Bild«, befahl sie und studierte eingehend das runde, rotwangige Gesicht mit den leuchtend blauen Augen. »Er wusste, dass wir die Disketten durchgehen und ihn sehen würden. Es hat ihn amüsiert.«
»Er hat sich als Weihnachtsmann verkleidet.« Immer noch starrte Peabody mit großen Augen auf den Bildschirm. »Das ist widerwärtig. Das ist einfach... nicht richtig.«
»Was? Hätten Sie es angemessener gefunden, wenn er als Satan verkleidet dort erschienen wäre?«
»Ja – nein.« Peabody trat von einem Bein aufs andere und zuckte mit den Schultern. »Es ist einfach... tja, es ist einfach krank.«
»Und zugleich wirklich clever.« Eve wartete, bis das Bild des Täters aus dem Drucker kam. »Den Weihnachtsmann lässt jeder rein. Diskette, weiter.«
Die Tür klappte hinter beiden zu, und der Flur blieb menschenleer.
Der unten im Bild eingeblendeten Uhr zufolge war es drei Minuten nach halb zehn.
Er hatte sich also Zeit gelassen, dachte Eve, fast zweieinhalb Stunden. Das Seil, mit dem er sie gefesselt hatte, und alles andere, was von ihm verwendet worden war, hatte er sicher in der großen, hübsch verpackten Schachtel mitgebracht.
Um elf kam ein lachendes Pärchen aus dem Fahrstuhl und lief Arm in Arm an Mariannas Wohnungstür vorbei. Ohne auch nur zu ahnen, dass genau zur gleichen Zeit hinter eben dieser Tür ein Mensch Furcht und Schmerzen auszustehen hatte, dass seine letzte Stunde angebrochen war.
Kurz nach halb eins wurde die Tür wieder geöffnet. Der Mann in dem roten Anzug trat, unverändert die Silberbox in seinen Händen, lächelnd in den Flur. Noch einmal sah er in die Überwachungskamera, dieses Mal jedoch blitzte in seinen Augen ein unheilvoller Wahn.
Tänzelnd bewegte er sich auf den Fahrstuhl zu.
»Kopie der Diskette für die Akte Hawley. Aktenzeichen 25176-H. Peabody, wie viele Weihnachtstage gibt es, haben Sie gesagt? Ich meine in dem Lied.«
»Zwölf.« Peabody benetzte ihre trockene Kehle mit einem Schluck ihres Kaffees. »Zwölf.«
»Wir müssen umgehend herausfinden, ob Marianna Hawley seine große Liebe war – oder ob er noch elf andere Menschen liebt.« Eve stand entschieden auf. »Los, sprechen wir mit ihrem Freund.«
Jeremy Vandoren arbeitete in einem winzigen Eckchen innerhalb eines riesigen Büros. Der Platz reichte gerade für seinen Computer, die Telefonanlage und einen Schreibtisch auf drei Rollen. Hinter ihm an der Stellwand waren Börsenberichte, ein Theaterprogramm, eine Weihnachtskarte mit einer üppigen, einzig mit strategisch günstig platzierten Schneeflocken bekleideten Blondine und ein Foto von Marianna Hawley festgepinnt.
Als Eve vor seinen Schreibtisch trat, hob er statt des Kopfs die Hand und hämmerte weiter auf das Keyboard seines Computers ein, während er zugleich, ohne auch nur Luft zu holen, in ein Headset sprach.
»Comstat steht weiter auf fünf ein achtel, Kenmart ist um drei dreiviertel gesunken. Nein, Roarke Industries hat gerade einen Sprung um sechs Punkte nach oben gemacht. Unsere Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen bis Ende des Tages um weitere zwei Punkte steigt.«
Eve zog eine Braue in die Höhe und stopfte die Hände in die Taschen ihrer Hose. Sie stand hier, um über einen Mord zu sprechen, und Roarke machte Millionen.
Es war wirklich verrückt.
»Fertig.« Vandoren drückte abermals auf eine Taste. Auf dem Monitor erschien ein Labyrinth aus Zahlen und Symbolen, und Eve ließ ihn noch dreißig Sekunden spielen, ehe sie ihren Ausweis zückte und ihm direkt vor das Gesicht hielt.
Er blinzelte verwirrt, wandte dann jedoch den Kopf und sah sie endlich an. »Verstanden. Sie sind fest entschlossen. Absolut. Danke.« Mit einem leicht nervösen Lächeln schob er das Mikrofon des Headsets an die Seite. »Hm, Lieutenant, was kann ich für Sie tun?«
»Jeremy Vandoren?«
»Ja.« Seine dunkelbraunen Augen blickten an ihr vorbei auf ihre Assistentin und dann wieder auf sie. »Bin ich in irgendwelchen Schwierigkeiten?«
»Haben Sie denn etwas Verbotenes getan, Mr. Vandoren?«
»Nicht, dass ich wüsste.« Wieder versuchte er zu lächeln, und in seinem Mundwinkel erschien ein kleines, verführerisches Grübchen. »Abgesehen von dem Schokoriegel, den ich im Alter von acht Jahren mal habe mitgehen lassen, fällt mir spontan nichts ein.«
»Kennen Sie Marianna Hawley?«
»Marianna, sicher. Erzählen Sie mir bloß nicht, Marianna hätte ebenfalls einen Schokoriegel geklaut.« Dann jedoch, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, schwand das unbeschwerte Lächeln aus seinem Gesicht. »Was ist los? Ist etwas passiert? Ist mit ihr alles in Ordnung?«
Er sprang von seinem Stuhl und blickte über den Rand der Stellwand, als erwarte er, Marianna dahinter zu sehen.
»Mr. Vandoren, es tut mir Leid.« Eve hatte auch nach Jahren noch keinen guten Weg gefunden, um diese schlimme Nachricht zu überbringen, und so sprach sie den grauenhaften Satz so schnell wie möglich aus. »Ms. Hawley ist tot.«
»Nein, das ist sie nicht. Nein«, beharrte er und starrte Eve mit seinen dunklen Augen an. »Das ist sie nicht. Das ist einfach absurd. Ich habe erst gestern Abend noch mit ihr geredet. Wir treffen uns um sieben zum Essen. Sie ist okay. Ihnen ist eindeutig ein Irrtum unterlaufen.«
»Es ist kein Irrtum. Tut mir Leid«, wiederholte sie, als er sie wie paralysiert ansah. »Marianna Hawley wurde gestern Abend in ihrer Wohnung ermordet.«
»Marianna? Ermordet?« Er schüttelte langsam den Kopf, als ergäben diese beiden Worte für ihn nicht den geringsten Sinn. »Das ist eindeutig falsch. Das kann nur falsch sein.« Er wirbelte herum und griff nach dem Hörer seines Tele-Links. »Ich werde sie auf der Stelle anrufen. Sie werden sehen, wie jeden Tag um diese Zeit ist sie im Büro.«
»Mr. Vandoren.« Eve legte eine Hand auf seine Schulter und drückte ihn auf seinen Stuhl. Für sie gab es keinen Platz zum Sitzen, und so hockte sie sich, um nicht von oben auf ihn herabsehen zu müssen, auf die Kante seines Schreibtischs. »Sie wurde anhand von ihren Fingerabdrücken und per DNA-Analyse identifiziert. Wenn Sie meinen, dass Sie es schaffen, hätte ich es gern, dass Sie mich begleiten und Sie persönlich identifizieren.«
»Persönlich...« Erneut sprang er auf und stieß dabei unsanft mit dem Ellenbogen gegen ihre immer noch nicht ganz verheilte Schulter. »Ja. Ich komme mit. Ich komme sogar ganz sicher mit. Weil sie es nicht ist. Es ist ganz bestimmt nicht Marianna.«
Das Leichenschauhaus war zu keiner Zeit ein froher Ort. Die roten und grünen Weihnachtskugeln sowie das hässlich goldene Lametta, die entweder von einem unverbesserlichen Optimisten oder aber von jemandem mit Sinn fürs Makabre unter der Decke und in den Türrahmen befestigt worden waren, verstärkten das Gefühl, als würde hier hämisch über den Tod gegrinst.
Eve stand wie schon allzu oft in ihrem Leben vor dem Fenster, durch das man in einen der Räume sah. Und spürte, wie ebenfalls schon allzu oft, fast körperlich den Schock des Mannes neben sich, als dieser den geliebten Menschen auf der anderen Seite dieses Fensters liegen sah.
Der Toten war eilig ein Laken übergeworfen worden. Damit Freunden, Verwandten und anderen, die sie liebten, wenigstens der Anblick ihrer jämmerlichen Nacktheit, der ihr mit dem Y-Einschnitt zugefügten Wunde und des abwaschbaren Stempels auf der Innenseite ihres Schenkels, der dem Opfer einen Namen und eine Nummer gab, erspart blieb.
»Nein.« Hilflos presste Vandoren beide Hände gegen die Scheibe, die ihn von seiner Liebsten trennte. »Nein, nein, nein, das kann nicht wahr sein. Marianna.«
Eve nahm ihn sanft am Arm. Er zitterte wie Espenlaub, ballte die Hände zu Fäusten und trommelte leicht gegen das Glas. »Nicken Sie nur, wenn Sie die Tote als Marianna Hawley identifizieren.«
Er nickte. Und begann zu weinen.
»Peabody, finden Sie ein leer stehendes Büro. Und holen Sie ihm ein Glas Wasser.«
Noch während Eve dies sagte, schlang er ihr die Arme um den Leib, presste sein Gesicht an ihre Schulter und sackte unter dem Gewicht der Trauer schlaff in sich zusammen.
Eve bedeutete dem Mann hinter der Scheibe, den Sichtschutz hochzufahren, und blieb still stehen.
»Kommen Sie, Jerry, kommen Sie bitte mit.« Mit dem Gedanken, dass sie lieber einen Schuss aus einem Stunner abbekäme als der Trauer eines Menschen ausgeliefert zu sein, legte sie einen Arm um seine Schulter und führte ihn fort. Für diese Menschen gab es keine Hilfe. Es gab weder ein Zaubermittel noch eine Medizin, und so dirigierte sie ihn leise murmelnd den gefliesten Korridor hinunter in Richtung einer von ihrer Assistentin aufgehaltenen Tür.
»Den Raum hier können wir benutzen«, sagte Peabody mit leiser Stimme. »Und jetzt hole ich das Wasser.«
»Wir sollten uns setzen.« Eve half Jeremy auf einen Stuhl, fischte ein Taschentuch aus seiner Anzugjacke und drückte es ihm in die Hand. »Tut mir Leid«, sagte sie wie immer und spürte, ebenfalls wie immer, wie unzulänglich diese Worte waren.
»Marianna. Wer hat Marianna so was angetan? Und vor allem: Warum?«
»Das herauszufinden ist mein Job. Und Sie können mir glauben, ich finde es heraus.«
Etwas in der Art, in der sie diese Sätze sagte, brachte ihn dazu, ihr ins Gesicht zu sehen. Seine Augen waren rot, verquollen und verzweifelt, und er atmete mit großer Mühe ein und aus. »Ich – sie war ein ganz besonderer Mensch.« Er zog eine kleine Samtschachtel aus seiner Tasche. »Das hier hatte ich ihr heute Abend geben wollen. Eigentlich hatte ich es für Weihnachten geplant – Marianna hat Weihnachten geliebt -, aber dann habe ich es mir anders überlegt. Noch so lange zu warten hätte ich nicht ausgehalten.«
Mit zitternden Händen klappte er das Kästchen auf und hielt Eve den mit einem blitzenden Diamanten besetzten Verlobungsring dicht vor das Gesicht. »Ich wollte sie heute Abend bitten, meine Frau zu werden. Sie hätte ja gesagt. Wir haben einander geliebt. War es...« Vorsichtig klappte er die Schachtel wieder zu und schob sie zurück in seine Tasche. »Ist es ein Raubüberfall gewesen?«
»Das glauben wir nicht. Wie lange haben Sie sie gekannt?« »Sechs Monate, fast sieben.« Als Peabody mit einem Wasserbecher kam, sagte er danke, nahm ihr den Becher ab, hielt ihn jedoch lediglich, ohne einen Schluck zu trinken, krampfhaft in der Hand. »Es waren die glücklichsten sechs Monate in meinem Leben.«
»Wie haben Sie sich kennen gelernt?«
»Über Personally Yours. Eine Partnervermittlungsagentur.«
»Sie sind Kunde bei einer Vermittlungsagentur?«, fragte Peabody mit überraschter Stimme.
Er zuckte mit den Schultern. »Das war eine spontane Idee. Ich verbringe die meiste Zeit im Büro und komme nur selten vor die Tür. Seit ein paar Jahren bin ich geschieden, und ich schätze, seither bin ich Frauen gegenüber ein wenig nervös. Tja, keine der Frauen, die ich irgendwo getroffen habe... bei keiner hat es geklickt, und dann habe ich eines Abends die Anzeige dieser Partnervermittlung im Fernsehen gesehen und gedacht, das sollte ich vielleicht mal probieren. Schaden könnte es ja nicht.«
Jetzt nahm er einen vorsichtigen Schluck von seinem Wasser, und man konnte deutlich sehen, wie er schluckte. »Marianna war die dritte der ersten fünf Frauen, die mir vermittelt wurden. Mit den ersten beiden habe ich mich auf einen Drink getroffen, doch es blieb bei oberflächlichen Gesprächen. Als ich aber Marianna traf, hat es sofort zwischen uns beiden gefunkt.«
Er schloss die Augen und rang mühsam um Fassung. »Sie ist einfach ein... wunderbarer Mensch. So energiegeladen und so enthusiastisch. Sie hat ihre Arbeit geliebt, ihre Wohnung und die Theatergruppe, in der sie mitspielt. Sie macht manchmal beim Laientheater mit.«
Mal sprach er in der Vergangenheit, mal in der Gegenwart von der geliebten Frau. Sein Verstand versuchte, sich daran zu gewöhnen, dass es sie nicht mehr gab, was ihm jedoch noch nicht vollständig gelang.
»Sie sind also öfter miteinander ausgegangen«, drängte Eve mit sanfter Stimme.
»Ja. Wir waren darin übereingekommen, uns weiter ab und zu auf einen Drink zu treffen, um uns besser kennen zu lernen. Dann sind wir zusammen essen gegangen und manchmal ins Café. Wir haben uns stundenlang miteinander unterhalten. Bereits nach dem ersten Abend hat keiner von uns beiden noch irgendwelche anderen Verabredungen getroffen. Wir wussten sofort, wir hatten den, beziehungsweise die, Richtige erwischt.«
»Und Marianna hat das ebenso gesehen?«
»Ja. Trotzdem sind wir die Sache behutsam angegangen, sind ein paar Mal miteinander Essen gewesen oder im Theater. Wir beide lieben das Theater. Dann haben wir angefangen, die Samstagnachmittage miteinander zu verbringen. Bei einer Matinee, in einem Museum oder mit einem Spaziergang. Außerdem sind wir in ihre Heimatstadt gefahren, damit ich ihre Familie kennen lernen konnte. Am vierten Juli. Und sie hat auch meine Familie kennen gelernt. Meine Mutter hat für uns gekocht.«
Sein Blick wurde verhangen, als er auf etwas starrte, was nur er alleine sah.
»Und während dieser ganzen Zeit hat sie niemand anderen gesehen?«
»Nein. Wir hatten eine feste Beziehung.«
»Wissen Sie, ob sie von jemandem belästigt worden ist – einem ehemaligen Freund oder Geliebten oder vielleicht von ihrem Ex-Mann?«
»Nein, ich bin sicher, davon hätte sie mir erzählt. Wir haben uns ständig unterhalten und keine Geheimnisse voreinander gehabt.« Sein Blick wurde wieder klar. »Warum wollen Sie das wissen? Wurde sie – wurde Marianna... hat er... O Gott.« Er ballte eine Hand zur Faust. »Er hat sie vorher vergewaltigt, oder? Dieser verdammte Bastard hat sie vergewaltigt. Ich hätte bei ihr sein sollen.« Er warf den Becher durch das Zimmer und sprang erschüttert auf die Beine. »Ich hätte dort sein sollen. Wenn ich bei ihr gewesen wäre, wäre all das nie passiert.«
»Wo waren Sie, Jerry?«
»Was?«
»Wo waren Sie gestern Abend zwischen einundzwanzig Uhr dreißig und vierundzwanzig Uhr?«
»Sie denken, ich -« Er unterbrach sich, hob eine Hand, schloss die Augen, atmete tief durch und schlug die Augen wieder auf. »Schon gut. Um den Täter finden zu können, müssen Sie ausschließen, dass ich selbst es war. In Ordnung. Schließlich tun Sie es für sie.«
»Genau.« Eve sah ihm ins Gesicht und empfand schmerzliches Mitgefühl mit diesem unglücklichen Mann. »Wir tun es für sie.«
»Ich war zu Hause, in meinem Appartement. Ich habe etwas gearbeitet, ein paar Telefongespräche geführt, ein paar Weihnachtsgeschenke über das Internet bestellt. Außerdem habe ich die Reservierung für den Tisch für heute Abend noch einmal bestätigt. Ich war total nervös. Ich wollte -« Er räusperte sich leise. »Ich wollte, dass es perfekt wird. Dann habe ich meine Mutter angerufen.« Er fuhr sich mit beiden Händen durchs Gesicht. »Ich musste es jemandem erzählen. Sie war völlig aus dem Häuschen, weil sie total begeistert von Marianna war. Ich glaube, das war gegen zehn Uhr dreißig. Sie können die Aufzeichnungen meines Links, meinen Computer, alles überprüfen.«
»Okay, Jerry.«
»Haben Sie – ihre Familie, weiß sie schon Bescheid?«
»Ja, ich habe mit ihren Eltern gesprochen.«
»Ich muss sie anrufen. Sie werden sie nach Hause kommen lassen wollen.« Wieder stiegen ihm Tränen in die Augen, doch während sie lautlos über seine Wangen rannen, erklärte er entschieden: »Ich werde sie nach Hause bringen.«
»Ich werde dafür sorgen, dass sie so bald wie möglich freigegeben wird. Können wir jemanden für Sie anrufen?«
»Nein. Ich muss es meinen Eltern sagen. Ich muss los.« Er wandte sich zum Gehen und sagte, ohne sich noch einmal umzudrehen: »Sie finden heraus, wer das getan hat. Sie finden heraus, wer sie derart verletzt hat.«
»Ich finde es heraus. Jerry, eine letzte Frage noch.«
Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und wandte sich ihr erneut zu. »Ja?«
»Hatte Marianna eine Tätowierung?«
Das kurze, harsche Lachen, das er ausstieß, schien ihm die Kehle aufzureißen. »Marianna? Nein. Sie war eine altmodische Frau, sie hätte noch nicht mal eine ablösbare Tätowierung je gewollt.«
»Da sind Sie sich ganz sicher?«
»Wir waren ein Paar, Lieutenant. Wir haben uns geliebt. Ich kannte ihren Körper, ihre Gedanken und ihr Herz.«
»Okay. Danke.« Sie wartete, bis er gegangen und die Tür mit einem leisen Klick hinter ihm ins Schloss gefallen war. »Und, Peabody, welchen Eindruck hatten Sie?«
»Es wirkte, als wäre dem armen Kerl das Herz aus der Brust gerissen worden.«
»Das sehe ich genauso. Aber Menschen bringen oft die Menschen um, die sie am meisten lieben. Selbst wenn die von ihm geführten Telefongespräche aufgezeichnet worden sind, ist sein Alibi eher schwach.«
»Er sieht kein bisschen aus wie der Weihnachtsmann.«
Eve verzog den Mund zu einem leichten Lächeln. »Ich garantiere Ihnen, dass der Mensch, der sie getötet hat, ebenso wenig danach aussieht. Andernfalls hätte er nicht so bereitwillig für die Kamera posiert. Mit einem Kissen unter dem Kostüm, einer falschen Augenfarbe, Schminke, einem falschen Bart und einer Perücke kann jeder aussehen wie der Weihnachtsmann.«
Vorläufig jedoch musste sie sich auf ihren Instinkt verlassen, und so sagte sie: »Er ist es nicht gewesen. Gucken wir, wo sie gearbeitet und was für Freunde und vor allem Feinde sie gehabt hat.«
Freunde, dachte Eve ein paar Stunden später, hatte Marianna beinahe im Überfluss gehabt. Feinde hingegen überhaupt nicht.
Das Bild, das von ihr gezeichnet worden war, war das einer glücklichen, umgänglichen Frau, die ihre Arbeit liebte, eine enge Bindung an die Familie hatte und trotzdem das Tempo und die Aufregung des Lebens in der Großstadt genossen hatte.
Sie hatte eine Reihe enger Freundinnen gehabt, eine Schwäche für ausgedehnte Einkaufsbummel, eine innige Liebe zum Theater und allen Befragten zufolge eine glückliche Beziehung zu Jeremy Vandoren.
Sie schwebte auf Wolke sieben.
Jeder, der sie kannte, hat sie unweigerlich geliebt.
Sie hatte ein offenes, vertrauensvolles Herz.
Auf der Fahrt nach Hause ging Eve die Aussagen von Freunden und Kollegen noch einmal gründlich durch. Niemand hatte etwas an Marianna auszusetzen gehabt. Nicht ein einziges Mal hatte Eve eine der gehässigen und häufig selbstgefälligen Bemerkungen zu hören bekommen, die so häufig von Lebenden über Tote fallen gelassen wurden.
Trotzdem hatte jemand etwas anderes gedacht, hatte jemand sie mit Berechnung, mit Sorgfalt und, falls das Blitzen seiner Augen etwas zu bedeuten hatte, mit einer gewissen Freude umgebracht.
Meine große Liebe.
Ja, jemand hatte sie genug geliebt, um sie zu töten. Eve wusste, dass es diese Art der kranken Liebe gab. Ihr selbst hatte einmal ein Mensch dieses alles beherrschende, verdrehte Gefühl entgegengebracht. Doch sie hatte überlebt, erinnerte sie sich und griff nach ihrem Link.
»Haben Sie inzwischen den toxikologischen Bericht über Marianna Hawley, Dickie?«
Auf dem kleinen Bildschirm tauchte das leidende, etwas füllige Gesicht des Laborchefs auf. »Sie wissen, dass wir in der Weihnachtszeit in Arbeit regelrecht ersticken. Die Leute bringen einander reihenweise um, und unsere Angestellten interessieren sich statt für ihre Arbeit nur noch für das bevorstehende Fest.«
»Ja, mir bricht das Herz. Trotzdem will ich den Bericht.«
»Und ich will endlich Urlaub.« Gleichzeitig jedoch rief er eine Datei auf seinem Computer auf. »Sie war betäubt. Mit irgendeinem milden Zeug, wie man es rezeptfrei in jeder Apotheke kriegt. Bei ihrem Gewicht hat die Dosierung höchstens zehn bis fünfzehn Minuten gewirkt.«
»Lange genug«, murmelte Eve.
»Wahrscheinlich wurde ihr das Zeug in den rechten Oberarm gespritzt. Muss in etwa dieselbe Wirkung gehabt haben wie ein halbes Dutzend Zombies: Benommenheit, Desorientierung, Muskelschwäche, vielleicht eine kurze Bewusstlosigkeit.«
»Okay. Irgendwelcher Samen?«
»Nein, wir haben keinen einzigen kleinen Soldaten in oder an ihr gefunden. Entweder hat er ein Kondom benutzt oder sie hat ein Verhütungsmittel genommen, das sie abgetötet hat. Das müssen wir noch prüfen. Der gesamte Körper war mit Desinfektionsspray eingesprüht. Selbst in ihrer Vagina haben wir Spuren davon gefunden, wodurch sicher ebenfalls ein paar der kleinen Krieger abgetötet worden sind. Wir haben effektiv nichts gefunden. Oh – eins noch. Die Schminke in ihrem Gesicht passte nicht zu der, die sie in ihrer Wohnung hatte. Wir haben die Untersuchung noch nicht zur Gänze abgeschlossen, aber das Zeug scheint ausschließlich natürliche Bestandteile zu haben, was heißt, dass es sicher superteuer war. Wahrscheinlich hat ihr Mörder die Sachen mitgebracht.«
»Nennen Sie mir so bald wie möglich die Namen der Produkte. Das ist eine gute Spur. Gut gemacht, Dickie.«
»Ja, ja. Ich wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten.«
»Danke gleichfalls, Sturschädel«, murmelte sie, nachdem das Gespräch von ihr beendet worden war, ließ ihre angespannten Schultern kreisen und bog in die Einfahrt ihres Hauses ein.
Durch das winterliche Dunkel sah sie die hellen Lichter hinter den in den Zinnen und Türmen runden und in der untersten Etage bodentiefen Fenstern.
Zu Hause, dachte sie. Wegen des Mannes, der dieses Anwesen besaß, des Mannes, der sie liebte, des Mannes, der sie zur Frau genommen hatte, war dies ihr Zuhause. Auch Jeremy hatte Marianna ehelichen wollen.
Sie drehte mit dem Daumen den Ehering an ihrem Finger und stellte ihren Wagen am Fuß der Eingangstreppe ab.
Sie hatte ihm alles bedeutet, hatte Jeremy gesagt. Noch vor einem Jahr hätte Eve die Bedeutung dieses Satzes nicht verstanden. Heute wusste sie genau, was ein Mensch mit dieser Aussage verband.
Sie blieb einen Moment sitzen und fuhr sich mit beiden Händen durch das bereits zerzauste, kurze Haar. Die Trauer des Mannes hatte heißes Mitgefühl in ihr geweckt. Das war eindeutig ein Fehler; es würde ihm nicht helfen und könnte die Ermittlungen behindern. Sie musste ihr Mitgefühl verdrängen, musste das Elend ignorieren, das sie empfunden hatte, als er beinahe in ihren Armen zusammengebrochen war.
Liebe siegte nun einmal nicht immer, erinnerte sie sich. Doch wenn sie gut genug war, konnte sie zumindest dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit gewann.
Sie stieg aus, ließ ihren Wagen absichtlich stehen, stapfte zur Haustür, schälte sich, als sie den Flur betrat, aus ihrer Jacke, warf sie achtlos über den eleganten Pfosten am Fuß der geschwungenen Treppe – und sofort tauchte der knochige, bleichgesichtige Summerset mit missbilligender Miene auf. »Lieutenant.«
»Lassen Sie mein Fahrzeug genau dort, wo es steht«, erklärte sie und wandte sich der Treppe zu.
Er atmete hörbar durch die Nase ein. »Sie haben mehrere Nachrichten erhalten.«
»Die können warten.« In dem Gedanken an eine heiße Dusche, ein Glas Wein und ein zehnminütiges Schläfchen lief sie unbeirrt weiter.
Er rief ihr etwas nach, doch sie hörte ihm schon nicht mehr zu. »Lecken Sie mich am Arsch«, murmelte sie, öffnete die Tür des Schlafzimmers und alles, was in ihrem Inneren zu welken angefangen hatte, erblühte.
Roarke stand, bis zur Hüfte nackt, vor seinem breiten Schrank. Seine Rückenmuskel spielten sanft unter der straffen, leicht gebräunten Haut, als er ein frisches Hemd vom Bügel nahm. Er wandte seinen Kopf, und die Schönheit seines Gesichts – die sinnlich geschwungenen Lippen, die leuchtend blauen Augen und das liebevolle Lächeln, als er seine dichte schwarze Mähne mit einem leichten Schwung zurückwarf – traf sie wie ein Hieb.
»Hallo, Lieutenant.«
»Ich dachte, du kämst erst in ein paar Stunden.«
Er legte das Hemd achtlos zur Seite. Sie hatte nicht gut geschlafen, dachte er besorgt, als er die dunklen Schatten unter ihren Augen bemerkte. »Ich bin gut durchgekommen.«