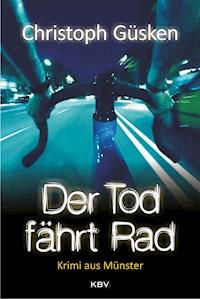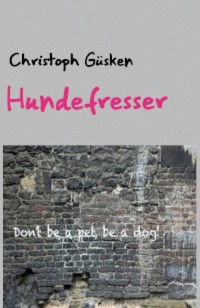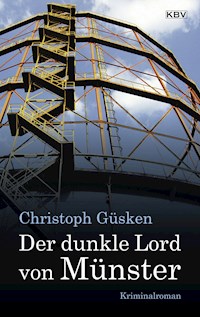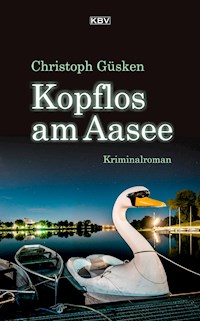Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ex-Hauptkommissar Niklas De Jong
- Sprache: Deutsch
Lesen und sterben in Münster Wie viele andere Städte will auch Münster zu einer Heimat des Buches werden. Eine ganze Woche lang soll bei »Münster liest« die Stadt für Bewohner und Gäste wie ein aufgeschlagenes Buch sein. Doch die ungetrübte Lesefreude wird jäh gestört, als in einer Kriminalroman-Ausstellung im neuen Landesmuseum ein Toter mit gebrochenem Genick entdeckt wird. Exhauptkommissar de Jong macht um Mordfälle eigentlich einen großen Bogen, aber hier handelt es sich um eine persönliche Sache, denn der Tote war sein Freund Ollie Frings. Gibt es womöglich einen Zusammenhang mit dem beliebten Büchertalk »Menetekel«, den Ollie unmittelbar vor der Tat moderiert hat? Schon bald geschieht ein weiterer Mord im Umfeld der Literatur. Während die Kripo hektisch ermittelt, um weitere Opfer zu verhindern und einen Imageschaden für die Stadt abzuwenden, führt die Spur de Jong in die Vergangenheit, in die frühen Neunzigerjahre, zu seinem ersten Kriminalfall in Münster. Ein Doppelmord am Berg Fidel wurde damals von der Presse als »der Mundharmonika-Mord« zum grausigsten Verbrechen in der Geschichte der Stadt gekürt. Aufgeklärt wurde diese Tat nie. Bis heute …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Güsken
Lies mir das Buch vom Tod
Bisher vom Autor bei KBV erschienen:
Der Tod fährt RadDas Wunder von HiltrupDas Mordkreuz von TilbeckDer Glöckner von St. LambertiKopflos am AaseeDer dunkle Lord von MünsterDer TotensammlerGanz miese Gesellschaft
Christoph Güsken wuchs in Mönchengladbach auf, studierte in Bonn und Münster und war Buchhändler in Köln. Er verfasste Texte im Geist der legendären Monty Pythons, u. a. für die »Springmaus«. Seit 1995 lebt er als freier Autor in Münster, schrieb zahlreiche Krimis, einige wenig ernste Romane und Hörspiele.
Lies mir das Buch vom Tod ist der achte Kriminalroman um den schrägen Ex-Hauptkommissar de Jong, der bei seiner Suche nach dem Sinn des Ganzen ständig über die schlimmsten Verbrechen stolpert.
www.christoph-güsken.de
Christoph Güsken
Lies mirdas Buch vom Tod
Originalausgabe
© 2024 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: info@kbv-verlag.de
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © Patrick Niebergall - stock.adobe.com
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-700-1
E-Book-ISBN 978-3-95441-711-7
Outside of a dog, a book is man’s best friend.
Inside of a dog, it’s too dark to read.
Groucho Marx
Well, I’m livin’ in a foreign country
but I’m bound to cross the line
Beauty walks a razor’s edge, someday I’ll make it mine
If I could only turn back the clock
to when God and her were born
»Come in«, she said, »I’ll give you shelter from the storm.«
Bob Dylan
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
1. Kapitel
Ein Film ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er hatte ihn zusammen mit Sorga gesehen, oder hieß sie Nora oder Cora? – Egal, sie war längst vergessen, und er hatte sie überhaupt nur deshalb noch im Gedächtnis, weil er mit ihr ebendiesen Film angesehen hatte. Es war ein ziemlich alter Streifen gewesen, die Bilder waren teilweise unscharf und an den Rändern seltsam ausgefranst gewesen, wie alte Fotos in einem Album. Ein Western. Er handelte von vier Banditen in langen, dunklen Mänteln, die eines Tages wie aus dem Nichts in der Wüste auftauchten, sich einen Mann schnappten und ihn aufknüpften, nur so zum Spaß. Der kleine Sohn des Mannes, sechs, höchstens sieben Jahre alt, war Zeuge des grausamen Geschehens. Aber damit nicht genug, die Banditen zwangen den kleinen Kerl, Mundharmonika zu spielen, während er seinen Vater, der mit dem Strick um den Hals auf seinen Schultern stand, so gut es ging abstützte, und zwar so lange wie möglich, denn sobald er abrutschte, würde er sich strangulieren. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der Junge erschöpft zusammenbrach. Der Vater baumelte tot am Strang – und der Kleine war schuld. Obwohl er sich viel später als Erwachsener jeden einzelnen der Peiniger vornahm und seine Rache grausam war, änderte sich daran nichts.
Zufällig wusste er nämlich genau, wie das ist: schuld zu sein. An einem Tod schuld zu sein. Bei ihm war es ganz ähnlich gewesen. Schon sehr anders, aber ähnlich. Bei ihm waren es nicht vier, sondern nur ein einziger Mann im langen Mantel gewesen. Es war kein dunkler Mantel gewesen, und es hatte auch keine Mundharmonika gegeben, aber das waren ja wohl lausige Nebensächlichkeiten.
»Nimm dir ein Buch und lies. Schlaf bloß nicht ein«, hatte Mutter gesagt. Ihre Stimme, die immer leicht schrill war, hallte bis heute in seinem Ohr und würde auch nie verschwinden. »Du weißt doch, ich kann sehen, ob jemand liest oder nur so tut als ob.«
Er hatte seltsame Geräusche gehört. Stöhnen und spitze Schreie. Das hatte ihn beunruhigt, schließlich hatte sie gesagt, der Mann mit dem langen Mantel sei für eine wichtige Besprechung gekommen, und da hatte er nicht mit Stöhnen und spitzen Schreien gerechnet. Also hatte er im Buch herumgeblättert und so getan, als würde er die Geräusche nicht hören, aber natürlich hatte er sie gehört. Es war ein langweiliges Buch gewesen, und das Herumblättern hatte ihn auf die Dauer ermüdet. Und irgendwann war er dann eingenickt. Vater war zurückgekommen, und er hatte geschlafen, mit dem Kopf auf den Seiten. So hatte er nicht verhindert, was er hatte verhindern sollen. Hätte verhindern müssen. Was auch immer dann geschehen war, es war seine Schuld gewesen.
Hätte er nur ihre Anweisung befolgt und gelesen und nicht nur so getan als ob, dann wäre alles anders gekommen. Davon war er inzwischen überzeugt, wenn er es auch nicht mehr beweisen konnte. Beim Lesen hätte er sich nämlich konzentriert und wäre nicht eingedöst. Mutter hatte ihm das immer wieder eingebläut. Lesen bildet, lesen macht wacher und klüger. Am deutschen Lesen wird die Welt genesen. Und nicht nur sie. Auch Vater, den sie hinter seinem Rücken immer nur den »Waschlappen« genannt hatte – in seiner Vorstellung hatte ein Waschlappen immer so ausgesehen wie Vater, bis er eines Tages einen aus Frottee mit Fischmustern drauf gesehen hatte –, war auch dieser Meinung gewesen. »Heutzutage liest ja kein Mensch mehr, und du siehst ja, was daraus wird«, hatte er gesagt. »Sie starren auf ihre Handys und tippen mit ihren Daumen auf lustige Gesichter. Eines Tages werden sie dann merken, dass man mit Emojis keinen Roman schreiben kann. Aber dann ist es zu spät.«
Dann war es so was von zu spät gewesen.
Schon lange vor Mutters tragischem Tod dämmerte ihm, dass er seltsam war, vielleicht regelrecht verkorkst. Anders als die anderen. Vielleicht mehr als nur anders. Verhaltensauffällig. Gefährlich möglicherweise – wie konnte er das wissen? Er beschloss, daran zu arbeiten. Eine Therapie zu machen zum Beispiel, das Ding war nur: Er traute keinem Therapeuten über den Weg. Psychoquacksalbern schon gar nicht. Schließlich las man täglich davon, dass sie nur darauf aus waren, armen, geistig irgendwie verdrehten Menschen – genau solchen wie ihm – Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ihr dilettantisches Unwissen war schuld daran, dass Klienten Amok liefen und wahllos Menschen erschossen. Zum Glück waren die Zeiten inzwischen vorbei, in denen es zu den Psychoquacksalbern keine Alternative gab. Heutzutage konnte man aus einer ganzen Palette wählen: Tanztherapie, Maltherapie, Sextherapie und Schlaftherapie. Sogar Bibliotherapie.
Darauf stieß er zufällig, als er im Wartezimmer seines Zahnarztes, der sich auf Naturheilverfahren und sanfte Medizin spezialisiert hatte, eine Zeitschrift durchblätterte. Bibliotherapie. Als hätte man die für ihn erfunden! Ebenso die Therapeutin: Kerstina Döring. Ihr Haar trug sie kurz, und sie hatte ein rundes, fast apfelförmiges Gesicht. Sie ähnelte sehr seiner Mutter, war nur viel jünger. Kerstina brachte ihn wieder auf Kurs. Unter ihrer Anleitung begann er wieder zu lesen. Goethe und Schiller, Böll und Grass. Enzensberger. Höchst anspruchsvolle Lektüre, ja, die besonders, darauf bestand sie. Er brauche ein Fundament, auf dem er dann alles Weitere errichten könne. Auch Lyrisches verordnete sie ihm, Eichendorff und Matthias Claudius als tägliche Entspannungsübungen. Kerstina diagnostizierte bei ihm eine Biblioparanoia im Anfangsstadium. Aber sie verschrieb ihm keine Psychopharmaka, die vor Nebenwirkungen strotzten, sondern Krimis. Agatha Christie, Raymond Chandler oder George Simenon. Ein wenig Poe, aber, wohlgemerkt, nur wenig. Und hin und wieder verabreichte sie ihm sogar eine Prise Stephen King. Was ihn zunächst alarmierte. »Wie soll das gehen?«, fragte er besorgt. »Das ist doch wohl so, als wollte man einen Brand mit einem Kanister Benzin bekämpfen.« Aber sie bat ihn, ihr zu vertrauen, und erklärte, dass genau das das Prinzip aller Impfungen sei. Kerstina versah sein bisher planloses Leben mit einem Sinnhorizont, der wie eine Sonne am Ende eines dunklen Tales aufleuchtete. Ihr Selbsthilfebuch Lesen – der Weg zu innerer Heilung wurde seine Bibel. Und natürlich träumte er nicht nur von dem Buch, das unter seinem Kissen steckte, sondern auch von ihr, dass sie neben ihm lag, nichts anhatte und verführerisch roch. Aber sie meinte, eine Beziehung zwischen Therapeutin und Klient habe so ihre Tücken und sei meistens zum Scheitern verurteilt.
Vielleicht hatte er es am Ende mit dem King doch etwas übertrieben. Oder Kerstina hatte die Gefahr unterschätzt. Schließlich war sie die Therapeutin und hätte die Warnzeichen erkennen müssen. Zum Beispiel dass er, wie es heute bei den Feuilletonisten standardmäßig hieß, kein Buch mehr aus der Hand legen konnte. Er las, wie ein Wanderer trank, der es mit letzter Kraft aus der staubigen Wüste zu einem Kiosk geschafft hatte. Manisch, gierig und maßlos. Kein Druckerzeugnis war vor ihm sicher. Ob Thomas Mann, Rosamunde Pilcher oder Aufbauanleitungen für Eckregale – Hauptsache lesen! Warum schritt sie damals nicht ein?
Im Nachhinein war ihm natürlich klar, warum: nämlich deshalb, weil sie gar keine Therapeutin war, sondern eine Hexe, die mit Heilung nichts im Sinn hatte. Eine Schlampe, der man nicht über den Weg trauen konnte. Das hatte sie ihm natürlich nie erzählt, ebenso wie er auch von Gerrie eines Tages rein zufällig erfuhr. Gerrie! Ständig belehrte sie ihn über problematische Therapeutin-Klienten-Beziehungen, die dem Heilungsprozess abträglich seien, während sie jede Nacht mit ihrem Gerrie im Bett lag (sie nannte ihn ihren G-Punkt, wie er aus Briefen wusste, die er abgefangen hatte) und sich ihm hingab. Als er eines Abends an ihrer Wohnungstür aufkreuzte, lächelte sie nett, aber ein Gefühl sagte ihm, dass sie ihm etwas vorspielte. Ihn nur abwimmeln wollte. Er musste sich Gewissheit verschaffen. Und wen fand er da nackt in ihrem Bett vor?
»Ich hab’s doch gewusst!«, stieß er hervor und merkte, wie in seinem Kopf gerechter, aber blindwütiger Zorn das Kommando übernahm und alles an sich riss.
»Was hast du gewusst?«, fragte sie in unschuldigem Tonfall, und G-Punkt-Gerrie rief: »Hey, du Looser, merkst du eigentlich nicht, dass du störst?«
Das reichte ihm. Die Wut verflog, und eine eisige Ruhe ergriff von ihm Besitz. »Ich bleibe auch nicht lange«, hatte er dem Kerl entgegnet. »Aber vorab eine kurze Frage an dich: Kannst du Mundharmonika spielen?«
2. Kapitel
Von Haus aus hatte Exhauptkommissar Niklas de Jong sich eigentlich nie für Bücher interessiert. Erst später, als er sich seine erste Wohnung einrichtete, hatte er sie gelegentlich zum Abstützen von Regalen benutzt, da man sie ja in jeder erdenklichen Dicke bekommen konnte. Es war praktisch gewesen, sie unter die Pfosten zu schieben, damit das Wackeln aufhörte. Sicher hatte er sie auch mal aufgeschlagen und hineingeschnuppert, während die Seiten für ein paar Sekunden an seinem Daumen vorbeiflatterten. Dann konnte er am Geruch erkennen, aus welchem Raum des elterlichen Hauses sie stammten.
Worten und Sätzen darin hatte er erst viel später Beachtung geschenkt. Das war, als er Giulia kennenlernte. Da hatte er seitenweise in Büchern geschmökert, meistens überflog er den Anfang und ging dann zügig zum Schluss über. Den Mittelteil überschlug er, weil der sich meistens zu sehr hinzog und voller Landschaftsbeschreibungen war, hin und wieder auch mit Kochrezepten gespickt, oder die jeweilige Autorin verlor sich in autobiografischen Betrachtungen und sperrigen Ansichten über das Wesen der Dinge. Irgendjemand hatte darüber sein Interesse für alte Philosophen geweckt – Aristoteles, Platon, die Vorsokratiker. Aber auch das war nur von kurzer Dauer gewesen. Und sein Entschluss, selbst etwas zu Papier zu bringen, wurzelte vorwiegend in dem Kalkül, Giulia zu beeindrucken und ihre anderen Verehrer aus dem Feld zu schlagen.
Das war ihm auch ab und an gelungen, bis es ihm später dann eines Tages auf die Füße gefallen war. Inzwischen waren Bücher nämlich aus der Mode gekommen. Die Leserschaft digitalisierte sich, ihr Leseverhalten definierte sich weniger inhaltlich als ressourcenschonend, man entschied sich gegen Papierverschwendung und für den Stromverbrauch. Digitale Bücher taugten nicht, um Regale abzustützen, aber wozu noch Regale, wenn man keine Bücher darin aufbewahrte? De Jong kam damals zu dem Entschluss, dass er am besten Ressourcen sparte, indem er mit dem Schreiben aufhörte.
Ganz anders Giulia. De Jong konnte von Glück sagen, dass es mit ihr zurzeit so gut lief. Er beklagte sich nicht, im Gegenteil. Sie war zu ihm zurückgekehrt, nachdem sie einen für zwei Monate geplanten Segeltörn mit Brian, einem Singer-Songwriter, schon nach drei Wochen abgebrochen hatte, wegen gewisser Differenzen. Welche genau das waren, wollte sie ihm nicht sagen, immerhin hatten sie sie aber dazu bewogen, in Donoussa, einer winzigen Kykladeninsel, von Bord zu gehen und dort fast eine ganze Woche auf die nächste Fähre nach Piräus zu warten.
Giulias Leidenschaft war die Literatur. Leidenschaft war fast zu glimpflich ausgedrückt, man konnte von einer regelrechten Besessenheit sprechen. In jungen Jahren hatte sie vorgehabt, Creative Writing zu studieren, den Plan dann aber im letzten Moment wieder aufgegeben. Stattdessen hatte sie eine Verlagslaufbahn eingeschlagen. Neuerdings trug sie sich mit der Idee, eine eigene Agentur zu gründen.
»Aber noch mal zu Brian«, sagte de Jong. »Warum willst du mir nicht sagen, was zwischen euch das Problem war?«
Sie musterte ihn mit einem finsteren Blick. »Das willst du nicht wissen.«
»Na ja, eigentlich doch. Sonst hätte ich nicht gefragt.«
Giulia schüttelte auf ihre eigene Art den Kopf, auf diese Art, die klar und deutlich machte, was sie von de Jongs Neugier hielt, wenn sie sich auf Dinge richtete, die ihn nichts angingen. »Abgesehen davon hatte ich nicht vor, Münster liest! zu verpassen.«
»Ist das ein Film im Fernsehen, oder was?«, erkundigte sich de Jong, der keine Ahnung hatte, wovon sie sprach.
»Münster liest! Das ist eine Veranstaltung, ein Festival, das hier in der Stadt stattfindet. Ab morgen und dann die ganze Woche. Am Sonntag ist der Abschluss mit großem Feuerwerk.«
»Nur deswegen bist du also zurückgekommen?«
»Da geht es ums Lesen. Veranstaltungen überall in der Stadt.«
»So eine Art Buchmesse? Oder eher Karneval?«
Giulias Stimme bekam einen professoralen Unterton, hin und wieder liebte sie es eben, die Expertin herauszukehren. »Leipzig hat seine Buchmesse«, dozierte sie. »Frankfurt auch. Bei uns findet Münster liest! statt. Da geht es nicht um die üblichen kommerziellen Blockbuster, sondern ausschließlich um ernste Literatur, die den Namen verdient.«
»Hört sich für mich eher anstrengend an«, meinte de Jong. Er war vor allem deshalb skeptisch, weil es für ihn so klang, als ob sie den Ägäis-Törn nur wegen dieses schrägen Buchevents abgebrochen hatte; was bedeuten konnte, dass sie sich mit Brian gar nicht entzweit hatte, jedenfalls nicht ernsthaft.
»Du kannst ja selbst herausfinden, ob es dir gefällt«, sagte sie. »Ich hab uns Karten besorgt.«
»Lieb von dir, Giulia, aber da bin ich leider schon mit Achim zur Probe …«
»Morgen Abend ist Eröffnung: das ›Menetekel‹. Der Büchertalk mit harten Bandagen. Wird dir gefallen.«
»Sonst liebend gern, aber …«
»Jetzt komm schon: Regale abstützen kannst du auch mit anspruchsvoller Literatur.« So wie sie das sagte, war de Jong schon klar, dass er schwer Nein sagen konnte. »Außerdem bist du es Oliver schuldig.«
»Oliver?«
»Oliver Frings, deinem alten Bekannten.«
»Was hat der damit zu tun?«
»Er moderiert die Veranstaltung.«
»Ausgeschlossen.« De Jong schüttelte den Kopf. »Ollie hat mit Literatur nichts am Hut. Er war immer der Überzeugung, dass Lesen schädlich ist, weil es einseitigen Intellektualismus fördert. Du musst dich irren.«
»Und wenn schon«, beharrte Giulia. »Wie lange habt ihr euch nicht mehr gesehen?«
3. Kapitel
Was de Jong nicht erwähnte, war, dass Ollie Frings viele Überzeugungen hatte. Das mit dem Lesen und dem Intellektualismus war nur eine von vielen, insofern konnte es sehr gut sein, dass er momentan eine ganz andere hatte. Und eine zweite Sache: Sosehr auf Frings die Bezeichnung »alter Bekannter« passte, stimmte es dennoch nicht, dass es eine Ewigkeit her war, dass sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Im Gegenteil. Erst drei Tage war es her, dass Frings nach ewig langer Zeit mal wieder auf de Jongs Hausboot aufgekreuzt war. Der Exkommissar kannte ihn nur oberflächlich, aber schon recht lange. Frings war Leadgitarrist in Janwillems ehemaliger Rockband gewesen. Janwillem, de Jongs Halbbruder, war damals mit Herz und Seele Musiker gewesen, mit demselben Herzen und derselben Seele, mit der er heutzutage als Comedian auf der Bühne stand. Frings war gut auf der Gitarre gewesen – brillant geradezu, was ihm de Jong heimlich übel genommen hatte. Als der Exkommissar sich nämlich mit Achim Bühlow zusammengetan hatte, um nach Feierabend ein bisschen Musik zu machen, war er kurz davor gewesen, Frings als zweiten Gitarristen vorzuschlagen. Aber schon bald war ihm klar geworden, wie das ausgehen würde: Achim würde eine Weile herumdrucksen, aber eines Tages keinen Hehl mehr daraus machen, dass er eigentlich lieber mit Oliver musizierte als mit de Jong, der die meisten Titel so gerade eben auf die Reihe bekam. De Jong war damals nicht gut auf Frings zu sprechen gewesen; Frings allerdings war nicht der Typ, dem es etwas ausmachte, wenn jemand nicht gut auf ihn zu sprechen war.
Abgesehen davon war er für de Jong immer auch eine Art heimliches Vorbild gewesen. Weil es Frings gelungen war, immer auf den Füßen zu landen – ohne einen Arschtritt einstecken zu müssen. Das war Frings’ eigentliche Kunst. Er war kein Krösus – aber auch das bewunderte de Jong: dass er immer seinen Stil gelebt hatte und sich weder vom großen Geld noch von gesellschaftlichen Normen hatte an die Leine nehmen lassen. Statt eines festen Jobs hatte er immer dies und das gemacht. Heute Taxifahrer, morgen Musiker, anschließend bei der Müllabfuhr und hin und wieder Conférencier auf diversen Bühnenveranstaltungen. So was lag ihm. Im Sommer Losverkäufer auf der Kirmes, hatte er in der Vorweihnachtszeit hin und wieder für ein kleines Auktionshaus den Hammer geschwungen. Oliver hatte das Leben seinen Glücksvorstellungen angepasst, nicht so wie de Jong, der seine Glücksvorstellungen je nach Lebenslage und Sachzwang umdefinierte. Trotzdem – oder vielleicht deshalb? – hatte man sich mit der Zeit aus den Augen verloren.
Und dann war er vor drei Tagen überraschend wieder auf der Bildfläche erschienen. Hatte de Jong auf dem Alten Mädchen besucht, seinem Hausboot, das dieser vor vielen Jahren günstig in Amsterdam erworben hatte. Er hatte sich umgesehen, anerkennend genickt und den Daumen hochgereckt. »Cooles Teil«, sagte er.
Es war ein Mittwochvormittag Ende Juni gewesen, Regen war angesagt, der dann aber doch nicht gefallen war.
»Tja, von hier aus sieht diese piefige Stadt ganz anders aus, was?«, meinte Frings, stieß sich von der Reling ab und ließ sich in einen der Gartenstühle fallen, die auf Deck herumstanden.
»Was ist denn hier piefig?«, gab de Jong gereizt zurück.
Aber Frings grinste versöhnlich und breitete die Arme aus. »Na, was kannst du mir anbieten: Wasser, Bier, grünen Tee?«
»Setz dich doch«, sagte de Jong und deutete auf den Stuhl, auf dem Frings es sich bereits gemütlich gemacht hatte. »Wie geht’s denn so?«, erkundigte er sich pflichtgemäß, als er mit zwei Bier in der Hand wieder auf Deck zurückkehrte.
»Bestens«, schwärmte Oliver. »Kann überhaupt nicht klagen. Gerade jetzt habe ich einen Riesenfisch an der Angel.«
»Ich will nichts davon wissen.«
»Aber warum denn nicht?« De Jongs Gast wirkte enttäuscht. »Ich bin hier und hab was zu erzählen.«
»Gern«, sagte de Jong. »Aber nichts über Riesenfische an der Angel. Das heißt bei dir immer was Halbseidenes. Wenn nicht Erpressung. Oder Mord.«
»Mord! Also jetzt übertreibst du maßlos.«
»Na gut. Dann aber das Erste.«
Frings stieß mit de Jong an und nahm einen Schluck aus der Flasche. »Und wenn?«
»Erpressung ist illegal. Ein Verbrechen.«
»Richtig, aber da wir hier unter uns sind, Niklas, kann ich dir was verraten: Ich bin so eine Art Robin Hood. Hole es mir bei den Reichen und gebe es den Armen. So viel zum Thema Verbrechen.«
De Jong fand, dass es keinen Sinn hatte, auf der Sache weiter herumzureiten. Schließlich war er kein Bulle mehr und musste deshalb nicht damit kommen, dass er sich selbst strafbar machte, wenn er sich so etwas anhörte, ohne darauf zu reagieren.
»Also gut«, sagte Ollie. »Dann nur so viel: Ich bin so gut wie saniert, und deshalb frage ich mich, ob ich mir nicht den Rest des Lebens freinehme. Und mich den wirklich wichtigen Dingen widme.«
»Sagtest du nicht gerade, du wolltest die Kohle an die Armen weiterreichen?«
»Genau.« Frings lehnte sich zurück und zeigte mit der Bierflasche auf das Kanalufer und alles dahinter. »Aber sieh dich doch mal um: Wo gibt es denn hier Arme? In dieser heilen Welt der Verwaltungsangestellten und Therapeuten? Meinst du etwa die bedauernswerten Schlucker, die sich darüber beklagen, dass es bei ihnen nur zum E-Bike vom Discounter reicht?«
»Ein blöder Ort für jemanden, der Robin Hood sein will, was?«
»Genau, mein Lieber, sag ich doch. Das ist Münster und nicht Nottingham.« Die Bierflasche zeigte jetzt auf de Jong. »Und trotzdem.«
»Trotzdem was?«
Frings musterte de Jong eingehend, ohne zu blinzeln. Nach einer Weile erschien in seinem Gesicht ein Lächeln, das sich rasend schnell zu einem Grinsen verbreiterte. »Du bist einfach zu sehr Bulle, um es zu bemerken, stimmt’s?«
»Ex-Bulle.«
»Geschenkt.«
»Um was zu bemerken?«
»Ich verarsch dich doch die ganze Zeit. Und du machst ein Gesicht, als wolltest du gleich runtergehen und die Handschellen holen.«
De Jong starrte ihn nur an, ebenso verblüfft wie verärgert.
»Die langweilige Wahrheit ist, dass ich meine Kohle auf rechtschaffene Weise verdiene. So wie alle hier. Hab die längste Zeit Computerprogramme geschrieben für einen Kerl, der davon keinen Schimmer hat.«
»Die längste Zeit?«
»Jetzt heißt es, neue Wege zu gehen.« Frings nickte. »Aber erst machen wir mal Urlaub. Rauskommen aus dem Ganzen hier.« Er drehte seine Bierflasche auf den Kopf, um sicherzugehen, dass sie leer war, und es tropfte ein bisschen. »Nur, Scarlett will nicht mit.«
»Warum nicht?«
»Keine Ahnung. Also komm du doch einfach mit.«
»Ich?« De Jong lachte auf. »Wohin denn?«
»Wie wär’s mit den Weihnachts- oder Osterinseln? Oder den Neujahrsinseln? Gibt’s die überhaupt? Egal, das Ziel ist unwichtig.«
»Kommst du mir jetzt etwa damit, dass der Weg das Ziel sei?«
»Ach Quatsch. Hauptsache, du lässt dein Jammertal hinter dir zurück.«
»Ich sehe hier nirgends ein Jammertal«, verwahrte sich de Jong.
Man konnte Frings ansehen, dass er de Jong nicht glaubte. »Giulia, die dir immer Hoffnungen macht und jedes Mal in die Arme eines anderen sinkt. Wie lange willst du das noch mitmachen?«
»Das geht dich nichts an.«
»Fang endlich an zu leben. Ich hab Scarlett. Wenn du wissen willst, wie eine Langzeitbeziehung funktioniert, dann frag mich.«
»Will sie deswegen nicht mit«, fragte de Jong höhnisch, »weil du zu viel davon verstehst?«
»Sie meint, sie brauche eine Auszeit. Was bestimmt ein Zeichen ist.«
»Ein Zeichen? Wofür denn?«
Ollie machte eine vage Handbewegung, dann erhob er sich ächzend und ging unter Deck, um sich in der Küche, ohne zu fragen, noch ein Bier zu holen.
Das war nämlich auch so ein Punkt. Während de Jong in der Illusion lebte, eines Tages wieder mit Giulia zusammenzusein, hatte Frings in Sachen Beziehung das berühmte große Los gezogen. Scarlett. Ein Traum von einer Frau. Auf verlockende Art schön, dass de Jong selbst heute und selbst nachdem er Giulia kannte, immer noch ein Schauer über den Rücken lief, wenn sie den Raum betrat. Damals, als die Beziehung noch frisch war und die beiden die Finger nicht voneinander lassen konnten, hatte Ollie ihm des Öfteren detailliert geschildert, was sie im Bett alles miteinander trieben. Solche ausufernden Schilderungen konnte man nur abwehren, indem man davon überzeugt war, dass das mit den beiden wahrscheinlich nur ein Strohfeuer war und sicher schon nach wenigen Monaten vor die Wand fahren würde. Aber das passierte nicht. Wie sich herausstellte, konnte sich Scarlett auch niemand anderen vorstellen als Frings. An dieser Stelle war de Jong klar geworden, dass seine Bewunderung für ihn in Neid umschlug.
»Also, wie steht’s?«, wollte Oliver wissen, sobald er wieder zurück war. »Keine Sorge, es geht nicht in den Indischen Ozean. Wie wär’s mit Amsterdam oder Kopenhagen? Ich hätte noch einen Platz frei.«
»Nein, ehrlich gesagt hab ich gar nichts gegen das Jammertal«, antwortete de Jong. »Es wird immer so schlechtgeredet, dabei hat es wirklich sehr schöne Ecken. Und es ist lange nicht so überlaufen wie Kopenhagen.«
»Darum geht’s doch überhaupt nicht. Scheißegal, ob du hier auf deinem Arsch sitzen bleibst oder ob du in Kopenhagen bist oder auf den Osterinseln. Was immer du tust, frag dich lieber, was du verpasst, während du es tust. Du hast nämlich nur ein Leben, weißt du?« Oliver Frings erhob sich, wobei sein Stuhl umkippte. »Denk einfach mal drüber nach«, sagte er und hob die Hand zu einer Abschiedsgeste. »Aber nicht zu lange, sonst nehme ich doch Scarlett mit. Ob sie will oder nicht.«
4. Kapitel
Was Giulia anging, so nahm de Jong ihr immer weniger ab, dass sie wirklich mit Brian Schluss gemacht hatte. Vorerst konnte er sich bei ihr auf nichts verlassen. Wer sagte ihm denn, dass sie nicht diese literarische Woche in der Stadt verbrachte und anschließend den nächsten Flieger nahm, zurück in die Ägäis, auf seine Jacht, in seine Kajüte? Aber gerade deshalb wollte er nichts riskieren und begleitete sie am Samstag kurz vor 20 Uhr zum Museum für Kunst und Kultur.
Es war ein perfekter Abend. Während die Sonne sich mit dem Untergehen Zeit ließ, erstrahlte der Himmel in einem blassen, wässrigen Blau, das allmählich einen rötlichen Unterton bekam. Die Abendluft war erfüllt von exotischen Gewürzen. Perfekt wäre der Abend sicher zum Ausgehen gewesen, ob er sich für einen literarischen Disput eignete, musste sich erst noch herausstellen.
Das Kulturevent fand unter freiem Himmel im Patio des Museums statt. In der Mitte hatte man eine kreisrunde Bühne errichtet, die Zuhörerschaft gruppierte sich um sie herum – ein Arrangement, das de Jong an einen Boxring erinnerte. Nur dass ein Boxring eben quadratisch war. Nachdem das Publikum auf mit weißem Kunstleder bezogenen Stühlen Platz genommen hatte, betraten vier Personen die Bühne und ließen sich in mintfarbenen, muschelförmigen Sesseln nieder, die um einen ebenfalls mintfarbenen Tisch herum platziert waren. Einer der vier war Oliver Frings, der de Jong, weil er in der ersten Reihe saß, sofort entdeckte und ihm zuzwinkerte. De Jong zwinkerte zurück. Er hätte Frings fast nicht erkannt, so fremd wirkte er im hellgrauen Anzug mit mintfarbener Krawatte.
Es wurde acht Uhr und etwas später, so lange herrschte gespannte Stille, die nur von gelegentlichem Räuspern oder Hüsteln gestört wurde. Schließlich ergriff Frings mit einer plötzlichen Bewegung das Mikrofon, das neben einem Stapel Bücher auf dem Tisch vor ihm lag. Mit sonorer, geradezu elvishafter Stimme hieß er die Anwesenden willkommen zum diesjährigen »Menetekel«, dem Büchertalk mit harten Bandagen, als Auftakt von Münster liest!, das nun schon zum dritten Mal stattfinde und somit den Münsteraner:innen eine liebe Tradition geworden sei. Aber nicht nur ihnen, inzwischen kämen Besucher:innen von überall her, sogar aus dem niederländischen Ausland, sodass die Medien gelegentlich schon von einer westfälischen Frankfurter Buchmesse gesprochen hätten. Er grinste, sein müder Scherz fuhr aber nur pflichtgemäßes Gelächter ein. Also dankte er erst mal den Organisatoren, allen voran Estella Nürburg, Geschäftsführerin der Münsterland Leseland GmbH, die diese Veranstaltung möglich gemacht habe, und erklärte die Regeln für den heutigen Abend: Jeder Podiumsgast habe ein Buch mitgebracht, über das man sich angeregt austauschen werde. Im Anschluss daran werde er das Publikum dazu auffordern, mithilfe der Kärtchen, die neben jedem Sitz lägen, abzustimmen: grün für top und rot für flop. Und das waren seine heutigen Gäste: Dea Blessing, Bestsellerautorin, vom Spiegel schon zur J. K. Rowling des Münsterlandes gekürt, Noel Sparwasser, zuständig für das Ressort Feuilleton bei der Münsterischen Allgemeinen Zeitung, und Bastian Gropius aus der Kulturredaktion des Westdeutschen Rundfunks. Alle drei quittierten den Begrüßungsapplaus mit einem gnädigen Nicken.
Sparwasser, der Zeitungsmann, schnappte sich ein Buch vom Tisch und hielt es hoch. Das Buchstabenzimmer von Ultra Braunsbüttel. Es gehe um Folgendes: Eine bekannte Autorin, Henrike Holmersen, ziehe sich auf der Suche nach sich selbst auf eine Hallig zurück, wo sie ihr Leben Revue passieren lasse. Sich ihren Dämonen stelle.
De Jong schätzte Sparwasser auf Mitte vierzig, sein schicker Fünftagebart verriet, dass er es darauf anlegte, als Mitte zwanzig durchzugehen: Das lange und ansatzweise schüttere Haar hatte er zu einem Dutt geknotet.
Interessant sei die Ich-Perspektive, schwärmte er. Viele Ich-Perspektiven. Wie meisterhaft die Autorin es verstehe, aus vielen Perspektiven zu erzählen und am Ende alles zusammenzuführen beziehungsweise die Enden der verschiedenen Stränge einfach fallen zu lassen – ein genialer Schachzug, obendrein die Ich-Perspektive einer Autorin, die eine multiple Persönlichkeit besitze, was das Werk ungeheuer vielschichtig mache. Alles in allem ein außerordentliches Werk.
Verhaltener Applaus.
Auch von Frau Blessing, die ihm gegenübersaß, kam Applaus, allerdings ein Slow Clap, auf die langsame, hämische Art und Weise. Außerordentlich. Dieses Wort treffe es sehr genau, insofern es nicht einseitig positiv konnotiert sei.
Frau Blessing war eine attraktive Frau, blond, in einem engen, cremefarbenen Kleid, das glatte, weißblonde Haar war so streng zusammengebunden, dass sie irgendwie haarlos wirkte. Ihr betont gelangweilter Blick hatte etwas Angriffslustiges.
Was sie damit denn meine, wollte ihr Gegenüber wissen. So viel sei in diesem wunderbaren Buch zu finden, was der durchschnittlichen Leserin entgehe.
»Wieso denn Leserin?«, fragte Blessing lauernd.
»Weil das heute nun mal so üblich ist. In welcher Welt leben Sie?«, erkundigte sich Sparwasser leicht irritiert und mit hörbar arrogantem Unterton.
»Es ist ja wohl typisch männlich«, zischte sie, »gerade dann zu gendern, wenn es um einen Durchschnittsleser geht. Dann ist es plötzlich eine Durchschnittsleser:in. So durchschaubar.«
»Also, meine liebe Thea …«, erhob er Einspruch.
»Dea.«
»Sag ich doch.«
»Sagen Sie nicht. Sie sagen Thea. So heiße ich nicht.«
»Dann eben nicht.«
Jemand räusperte sich, es war Oliver Frings, der offenbar fürchtete, dass ihm der Disput entglitt. »Zurück zu unserem Buch. Mich würde interessieren, ob und welche …«
Die Autorin unterbrach ihn: »Noch mal, ich stimme Herrn Barwasser …«
Sparwasser: »Sparwasser.«
Blessing: »Sag ich doch. Ich stimme ihm hinsichtlich der Außergewöhnlichkeit zu. Das Buch erscheint mir außergewöhnlich banal zu sein. Geschwätzig und …«
Sparwasser: »Schau’n Sie, wir sind hier eine friedliche – und ich möchte unnötigerweise betonen: kompetente Runde. Aber wenn Sie, verehrte Kollegin, von Geschwätz sprechen …«
Blessing: »Kollege? Das ja wohl kaum.«
Sparwasser: »Kaum?«
Blessing: »Nur am Rande: Ich bin Schriftstellerin, die ein Werk erschafft, und Sie fabrizieren Zeitungsartikel zweifelhafter Qualität darüber, wie andere kreativ sind. Kann man da im Ernst von Kollegen sprechen?«
Sparwasser: »In Sachen Geschwätzigkeit kann ich Ihnen jedenfalls nicht das Wasser reichen, Frau Schriftstellerin.«
Frings ging wieder dazwischen: »Aber vielleicht möchten Sie, Herr Gropius, uns einmal erzählen, wie es Ihnen bei der Lektüre dieses bemerkenswerten Werks …«
»Bemerkenswert! Wieder so ein Wort!«, schnaubte Dea Blessing dazwischen.
»… so ergangen ist.«
Bastian Gropius beugte sich vor. Er war älter als seine Kontrahenten, Ende fünfzig. Kahlköpfig, klein und beleibt. Auf seiner Nase saß eine klassische Brecht-Brille, mit der er aber nicht Brecht ähnelte, wie de Jong fand, sondern eher Frodo Beutlin, dem berühmten Hobbit, wenn der in die Jahre gekommen wäre und den Besuch beim Optiker nicht mehr hätte aufschieben können. »Also, ich …«
Weiter kam er nicht. Blessing redete wieder los: »Außerdem möchte ich noch eines klarstellen, wenn wir schon von Kollegen sprechen …«
Frings: »Herr Sparwasser, bitte noch mal zum Buchstabenzimmer.«
Sparwasser: »Ein komplexes, vielschichtiges Werk. Vielschichtiger als so manches, das in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist.«
Frings: »Frau Blessing, Ihr Fazit?«
Blessing: »Ein wirres Machwerk, das nur um sich selbst kreist. Langatmig und weitschweifig. Weitschweifiger als so manches, das in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist.«
Sparwasser: »Da weiß jemand, wovon sie redet.«
Blessing: »Allerdings. Ganz im Gegensatz zu jemand anderem.«
Frings: »Also bitte …«
Sparwasser: »Sagen Sie mir eins: Ist der Neid auf den Erfolg einer Kollegin neuerdings ein Kriterium für ein qualifiziertes literarisches Urteil?«
Blessing: »Gegenfrage: Stimmt es übrigens, dass Sie die Autorin dieses außergewöhnlichen Werks persönlich kennen?«
Sparwasser behauptete, daraus keinen Hehl zu machen. Ihm sei die Ehre zuteilgeworden, dieses vielversprechende Talent zu interviewen.
Blessing: »Wie man es auch immer nennen mag.«
Sparwasser: »Wie bitte?«
Blessing: »Na ja, mit ein bisschen Fantasie – und glauben Sie mir, von Fantasie verstehe ich etwas – kann man sich durchaus vorstellen, was interviewen in diesem Zusammenhang alles heißen kann.«
Sparwasser: »Wollen Sie damit irgendwas andeuten, verehrte Kollegin?«
Blessing: »Natürlich will ich das. Abgesehen davon bin ich, wie schon gesagt, nicht Ihre Kollegin. Wenn Sie also die Freundlichkeit hätten, es zurückzunehmen.«
Sparwasser: »Ich habe die Freundlichkeit, das ›verehrte‹ zurückzunehmen.«
Frings wusste sich jetzt nicht mehr anders zu helfen, als ein Glas Wasser umzustoßen. Sparwasser zuckte zusammen, Frau Blessing sprang mit einem Quieken auf. Während der Moderator wortreich um Entschuldigung bat, zückte sie ein Taschentuch und rubbelte damit hektisch über ihren Rocksaum.
»Aber nun zu unserem zweiten Titel«, beschwichtigte Frings. »Zu guter Letzt. Da darf ich Sie, Frau Blessing, um das Wort bitten.«
»Das geht nicht mehr raus!«, beschwerte sich die Autorin, nahm aber wieder Platz.
»Jetzt stellen Sie sich nicht so an«, höhnte der Journalist. »Das ist Mineralwasser.«
»Ganz und gar nicht«, meckerte sie. »Ich hatte Rhabarberschorle.«
»Wie auch immer«, sagte Frings. »Unser nächster Roman: Zu guter Letzt.«
»Von Hektor W. Stoltenhoff«, sagte Blessing. »Und der Titel lässt ein Happy End erahnen, nur, genau das wird es nicht geben. Der Autor lässt die Leser:innen bewusst in diese Falle laufen und die Enttäuschung empfinden. Überhaupt bezeichnet er das Buch als Spannungsroman, verzichtet aber bewusst darauf, jegliche Spannung aufzubauen, weil er damit gegen die Gebrauchsliteratur protestieren will, die nur zur banalen Unterhaltung der Massen produziert wird und mithilfe von Aufbau künstlicher Spannung an die Schaulust des Lesers appelliert. Auch hier wieder diese raffinierte Technik: die Leser:innen zu täuschen, ja zu enttäuschen …«
Sparwasser: »Was ihm gelingt wie keinem anderen!«
»… und ihn am Ende mit der Frage, warum er das Buch überhaupt aufgeschlagen hat, alleinzulassen. Genau das ist ja gewollt.«
Sparwasser: »Frage: Sind Sie da sicher?«
Blessing: »Sicher? Was meinen Sie?«
Sparwasser: »Na ja, ob das gewollt ist.«
Blessing: »Zufällig hat es mir der Autor persönlich gesagt.«
Sparwasser: »Er hat es vielleicht behauptet. Das kann jeder.«
Blessing: »Was soll das jetzt wieder? Schämen Sie sich.«
»Also, ich danke Ihnen für Ihre Statements und die lebhafte Diskussion«, grätschte Frings dazwischen. Er grinste, aber es war ein freudloses, gestresstes Grinsen. »Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Genießen Sie die Pause.«
5. Kapitel
Exhauptkommissar de Jong sparte nicht mit Applaus, hatte er sich doch auf einen eher spröden Abend eingestellt, eine ermüdende Nabelschau in Sachen Literatur, die er nur Giulia zuliebe über sich ergehen ließ. Aber wer hätte das gedacht: Der Büchertalk hatte richtig gezündet und brauchte den Vergleich mit einer zünftigen Kneipenschlägerei nicht zu scheuen! Giulia allerdings war nicht annähernd so angetan wie de Jong, und als er ihr für den kurzweiligen Abend dankte, schenkte sie ihm nicht das Lächeln, das er von ihr erhofft hatte. Stattdessen brummelte sie irgendetwas Einsilbiges und verzog sich auf die Toilette.
De Jong suchte Frings, um ihm seine Anerkennung zu überbringen. Er entdeckte ihn im allgemeinen Gedrängel, wo er hektisch mit seinen Daumen auf dem Handy tippte. Also beschränkte er sich auf ein aufmunterndes Zunicken, das Frings erst nicht wahrnahm, weil er nicht aufsah. Aber dann kam er doch herüber.
»Die Pause hast du dir redlich verdient, was?«, sagte der Exkommissar.
»Wer hätte diesen schöngeistigen Menschen so was zugetraut?« Frings machte eine Geste, als wischte er sich den Schweiß von der Stirn. »Mannomann, wenn das so weitergeht, beißt hier noch einer ins Gras.«
»Das wird schon«, beruhigte ihn de Jong grinsend. »Aber vor dem zweiten Durchgang solltest du deine Kandidaten vorsichtshalber auf Waffen untersuchen.«
»Kann ich dich gleich noch kurz sprechen? Ich meine, falls ich das hier heil überstehen sollte.«
»Worum geht’s denn?«
»Ach, keine große Sache. Nur ein mittleres Dilemma. Wie verträgt man sich wieder mit seinem Chef, nachdem man ihn in den Arsch getreten hast? Das ist die Frage.«
»Welchem Chef?«
»Das erklär ich dir gleich, ich …« Oliver sah de Jong nicht mehr an. Sein Blick schweifte ab und richtete sich auf eine Frau in einem schwarzen Abendkleid, die ein paar Meter entfernt stand und Frings auffordernd zuwinkte. »Moment, aber warte mal kurz …« Damit ließ er de Jong stehen und trat zu ihr.
Der Exkommissar spazierte in der Eingangshalle des Museums herum, die erfüllt war vom Schwatzen der Besucher, die mit Gläsern in der Hand die erste Halbzeit der Veranstaltung diskutierten. An den Büchertischen in der Nähe des Eingangs, auf denen Zu guter Letzt und Das Buchstabenzimmer stapelweise feilgeboten wurden, hatten sich Schlangen gebildet.
»Na, was sagen Sie? Zufrieden mit der Show?«
Vor ihm stand ein Mann mit einer Flasche Mineralwasser in der Hand. Ungefähr so alt wie de Jong, aber kleiner. Und fülliger.
»Da scheint mir so einiges aus dem Ruder gelaufen zu sein«, sagte der Exkommissar.
»Brillant beobachtet.« Der Mann hatte spärliches Haar, das sich bemühte, kahle Stellen zu bedecken; de Jong musste an den diesjährigen Waldzustandsbericht denken und an die besorgniserregenden Fernsehbilder, die ihn illustriert hatten. Im Gesicht des Mannes dominierten Pausbacken, die man eigentlich als Hängebacken bezeichnen musste, und die Augen versteckten sich hinter einer grün getönten Brille mit weißer Fassung, an der Elton John seine Freude gehabt hätte. »Kaiser Nero, der angeblich kein Blut sehen konnte, soll gesagt haben: ›Es gibt nichts Widerwärtigeres als Gladiatorenkämpfe. Aber wenn die Leute auf Gemetzel stehen, will ich kein Spielverderber sein.‹«
»Das klingt wirklich original nach ihm.« De Jong sah sich nach Frings um, konnte ihn aber nirgends mehr entdecken.
Der Mund unter der grünen Brille verbreiterte sich zu einem kultivierten Lächeln. »Na ja, immerhin könnte er es doch gesagt haben. Heute Abend jedenfalls würde es perfekt passen, oder nicht?«
»Sie meinen, den Leuten gefällt das Spektakel, und das ist die Hauptsache?«
Der Pausbäckige hob einen Daumen zum Zeichen, dass er genau das gemeint hatte.
»Mir gefällt es jedenfalls nicht«, sagte Giulia. De Jong bemerkte erst in diesem Moment, dass sie sich zu ihnen gesellt hatte.
»Das erstaunt mich jetzt nicht«, meinte der Mann, und sein heiterer Ton bekam eine leicht spöttische Färbung. »Immer noch die reine Lehre, was? Genau wie früher.«
»Früher?«, hakte de Jong neugierig nach.
»Niklas.« Giulia wies mit der Hand auf de Jong und dann auf den Mann mit der grünen Brille. »Gunnar.«
»Oswald.« Gunnar streckte de Jong die Hand hin.
»Ja, was denn jetzt?«, fragte de Jong und ergriff die Hand.
»Gunnar Oswald.«
»So wie der Präsidentenmörder?«
»Weder verwandt noch verschwägert.« Oswald deutete in Richtung Bühne. »Dieser Kerl mit der Krawatte, der die Streithähne davon abhält, sich zu zerfleischen, das ist mein Mann.«
De Jong wunderte sich. »Olli Frings ist Ihr Mann?«
Oswald nickte. »Schlägt er sich nicht wacker? Auch wenn er sich den Job sicher gemütlicher vorgestellt hat.« Damit wandte er sich an Giulia. »Das musst selbst du zugeben.«
»Ihr kennt euch?«, fragte de Jong.
»Na ja, kennen wäre viel zu viel gesagt«, meinte Giulia und widersprach damit Oswald, der die Frage mit einem Nicken bejahte. »›Kannten‹ trifft es wohl eher.«
»Uralte Bekannte«, erklärte der Mann neben ihr und hob sein Fläschchen mit Mineralwasser. »Giuli und ich haben zusammen studiert.«
Giuli, dachte de Jong, Bekannter wäre zu viel gesagt, aber er nennt sie Giuli.
»Nur eine gewisse Zeit lang«, präzisierte Giulia.
Oswald hielt sein Getränk immer noch erhoben. »Will jemand ein Wasser? Ich brauche jedenfalls noch eins.«
»Von ihm hast du mir nie erzählt«, sagte de Jong, sobald Oswald zum Getränkestand abgezogen war, und er klang irgendwie vorwurfsvoll.
»Nö.« Sie zuckte mit den Schultern, als könnte sie sich kaum etwas vorstellen, das weniger erzählenswert war. »Ich hatte ihn auch glatt vergessen.«
»Du warst also nicht mit ihm zusammen oder er mit dir?«
Sie verdrehte nur die Augen, als empfände sie allein die Vorstellung als Beleidigung. »Hast du es nicht bemerkt? Er riecht aus dem Mund.«
»Und sonst?«
»Soviel ich weiß, hat er einen Blog im Internet. Literaturkritiken oder so was Ähnliches. Aber hauptsächlich macht er, glaub ich, gar nichts. Wohnt auf einem Kotten draußen auf dem Land.«
»Einem kleinen, aber feinen Landsitz«, präzisierte Oswald, der mit seinem Mineralwasser gerade wieder neben sie trat. »Und sie hat ganz recht: Ich würde mich als Tagedieb bezeichnen.« Er hob einen Finger: »Nein, die genaue Bezeichnung wäre wohl Tagemeisterdieb.«
»Wenn man’s sich leisten kann«, kommentierte Giulia, und de Jong hörte beißenden Spott heraus. Oder war es Neid?
»Nun ja, um ehrlich zu sein, verfüge ich über ein kleines, aber feines Vermögen«, antwortete Oswald. »Eine Erbschaft, die mir ohne mein Zutun zugefallen ist. Sie ermöglicht mir die Erfüllung meiner Träume und das Leben auf großem Fuß.« Er nahm einen Schluck von seinem Wasser und ließ die Flasche dann durch die Luft kreisen, als wollte er das ganze Museum damit umfassen. »Wenn man bedenkt, dass in diesem Haus sozusagen alles angefangen hat. Ich habe damals hier als Aushilfe gejobbt, um mein Studium zu finanzieren. Tja, da hat sich inzwischen so vieles verändert …« Die Flasche hatte ihren Rundflug beendet und zeigte auf Giulia. »Und wie steht’s mit dir? Es wundert mich schon ein bisschen, dich bei diesem skurrilen Schauspiel anzutreffen. Ich wette, du hättest dich viel lieber gelangweilt, wenn auch auf hochliterarische Weise, hab ich recht?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn du doch mal eine Beschäftigung suchen solltest, was hältst du davon, Boxkämpfe zu managen?«
»Vielleicht mach ich das ja mal. Aber du kennst mich: Die Literatur liegt mir einfach zu sehr am Herzen.«
Sie lachte laut auf.
»Du magst so was wie das hier peinlich finden.« Er schüttelte den Kopf. »Ich ja auch, aber das alles ist nicht von Belang. Aufmerksamkeit ist heutzutage alles. Aufmerksamkeit ist das Gold unserer Mediengesellschaft. Ohne sie werden gedruckte Bücher bald Geschichte sein.«
»Wenn du es sagst.« Giulia sah auf die Uhr. »Es geht jetzt weiter.« Sie klang genervt.
Gunnar Oswald winkte zum Abschied mit seiner Flasche. »Versprecht mir, dass ihr mich mal draußen besuchen kommt. Auf meiner bescheidenen Ranch. Das müsst ihr unbedingt.«
Giulia zog eine Grimasse.
»Er scheint doch ganz nett zu sein«, meinte de Jong, während sie zu ihrem Platz zurückehrten.
»Er ist genauso wie früher«, zischte sie. »Hat sich kein bisschen verändert.«
»Aber er hat recht, so ein Wortgemetzel hat es in sich«, wandte de Jong ein. »Das muss man erst mal auf die Beine stellen.«
Sie blieb abrupt stehen und musterte ihn mit einem finsteren Blick.
»Also ich meine für mich als Laien«, ruderte er schnell, wenn auch nicht zurück, so doch wenigstens zur Seite. »Als einer, der einfach nur was erleben will. Aber wenn es dich nervt, dann gehen wir einfach und machen was anderes, was meinst du?«
Sie machte ein Gesicht, als würde sie das in Betracht ziehen. Aber dann ließ sie ihn stehen, rauschte an ihm vorbei und begab sich an ihren Platz. Er folgte ihr. Von jetzt an herrschte angespanntes Schweigen zwischen ihnen, auch als Oliver Frings kurz darauf auf die ansonsten leere Bühne trat. Da stand er, mit dem Mikro in der Hand, zwischen unbesetzten, mintfarbenen Sitzmöbeln, und wartete darauf, dass Ruhe einkehrte. Schließlich räusperte er sich wie ein Busfahrer ins Mikro, um gleich darauf eine Erklärung abzugeben. Die leichten Differenzen, die unter den Podiumsgästen während der ersten Hälfte hier und da aufgeflammt seien, hätten während der Pause leider nicht beigelegt werden können, im Gegenteil. Sodass die Beteiligten darin übereingekommen seien, dass eine Fortführung in dieser Form nicht sinnvoll sei. Alle drei hätten zwar ihre Bereitschaft bekundet, den Abend fortzuführen, jedoch unter der einen Bedingung, dass die jeweils beiden anderen verzichteten, sich auf der Bühne zu zeigen, sodass in diesem Punkt leider keine Einigung erreicht werden konnte. Insofern müsse leider auch die beliebte Publikumsabstimmung dieses Mal ausfallen. Von Veranstalterseite sei man aber überzeugt, spätestens bis zur Folgeveranstaltung, dem sogenannten Endspiel, das zum Ausklang von Münster liest! stattfinden werde, eine Lösung zu finden. Schon jetzt könne man garantieren, dass für alle heutigen Gäste der Eintritt frei sein werde.
»Na, das nenne ich mal einen gelungenen Abend«, spottete Giulia und erhob sich von ihrem Stuhl.
»Was hältst du davon, wenn wir noch irgendwo was essen?«, schlug de Jong vor. »Als Entschädigung für dieses Desaster.«
»Desaster?« Sie drehte sich nicht mal zu ihm um. »Du warst doch richtig begeistert.«
»Begeistert würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber weil dieser Gunnar eben meinte, dass …«
»Klar, Gunnar!«, schäumte Giulia, die aus irgendeinem Grund auf Streit aus zu sein schien. »Er hatte auch immer schon ein Faible für unterste Schubladen.«
»Auch? Also gut, aber du meinst jetzt nicht, dass das für mich gilt, das mit den Schubladen …«
»Weißt du was: Warum gehst du nicht mit ihm noch irgendwo was essen? Ihr hättet euch bestimmt viel zu erzählen.«
»Nein, wieso denn? Das hast du aber ganz falsch …«
»Ich jedenfalls werde jetzt nach Hause gehen und mich langweilen. Auf hochliterarische Weise.«
6. Kapitel
Es war kurz vor zehn, also noch nicht spät am Abend. Trotzdem hätte de Jong Giulia gern nach Hause begleitet, wenn sie nicht so stur darauf bestanden hätte, ihn zu ignorieren. Er unternahm ein paar halbherzige Versuche, mit ihr in Kontakt zu kommen, aber sie ließ sich nicht herab, mit ihm zu sprechen. Was er gut verstehen konnte: Aus eigener Erfahrung wusste er, dass es besser war, ein Geschmolle bis zum Ende durchzuziehen, hatte man es einmal angefangen; Einknicken war keine Option, wenn man nicht alle Glaubwürdigkeit verlieren wollte. Also ließ er Giulia ziehen, holte sein Handy aus der Tasche und rief Achim Bühlow an. Der ging aber nicht ran, und der Exkommissar beschloss notgedrungen, den Heimweg anzutreten. Da rief der Hauptkommissar doch zurück. Und es stellte sich heraus, dass er zufälligerweise gerade in der Stadt weilte, gar nicht weit von de Jong entfernt.
»Außerdem hatte ich noch einen Anschlag auf dich vor«, sagte er.
»Na, vielen Dank«, sagte de Jong.
Sie verabredeten sich in einer Kneipe in der Nähe, die sich Lauschige Ecke nannte und die Bühlow als heimelig und gemütlich beschrieb. Eine Beschreibung, die vermutlich aus dem Bewertungs-Internet stammte, da sie mit der Realität nicht viel zu tun hatte. De Jong war als Erster vor Ort und fand ein düsteres Halbdunkel vor, stickig und bierdunstig, das akustisch von einer etwa dreißigköpfigen Männerrunde beherrscht wurde, die alle paar Sekunden irgendein Lied jenseits aller Tonalität anstimmte. Zwischen den Gesängen knallten sie ihre Bierkrüge auf den Tisch, trampelten mit den Füßen und brüllten: »Ausziehen, ausziehen!«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: