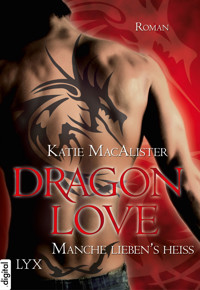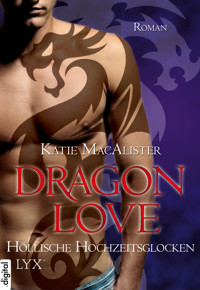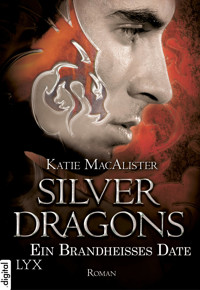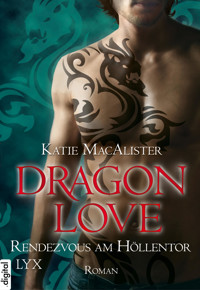9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Light-Dragons-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die romantischen und turbulenten Geschichten rund um die Drachenclans gehen weiter! Tully Sullivan führt mit ihrem neunjährigen Sohn ein gewöhnliches Leben in der Vorstadt. Bis sie eines Tages erfährt, dass sie angeblich Isolde de Bouchier ist - eine Legende unter den Werdrachen. Sie begegnet dem Drachen Baltic, der sich mit seiner raubeinigen Art in ihr Herz schleicht. Doch dann soll Tully für einige Verbrechen aus Isoldes Vergangenheit bestraft werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
KATIE MACALLISTER
LIGHT DRAGONS
DRACHE WIDER WILLEN
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Margarethe van Pée
Inhalt
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Impressum
Kurz nach Beendigung dieses Buches starb mein geliebtes Hundemädchen Jazi. Zwölf Jahre lang war sie meine ständige Begleiterin, und während ich in die Tasten haute, wich sie buchstäblich nicht von meiner Seite und lag in ihrem Körbchen neben meinem Schreibtisch. Sie war verwöhnt, fordernd und äußerst stur, wenn es darum ging, ihren Willen durchzusetzen. Aber sie schenkte mir auch mehr Glück und Liebe, als ich mir jemals hätte wünschen können. Dieses Buch ist ihr gewidmet, damit die Erinnerung an sie niemals erlischt.
1
»Wenn Lady Alice dich hier findet, kannst du stundenlang auf den Knien liegen und beten.«
Ich zuckte zusammen beim Klang der leisen, rauen Stimme, aber mein Herzschlag beruhigte sich wieder, als ich sah, wer mich entdeckt hatte. »Beim Allmächtigen! Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Ulric!«
»Das glaube ich gern«, erwiderte der alte Mann und stützte sich auf eine ramponierte Hacke. »Das kommt wahrscheinlich von deinem schlechten Gewissen. Solltest du nicht bei den anderen Frauen im Privatgemach sein?«
Ich klopfte die Erde um die früh blühende Rose fest, die ich gerade vom Unkraut befreit hatte, und schnaubte damenhaft. »Ich durfte gehen.«
»Ach ja? Und weswegen? Doch nicht etwa, um deine Näharbeiten und all die anderen Dinge, die Lady Alice dir beizubringen versucht, liegen zu lassen, oder?«
Ich erhob mich, klopfte mir die Erde von Händen und Knien und blickte auf den kleinen Mann herunter, um ihn einzuschüchtern. Allerdings wusste ich von vorneherein, dass mir das nicht gelingen würde. Ulric hatte mich schon als winzigen Säugling in Windeln gekannt. »Und was geht Euch das an, guter Mann?«
Er grinste und zeigte seine schwarzen Zahnstummel. »Wenn du willst, kannst du sehr damenhaft sein. Nun, ich möchte wissen, ob deine Mutter dir erlaubt hat, hier im Garten zu sein, oder ob du eigentlich lernen sollst, dich wie eine richtige Dame zu betragen.«
Ich trat nach einem Maulwurfshügel. »Ich durfte gehen… zum Örtchen. Du weißt doch, wie schlimm es immer ist – ich brauchte einfach frische Luft, um mich von dem Vorfall zu erholen.«
»Na, das hast du ja wohl reichlich getan, dem ganzen Unkraut nach zu urteilen, das du gejätet hast. Geh jetzt wieder in die Gemächer zu den anderen Frauen, ehe deine Mutter mich noch ausschimpft, weil ich dich hier draußen herumlaufen lasse.«
»Ich … äh … ich kann nicht.«
»Und warum nicht?«, fragte er misstrauisch.
Ich räusperte mich und versuchte, nicht im Geringsten schuldbewusst auszusehen. »Es hat einen … Zwischenfall gegeben.«
»Ach ja?« Sein Misstrauen schien sich zu verhärten. »Was für einen Zwischenfall?«
»Nichts Ernstes. Nichts von Bedeutung.« Ich zupfte ein welkes Blatt von einem Rosenbusch. »Ich habe nichts damit zu tun, auch wenn du das offenbar glaubst, was ich äußerst beleidigend finde.«
»Was für einen Zwischenfall?«, wiederholte er, ohne auf meine empörten Unschuldsbekundungen einzugehen.
Seufzend warf ich das trockene Blatt weg. »Es geht um Lady Susan.«
»Was hast du denn der Kusine deiner Mutter jetzt schon wieder getan?«
»Nichts! Ich habe nur etwas Lilienwurzeltee gekocht und ihn unglückseligerweise im Privatgemach neben ihren Stuhl gestellt, mit einer Tasse und einem kleinen Töpfchen Honig. Wie konnte ich denn ahnen, dass sie alles trinken würde? Außerdem dachte ich, jeder wüsste, dass Lilienwurzeltee heftige Auswirkungen auf unsere Gedärme hat.«
Ulric warf mir einen Blick zu, als hätten sich meine Gedärme vor ihm gehen lassen.
»Sie hat so laut auf dem Abort geschrien, dass Mutter mir erlaubt hat, für eine Weile zu verschwinden, während sie einen von Papas Wachen holt, damit er die Tür zum Abort aufbricht. Ihre Hofdamen waren nämlich der Meinung, dass Lady Susan hineingefallen sei und jetzt in der Rinne stecken würde.«
Er warf mir einen wahrhaft entsetzten Blick zu.
»Ich hoffe nur, sie sieht auch die positive Seite des Ganzen«, fügte ich hinzu und trat mit der Schuhspitze auf den Maulwurfshügel.
»Grundgütiger, du bist fürwahr ein merkwürdiges Kind. Was gibt es denn für eine positive Seite daran, sich die Eingeweide aus dem Leib zu spucken, während man im Abort feststeckt?«
Ich warf ihm einen hochmütigen Blick zu. »Lady Susan hat immer ganz entsetzliche Winde. Sie riecht manchmal schlimmer als die Latrine! Da hat der Lilienwurzeltee bestimmt für Abhilfe gesorgt. Eigentlich sollte sie mir dankbar sein.«
Ulric blickte zum Himmel und murmelte etwas Unverständliches.
»Außerdem kann ich jetzt nicht hineingehen. Mutter sagte, ich solle ihr nicht in die Quere kommen, weil sie alle Hände voll zu tun hat, alles für Vaters Besuch vorzubereiten.«
Das stimmte nicht ganz – eigentlich hatte meine Mutter mich angefahren, dass ich ihr aus dem Weg gehen und mich nützlich machen solle, statt Vorschläge zu unterbreiten, wie man die Tür des Aborts aufbrechen könne, und was konnte schon nützlicher sein, als im Garten Unkraut zu jäten? Die gesamte Burg wurde schließlich für einen wichtigen Gast herausgeputzt, und ich wollte, dass auch der Garten einen guten Eindruck machte.
»Mach, dass du wegkommst!« Ulric scheuchte mich aus dem Garten. »Sonst erzähle ich deiner Mutter, wo du die letzten Stunden verbracht hast, statt deinen eigentlichen Pflichten nachzugehen. Wenn du brav bist, helfe ich dir vielleicht später bei den Rosen.«
Ich lächelte so unschuldig, wie es nur ein siebzehnjähriges Mädchen vermochte, und lief aus dem Schutz des Gartens den dunklen Vorsprung entlang, der in den oberen Burghof führte. Es war beinahe schon Sommer, ein prachtvoller Morgen, und die Dienstboten meines Vaters gingen ihren täglichen Pflichten mit weniger Klagen als sonst nach. Am Stall blieb ich stehen, um mir aus dem letzten Wurf kleiner Kätzchen ein hübsches schwarz-weißes Tierchen auszusuchen, welches ich gerne behalten wollte. Gerade war ich auf dem Weg zur Küche, um zu sehen, ob ich den Köchen ein bisschen Brot und Käse abschwatzen konnte, als dumpfes Hufgetrappel meine Aufmerksamkeit erregte.
Von der Küchentür aus beobachtete ich eine Gruppe von vier Männern, allesamt in Rüstung und bewaffnet, die in den Burghof ritten.
»Ysolde! Was machst du hier? Warum bist du nicht oben im Wintergarten und kümmerst dich um Lady Susan? Mutter hat nach dir gesucht!« Margaret, meine ältere Schwester, tauchte aus den Tiefen der Küche auf, um mich auszuschimpfen.
»Dann habt ihr sie also aus dem Abort befreit?«, fragte ich unschuldig.
»Ja.« Sie kniff die Augen zusammen. »Es war schon merkwürdig, dass die Tür so klemmte. Fast, als ob jemand sich daran zu schaffen gemacht hätte.«
Ich riss die Augen auf und blinzelte. »Arme, arme Lady Susan. Auf dem Abort gefangen und ihre Gedärme in Aufruhr. Glaubst du, sie ist verflucht worden?«
»Ja, und ich weiß auch, von was. Oder vielmehr, von wem.« Meine Schwester wollte mir gerade eine Strafpredigt halten, als eine Bewegung im Burghof ihre Aufmerksamkeit erregte. Sie blickte hinüber und zog mich rasch in die dämmerige Küche. »Du solltest nicht hier herumstehen, wenn Vater Gäste hat.«
»Wer ist es denn?«, fragte ich und versuchte, an ihr vorbei auf den Hof zu schauen.
»Ein wichtiger Magier.« Sie drückte eine gerupfte Gans an ihre Brust, während sie die Männer beobachtete. »Der da in Schwarz, das muss er sein.«
Alle Männer waren bewaffnet, ihre Schwerter und Kettenhemden glitzerten hell in der Sonne, aber nur einer trug keinen Helm. Er stieg vom Pferd und hob die Hand zum Gruß, als mein Vater die Burgtreppe herunterkam.
»So einen Magier habe ich noch nie gesehen«, sagte ich zu meiner Schwester. Obwohl seine Rüstung mindestens fünfzig Pfund zu wiegen schien, bewegte er sich leichtfüßig. »Er sieht eher aus wie ein Krieger. Sieh mal, er hat Zöpfe im Haar, so wie der Schotte, der vor ein paar Jahren zu Vater gekommen ist. Was will er wohl von ihm?«
»Wer weiß? Vater ist bekannt für seine Kräfte; vermutlich will der Magier ihn wegen arkaner Angelegenheiten um Rat fragen.«
»Hmm. Arkane Angelegenheiten«, sagte ich mürrisch.
Die Mundwinkel meiner Schwester zuckten. »Ich dachte, du wolltest dich nicht mehr darüber ärgern.«
»Das tue ich auch nicht«, erwiderte ich abwehrend. Mein Vater und der Krieger begrüßten sich. »Es ist mir völlig egal, dass ich Vaters Fähigkeiten nicht geerbt habe. Du kannst sie alle haben.«
»Wohingegen du kleiner Wechselbalg lieber im Garten in der Erde buddelst, statt zu lernen, wie man einen blauen Feuerball heraufbeschwört.« Lachend zog Margaret Grashalme aus dem Spitzenbesatz an meinem Ärmel.
»Ich bin kein Wechselbalg. Mutter sagt, ich sei ein Geschenk Gottes, und deshalb sind meine Haare auch blond, während du genau wie Papa und sie rote Haare hast. Wozu braucht ein Magier drei Wachen?«
Margaret zog sich von der Tür zurück und schubste mich beiseite. »Warum nicht?«
»Wenn er ein ebenso mächtiger Magier ist wie Vater, dann braucht er doch niemanden, der ihn beschützt.« Ich beobachtete, wie meine Mutter vor dem Fremden einen Knicks machte. »Er sieht einfach … nicht richtig aus. Für einen Magier jedenfalls.«
»Es spielt keine Rolle, wie er aussieht – du sollst dich sowieso fernhalten. Wenn du deinen Pflichten nicht nachgehen willst, kannst du ja mir helfen. Ich habe genug zu tun. Zwei der Köche haben die Pocken, und Mutter hat alle Hände voll mit dem Gast zu tun. Ysolde? Ysolde!«
Ich schlüpfte aus der Küche, weil ich einen besseren Blick auf den Krieger erhaschen wollte, der mit meinen Eltern in den Turm ging, der uns als Wohnung diente. Die Art, wie der Mann sich bewegte, zeugte von unterschwelliger Macht, wie ein wilder Eber, bevor er angreift. Trotz des schweren Kettenhemdes waren seine Bewegungen anmutig, und lange schwarze Haare umrahmten glänzend wie Rabenflügel sein Gesicht, das ich leider nicht sehen konnte.
Die anderen Männer folgten ihm, und obwohl auch sie sich forsch bewegten, hatten sie nicht seine Ausstrahlung.
Ich huschte hinter ihnen her, in ausreichendem Abstand, damit mein Vater mich nicht bemerkte. Ich wollte zu gerne wissen, was dieser seltsame Magier-Krieger wollte. Ich war gerade an der untersten Stufe angelangt, als der Letzte aus der Begleittruppe des Magiers sich plötzlich umdrehte.
Seine Nüstern blähten sich, als ob er etwas riechen würde, aber das war es nicht, was mir Gänsehaut verursachte. Seine Augen waren dunkel, und als ich ihn anblickte, verengten sich die Pupillen wie bei einer Katze, die aus dem dunklen Stall ins Sonnenlicht tritt. Nach Atem ringend wirbelte ich herum und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Das Gelächter des seltsamen Mannes folgte mir, verspottete mich und hallte in meinem Kopf wider, bis ich glaubte, laut schreien zu müssen.
»Ah, du bist wach.«
Meine Augenlider waren bleischwer, aber schließlich gelang es mir doch, sie zu öffnen. Ich starrte direkt in die dunkelbraunen Augen einer Frau, deren Gesicht sich dicht vor meinem befand. Erschrocken schrie ich auf. »Aaahhh!«
Sie sprang zurück, als ich mich aufsetzte. Mein Herz klopfte wie verrückt, und ein schwacher, dumpfer Schmerz vermittelte mir das Gefühl, dass mein Kopf verletzt war.
»Wer bist du? Gehörst du in den Traum? Ja, nicht wahr? Du bist nur ein Traum«, krächzte ich. Ich berührte meine Lippen. Sie waren trocken und aufgesprungen. »Allerdings waren die Leute da mittelalterlich gekleidet, und du trägst Hosen. Trotzdem, das war ein ausgesprochen realer Traum. Nicht so interessant wie der letzte, aber auch nicht uninteressant, dafür aber umso realer. Sehr real. So sehr, dass ich hier liege und im Traum mit mir selber rede.«
»Ich bin kein Traum«, sagte die Traumfrau dicht vor meinem Gesicht. »Und du bist nicht allein, sondern redest mit mir.«
Ich war klug genug, nicht hastig aufzuspringen, dazu hatte ich zu starke Kopfschmerzen. Langsam hob ich die Beine über die Bettkante. Während ich aufstand, fragte ich mich, ob ich jetzt wohl zu träumen aufhören und im wirklichen Leben erwachen würde.
Ich war sehr wackelig auf den Beinen, und die Traumdame ergriff mich am Arm und hielt mich fest.
Ihr Griff hatte so gar nichts Traumhaftes an sich. »Du bist real«, sagte ich überrascht.
»Ja.«
»Du bist eine reale Person, nicht Teil eines Traums?«
»Ich meine, das hätten wir schon geklärt.«
Ich spürte einen irritierten Ausdruck über mein Gesicht kriechen – kriechen, weil mein Gehirn noch nicht wach war. »Wenn du real bist, darf ich dann fragen, wie du dazu kommst, dich so horrormäßig nah über mein Gesicht zu beugen? Ich hätte mir vor Schreck fast in die Hose gemacht.«
»Ich habe nur deine Atmung überprüft. Du hast gestöhnt und Geräusche gemacht, als wolltest du aufwachen.«
»Ich habe geträumt«, sagte ich, als ob das alles erklären würde.
»Ja, das hast du wiederholt erwähnt.« Die Frau, die eine Hautfarbe wie geöltes Mahagoniholz hatte, nickte. »Das ist gut. Du beginnst dich zu erinnern. Ich habe mich gefragt, ob der Drache in dir vielleicht so mit dir spricht.«
Ganz schwach begannen Alarmglocken in meinem Kopf zu läuten, so als ob man in einem winzigen Zimmer mit jemandem eingesperrt ist, der offensichtlich im nächsten Moment durchdreht. »Na, reizend. Ich fühle mich beschissen und sitze hier mit einer Irren fest.« Erschrocken schlug ich die Hand vor den Mund, weil ich die Worte tatsächlich ausgesprochen hatte, statt sie nur zu denken. »Hast du das gehört?«, fragte ich hinter vorgehaltener Hand.
Sie nickte.
Ich ließ die Hand sinken. »Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Es ist nur … na ja … wie soll ich sagen? Drachen? Das ist ja wohl völlig absurd.«
Sie runzelte die Stirn. »Du wirkst ein bisschen verwirrt.«
»Das ist die Untertreibung des Jahres. Wäre es sehr unhöflich, wenn ich dich fragen würde, wer du bist?« Vorsichtig rieb ich mir über die Stirn und schaute mich im Zimmer um.
»Mein Name ist Kaawa. Mein Sohn ist Gabriel Tauhou, der silberne Wyvern.«
»Ein silberner was?«
Sie schwieg und musterte mich kühl. »Muss das wirklich sein?«
»Was? Dass ich Fragen stelle oder dass ich meinen Kopf reibe? Aber ja. Ich stelle immer Fragen, weil ich von Natur aus neugierig bin. Da kannst du jeden fragen; das werden dir alle bestätigen. Und ich reibe mir immer den Kopf, wenn ich das Gefühl habe, jemand sei darübergetrampelt.«
Sie schwieg erneut. »Du bist nicht so, wie ich erwartet habe.«
Meine Augenbrauen funktionierten immerhin noch so gut, dass ich sie hochziehen konnte. »Du hast mich zu Tode erschreckt, indem du mich aus wenigen Millimetern Entfernung angestarrt hast, und ich bin nicht so, wie du erwartet hast? Was soll ich denn dazu sagen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer du bist, abgesehen davon, dass du Kaawa heißt und so klingst, als ob du aus Australien wärst. Ich weiß nicht, wo ich bin, und was ich hier tue. Wie lange habe ich überhaupt geschlafen?«
Sie blickte auf die Uhr. »Fünf Wochen.«
Ich warf ihr einen Blick zu, dem sie entnehmen konnte, dass ich mich auf keinen Fall von ihr auf den Arm nehmen lassen würde. »Sehe ich etwa so aus, als ob du mir jeden Scheiß erzählen könntest? Warte – Gareth hat dich dazu angestiftet, oder? Er versucht, mich hereinzulegen.«
»Ich kenne keinen Gareth«, erwiderte sie und trat ans Fußende des Bettes.
»Nein …« Ich runzelte die Stirn, während mein Verstand, der immer noch ganz benebelt vom langen Schlafen war, langsam wieder zum Leben erwachte. »Du hast recht. Gareth würde das nicht tun – er hat absolut keinen Sinn für Humor.«
»Du bist vor fünf Wochen und zwei Tagen in eine Starre verfallen. Seitdem hast du geschlafen.«
Mir lief es kalt den Rücken hinunter. In ihren Augen sah ich, dass sie die Wahrheit sagte. »Das kann nicht sein.«
»Es ist aber so.«
»Nein.« Vorsichtig schüttelte ich den Kopf. »Es ist noch nicht an der Zeit; ich dürfte erst in sechs Monaten den nächsten Anfall haben. Oh Gott, du bist keine Irre aus Australien, die unschuldige Leute anlügt, oder? Du sagst die Wahrheit, was? Brom! Wo ist Brom?«
»Wer ist Brom?«
Voller Panik sprang ich auf, als mein Körper mich eines Besseren belehrte. Sofort brach ich auf dem Boden zusammen. Meine Beine fühlten sich an wie aus Gummi, und meine Muskeln zitterten vor Anstrengung. Ich ignorierte die Schmerzen, die der Sturz verursacht hatte, und zog mich mühsam an der Bettkante hoch. »Ein Telefon. Gibt es hier ein Telefon? Ich muss dringend telefonieren.«
Als ich wackelig wieder auf meinen Füßen stand, ging die Tür auf.
»Ich habe gehört, wie … oh. Sie ist ja aufgestanden. Hallo, Ysolde.«
»Hallo.« Mein Magen hob sich mitsamt dem Fußboden. Ein paar Sekunden lang klammerte ich mich ans Bett, bis alles wieder normal war. »Wer bist du?«
Sie warf der anderen Frau einen verwirrten Blick zu. »Ich bin May. Wir kennen uns schon, weißt du das nicht mehr?«
»Nein, überhaupt nicht. Hast du ein Telefon, May?«
Wenn die Frage sie überraschte, so ließ sie sich nichts anmerken. Sie zog ein Handy aus ihrer Jeanstasche und reichte es mir. Ich ergriff es und starrte sie einen Moment lang an. Sie hatte etwas an sich, das mir vertraut vorkam … und doch war ich sicher, sie nie zuvor gesehen zu haben.
Verwirrt schüttelte ich den Kopf und tippte eine Nummer ein. Ich hielt inne, als mir klar wurde, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich war. »Was ist das hier für ein Land?«
May und Kaawa wechselten einen Blick, und May antwortete: »England. Wir sind in London. Wir hielten es für besser, dich nicht zu weit wegzubringen. Bei Drake konntest du aber nicht bleiben, er ist ein bisschen durchgedreht seit der Geburt der Zwillinge.«
»London«, sagte ich und versuchte verzweifelt, im schwarzen Abgrund meiner Erinnerung etwas zu erkennen. Aber da war nichts. Das war allerdings nicht ungewöhnlich nach einem Vorfall. Glücklicherweise funktionierten ja ein paar Gehirnzellen noch, und wenigstens an meine Telefonnummer konnte ich mich noch erinnern.
Das Freizeichen ertönte leise an meinem Ohr. Ich hielt den Atem an und zählte, wie oft es klingelte, bevor jemand am anderen Ende abnahm.
»Ja?«
»Brom«, sagte ich. Ich hätte am liebsten geweint, als ich seine Stimme hörte. »Ist alles in Ordnung?«
»Ja. Wo bist du?«
»In London.« Ich warf der kleinen, dunkelhaarigen Frau, die so aussah, als sei sie geradewegs einem Stummfilm entsprungen, einen Blick zu. »Bei … äh … Leuten.« Ob die Leute verrückt oder normal waren, musste ich erst noch herausfinden.
»Du bist immer noch in London? Du wolltest doch nur drei Tage dortbleiben. Du hast gesagt, drei Tage, Sullivan. Und jetzt ist es schon über einen Monat.«
Er klang verletzt, und das gefiel mir gar nicht. »Ich weiß. Es tut mir leid. Ich … es ist etwas passiert. Etwas Bedeutendes.«
»Was denn?«, fragte er neugierig.
»Ich weiß nicht. Ich kann nicht klar denken«, sagte ich aufrichtig. Mein Gehirn fühlte sich an wie Zuckerwatte. »Die Leute, bei denen ich bin, haben sich um mich gekümmert, als ich geschlafen habe.«
»Ach so, so etwas. Das habe ich mir schon gedacht. Gareth war sauer, als du nicht wiedergekommen bist. Er hat deinen Chef angerufen und ihm Vorwürfe gemacht, weil er dich so lange festhält.«
»Oh nein«, sagte ich. Meine Schultern sanken herab, als ich an den mächtigen Erzmagier dachte, dessen Lehrling ich war.
»Das war echt cool! Das hättest du hören müssen! Dr. Kostich hat Gareth angeschrien, er solle ihn nicht mehr anrufen und es ginge dir gut, aber er würde ihm nicht sagen, wo du seiest, weil Gareth dich sowieso nur missbrauchen würde. Und dann hat Gareth gesagt, er solle sich besser in Acht nehmen, weil er nicht der Einzige sei, der Dinge geschehen lassen könne, und Kostich sagte, ja klar, und Gareth sagte, genau, seine Schwägerin könne Geister beschwören, und dann hat Ruth ihn geschubst und ihm so fest ins Ohr gebissen, dass es geblutet hat, und danach habe ich einen toten Fuchs gefunden. Kannst du mir fünfzig Dollar geben, damit ich Natron kaufen kann?«
Blinzelnd versuchte ich den Informationsfluss zu verarbeiten, der in mein Ohr strömte. Das musste ja eine schreckliche Szene mit Dr. Kostich gewesen sein, dachte ich, und dann erst fiel mir die seltsame Bitte auf. »Wozu brauchst du Natron?«
Brom seufzte. »Weil ich doch den toten Fuchs gefunden habe. Um ihn zu mumifizieren, braucht man bestimmt eine Menge Natron.«
»Ich glaube nicht, dass wir eine Fuchsmumie brauchen, Brom.«
»Das ist mein Hobby«, sagte er genervt. »Du hast doch gesagt, ich soll mir ein Hobby zulegen, und jetzt habe ich eines.«
»Als du gesagt hast, du würdest dich für Mumien interessieren, habe ich gedacht, du meinst die ägyptischen. Mir war nicht klar, dass du deine eigenen fabrizieren willst.«
»Du hast ja auch nicht gefragt«, erwiderte er, und dem konnte ich nichts entgegensetzen.
»Wir reden darüber, wenn ich zurück bin. Ich muss jetzt erst mal mit Gareth sprechen«, sagte ich, obwohl ich eigentlich keine Lust dazu hatte.
»Das geht nicht. Er ist in Barcelona.«
»Oh. Ist Ruth da?«
»Nein, sie ist mitgefahren.«
Panik stieg in mir auf. »Du bist doch nicht etwa allein zu Hause, oder?«
»Sullivan, ich bin kein Kind mehr«, antwortete er. Er klang empört, weil ich die Weisheit infrage stellte, die er während seiner ganzen neun Lebensjahre erworben hatte. »Man kann mich durchaus alleine lassen.«
»Aber doch nicht fünf Wochen lang …«
»Ist schon okay. Als Ruth und Gareth gefahren sind und du immer noch nicht zurück warst, hat Penny gesagt, ich könne bei ihr bleiben, bis du nach Hause kämest.«
Erleichtert sank ich gegen das Bett, ohne darauf zu achten, dass die beiden Frauen mich scharf beobachteten. »Dem Himmel sei Dank für Penny! Ich buche so schnell wie möglich einen Flug und komme nach Hause. Hast du einen Stift?«
»Ja, warte mal.«
Ich hielt die Hand über das Handy und blickte die Frau namens May an. »Gibt es hier eine Telefonnummer, die ich meinem Sohn für den Notfall geben kann?«
»Deinem Sohn?«, fragte sie und riss die Augen auf. »Ja. Hier.«
Ich ergriff die Karte, die sie aus der Tasche zog, und las Brom die Nummer vor. »Du bleibst bei Penny, bis ich dich holen komme, okay?«
»Ja, Sullivan, ich bin ja schließlich nicht behindert.«
»Ich habe dir doch gesagt, du sollst solche Ausdrücke nicht … ach, ist egal. Wir reden später darüber. Bleib einfach bei Penny, und wenn du mich brauchst, rufst du mich unter der Nummer an, die ich dir gegeben habe. Ach, und Brom?«
»Was?«, fragte er so gelangweilt, wie es nur neunjährige Jungs auf der ganzen Welt können.
Ich wandte den beiden Frauen den Rücken zu. »Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Denk immer daran, okay?«
»Okay.« Ich sah förmlich, wie er die Augen verdrehte. »Hey, Sullivan, warum hast du dein Dingens eigentlich jetzt gehabt? Ich dachte, es sollte erst an Halloween passieren.«
»Ist es aber nicht, und ich weiß auch nicht, warum es jetzt passiert ist.«
»Gareth wird bestimmt sauer sein, weil er es verpasst hat. Hast du … du weißt schon … das gute Zeug produziert?«
Mein Blick wanderte langsam durch das Zimmer. Es kam mir vor wie ein ganz normales Schlafzimmer, mit einer großen Kommode, einem Bett, zwei Stühlen, einem kleinen Tisch mit Tischdecke und einem weißen, steinernen Kamin. »Ich weiß nicht. Ich rufe dich später noch einmal an, wenn ich weiß, wann ich in Madrid lande, in Ordnung?«
»See you later, alligator«, antwortete er mit seinem Lieblingsspruch.
Ich lächelte. Er fehlte mir, und ich wünschte, ich könnte mich auf magische Weise in die kleine, vollgestopfte, laute Wohnung beamen, in der wir lebten, um ihn in die Arme zu nehmen und ihm durch die Haare zu wuscheln und wieder einmal darüber zu staunen, dass ich so ein intelligentes, wundervolles Kind hatte.
»Danke«, sagte ich und gab May das Handy zurück. »Mein Sohn ist erst neun. Er hat sich Sorgen um mich gemacht.«
»Neun.« May und Kaawa wechselten erneut einen Blick. »Neun … Jahre?«
»Ja, natürlich.« Ich wich ein wenig zurück, für den Fall, dass sich doch eine der Frauen als verrückt herausstellen sollte. »Es ist mir sehr peinlich, aber ich kann mich leider an keine von euch erinnern. Kennen wir uns?«
»Ja«, sagte Kaawa. Sie trug eine weite Hose und ein wunderschönes schwarzes Oberteil, das silbern mit allen möglichen Tiermotiven der Aborigines bestickt war. Ihre Haare waren zu mehreren Zöpfen geflochten und hinten im Nacken zusammengebunden. »Ich bin dir einmal begegnet, in Kairo.«
»Kairo?« Ich durchforstete den undurchdringlichen schwarzen Nebel, aus dem mein Gedächtnis bestand. Es tat sich nichts. »Ich glaube nicht, dass ich jemals in Kairo war. Ich lebe in Spanien, nicht in Ägypten.«
»Es ist schon eine Weile her«, sagte die Frau bedächtig.
Vielleicht hatte ich sie auf meinen Reisen mit Dr. Kostich kennengelernt. »Oh. Wie lange denn?«
Schweigend blickte sie mich einen Moment lang an, dann sagte sie: »Etwa dreihundert Jahre.«
2
»Ysolde ist wieder wach«, sagte May, als sich die Tür zum Arbeitszimmer öffnete.
Ich blickte von der Tasse Kaffee auf, in die ich gerade versonnen gestarrt hatte. Zwei Männer betraten den Raum, beide groß und gut gebaut. Seltsamerweise hatten beide graue Augen. Der erste blieb an Mays Stuhl stehen und strich ihr über die kurzen Haare, während er zu mir herüberblickte. Ich erwiderte den Blick, wobei ich milchkaffeebraune Haut, ein Ziegenbärtchen und schulterlange Dreadlocks registrierte.
»Wieder?«, fragte der Mann.
»Sie ist in Ohnmacht gefallen, nachdem sie das erste Mal aufgewacht ist.«
Ich musterte ihn. Seit einer Stunde glaubte ich nicht mehr, dass von May und Kaawa irgendeine Gefahr ausging – ich hatte duschen dürfen, sie wollten mir etwas zu essen machen, und sie hatten mir Kaffee gegeben. So etwas taten Verrückte nicht.
»Ah. Das hat aber hoffentlich keine Nachwirkungen gehabt, oder?«, fragte er.
»Wenn man davon absieht, dass zweiundfünfzig Elefanten in Springerstiefeln auf meinem Kopf herumsteppen«, sagte ich und warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Flasche mit Ibuprofen.
»Nein, keine mehr«, erklärte May entschieden und zog sie außer Reichweite. »Wenn du noch mehr nimmst, vergiftest du dich.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!