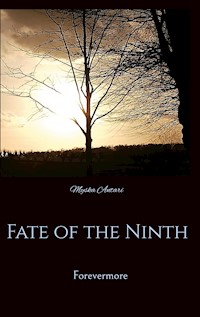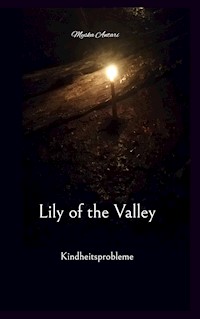
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lily of the Valley
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in die düstere Welt von Marius - Vampire, dunkle Geheimnisse und sein Kampf um die eigene Identität! In einer schicksalhaften Winternacht ändert sich Marius' Leben für immer. Als er gerade fünf Jahre alt ist, wird seine Geburtsfamilie von einem grausamen Vampir ausgelöscht. Und als wäre dies nicht schon schlimm genug, erfährt der junge Marius immer wieder Ablehnung von seinen Pflegefamilien, die ihn nie für lange Zeit behalten wollen. Als er schließlich doch eine Familie findet, die ihn adoptieren will, muss er feststellen, dass diese Vampire sind! Marius muss sich nicht nur mit der Tatsache abfinden, dass er Teil dieser Welt ist, sondern er erkennt auch, dass er selbst zum Vampir wird, sobald er die Volljährigkeit erreicht - es sei denn, er findet einen Weg, diesem Schicksal zu entkommen. Buch I der Lebensgeschichte des Marius Lionstone
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Michael, weil er immer für mich da ist.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
~Marius~
Kapitel 1: Der Überfall
~Trigon 12.02.2319~
Kapitel 2: Eine neue Familie I
~Trigon 21.02.2319~
Kapitel 3: Eine neue Familie II
~Trigon 06.07.2319~
Kapitel 4: Ein überraschendes Wiedersehen
~Trigon 08.07.2319~
~Trigon 09.12.2319~
Kapitel 5: Im Kloster
~Trigon 30.06.2320~
Kapitel 6: Ein neues Angebot
~Trigon 01.07.2320~
Kapitel 7: Ein neues Zuhause I
~Trigon 08.07.2320~
Kapitel 8: Ein neues Zuhause II
Kapitel 9: Ein neues Zuhause III
~Trigon 09.07.2320~
Kapitel 10: Der seltsame Junge
Kapitel 11: Nächtlicher Unterricht
Kapitel 12: Nur ein Traum?
~Trigon 06.11.1984~
Kapitel 13: Einsamkeit
~Trigon 10.07.2320~
Kapitel 14: Nur ein weiterer Traum?
~Trigon 07.11.1984~
Kapitel 15: Vampirkind
~Trigon 10.07.2320~
Kapitel 16: Familienprobleme
~Trigon 11.07.2320~
Kapitel 17: Ein Wintertag
~Trigon 16.02.2325~
Kapitel 18: Der Verwandlungsvertrag
~Trigon 13.08.2327~
Kapitel 19: Sebastians Volljährigkeitsfeier I
~Trigon 03.12.2328~
Kapitel 20: Sebastians Volljährigkeitsfeier II
Kapitel 21: Sebastians Volljährigkeitsfeier III
Kapitel 22: Auf der Flucht
~Trigon 04.12.2328~
~Trigon 06.12.2328~
Kapitel 23: Unerwünschter Besuch
~Trigon 09.08.2332~
Kapitel 24: Unerwünschter Besuch aus Sebastians Sicht
~Sebastian~
~Trigon 09.08.2332~
Kapitel 25: Die Verwandlung aus Sebastians Sicht
~Trigon 24.07.1985~
Kapitel 26: Während der Verwandlung aus Sebastians Sicht
Kapitel 27: Im Verwandlungsfieber I
~Marius~
~Trigon 20.05.1985~
~Trigon 10.08.2332~
Kapitel 28: Im Verwandlungsfieber II
~Trigon 28.07.1985~
~Trigon 11.08.2332~
Kapitel 29: Beginn eines neuen Lebens
~Trigon 12.08.2332~
Kapitel 30: Laurens Volljährigkeitsfeier
Kapitel 31: Schlechte Nachrichten
~Trigon 13.08.2332~
Kapitel 32: Sonnenbrand
Kapitel 33: Der Kampf mit Tortus
Kapitel 34: Erneuter Fluchtversuch
~Trigon 14.08.2332~
Kapitel 35: Henrys Verhaftung I aus Sebastians Sicht
~Sebastian~
~Trigon 13.08.2332~
Kapitel 36: Henrys Verhaftung II aus Sebastians Sicht
~Trigon 26.07.1985~
~Trigon 13.08.2332~
Kapitel 37: Erneuter Fluchtversuch aus Sebastians Sicht
~Trigon 14.08.2332~
Kapitel 38: Das unsichtbare Bündnis aus Sebastians Sicht
Kapitel 39: Kampf mit Todesfolge aus Sebastians Sicht
Kapitel 40: Frühstück und Drecksarbeit
~Marius~
Kapitel 41: Innere Unruhe
~Trigon 15.08.2332~
Kapitel 42: In der Dunkelheit
Kapitel 43: Erweckung eines Toten
Kapitel 44: Der Kampf gegen Henry
Kapitel 45: Wiederbelebung
Vorwort
'Lieber S.,
In meiner Zeit in Terra habe ich damit begonnen, Sachen aus meinem Leben niederzuschreiben und in den fünf Jahren dort ist doch so einiges zusammengekommen. Da du mein bester Freund bist und mit mir sehr viel mehr als nur das Blut teilst, sollst du auch derjenige sein, der dieses lesen darf.
Vielleicht kannst du es als meine Biografie veröffentlichen. Oder du sorgst einfach nur dafür, dass meine Nachfahren mich nicht vergessen. Oder du behältst es für dich. Ich kann dich ja jetzt nicht mehr beeinflussen und ehrlich, ich will es auch nicht. Ich will nur, dass du es liest.
Ich bin mir sicher, dass du in meinem Schreiben einiges Neues von mir erfahren wirst, denn du warst zwar eine lange Zeit an meiner Seite, aber hast eben auch nicht alles mitbekommen. Manches davon habe ich dir auch verheimlicht, doch jetzt wo ich nicht mehr da bin, sollst du davon auch endlich erfahren.
Ich verdanke dir wirklich viel und ich bin sehr froh, dass du mein Freund warst, deswegen würde ich mir wünschen, dass, sollte ich erneut wiedergeboren werden, ich wieder in deine Nähe komme. Aber das kann ich auch nicht beeinflussen. Bitte kümmere dich gut um meine Erben.
In Liebe, dein M.'
~Marius~
Geboren wurde ich im Mai 2313 in meiner Heimatwelt Trigon als erstes Kind einer relativ normalen Familie. Zumindest war sie nicht viel anders, als jede andere, die ich kennengelernt habe. Der, den ich für meinen Vater hielt, war ein guter und hart arbeitender Mann, und soweit ich mich erinnere, verdiente er sein Geld mit Schreiben. Leider bekam ich nie die Chance herauszufinden, ob er Schriftsteller war oder was er eigentlich genau machte, wenn er in seinem Arbeitszimmer saß. Genauso wie ich nie herausgefunden habe, ob er tatsächlich wusste, dass ich gar nicht sein Sohn war.
Wenn er es gewusst hatte, so hatte er es sich nicht anmerken lassen und mich stets so behandelt, als entstamme ich seiner Blutlinie. Als sei ich sein Sohn. Ich vermute aber, dass er es tatsächlich nicht gewusst hat bis zu seinem Tod.
Da seine Arbeit allein wohl nicht ausgereicht hätte, um unsere Familie zu ernähren, war auch meine Mutter berufstätig, doch auch von ihr weiß ich nicht, was sie eigentlich machte und ich sollte es auch nie erfahren. Natürlich hätte ich versuchen können es herauszufinden, doch ich habe das nie getan und ich werde es wohl auch nicht mehr. Was ich jedoch über sie mittlerweile weiß, ist, dass sie ihren Mann zu Beginn ihrer Ehe wohl betrogen hat und mich dabei gezeugt hat. Wenn gleich auch erst eine ganze Weile vergehen mussten, bis ich selbst davon erfuhr und somit auch herausfand, dass ich nicht das war, wofür ich mich gehalten hatte.
Doch dazu später mehr.
Ich kann mich heute nur an die Gesichter meiner Geburtsfamilie erinnern, weil ich im Besitz zweier Fotos gekommen bin. Ich soll die Augen meiner Mutter geerbt haben, so sagt man mir. Da aber die noch existierenden Bilder von der Familie, in die ich geboren wurde, leider nur schwarzweiß sind für mich, aus Gründen, die ich auch noch erklären werde, werde ich wahrscheinlich nie mehr nachvollziehen können, ob das wirklich stimmt.
Ich hatte übrigens auch eine drei Jahre jüngere Schwester, nein, Halbschwester, die laut ihrer Geburtsurkunde wohl Wilhelmina hieß, von mir aber immer nur Mina genannt worden war. Ich erinnere mich bei ihr eigentlich an nicht mehr soviel, außer an ihren Namen und ihre hellbraunen Augen. Und daran, dass sie mich fast jede Nacht mit ihrem Schreien aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich denke aber, dass ich sie dennoch gemocht habe. Selbst Jahre später habe ich sie noch manchmal nachts gehört, obwohl ich mir da schon sicher war, dass sie nicht mehr lebte. Obwohl ich sicher wusste, dass es sie und meine Eltern nicht mehr gab. Und ich denke, es ist ein guter Einstieg zu schreiben, wie ich sie verlor:
Kapitel 1 Der Überfall
~Trigon 12.02.2319~
Ich war fünf Jahre alt, als dies geschah, und noch heute erinnere ich mich an ein paar Details dieser Nacht. Auch wenn ich mich manchmal schon zu fragen begann, wie viel davon mein Gehirn am Ende nur dazu gedichtet hatte, um die Lücken zu füllen, die in meinen Erinnerungen geblieben waren.
Es war eigentlich eine Nacht gewesen, wie jede andere auch. Wir hatten gemeinsam zu Abend gegessen und danach hatte meine Mutter meine Schwester zu Bett gebracht, während mein Vater in sein Arbeitszimmer verschwunden war, um weiter an etwas zu schreiben, dass ihn schon den ganzen Tag beschäftigt hatte. Ich war in mein Zimmer gegangen und hatte dort noch ein wenig mit den Holzfiguren gespielt, die ich zu meinem letzten Geburtstag geschenkt bekommen hatte, bevor meine Mutter hereinkam und mich bat, meine Sachen wegzuräumen und ins Bett zu krabbeln.
Brav war ich ihrer Aufforderung nachgekommen und sie hatte mir zur Belohnung noch eine Geschichte aus meinem Lieblingsbuch vorgelesen. Heute weiß ich jedoch nicht mehr, welches es gewesen ist.
Danach hatte sie mich zugedeckt und mir einen Kuss auf die Stirn gegeben, ehe sie mein Zimmer leise verlassen hatte und ich weiß noch, dass ich noch einmal zu ihr gesehen hatte, bevor sie die Tür schloss. Niemals hätte ich da gedacht, dass dies das letzte Mal sein sollte, dass ich sie lebend sah. Aber wer hätte auch ahnen können, was kurz darauf passieren würde? Ich jedenfalls nicht.
Ich wartete einen Moment, bis ich mir sicher war, dass sie in ihr Schlafzimmer verschwunden war, bevor ich heimlich aufstand und zu den gerade weggeräumten Spielsachen schlich, um mir zwei hölzerne Reiterfiguren zu holen und mit diesen zurück ins Bett zu krabbeln.
Leise spielte ich mit diesen im Dunkel meines Zimmers, dabei immer darauf vorbereitet, sie zu verstecken, sobald ich jemanden im Flur vor meinem Zimmer hörte. Zumindest war ich als kleiner Junge ziemlich überzeugt davon, dass mich keiner dabei erwischen würde.
Die Müdigkeit übermannte mich schließlich doch und immer noch mit den Figuren in der Hand schlief ich ein. Ich träumte etwas, aber es war nichts, an das ich mich nach meinem Aufwachen erinnerte.
Geweckt hatte mich, wie schon so oft, das Geschreie meiner Schwester. Ihre Stimme klang etwas heiser, wenn ich mich recht entsinne, aber damals war es mir nicht aufgefallen. Mit einem der Holzreiter in der Hand, der andere war zu Boden gefallen, drehte ich mich auf die Seite und schloss wieder die Augen. Dann wartete ich, dass meine Mutter oder mein Vater zu der Kleinen gingen und sie beruhigten, wie sonst auch, damit ich endlich weiter schlafen konnte. Doch nichts geschah.
Ich fragte mich, ob sie sie nicht hörten oder was los war, also stand ich auf, die Figur immer noch in der Hand, und schlich zu meiner Zimmertür, um den Geräuschen auf dem Flur genauer zu lauschen.
Es war still, bis auf das Geschreie meiner Schwester. Keine Schritte von Mutter oder Vater. Keine Stimmen. Nur das laute Weinen von Mina. Vorsichtig öffnete ich meine Zimmertür und trat auf den Flur.
Es war dunkel, was mir alleine schon Angst machte, und ich wunderte mich, wo unsere Eltern blieben. Warum hatten sie nicht reagiert bisher, begann ich mich zu fragen. Immerhin konnte ich trotz der Dunkelheit erkennen, dass sowohl ihre Schlafzimmertür zu meiner Rechten, als auch die Kinderzimmertür meiner Schwester direkt gegenüber von mir nur angelehnt waren. Sie hätten sie also hören müssen. Irgendetwas stimmt also nicht.
Ich nahm meinen Mut zusammen und ging in das Zimmer meiner Schwester, wo ich zunächst das Licht anknipste, bevor ich zu ihr sah. Sie stand in ihrem Kinderbettchen und rüttelte am Gitter. Mit verheulten Augen blickte sie zu mir und ich erkannte ein paar Tränen, die ihr über die schon geröteten Wangen liefen. Trotzdem verstummte ihr Schreien als sie mich erkannte und sie zeigte auf den Schnuller, der ihr aus dem Bett gefallen war und an den sie jetzt nicht mehr herankam. Ich trat ein paar Schritte näher heran und hob ihn auf.
„Nein“, sagte sie plötzlich, „Nein. Nein. Nein.“
Es irritierte mich, dass sie so oft Nein sagte. Trotzdem hielt ich ihr den Schnuller hin, den sie mir sofort abnahm und wieder in den Mund steckte.
„Siehst du. Nicht nein. Ja“, erklärte ich ihr und lächelte. Dann drehte ich mich um und ging ein paar Schritte zurück zu Tür. Etwas traf meinen Kopf von hinten und ich merkte, dass es der Schnuller war, den sie mir hinterhergeworfen hatte.
„Aua“, schimpfte ich und wandte meinen Kopf zu ihr um, „Was soll das?“
Sie aber starrte an mir vorbei zu der dunklen Gestalt, die gerade ebenfalls den Raum betreten hatte und die eindeutig keines unserer Elternteile war.
„Da“, sagte sie verängstigt, „Nein Nein.“
Ich musterte den Fremden aufmerksam und stellte mich schützend vor meine Schwester. Er war blass und wirkte bedrohlich, außerdem klebte etwas Rotes in seinem Gesicht und auf seiner Kleidung. Dass es Blut war, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht und vermutlich war das auch gut so. Er war so schon unheimlich genug.
„Ach, hier ist dieser Schreihals“, meinte er und ich erkannte ein Funkeln in seinen Augen, dass mir noch mehr Angst machte, als die bloße Tatsache, dass ein Fremder im Haus war. Sehr viele Fragen schossen mir durch meinen kleinen Kopf.
„Wer sind Sie?“, fragte ich, „Was wollen Sie?“
„Stell nicht so viel Fragen, Junge“, erwiderte er und ehe ich irgendetwas sagen konnte, stieß er mich zur Seite und hob meine Schwester aus dem Bett, die sofort wieder zu schreien begann, „Weißt du, wie sehr ich schreiende Menschen verachte? Und allen voran Kinder? Aber immerhin dürfte dein Blut gut schmecken.“
Ich schmiss ihm die Holzfigur an den Kopf, die ich immer noch in der Hand hielt, doch er reagierte nicht. Stattdessen starrte er nur in die weit geöffneten Augen meiner Schwester und ich bemerkte, dass sie aufhörte zu schreien und ihren Kopf zur Seite fallen ließ. Er senkte den Seinen an ihren Hals und ich sah, wie er zubiss. Ich stieß einen Angstschrei aus, rappelte mich auf und rannte aus dem Zimmer. Ich musste zu meiner Mutter. Oder zu meinem Vater. Zu irgendwem. Hauptsache weg von diesem Fremden.
Ich kam nicht weit, denn bevor ich das Schlafzimmer meiner Eltern erreichte, hatte er mich eingeholt, gepackt und mit seinen viel stärkeren Armen an die Wand gedrückt. Panisch trat ich nach ihm und schrie um Hilfe, doch er lachte nur.
„Erspare dir das, Zwerg. Es wird dir keiner mehr zur Hilfe kommen“, seine Augen funkelten wieder bedrohlich rot und ich konnte meinen Blick nicht von ihnen abwenden. Hypnotisiert hörte ich auf ihn zu treten und ließ meinen Kopf zur Seite sinken, wie es zuvor meine Schwester auch getan hatte und ich spürte einen stechenden Schmerz, als er mir in den Hals biss. Eine Stimme in mir schrie mich an und riss mich damit aus meiner Starre. Damals wusste ich nicht, wieso das funktioniert hatte und auch nicht, was das für eine Stimme war, und selbst heute habe ich nur eine Vermutung, wer mit mir da gesprochen hatte, doch dazu ebenfalls später mehr.
Erneut trat ich nach dem Fremden und traf ihn dieses Mal im Schritt, woraufhin er abrupt von mir abließ und ich zu Boden fiel.
Ich zögerte nicht, sondern rappelte mich auf, während er sich fluchend krümmte, und rannte ins Schlafzimmer meiner Eltern, weil ich dort Schutz erhoffte.
Der Raum war dunkel, doch ich konnte dank des wenigen Lichts, welches noch durch die Fenster schien, die beiden Körper sehen, die da auf dem Boden regungslos lagen und um die sich dunkle Pfützen gebildet hatten. Deshalb waren sie nicht gekommen. Meine Eltern waren tot oder zumindest regten sie sich nicht.
Schockiert kniete ich neben dem reglosen Körper meiner Mutter und weinte. In diesem Moment wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte. Selbst weglaufen schien mir einfach nur noch unsinnig. Er würde mich doch nur einholen.
Ich hörte den Fremden hinter mir den Raum betreten, aber ich drehte mich nicht um zu ihm. Ich wusste ganz genau, dass es jetzt vorbei war für mich, und das förderte meine Angst nur noch mehr, die ich hatte. Ich wünschte mir, dass dies nur ein Alptraum war.
„Das war gerade durchaus interessant. Du bist wohl kein normaler Menschenjunge, wie ich dachte. Dein Blut schmeckt zumindest nicht danach“, sagte er, doch immer noch wandte ich mich nicht um, „Schade, dass ich dich jetzt trotzdem töten werde. Ich kann nämlich keine Zeugen gebrauchen.“
Er lachte und ich stand auf.
„Aber ich verstehe das nicht. Warum hast du uns das angetan?“, fragte ich und drehte mich nun doch um. Ich wusste, dass ich sicher sterben würde, aber zumindest wollte ich wissen, warum.
„Was interessiert es dich?“, erwiderte er und trat höhnisch grinsend näher, „Du wirst jetzt ohnehin sterben und damit auch die Antwort auf diese Frage mit in dein Grab nehmen.“
Ich wich zurück von ihm und überlegte, was ich noch tun konnte.
Seine Augen funkelten wieder rot, doch dieses Mal vermied ich es, sie anzusehen. Noch einmal würde ich mich nicht hypnotisieren lassen, schwor ich mir.
Das schien ihn allerdings ziemlich zu verärgern, denn bevor ich einen weiteren Schritt zurück machen konnte, packte seine große Hand mich am Hals und drückte zu.
„Gut, wenn du dich eben nicht hypnotisieren lassen und leer trinken lassen willst, erwürge ich dich halt“, meinte er, während ich verzweifelt in seinem Griff zappelte und mir die Luft knapp wurde.
Ich trat ihn ein paarmal gegen den Bauch und versuchte seinen Arm, mit dem er mich festhielt, zu zerkratzen, doch er ließ nicht los. Mir wurde schwindelig, als ich langsam zu ersticken begann.
Jedenfalls vermute ich, dass es daran lag.
Erst als ich kurz davor war, mein Bewusstsein zu verlieren, ließ sein Griff mich los und ich fiel zu Boden. Ich atmete ein paarmal schnell ein und aus, bevor ich versuchte zu erkennen, was passiert war. Erst erkannte ich nur Schemen, da ich wohl noch unter Sauerstoffmangel litt, doch dann wurden diese etwas deutlicher und ich hörte auch Stimmen.
Jemand Großes hielt den Fremden, der gerade noch versucht hatte, mich zu töten, unsanft fest und ich musterte ihn. Er machte mir Angst, obwohl er mich anscheinend gerade gerettet hatte. Er sah nämlich noch unheimlicher aus, als der Fremde, den er gerade festhielt.
„Lass mich gefälligst los“, schimpfte der Festgehaltene, doch der andere ignorierte ihn und musterte mich anscheinend auch.
„Alles ok bei dir, Kleiner?“, fragte er mich, erwartete jedoch keine Antwort, sondern wandte sich seinem Gefangenen zu, „Auch wenn es nur Zufall war, dass ich dich heute hier erwischt habe, erinnere ich mich an dein Gesicht und an deine Verbrechensliste. Und auch daran, was ich jetzt mit dir anstellen darf, nachdem was du hier angestellt hast. Du wirst einen sehr netten Freund von mir kennenlernen dürfen“, der Fremde schluckte. Damals hatte ich zwar gehört, was er gesagt hatte, aber weder verstanden, wer er war, noch was er genau gemeint hatte.
Und ich hatte auch nicht gewusst, was ich tun sollte. Also hatte ich wieder begonnen zu heulen, weil ich immer noch furchtbare Angst hatte.
Der Große führte den Fremden, der versucht hatte mich zu töten, ab zur Tür und wandte dort noch einmal einen Blick in meine Richtung. Und ich denke, ein Ausdruck von Sorge lag diesem sogar.
„Ich schicke dir jemanden, der sich um dich kümmert, Kleiner.
Bleib einfach eben hier, ok?“, sagte er mir und verschwand mit seinem Gefangenen im Flur. Ich sah ihnen hinterher und weinte weiter. Dann legte ich mich zu meiner toten Mutter und wartete.
Vielleicht, so dachte ich, wird sie wieder erwachen, wenn sie mich an ihrem Körper spürt. Wenn mein Atem sie anhaucht.
Es war ein sehr naiver Glaube von mir, dass dies funktionieren könnte, aber ich war ja auch nur ein Kind damals.
Ich schrak hoch, als ich Schritte hörte, die vom Flur in die Richtung des Zimmers kamen, in dem ich lag. Jemand stieß die Tür auf und ich befürchtete schon, es sei wieder der Fremde, der zurückgekommen war, um zu beenden, was er versucht hatte. Oder dass es der andere wäre, der mir vielleicht auch etwas antun wollte.
Doch es war weder der Eine noch der andere. Es war eine Frau, die eintrat und sich mir ganz langsam näherte. Ich kroch etwas von ihr weg, da ich auch sie nicht kannte, und mich meine Erfahrung, die ich diese Nacht gemacht hatte, davon abhielt ihr zu trauen.
„Hab keine Angst“, flüsterte sie sanft, „Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich heiße Claudia. Und wie heißt du?“
Ich sah sie nicht an, sondern kroch noch ein Stück weiter weg von ihr und schwieg. Sie hockte sich hin und wartete geduldig darauf, dass ich ihr antwortete.
„Mama“, flüsterte ich schließlich und zeigte auf den reglosen Körper unweit von mir, „Mach das sie wieder aufsteht und alles wieder so wird wie vorher.“
Claudia schien verwundert und schüttelte traurig den Kopf.
„Das kann ich nicht“, erwiderte sie ruhig, „Aber ich bin trotzdem hier, um dir zu helfen. Du musst mich nur ansehen, mein Kleiner.“
Ich kam ihrer Aufforderung zögernd nach und meinte, die Sterne leuchten zu sehen in ihren Augen. Es faszinierte und beruhigte mich zugleich, auch wenn ein Teil von mir wieder versuchte, mich zum Wegsehen zu bewegen. Um genau zu sein war es dieselbe Stimme, die mich schon aus der Hypnose befreit hatte, die protestierte. Und im Nachhinein kann ich wohl auch verstehen, warum diese etwas dagegen hatte. Damals wusste ich es nicht und ignorierte sie stattdessen.
„Alles wird gut, Kleiner“, sagte Claudia mir und lächelte freundlich, „Du musst keine Angst vor mir haben. Ich werde dir nicht wehtun.“
Vielleicht ist sie ja doch freundlich, dachte ich.
Vorsichtig bewegte ich mich auf sie zu und starrte dabei immer noch in ihre wie Sterne funkelnden Augen.
„Wie heißt du, mein Kleiner?“, fragte sie erneut und dieses Mal war ich auch bereit ihr zu antworten.
„Marius“, flüsterte ich mehr, als dass ich es wirklich sagte, „Ich heiße Marius.“
Sie lächelte wieder freundlich.
„Das ist ein schöner Name“, meinte sie und strich mir sanft über den Kopf, während ich mich gänzlich in ihren Augen verlor.
Kapitel 2 Eine neue Familie I
~Trigon 13.02.2319~
Ich erwachte in einem Krankenbett und jemand hatte meine Hände ans Seitengeländer davon gebunden, wahrscheinlich damit ich mir nicht versehentlich im Schlaf den Tropf aus dem linken Arm riss. Es bereitete mir jedoch ziemliches Unbehagen, also schrie ich und zerrte an meinen Fesseln, kaum dass ich dies bemerkte.
„Beruhige dich bitte, Marius“, sagte eine weibliche Stimme neben meinem Bett, „Alles ist in Ordnung. Ich mache dich los. Hab keine Angst.“
Ich hielt inne und sah zu der Dame, die mich angesprochen hatte.
Sie war mir unbekannt, wirkte aber wie eine sehr nette ältere Frau.
Wie versprochen löste sie meine Fesseln, während ich darüber nachdachte, wo ich war, warum und vor allem wo meine Eltern waren. Außerdem setzte ich mich auf.
„Wo ist meine Mama?“, fragte ich die Fremde, „Ich will meine Mama sehen.“
Sie sah mich traurig an.
„Das geht leider nicht, Marius“, erwiderte sie, „Es gab einen Überfall auf euch und ...“
Sie verstummte und schien zu überlegen, wie sie mir erklären sollte, was passiert war. Zu diesem Zeitpunkt erinnerte ich mich nämlich nicht an das, was geschehen war, denn Claudia hatte meine Erinnerungen manipuliert. Ich wusste nur noch, dass meine Mutter mich ins Bett gebracht hatte, nicht aber was danach noch geschehen war. Und vielleicht war das auch gut, denn kein Fünfjähriger sollte mit Erinnerungen daran leben müssen, wie seine Eltern umgebracht wurden. Ich hätte es an Claudias Stelle auch getan.
„Mein Name ist Svenja Becker, aber du kannst mich ruhig nur Svenja nennen“, fuhr sie fort, „Ich betreue Kinder, wie dich, die keine lebenden Verwandten mehr haben, und helfe ihnen neue Familien zu finden.“
Mein kleines Gehirn versuchte angestrengt die Informationen zu verarbeiten, die sie mir gerade gegeben hatte. Keine lebenden Verwandten. Neue Familie. Ich schüttelte den Kopf ungläubig.
„Danke Svenja“, gab ich zurück, „Aber meine Mama und mein Papa kommen mich gleich abholen. Wahrscheinlich sind sie nur gerade mit meiner Schwester draußen. Sie kommen bestimmt gleich zurück. Ich brauche keine neue Familie.“
Dieses Mal war sie es, die den Kopf schüttelte.
„Leider irrst du dich“, erwiderte sie, „Sie werden nicht kommen und dich abholen, denn sie sind leider verstorben. Deine Mama, dein Papa und deine Schwester sind jetzt im Himmel.“
Ich schluckte und starrte sie noch ungläubiger als zuvor an. Etwas in mir wünschte sich, dass sie log. Ich wollte das nicht wahrhaben.
„Aber ...“, stammelte ich, während sich meine Augen mit Tränen füllten, „Das ist nicht wahr. Du lügst.“
Sie holte ein Taschentuch hervor und reichte es mir, dann streichelte sie mir beruhigend über den Rücken, während ich eine ganze Weile einfach nur heulte und mich fragte, warum meine Eltern mich alleine auf dieser Welt zurückgelassen hatten. Warum sie so etwas tun sollten.
„Alles wird wieder gut“, sagte sie schließlich, nachdem ich meine Nase zum gefühlt hundertsten Mal geputzt hatte, „Du wirst sehen, Marius. Wir werden eine liebe Familie für dich finden. Jemand, der sich um dich kümmert. Aber erst einmal musst du wieder ganz gesund werden.“
Ich nickte und wischte mit einem sauberen Taschentuch meine Tränen weg. Es würde zwar nie mehr so werden, wie es gewesen war, aber vielleicht war es doch gut neue Hoffnung zu haben.
~Trigon 21.02.2319~
Ich verbrachte eine Woche bei Svenja und ihrem Mann im Haus, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ehe mich eine Familie aufnahm, die selber schon drei Kinder hatten.
Die Frau stellte sich mir als Elena Bache vor und war mir auf Anhieb sympathisch, weshalb ich sie liebevoll gleich Mama Bache nannte, sehr zum Verdruss meiner neuen Geschwister.
Ihr Mann hieß Edward Bache, doch ich nannte ihn Papa Bache, was ebenfalls nicht gut bei meinen neuen Brüdern und meiner neuen Schwester ankam.
Sie brachten mich und die wenigen Sachen, die ich besaß zu dem Bauernhof, auf dem sie lebten, und Mama Bache nahm mich an die Hand und zeigte mir alles, während Papa Bache meine Besitztümer in mein neues Zimmer räumte.
„Das hier ist dein neues Zimmer“, sie zeigte mir das Zimmer, welches als Erstes kam, nachdem man von der Küche in die Diele getreten war, „Direkt daneben ist unser Schlafzimmer und daneben ist das von deiner Schwester Lisa. Auf der anderen Seite haben deine Brüder Max und Manuel ihre Zimmer und direkt gegenüber von deinem Kinderzimmer ist das Badezimmer. Da gibt es auch eine Badewanne.“
Ich nickte und schenkte ihr ein Lächeln. Vielleicht würde es doch ganz wundervoll in dieser Familie werden, auch wenn ich meine richtigen Eltern immer noch vermisste.
Sie führte mich zurück durch die Küche nach draußen auf den Hof und zeigte mir die große Scheune, die sich dem Haus anschloss.
„Dort drin stehen unsere Kühe“, erklärte sie mir und führte mich hinein, „Ich zeige sie dir.“
Ich vernahm ein lautes Muhen, als wir hineintraten und erschrak zunächst vor dem großen gehörnten Untier, das zwar durch ein Gitter von mir getrennt war, aber trotzdem direkt auf mich zukam.
„Die hier vorne heißt Ilse“, erklärte meine neue Mutter mir und streichelte den schwarz weißen Kopf der Kuh oder wie ich es damals sah, das schwarz weiße Untier mit Hörnern, „Sie ist eine ganz Liebe, du wirst schon sehen. Da hinten in der Ecke stehen Berta und Maja“, ich sah zu dem Punkt, den sie mir deutete, und erkannte zwei weitere schwarz weiße Untiere. Was hatte sie gesagt, was es waren?
Kühe? So etwas hatte ich noch nie gesehen.
Eine weitere, jedoch braune Kuh kam aus dem Dunkel nach vorne und ich machte einen Schritt zurück.
„Das ist Frieda. Wir haben sie noch ganz neu und wenn alles klappt, dann bekommt sie vielleicht nächstes Frühjahr ihr erstes Kälbchen.“
Ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht war, und lächelte einfach nur unsicher. Diese Tiere machten mir Angst. Sie waren größer als ich, hatten Hörner und ich wusste einfach nichts mit ihnen anzufangen. Deshalb begann ich mich Rockzipfel meiner neuen Mutter zu verstecken.
„Du musst keine Angst haben, Marius“, erklärte sie weiter und streichelte mir über meinen Kopf, „Sie geben uns Milch. Die kannst du trinken oder wir machen Butter und Käse daraus zum Essen.“
Das überzeugte mich nur geringfügig und ich war froh, als sie mich weiter nach hinten, an den Tieren vorbei, in den Stall führte. Links und rechts vom Gang, den wir nahmen, waren Mauern, die gerade hoch genug waren, dass ich nicht darüber blicken konnte, doch ich hörte Geräusche dahinter. Auf der einen Seite war es ein Gackern und auf der anderen ein lautes Schnattern und Fauchen.
Mama Bache hob mich hoch, damit ich sehen konnte, was da diese Geräusche machte. Es waren Hühner auf der einen und Gänse auf der anderen Seite. Solche Tiere hatte ich schon einmal in meinen Märchenbüchern gesehen, aber es verwunderte mich etwas, dass die Gänse fauchten, wie Katzen und Zähne zu haben schienen. Ich schloss, dass es vermutlich ratsamer wäre, mich von ihnen fernzuhalten.
„Das sind unsere Gänse und unsere Hühner“, sagte Mama Bache und stellte mich wieder auf den Boden, „Das sind alle Tiere, die wir hier haben. Ein paar Katzen leben hier auch, aber die verstecken sich meistens auf dem Dachboden oder jagen Mäuse dort oben im Heu“, sie deutete auf den Heuboden über unseren Köpfen, zu der eine Leiter hinaufführte, „Ich weiß, dass Max und Manuel dort oben ihr Geheimversteck haben, aber bitte sei vorsichtig, wenn du dort mit ihnen hinaufkletterst. Am besten wäre es, wenn du es nicht tust.“
Ich nickte, sah erst zur Leiter hinauf und dann zu ihr zurück. Sie lächelte wieder und nahm meine Hand.
„Lass uns jetzt zurück ins Haus gehen. Ich muss das Essen vorbereiten und du willst doch sicher dein neues Zimmer begutachten.“
Ich nickte erneut und ging mit ihr den Weg zurück, den wir gekommen waren.
Kapitel 3 Eine neue Familie II
Es vergingen einige Wochen, in denen ich mich in meine neue Familie einlebte und lernte auf dem Hof mitzuhelfen. Ich versorgte mit meiner Schwester täglich die Hühner und Gänse, und obwohl sie mich anfangs nicht mochte, brach doch schließlich das Eis zwischen uns und sie fing an mir ein paar Dinge beizubringen. Sie ließ mich zum Beispiel jeden Morgen zählen, ob noch alle Tiere im Stall waren, bevor wir diese hinausließen, und tat selbiges Abends noch einmal. Manchmal fehlte ein Huhn und wir mussten es suchen.
Mein Verhältnis zu meinen Brüdern hingegen blieb kalt. Sie mochten mich nicht und wollten auch nichts mit mir zu tun haben, obwohl ich immer wieder den Kontakt zu ihnen suchte. Sie beleidigten und beschimpften mich und manchmal, wenn Mama und Papa nicht in der Nähe waren, schlugen sie mich auch. Nie so stark, dass es aufgefallen wäre, aber die eine oder andere Blessur trug ich schon davon. Außerdem war ihr Lieblingsschimpfwort für mich Vampirkind, wovon ich weder wusste, was sie damit meinten, noch warum sie mich so bezeichneten. Trotzdem machte mir das Wort Angst und es verunsicherte mich. Und mehr als einmal frage ich auch Mama Bache, was meine Brüder damit meinten, und sie schimpfte dann mit ihren Söhnen darüber, was diese aber nicht davon abhielt, es ein paar Tage später wieder zu sagen. Eine vage Erklärung dazu bekam ich erst am letzten Tag, den ich in dieser Familie verbringen sollte.
~Trigon 06.07.2319~
Es war ein Tag, wie jeder andere auch. Morgens weckte mich meine Schwester, damit ich mich anzog und frühstückte, bevor ich mit ihr die Tiere wieder versorgte. Dann ging sie mit mir zurück ins Haus und half unserer Mutter, während ich mir die Lernbücher ansah, welche ich von ihr bekommen hatte. Dank diesen konnte ich mittlerweile zumindest meinen Namen und den meiner Geschwister schreiben und ein paar einfache kurze Wörter. Ich war stolz auf mich darüber und freute mich schon darauf, bald in die Schule gehen zu dürfen.
Es war bereits Mittag, als jemand an meiner Tür klopfte und mich rief.
„Hey Vampirkind“, ich erkannte die Stimme von Max, „Es gibt Essen.
Komm.“
Eine ältere Stimme hinter ihm schimpfte laut und ich wusste, dass es Papa Bache war.
„Du sollst ihn nicht so nennen“, sagte er, während ich meine Bücher verstaute und aus meinem Zimmer trat.
Ich sah beide fragend an. Bisher hatte mir nie einer erklärt, was das Wort überhaupt hieß. Mir war bewusst, dass ich noch ein Kind war, aber den anderen Begriff kannte ich nicht. Was bitte war ein Vampir und warum machte mir der Gedanke an dieses Wort schon Angst?
„Beachte das nicht weiter“, meinte Papa Bache sanft zu mir, „Du bist kein Vampirkind, Marius.“
Dann drehte er sich um und ging mit Max in Richtung Küche. Ich blieb einen Moment stehen, bevor ich ihnen folgte. Dieses Mal, so entschloss ich mich, musste mir einer erklären, was genau ein Vampir war und warum meine Brüder mich ständig so nannten.
„Papa“, begann ich, nachdem ich mich an den Esstisch gesetzt hatte, und sah zu dem Mann, der am Kopfende von Tisch saß, „Was ist das überhaupt?“
Er reagierte nicht sofort, sondern tat sich etwas zu essen auf. Es war mein Bruder Manuel, welcher rechts von ihm Platz genommen hatte, der mich ansah und über meine Frage lachte.
„Kartoffeln, Möhren und Soße, das siehst du doch“, erwiderte er und bekam für seine freche Antwort einen bösen Blick von unserem Vater zu geworfen.
„Das sehe ich auch“, gab ich zurück und bekam einen ebenso mahnenden Blick, „Ich meine etwas anderes.“
Ich aß einen Bissen.
„Und was genau meinst du?“, fragte Mutter sanft.
Ich schluckte und legte meine Gabel neben meinen Teller, bevor ich zu ihr sah.
„Max hat mich wieder Vampirkind genannt“, erklärte ich und merkte, wie auch Mutter ansetzte, um mit diesem zu schimpfen, daher fuhr ich rasch fort, „Ich wüsste gerne, was er meint. Was ist ein Vampir?“
Ich merkte, wie Vater schluckte und meine Schwester ihre Gabel fallen ließ, kaum dass ich meine Frage ausgesprochen hatte. Mutter starrte mich entsetzt an und ich hörte Max leise kichern, während Manuel in Ruhe weiter aß.
„Das ist nichts, womit sich ein kleiner Junge wie du befassen muss“, erklärte Vater dann etwas gefasster, „Wenn du etwas älter bist, werde ich dir erklären, was ein Vampir ist. Aber im Moment sollst du einfach nur wissen, dass du keiner bist. Auch nicht das Kind von Einem. Du bist ein ganz normaler Menschenjunge, wie Max und Manuel auch.“
Das beantwortete meine Frage überhaupt nicht. Ich setzte erneut zur Frage an, doch Vater sah mich streng an.
„Keine Frage mehr dazu. Iss jetzt, Marius, bevor dein Essen kalt wird“, wies er mich an.
Ich nickte brav und schwieg.
Warum erklärte er es mir nicht? Ich verstand es nicht und aß immer noch rätselnd mein Mittag. War es so schlimm, zu wissen, was ein Vampir war? Oder war da noch etwas anderes, weshalb er es mir nicht verriet?
Nach dem Essen half ich meiner Mutter beim Abwaschen, während alle anderen nach draußen verschwanden. Mit ihr alleine stellte ich ihr erneut die Frage.
„Mama, was ist ein Vampir?“, ich sah sie direkt an und trocknete den Teller ab, den sie mir gab.
„Dein Vater hat dir doch schon gesagt, das ist nichts, womit sich ein kleiner Junge, wie du befassen muss“, sagte sie und wandte sich ihrem Abwasch zu, „Du bekämst nur Alpträume, wenn du mehr wüsstest.“
Ich gab mich nicht damit zufrieden, wieder abgewiesen worden zu sein. Jemand musste es mir doch erklären können und wollen.
„Aber Mama“, protestierte ich und stellte den getrockneten Teller auf den Tisch, „Meine Brüder nennen mich immer wieder so und ich verstehe nicht warum.“
Sie gab mir erneut einen Teller zu trocknen und seufzte kurz.
„Marius, ein Vampir ist jemand, der das Blut von Menschen trinkt“, sagte sie und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken.
Ich schüttelte mich.
„Nein, so etwas mache ich nicht“, erwiderte ich und betrachtete den Teller, den sie mir gegeben hatte, „So etwas macht man nicht. Das gehört sich nicht.“
Sie lachte leise über meine kindliche Art.
„Da hast du vielleicht recht“, gab sie zurück und nahm sich das zweite Handtuch, welches vor dem Herd hing, „Warum gehst du nicht nach draußen, etwas spielen? Ich schaffe den Rest hier alleine.“
Ich nickte, legte den getrockneten Teller zu dem anderen auf den Tisch und warf mein Handtuch über meinen Stuhl, ehe ich in die Diele ging, wo ich mir Schuhe und Jacke anzog.
„Bleib aber in Rufweite“, rief sie mir nach, als ich aus der Haustür trat.
Kaum, dass ich nach draußen getreten war, betrachtete ich den Himmel. Es war bewölkt, aber das war es schon den ganzen Tag. In der Ferne waren dunkle Wolken zu sehen, die mir ein wenig Angst machten. Meistens hieß das, dass es bald ein Gewitter geben würde.
Oder einen Sturm.
Ich überlegte kurz, ob ich nicht doch wieder zurück ins Haus gehen sollte, als ich meine Brüder und noch ein paar andere Jungs auf dem gegenüberliegenden Rasenplatz hörte. Anscheinend spielten sie etwas mit einem Ball. Neugierig ging ich zu ihnen. Ich hatte sie schon oft genug beobachtet, doch nie mitgespielt. Vielleicht würde ich es dieses Mal tun. Es würde mich zumindest von dem Gewitter ablenken, welches durch sehr, sehr leises Grollen in der Ferne schon zu hören war.
„Wer hat den Knirps denn eingeladen?“, schimpfte einer der älteren Jungs, kaum, dass ich mich am Rande des Spielfeldes gestellt hatte.
Es war Max, der auf mich zuschritt und seine Arme vor mir in die Seiten stützte.
„Verschwinde, Vampirkind, wir wollen nicht mit dir spielen“, fuhr er mich an und baute sich bedrohlich vor mir auf.
„Papa sagt, du sollst mich nicht so nennen“, protestierte ich und wurde für meine Antwort von ihm zu Boden gestoßen.
„Es ist nicht dein Papa“, schimpfte er weiter und trat mir in die Seite, „Das war er nie und wird er nie sein. Es ist mein Vater, nicht deiner.
Du bist nicht mein Bruder.“
Erneut trat er nach mir und ich wimmerte. Die Stelle, die er traf, schmerzte furchtbar und ich rollte mich zur Seite, um weiteren Tritten zu entgehen. Die anderen Jungen kamen zu uns und es war Manuel, der schließlich Max packte und ihn daran hinderte, mich noch einmal zu treten.
„Lass das“, raunte er seinem Bruder zu, „Der ist es nicht wert, sich Ärger einzufangen.“
Ich sah von einem zum anderen und setzte mich auf. Meine Seite schmerzte und ich hob meine Jacke und mein Oberteil an. Die Stelle, die sein Fuß getroffen hatte, verfärbte sich dunkel. Das war bestimmt nicht gut.
Ich ließ meine Sachen wieder sinken und stand auf. Der Kreis der Jungen, der sich um uns gebildet hatte, weil sie dachten, wir würden uns prügeln, löste sich langsam wieder auf und die Einzigen, die blieben, waren ich und meine Brüder. Der Rest wandte sich wieder ihrem Ballspiel zu.
„Ich bin kein Vampir“, protestierte ich erneut, „Mama hat gesagt, dass diese Blut trinken und so etwas mache ich nicht.“
Max zog die Luft scharf ein, als ich das Wort Mama aussprach und ich war mir sicher, dass er mich geschlagen hätte dafür, wenn ihn Manuel nicht in diesen Moment festgehalten hätte.
„Nur dass du es noch nicht getan hast, heißt nicht, dass du keiner bist“, fuhr er mich stattdessen an, „Schließlich hat dich einer gebissen, als er deine Familie getötet hat.“
Ich wusste im ersten Moment nicht, was mich mehr erschreckte:
Dass er mir ins Gesicht sagte, dass mich so ein Monster gebissen hatte oder der Donner, der seinen Worten folgte und mir damit verdeutlichte, wie nahe dieses Gewitter mittlerweile war.
Trotzdem machte mich ein Biss doch nicht gleich zu einem Vampir, dachte ich mir, doch sicher war ich mir nicht.
Die ersten Regentropfen begannen zu fallen und die anderen Jungen brachen ihr Spiel ab, um nach Hause zu eilen.
„Das ist nicht wahr“, sagte ich schließlich und weinte, „Ich bin keiner.“
Manuel ließ Max los und dieser ging ohne ein weiteres Wort an mir vorbei, gefolgt von dem anderen. Ich sah ihnen nach, ehe ich mich entschloss, ihnen zu folgen. Der Regen wurde abrupt stärker und wir waren alle drei durchnässt, als wir den Hof erreichten.
„Ich bin trotzdem keiner“, wiederholte ich, während Manuel uns die Haustür aufschloss, „Ich will auch keiner sein.“
Der Himmel erhellte sich kurz, als wir eintraten und ein lauter Knall erfolgte kurz darauf. Ich machte einen Satz nach vorne und rempelte Max an, weil ich mich erschrak.
„Entschuldige“, sagte ich, weil er mich daraufhin grimmig anblickte, doch er ignorierte mich und zog sich seine Schuhe und seine Jacke aus, ehe er in sein Zimmer verschwand, um sich vermutlich seiner restlichen durchnässten Kleidung zu entledigen.
Ich tat es ihm gleich und hörte erneut ein viel zu lautes Donnern, welches mich zusammen zucken ließ.
„Sei keine Memme“, meinte Manuel zu mir, „Du bist schließlich kein Baby mehr.“
Ich schluckte meine Angst hinunter, nickte und ging in mein Zimmer. Meine durchnässten Sachen warf ich zu Boden, bevor ich mir trockene Kleidung aus meinem Schrank nahm. Die Worte von Max hallten in meinem Kopf nach, während ich mich anzog und ich betrachtete einen kurzen Moment den großen blauen Fleck, der mittlerweile meine Seite zierte und furchtbar schmerzte. Es donnerte erneut laut und dieses Mal zuckte ich nicht mehr so heftig zusammen.
„Ich bin kein Vampir“, flüsterte ich zu mir und hockte mich mit angewinkelten Beinen auf mein Bett. Wieder weinte ich, während draußen das Gewitter tobte. Ich bildete mir ein, mit jedem Donner das Schreien eines kleinen Kindes zu hören, aber ich verstand überhaupt nicht, woher das Geräusch kam. Ich hielt mir die Ohren zu, doch ich konnte es trotzdem noch hören.
Jemand klopfte laut an meine Tür und trat ein. Es war Manuel und seine Anwesenheit ließ das Schreien abrupt verstummen.
„Macht dir so ein kleines Gewitter wirklich solche Angst, Vampirkind?“, fragte er und schloss hinter sich die Tür, kaum dass er eingetreten war.
Ich schüttelte den Kopf.
„Nenn mich nicht so“, widersprach ich, „Ich bin kein Vampir.“
Er kam langsam auf mich zu und ich betrachtete die Kette, die er in seiner Hand hielt. Ich begann mich direkt zu wundern, was er von mir wollte.
„Hier“, er legte mir den Anhänger der Kette in meine linke Hand und schloss sie, „Die Anhänger besteht aus Silber und Vampire reagieren auf Silber. Wenn du wirklich keiner bist, dann dürftest du auch keine Reaktion darauf haben.“
Ich sah ihn ungläubig an, doch er erwiderte meinen Blick mit Entschlossenheit.
Erneut schüttelte ich den Kopf und warf die Kette wütend von mir weg.
„So ein Unsinn“, schimpfte ich und stand auf, „Ich brauche keinen doofen Test, um zu beweisen, dass ich keiner bin. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich dir glauben kann.“
Ich ballte meine Hand zu Fäusten und beobachte ihn, wie er das weggeworfene vom Boden aufhob. Sein Blick wirkte nachdenklich, als er sich wieder zu mir umdrehte.
„Du musst mir ja auch nicht glauben“, sagte er und zeigte auf meine linke Hand, „Aber du solltest dir deine Hand ansehen.“
Ich öffnete meine Faust und sah auf meine Handinnenfläche. Ein leichter grauer Schimmer lag auf ihr, dort wo der Anhänger gewesen war, und ich rieb ihn mir an meiner Hose weg. Das musste gar nichts heißen. Meine Hände konnten genauso gut noch von draußen schmutzig sein. Das bewies also in erster Linie rein gar nichts.
Manuel wollte etwas sagen, doch ein ohrenbetäubender Knall und das plötzliche Erlöschen der Deckenlampe ließen ihn verstummen.
Ein Blitz war direkt in unser Haus ein geschlagen und hatte das Heu, welches auf dem Dachboden lagerte, entzündet.
Dann ging alles ziemlich schnell. Ehe ich oder mein Bruder überhaupt reagieren konnten, stürmte unser Vater ins Zimmer, packte uns und lief mit uns aus dem brennenden Haus.
Ich hörte meine Mutter rufen. Nach meiner Schwester und nach meinem anderen Bruder. Und ich sah meinem Vater hinterher, der wieder ins Haus lief, um die anderen zu retten. Wie erstarrt blickte ich auf die Flammen, während der Regen mich erneut durchnässte.
Bilder von der Nacht, in der meine richtigen Eltern gestorben waren, tauchten vor meinen Augen auf und ich versuchte sie zu verdrängen.
Sie sind nicht echt, redete ich mir ein, während sich meine Tränen mit dem Regen mischten und es erneut donnerte. Außerdem wurden die Schmerzen in meiner Seite schlagartig so schlimm, dass ich dadurch mein Bewusstsein verlor und zu Boden sank.
Kapitel 4 Ein überraschendes Wiedersehen
~Trigon 08.07.2319~
Das Nächste woran ich mich danach klar erinnerte, war das ich wieder in einem Krankenbett erwachte, dieses Mal jedoch ohne festgebunden zu sein. Ich setzte mich auf, kaum dass ich wach war und hatte Schmerzen in der Seite, die aber schwächer als die waren, die ich kurz vor meinem Zusammenbruch hatte.
„Du solltest dich besser nicht bewegen“, erklärte eine weibliche Stimme neben mir und ich erkannte, dass es Svenja war, „Du hattest Glück, dass das Feuer ausgebrochen ist, sonst wärst du an inneren Blutung gestorben.“
Ich dachte darüber nach, was passiert war. Meine Gedanken rasten.
Da war der Streit mit meinem Bruder, das Gewitter und dann das Feuer.
„Wo sind sie?“, fragte ich schließlich, „Wo ist meine neue Familie?
Wo ist Mama Bache?“
„Sie waren nicht gut für dich“, erklärte Svenja ruhig, „Sie haben dich verletzt.“
Sie deutete auf den Verband um meinen Bauch. Ich schüttelte den Kopf.
„Das waren sie nicht“, widersprach ich, „Das war nur ein Streit mit meinem Bruder und der hat das sicher nicht so gemeint.“
Es klang absurd aus meinem Mund. Ich wusste doch ganz genau, dass Max mich hasste. Doch ich wusste nicht sicher, ob es Absicht gewesen war oder nicht. Und ich war mir auch nicht sicher, warum er das getan hatte und ob er es wiederholen würde, hätte er die Chance dazu.
„Du wirst jedenfalls zu deiner eigenen Sicherheit nicht zu ihnen zurückkehren“, fuhr sie fort, „Aber ich habe schon eine neue ganz tolle Familie für dich gefunden.“
Sie lächelte und ich sah sie skeptisch an. Ich wollte keine neue Familie. Ich war in der Letzten ganz glücklich gewesen. Warum konnte ich nicht zu dieser zurück?
„Ich werde sie dir morgen vorstellen“, sagte sie weiter, „Und wenn du aus dem Krankenhaus entlassen wirst, kannst du auch direkt zu ihnen.“
Ich sagte nichts, sondern sah zu dem Kind, das in seinem Bett neben mir lag und schlief. Das letzte Mal war ich allein im Zimmer gewesen, als ich im Krankenhaus lag, doch dieses Mal nicht und das irritierte mich für einen kurzen Moment.
Ich wandte mich zurück an Svenja.
„Kann ich dort dann bleiben?“, fragte ich sie direkt.
Sie sah mich verwundert an.
„Natürlich. Das sollst du nach Möglichkeit sogar“, erwiderte sie.
Ich nickte und lehnte mich wieder zurück ins Bett. Dann schloss ich meine Augen.
~Trigon 09.12.2319~
Die neue Familie stellte sich als ein Frauenpaar heraus, das frisch verheiratet war und ein Kind adoptieren wollte. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre Namen, aber ich weiß, dass sie sehr nett zu mir gewesen sind und dass sie in einer kleinen Stadt gewohnt haben.
Und es war auch eben in dieser Stadt, wo ich Claudia erneut begegnete, an die ich mich bis dahin nicht wirklich erinnern konnte.
Es war ein kalter Wintermorgen gewesen, an dem ich den kurzen Weg zu meiner Grundschule, die ich seit diesem Jahr dort besuchte, durch den frisch gefallenen Schnee stapfte. Die Schule lag nur zwei Straßen weiter von der Wohnung, in der wir lebten, und daher durfte ich die Strecke auch allein gehen.
Meine Atemluft dampfte wegen der Kälte und ich bildete mir ein, ein feuerspeiender Drache zu sein, der den Schnee schmelzen würde. Ich lachte leise vor mich hin und merkte nicht, wie plötzlich jemand aus einem der Häuser neben mir herausstürmte und mit mir zusammenstieß.
Ich fiel zu Boden und der Inhalt meiner Schultasche verteilte sich auf dem Gehweg. Der Zusammenstoß hatte allerdings nicht nur mich zu Boden gerissen, sondern auch die Person, welche ihn verursacht hatte. Es war ein junges Mädchen, welche mich etwas irritiert ansah.
„Tu jetzt nichts Unüberlegtes“, hörte ich eine Frau sagen, die nun ebenfalls aus dem Haus trat.
Das junge Mädchen grinste und im selben Moment wie sie sich wieder aufgerichtet hatte, hatte sie mich auch gepackt und mich mit ihrem Arm um meinen Hals vor sich gestellt. Ich zappelte, um mich aus ihrem Griff zu befreien, doch sie war stärker als ich.
Verzweifelt starrte ich die andere Frau an, deren Gesichtszüge mir seltsam bekannt vorkamen.
„Wir machen einen Deal“, sagte das Mädchen zu ihr, „Ich lasse den Jungen los und du lässt mich gehen.“
Ich sah, wie der Blick der Frau abwechselnd von mir zu dem Mädchen wanderte. Erneut versuchte ich mich zu befreien, mit dem Ergebnis, dass sie ihre Umklammerung verstärkte und mir das Atmen schwerer fiel.
„Das kann ich nicht tun und das weißt du auch“, erwiderte die Frau, „Sei vernünftig. Er hat schließlich mit der Sache nichts zu tun.“
Plötzlich erinnerte ich mich wieder daran, woher ich diese Frau kannte. Es war in jener Nacht gewesen, als meine leiblichen Eltern starben, wo ich ihr das erste Mal begegnet war. Ihr Name war Claudia. Und mit der Erinnerung an sie kam auch der Rest zurück, weshalb ich stummen Schrei von mir gab. So war das also gewesen.
Doch statt zu weinen, wurde ich wütend.
Wütend darüber, dass ich nichts hatte machen können. Wütend darüber, dass ich jetzt schon wieder festgehalten wurde und nichts tun konnte, um mich zu befreien. So etwas konnte und wollte ich nicht mehr mit mir machen lassen, schwor ich mir.
Im Zorn tat ich das erst Beste, was mir einfiel, und biss den Mädchen in den Arm, in Hoffnung, sie würde mich fallen lassen.
Was sie tatsächlich sogar tat.
„Verdammte Mistkröte“, fluchte sie und bevor sie mich wieder ergreifen konnte, trat ich ihr mit voller Wucht gegen ihr Schienbein.
Ich wich ihr aus, als sie ihr Gleichgewicht durch meinen Tritt verlor und mit dem Gesicht voran in den Schnee fiel. Im selben Augenblick war Claudia bei ihr und packte sie. Dem Mädchen wurde klar, dass sie jetzt keine Chance mehr hatte und sie wehrte sich nicht mehr.
Ich starrte beide einen Moment an, dann realisierte ich, was ich gerade getan hatte. Schnell hob ich meine Schultasche auf und begann meine Sachen aus dem Schnee zu sammeln, um mich zu beruhigen.
„Das war gut, aber auch riskant, Kleiner“, sagte die Frau und ich blickte zu ihr. Sie hielt die Arme des Mädchens auf deren Rücken verschränkt und musterte mich. Ich zuckte mit den Schultern.
„Riskant vielleicht“, erwiderte ich, „Aber ich konnte mich nur so befreien, Claudia.“
Sie wirkte ziemlich verwundert darüber, dass ich ihren Namen kannte.
„Wer bist du?“, fragte sie skeptisch, „Und woher kennst du meinen Namen?“
Ich sah sie direkt an.
„Du hast ihn mir selbst vor einiger Zeit gesagt“, gab ich zurück, „Ich bin Marius.“
In ihrem Blick las ich Verwunderung und Unglaube. Und sie schüttelte den Kopf.
„Daran solltest du dich nicht erinnern können“, meinte sie schließlich und ich erkannte wieder das Funkeln in ihren Augen, „Du bist schon sehr ungewöhnlich, Marius.“
Und obwohl ich wusste, was sie vorhatte, wandte ich meinen Blick nicht ab. Ich wollte, dass sie mich hypnotisierte. Ich wollte, dass sie mir die Erinnerungen nahm. Und wieder verlor ich mich im Funkeln der Sternenaugen.
Dieses Mal erwachte ich in meinem Kinderbett. Ich hörte, wie sich meine Pflegemütter über irgendetwas stritten und stand auf, um zu ihnen zu gehen. An meiner wenig geöffneten Zimmertür blieb ich stehen und lauschte.
„Hätte eine von uns ihn begleitet, so wie ich das gesagt hatte, dann wäre das nicht passiert“, schimpfte die Eine, „Was ist, wenn er verletzt worden wäre?“
„Ist er aber doch nicht“, widersprach die andere, „Sie hat ihn uns doch unverletzt zurückgebracht.“
Es ging also um mich und um etwas, dass auf dem Weg zur Schule passiert war. Ich überlegte, doch es fiel mir nicht ein, weil mir Claudia wieder die Erinnerungen daran genommen hatte.
„Ja, dieses Mal nicht“, sagte wieder die Erste, „Und nächstes Mal?“
„Es wird kein nächstes Mal geben. Aber wir können ihn auch gerne in Watte packen und jeden seiner Schritte überwachen, wenn du das unbedingt willst“, ich hörte wie sie in Richtung Flur ging und schloss meine Zimmertür. Trotzdem lauschte ich weiter. Ein Schlüssel klimperte.
„Ich gehe jetzt etwas an die frische Luft“, fuhr sie fort, „Vielleicht war die ganze Aktion ohnehin ein Fehler. Vielleicht stimmt es ja, was man über Kinder wie ihn sagt, und dieser Junge bringt wirklich nur Unglück.“
Die Haustür wurde geöffnet und kurz darauf wieder geschlossen, während ich vor meiner Zimmertür zu Boden sank und vor mich hinstarrte.
Es tat weh zu hören, dass ich angeblich nur Unglück brachte. So war das doch gar nicht gewesen. Glaubte ich. Hoffte ich. Aber weil ich mich einfach an so vieles nicht erinnerte, wusste ich es einfach nicht.
Vielleicht war es besser, wenn ich davon lief. Doch wo sollte ich hin?
Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Es hatte wieder zu schneien begonnen und ich realisierte, dass ich erfrieren würde, wenn ich jetzt davon lief.