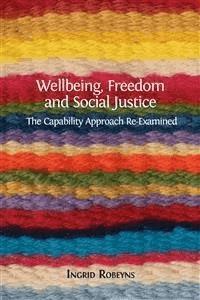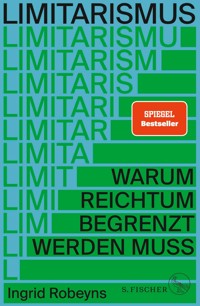
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Von der renommierten Philosophin und Ökonomin Ingrid Robeyns: Ein revolutionäres Konzept zur Begrenzung exzessiven Reichtums, das eine gerechtere Welt für alle schaffen würde. Wenn die Armen ärmer werden, merken wir es alle: an zunehmender Obdachlosigkeit oder Schlangen vor der Essensausgabe. Aber wenn die Reichen reicher werden, gibt es in der Öffentlichkeit nicht viel zu sehen, und für die meisten von uns ändert sich der Alltag nicht. Zumindest nicht sofort. Mit dieser verblüffenden, augenöffnenden Intervention legt die weltweit renommierte Philosophin und Ökonomin Ingrid Robeyns das wahre Ausmaß unseres Wohlstandsproblems offen, das in den letzten fünfzig Jahren stillschweigend außer Kontrolle geraten ist. Sie zeigt, dass extremer Reichtum aus moralischer, politischer, ökonomischer, sozialer, ökologischer und psychologischer Hinsicht nicht nur nicht gerechtfertigt werden kann, sondern uns allen zutiefst schadet – auch den Superreichen. Anstelle unseres derzeitigen Systems bietet Robeyns eine atemberaubend klare Alternative: den Limitarismus. Die Antwort auf so viele Probleme des neoliberalen Kapitalismus – und die Chance auf eine weitaus bessere, gerechtere Welt – liegt darin, dem Reichtum, den eine Person anhäufen kann, eine harte Grenze zu setzen. Denn niemand verdient es, Millionär zu sein. Nicht einmal Sie. »Ein schlagkräftiges Plädoyer für den Limitarismus – die Idee, dass wir eine Obergrenze dafür festlegen sollten, wie viele Ressourcen Einzelne anhäufen können. Pflichtlektüre!« Thomas Piketty, Autor von »Das Kapital im 21. Jahrhundert« »Robeyns zeigt klar und deutlich, dass es in einer echten Demokratie keine Rechte ohne Pflichten gibt – und kein Vermögen ohne Grenzen. Limitarismus bietet eine Möglichkeit, Reichtum zu demokratisieren und damit das reichste Prozent zu resozialisieren.« Marlene Engelhorn, Autorin von »Geld« und Mitgründerin von taxmenow »Ingrid Robeyns' nuancierte und überzeugende Verteidigung des Limitarismus, die sich mühelos zwischen Ethik, politischer Theorie, Wirtschaft und öffentlicher Politik bewegt, ist auch ein dringend benötigtes Manifest für die Neugestaltung politischer Institutionen.« Lea Ypi, Autorin von »Frei«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Ingrid Robeyns
Limitarismus
Warum Reichtum begrenzt werden muss
Über dieses Buch
Wenn wir exzessiven Reichtum begrenzen, schaffen wir eine gerechtere Welt für alle
Mit dieser verblüffenden, augenöffnenden Intervention legt die weltweit renommierte Philosophin und Ökonomin Ingrid Robeyns das wahre Ausmaß unseres Wohlstandsproblems offen, das in den letzten fünfzig Jahren stillschweigend außer Kontrolle geraten ist. Sie zeigt, dass extremer Reichtum aus moralischer, politischer, ökonomischer, sozialer, ökologischer und psychologischer Hinsicht nicht nur nicht gerechtfertigt werden kann, sondern uns allen zutiefst schadet – auch den Superreichen.
Anstelle unseres derzeitigen Systems bietet Robeyns eine atemberaubend klare Alternative: den Limitarismus. Die Antwort auf so viele Probleme des neoliberalen Kapitalismus – und die Chance auf eine weitaus bessere, gerechtere Welt – liegt darin, dem Reichtum Einzelner eine harte Grenze zu setzen. Denn niemand verdient es, Millionär zu sein. Nicht einmal Sie.
»Ein schlagkräftiges Plädoyer für den Limitarismus – die Idee, dass wir eine Obergrenze dafür festlegen sollten, wie viele Ressourcen Einzelne anhäufen können. Pflichtlektüre!« Thomas Piketty, Autor von »Das Kapital im 21. Jahrhundert«
»Robeyns beweist, dass es in einer echten Demokratie keine Rechte ohne Pflichten gibt – und keinen Reichtum ohne Grenzen. Der Limitarismus bietet eine Möglichkeit, den Reichtum wieder zu demokratisieren und damit das reichste Prozent zu resozialisieren.« Marlene Engelhorn, Autorin von »Geld« und Mitgründerin von taxmenow
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ingrid Robeyns, 1972 in Löwen, Belgien, geboren, ist Professorin für Ethik an der Universität Utrecht. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Philosophie promovierte sie an der University of Cambridge bei Amartya Sen. Sie gilt als Begründerin des Limitarismus und trägt wesentlich zur Verbreitung des Konzepts bei. Zur Unterstützung ihrer Forschung erhielt sie 2022 den Vici Grant des Dutch Research Council (NWO). Robeyns lebt mit ihrer Familie in Utrecht.
Inhalt
Widmung
Einleitung
Kapitel 1 Wie viel ist zu viel?
Kapitel 2 Extremer Reichtum hält die Armen in Armut, während die Ungleichheit wächst
Kapitel 3 Extremer Reichtum stammt aus schmutzigem Geld
Kapitel 4 Extremer Reichtum untergräbt die Demokratie
Kapitel 5 Extremer Reichtum steckt die Welt in Brand
Kapitel 6 Niemand verdient es, Multimillionär zu sein
Kapitel 7 Mit dem Geld lässt sich so viel machen
Kapitel 8 Philanthropie ist nicht die Lösung
Kapitel 9 Auch die Reichen werden profitieren
Kapitel 10 Der weitere Weg
Danksagung
Für alle Aktivisten, die gegen Ungerechtigkeit kämpfen
Einleitung
Alljährlich veröffentlicht die Sunday Times ihre »Reichenliste«, eine Rangliste der reichsten Menschen im Vereinigten Königreich. Den Spitzenplatz nahm 2021 Sir Leonard Blavatnik ein. Laut der Zeitung belief sich sein Vermögen auf 23 Milliarden Pfund. Das klingt nach viel Geld. Aber wie viel ist es wirklich? In Wahrheit können sich die meisten von uns gar nicht vorstellen, wie viel es ist, weil es so weit außerhalb der Parameter des Wohlstands liegt, die wir kennen. Uns fehlt ein Bezugsrahmen. Jemand könnte eine Null hinzufügen oder streichen, und wir würden den Unterschied gar nicht wirklich begreifen. Vielleicht haben selbst die Superreichen gar keine richtige Vorstellung mehr davon, wofür diese Zahlen eigentlich stehen, außer dass sie ein Mittel darstellen, sich mit anderen zu vergleichen.
Versuchen wir also, 23 Milliarden Pfund in etwas zu übersetzen, das wir begreifen können. Angenommen, jemand arbeitet vom 20. bis zum vollendeten 65. Lebensjahr fünfzig Stunden in der Woche – Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wie hoch müsste der Stundenlohn sein, damit sich am Ende 23 Milliarden Pfund angesammelt hätten? Die Antwort lautet: 45 Jahre lang 196581 Pfund pro Stunde. Bei diesem Stundenlohn könnte man sich täglich eine Dreizimmerwohnung mitten in London kaufen.
Im Laufe der Jahre gab es – selbstverständlich – Fluktuationen auf der Reichenliste der Sunday Times. So verlor beispielsweise Blavatnik 2022 etwa 3 Milliarden Pfund und rutschte auf den vierten Platz ab. In jenem Jahr standen die Brüder Sri und Gopi Hinduja und ihre Familien mit einem Gesamtvermögen von 28,5 Milliarden Pfund an der Spitze. Zu Recht mag man sich fragen: Wen kümmert es, dass Blavatnik vom Spitzenplatz verdrängt wurde? Für uns, die wir das Phänomen extremen Reichtums zu verstehen versuchen, spielt es keine Rolle, wer an erster oder zweiter Stelle steht. Was zählt, ist die Größenordnung dieser Vermögen. Alles, was wir wissen müssen, ist, dass in den vergangenen fünf Jahren jeder der zehn reichsten britischen Milliardäre mindestens 10 Milliarden Pfund – in Zahlen: 10000000000 Pfund – besaß oder das Äquivalent von zehntausend Dreizimmerwohnungen mitten in London. Zehntausend Dreizimmerwohnungen.
Betrachtet man die ganze Welt, führen solche Berechnungen zu noch schwindelerregenderen Zahlen. Elon Musk, der Eigentümer von Tesla und SpaceX, rangierte 2022 an der Spitze der Milliardärsliste des US-Magazins Forbes.[1] Damals belief sich der geschätzte Wert seines Vermögens auf 219 Milliarden US-Dollar. Die gleiche Frage: Welchem lebenslangen Stundenlohn entspricht Musks Vermögen? Antwort: 1871794 US-Dollar pro Stunde. Annähernd zwei Millionen Dollar pro Stunde. Fünfundvierzig Jahre lang für jede Arbeitsstunde.
Forbes würde umgehend darauf hinweisen, dass der Reichtum dieser Milliardäre innerhalb sehr kurzer Zeit schwinden kann. Nachdem Elon Musk im Oktober 2022 Twitter für die atemberaubende Summe von 44 Milliarden US-Dollar gekauft hatte, verloren Tesla-Aktien mehr als ein Drittel ihres Werts und Musks geschätztes Vermögen reduzierte sich um nahezu 20 Prozent auf 180 Milliarden US-Dollar. Im folgenden Frühjahr stand der Franzose Bernard Arnault (Eigentümer von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Christian Dior und Tiffany) an der Spitze der Forbes-Liste, da sein Vermögen 2022 um 53 Milliarden auf insgesamt 211 Milliarden US-Dollar gewachsen war.
Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates und andere Milliardäre an der Spitze der Reichenliste der Welt mag man für außergewöhnlich halten. In gewisser Hinsicht sind sie es auch. Aber nicht nur die Menschen ganz oben an der Spitze besitzen schwindelerregende Geldsummen: 2022 standen auf der Forbes-Liste 2668 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von 12700000000000 US-Dollar. Wem mögen all diese Nullen nicht vor den Augen tanzen? Das liegt daran, dass wir diese Zahl nicht begreifen können. Ausgeschrieben lautet sie: Zwölftausendsiebenhundert Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Vermögenswert eines jeden von ihnen 4,75 Milliarden Dollar beträgt. Stellen wir erneut die Frage nach dem entsprechenden lebenslangen Stundenlohn, kommen wir auf 40598 Dollar pro Stunde, was dem Jahreseinkommen vieler amerikanischer Familien entspricht.
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine Milliarde sind tausend Millionen – aber es gibt noch viel mehr Multimillionäre als Milliardäre. Wenn jemand fünfzig Millionen Dollar, Pfund oder Euro besitzt, kann er vielleicht nicht Twitter kaufen oder in den Weltraum fliegen, hätte aber immer noch genug, um sich nie wieder um seine finanzielle Sicherheit sorgen zu müssen – und noch etwas mehr.
Schon lange hatte ich den Eindruck, dass etwas falsch daran ist, dass ein einzelner Mensch so viel Geld anhäuft, aber ich konnte nicht recht formulieren, warum. Die Pauschalerklärung, der »Kapitalismus« sei schuld an der zunehmenden Ungleichheit, als könne er wie eine Maschine mit eigenem Willen operieren, ohne dass Menschen sie steuern, genügte mir nicht. Die Proteste der Occupy-Bewegung 2011 nach der Finanzkrise von 2008 faszinierten mich: Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass den Protestierenden früher als den meisten Akademikern aufgefallen war, dass an der Konzentration von Reichtum in den Händen so weniger Menschen etwas grundlegend falsch war. Obwohl die Occupy-Bewegung wieder abebbte, weckte sie doch ein neues, wachsendes Bewusstsein für Vermögensungleichheiten. »Wir sind die 99 Prozent«, skandierten sie – und machten der breiten Öffentlichkeit bewusst, dass das übrige 1 Prozent uns allen Probleme bereiten könnte.[2]
Also beschloss ich 2012, meine Philosophie- und Ökonomiekenntnisse zur Beantwortung der Frage zu nutzen: Kann ein Mensch zu reich sein? Dazu musste ich herausfinden, was »zu reich« bedeutet, und nach Gründen suchen, warum es schlecht sein könnte, zu viel Geld zu haben – falls es überhaupt plausible Gründe dafür gab. Schließlich war es durchaus möglich, dass keines der Argumente gegen die Anhäufung von Reichtum etwas taugte. Mir war klar, dass ich mich irren mochte – dass durchaus nichts Falsches daran war, Millionen oder sogar Milliarden auf der Bank zu haben. Ich wollte es lediglich herausfinden.
Einige meiner Kollegen – Professoren für Philosophie, Ökonomie und verwandte Disziplinen – amüsierten sich anfangs, dass ich mich in diese Themen stürzen wollte. Manche argumentierten, Armut sei das, was zähle, nicht Ungleichheit. Einige wenige hatten den Eindruck, sich auf die Reichen zu konzentrieren, sei bei mir ein Zeichen von Neid. Das war eine ernüchternde Reaktion – sich allein aufgrund von Neid eine Meinung zu bilden ist offenkundig etwas sehr Schlechtes –, die ich im Laufe meiner Forschungen immer öfter zu hören bekam, sei es von Politikern oder in Social-Media-Kommentaren.
Aber ich stand nicht allein da. Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten, nicht nur aus meinem eigenen, begannen zu bemerken, dass in den oberen Gesellschaftsschichten etwas vorging und wir dem Aufmerksamkeit schenken sollten. Philosophen begannen, neue Argumente zu entwickeln und die Probleme mit der Ungleichheit auszumachen. In der Soziologie fingen einige an, die Auswirkungen von extremem Reichtum auf das Leben der Superreichen und ihrer Kinder zu untersuchen und zu fragen, wie derart reiche Menschen es rechtfertigen konnten, in einer Welt zunehmender Ungleichheit so viel zu besitzen. Wirtschaftswissenschaftler begannen, die nötigen Daten zusammenzutragen, um festzustellen, wie sich die Verteilung von Einkommen und Wohlstand im Laufe der Zeit verändert hatte. Wie ihre Studien belegten, hatten Vermögens- und Einkommensungleichheiten in den Industrieländern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgenommen, aber diese allgemeine Tendenz endete in den achtziger Jahren. In manchen Ländern nahmen diese Ungleichheiten danach tatsächlich wieder zu, unter anderem und vor allem in den USA und im Vereinigten Königreich. Unterdessen fanden Forscher auf dem Gebiet der politischen Ökonomie Erklärungen für die zunehmende Ungleichheit, als sie sich ansahen, wie sich das Wirtschaftssystem infolge gezielter Anpassungen an die Marktregeln verändert hatte. Verschiedene Puzzleteile aus den diversen Forschungsgebieten setzten sich allmählich zu einem Bild zusammen.[3]
Auf meinem weiteren Weg zeigte sich deutlich, dass extremer Reichtum nicht nur praktische und politische, sondern auch moralische Probleme schafft. Die Legitimität von Ungleichheit und vor allem von extremem Reichtum einzuschätzen bedeutete, sich einer Reihe von grundlegenden philosophischen Fragen zu stellen. Wie sehen wir uns als Menschen? Wie verstehen wir unser Verhältnis zu anderen in der Gesellschaft? Welche Verantwortung haben wir für vulnerable Menschen und die Bereitstellung öffentlicher Güter? Und was sollen wir mit den Rechtfertigungen extrem reicher Menschen anfangen, warum sie so viel Geld und Macht besitzen?
Ich fing an, systematisch über die Ethik der Konzentration von extremem Reichtum nachzudenken, und veröffentlichte einige meiner Ergebnisse. Das blieb in der akademischen Welt nicht unbemerkt und brachte andere dazu, weitere Forschungen zu diesen Fragen anzustellen. Nachdem ich zehn Jahre lang extremen Reichtum analysiert und darüber debattiert hatte, kam ich zu der Überzeugung, dass wir eine Welt schaffen müssen, in der niemand superreich ist – dass es eine Obergrenze des Reichtums geben muss, den eine Einzelperson haben darf. Das nenne ich Limitarismus.[4]
Als Konzept ist der Limitarismus einfach, aber was bedeutet er in der Praxis? Sprechen wir davon, Reichtum durch politischen Zwang oder durch institutionelle Reformen zu begrenzen, oder geht es nur darum, zu mehr karitativen Spenden zu ermuntern? Schlage ich vor, Staaten sollten eingreifen und Milliardenvermögen beschlagnahmen? Oder streben wir an, progressive Steuersätze allmählich anzuheben und gegen die derzeit herrschende enorme Steuerhinterziehung vorzugehen? Macht der Limitarismus es notwendig, unsere wirtschaftlichen und politischen Regeln grundlegend so zu ändern, dass Gesellschaften von Anfang an limitaristisch sind, bevor Menschen anfangen, zu arbeiten, zu verkaufen, zu sparen, zu investieren und Waren zu kaufen, oder anders gesagt, dafür zu sorgen, dass niemand überhaupt erst superreich werden kann?
All diese Fragen versucht dieses Buch zu beantworten. Allerdings sollte ich von vornherein sagen, dass der Limitarismus keine Wunderwaffe oder einzelne politische Maßnahme bietet, die alles lösen würde. Er lässt sich am ehesten als regulatives Ideal verstehen – ein Ergebnis, das man anstreben sollte, aber so, wie die Welt gegenwärtig organisiert ist, wahrscheinlich nie endgültig erreichen wird. Das gilt für die meisten unserer gesellschaftlichen Ideale, auch für die Beseitigung der Armut (es wird immer einige Menschen geben, die mit Strategien zur Armutsbekämpfung nicht zu erreichen sind) und die Beendigung von Diskriminierung (da die Verwirklichung dieses Ideals moralisch einwandfreies Verhalten aller Personen und Institutionen erfordert). Zuzugeben, dass die Beseitigung der Armut und die Beendigung der Diskriminierung regulative Ideale sind, macht sie durchaus nicht weniger wichtig. Das Gleiche gilt für die Begrenzung individuellen Reichtums.
Damit soll keineswegs gesagt sein, dass sich gesellschaftliche Ideale niemals vollständig verwirklichen ließen – die Ausrottung tödlicher Viruserkrankungen ist ein einschlägiges Beispiel. Lange haben sich internationale Gesundheitsinstitutionen bemüht, diese Krankheiten auszurotten, und ihre Erfahrungsgeschichte zeigt, wie schwierig das ist. Aber im Fall der Pocken, einer durch das Pockenvirus verursachten Infektionskrankheit, die etwa drei von zehn Infizierten tötete, ist es ihnen gelungen: Nach jahrelangen intensiven Impfkampagnen in den sechziger und siebziger Jahren erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Pocken 1980 für vollständig ausgerottet. Solche Erfolge sind allerdings selten und bilden in Wirklichkeit die Ausnahme von der Regel, dass sich die meisten Ideale nicht endgültig erreichen lassen. Das heißt jedoch nicht, dass wir aufhören sollten, sie anzustreben. Vielmehr sollte es unser Anspruch sein, der Verwirklichung unserer Ideale immer näher zu kommen und dazu die gesamte Bandbreite der uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen einzusetzen.
Praktisch erfordert der Limitarismus ein Handeln auf drei Gebieten. Da sind zunächst strukturelle Maßnahmen. Die sozialen und wirtschaftlichen Schlüsselinstitutionen unserer Gesellschaften sollten den Menschen durch erschwingliche Kinderbetreuung, kostenlose, qualitativ hochwertige Bildung und eine umfassende Armutsbekämpfung echte Chancengleichheit bieten. Zudem sollten wir anstreben, unsere Wirtschaft so umzugestalten, dass wir zu einer gerechten Verteilung des Wohlstands und einem angemessenen Lebensstandard für alle gelangen. Mit anderen Worten: Wir brauchen politische Maßnahmen wie einen garantierten Mindestlohn, der es Menschen ermöglicht, in Würde zu leben, eine erschwingliche allgemeine Gesundheitsversorgung und den Schutz des Wohnungsmarkts vor den verzerrenden Auswirkungen von Spekulanten und Immobilienhaien. Solche strukturellen Maßnahmen begrenzen die Ungleichheit, indem sie die wirtschaftliche Stellung der Armen und der Mittelschicht stärken: Das bedeutet, dass ein größerer Teil des Kuchens an die Armen und ein kleinerer an diejenigen geht, die gegenwärtig den größten bekommen.
Je mehr strukturelle Schritte wir unternehmen, um die Ungleichheit zu reduzieren, desto geringer wird die Notwendigkeit für die zweite Strategie: fiskalische Maßnahmen. Strukturelle Maßnahmen wie die oben genannten werden allein nicht ausreichen, um die Entstehung großer Ungleichheiten zu verhindern oder allen Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Auch weiterhin bleibt der Fiskus, also das Steuer- und Beihilfesystem, unverzichtbar. Wäre die Besteuerung unser einziges Instrument, um zu einer limitaristischen Gesellschaft zu gelangen, müsste der Steuersatz auf Vermögen und Einkommen oberhalb einer bestimmten Grenze 100 Prozent betragen (Spoileralarm: Sie ist nicht das einzige Instrument). Dennoch gibt es triftige Argumente, eine Obergrenze für extremen Reichtum einzuführen, wie ich im Folgenden darlegen werde.
Aber selbst mit einem tiefgreifenden Strukturwandel und einer sinnvollen Besteuerung extremen Reichtums wird der Limitarismus ohne das Engagement aller Beteiligten nicht möglich sein. Daher erfordert er als dritten Aspekt ethisches Handeln: Wir alle müssen uns ein limitaristisches Ethos zu eigen machen. Angesichts politischer Trägheit und des überproportional starken Einflusses reicher Eliten auf unsere Politik mag es unmöglich sein, die für den Limitarismus notwendigen strukturellen und fiskalischen Maßnahmen kurzfristig umzusetzen. Die vorherrschenden ideologischen Normen und Interessen lassen vermuten, dass es dagegen beträchtlichen politischen Widerstand geben wird. Und es wird immer Ausreißer geben: Selbst in einer Welt mit effektiven Gesellschaftsstrukturen und fiskalischen Regeln könnte eine Person durch einen großen Glücksfall übermäßig reich werden. Unter diesen Umständen gibt der Limitarismus den Superreichen Grund, ihren überschüssigen Reichtum für etwas zu spenden, was Leid lindert und kollektive Probleme angeht. Wenn Vermögende den Argumenten gegen die Konzentration von extremem Reichtum zustimmen, sollten sie nicht abwarten, bis die gesamte Gesellschaft den Limitarismus akzeptiert. Wie wir sehen werden, können sie inzwischen sehr viel tun, uns von dem derzeitigen Maß an Ungleichheit und Ungerechtigkeit in Richtung einer gerechteren Welt voranzubringen – einer Welt, in der niemand übermäßig reich werden oder bleiben kann.[5]
Im Laufe der Jahre bin ich vielen Menschen begegnet, die den Limitarismus gar nicht für einen sonderlich radikalen Vorschlag halten. Sie denken bereits seit langem in diese Richtung und freuen sich, dass es nun eine Bezeichnung für ihre Überzeugung gibt; dass die Zeit endlich reif ist für eine breitere Debatte über die Gefahren und Risiken, die eine Konzentration extremen Reichtums birgt, und über die Chancen, die eine Vermögensobergrenze für uns alle bietet. Solche Reaktionen kamen von äußert unterschiedlichen Menschen. Als ich meine Forschungen zum Limitarismus einmal in New York vorstellte, erklärte mir ein Zuhörer, der sich als Mitarbeiter von Goldman Sachs vorstellte, er stimme meinen Vorschlägen zu. Ein anderes Mal fiel mir bei einem Vortrag in einer protestantischen Kirche in den Niederlanden vor einheimischem Publikum in den hinteren Reihen ein Geistlicher auf, der zustimmend nickte, als ich meine Argumente darlegte. Anschließend kam er zu mir und sagte mir, wie dringend wir eine solche Debatte bräuchten. Zudem habe ich unzählige E-Mails und Zuschriften von Personen bekommen, die meine Zeitungs- und Zeitschriftenartikel gelesen hatten und mir mitteilen wollten, dass sie mir unbedingt zustimmten.
Es gibt, wie ich zeigen werde, viele moralische, politische und praktische Gründe, die Intuitionen dieser Menschen zu unterstützen – Gründe, die Argumente gegen extremen Reichtum, oder anders gesagt, für den Limitarismus erhärten. Wenn wir eine ehrliche Debatte über Ungleichheit führen und aufrichtig auf die Argumente für den Limitarismus hören können, hoffe ich, die meisten Menschen zu überzeugen.
Allerdings sollten wir uns zunächst darüber einigen, was eine fundierte Debatte ausmacht. In den ersten Monaten des Jahres 2023 gab es in den belgischen und niederländischen Medien eine hitzige Auseinandersetzung über den Limitarismus. Was geschah, war vorhersehbar: Leute, die diese Debatte beenden wollten, richteten ihre Angriffe gegen unplausible Scheinversionen des Vorschlags. Insbesondere behaupteten mehrere Kritiker, der Limitarismus beinhalte zwangsläufig eine progressive Besteuerung des Einkommens (statt des Vermögens) bis zu einem Höchststeuersatz von 100 Prozent. Das würde bedeuten, sobald das Einkommen einer Person einen gewissen Schwellenwert erreicht, würde das darüber hinaus erzielte Geld vollständig in die Steuern fließen. Sie begriffen nicht, dass es noch andere Wege gibt, eine limitaristische Gesellschaft zu erreichen, aber das kümmerte sie offenbar nicht. Manche gingen sogar so weit, zu behaupten, der Limitarismus berücksichtige nicht, was mit all den zusätzlichen Steuergeldern passieren würde. Es gehe lediglich darum, die Reichen für ihren Reichtum zu bestrafen.
Das ist eine überaus unlautere Art, eine Debatte über einige überaus drängende und weitgehend übersehene Fragen im Keim zu ersticken. Kann ein Mensch zu reich sein? Hat extremer Reichtum negative Konsequenzen? Und wenn die Antwort ja lautet, ein Mensch kann zu reich sein, und ja, es hat schlimme Konsequenzen, was sollte man dann tun? Wir können sicherlich mehr tun, als uns in Karikaturen und Spott zu flüchten.
Zuweilen stimmt jemand zu, dass Ungleichheit schlecht ist, erklärt aber gleichzeitig, es sei zu drastisch, eine Obergrenze festzulegen, wie viel jemand besitzen darf. Eine solche Haltung ist verwirrend. Wie kann das sein? Wir reden hier schließlich über zwei Seiten derselben Medaille: Ungleichheit von oben nach unten zu begrenzen und die durch die Konzentration übermäßigen Reichtums verursachten Schäden und die Verschwendung zu beseitigen. Wenn man will, dass niemand in Armut lebt, und zu viel Ungleichheit für schlecht hält, folgt daraus, dass es eine Obergrenze für das Vermögen geben muss, das eine Person besitzen darf. In Zahlen ausgedrückt, ist Ungleichheit der Abstand zwischen unten und oben. Wenn sie denn je eingedämmt werden soll, muss es eine Obergrenze geben, und diese gibt uns unsere Wohlstandsgrenze vor. Selbstverständlich wird es Streit darüber geben, wo diese Grenze zu ziehen ist und ob und wie sie durchgesetzt werden sollte. Aber alle, die Ungleichheit für ungerecht und unerwünscht halten, müssen die Einführung irgendeiner Form von Vermögensobergrenze unterstützen.
Wo sollte diese Grenze also liegen? Letztlich ist es an den Bürgern eines jeden Landes, in einem wohlgeordneten politischen Verfahren darüber zu entscheiden. In einer gesunden Öffentlichkeit würden die Argumente für den Limitarismus gründlich diskutiert, und diese Debatte würde in die politischen Verhandlungen einfließen, wie viel zu viel ist. Wenn das aber alles wäre, was ich dazu zu sagen habe, wäre es verständlicherweise enttäuschend und würde die Debatte nicht wirklich voranbringen. Schließlich ist es ein erheblicher Unterschied, ob man für eine Vermögensobergrenze von 5000 Pfund oder 50 Milliarden Pfund eintritt. Also wage ich mich vor und sage, wo diese Grenze meiner Ansicht nach gezogen werden sollte, möchte allerdings betonen, dass ich meine Meinung lediglich als Sprungbrett für weitere Diskussionen äußere.
Ich schlage nicht nur eine, sondern zwei Obergrenzen vor. Die obere ist politisch und bezeichnet die Grenze, die unsere Gesellschaftsstruktur und unser Steuersystem durchsetzen sollten. Die zweite, untere ist persönlich – und hier kommt die Ethik ins Spiel.
Auf welchem Niveau sollte die höhere politische Grenze festgesetzt werden? Manche sagen, jeder Milliardär stehe für ein Politikversagen, daher würden sie die Schwelle bei einer Milliarde ziehen. In den sozialen Medien kursiert ein Witz, dass jeder, der Milliardär wird, eine Trophäe erhalten sollte, die ihm dazu gratuliert, dass er »den Kapitalismus gewonnen« habe. Man solle einen Hundepark nach ihm benennen und jedes zusätzliche Vermögen konfiszieren.
Das ist witzig, aber eine Milliarde ist viel zu viel. Um die politische Obergrenze zu berechnen, müssen wir zunächst über den Kontext nachdenken, in dem sie umgesetzt wird (dazu mehr im folgenden Kapitel). In einem Land mit einem ähnlichen sozioökonomischen Profil wie die Niederlande, wo ich wohne, sollten wir eine Gesellschaft anstreben, in der niemand mehr als 10 Millionen Euro besitzt. Es sollte keine Dekamillionäre geben. Diese Grenze in Euro, Dollar oder Pfund gilt in etwa für die meisten entwickelten Volkswirtschaften, allerdings ist wichtig festzuhalten, dass es mehr auf die Berechnungsmethode als auf den spezifischen Betrag ankommt. Denn sie erlaubt es allen, die in einem anderen sozioökonomischen System leben, eigene Einschätzungen anzustellen, wo die Obergrenze liegen sollte.
Was die Berechnung der niedrigeren ethischen Grenze angeht, gibt es – in den meisten Fällen – sehr gute Gründe, sie weit unter der politischen Schwelle von zehn Millionen zu ziehen. Ich behaupte, dass für Menschen, die in einer Gesellschaft mit einem soliden kollektiven Rentensystem leben, die ethische Obergrenze etwa um 1 Million Pfund, Dollar oder Euro pro Person liegt. Die ethische Grenze hängt ebenfalls vom Kontext ab und dürfte unter manchen Bedingungen niedriger, unter anderen höher sein, wie ich zeigen werde. Auch hier ist nicht der genaue Betrag wichtig, sondern der Weg, ihn zu ermitteln. Sicher wird es Auseinandersetzungen über die Höhe beider Schwellenwerte geben – und manche werden argumentieren, die ethische Grenze müsse wesentlich niedriger angesetzt werden als von mir vorgeschlagen.
Halten wir kurz inne, um uns mit einigen Einwänden zu befassen, die manche Leser bis hierhin sicher schon vorbringen werden. Der erste lautet: Bedeutet Limitarismus nicht, dass alle, ganz gleich was sie tun, das gleiche Ergebnis erzielen? Die Antwort ist schlicht: nein. Der Limitarismus tritt nicht für strikte Gleichheit ein. Es gibt prinzipielle wie auch pragmatische Gründe, dass ein gewisses Maß an Ungleichheit gerechtfertigt ist. Manche Menschen arbeiten härter als andere, gehen höhere Risiken ein oder übernehmen mehr Verantwortung. Manche erledigen gefährliche, extrem aufreibende oder gesundheitsbelastende Arbeiten. Manche haben Arbeitszeiten, die ein normales Familienleben gefährden. Manche müssen ständig in Bereitschaft sein. Andere pflegen einen bescheidenen Lebensstil und können mit der Zeit Ersparnisse anlegen. Es gibt noch weitere Gründe, dass ein gewisses Maß an Ungleichheit gerechtfertigt sein kann, zu denen wir später kommen. Aber grenzenlose Ungleichheit lässt sich durch nichts rechtfertigen. Und das ist in Hinblick auf den Limitarismus der wichtigste Punkt.
Der zweite Einwand lautet: Zu begrenzen, wie viel Reichtum eine Person anhäufen darf, würde erfordern, Privatbesitz und Marktmechanismen aufzugeben, und uns einen Kommunismus sowjetischen Stils aufzwingen. Diese Argumentation finde ich insofern erstaunlich, als sie etwas über die Qualität unserer öffentlichen Debatte offenbart. Ein solcher Einwand ist Unsinn und stellt vermutlich nur einen weiteren Versuch dar, begründete Kritik am Status quo zum Schweigen zu bringen. Aber da ich ihn schon so oft gehört habe, möchte ich vorab versichern: Ich plädiere weder für einen Kommunismus sowjetischen Stils noch für ein sonstiges Regime, das die Abschaffung der Märkte oder des Privateigentums erfordert. Märkte sind ein sehr wirkmächtiges Instrument, um materiellen Wohlstand zu sichern; Privateigentum ist ein Eckpfeiler unserer Sicherheit, unserer Autonomie und unseres Wohlstands; in Verbindung mit öffentlichen Gütern und allen zugänglichen kollektiven Ressourcen sind beide unerlässlich für eine funktionierende Gesellschaft. Wir würden uns ins eigene Knie schießen, wenn wir sie abschafften. Die eigentliche Frage, die wir beantworten müssen, ist vielmehr, welche Beschränkungen wir dem Markt und dem Privateigentum auferlegen müssen, um den Limitarismus zu erreichen.
Dem dritten Einwand sind wir bereits begegnet: Diskussionen, welche die Legitimität extremen Reichtums in Frage stellen, seien von Neid getrieben. Das ist einer der am weitesten verbreiteten Kritikpunkte – mit dem sich nicht nur Befürworter des Limitarismus konfrontiert sehen, sondern alle, die für eine stärkere Progression der Besteuerung eintreten. Als Bernie Sanders und Elizabeth Warren während der Vorwahlen der Demokratischen Partei für die US-Präsidentenwahl 2020 Vermögenssteuern vorschlugen, warf man ihnen Neid vor. Als deutsche Politiker 2019 über einen Vorschlag diskutierten, eine Vermögenssteuer einzuführen, taten ihre Kritiker es als »Neiddebatte« ab. Als Nick Clegg, der damalige stellvertretende Premierminister des Vereinigten Königreichs, 2012 vorschlug, eine einmalige Vermögensabgabe von superreichen Briten zu erheben, um die Rezession zu bekämpfen und soziale Unruhen zu vermeiden, hielt man ihm vor, er betreibe eine Neidpolitik. Niederländische Konservative und rechte Politiker haben sogar ein neues Wort geprägt – jedes Mal, wenn jemand die Einführung einer Steuer vorschlägt, die sehr reiche Menschen überproportional belastet, sprechen sie von jaloesiebelasting (Neidsteuer). In all diesen Ländern sind Variationen desselben Themas zu beobachten: Wenn man sich auf die Reichen fokussiert, muss man neidisch sein.[6]
Selbst unter einigen gemäßigten Progressiven herrscht das allgemeine Gefühl, es sei schlecht, den Superreichen ihren Reichtum zu verübeln. In Anbetracht all ihrer harten Arbeit, Mühen und Talente hätten sie ihn verdient. Sie zu kritisieren zeuge von schlechtem Geschmack und sei sogar peinlich: Denn es läge die Vermutung nahe, dass man selbst nicht das Talent oder den Charakter besitze, hart zu arbeiten. So deuten nicht nur Konservative und rechts eingestellte Personen die Kritik an übermäßigem Reichtum. Barack Obama erfasste es recht gut, als er auf die Frage eines Journalisten nach Bonuszahlungen antwortete: »Wie die meisten Amerikaner verübele ich Menschen ihren Erfolg oder Wohlstand nicht. Das gehört zur freien Marktwirtschaft.«[7]
Da diese Anschuldigung so weit verbreitet ist, möchte ich sie ernst nehmen und aufzeigen, warum sie falsch ist. Der direkteste Weg, sie zurückzuweisen, ist der Hinweis auf die vielen sehr reichen Menschen, die sich für politische Maßnahmen einsetzen, um die Ungleichheit von oben nach unten zu reduzieren. Viele Multimillionäre und Milliardäre warnen, dass die Ungleichheiten zu groß werden und Staaten die Steuern für die Reichsten erhöhen müssen. Im Januar 2023 unterzeichneten etwa zweihundert Multimillionäre einen offenen Brief an die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos, in dem sie für eine höhere Besteuerung der Reichen plädierten. Dasselbe forderte Bill Gates schon mehrfach. Siebzehn Superreiche, darunter auch George Soros, forderten 2020 die US-Präsidentschaftskandidaten auf, eine Vermögenssteuer einzuführen. Es ist eindeutig ein Widerspruch, zu behaupten, dass Personen, die für eine höhere Besteuerung ihrer eigenen Schicht plädieren und häufig Geld spenden, neidisch auf den Reichtum sind, den sie und Ihresgleichen genießen. Das ergibt keinen Sinn. Wie könnte jemand neidisch auf sich selbst sein?[8]
Darüber hinaus ließe sich auch anmerken, dass sich alle, die den Limitarismus auf dieser Basis ablehnen, ins eigene Fleisch schneiden. Denn die Ungleichheit zu reduzieren, würde auch die Gründe für Neid zwischen den Menschen verringern und damit letztlich den Neid selbst, wie die beiden dänischen politischen Theoretiker David Axelsen und Lasse Nielsen argumentieren. Nach ihrer Ansicht tendieren Menschen, die den »Neideinwand« erheben, zu der Auffassung, die Politik solle die weniger Wohlhabenden nicht ermuntern, das haben zu wollen, was andere besitzen. Stattdessen sollten sich die weniger Begüterten auf ihre eigenen Projekte konzentrieren und versuchen, ihr Leben zu verbessern. Axelsen und Nielsen wenden ein, dass Menschen nicht so sehr durch das, was andere haben, abgelenkt wären, wenn es eine Obergrenze dafür gäbe, wie viel jemand anhäufen und ausgeben kann. Es gäbe weniger Konkurrenz um Statusgüter und daher auch weniger demonstrativen Konsum, der überhaupt erst Neid erregt. Eine limitaristische Gesellschaft wäre für alle besser, auch für die sehr Reichen, weil sie den endlosen Konkurrenzkampf um Statusgüter beendete. Wer gegen Neid ist, hat allen Grund, den exzessiven Konsum einzudämmen, der mit exzessivem Reichtum einhergeht.[9]
Es gibt noch eine letzte Antwort auf den Neideinwand. Selbst wenn eine einzelne Person, die für eine Vermögensobergrenze eintritt, Neidgefühle hegen sollte, spielt das eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist, ob sie triftige Argumente dafür hat, Ungleichheit einzudämmen. Solange dies der Fall ist, können wir sagen, dass ihr Neid zwar bedauerlich ist, aber der limitaristische Vorschlag Bestand hat. Wir sollten uns auf die eigentlichen Argumente konzentrieren und nicht auf die Einstellung, die den Verfechtern dieses Vorschlags unterstellt wird. Letzten Endes versteht man den Neideinwand am besten als weiteres Ablenkungsmanöver, das uns daran hindern soll, über den mit exzessivem Reichtum verbundenen Schaden und über die Argumente für den Limitarismus zu sprechen. Konzentrieren wir uns also auf die Hauptsache.[10]
Eine ermutigende Entdeckung der letzten Jahre ist, dass es Superreiche gibt, die bereits angefangen haben, den Limitarismus in ihrem Leben umzusetzen. Ein britischer Dekamillionär, den ich interviewte, beschloss gemeinsam mit seiner Frau, nicht mehr als 2 Millionen Pfund für sich und ihre Kinder zu behalten; sie planen, den Rest bis 2030 wegzugeben. Sie besitzen genug, um sich mehrere Häuser zu kaufen, leben aber in einem normalen Einfamilienhaus und geben ihr Geld nicht für Extravagantes aus. Seine Begründung, alles zu verschenken, war, dass sie für ein erfülltes Leben nicht mehr bräuchten: Mit 2 Millionen Pfund verfügt eine vierköpfige britische Familie über ausreichende Mittel, um ein gutes Leben zu führen, und kann das restliche Geld ohne weiteres einsetzen, um weniger Betuchten zu einem besseren Leben zu verhelfen.
Aber nicht nur anonyme Millionäre denken, dass es eine Obergrenze für das Vermögen eines Menschen geben sollte. Es gibt einige gut dokumentierte Beispiele für limitaristisches Verhalten in einem erheblich größeren Maßstab. Charles »Chuck« Feeney, ein ehemaliger Milliardär, verschenkte praktisch sein gesamtes Vermögen, als er um die Lebensmitte feststellte, dass er ein großes Vermögen besaß, aber auch eine tiefe Abneigung gegen den protzigen Konsum hatte, den er um sich herum sah. Daher beschloss er, es sei das Beste, das Geld zu verschenken, bevor er starb. Und genau das tat er: Er übertrug den Großteil seines Vermögens, etwa 8 Milliarden US-Dollar, seiner philanthropischen Stiftung, die nach Abschluss ihrer Mission 2020 geschlossen wurde. Angeblich lebte er bis ins Alter von 92 Jahren mit seiner Frau in einer gemieteten Dreizimmerwohnung, nachdem er 2 Millionen Dollar für sich behalten hatte. Seine Kinder erwarteten nicht, ein großes Vermögen zu erben. Sie sagten, sie seien dankbar, dass sie ein normales Leben führen konnten.[11]
Erst kürzlich beschloss Yvon Chouinard, der Gründer der Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia, sämtliche Anteile an seinem Unternehmen einer gemeinnützigen Stiftung zu übertragen, die mit den Gewinnen weltweit Maßnahmen gegen den Klimawandel und zum Schutz unerschlossener Landflächen finanziert. Der Unternehmenswert wird auf etwa 3 Milliarden US-Dollar geschätzt und erwirtschaftet jährlich Gewinne von etwa 100 Millionen Dollar. Anders als bei Feeney hatte Chouinards Entscheidung weniger mit seinem eigenen Lebensstil zu tun, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er sonderlich extravagant lebt, wenn man bedenkt, dass er angeblich kein Mobiltelefon besitzt, geschweige denn einen Computer. Vielmehr basierte sein Entschluss auf seiner Ansicht, dass die Existenzberechtigung seines Unternehmens darin besteht, eine positive Wirkung für den Planeten zu haben. Chouinard mag eine unorthodoxe unternehmerische Sicht haben – Menschen und der Erde Vorrang vor Profiten einzuräumen –, aber er hat gezeigt, dass selbst erfolgreiche multinationale Unternehmer eine limitaristische Weltsicht haben können.[12]
Letzten Endes stimmten fast alle Superreichen, die ich interviewte, zu, dass Ungleichheit ein ernsthaftes politisches Problem ist und Staaten die sehr Wohlhabenden ungeschoren davonkommen ließen. Ich suchte diese Männer und Frauen auf, weil ich besser verstehen wollte, wie sie zu ihrem Vermögen standen und wie sie die Dynamik des Reichtums erlebten. Es war erhellend, sie über die Dilemmata reden zu hören, mit denen sie sich konfrontiert sahen, wenn sie ihren Reichtum verschenken wollten. Wenig überraschend, versuchten viele Vermögende zu rechtfertigen, dass sie so viel Geld angehäuft haben – schließlich sind sie Menschen wie alle anderen, und wir alle versuchen, die Entscheidungen, die wir treffen, zu verteidigen, wobei viele von uns nicht fähig oder bereit sind, sich die eigenen Privilegien einzugestehen. Dennoch waren sich alle die sehr reichen Menschen, mit denen ich sprach, der Probleme völlig bewusst, die das gegenwärtige Maß an Ungleichheit erzeugt. Die meisten waren keine Theoretiker, Akademiker oder Autoren, aber viele äußerten limitaristische Ansichten und Argumente, wie sie in diesem Buch dargelegt sind. Es war beruhigend, festzustellen, dass weite Teile dieser Ansichten von Menschen geteilt werden, die jener Gruppe angehören, die durch eine Wende hin zum Limitarismus am meisten Geld zu verlieren haben.
Dass solche Beispiele selten sind, versteht sich von selbst. Weit häufiger sind Multimillionäre und Milliardäre, die an ihrem Vermögen festhalten und bestenfalls einige Krümel abgeben, oder schlimmer noch, die Geld auf eine Weise spenden, die sie sogar noch reicher macht, indem sie karitative Stiftungen gründen, die ihren Geschäftsinteressen dienen und Steuerabschreibungen ermöglichen. Leider sind die Dekamillionäre, die meinen, ihr Reichtum stehe ihnen zu, nicht sonderlich daran interessiert, darüber zu sprechen. Nach meiner Erfahrung mit den Medien – und mit meinen Recherchen zu diesem Buch – lässt sich nur schwer jemand finden, der bereit wäre, diese Haltung auf der Bühne oder in Funk und Fernsehen zu verteidigen. Im Januar 2022 interviewte mich der Fernsehsender CBS zum Limitarismus und sprach anschließend mit der Disney-Erbin und Filmproduzentin Abigail Disney über ihr politisches Engagement im Kampf gegen wachsende Ungleichheit. Soweit ich weiß, bemühte sich CBS monatelang, eine sehr reiche Person zu finden, die das Prinzip der Kapitalakkumulation der Superreichen im Fernsehen verteidigen würde. Aber vergebens. Schließlich gelang es dem Sender, Vivek Ramaswamy zu gewinnen, einen amerikanischen Unternehmer und Investor aus einer Einwandererfamilie, der sich später um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikanische Partei bewerben sollte. Er erzählte eine nicht sonderlich relevante Geschichte über die Bedeutung von Chancengleichheit. Selbstverständlich sind wir alle für Chancengleichheit! Es ist lobenswert, über Bemühungen zu reden, Gutes für die weniger Wohlhabenden zu tun – aber die Reichen haben gelernt, dies auf eine Weise zu tun, die allen Fragen zu ungleichen Ergebnissen ausweicht. Denn früher oder später münden solche Fragen in einer Analyse der Gesellschaftsstrukturen, politischen Entscheidungen und Machtverhältnisse, die zu diesen Ungleichheiten geführt haben. Und dabei haben die Reichsten nichts zu gewinnen. Wenig überraschend bemüht sich die Mehrheit von ihnen, das Thema zu vermeiden.[13]
Wir sollten jedoch weiterhin versuchen, mit den Superreichen in einen Dialog zu treten, auch wenn manche von ihnen derart von sich eingenommen sind, dass es schwerfällt, sich davon nicht abschrecken zu lassen. Progressive tappen verständlicherweise gern in die Falle, extrem reiche Menschen zu verteufeln. Ich finde jedoch, dass dies zwar in manchen Einzelfällen gerechtfertigt ist, aber eine allzu simple Reaktion darstellt. Die extreme Konzentration von Reichtum ist in erster Linie ein Strukturproblem. Daher sollten wir uns vor allem auf die notwendigen strukturellen Veränderungen konzentrieren und uns nicht auf die reichen Personen an sich fixieren, solange sie den erforderlichen Strukturwandel nicht aktiv behindern.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass die Gruppe der Superreichen eine große Bandbreite recht unterschiedlicher Menschen umfasst. Manche der Vermögenden, mit denen ich gesprochen habe, organisieren politische Proteste gegen extremen Reichtum und plädieren für eine Umverteilung von Geld und Macht von den Reichen an die Armen und die Mittelschicht. Manche sprechen sich sogar für eine grundlegende Umwälzung unserer Wirtschaft aus. Man wird dieser Gruppe nicht gerecht, wenn man sie alle über einen Kamm schert, ganz abgesehen davon, dass es für alle, die einen echten Wandel anstreben, strategisch unklug wäre.
Zudem ist es auf einer tieferen Ebene wichtig, dass wir mit Menschen, die völlig anderer Meinung sind als wir, Gesprächskanäle offen halten, solange alle Beteiligten bereit sind, zuzuhören, und es vermeiden, auf Lügen, Täuschung oder Beleidigung zurückzugreifen (zugegebenermaßen erfordert das, dass die Medien solche Debatten ermöglichen und somit frei von Machtmissbrauch durch Konzerne sind, ein Problem, auf das wir später zurückkommen werden). Wenn wir Superreiche verurteilen, statt uns auf das umfassendere Problem der Konzentration extremen Reichtums zu fokussieren, wird dieses Gespräch erheblich erschwert. Der Austausch von Ideen und die Bereitschaft, den eigenen Standpunkt in Frage stellen zu lassen und potenziell zu ändern, ist das, was uns als denkende Wesen ausmacht. Es ist das lebendige Herz der demokratischen Gesellschaft. Wenn wir in einer besseren Welt leben wollen, müssen wir, wie Anand Giridharadas in seinem Buch The Persuaders argumentiert, zu dem Versuch bereit sein, andere zu überzeugen, und offen dafür sein, uns von ihnen überzeugen zu lassen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir herausgefordert werden, nicht einfach nur unsere politischen Ansichten herausbrüllen, sondern darüber nachdenken, warum wir sie haben. Wir müssen unserer Umgebung unsere Überlegungen respektvoll darlegen, denn letztlich müssen wir alle – in jedem Land und auf dieser Erde – mit unseren Mitmenschen zusammenleben.[14]
Vor über zehn Jahren habe ich mich aufgemacht, um die Frage zu beantworten, ob an extremem Reichtum etwas falsch ist. Unterwegs habe ich eine ganze Reihe von moralischen, politischen und praktischen Argumenten durchgearbeitet und die Fülle von Informationen herangezogen, die von der empirischen Forschung und dem investigativen Journalismus zusammengetragen wurden. Am Ende habe ich dieses Buch geschrieben, das sich zu einem öffentlichen Überzeugungsversuch entwickelt hat. Ich hoffe, meine Leserschaft zu überzeugen, dass es uns allen in einer Welt, in der es keine Superreichen gibt, besser gehen würde; in einer Welt, in der die »nur« Reichen bereit wären, nachdem sie ihre Steuern bezahlt haben, mehr von ihrem Vermögen mit den weniger Wohlhabenden zu teilen. In einer solchen Welt würde es uns allen nicht nur besser gehen – es gäbe darin auch erheblich weniger Ungerechtigkeit aller Art.
Viele progressive Kräfte werden auf den folgenden Seiten Argumente finden, die ihre bisherigen Ansichten stützen. Die meisten Konservativen, Neoliberalen und Rechts-Libertären vertreten in dieser Debatte Positionen, die erheblich weiter von meiner entfernt sind. Dennoch hoffe ich, dass auch sie bereit sein werden, sich darauf einzulassen. Schließlich betrifft es auch ihre Zukunft: Auch sie haben ebenso wie der Rest von uns viel zu verlieren, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Kapitel 1Wie viel ist zu viel?
Als mein ältester Sohn etwa zwölf Jahre alt war, radelten wir von unserer Wohnung in Utrecht in ein benachbartes Dorf. Utrecht ist eine wunderschöne alte Stadt in den Niederlanden mit vielen Gebäuden aus dem Mittelalter. Sie schwirrt vor Leben. Wie alle Städte hat sie ihre Probleme, aber dank jahrelanger progressiver Kommunalpolitik bietet sie ihren Einwohnern eine hohe Lebensqualität. Und wie überall in den Niederlanden hat sie eine hervorragende Infrastruktur für Radfahrer, und nahezu alle radeln, Jung und Alt, Reich und Arm.
Es war ein herrlicher Tag, und während der Fahrt plauderten wir. Als wir den Stadtrand erreichten, kamen wir an einer Bank vorbei, auf der ein schlafender Mann lag. Er war unverkennbar in einer schlechten Verfassung: Seine Kleidung war ausgefranst und voller Flecken, seine Schuhe waren abgetragen und sein Gesicht und seine Hände voller Schwären. Als wir an ihm vorbei waren, fragte mein Sohn: »Mama, hast du das gesehen?« »Ja«, erwiderte ich, »das ist ein Obdachloser.« Mein Sohn schwieg eine Weile und sagte dann: »Ich schäme mich, dass wir als Gesellschaft Menschen so behandeln.«
Überall sieht man Obdachlose, die auf einer Bank oder einem Stück Pappe auf dem Bürgersteig schlafen, wenn auch an manchen Orten häufiger als an anderen. Die schlimmste Armut ist gewöhnlich für alle gut sichtbar: sei es nun Obdachlosigkeit oder eine andere Form materieller Entbehrungen – Kinder, die immer in denselben Kleidern in die Schule kommen und auf das kostenlose Mittagessen angewiesen sind, das sie dort bekommen. Dagegen ist großer Reichtum häufig unsichtbar. Tatsächlich ziehen es Reiche und Superreiche in vielen Ländern vor, unentdeckt zu bleiben. Sie bauen ihre Villen hinter hohen Zäunen oder in bewachten Wohnanlagen mit Kameras, die Neugierige in Schach halten. Sie tragen teure Kleidung und Schmuck, wenn sie Events mit anderen Superreichen besuchen, aber bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sie an öffentlichen Orten mit dem Rest von uns zusammentreffen, versuchen sie häufig, nicht aufzufallen. In der Öffentlichkeit präsentiert sich Ungleichheit häufiger in Form von Armut als in Gestalt von extremem Reichtum.
Es mag trivial klingen, aber es gibt zwei Seiten der Ungleichheit. Sie kann zunehmen, weil die Armen ärmer werden oder weil die Reichen noch reicher werden – und die Mittelschicht und die Armen noch weiter hinter sich lassen. Wenn die Ungleichheit wächst, weil die Armen ärmer werden oder die Mittelschicht in Bedrängnis gerät, ist sie offensichtlicher und wird von vielen Menschen aus erster Hand erlebt. Es fällt uns auf, wenn auf den Straßen mehr Obdachlose und Bettler sind. Lebensmitteltafeln teilen den Medien ohne Zögern mit, wenn die Schlangen länger werden – wenn immer mehr Familien verzweifelt Unterstützung brauchen, weil ihr Einkommen nicht mehr für ihre Grundbedürfnisse ausreicht. Wenn dagegen die sehr Reichen reicher werden, ist in der Öffentlichkeit nicht viel davon zu sehen, und die Alltagserfahrung der meisten von uns verändert sich nicht. Zumindest nicht unmittelbar. Was passiert ist, können wir nur herausfinden, wenn wir die jährlichen Reichenlisten konsultieren oder die Medien über aktualisierte Statistiken der Vermögensverteilung berichten, das heißt, falls sie sich überhaupt entschließen, über diese Themen zu berichten.
Vielleicht erklärt das, warum in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nur wenige Menschen bemerkten, dass die Ungleichheit zuzunehmen begann. In vielen Ländern gab es eine Zeitlang keine spürbare Zunahme der Armut, und in manchen Entwicklungsländern, vor allem in China, wuchs die Mittelschicht. Die meisten Ökonomen fokussierten sich auf Letzteres und feierten, dass die Ausweitung des internationalen Handels die willkommene Auswirkung hatte, das Ausmaß extremer Armut im Globalen Süden zu verringern. Die Finanzkrise 2008 führte zwar zu einem sichtbaren Zuwachs von Menschen, die in Not gerieten, aber das Wort »Krise« vermittelte der Öffentlichkeit den irreführenden Eindruck, es handele sich um eine vorübergehende Störung eines Systems, das im Grunde auf einer gerechten Basis mehr Wohlergehen für alle schaffte.
Das alles änderte sich 2013, als der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty sein Buch Le Capital au XXIe siècle (dt.: Das Kapital im 21. Jahrhundert) veröffentlichte. Es schlug ein wie eine Bombe. Piketty und seine internationalen Mitarbeiter hatten neue Daten gesammelt, viele davon aus bis dahin unerforschten Quellen wie historischen Steuerunterlagen. Sie bestätigten die weit verbreitete Ansicht, dass die Ungleichheit in vielen reichen Ländern in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg abgenommen hatte. Der Krieg hatte sich als brutaler Gleichmacher erwiesen, da er viele große Vermögen vernichtet hatte; anschließend bemühte man sich, mit vereinten Kräften eine Gesellschaft wiederaufzubauen, in der alle aufblühen konnten. Aber Pikettys Analyse zeigte auch, dass es gegen Ende der siebziger Jahre einen klaren Wendepunkt gab und von da an die Ungleichheiten – beim Einkommen, aber mehr noch bei den Vermögen – stetig zugenommen hatten. Er entlarvte die Vorstellung als Mythos, dass es nie wieder Ungleichheiten in einer Größenordnung geben würde, wie sie zu Feudalzeiten existiert hatten: Wenn wir nicht politisch intervenieren würden, befänden wir uns auf dem Weg in eine neue quasi-feudale Ära, in der die wenigen nahezu alles, und die vielen nahezu gar nichts besäßen, warnte er.[1]
Leider hat er recht behalten. Angesichts der politischen Entscheidungen, die wir getroffen haben, bekommt extremer Reichtum freie Fahrt. Und sein lawinenartiges Anwachsen macht es zunehmend schwieriger, etwas gegen die Ungleichheit zu unternehmen. In den zehn Jahren, die seit Erscheinen von Pikettys Buch vergangen sind, sind die Reichen weiterhin immer reicher geworden: Alljährlich liefert der Oxfam-Bericht zur Vermögensungleichheit schockierende Statistiken zur globalen Vermögensverteilung. Nur ein Beispiel: Von 2020 bis 2022 waren Einkommen und Vermögen des obersten 1 Prozents doppelt so hoch wie das der übrigen 99 Prozent der Weltbevölkerung.[2]
Wenn wir eine Chance haben wollen, eine Lösung für dieses Problem zu finden, müssen wir das Wesen und Ausmaß extremen Reichtums verstehen. Wenn mein Sohn einen Obdachlosen sieht, können wir darüber reden, warum das passiert und was dagegen getan werden sollte; aber wir fragen uns kaum einmal – falls überhaupt –, welcher Zusammenhang zwischen den Superreichen, die in Villen hinter verschlossenen Toren wohnen, und den Obdachlosen auf der Straße oder den Mittelschichteltern besteht, die Mühe haben, ihre Miete zu bezahlen.[3]
Statistiken und andere Daten können uns genau aufzeigen, wie viel die reichsten Menschen der Gesellschaft typischerweise verdienen und besitzen; wie ihr Vermögen im Laufe der Zeit gewachsen ist und wie sie es erworben haben; und vor allem wie das oberste 1 Prozent als Ganzes seinen Reichtum vermehrt hat. Aber bevor wir uns in die Zahlen versenken, sollten wir herausfinden, wer diese Menschen sind. Über wen sprechen wir hier? Was für ein Leben führen sie? Eindeutig haben die Superreichen alle viel Geld. Auf die Frage, wie viel »viel Geld« ist, kommen wir später zurück, vorerst gehen wir als Arbeitsdefinition für »Superreiche« von Menschen aus, die jeweils über ein Vermögen von mindestens 5 Millionen Pfund oder über ein Einkommen verfügen, das es ihnen ermöglicht, ein solches Vermögen im Laufe der Zeit anzuhäufen. Viele Menschen haben ein beträchtliches Einkommen – nicht wenige CEOs großer Konzerne verdienen im Jahr 10 Millionen Pfund und mehr. Andere haben vielleicht ein geringeres Einkommen, aber beträchtliche Vermögenswerte wie Land, Immobilien oder geerbtes Geld. Ansehnliches Kapital dieser Art bedeutet, dass sie ihren Reichtum sich vermehren lassen können, da die Erträge von Investitionen und Darlehen aus solchen Vermögenswerten wesentlich höher sind als die von Ersparnissen einer Mittelschichtfamilie. Eine gewöhnliche Person mit bescheidenen Ersparnissen auf der Bank bekommt typischerweise weniger als 1 Prozent Zinsen, aber Menschen, die große Summen langfristig anlegen können, erhalten in der Regel 5 Prozent und mehr.
Sieht man sich jedoch ihr Leben an, wie sie ihr Vermögen angehäuft haben, was sie mit ihrem Reichtum tun und welche Ansichten sie zur Legitimität ihres Wohlstands hegen, sind die Supereichen äußerst verschieden. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Konzentration von Reichtum Risiken für die Gesellschaft birgt: In allen Fällen gibt es gewichtige Einwände gegen die Größe ihres Vermögens. Dennoch ist die Diversität der Superreichen wichtig. Wenn wir uns den Argumenten für (oder gegen) den Limitarismus zuwenden, werden wir sehen, dass ein Bewusstsein für die vielen, den Superreichen zur Verfügung stehenden Quellen des Reichtums uns zu erkennen hilft, welche dieser Argumente auf den Einzelnen zutreffen (es werden mehrere zutreffen, aber nicht alle für jeden oder zumindest nicht im selben Maß). Wenn wir eine politische Debatte über extremen Reichtum führen wollen, müssen wir darüber hinaus dafür sorgen, dass wir uns nicht auf eine spezifische Untergruppe der Superreichen fixieren, und unsere Behauptungen verallgemeinern. Das zu tun würde bedeuten, die Superreichen in Bausch und Bogen entweder zu glorifizieren oder zu verteufeln.
Eines haben sie allerdings alle gemeinsam: Was sie eint, ist, dass sie viel Geld besitzen und, wie wir später noch sehen werden, in einem System leben, das Reichtum schützt und seine weitere Akkumulation ermöglicht. Wollen wir aber Erklärungen für die wachsende Ungleichheit finden und die Folgen extremen Reichtums verstehen, so brauchen wir ein vollständigeres Bild. Also: Wer sind sie?
Fangen wir mit den Wohlfühl-Erfolgsgeschichten an. Das sind die seltenen Multimillionäre, die gegen jede Wahrscheinlichkeit reich geworden sind und angeblich den lebenden Beweis liefern, dass jeder »es schaffen« kann. Nehmen wir J. K. Rowling, die ihren ersten Harry-Potter-Band schrieb, als sie als alleinerziehende Mutter von Sozialhilfe lebte. Der Erfolg ihrer Romane und der anschließende Verkauf der Filmrechte machten sie in Großbritannien zur erfolgreichsten lebenden Bestseller-Autorin und brachten ihr ein Vermögen ein, das auf etwa 1 Milliarde Pfund geschätzt wird. Oder nehmen wir Oprah Winfrey, die in bitterer Armut aufwuchs und als Kind wiederholt sexuell missbraucht wurde. Trotz dieser extrem harten Kindheit baute sie sich eine glänzende Fernsehkarriere auf, die sie zu einer der einflussreichsten Medienpersönlichkeiten Amerikas – und zur Milliardärin – machte. Aber wir dürfen uns von J. K. Rowlings und Oprah Winfreys Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichten nicht hinreißen lassen: Ja, manche können gegen jede Wahrscheinlichkeit reich werden, das heißt jedoch keineswegs, dass dies allen gelingen kann, die in Armut oder Elend aufwachsen. Ganz im Gegenteil. Es kommt extrem selten vor, dass ein schwer arbeitender, ehrgeiziger Mensch aus der Unterschicht oder der unteren Mittelschicht Milliardär wird. Die meisten können von den außerordentlichen Transformationen, die Rowling und Winfrey erfahren haben, nur träumen. Abgesehen von diesen seltenen Ausnahmen, die wir gern ins Rampenlicht rücken, bleiben die meisten Menschen aus diesen Schichten trotz aller Anstrengungen arm oder auf Mittelschichtniveau.
Häufiger sind superreiche »Selfmade«-Geschäftsleute, die in Familien der (oberen) Mittelschicht aufgewachsen sind. In der Regel fangen sie ohne ererbtes Vermögen an und arbeiten eine Zeitlang in mittelmäßig bezahlten Anstellungen. Irgendwann gründen sie ein Unternehmen in einem günstigen Marktsegment. Wenn sie dieses Unternehmen verkaufen und sich zur Ruhe setzen – meist mit Ende vierzig oder fünfzig –, haben sie sehr viel Geld auf dem Bankkonto. Manche dieser Firmen können mit der Zeit wirklich sehr groß werden, aber viele dieser Selfmade-Dekamillionäre tun nicht so absurde Dinge, wie Twitter zu kaufen oder Weltraumtourismusprogramme zu entwickeln. Es sind Geschäftsleute, die weiterhin mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Das gilt für mehrere der Dekamillionäre, die ich interviewte. In den ersten Jahrzehnten führten sie ein normales Mittelschichtleben, was vielleicht teilweise erklärt, warum sie sich nicht wohl damit fühlen, so viel Geld zu besitzen. Manche bemühen sich aktiv, es auf umsichtige Weise zu verschenken. Andere verspüren ein tieferes Unbehagen wegen ihres Reichtums und schließen sich politischen Organisationen an, die für höhere Besteuerung der sehr Reichen eintreten, wie den Patriotic Millionaires in den USA und im Vereinigten Königreich, taxmenow in den deutschsprachigen europäischen Ländern und den Millionaires for Humanity, die weltweit tätig sind.[4]
Manche dieser geschäftstüchtigen Multimillionäre und Milliardäre mögen erscheinen, als hätten sie alles aus eigener Kraft geschafft – als seien sie wie Oprah Winfrey tatsächlich aus dem Nichts gekommen. Häufig entspricht das jedoch nicht der Wahrheit. Meist hatten sie Eltern, die ihre Talente aktiv gefördert und in sie investiert haben, oder Lehrer, die sich besonders für sie eingesetzt haben. Oder wohlhabende Verwandte, die ihre Studiengebühren übernommen haben, so dass sie bei ihrem Eintritt ins Arbeitsleben nicht mit der Rückzahlung erheblicher Studienkredite belastet waren. Oder sie profitierten von einer Politik, die ihnen Startvorteile verschaffte oder sie weiter unterstützte, auch wenn sie bereits finanziell gut gestellt waren.
Dann gibt es noch eine weniger klar umrissene Gruppe von Superreichen, die kein eigenes Unternehmen aufgebaut, sondern sich in einem Konzern hochgearbeitet haben. Sie verkörpern exemplarisch den Erfolg im Spiel des Kapitalismus. Diese Menschen sind die Triebkräfte von Institutionen, die erhebliche Ressourcen um die Welt bewegen, die Güter und Dienstleistungen produzieren, welche die Nachfrage der Konsumenten decken, und die finanziellen Wohlstand schaffen (ob sie für das Wohl von Konsumenten oder überhaupt jemandem sorgen, ist allerdings eine andere Frage; nicht alle verkauften und gekauften Güter steigern unser Wohlergehen). Nehmen wir Ben van Beurden, von 2014 bis 2022 CEO von Shell. Laut der Webseite des Konzerns gehörte es in dieser Zeit zu seinen Hauptverdiensten, dass das Unternehmen unter seiner Führung seine Finanzperformance erheblich verbesserte und unter anderem ein um 65 Prozent höheres bereinigtes Ertragsergebnis erzielte und die Ausschüttungen an die Aktionäre verdoppelte. Eindeutig versteht er es sehr geschickt, in der heutigen globalisierten kapitalistischen Welt Geschäfte zu machen. Im März 2019 gab es in den Niederlanden einige Diskussionen über sein Einkommen in den vorangegangenen Jahren, das von 8,9 Millionen Euro 2017 auf 20,1 Millionen Euro 2018 angewachsen war – was 55000 Euro pro Tag entspricht. In den meisten Jahren lagen seine Gesamteinkünfte bei Shell in der Größenordnung von 5 bis 8 Millionen Euro.[5] Nach niederländischen Maßstäben ist das ein sehr hohes Einkommen. Aber wenn van Beurden sich anderswo umsieht, vor allen unter seinesgleichen im Vereinigten Königreich und in den USA, könnte er es durchaus für ein bescheidenes Gehalt halten. Schließlich betrug 2018 das Durchschnittsgehalt eines CEO in einem der 350 größten amerikanischen Konzerne 14 Millionen Dollar oder 17,2 Millionen Dollar, wenn man Aktienoptionen mitrechnet.[6] Es gibt immer jemanden, der mehr verdient.
Selbstverständlich gibt es auch eine recht große Gruppe, die für ihr Geld nichts getan hat: die Erben eines Vermögens. Das sind zunächst einmal die Königshäuser. Die meisten Mitglieder von Königsfamilien wurden in großen Reichtum hineingeboren und genießen beträchtliche Jahreseinkommen. Prinz William, der nach dem Tod von Königin Elizabeth II. Prince of Wales wurde, besitzt nun ein Herzogtum, das etwa 1 Milliarde Pfund Wert ist und in den letzten Jahren einen Jahresertrag von über 20 Millionen Pfund erwirtschaftet hat.[7] Aber nicht nur Monarchen genießen das Privileg eines großen Erbes. Über die Hälfte des gegenwärtigen Reichtums stammt aus einer Erbschaft (oder aus einer Serie von Erbschaften, wie die superreichen Dynastien es gern sehen). Die Nutznießer dieser Erbschaften üben vielleicht selbst einen Beruf aus oder arbeiten gar nicht. Manche nutzen ihr Erbe als Startkapital, um eigene Unternehmen zu gründen. Ihr Vermögen ist dann eine Kombination aus ererbtem Reichtum und zusätzlichem Wohlstand aus ihrer Geschäftstätigkeit, allerdings ist anzumerken, dass ihre Unternehmen durch ihr Anfangskapital zumindest unterstützt wurden. Erben großer Vermögen können sich natürlich jede Tätigkeit aussuchen, die ihnen gefällt, aber interessanterweise gibt es schichtspezifische Erwartungen, was sie tun sollten und vor allem nicht tun sollten. Einer meiner Gesprächspartner, der viele reiche Leute aus der Finanzwelt interviewt hatte, erwähnte, dass junge Frauen in europäischen Elitekreisen ermuntert werden, Kunstgeschichte zu studieren, damit sie sich um die Kunstsammlung der Familie kümmern können, während ihr Mann in der Finanzbrache arbeitet.
Das soll keineswegs heißen, dass es nicht auch Menschen gibt, die wie Chuck Collins ein Vermögen erben und beschließen, es nicht zu behalten. Er wuchs in den sechziger und siebziger Jahren in einem Vorort von Detroit auf und erlebte aus erster Hand die durch ungleichen Wohlstand verursachte enorme Ungleichheit der Chancen. Er fand es ungerecht, dass er mit einem Treuhandfonds geboren wurde, während Menschen, die in Wohncontainern lebten, ihre Zwangsräumung befürchten mussten. Zudem stießen ihn die Argumente der älteren Mitglieder seines Netzwerks Vermögender ab, die junge Millionäre warnten, nicht die Gans zu schlachten, die goldene Eier legte. Anders gesagt: Rühre das Kapital nicht an, das deine Eltern und Großeltern dir vermacht haben – lass es wachsen und lebe von dessen Ertrag. Mit 26 Jahren verschenkte er 1985 sein Erbe (damals 500000 Dollar, die laut Schätzung eines Journalisten 2016 einen Wert von über 7 Millionen Dollar gehabt hätten). Seitdem engagierte er sich in diversen Organisationen, die Forschungen zu Ungleichheit durchführen, das Bewusstsein für dieses Problem schärfen und Vorschläge für politische Maßnahmen entwickeln, um etwas dagegen zu unternehmen. Außerdem hat er zahlreiche Bücher zu diesem Thema veröffentlicht, unter anderem eines gemeinsam mit Bill Gates Sen., in dem sie sich gegen die Abschaffung der estate tax in den USA, der dortigen Form der Erbschaftssteuer, aussprechen.[8]
Collins ist keineswegs der einzige Erbe, der das Gefühl hatte, er solle das ererbte Geld nicht behalten. Eine der bekanntesten europäischen Kritikerinnen, die die Legitimität großer Erbschaften in Frage stellt, ist die deutsch-österreichische Aktivistin Marlene Engelhorn. Sie erregte 2022 weltweites Aufsehen, weil sie ihr Unbehagen über das Erbe in zweistelliger Millionenhöhe äußerte, das ihre Großmutter ihr hinterlassen hatte. Schließlich habe sie nichts getan, womit sie dieses Geld verdient hätte. Journalisten erklärte sie, sie werde mindestens 90 Prozent davon weggeben, obwohl sie im Idealfall lieber zusammen mit allen anderen sehr reichen Menschen besteuert würde, da sie überzeugt ist, dass es nicht ihre Sache ist, zu entscheiden, wofür das Geld ausgegeben werden soll.[9]
Engelhorns Ansicht deckt sich weitgehend mit der von Mitgliedern der amerikanischen Organisation Resource Generation, deren Mission auf limitaristischen Prinzipien beruht (ohne sie jedoch so zu nennen). Sie begann vor etwa fünfundzwanzig Jahren als informelles Netzwerk wohlhabender junger Leute, die an philanthropischen Tagungen teilnahmen und sich der älteren Generation entfremdet fühlten. Sie suchten nach einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Aber nach einer Reihe politischer Ereignisse, die die systemische Ungerechtigkeit der amerikanischen Gesellschaft unterstrichen, entwickelte sich das Netzwerk zu einer offiziellen Organisation. Der erste größere Wendepunkt war die Finanzkrise 2008/2009, die das Leben vieler normaler Menschen durch das ungezügelte Profitstreben und die zunehmend riskanten Entscheidungen von Finanzinstitutionen ruinierte. Kurze Zeit später entstand 2011 die Occupy-Bewegung. Mitglieder von Resource Generation schlossen sich den Protesten solidarisch an und forderten auf Plakaten: »Ich bin das 1 %, besteuert mich.« Resource Generation wurde zu einer Organisation für reiche Amerikaner zwischen 18 und 35 Jahren aus den oberen 10 Prozent, die Mitgliedsbeiträge entrichten, und hat derzeit mehr als 1100 zahlende Mitglieder aus den gesamten USA. Sie ermuntert ihre Mitglieder, sich an einen durchschnittlichen Lebensstandard zu halten – einen Lebensstil, den idealerweise alle pflegen würden – und darauf hinzuarbeiten, ihren gesamten überschüssigen Reichtum wegzugeben, und zwar so, dass sie damit Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und Fortschritt in Richtung auf eine Gesellschaft unterstützen, in der es keine privilegierte Klasse von Menschen gibt, die zu viel besitzen.[10]
Last, but not least müssen wir in diese Parade sehr reicher Menschen auch noch diejenigen einbeziehen, deren Reichtum auf Verbrechen, Unterdrückung und Ausbeutung beruht. Ein Beispiel sind russische Superreiche, jene Oligarchen, die extrem reich wurden, als sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die früheren Staatsbetriebe übernahmen. Es sind Leute, die riesige Yachten und Villen in London oder Berlin und eine zweite Staatsbürgerschaft in Malta oder anderen europäischen Ländern besitzen. Vermutlich gehört auf diese Liste auch Wladimir Putin. In der ersten Jahreshälfte 2022 herrschte allgemein die Ansicht, Elon Musk sei mit seinem geschätzten Nettovermögen von 260 Milliarden US-Dollar der reichste Mann der Welt. Aber als man ihn im März 2022 in einem Interview fragte, wie es sich anfühle, der reichste Mensch auf Erden zu sein, erwiderte Musk, er glaube, Wladimir Putin sei erheblich reicher als er. Zugang zu Details über Putins tatsächliches Vermögen wird allen, die dazu recherchieren möchten – seien es Wissenschaftler, Journalisten oder auch russische Bürger –, weitestgehend streng verwehrt. Einige Insider schätzen, es könne über 200 Milliarden US-Dollar betragen, allerdings gibt es dafür keine Belege. Aber nach allem, was wir über seine Vorgehensweise wissen, und in Anbetracht sämtlicher Berichte, wie er russischen Oligarchen Geld abringt, ist diese Summe durchaus nicht unplausibel. Wie groß sein Vermögen auch sein mag, ist es vermutlich eng mit illegalen Finanztransaktionen verknüpft.[11]
All diese Menschen unterscheiden sich grundlegend in ihrer Herkunft und verfügen über ein sehr unterschiedliches Maß an Reichtum. Was sie eint, ist, dass sie alle zu dem 1 Prozent gehören: Sie alle sind extrem reich. Hier reden wir nicht nur über Reiche – sondern über Superreiche. Und ob sie nun Erben, Industriekapitäne oder kleptokratische Staatslenker sind, besitzen sie alle weit mehr, als sie brauchen, und viel, viel mehr, als ihnen zusteht. Diese Gruppe entfernt sich mehr und mehr von uns Übrigen.
Es wird zwar nicht viel darüber gesprochen, aber es existiert eine Grenze zwischen »reich« und »superreich« – wie wissenschaftliche Studien zunehmend belegen. Zwei Forscherteams haben etwa die Frage erforscht, ob es möglich ist, die Reichen von den Superreichen zu unterscheiden. In Großbritannien führte ein Team unter der Leitung der Soziologin Abigail Davis kürzlich eine qualitative Studie mit der Fokusgruppen-Methode durch. Sechs Gruppen von jeweils zehn Personen diskutierten über die Frage, wie man zwischen verschiedenen Niveaus des Lebensstandards in London unterscheiden könne. London ist eine der Städte der Welt mit der größten Ungleichheit, ihre Bevölkerung umfasst sowohl Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, als auch sehr Wohlhabende. Interessanterweise herrschte unter den Teilnehmenden große Einigkeit, wie wir die verschiedenen Kategorien des Lebensstandards unterscheiden sollten.[12]
Am unteren Ende der Skala stehen Menschen, die unterhalb oder knapp an der Armutsgrenze leben (in Großbritannien »Minimum Income Standard« genannt). Darauf folgen drei Gruppen, die grob der unteren Mittelschicht, der Mittelschicht und den Reichen entsprechen, und ganz oben steht die eigene Kategorie der Superreichen. Menschen in der unteren Mittelschicht können etwas ruhiger schlafen als diejenigen, die an oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Sie haben vielleicht bescheidene Ersparnisse und einige preiswerte Hobbys. Angehörige der Mittelschicht genießen ein höheres Maß an Sicherheit und mehr Möglichkeiten: Vielleicht besitzen sie ein (mit Hypotheken belastetes) Haus und können sich Kinderbetreuung in einer Krippe oder einem Kindergarten sowie gelegentlich einen Urlaub im Ausland leisten. Die Reichen können sich ein Haus ohne Hypothek kaufen und besitzen vielleicht ein weiteres Haus im Ausland. Zudem können sie private Dienstleistungen (wie ein Kindermädchen, einen Gärtner oder einen Finanzberater) in Anspruch nehmen und besitzen mehrere Autos und beträchtliche Investitionen. Die Superreichen – hochrangige Geschäftsleute, Promis und Unternehmer – haben mehrere Häuser, beschäftigen