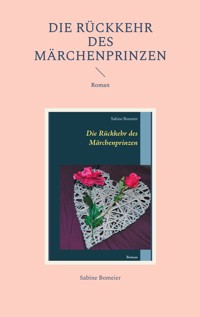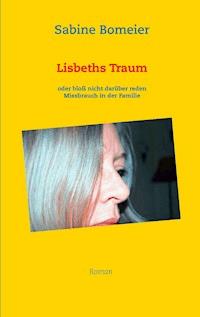
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lisbeth hatte einen Traum. Sie wollte groß hinaus, eine kultivierte Dame werden. Das war nicht so einfach in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Moralvorstellungen waren streng und eine eigene berufliche Karriere für die meisten Frauen weder erreichbar noch vorstellbar. Aber Lisbeth meinte, in Kurt den Mann gefunden zu haben, der sie aus dem engen Milieu ihres Elternhauses entführen würde. Zunächst schien auch alles ganz nach ihren Wünschen zu verlaufen. Aber diese Ehe entwickelte sich anders als sie es sich erträumt hatte. Kurt zeigte mehr Interesse an der gemeinsamen Tochter als an seiner Frau. Aber Lisbeth wollte sich dadurch ihren Traum nicht zerstören lassen. Es würde schon alles nicht so schlimm sein, wenn man nur darüber schweigen würde. Sie schottete sich von der Welt ab, zog sich in eine Traumwelt zurück und meinte, in der Tochter doch noch ihre eigenen Wünsche wahr werden lassen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Sabine Bomeier, Jahrgang 1957 schreibt über Frauen, ihr Leben, ihren Alltag. Das ist meist ein Blick in Lebenswelten, die nicht immer einfach sind, in denen Frauen um ihre Existenz und Selbstbestimmung ringen und manchmal auch tatsächlich den Weg zu sich selbst finden.
Sabine Bomeier war Journalistin, Redakteurin und Pressesprecherin bevor sie sich ganz für das kreative Schreiben entschied.
Angst
vor dir
vor einer Macht,
die mir alles nimmt,
die mich zerstört,
allein lässt,
begräbt
Alle in diesem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Prolog
In den von Prüderie, engen Moralvorstellungen und den Nachwirkungen des Krieges geprägten fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat eine junge Frau einen Traum. Sie will anders, besser leben als sie es aus ihrem Elternhaus gewohnt ist.
Aber das Schicksal selber in die Hand nehmen, einen sie ausfüllenden Beruf ergreifen, gar Karriere machen, und so die eigenen Träume Wirklichkeit werden zu lassen, das war damals für die meisten Frauen kaum möglich. Da blieb nur die Heirat mit einem Mann, der sie in eine schönere Welt bringen würde. Aber was passiert, wenn dieser Mann mehr an der Tochter als an der Ehefrau interessiert ist? Scheidung? Aber was würde das für die Frau bedeuten?
Was ist Missbrauch? Wo fängt er an? Wie funktionieren Familien, in den es Geheimnisse gibt, über die nicht gesprochen werden darf? Und welche Wege finden die Mütter, um nicht hinsehen zu müssen, um leugnen zu können?
Sind Mütter Mittäterinnen oder Opfer? Der Sicht, dem Verhalten der Mütter wird im Allgemeinen viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das Buch will und kann keine Antworten geben, es ist „nur“ ein Roman, in dem es einmal vorrangig um die Rolle der Mütter geht.
Kapitel 1
Matt fiel das Licht in die Wohnküche. Es begann schon dunkel zu werden und Lisbeth, die eigentlich Elisabeth hieß, aber von niemandem so genannt wurde, hatte alle nötigen Arbeiten des Tages erledigt, der Abwasch war getan, der Boden gewischt. Nun konnte sie sich einen Moment an den großen Küchentisch setzen. Hier fand das Familienleben statt, wurde gegessen, gefeiert, wenn es etwas zu feiern gab und es wurden die wichtigen Dinge des Lebens besprochen. Das alles wohl auch, weil es hier, dank des ständigen Kochens auf dem großen Herd, immer warm war. Im Winter legte die Mutter schon ganz früh, gleich nachdem sie aufgestanden war, einige Briketts in den Ofen. Lisbeth mochte diese frühen Stunden und stand oft schon kurz nach der Mutter auf. Gemeinsam tranken sie dann, in ihre Bademäntel gehüllt und warme Socken an den Füßen, den ersten heißen Tee des Tages. Lisbeth fühlte sich der Mutter so wunderbar nah in diesen Momenten. Auch jetzt am Abend saß sie hier am großen Küchentisch, sah auf die zahlreichen Einkerbungen, die das viele Schneiden von Gemüse oder Obst hinterlassen hatte, obwohl eigentlich nicht auf der Tischplatte geschnitten werden durfte. Sie genoss einen Moment der Ruhe. Wohlig seufzend legte sie ihre Füße auf den Suhl, auf dem sonst immer der Vater saß. Sie hätte sich jetzt gerne einen Tee gekocht und den Tag damit abgeschlossen.
Aber heute stand neben der Hausarbeit nach ihrer Arbeit in der Wäschefabrik noch mehr auf dem Programm. Sie sollte ihre Schwester Hedwig zum Siedlungsfest begleiten. Alt und Jung ging zu den regelmäßig stattfindenden Festen, die jungen Leute standen separat in einer Ecke, die alten saßen an den Tischen. Lust dorthin zu gehen hatte sie nicht. Diese Siedlungsfeste waren wahrlich nicht das, wohin es Lisbeth zog. Sie fand es dort immer zu lärmend. Die Musik, meist Schlager von der werkseigenen Feuerwehrkapelle vorgetragen, und alle stets viel zu laut und nicht immer in der richtigen Tonlage gespielt, war nicht nach ihrem Geschmack und wenn die Männer dem Alkohol in Form von diversen Schnäpsen erst einmal genügend zugesprochen hatten, was spätestens nach zweiundzwanzig Uhr der Fall war, dann wurden Witze gerissen, die sie ordinär fand. Das laute, dröhnende Lachen der jungen Männer in der rauchgeschwängerten Luft der Halle, das Schenkelklopfen der alten Männer, die gierigen Blicke aller Männer auf die jungen Frauen – all das widerte sie an. So manches Mal wurde auch sie zum Ziel des Gespötts. Manchmal lachten gerade die jungen Männer über sie, meist waren ihre viel zu dicken Beine das Ziel ihres Spotts, das war dann verletzend und damit noch viel schlimmer als all die ordinären Worte, die sie so sehr verabscheute. Hatte denn keiner der Männer Sinn für wenigstens ein wenig Schöngeisterei, fragte sie sich immer wieder. Schöngeisterei - so wurde in der Familie ihr Hang zu schönen Dingen genannt, es war nicht immer nur nett gemeint. Aber schöne Dinge, die mehr als nur den Sinn für Saufereien ansprachen, wie das Arrangieren von Blumen in einem Saal, in dem gefeiert werden sollte, oder die Anordnung der Stühle oder Tische auf die, wie Lisbeth fand, wenigstens Decken gelegt werden sollten – all das gab es bei den Siedlungsfesten nicht. Es reichte, wenn die Bühne mit bunten und oft auch noch viel zu grell glitzernden Girlanden geschmückt wurde, die aus einer Kiste im Büro des Hausmeisters hervorgeholt wurden. Mehr bedurfte es nicht beim allmonatlichen Schwof.
Die Leitung des Werkes zu der die Siedlung gehörte, veranstaltete diese Siedlungsfeste. Es gab eigens ein Komitee, das dafür verantwortlich war, dass diese stets fröhlichen und feuchten Zusammenkünfte ordnungsgemäß abliefen. Spaß sollten die Jungen und die Alten haben, aber es sollte dennoch alles in einem gewissen Rahmen bleiben. Schlägereien wollte man nicht. Aber man wollte den Arbeitern durchaus auch mal die Gelegenheit geben zu feiern, auch um so eine gewisse Zufriedenheit unter ihnen zu garantieren. Wer feiert, revoltiert nicht, war man höheren Ortes der Meinung, wahrscheinlich zu Recht, denn die Feste kamen gut an, besonders bei den jungen Leuten. Aber diese hatten sonst ja auch kaum Gelegenheiten sich zu amüsieren. Geld für die teure Bar in der Innenstadt, es gab nur die eine, hatten sie nicht. Die Gastwirtschaften am Bahnhof kamen auch nicht in Frage, dort trafen sich nach der Arbeit die Älteren und die passten gut auf, dass keiner über die Stränge schlug. Das Café in der Einkaufsstraße war etwas für Frauen der besseren Schichten. Die Milchbar zu besuchen, die es seit neuestem in der Stadt gab, war zwar modern, aber auch teuer und eigentlich auch zu brav, man wollte schließlich hin und wieder auch mehr erleben, ausgelassen sein – und vor allen Dingen, mal ein paar Bier trinken, den Alltag vergessen, sich an die Mädchen heranmachen. Darauf hatte man doch wohl ein gewisses Recht nach all der harten Arbeit im Werk, meinten nicht nur die jungen Männer.
Die Mädchen oder jungen Frauen ihrerseits waren erpicht darauf, nach den Jungen Ausschau zu halten, die eventuell für eine Heirat in Frage kamen. Auf den Siedlungsfesten konnten sie abschätzen, ob einer nur ein Langweiler oder zwar lustig mit anderen war, aber doch zu viel trank. Dann würde er später sicher auch den Lohn vertrinken. Bei so einem sollte man vorsichtig sein. Vor solchen Männern warnten die Mütter ihre Töchter. Zudem konnten die jungen Mädchen hier ihren Marktwert testen. Wurden sie auch oft genug aufgefordert? Warfen die Jungen ihnen Blicke zu, die sagten, dass sie schön seien und begehrenswert?
Lisbeth hatte gelernt, sich zurückzuziehen, wenn es ihr zu laut wurde und wenigstens so zu tun, als wollte sie ohnehin nichts mit all diesen jungen Leuten zu tun haben, wenn wieder einmal sie der Gegenstand des Gespötts war. Aber was konnte denn sie dafür, dass sie nicht so hübsch wie ihre zierliche Schwester war, die alle immer so apart fanden, mit ihren dunklen Locken und den lustigen Grübchen in den Wangen? Sie dagegen war die Dicke mit den ewig geschwollenen Beinen. Sie neigte eben bereits früh zu Wasser in den Beinen. Schon als kleines Kind hatte sie sich, wenn es mal wieder um die Schwester ging, stets in eine ganz eigene Welt zurückgezogen und lieber ein Bild gemalt als mit den anderen herumzutollen. Da konnte sie sich dann ihre Welt zeichnen, in der auch sie einmal die schöne Prinzessin war und die anderen sie nicht Pummellise riefen.
Sie hasste diesen Spitznamen, den sie seit ihrer Kindheit trug und der so trefflich zum Ausdruck brachte, wo ihre Schwächen lagen. Ja, sie war zu dick, war es immer gewesen. Viele in der Siedlung riefen sie so, immer noch. Nur die schönen dunklen Locken waren beiden Schwestern von der Mutter mitgegeben worden.
Lisbeth lebte in einer recht durchschnittlichen Familie: Vater, Mutter und drei Kinder. So war es üblich in der Siedlung. Die Mutter besorgte den Haushalt und kümmerte sich um die drei Kinder, zwei Mädchen und einen Jungen. Der Junge war der Jüngste und brauchte seit seiner Geburt viel Aufmerksamkeit. Warum er diese Aufmerksamkeit brauchte, hatte sich Lisbeth nie wirklich erschlossen aber er war eben der heiß ersehnte Stammhalter, auch dementsprechend verwöhnt. Die Mutter ließ ihm vieles durchgehen, was bei den Mädchen unmöglich gewesen wäre. Er musste nie im Haushalt helfen, bekam am Mittagstisch stets die besten Stücke und bedurfte ganz allgemein eben einer besonderen Fürsorge. „Weil er doch etwas kränklich ist“, wie die Mutter immer wieder betonte. Lisbeth allerdings konnte an ihm nichts Kränkliches feststellen. Der Junge sollte Abitur machen und studieren und es einmal besser haben als seine Eltern. Da entwickelte besonders die Mutter durchaus einen gewissen Ehrgeiz.
Lisbeth war die Älteste und musste oft im Haushalt mithelfen, besonders wenn sich der Mutter die Gelegenheit bot, etwas zur Aufbesserung der Haushaltskasse beizutragen und sie bei fremden Leuten putzen ging oder in den Häusern in den besseren Vierteln der Stadt beim Einmachen half. Dann musste Lisbeth sich, neben ihrer Stelle in der Wäschefabrik, um den Haushalt kümmern. Sie schälte die Kartoffeln für den nächsten Tag, machte den Abwasch und den Geschwistern das Abendessen. Aber diese Arbeit der Mutter sicherte der Familie das Leben in dem kleinen Arbeiterhäuschen. So ein Haus konnten sich, trotz der Förderung durch die Werksleitung, nicht alle Beschäftigten des Werks leisten, denn die Arbeiter mussten, außer die Miete zu zahlen auch selbst für die Instandhaltung der Häuser sorgen. Das war so manches Mal nicht ganz leicht zu bewerkstelligen, das Geld dafür war immer knapp. Aber die Eltern waren dennoch stolz auf ihren bescheidenen Lebensstandard. Immerhin hatten sie sich nach den Kriegsjahren wieder einigermaßen etwas erarbeitet.
Ach diese die Siedlung! Lisbeth lebte nicht gerne hier. Die Arbeiter des nahen chemischen Werkes wohnten hier mit ihren Familien, waren sogar froh, hier ein Haus bekommen zu haben, das bezahlbar war und immerhin einen gewissen Wohnkomfort bot, wie Toiletten im Haus und Gärten hinter den Häusern. Die Firma zeigte sich mit dem Bau dieser Häuser sozial eingestellt und band gleichzeitig die Arbeiter an die Firma. Denn nur wer im Werk beschäftigt war, durfte dort wohnen und bekam gegebenenfalls einen günstigen Kredit, um das Haus auch einrichten zu können. Der Kredit war verspielt, wollte man das Unternehmen verlassen. Aber dazu fehlte es eh an Möglichkeiten. Wo hätte man denn sonst arbeiten können? Das Haus gab es nur zur Miete, ein Kauf war unmöglich, aber der Erwerb eines Hauses kam für die meisten der hier Lebenden ohnehin nicht in Frage. Man war ja schon froh, überhaupt in so einem Haus wohnen zu dürfen. Schon das war mehr als die meisten je vom Leben erwartet hatten. Aber auch mit Arbeit und einem regelmäßigen Einkommen war so ein Häuschen nicht billig, denn ständig gab es etwas instand zu setzen, mal leckte das Dach, ein anderes Mal musste der Geräteschuppen hinter dem Haus erneuert werden. Überhaupt war es nicht immer einfach, eine Familie anständig über die Runden zu bringen.
Schon früh wurde Lisbeths Eltern eines der nicht nur damals so beliebten kleinen Arbeiterhäuschen gleich neben dem Werk angeboten. Auch Lisbeths Eltern waren begeistert über die Möglichkeit das kleine Arbeiterhaus mieten zu können, als man es ihnen beim Eintritt des Vaters in das Werk anbot, anders wären sie nie zu einem fast eigenen Heim gekommen. Und dann auch noch eines mit Garten hinter dem Haus! Da würde sich Kleintier halten lassen und man hätte zu Weihnachten immer einen schönen Braten auf dem Tisch. Auch etwas Gemüse würde sich ziehen lassen, das könnte man für den Winter einmachen. Die Mutter war gelernte Köchin und plante schon immer weit im Voraus den Speiseplan für das Jahr. Allerdings würde die Mutter ab und zu mal, wenn es sich so ergäbe, gegen Lohn in den besseren Haushalten der Stadt aushelfen müssen, anders wäre das Haus denn doch nicht zu finanzieren gewesen, obwohl man von Anfang an einplante, einen der oberen Räume zu vermieten, auch das würde etwas Geld in die Haushaltskasse spülen. So machten es die meisten Bewohner der Siedlung.
Und es wurde auch schnell ein in der Stadtbücherei angestellter Bibliothekar gefunden, der Interesse an diesem Raum im Obergeschoss mit der schönen Dachschräge hatte. Später verlor er seine Arbeit, keiner wusste genau, warum. Es soll „etwas Politisches“ gewesen sein, munkelte man. Darunter konnten Lisbeth und Hedwig sich aber nichts vorstellen, so sehr sie auch rätselten. Mehr war aber auch nicht heraus zu bekommen. Aber der Bibliothekar blieb bei ihnen wohnen und hielt sich eben irgendwie mit Aushilfsjobs über Wasser. Sogar für eine Zeitung soll er hin und wieder geschrieben haben. Zwar fand dieser Bibliothekar nie näheren Anschluss an die Familie, außer mit Lisbeth verband ihn mit niemandem in dem Haus etwas. Er lebte von den anderen kaum bemerkt in dem Zimmer in der oberen Etage, aber er lebte nicht mit im Haushalt der Familie. Er nahm nicht an den Mahlzeiten teil, sondern schmierte sich ein Brot in seinem Zimmer, mittags ging er in einer Gaststätte essen und keiner wusste, woher er das Geld dazu nahm. Außer Lisbeth suchte keiner im Haus näheren Kontakt zu ihm. Die aber umso lieber, denn dieser Mann hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Lisbeth Bücher mitzubringen und sie ihr zu erklären. Lisbeth liebte das, auch weil sie sich so wichtig vorkam, wenn der Bibliothekar vor ihr stand, ihr ein Buch reichte und meinte: „Lies´ das mal, es könnte dich vielleicht interessieren, und dann sage mir hinterher, wie es dir gefallen hat.“ Er schien ein ehrliches Interesse daran zu haben, Lisbeth in die Welt der Bücher einzuführen und ihr Lust auf Lesen zu machen.
Die beiden Mädchen teilten sich einen Raum, der Junge schlief bei den Eltern im Schlafzimmer, was vielleicht der Grund dafür war, dass es keine weiteren Geschwister für Lisbeth und Hedwig gab, denn Gerdi, so der Kosename des Stammhalters, schlief zunächst vorzugsweise auf dem Bauch seiner Mama, ein Luxus, der den beiden Mädchen nie gestattet worden war. Später wechselte er in ein eigenes Bett, welches aber immer noch im Schlafraum der Eltern stand. Sehr viel später bekam er das Zimmer des Bibliothekars, als der auszog und die Eltern nicht mehr auf die Miete angewiesen waren, die Mädchen teilten sich weiter ein Zimmer.
Gelebt wurde vorwiegend in der großen Wohnküche, in der die Kochnische durch einen Vorhang vom übrigen Teil des Raumes abgetrennt war. Im Küchenschrank gab es eine Dose, in der die beim Kaufmann erstandenen Rabattmarken aufbewahrt wurden. Waren genügend davon vorhanden, durfte „etwas extra“ gekauft werden. Lisbeth liebte die Tage, an denen das geschah. Manchmal wurden dann Bonbons gekauft, oder die feine Schokolade in dem bunten Glitzerpapier. Sie naschte doch so gerne. Die Mutter ging dann, die Rabattmarken in einem Kuvert in der Einkaufstasche, mit den Kindern zum Kaufmann an der Ecke und erstand das bunte Naschwerk, dass zu Lisbeths Bedauern immer gerecht zwischen allen Kindern aufgeteilt wurde. Sie wäre so gerne einmal bevorzugt worden. Aber das sagte sie ihren Geschwistern nie, sondern vertrat nach außen, wie die Eltern und wie es sich als große Schwester gehörte, den Standpunkt, es müsse immer alles gerecht zugehen. Und nur ganz selten stibitzte sie dann doch einmal ein Bonbon nur für sich und lutschte das ganz langsam und genussvoll. Dafür verkroch sie sich in den Schuppen hinter dem Haus. Nichts wäre für sie schlimmer gewesen, als in diesem Moment erwischt zu werden, was aber nie geschah.
Eine gute Stube gab es auch. Aber benutzt wurde die fast nie. Nur an hohen Festtagen wurde dort der Tisch gedeckt und das gute Porzellan aus dem Schrank geholt. Aber die Mutter lüftete die Stube jeden Tag, sodass es dort immer gut roch.
Die Toiletten waren in den Häusern, was zu dieser Zeit durchaus einen gewissen Luxus darstellte. Man musste sich das Klo nicht mehr mit anderen Mietern teilen oder gar hinter dem Haus aufs Plumpsklo gehen. Lisbeths Mutter erzählte noch immer, welche Angst sie ausgestanden hatte, wenn sie in dunkler, kalter Nacht durch den Schnee stapfte, um sich zu erleichtern. Lisbeth schauderte bei solchen Erzählungen.
„Ihr hättet ja auch einen Nachttopf nehmen können“, meinte die Schwester pragmatisch. Aber so war die Schwester eben. Lisbeth fand, es mangelte ihr oft am nötigen Einfühlungsvermögen. Der Abort, mit den genau gesechzehntelten Zeitungsseiten als Toilettenpapier, richtiges wäre für den dafür vorgesehene Zweck viel zu teuer gewesen, befand sich im kleinen Anbau, in dem die Waschküche war, von der es auch in den Keller ging, wo all das Eingemachte aufbewahrt wurde, von dem die Kinder nicht naschen durften, auch nicht von den leckeren Erdbeeren. Da war die Mutter streng. Schließlich sollte auch im Winter Obst auf den Tisch kommen, die Erdbeeren aber nur an besonderen Feiertagen. Um den Saft, der im Glas war, gab es regelmäßig Streit unter den Kindern, bis der Vater einschritt und alles gleichmäßig und gerecht unter den Kindern aufteilte.
Im hinteren Teil des Anbaus war noch ein Kohlenverschlag untergebracht, in dem die Kinder zwar gerne spielten, genau dies aber nicht durften, denn anschließend sahen sie aus wie übergroße Kohlenstücke und der Vater meinte, es bestünde die Gefahr, dass er sie mit den Briketts verwechseln würde. Als die Kinder noch klein waren, hatten sie tatsächlich große Angst davor, denn als Brikett würden sie unweigerlich irgendwann im Ofen landen, was sie natürlich keinesfalls wollten.
Die Häuser der Vorarbeiter auf der ihrem Haus gegenüberliegenden Seite hatten sogar Bäder mit einer richtigen Badewanne. Aber zum Vorarbeiter hatte es bei Lisbeths Vater nicht gereicht. Und so wuschen Lisbeth und ihre Familie sich weiter in der Küche oder in der Waschküche, aber dort war es gerade im Winter immer so kalt, dass man sich eigentlich kaum die Wäsche vom Körper streifen mochte und außerdem war man dort nie sicher, wie lange man unbeobachtet blieb, stets konnte jemand hereinkommen, wenn eigentlich auch nur jemand aus der Familie. Der Vater hatte dennoch eine Holzwand aufgebaut, hinter der sich vor allem die Frauen der Familie ungestört waschen konnten. Nett von ihm, aber dennoch irgendwie primitiv, fand Lisbeth. Ihrer Schwester schien das nichts auszumachen. Lisbeth hätte lieber auch ein richtiges Badezimmer gehabt, eines mit lavendelfarbenen Kacheln. So etwas hatte sie einmal in einer Illustrierten gesehen.
Man kannte sich untereinander in der Siedlung, hielt zusammen, half bei Reparaturen am Haus oder wenn die Frau mal krank darniederlag oder im Wochenbett war. Dann versorgten die Frauen abwechselnd die Familie, die es gerade nötig hatte, und die Männer gingen sich bei der Arbeit am Haus zur Hand, deckten gemeinsam die Dächer oder bauten die Obergeschosse aus. Zwischendurch gab es einen reichlichen Schluck vom besten Schnaps im Haus. Das alles schweißte die Nachbarn zusammen. Es war eine gute Gemeinschaft, fanden alle.
Vor den Häusern hatten die Frauen winzige Gärten angelegt mit Rittersporn oder hin und wieder sogar einem Rosenstock. Am Sonntag kam manchmal ein schöner Strauß in die Vase auf den Tisch in der guten Stube, die nur zu Festtagen genutzt wurde und so den schönen Blumenstrauß ungesehen verwelken ließ.
Hinter den Häusern waren die Gärten größer, dort wurde Gemüse angebaut, oder auch ein Obstbaum gepflanzt. Der Ertrag wurde eingemacht, die kleinen Keller waren voll von Gläsern mit eingemachten Erdbeeren, Gurken oder Kürbis und natürlich fehlte auch nirgends die Kartoffelkiste, so hatte man auch im Winter etwas Gutes auf dem Teller. Die Frauen der Arbeiter verstanden sich aufs Wirtschaften und dachten und planten stets viele Monate im Voraus. Zudem hatte fast jeder einen Kaninchen- oder Hühnerstall, das sorgte für die nötige Fleischportion am Sonntag. So dachten nicht nur Lisbeths Eltern. Das Darben und Hungern der Kriegstage steckte vielen noch in den Knochen. Man wollte endlich wieder richtig leben, wie es die Bewohner der Siedlung nannten, und das hieß vor allen Dingen, dass der Esstisch gut gedeckt sein musste. Zum Kaufmann an der Ecke ging man aber nur das Nötigste kaufen, schließlich waren die Portemonnaies der Arbeiter nicht gerade allzu reichlich gefüllt. Auch wenn es den Menschen wieder gut ging, so musste dennoch sparsam gewirtschaftet werden. Außerdem konnte man nie sicher sein, was die Zukunft noch so bringen würde? Da war es schon gut, einen Notgroschen in der Hinterhand zu haben.
Sie waren eine ordentliche Familie, das hörte Lisbeth auch von den Nachbarn. Lauten Zank gab es bei ihnen nicht, die Kinder waren sauber und adrett gekleidet und gingen immer brav zur Schule, zumindest die Mädchen. Der Junge sollte mal aufs Gymnasium, aber da er so „kränklich“ war, wie die Mutter nicht müde wurde zu betonen, und deswegen oft zu Hause bleiben musste und den Sprung auf die Oberschule erst mal gründlich vermasselte, es auch im zweiten Anlauf nicht hinbekam, wurde nichts aus den großen Plänen für den Jungen. Das war besonders für die Mutter eine herbe Enttäuschung, aber sie tröstete sich damit, dass „der Junge dann eben eine ordentliche Ausbildung in der Bank“ machen müsse, auch das stellte sich als Illusion heraus. Er würde weder die Schule anständig beenden, noch überhaupt irgendeine Ausbildung machen.
Für die Mädchen kam der Gedanke an den Besuch einer höheren Schule natürlich nicht in Frage, aber auch das war damals durchaus üblich, denn man war generell der Auffassung, dass Mädchen eh irgendwann heiraten würden und dann sei das ganze Geld für die Ausbildung herausgeschmissen, sie würden doch nur den Haushalt führen. Immerhin stimmten Lisbeths und Hedwigs Eltern einer Lehre zu. Hedwig lernte Verkäuferin im Kaufhaus in der Stadt und brachte schon bald Geld nach Hause und Lisbeth ging bei einer Schneiderin in die Lehre, aber diese Ausbildung dauerte länger und so musste sie ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen und durfte sich nur Näherin nennen, was sie als schwere Kränkung empfand. Aber auch sie verdiente Geld. Die Eltern verlangten zwar Kostgeld von ihren Mädchen, aber sie ließen ihnen auch einen Teil als Taschengeld und einen anderen Teil, um sich etwas zusammenzusparen. Schließlich sollten sie auch einmal einen anständigen eigenen Haushalt führen können. Dazu bedurfte es einer Aussteuer, dafür wurde gespart. So gehörte es sich. Hedwig nahm es mit dem Sparen oft nicht ganz so genau, gab gerne auch mal etwas für sich aus, ging auch abends gerne tanzen, allerdings musste meist Lisbeth sie begleiten, das sei „schicklicher“, meinte die Mutter. So waren Lisbeth und Hedwig, zumindest als Teenager, trotz aller Unterschiede, eng miteinander verbandelt, wenn auch nicht immer so ganz freiwillig.
Lisbeth fühlte sich abgestoßen von der Atmosphäre, die in der Siedlung herrschte. Eine Hülle aus harter Arbeit, ständigem Geldmangel und biederer Strenge schien die Siedlung fest zu umschließen. Sie träumte von etwas Besserem als einem Kaninchenbraten am Sonntagmittag. Sie wollte weder die erdigen Kartoffeln aus den Furchen des kleinen Ackers hinter dem Haus klauben noch das Gemüse einkochen, sondern Bücher lesen und in Konzerte gehen. Damit war sie sehr alleine in der Siedlung.
„Lisbeth, du machst immer viel zu viel Getue und spielst dich auf als seist du etwas Besseres, lach´ doch einfach mal mit, dann machen die anderen auch keine Witze mehr über dich“, sagte ihre Schwester immer wieder zu ihr. Hedwig machte kein Getue und amüsierte sich denn auch immer ganz prächtig auf den Siedlungsfesten, ging auf den lockeren Ton der anderen ein, wurde akzeptiert. Sie war eine von ihnen. Aber Lisbeth wollte nicht mit den anderen lachen, sondern sich mit ihren Büchern in eine bessere und schönere Welt träumen. Es war eine Welt, in der es Opernbesuche und Literatur gab, in der sie sich in wohlgeformten Sätzen mit gebildeten und kultivierten Menschen unterhielt, die ebenfalls nicht anderes im Sinn hatten als über Bücher und Musik zu reden. Sie sah sich in ihren Träumen in einem Café mit dunkelrot gepolsterten kleinen Stühlen sitzen, Tee aus winzigen, hauchdünnen Tassen trinken, Gebäck naschen und mit anderen Frauen über den letzten Theaterbesuch plaudern.
Aber Lisbeths wirkliche Welt sah anders aus, denn ihre Träume hatten mit ihrem Alltag im Elternhaus nichts zu tun. Der Vater ging im nahegelegenen Werk jeden Tag arbeiten, mal zur Frühschicht, mal zur Spätschicht und natürlich war er auch Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr. Das gehörte dazu. Aber zur großen Erleichterung von Lisbeths Schwester spielte er nicht in der Feuerwehrkapelle mit, denn das hätte bedeutet, dass er auch auf den Siedlungsfesten anwesend gewesen wäre und somit seine Töchter hätte kontrollieren können. Lisbeth wäre es egal gewesen, für Hedwig war das eine geradezu furchteinflößende Vorstellung.
Die Lehrstelle bei der Schneiderin hatte Lisbeth sich nach dem Ende der Hauptschule selber gesucht, darauf war sie stolz, denn wenn sie schon nicht weiter zur Schule gehen durfte, so wollte sie wenigstens etwas machen, das ihr Spaß machte. Schneidern gehörte dazu. Genäht oder gehandarbeitet hatte sie schon immer gerne. Die Mutter hätte sie sicher zum Kaufmann an der Ecke in die Lehre gegeben, aber die Aussicht hinter dem Tresen zu stehen und den Frauen aus der Siedlung die gewünscht Menge Käse von dem großen gelben Laib, der in der Auslage hinter Glas lag, abzuschneiden und dabei immer freundlich und nett zu den Kundinnen sein zu müssen, behage Lisbeth überhaupt nicht. Einmal hinter diesem Tresen gelandet - und sie würde niemals wieder aus dieser Siedlung herauskommen, war sie sicher. Und so hatte sie eben bei der Schneiderin in der Stadt angefragt, ob sie dort eine Lehre machen könne. Sie wurde genommen.
Diese Lehre hatte Lisbeth allerdings nicht zu Ende machen dürfen. Die Mutter hatte sie aus der Lehre herausgenommen, weil sie in der großen Wäschefabrik mehr Geld verdienen konnte als in diesem feinen aber eben auch sehr kleinen Schneideratelier, in dem keine hohen Löhne bezahlt wurden, schon gar nicht den Lehrmädchen.
„Du kannst doch jetzt nähen, für den Haushalt reicht das allemal und das Geld, das du in der Fabrik mehr verdienst, können wir gut gebrauchen und auch du kannst dann einiges für dich beiseitelegen“, hatte die Mutter gesagt und zu Recht darauf gehofft, dass Lisbeth, wie allgemein üblich, einen Teil ihres Lohnes zu Hause abgeben würde. Die Löhne der Kinder wurden so dringend gebraucht in den Arbeiterfamilien. Nur damit ließen sich die neuen Schuhe für den Vater bezahlen oder die Medikamente für den Großvater. Der Lohn der Väter reichte meist nur für das Nötigste.
Lisbeth beneidete die Mädchen, die sich nicht um ihre Geschwister kümmern mussten und ihre Lehre abschließen oder gar zum Gymnasium gehen durften, aber das waren eigentlich auch alles Töchter der Ingenieure des Werkes. Die lebten sowieso irgendwie anders, hatte Lisbeth schon früh festgestellt. Lisbeth war zum ersten Mal gleich nach ihrer Einschulung, bei einer Tochter eines Ingenieurs zu Hause gewesen. Sie war von der Mutter dorthin geschickt worden, um ein paar Gläser mit von der Mutter eingemachtem Obst abzugeben. Auch heute erledigte sie solche Besorgungen noch hin und wieder. Das Eingemachte ihrer Mutter war sehr begehrt und galt als ganz ausgezeichnet.
Tochter und Sohn des Ingenieurs hatten je ein eigenes Zimmer und darin einen Schreibtisch, an dem sie in aller Ruhe ihre Schularbeiten machen konnten. Über dem Schreibtisch war ein Bücherbord angebracht, auf dem erst Kinder- und später wohl Jugendbücher standen. Lisbeth machte ihre Hausaufgaben am Küchentisch und musste zum Essen stets alles wegräumen. Bis heute hatte sie keinen eigenen Schreibtisch. Es gab im ganzen Haus keinen. Aber wozu auch? Es gab ja nichts mehr zu lernen. Lisbeth war noch immer neidisch auf diese Kinder. Sie wäre so gerne länger zur Schule gegangen.
Aber immerhin bekam Lisbeth zum Abschied von der Schneidermeisterin eine alte, aber voll funktionsfähige Nähmaschine geschenkt. Lisbeth hätte sich nie eine eigene Nähmaschine leisten können, schon gar nicht eine so gute, sie strahlte ihre nun ehemalige Chefin denn auch ganz dankbar an.
„Damit du dir auch selber weiter tolle Kleider nähen kannst“, meinte ihre Lehrmeisterin, der es leid tat, einen talentierten Lehrling zu verlieren. „Aus der hätte etwas werden können“, dachte sie denn auch so manches Mal. Aber sie wusste auch, wie selten es vorkam, dass ein Mädchen eine Ausbildung abschloss. Mädchen würden ja doch heiraten, war man der Meinung, da brauchten sie keine Ausbildung.
Sich etwas nähen, das wollte Lisbeth denn auch gerne tun. Sie nähte sich weiter sehr schöne und sehr elegante Kleider, die nicht immer so ganz in die Siedlung passen wollten. Überhaupt hatte sie sich in der Schneiderwerkstatt wohl gefühlt. Dort ging es nicht nur darum, die Kleider schnell fertig zu bekommen, sondern alles musste einen gewissen Schick haben, die Kundinnen kamen immerhin aus den besseren Kreisen der kleinen Stadt. Es waren Frauen, die ab und an auch ins nahe Bremen fuhren, um dort das Theater zu besuchen oder ein Abonnement in der Leihbücherei hatten und deren Kinder Musikunterricht bekamen. All das imponierte Lisbeth sehr. Wenn sie bei der Anprobe der Kleider diesen Frauen nahe kam, dann roch sie das zarte Parfum und sah ihre gepflegten, weichen Hände, die so gar keine Schwielen oder Risse, eben die Spuren von harter Arbeit, aufwiesen. Ja, so wollte Lisbeth auch sein.
Sie träumte davon, eines Tages einmal zu diesen Frauen zu gehören. Sie stellte sich vor, dass die Frauen alle miteinander befreundet wären und sich ständig gegenseitig besuchten. Lisbeth mochte es, sich in der Nähe dieser Frauen aufzuhalten, sich abzugucken, wie sie redeten oder sich benahmen, so fein, als hätten sie immer Angst, sich die Hände zu beschmutzen, wenn die Schneidermeisterin ihnen während der Wartezeit einen kleinen Imbiss anbot. Sie sah die Frauen den kleinen Finger abspreizen, wenn sie die hübsche Teetasse mit dem schmalen Goldrand zum Mund führten oder sie sich beim Essen den Mund mit der Serviette abtupfen, bevor sie aus einem feingeschliffenem Glas Wasser oder Wein tranken – das waren Dinge, die Lisbeth ungemein beeindruckten. Bei ihr zu Hause ging es weniger elegant zu. Die Hände der Mutter waren von der vielen Arbeit rau und hatten noch nie eine Maniküre kennengelernt. Servietten kamen bei Lisbeths Eltern nur zu Feiertagen auf den Tisch und auch das gute Teeservice wurde geschont und nur sehr selten benutzt. Lisbeth bedauerte das immer wieder.
Aber Lisbeth schwor sich, dass ihre Tochter, sollte sie jemals eine haben, nicht bei der Hausarbeit würde helfen müssen und auch einen eigenen Schreibtisch bekommen würde, vielleicht sogar Musikunterricht, und auch gute Tischmanieren wollte sie ihre Tochter lehren.
„Kommst du nun mit oder muss ich wieder alleine gehen?“, fragte Hedwig ungeduldig bestimmt nun schon zum dritten Mal und riss Lisbeth aus ihren Gedanken. Hedwig war noch nie alleine zu einem dieser Feste gegangen und wusste, dass sie gar nicht alleine dorthin gehen durfte. Lisbeth musste sie begleiten, darauf bestand die Mutter, denn sie fand, dass Hedwig mit ihren sechzehn Jahren noch zu jung war, um alleine auszugehen. Die Mädchen sollten nicht in einen schlechten Ruf kommen. Das war den Eltern wichtig. Lisbeths Bemühungen, die Mutter glauben zu machen, dass es ebenso schicklich wäre, wenn eine ältere Freundin Hedwig begleiten würde, denn die Hauptsache sei doch, dass ein Mädchen abends nicht alleine unterwegs sei, fruchteten wenig. Hedwig wäre es nur recht gewesen, ohne die Schwester auszugehen, sie würde mehr Spaß mit ihrer Freundin haben als mit ihrer eigentlich immer viel zu ernsten Schwester, die sie aber dennoch sehr gerne hatte. Und trotz aller Unterschiede zwischen den Schwestern, erzählte Hedwig abends, wenn im Hause schon die Lichter gelöscht waren und beide Mädchen in ihrem gemeinsamen Zimmer alleine waren, ihre Erlebnisse der Schwester. Ihr fiel dabei allerdings nie auf, dass Lisbeth selbst keine Erlebnisse zu berichten hatte. Aber Hedwig sprach gerne in die Dunkelheit hinein von ihren Erlebnissen am Tage, fast als führte sie ein gesprochenes Tagebuch. Manchmal hielt sie dabei Lisbeths Hand über den schmalen Gang zwischen ihren Betten. Lisbeth gab den Händedruck fast zärtlich zurück.
„Ich muss mich noch umziehen, dann komme ich mit“, antwortete Lisbeth mit wenig Begeisterung in der Stimme. Aber vielleicht würde es ihr wirklich guttun, wenn sie mal wieder herauskäme und nicht immer nur ihren Träumen hinterher hinge, die würden sich doch nie erfüllen. Im Grunde war ihr das klar, die Realität sah eben nicht sehr vielversprechend aus. Sie würde ewig die stumpfsinnige Arbeit in der Wäschefabrik machen müssen, ewig die gleichen Nähte nähen, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel schaffen. Es war eine Akkordarbeit und ebenso gut hätte sie am Band in einer der Fischkonservenfabriken stehen können, dachte sie manchmal und wusste, dass sie es mit der Wäschefabrik denn doch besser getroffen hatte. Dort war es wenigstens sauber. Aber dennoch wäre sie lieber woanders gewesen. Da tat es eben gut, sich wenigstens ab und an mal in eine andere Welt zu träumen, manchmal kam darin sogar ein Märchenprinz vor, der sie in eine schönere Welt entführte und aus ihr die Frau machte, die sie doch so gerne gewesen wäre.
Aber jetzt musste sie zum Siedlungsfest. Sie ging nach oben in das kleine Mädchenzimmer, zog das blaue Kleid an, dass sie sich erst neulich genäht hatte und schlüpfte in die ebenfalls blauen Pumps. Es war ja nicht so, dass sie keine passende Garderobe im Schrank hatte, schließlich hatte sie ihre Schneiderlehre zwar nicht abgeschlossen, aber doch einiges in dieser Zeit gelernt – und viel Spaß machte ihr das Nähen immer noch.
Wie gerne hätte sie in einem eigenen Atelier für andere Kleider entworfen, elegante Kleider, die zu Gesellschaften getragen wurden oder beim Bummel durch teure Geschäfte und beim anschließendem Kaffee oder Tee mit einem Stück Torte in einem schicken Café. Aber auch dieser Traum würde sich nie erfüllen, wusste sie. Naja, wenigstens für sich selbst konnte sie Kleider entwerfen und nähen. An Mode hatte sie ihre Freude und wohl auch ein gewissen Talent dafür.
Wenig später stand sie ausgehbereit neben ihrer Schwester und die beiden machten sich auf den Weg. Hedwig plapperte vor sich hin und freute sich auf das Fest, Lisbeth hörte kaum zu, dachte vielmehr darüber nach, wie ihre Eltern eigentlich zu ihr standen? Sie wollte so gerne geliebt werden.
Ein erwünschtes Kind war Lisbeth sicher nicht, aber sehr geliebt dennoch, auch wenn Lisbeth das so selten fühlte. Ihre Eltern waren noch in der Verlobungszeit zu einer Zärtlichkeit gelangt, die wohl als fruchtbar bezeichnet werden kann, und damit nicht so schamhaft war, wie es sich zu der Zeit noch geziemte. Lisbeth erblickte nur wenige Monate nach der Hochzeit kerngesund und keinesfalls unterentwickelt, das Licht der Welt. Dennoch versicherten alle, sie sei eine Frühgeburt, nur eben sehr gut entwickelt. So bekam die Ehrhaftigkeit der Eltern keinen Kratzer. Gut entwickelt sollte sie auch bleiben, sie war ein pummeliges Baby, wurde ein noch pummeligeres Kleinkind und da sie immer gerne aß, auch eine sehr rundliche junge Frau. Aber bis es so weit war, wurden ihr noch zwei Geschwister zur Seite gestellt, jeweils im Abstand von zwei Jahren, beide sehr viel willkommener als sie, zumindest empfand Lisbeth das so, das wohl auch, weil sie, sobald sie dazu auch nur annähernd in der Lage war, sich um die beiden Geschwister zu kümmern hatte und ihr so nur wenig Zeit für ihre eigenen Interessen blieb, aber das galt damals durchaus als normal, ging man doch ohnehin davon aus, dass das Kümmern um Haus und Familie den Frauen oblag. Warum dann nicht schon in jungen Jahren damit anfangen? Das konnte doch nur eine gute Übung für später sein, wenn erst einmal die eigenen Kinder da sein würden. Die Männer hingegen hatten das Geld heimzubringen und damit für den materiellen Erhalt der Familie zu sorgen. Die Meisten taten das klaglos und gewissenhaft, wenn auch nicht immer wirklich glücklich in ihrer Rolle. Aber wer fragte in der damaligen Zeit schon nach dem Glück? Die Sorge um das tägliche Überleben überwog.
Auch Lisbeths Vater sorgte verantwortungsbewusst und ohne jemals zu murren für seine Familie. Anders als im festen Rahmen einer Familie zu leben, lag außerhalb seiner Vorstellungswelt. Not litt die Familie nie, wenn es auch zu keiner Zeit glänzend um sie stand. Der Vater fand früh eine Stelle als Arbeiter im großen Werk der chemischen Industrie. Ursprünglich hatte er Bäcker gelernt, aber als solcher war keine Stelle zu finden und eigentlich gefiel ihm die Arbeit im Werk auch besser als die in der Backstube und auch der Lohn war höher. Er empfand die Arbeit im Werk zudem als männlicher. Es hatte etwas erhebendes, wenn morgens die Männer der Siedlung im Arbeitszeug, einer nach dem anderen, aus den Häusern traten und dann gemeinsam in die Schicht auszogen und abends müde, aber sich ihrer Bedeutung bewusst, wieder heimkehrten. Wenn er so mit seinen Kollegen zur Schicht ging, fühlte er sich fast geborgen in der ihn umgebenden Solidarität unter Männern. Er war ein guter und treuer Ehemann, schlug seine Frau nie, lieferte den Lohn pünktlich ab, ohne etwas davon für sich zu verschwenden. Das stünde ihm nicht zu, meinte er. Betrunken sah man ihn nur jeweils einmal im Jahr, beim Ball der freiwilligen Feuerwehr, dann aber genehmigte er sich einen „ordentlichen Schluck“, wie er es ausdrückte und kam „sturzbesoffen“, wie seine Frau es ausdrückte, erst mitten in der Nacht wieder nach Hause. In späteren Jahren war er sogar einmal dermaßen angeheitert, dass er seinem Magen über der Toilette Erleichterung verschaffen wollte oder musste und dabei sein gerade erst erstandenes Gebiss in eben dieser Toilette verlor. Es war Hedwig, die beim verzweifelten Schrei des Vaters herbeilief, mit der Hand beherzt nach dem verlorenen Gegenstande griff und diesen so rettete. Niemand war ihr dankbarer als die Mutter, denn das Gebiss war teuer gewesen. Es war also auch in dieser Situation nicht Lisbeth, der man Dankbarkeit und damit Aufmerksamkeit zollte, sondern wieder stand Hedwig im Mittelpunkt. Diese aber lachte nur und fand es komisch wie der Vater ohne Zähne aussah und sprach. Und überhaupt, wie konnte er seine Zähne nur in die Toilette spucken? Noch wochenlang konnte sie sich darüber amüsieren. Lisbeth nahm es leicht gekränkt und leicht pikiert zur Kenntnis. Gekränkt, weil sie nie irgendeinen Dank für ihre Arbeiten in der Küche oder für die Geschwister erhielt, pikiert, weil es sie insgeheim doch etwas anekelte, dass jemand wie ganz selbstverständlich, so ohne jegliche Skrupel, in eine mit Kotze gefüllte Toilettenschüssel fassen konnte. Igitt!
Lisbeth registrierte den Jubel um die Heldentat Ihrer Schwester, der noch tagelang anhielt, denn auch zunehmend missmutig, denn es war doch stets Lisbeth, die zurücksteckte, wenn es galt, irgendwo zu helfen. Sie schrubbte die Fußböden im Haus, putzte das Gemüse, kochte das Mittagessen und blieb daheim, wenn der kleine Bruder mal wieder Hilfe brauchte oder einfach nicht alleine sein wollte. Aber kaum jemand in der Familie verlor darüber jemals ein Wort des Dankes. Aber tat sich die Schwester auch nur einmal hervor, so wurde tagelang darüber gesprochen. Das war ungerecht, fand Lisbeth.
Lisbeth aber lernte auf diese Weise die Freuden der wahren Märtyrerin kennen, die es genoss, sich ohne Lohn für andere einzusetzen, und doch im Stillen Dankbarkeit erwartete, ohne das jemals offen auszudrücken. Der Schmerz des Entsagens war ihr Lust, das Fehlen des Dankes eine Freude – so sah Lisbeth es, berauscht von der eigenen Schwülstigkeit.
Sie redete sich ein, dass sie das alles doch gerne mache, wenn es nur den anderen gut gehe. Sie selbst forderte doch nichts für sich. Dieses sich Aufopfern für andere gab ihr ein Gefühl der inneren Größe und erhob sie über die anderen. Und so blickte sie sich denn auch oft Beifall heischend um, wenn die Mutter abends betonte, dass sie ohne die Hilfe von Lisbeth eigentlich gar nicht wüsste, wie sie all die täglichen Mühen schaffen sollte, was dann ja doch so etwas wie Dank war. Leider blieb der Beifall der anderen Familienmitglieder meistens aus. Lisbeth hatte ihre Rolle gefunden und merkte erst später, dass sie sich damit auch ins Abseits bugsiert hatte. Man halste ihr immer mehr Arbeit auf. Bitten wie „Lisbeth, kannst du noch mal eben schnell mein Hemd bügeln, dir geht das doch so leicht von der Hand?“ oder „Lisbeth, magst du am Wochenende beim Einmachen helfen, das Obst muss weg?“, kamen immer öfter und jeder ging davon aus, dass es Lisbeth nichts ausmache, wenn sie helfend einsprang. Einen wirklichen Dank bekam sie selten zu hören. Und entgegen Lisbeths Erwartungen neidete die Schwester ihr diese Rolle so gar nicht.
Lisbeth hasste es, immer die Anstandsdame für die hübsche Schwester spielen zu müssen. Aber sie fügte sich, wie sie es immer tat. Was hätte sie auch tun sollen? Und tief in sich drinnen wusste sie, dass es für sie die einzige Möglichkeit war, überhaupt einmal aus dem Haus zu kommen. Andere Freundinnen, mit denen sie sich hin und wieder einmal hätte verabreden können, hatte sie nicht. Sie war nie sehr kontaktfreudig gewesen, eher immer sehr verschlossen. Sie hatte stets das Gefühl gehabt, mit den anderen Mädchen nicht konkurrieren zu können, schon in der Schule war das so gewesen und hatte sich in der Lehre fortgesetzt. Die anderen Mädchen in der Klasse oder später in der Lehre waren immer hübscher und lustiger und fanden so leicht Kontakt zueinander, lachten miteinander und redeten über Themen, zu denen Lisbeth keinen Zugang hatte. Sie beneidete die anderen Mädchen um ihre Ungezwungenheit. Aber sie war einfach nicht in der Lage, fröhlich auf andere zuzugehen, erst später sollte sich das ändern. Aber zugeben konnte sie nicht, dass sie im Umgang mit anderen doch so ihre Schwächen hatte. Überhaupt war sie nicht in der Lage, Schwächen zuzugeben, als solche betrachtete sie auch ihren Mangel an Freundinnen, und so umgab sie sich lieber mit dem Nimbus für Höheres vorgesehen zu sein und darauf zu warten, dass dies denn endlich auch einmal einträte. Damit galt sie zwar vielen als reichlich überheblich und versponnen, „denn was um Himmels Willen will diese Lisbeth eigentlich“, fragten sich so einige. Sie hatte schließlich nicht mehr zu bieten als alle anderen auch. So abgestempelt zu werden, schien Lisbeth immer noch besser als das graue Mauerblümchen zu sein, an dem keiner so rechtes Interesse hatte, aber diese Einstellung machte eben auch einsam. Mit so einer, die immer etwas Besseres sein wollte, mochte man nicht zusammen sein. Hätte sie aber Hilfe gesucht, so hätte sie diese bei ihrer Schwester sicher gefunden, denn insgeheim wünschte sie sich natürlich Freundinnen, mit denen sie hätte reden können oder auch ihre Interessen teilen. Sie stellte sich vor, wie es wäre, wenn auch sie sich einmal zu einem Kaffeeklatsch mit einer Freundin verabreden würde, mit der dann über alles Mögliche reden und ihr kleine Geheimnisse anvertrauen könnte. Aber hatte sie denn überhaupt Geheimnisse? Nein, die hatte sie eben nicht, gestand sie sich selber ein. Sie hatte keine Geheimnisse und schon gar keine Freundinnen. Hätte sie nicht ständig ihre Schwester begleiten müssen, so wäre sie gar nicht aus dem Haus gekommen. Sie hätte ihrer Schwester also fast dankbar sein müssen. Lisbeth wusste das, hätte es aber niemals zugegeben.
So spazierten die beiden Mädchen die lange Straße durch die Siedlung, beide herausgeputzt, die eine willens sich zu amüsieren, die andere dreinblickend mit einer Mischung aus Hochmütigkeit, Langeweile und des Abgestoßenseins von all dem, was sie umgab. Das machte Lisbeth nicht eben attraktiver für die anderen Jugendlichen in der Siedlung. Die Pummelliese galt als arrogante Schnepfe.
Lisbeth meinte denn auch jetzt schon zu wissen, was sie gleich erwartete: Sie würde wie immer alleine in einer Ecke stehen, an einer Limo nippen und neidisch die Schwester beobachten, sich ihren Neid aber auf keinen Fall anmerken lassen. Bloß das nicht, dabei wäre sie so gerne auch einmal zum Tanzen aufgefordert worden, hätte auch so gerne einmal mit einem der Jungen geflirtet, auch wenn sie immer behauptete, dass von denen aus der Siedlung oder der Nachbarsiedlung, andere waren sowieso nicht da, ihr keiner gut genug wäre.
Das stimmte allerdings auch. Sie träumte von einem Lehrer, der abends nicht mit schmutzigen Händen nach Hause käme, abends kein Bier tränke, sondern bei einem Glas Wein, wenn es denn überhaupt Alkohol sein müsste, ein Buch läse, ihr vielleicht daraus ein paar interessante Stellen vorläse und sie um ihre Meinung dazu fragte. Dann würde sie zusammen sitzen und über das Gelesene sprechen, er würde ihre Meinung schätzen, sie zärtlich in den Arm nehmen und sagen: „Ach wenn ich dich nicht hätte, du gibst mir so viele Anregungen.“ Aber solche Männer waren hier nicht zu finden.
„Da vorne ist ja der Kurt“, jubelte Hedwig gleich beim Eintritt in die Kantine und strahlte Lisbeth an als erwarte sie, dass diese ihren Jubel teile. Die Kantine ließ mal wieder jede Spur von Eleganz vermissen, ja nicht einmal gemütlich war es hier, stellte Lisbeth fast resigniert fest. Aber das Werk stellte für diese Feiern diesen Raum bereitwillig zur Verfügung, das musste man anerkennen. Immerhin hatte irgendjemand die bunten, glitzernden Girlanden aufgehängt, aber das Licht war zu grell und in der hinteren Ecke stand noch ein Rollwagen mit dickem weißem Geschirr, das wahrscheinlich für den kommenden Tag gebraucht wurde.
„Man sollte wenigstens weniger Lichter anmachen, dann wäre es etwas festlicher“, meinte Lisbeth zu ihrer Schwester. „Mensch, und das von dir. Mit weniger Licht wird es doch auch schummriger, das lädt zum Knutschen ein, das weiß du doch“, erwiderte Hedwig und zeigte wieder ganz aufgeregt auf diesen Kurt.
„Siehst du den Typen da vorne, ich finde den ganz toll“, gestand Hedwig der Schwester. „Kurt fährt noch zur See, aber später will er mal auf die Seefahrtsschule und dann wird er Offizier auf einem der ganz großen Schiffe, vielleicht sogar einmal Kapitän“, meinte Hedwig weiter und deutete auf einen eher kleinen, schmächtigen dunklen Typen, der lässig mit dem Arm auf der Theke lehnte und ein Bierglas in der Hand hielt. In der anderen hielt er eine Zigarette. Der machte schon etwas her, fand auch Lisbeth. Er schien mit einer Gruppe von anderen jungen Männern hier zu sein, aber irgendwie dann doch nicht richtig zu ihnen zu gehören, er hielt sich auffällig abseits von ihnen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, die anderen würden ihn in ihrem Kreis nicht zulassen. Er schien es nicht nötig zu haben, sich bei den anderen jungen Männern anzubiedern. Er war anders als sie und das schien für alle so in Ordnung zu sein. Lisbeth gefiel das. Er war vielleicht genauso alleine wie sie, aber ohne darunter zu leiden, meinte sie zu spüren. Das imponierte ihr fast.
Ihre Beobachtungen teilte sie aber nicht mit ihrer Schwester, die würde solche Überlegungen ohnehin nicht verstehen, war Lisbeth sicher. Sie war immer überzeugt, dass nur sie zu tieferen Gedankengängen fähig war und alle anderen stets nur an der Oberfläche kratzten. Wohl auch deshalb hatte sie so wenige Freunde.
„Ich hab´ den Kurt letzte Woche bei uns im Laden kurz gesehen, er ist ja nicht so oft hier, meistens auf dem Schiff. Aber sieht er nicht toll aus?“, begeisterte sich Hedwig wieder und schaute Lisbeth in Erwartung einer Bestätigung an.
„Wenn er all das schafft, was er sich vorgenommen hat, dann hätte er etwas geleistet“, antwortete Lisbeth etwas oberlehrerinnenhaft und dachte im Stillen, dass so ein Offizier oder Kapitän ihr auch gefallen könnte, ohne sich wirklich Hoffnungen darauf zu machen, diesen Kurt für sich einnehmen zu können. Der würde sicher noch ganz andere Mädchen kennen, war sie überzeugt. Da würde sie keine Chancen haben, war Lisbeth sicher und fiel in Selbstmitleid, was sie hin und wieder gerne einmal machte, denn ansonsten sah ja nie niemand das Tragische in ihrem Leben und schon gar nicht hatte jemand Mitleid mit ihr. Lisbeth nannte diese Stimmungen Melancholie und fand es schick. Sie meinte, das mache sie interessant. Den Ausdruck „Melancholie“ hatte sie aus einem der Bücher, die der Bibliothekar ihr geliehen hatte. Es ging in dem Buch um leicht anämische junge Dame aus der besseren Gesellschaft, allerdings der vor hundert Jahren. Wurde ihnen langweilig, so litten sie unter einer Melancholie und verreisten in das nächste Bad, um sich zu erholen. Dieser Weg stand Lisbeth leider nicht offen. Und zu ihrem Leidwesen bemerkte diese schöne Melancholie bei ihr noch nicht einmal jemand. „All die Menschen hier um mich herum sind eben stumpf, zu sensiblen Empfindungen gar nicht fähig“, jammerte sie in ihrem Innern und kam sich wieder einmal sehr verkannt vor. Sie gehörte hier nicht her, war sie sicher. Aber wohin sollte sie dann gehen?
Als sie aus ihren Gedanken erwachte und sich umdrehte, war Hedwig schon nicht mehr an ihrer Seite und steuerte geradewegs auf diesen Kurt zu. „Na, das geht ja gut los. Da werde ich Probleme haben, Hedwig schon um zehn wieder nach Hause zu bringen“, dachte Lisbeth nicht ohne Ärger in sich zu spüren. Länger als bis zehn Uhr abends durften die Mädchen nicht fortbleiben und Lisbeth war dafür verantwortlich, Hedwig pünktlich nach Hause zu bringen, was wahrlich nicht immer einfach war. Hedwig wollte immer länger fortbleiben, Lisbeth dagegen war schon zehn Uhr zu spät. Ihr war es wichtiger, am nächsten Tag ausgeschlafen zu sein, als sich lange auf diesen für sie langweiligen Festen „herumzutreiben“, wie sie es ausdrückte. Da zeigte sie sich einig mit der Mutter. „Später nach Hause zu kommen schickt sich nicht“, sagte diese immer und meinte damit wohl mehr die erst sechzehnjährige Hedwig, aber der Lisbeth schadete es auch nicht, wenn sie früh wieder daheim war, war die Mutter überzeugt. Und Lisbeth war das im Allgemeinen ja auch ganz recht. Je früher sie diese leidigen Siedlungsfeste wieder verlassen konnte, umso besser. Zwar musste sie am nächsten Tag nicht arbeiten, denn die Siedlungsfeste fanden immer an einem Samstag statt, aber für Lisbeth gab es auch sonntags genug zu tun, sie half dann ja immer der Mutter bei der Vorbereitung des Essens, machte das auch gerne, denn dann konnte sie schon mal vorab von der Sauce naschen, die die Mutter so gut zuzubereiten verstand.
Ohnehin hätte sie diesen und auch die anderen Abende viel lieber gemütlich zu Hause verbracht, sich mit einem Buch ins Bett verzogen und sich ihren Träumen hingegeben. Stattdessen musste sie nun irgendwie die Stunden hier herumbringen. Sie fühlte sich mal wieder von den Eltern und der Welt ungerecht behandelt.
Dann sah sie Hedwig mit Kurt am Arm auf sich zusteuern. „Er sieht wirklich nicht schlecht aus mit seinem dunklem Schnurrbart über den sinnlichen Lippen, aber etwas klein ist er, obwohl er einen sehr sportlichen, durchtrainierten Körper hat“, dachte Lisbeth und sah sich auch schon gezwungen, Kurt die Hand zu geben, denn das musste man wohl machen, wenn einer jungen Frau ein junger Mann vorgestellt wird. Und genau das machte Hedwig gerade.
„Lisbeth, das ist Kurt, ich hab´ dir ja schon von ihm erzählt, sagte sie und strahlte dabei Kurt an.
„Kurt, das ist meine Schwester Lisbeth, sie muss auf mich aufpassen, damit ich keine Dummheiten mache“, kicherte sie und himmelte Kurt mit ihren blauen Augen an. Aber der auch sie, stellte Lisbeth fest. „Da scheinen sich zwei gefunden zu haben“, dachte Lisbeth und spürte einen kleinen Stich im Herzen. Warum wurde sie nie so verliebt von einem Mann angesehen? Warum wurde sie nie begehrt?
„Ja, so ist es und um zehn musst du zu Hause sein, vergiss das nicht“, sagte Lisbeth, beide gleichzeitig anschauend und mit einem leicht schnippischem Unterton in der Stimme.
„Lisbeth verdirbt gerne den anderen den Spaß, das musst du nicht so ernst nehmen“, meinte Hedwig und strahlte Kurt weiter an.
„Ich gehe mal einen Moment an die frische Luft, mir ist das hier zu stickig“, meinte Lisbeth und wandte den Beiden den Rücken zu. Bloß weg, sonst fiel es Hedwig noch auf, dass ihr wirklich nicht unbedingt fröhlich zu Mute war und ihr gerade ein dicker Kloß den Hals heraufkroch. Ihr war eher zum Heulen zu Mute. Die Schwester würde ihr heute Abend im Bett ohnehin noch viel zu viel über diesen Kurt erzählen.
„Offizier will er werden, das schafft er ja doch nicht“, dachte Lisbeth, immer noch schnippisch und ging nach draußen, setzte sich vor dem Kasino auf eine der Bänke und atmete die frische Frühlingsluft ein. Wie gerne wäre sie jetzt zu Hause gewesen, würde sich noch ein wenig auf die Gartenbank vor dem Haus setzen und lesen. Die Mutter sah das allerdings nicht gerne, denn mit einem Buch vor der Nase draußen zu sitzen, sah doch allzu sehr „nach etwas Besserem“ aus, wie diese immer sagte, „das passt nicht zu unsereins.“ „Vielleicht hat die Mutter ja recht, vielleicht habe ich wirklich nur zu viele Träume im Kopf“, dachte Lisbeth und wusste auch nicht, wie sie sich diese Träume erfüllen könnte. „So ein Offizier – ja, das wäre schon etwas“, ging es ihr durch den Kopf
So gut wie Lisbeth und Hedwig hatte es Kurt mit seinem Elternhaus beileibe nicht getroffen. Ein Haus gab es nicht, stets nur preiswert gemietete Zimmer, die den Eltern vom Amt zugewiesen wurden, kärglich waren diese, stets nur mit dem nötigsten ausgestattet. Und auch dieses Nötigste, meist von anderen Abgelegtes, war oft genug noch schäbig und eigentlich nicht mehr vorzeigbar. Er war schon froh, wenn er in den kleinen Zimmern ein eigenes Bett hatte, mehr als zwei Zimmer waren nie für die gesamte Familie vorhanden. Das musste eben reichen. Und das tat es auch, denn man kannte es ja nicht anders. Kurt lernte schon früh, was Not bedeutet und was es heißt, nicht jeden Mittag eine warme Mahlzeit zu bekommen. Und dann war da noch die Angst vor einem Vater, der nicht regelmäßig arbeiten ging, vielmehr gerne seine Zeit auf dem Sofa in der spärlich eingerichteten Küche verbrachte. Stattdessen sich aber seinen zwei Söhnen, von denen nur Kurt von ihm war, auf eine Weise näherte, auf die ein Vater seine Söhne nicht, sagen wir: lieben sollte. Genaues wurde nie bekannt, darüber sprach man nicht, auch Kurt in späteren Jahren nicht. Es war ihm wohl zu peinlich. War er da doch in etwas hinein geraten, was er zum einen selber nicht verstand aber ihn in seinen Augen, und das war viel schlimmer, als einen Menschen darstellte, der schwach war und sich nicht gewehrt hatte, als er es eigentlich hätte tun sollen. Jedenfalls sah Kurt es auch als Erwachsener noch so. Er verzog sich stattdessen in eine dunkle Ecke, ballte die Hände zu Fäusten, biss hinein, bis es blutete und wusste doch nicht, wohin mit seiner Wut. Er lernte, diese Wut in sich hineinzufressen, so sehr, dass die Adern an der Stirn anschwollen und sein Gesicht ganz rot wurde. In seiner Phantasie malte er sich aus, wie er Rache nahm, wie er endlich die Worte fand, um seinem Vater all seinen Hass ins Gesicht zu schleudern wie klatschende nasse Lappen. In seiner Phantasie ließ er seinen Vater vor sich auf den Knien kriechen und um Gnade winseln. Es kam nie so weit, der Vater starb irgendwann als Kurt schon ein Mann war und solche Gedanken ad acta gelegt hatte. Es reichte, wenn er nicht mehr als nötig Kontakt zu seinen Eltern hatte. Die Mutter redete später kaum noch über ihren Mann, fing aber nach seinem Tod an, die kleinen Zimmer mit allerlei Nippes auszustaffieren. Sie wollte es wohl endlich etwas gemütlich haben und nach ihrer Façon leben. Kurt gönnte es ihr von Herzen.
Wohl auch als erwachsener Mann war Kurt noch tief in seiner Seele verletzt und verwand nie, was ihm als Kind angetan worden war und was er zeit seines Lebens verabscheute, nämlich Zärtlichkeiten zwischen Männern. Dass sein Liebhaber der eigene Vater gewesen war, schob er in die tiefsten Tiefen seiner Seele. Und er fühlte sich schuldig, denn war nicht doch er es gewesen, der den Vater gereizt hatte? Warum sonst hatte die Mutter immer wieder gesagt, er solle den Vater nicht so reizen? Kurt kam nie auf die Idee, die Schuld nicht bei sich zu suchen, sondern bei den Erwachsenen. Später wechselte er nur die Rollen. Zudem war es wohl auch so, dass seine Mutter gar nicht wissen wollte, was da nächtens in den Kammern geschah. Sie war froh, überhaupt noch einen Mann „…abbekommen zu haben“, wie sie sagte und nicht ganz alleine dazustehen, „schließlich hatte ich schon ein Balg am Hals, um eine solche Frau reißen sich die Männer nicht gerade“, so sagte sie es immer wieder, auch ihren Kindern. Für Frauen wie sie war es nicht leicht, wieder zurück in geordnete Bahnen zu kommen, denn wohl auch schon vor Geburt des ersten Sohnes lebte sie in Verhältnissen, in die Lisbeths Eltern ihre Töchter nie gelassen hätten. Kurt schnappte, als er sie wieder einmal zum Amt begleiten musste, auf, wie sie von ihrem Leben mit dem „fahrendem Volk“ sprach, einer Schaustellertruppe. Ihr Blick bekam einen fast wehmütigen Ausdruck dabei, wahrscheinlich hatte sie damals so etwas wie ein kleines Glück gefunden, aber als Kurt sie danach fragte, winkte sie nur ab. Über ihre Zeit vor der Ehe mit Kurts Vater und die Herkunft des Bruders, der wahrscheinlich die Folge eines Fehltritts seiner Mutter war, bevor diese seinen Vater kennengelernt hatte und sesshaft wurde, wurde nie gesprochen. Vergangenheit war etwas, über das man nicht sprach, was vorbei war, hatte keine Bedeutung mehr. Mit der Heirat wurde sie dann „fast solide“, wie sie es nannte, aber einfacher wurde es nicht. Schon ihr Aussehen machte viele misstrauisch. Woher hatte sie die dunkle Haut, die dunklen Augen und die fast schwarzen Haare? Da konnte doch irgendetwas nicht stimmen. Nicht selten musste sie solch Getuschel über sich hören.
Aber ohnehin konnte Kurt sich nicht daran erinnern, jemals tiefergehende Gespräche mit seiner Mutter geführt zu haben. Man sprach nur über das, was das Tagesgeschehen ausmachte und organisierte. Warst du auf dem Amt? Haben die Geld gegeben? Solches und ähnliches wurde gesprochen aber mehr war in dieser Familie nicht üblich.
Kurt wusste auch, was es heißt, immer wieder bei der Fürsorge vorstellig werden zu müssen, weil das Geld nicht reichte und wieder nicht die Miete bezahlt werden konnte oder nichts mehr zu essen im Hause war. Seine Mutter nahm dann gerne die Kinder mit in die Amtsstuben. So liebe Jungen konnten doch die Herren oder Damen da oben nicht hungern lassen wollen, da würde man doch wohl auf eine kleine Zuwendung hoffen dürfen. Von den fleischlichen Bedürfnissen des Vaters sagte sie nichts. Aber sie bekam Geld in die Hand gedrückt und konnte etwas auf den Tisch bringen. Mehr verlangte sie nicht vom Leben, weder für sich noch für ihre Kinder. Sie meinte, es mit diesem Mann, der ihr Schutz bot vor dem Geschwätz der Nachbarn und den Zudringlichkeiten anderer Männer, halbwegs gut getroffen zu haben. Ihre Erwartungen an das Leben waren nie besonders hoch gewesen, wohl weil sie es nicht anders kannte, und was man nicht kennt, das vermisst man im Allgemeinen ja auch nicht.
Nur an einem Ritual hielt sie bis ins hohe Alter fest, nämlich dass stets eine Kanne mit heißem Tee auf dem Herd stand, und jedem, der in die kleine Wohnung kam, wurde ein Tasse Tee angeboten. Getrunken wurde immer aus winzigen Tassen, eben ganz so wie es in Friesland Brauch war, dort, wo sie einst geboren worden war.
Mit seinem Bruder Heinz verband Kurt nicht viel. Heinz und er hatten sich nicht viel zu sagen, was vielleicht auch am Altersunterschied von zwölf Jahren lag. Der Bruder war ja fast schon ein Mann, als Kurt noch immer das Kind war, dass den Gelüsten des Vaters ausgesetzt war. Der Bruder war Kurt keine Hilfe. Man schwieg auch hier über das, was geschah, war wohl froh, wenn es einen nicht mehr selber traf. Ansonsten schien der Bruder recht zufrieden mit den Möglichkeiten, die er hatte. Er arbeitete als ungelernter Helfer im Hafen und verdiente gar nicht mal so schlecht dabei, fand er. Irgendwann heiratete er eine Frau, die ebenfalls keine großen Ansprüche stellte. Sie bekamen vier Kinder in nur sechs Jahren und lebten still und zufrieden vor sich hin. Als Erwachsene sahen Kurt und er sich kaum.