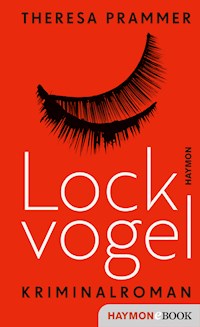
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lorenz und Brehm
- Sprache: Deutsch
Sie hat Talent – und er sie in der Hand: Was ist dran an der Geschichte, dass ein einflussreicher Regisseur übergriffig geworden sein soll? Toni ist pleite und ihr läuft die Zeit davon Toni hat praktisch keinen Euro mehr in der Tasche. Nicht, weil die Schauspielschülerin ihren Allerwertesten nicht hochbekommt, sondern weil sich ihr Freund Felix mit ihren Ersparnissen auf und davon gemacht hat. Geld weg, Freund weg (Oder Ex-Freund? Betrüger? Was zur Hölle ist er denn nun?), dafür werden die unbezahlten Rechnungen immer mehr. – Toni hat einen riesigen Berg besonders saurer Zitronen vorgesetzt bekommen. Nur: Was macht sie daraus? Zuerst einmal: Durchatmen, Limonade machen auf später verschieben und schleunigst Felix zur Rede stellen. Dafür wendet sie sich an Privatdetektiv Edgar Brehm. Der könnte Felix aufspüren. Doch wie soll sie ihn bezahlen? Ein Fall von #metoo? – Undercover als Lockvogel Auch Sybille Steiner findet den Weg in Brehms Detektei: Die Ehefrau eines Starregisseurs hat beunruhigende Post erhalten. Einem anonymen Tagebuch zufolge soll ihr Ehemann vor Jahren gegenüber einer jungen Schauspielerin seine Machtposition ausgenutzt haben. Sind die Anschuldigungen wahr? Wer ist die Verfasserin? Hat damit gar der Tod eines Mannes auf einer von Steiners High-Society-Partys etwas zu tun? Möglichst schnell, bevor die Presse Wind davon bekommt, muss Brehm genau das herausfinden. Wie praktisch, dass gerade eine Schauspielschülerin bei Brehm aufgetaucht ist, die ihn nicht bezahlen kann: Toni wird als Lockvogel engagiert. Welche Gefahren warten auf sie in der Filmbranche, die für Machtgefälle und Intrigen berüchtigt ist? Theresa Prammers Kriminalroman bringt deinen Puls auf Hochtouren! Ist das nur ein "lockerer Typ" oder nutzt er seine Position aus? Darf ich noch vertrauen? Was zieht es nach sich, wenn ich mutig bin und Missstände aufzeige? – Es ist ein brisanter Stoff, dem sich die Autorin, Schauspielerin und Regisseurin Theresa Prammer in "Lockvogel" zuwendet. Und genau dafür wird sie geschätzt: Dass ihre Bücher nicht nur spannend sind und bis tief hinein die Nacht bei geöffneten Buchdeckeln mitfiebern lassen. Sondern dass sie uns in ihren Romanen vor Fragen stellt, die uns auch im richtigen Leben beschäftigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theresa Prammer
Lockvogel
Kriminalroman
Für meine Nichten Carina, Kathi, Muriel, Rebecca und StefanieUnd für J. – immer wieder
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Altes Testament
Der Mut bietet immer ein schönes Schauspiel.
Alexandre Dumas
Prolog
Jeder Zentimeter seines Hemdes klebte an ihm. Wegen dieser viel zu eng gebundenen Fliege konnte er kaum atmen. Das hier war seine einzige Chance. Er wollte sie. Er brauchte sie. Eine zweite würde er nicht bekommen.
Die Knie zitterten ihm so sehr, dass sogar das Tablett voller Champagnergläser in seinen Händen vibrierte.
Er durfte sich jetzt auf keinen Fall einschüchtern lassen. Er hatte eine Mission. Er war ein Krieger. Ein Held. Er stand hier für die unzähligen Demütigungen, die er ertragen und die er immer wieder von sich abgeschüttelt hatte.
Obwohl es in dem Wohnzimmer neben der aufgebauten Cocktailbar angenehm kühl war, strömte ihm der Schweiß aus allen Poren. Die Ehefrau des Gastgebers kam in einem trägerlosen und sehr kurzen Glitzerkleid auf ihn zu.
Vor einer Stunde hatte er sie noch in einem pinkfarbenen Jogginganzug und mit Lockenwicklern im Haar durchs Haus eilen gesehen. Jetzt bewegte sie sich in ihren High Heels so elegant, als würde sie auf einem Laufsteg stolzieren.
Er streckte ihr das Tablett ein wenig entgegen.
„Champagner?“
Seine Stimme klang merkwürdig hoch, doch die Dame des Hauses schien es nicht zu bemerken. Sie sah an ihm vorbei.
„Sie werden fürs Servieren bezahlt. Nicht, um hier herumzustehen und die Klimaanlage zu genießen.“
„Pardon, das ist heute mein erster Tag.“
Er bemühte sich um ein Lächeln. Sie nahm es mit einer Mischung aus ungläubigem Räuspern und einer wedelnden Handbewegung hin, als würde sie eine Fliege verscheuchen.
„Auf der Terrasse verdursten unsere Gäste. Also los, raus.“
Schwungvoll nahm sie ein Glas vom Tablett und stöckelte mit ausgebreiteten Armen auf eine andere Blonde zu, die ihre Zwillingsschwester hätte sein können. Vielleicht hatten sie aber auch nur denselben Chirurgen.
Er sah zum dunkelhäutigen Barkeeper, der die nächste Flasche Champagner öffnete und konzentriert mit beiden Händen in die aufgereihten Gläser einschenkte. Wahrscheinlich hatte er auch schon einen Anschiss bekommen, weil er ein Tröpfchen vergossen hatte.
Natürlich gab es Dom Pérignon. Das Personal heute Abend bekam hingegen nur einen Stundenlohn von acht Euro fünfzig bezahlt, wie er mitbekommen hatte. Schwarz auf die Hand. Nein, nicht davon ablenken lassen, er sollte sich auf sein Ziel konzentrieren.
Schluck deinen Ärger runter, Mann.
Es waren gar nicht die hochsommerlichen Temperaturen, die in diesem Juni herrschten, die ihn im Innenraum hielten. Der Grund dafür befand sich keine drei Meter von ihm entfernt. Der Grund, warum er sich überhaupt als falscher Kellner verkleidet auf die Veranstaltung geschlichen hatte. Unter dem Tresen, in einem schwarzen Rucksack, hinter einer Kiste mit französischem Rotwein versteckt.
Was, wenn den jemand finden würde, während er der Wiener High Society Champagner unter die korrigierten Nasen hielt? Dann wäre sein ganzer Plan vorbei, noch bevor er überhaupt begonnen hätte. Die ersten paar Stunden musste er einfach so tun, als wäre er vom Personal. Das Abendessen abwarten, dann käme sicher eine Band oder ein DJ, um Musik zu machen.
Diese Partys waren bekannt für die ausgelassene Stimmung, je später es wurde. Genau dann, wenn alle bei bester Laune wären, würde er tun, weswegen er gekommen war.
Aber bis es so weit war, konnte er nicht die ganze Zeit wie angewurzelt hier stehen bleiben. Er musste da raus. Für sich. Für Carla. Der Gedanke an sie gab ihm neue Kraft.
Ihr würde es hier gefallen. Dieses Haus war atemberaubend. Die Inneneinrichtung aus Chrom, aus schwarzem und weißem Marmor, eine beigefarbene Ledercouch als Liegewiese vor einem Flatscreen. Der war größer als ihr Doppelbett. Carla hätte es verdient, so zu wohnen. Und noch viel mehr.
„Wir können nicht so weitermachen“, hatte sie gestern zu ihm gesagt. Danach der Riesenkrach, weil er wusste, dass sie im Recht war. Er hatte türknallend die Wohnung verlassen, war durch die Straßen gelaufen, hin und her geworfen zwischen Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Bis er beim U-Bahn-Abgang an den Aufstellern mit der Gratiszeitung vorbeigekommen war und auf der Titelseite die Ankündigung für dieses Sommerfest gesehen hatte. Das war es. Das Zeichen, um das er so lange gefleht hatte. Eigentlich unglaublich, dass er es hierhergeschafft hatte. Schon allein das war eine Story. Die halbe Nacht hatte er wachgelegen und sich vorgestellt, wie er die Geschichte in unzähligen TV-Interviews zum Besten geben würde. Aber dazu musste er seinen Posten verlassen, sonst feuerte ihn die Glitzerlady garantiert.
Er warf dem Barkeeper einen beschwörenden Blick zu, schickte ein leises Stoßgebet zum Himmel und ging auf die überdachte Terrasse. Die Hitze schlug ihm entgegen wie ein schwerer Vorhang, aber im nächsten Moment wehte auch schon ein angenehm feuchter Nebel auf ihn herab.
Die Düsen, die an der Hausmauer des Zubaus befestigt waren, versprühten einen kühlen Hauch auf die Gäste. Das Sonnenlicht brach sich darin. Wahrscheinlich war dieses Haus zu einem großen Teil für den Klimawandel verantwortlich.
Meine Güte, draußen war es noch viel schöner als drinnen. Die Terrasse mündete in einen zur Hälfte über dem Abhang schwebenden Pool, der einen herrlichen Ausblick auf die Stadt bot. Wie in einem Werbeprospekt für Wien.
Er musste sich nur ein paar Schritte durch die Gästeschar bewegen, die Champagnergläser wurden ihm quasi vom Tablett gerissen. So viel Prominenz überraschte ihn. Zwar war er nicht so bewandert wie Carla, doch sogar er erkannte berühmte Gesichter aus Politik, Film und Musik.
Jedes Mal, wenn er sein Tablett bei der Bar mit vollen Gläsern bestückte, versicherte er sich, dass sein Rucksack noch in dem Versteck war.
So gingen ein, vielleicht zwei Stunden dahin. Den Gastgeber hatte er die ganze Zeit noch nicht gesehen, aber möglicherweise gehörte es zum Spleen eines so erfolgreichen Mannes, selbst zu spät zur eigenen Party zu kommen.
Auf dem Weg in die Küche, um die leeren Gläser loszuwerden, lief er fast in einen Mann hinein. Im letzten Moment stoppte er, doch ein Glas segelte vom Tablett. Der Mann drehte sich um. Das war er – sein Ziel.
In Wirklichkeit war Alexander Steiner noch größer und imposanter als im Fernsehen und auf Fotos.
Er sollte jetzt etwas sagen, etwas Amüsantes, Geistreiches. Aber sein Mund wurde schlagartig trocken und in seinem Kopf herrschte nur panische Leere. Ein merkwürdiges Quietschen kam aus seinem Hals, als hätte er eine Maus verschluckt.
Und dann war Alexander Steiner auch schon Richtung Terrasse verschwunden. Im nächsten Moment wehte ein Klangteppich aus „Aaahs“ und „Ohhhs“ von draußen herein, gefolgt von Applaus. Na, das war ja ein beschissener erster Eindruck, den er da abgeliefert hatte. Sein Gesicht brannte, so rot war er geworden. Wahrscheinlich war das hier alles nur eine maßlos bescheuerte Idee. Er war ja nicht mal zu einem normalen „Hallo“ in der Lage, wie sollte er dann später tun, weswegen er gekommen war?
Ein Schniefen riss ihn aus seinen Gedanken.
Etwas abseits stand ein Mädchen in Jeans und schwarzem T-Shirt, er hatte sie gar nicht bemerkt. Eine Träne kullerte ihr über die Wange, sie biss sich auf den kleinen Finger.
„Oh nein, tut mir leid, hat dich ein Splitter getroffen?“
Das Mädchen schüttelte den Kopf. Sie war vielleicht dreizehn oder vierzehn und gerade in dem Wachstumsstadium, in dem die Proportionen noch lustig durcheinanderwuchsen. Lange Arme, kurze Beine, Kinderhände und die Kopfgröße bereits drei Jahre voraus. Bei ihm war das ganz genauso gewesen, jahrelang war er deswegen gehänselt worden. Was wahrscheinlich der Grund war, warum er überhaupt zu schreiben begonnen hatte. Wie er damals schien auch sie nicht zu den „coolen Kindern“ zu gehören, obwohl sie sich – ihrer Kleidung nach zu urteilen – offenbar darum bemühte. Doch ihre zusammengesunkene Körperhaltung und die traurigen Augen verrieten zu viel. Eine weitere Träne löste sich aus ihrem Augenwinkel.
Am liebsten hätte er jetzt mit ihr geheult, so elend fühlte er sich.
„Kann ich dir irgendwie helfen?“, fragte er. Keine Reaktion. Warum auch, er war ja nur ein „Niemand“.
Er seufzte. Was machte er sich da eigentlich vor? Das war doch idiotisch, er würde es nie schaffen. Er stellte das Tablett ab und mit ihm auch gleich seine Pläne und Hoffnungen. Jetzt würde er seinen Rucksack holen, nach Hause gehen zu Carla und ihr sagen, dass er sich morgen einen Job suchen würde. Und wenn er wieder im Supermarkt Regale schlichten oder Pakete ausliefern musste, dann war das eben so.
Das Mädchen stand da wie angewurzelt, die mausbraunen Haare fielen ihr ins Gesicht. Sie starrte vor sich hin, alles an ihr hing, wie bei einer Marionette, der man die Fäden gekappt hatte.
„Was ist denn los?“, fragte er.
Sie hob den Blick, als wäre sie verwundert, dass er noch immer da war. Wortlos zog sie ein zusammengerolltes Heft aus der Gesäßtasche ihrer Jeans, klappte es auf. Ein Aufsatz wahrscheinlich. Die Anzahl der roten Striche und Kommentare war bemerkenswert, die Seiten sahen aus wie ein abstraktes Gemälde. THEMENVERFEHLUNG – NICHT GENÜGEND, stand darunter.
„Deutsch?“
Sie nickte und kratzte sich an der Nase.
„Schularbeit.“
„Darf ich es lesen?“
„Egal.“
Es war kein schlechter Aufsatz. Vielleicht in zwei Passagen ein bisschen verwirrend und manchmal holprig im Ausdruck, aber vielversprechend. Und definitiv kein „Nicht genügend“. Er gab ihr das Heft zurück.
„Willst du die Meinung eines arbeitslosen Drehbuchautors?“
Sie zuckte mit den Schultern, murmelte wieder kaum hörbar: „Egal.“
„Wer dich da benotet hat, ist ein Trottel.“
Sie lachte auf, es klang viel zu resigniert für ein so junges Mädchen.
„Wirklich. Und ich sage das jetzt nicht, um dich zu trösten. Der Aufsatz hat was. Klar, es sind ein paar Fehler drin, aber was soll’s? Würde ich meine Sachen nicht überarbeiten, wären sie auch gespickt mit Fehlern. Und dein Text ist witzig, voller guter Ideen.“
„Ich krieg einen Fleck nach dem anderen. Er hasst mich einfach.“
„Das tut mir leid.“ Er wollte schon gehen, drehte sich aber noch mal um. „Manchmal gibt es solche Menschen. Du kannst die süßeste, köstlichste Erdbeere der Welt sein, aber wenn jemand einfach keine Erdbeeren mag oder vielleicht allergisch dagegen ist, was ist dann?“
Sie hob die Schultern.
„Keine Ahnung … dann mag er sie trotzdem nicht?“
„Ganz genau. Er mag sie trotzdem nicht. Und es hat nichts mit der Erdbeere zu tun. Ich mag Erdbeeren. Sehr. Und du?“
Sie sah ihn an. Sehr langsam hob sich ihr Mundwinkel zu einem halben Lächeln, das sich wie in Zeitlupe zu einem Strahlen ausbreitete.
„Ich auch.“
Er nickte ihr zu. Sie lächelten einander an, und im selben Moment entschied er, doch zu bleiben. Er hatte da seine persönliche Erdbeere im Rucksack in Form des Drehbuchs, an dem er die letzten vier Jahre geschrieben hatte. Unzähligen Produktionsfirmen hatte er es geschickt, die meisten hatten nicht einmal geantwortet. Und wenn er eine Rückmeldung bekommen hatte, dann waren es die üblichen Floskeln: man hätte „momentan keinen Bedarf“, „die Kapazitäten wären im Moment ausgereizt“. Wahrscheinlich hatte nie einer mehr als die ersten drei Seiten gelesen.
Deswegen war er am Morgen hergefahren, hatte sich versteckt, dem Catering beim Ausliefern zugesehen, sich in einem günstigen Moment ins Haus geschlichen, Hemd, Hose und Fliege aus dem Badezimmer geklaut, in dem sich die Kellner umzogen. Alles nur, um Alexander Steiner, einem der erfolgreichsten Regisseure des Landes, persönlich sein Drehbuch in die Hand zu drücken.
Die nächsten Stunden zogen sich: auftragen, abservieren, auftragen, abservieren. Immer wieder sah er Alexander Steiner, umringt von wichtigen Leuten – oder zumindest von solchen, die sich dafür hielten. Das Mädchen sah er nicht mehr.
Es war schon fast Mitternacht, der DJ war eingetroffen, die Party hatte sich wegen eines plötzlichen Wolkenbruchs nach drinnen verlagert, da endlich entdeckte er Alexander Steiner alleine. Er stand auf der Terrasse und paffte im Halbdunkeln eine klischeehaft dicke Zigarre.
Das war seine Chance.
Eilig wühlte er sich durch die Menschenmenge, fischte das Drehbuch aus dem Rucksack, ging wieder zurück zur Terrassentür.
Mist, jetzt war er zu spät. Alexander Steiner war nicht mehr alleine. Neben ihm stand der dunkelhäutige Barkeeper. Er hielt etwas in der Hand, eine schwarze Box. War das eine DVD-Hülle?
„Ich bin Schauspieler, mache das hier nur nebenbei“, hörte er die erstaunlich hohe Stimme des Barkeepers. „Mein Demoband ist auf dem neuesten Stand, und ich dachte mir …“
Er hatte das Gefühl, in seiner Brust würde ein Fahrstuhl abstürzen. Alexander Steiner sagte was, das er wegen der Zigarre zwischen seinen Lippen nicht verstehen konnte. Es klang unfreundlich. Der Barkeeper wollte etwas erwidern, da nahm ihm Alexander Steiner die schwarze Hülle ab und schleuderte sie in den Swimmingpool. Der Barkeeper schnappte nach Luft. Alexander Steiner ließ seine Zigarre auf den Boden fallen und trat sie aus, dann drehte er sich um und kam an ihm vorbei, als er das Wohnzimmer betrat.
Der Barkeeper schaute fassungslos hinterher.
„Was für ein Arschloch. Dafür lass ich eine Kiste von deinem scheiß Champagner mitgehen.“
Der aufgebrachte Schauspieler beachtete ihn gar nicht, als er dem Regisseur folgte.
Und dann war er alleine. Das Drehbuch in seiner Hand fühlte sich zentnerschwer an.
Er ging hinüber zum Swimmingpool, betrachtete die DVD-Hülle, die auf dem Wasser schaukelte. Das war es. Ein deutlicheres Zeichen brauchte er nicht.
Er holte aus, um sein Drehbuch in den Pool zu werfen. Da zupfte ihn jemand am Hemd.
Es war das Mädchen.
„Wolltest du ihm das geben?“
„Was?“, fragte er geistesabwesend.
Sie deutete auf sein Drehbuch.
„Es kommen immer wieder irgendwelche Schauspieler oder Leute mit Filmideen her und glauben, das bringt was. Aber das tut es nie. Im Gegenteil, er macht sich darüber jedes Mal lustig.“
„Woher weißt du das?“
„Ich bin Zoe Steiner. Er ist mein Vater. Wenn du es mir dalässt, dann geb ich es ihm. Ich werd sagen, ich hab gesehen, wie es jemand dem Bitlinger gegeben hat, und hab es ihm aus der Tasche genommen, als er gegangen ist. Dann interessiert es ihn sicher. Er hasst den Bitlinger, weil der ihn bei einem Filmprojekt unterboten hat.“
Er war zu perplex, um zu antworten.
Sie nahm ihm das Drehbuch einfach aus der Hand, grinste und sagte: „Wir Erdbeeren müssen doch zusammenhalten.“
Dann schlüpfte sie zurück ins Wohnzimmer und war in der tanzenden Menschenmenge verschwunden.
***
Die Morgendämmerung setzte ein, doch sie konnte noch immer nicht schlafen. Mit dem Koks hatte sie es ein bisschen übertrieben, aber wenn sie jetzt einen Downer nahm, würde sie den ganzen Tag flachliegen. Die letzten Gäste waren vor zwei Stunden gegangen. Das Wohnzimmer sah aus wie ein Schlachtfeld. Mit dem Wolkenbruch hatte niemand gerechnet.
Und nachdem dann auch noch die Barkeeper einfach um Mitternacht abgehauen waren, hatten alle begonnen, sich die Drinks selbst zu mixen. Zum Glück hatte sie in weiser Voraussicht einen ganzen Putztrupp für heute bestellt. Obwohl Alexander protestiert hatte, dass sie sich das sparen könnten, wenn sie beide der Frau Ilda helfen würden. Doch darauf fiel sie nicht mehr rein. Er hätte dann doch wieder was wahnsinnig Wichtiges zu tun und sie wäre allein mit der sechzigjährigen Haushaltshilfe und könnte sich abrackern. Sie zog den Bademantel fester, dieses blöde Paillettenkleid hatte ihr in die Achseln geschnitten. Außerdem brannten ihre Füße höllisch, ihre Zehen waren ganz rot und gequetscht von den High Heels.
Sie nahm sich eine halb volle Flasche Champagner und öffnete die Terrassentür. Die Luft war frisch, der kühle Stein fühlte sich gut an unter den Sohlen.
Der Sonnenaufgang färbte den Himmel über dem Pool in einem satten Orange. Sie würde jetzt ihre Füße reinhängen und einfach warten, bis die Müdigkeit einsetzte.
Irgendwas lag da im Wasser. Etwas Dunkles. Ohne Kontaktlinsen und Brille konnte sie nicht erkennen, was da im Pool schwamm. Sie trat näher.
Der grelle Schrei, der ihr entfuhr, als sie den ungeschickten Kellner von gestern Abend tot im Pool treiben sah, weckte das ganze Haus.
WIEN – Tragödie bei Promi-Party
Es sollte die Party des Jahres werden. Der berühmte Film- und TV-Regisseur Alexander Steiner („Das letzte Wiedersehen“ gewann den deutschen Filmpreis, Anm. d. Red.) und seine Frau Sybille gaben ihr alljährliches rauschendes Fest. Unter den Gästen des beliebten Ehepaars war zahlreiche Prominenz aus Medien, Politik und Wirtschaft (siehe Bericht Chronik). Doch der Schock am nächsten Morgen machte die schönen Erinnerungen zunichte.
„Im ersten Moment dachte ich, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt“, sagte Sybille Steiner, die den Toten fand. „Es war einfach schrecklich, wie er im Wasser trieb. Den Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen.“
Über die Identität des Opfers gibt es keine Angaben. Der Mann war keiner der Gäste, und es ist noch unklar, ob es sich bei ihm um einen Angestellten der Catering-Firma handelte. Auch die Frage nach Fremd- oder Eigenverschulden muss erst von der Polizei geklärt werden.
„Ich hoffe, wir finden bald Antworten“, sagt Alexander Steiner. „Zurzeit stecke ich in den Dreharbeiten meiner neuen Serie. Aber ich werde natürlich jederzeit für die Aufklärung zur Verfügung stehen.“
Vor einer Woche erst haben die Aufnahmen zu „Die Liebenden“ (eine Romanze zwischen einer Jüdin und einem Offizier der SS während des Zweiten Weltkriegs) in Wien begonnen, mit den hochkarätigen Schauspielern Anna Ferry und Hermann Thiel.
1
„Augen schließen. Mit dem nächsten Ausatmen stellt euch vor: Ihr fließt in die Matte, auf der ihr liegt. Jede Zelle eures Körpers löst sich auf. Haltet nichts zurück. Wenn Gefühle hochkommen, lasst sie raus. Seid laut. Gebt euch hin.“
Als hätten alle nur auf ein Kommando gewartet, ging das Stöhnen los. Jammern, Klagen, Seufzen. Es hörte sich nach einer Mischung aus Gruppensex und Begräbnis an.
Toni stieß ein halbherziges „Ohhh“ aus, während sie zur Uhr über der Tür blinzelte. Der Termin bei dem Privatdetektiv war erst in zwei Stunden, trotzdem hatte sie dieses drängende Gefühl, sie könnte ihn verpassen. Und das durfte sie auf keinen Fall.
„Die Uhrzeit ist egal, Antonia. Loslassen“, bellte die Schmitz. Sie war die Leiterin der Schauspielschule und eine gute Lehrerin, aber wehe, jemand hielt sich nicht an ihre Anweisungen. Und Toni stand durch ihre vielen Fehlstunden der letzten vier Wochen sowieso schon auf der schwarzen Liste.
Lena auf der Matte rechts neben ihr stieß ein leises Grunzen aus – ihr Geheimcode. Lena sagte immer, wenn die Schmitz wütend wurde, hatte sie was von einem wildgewordenen Eber.
Toni unterdrückte ein Lachen und schloss rasch die Augen. Sie nahm einen tiefen Atemzug und versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, was sie dem Detektiv alles sagen wollte. Und da passierte es.
Obwohl Felix bereits einen Monat fort war, konnte sie ihn vor sich lächeln sehen. Als hätte er ein Trugbild in ihrem Gedächtnis hinterlassen.
Wie dieses Jesus-Sehtestbild aus dem Internet, von dem Lena so begeistert war. Das man nur lange genug ansehen muss, damit es wieder auftaucht, wenn man auf einen hellen Untergrund sieht. Felix strahlte sie über das ganze Gesicht an. Dieses erste Lächeln, das sie buchstäblich und entsetzlich kitschig ins Herz getroffen hatte, obwohl sie von sich selber wirklich niemals als Romantikerin sprechen würde. Mit den kleinen Fältchen, die sich wie Astgabeln um seine Augen kräuselten, den rosigen Lippen im dunklen Dreitagebart. Wie Himbeeren und Schokolade.
Vor neun Monaten, als er im Café gesessen hatte, über den Laptop gebeugt, hatte sie es zum ersten Mal gesehen. Er war vertieft in seine Arbeit und zusammengezuckt, als sie ihn gefragt hatte, was er trinken wollte.
„Hast du mich erschreckt“, hatte er gesagt, sie angesehen und im nächsten Moment gestrahlt. Als wäre sie jemand, auf den er schon sehr lange wartete.
„Sorry. Soll ich wieder gehen und noch mal kommen?“
Sein leuchtendes Gesicht mit den zu einer stummen Frage hochgezogenen Augenbrauen wirkte auf sie wie ein Schaufenster zu Weihnachten für ein Kind. „Dann wärst du vorbereitet.“ Sie trat einen Schritt Richtung Theke.
„Nein, danke.“ Sein noch breiteres Lächeln, während er eine Hand auf sein Herz legte. „Jetzt ist der Schaden schon angerichtet.“ Gespieltes Keuchen. „Darf ich den Namen meiner Beinahe-Killerin erfahren?“
„Toni.“
Wieder sein fragender Blick.
„Von Antonia.“
Normalerweise sagte sie das nicht dazu. Ihr Herz flatterte, während er sie länger ansah, als die Gäste es normalerweise taten. Und sie fing an zu grinsen, sie konnte gar nichts dagegen tun.
„Danke. Ich bin Felix. Von Felix.“
„Und was möchte Felix von Felix auf diesen Schreck trinken?“
„Was empfiehlt Toni von Antonia mir denn?“
Noch am selben Abend hatten sie sich verabredet. Danach war alles sehr schnell gegangen, als hätte es schon einen vorgefertigten Felix-und-Toni-Plan gegeben, den sie nur noch erfüllen mussten.
Das letzte Mal, als sie ihn gesehen hatte, war er am Morgen vor vier Wochen in der Tür gestanden, in seinen grünen Boxershorts und dem ausgeleierten weißen T-Shirt. Die dunklen Haare ganz zerzaust. Sie war zu spät zum Dramatikunterricht, konnte wie üblich weder Handy noch Schlüssel finden. Er hatte ihr beides in die Hand gedrückt und nachgerufen, dass sie nicht zu viel lernen sollte. Sie hatte sich umgedreht und gegrinst. Weil seine Verführungskünste an diesem Morgen der Grund waren, warum sie es jetzt so eilig hatte.
Natürlich hatte sie keine Ahnung gehabt, dass es das letzte Mal sein sollte. Das letzte Mal Sex, das letzte Mal Felix, das letzte Mal, dass sie ausreichend Geld hatte und sich keine finanziellen Sorgen machen musste.
Ihr Gedankenkarussell fing an, sich zu drehen.
Hatte sie etwas übersehen? Nein, es war unmöglich, dass alles von Anfang an sein Plan gewesen war. Und seine ganze Zuneigung nur vorgespielt. Es musste etwas anderes sein. War er in ernsthaften Schwierigkeiten? War er irgendwo und brauchte ihre Hilfe?
Vielleicht war das der Grund, warum sie sich seit einiger Zeit verfolgt fühlte. Und kein „Hirngespinst“, wie Lena das immer nannte, weil sie nie jemanden entdecken konnte, wenn Toni sie darauf aufmerksam machte.
Ein Schluchzen neben sich riss Toni aus den Gedanken, auf die sie sowieso keine Antwort hatte. Es war Lena. Und es klang nicht nach einem Stöhnen, sondern als würde sie weinen.
Toni drehte sich zur Seite, Lenas rote Locken lagen quer über ihrem Gesicht, ihr Oberkörper bebte. So vorsichtig, dass es die Schmitz nicht sehen konnte, tippte Toni ihre Freundin an. Lena drehte den Kopf zu ihr, die Tränen hatten ihre Wimperntusche verschmiert. Sie formte Worte mit ihren Lippen, doch Toni konnte nicht erkennen, was sie sagen wollte.
„Was ist –“, begann Toni leise, da donnerte die Schmitz bereits: „RUHE! KEINE INTERAKTION. SONST FLIEGST DU RAUS, ANTONIA. UND DU WEISST, WAS DAS FÜR DICH BEDEUTET!“
Lena presste die Lippen zusammen, schüttelte leicht den Kopf und schloss die Augen wieder.
War irgendwas passiert? Etwas, das Toni nicht mitbekommen hatte, weil sie so mit sich, Felix, ihrer Großmutter und den Geldsorgen beschäftigt gewesen war?
„DU AUCH, LENA!“
Das war beunruhigend. Lena war immer gut drauf, nichts schien sie wirklich zu erschüttern. Und sie weinte noch immer, Toni konnte es ganz deutlich hören.
Sie wartete, bis sich die Schritte der Schmitz entfernten, und schob ihren Arm in Lenas Richtung, bis sie ihre Hand spürte. Tonis Finger glitten zwischen die ihrer Freundin und hielten sie fest.
„SO, DAS WAR’S, ANTONIA. DU VERLÄSST DEN UNTERRICHT!“, schrie die Schmitz. „RAUS!“
Eine dreiviertel Stunde später stieg Toni aus der U4 und lief Richtung Auhofstraße. Sie war ein wenig zu früh dran, was fast schon eine Ironie war, denn Toni litt an „Zuspätkommeritis“, wie sie selbst diagnostiziert hatte. Eine Kindergartengruppe in Zweierreihe kam ihr aufgeregt entgegen. Sie schnappte die Worte „Zoo“ und „riesiges Löwenkacka“ auf und musste grinsen, als die Kinder die Ausmaße des Haufens in großen Gesten darstellten, während ihre Betreuer die Augen verdrehten. In der Schauspielschule hätte es für so eine Szene Applaus gegeben.
Toni zwinkerte den Kindern zu, die an ihr vorbeigingen. Die Sonne brannte, sie hatte sich eindeutig zu warm angezogen und schlüpfte aus der Jeansjacke.
Es war nur ein winzig kleiner Moment, in dem sie sich umgedreht hatte. Aus den Augenwinkeln sah sie jemanden in einem schwarzen Sweatshirt. Eine große Gestalt mit einer Sonnenbrille und einer in die Stirn gezogenen schwarzen Kappe, unter der blonde Haare hervorlugten. Der Mann hatte irgendwas in der Hand – vielleicht ein Handy oder einen Fotoapparat –, das in Tonis Richtung zeigte. Eines der Kinder vor ihr quietschte, deutete in Richtung Kanaldeckel, in dem gerade der Schwanz einer Ratte verschwand. Toni war kurz abgelenkt. Sofort sah sie wieder zurück. Der Mann war verschwunden.
Ihr wurde heiß. War er ihr gefolgt? Hatte sie beobachtet? Wieso sollte ein fremder Mann Fotos von ihr machen?
„Schau mal, es ist kein Wunder, nach dem, was dir passiert ist“, hatte Lena erst letztens gesagt, als sich ein Verdacht wieder als unbegründet herausgestellt hatte. „Vielleicht sucht dein Unterbewusstsein einen Ausweg, um die Wahrheit nicht akzeptieren zu müssen. Hast du überhaupt irgendwann mal durchgeschlafen, seit –?“
Weiter hatte Lena nicht sprechen müssen, denn Toni hatte bereits den Kopf geschüttelt. Wegen „seit“ war sie nun hier, weil sich seit „seit“ alles geändert hatte. Die Müdigkeit der vergangenen Wochen steckte ihr in den Knochen. Letzte Nacht hatte sie noch weniger geschlafen als sonst. Blendete sie all ihre Sorgen aus, dann musste das eben ein Tourist gewesen sein, Schönbrunn war schließlich ganz in der Nähe. Trotzdem drehte Toni sich auf dem Weg noch ein paar Mal um, ganz plötzlich, als wäre ihr etwas eingefallen, das sie vergessen hatte. Doch außer einer alten Frau, die erschrocken zusammenzuckte, war niemand hinter ihr.
Und dann war sie am Ziel.
Das Gebäude sah herrschaftlich aus. Roter Backstein, hohe Fenster, zwei Treppen, die zum Rundbogen-Eingang führten. Toni war so nervös, dass sie beim Überqueren erst in der Mitte der Straße überprüfte, ob ein Auto kam.
Auf dem Schild der Detektei war das „3. Stock“ durchgestrichen, stattdessen war mit Edding ein Pfeil gemalt und darunter stand „Innenhof, 1. Stock“.
Dort befand sich ein weiteres Haus, baufällig und schäbig. Als hätte man es hier hinten versteckt, weil es so erbärmlich aussah. Es schien nachträglich errichtet worden zu sein, wahrscheinlich in den Fünfzigerjahren. Abgebröckeltes, graues Mauerwerk. Alte Fenster mit abgesplitterten Holzrahmen. Im Erdgeschoss ein paar eingeschlagene Scheiben, die notdürftig mit Karton zugeklebt waren. Eine dreifarbige Katze schlich an der Mauer entlang und verschwand um die Ecke.
Als Toni das Haus betrat, stach ihr eine Mischung aus Urin und Verwesung in die Nase. Neben der Tür im schmalen Korridor des ersten Stocks stapelten sich Akten wie schiefe Türme an den Wänden entlang.
„Hallo?“
„Hinter der braunen Tür. Kommen Sie rein“, antwortete eine knarrende Stimme.
Wahrscheinlich war das Fernsehen daran schuld, dass sich Tonis Vorstellungen eines Privatdetektivs in mit Klischees gespickten Superlativen bewegten. Athletisch, damit er jede Verfolgungsjagd zu Fuß aufnehmen konnte. Durchtrainiert, damit ihm nie die Kondition ausging. Und attraktiv, damit alle Frauen, die wegen ihres untreuen Ehemanns seine Dienste in Anspruch nahmen, in seinen starken Armen Trost fanden. Mit Abweichungen nach unten und oben hatte sie gerechnet. Aber nicht mit diesem mürrisch dreinblickenden Mann, der hinter dem mit Akten und Papieren vollbepackten Schreibtisch saß.
Dem auffallend hübschen antiken Schreibtisch. Mit Marmorplatte, goldenen Löwenköpfen an den Ecken und kunstvoll geschwungenen Tischbeinen mit Goldmuster. Hinter ihm an der Wand stand eine längliche schwarzlackierte Kommode mit eingelassenen goldenen, blauen und roten Vögeln. Toni sah sich um.
Das kleine Büro war vollgestopft mit diesen goldverzierten Schränken, einem Sekretär aus rötlich scheinendem Holz mit unzähligen kleinen Perlmuttladen, etwas, das aussah wie ein mit Blättern aus Porzellan dekorierter Schminktisch.
Da waren Beistelltische mit weißen Marmorplatten, eine hellblaue Chaiselongue mit goldenen Fransen. Alle Möbel wahrscheinlich aus der Kaiserzeit. Sogar ein riesiger Stuhl mit rotem Samtbezug und Goldrahmen stand im Büro, wie ein Thron. Als hätte er Schönbrunn geplündert. Jedes Möbelstück musste ein Vermögen wert sein – wenn es denn echt war. Und auch hier waren jede Menge Aktenordner, sie türmten sich neben den Möbeln. Der Detektiv musste sein gesamtes Hab und Gut aus einem wohl größeren Büro im dritten Stock in diese viel zu kleine Kammer hier übersiedelt haben.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte er. Obwohl Toni sonst ziemlich gut darin war, das Alter von jemandem zu schätzen, konnte sie bei ihm nicht sagen, wie alt er war.
„Sind Sie der Privatdetektiv?“
Er zog die Mundwinkel hoch zu einem Grinsen. Seine erstaunlich blauen Augen lachten nicht.
„Auf jeden Fall bin ich nicht die Vorzimmerdame. Treten Sie bitte ein.“
Ein elegant geschwungener Scheitel teilte sein silbergraues Haar. Dazu hatte er eine dieser halben Lesebrillen, über deren oberen Rand er sie prüfend ansah. Sofort fühlte sie sich ins Gymnasium zurückversetzt. Als wäre sie erneut in die Direktion gerufen worden: Toni war schon wieder frech.
Der Aschenbecher mit einer nicht angezündeten Zigarette am Tisch passte allerdings nicht ins Bild – in der Schule hatte striktes Rauchverbot geherrscht.
Der Detektiv kratzte sich am Kinn, schob ein paar Zettel vor sich herum, schien jedoch nicht zu finden, was er suchte. Obwohl er saß, konnte sie erkennen, dass er groß sein musste. In der Armbeuge seines weißen Hemds war ein rötlicher Fleck zu sehen.
„Wir haben einen Termin, ich bin Toni Lorenz.“
Sie trat zum Schreibtisch, schüttelte ihm die Hand. Ein warmer, fester Händedruck.
„Brehm. Sie können stehen oder sitzen, wie Sie möchten. Was kann ich für Sie tun?“
Die Chaiselongue war voll mit Akten, darum nahm sie auf dem Thron Platz. Sonnenlicht beleuchtete das Fenster hinter ihm, es war dreckverschmiert.
Wie sollte sie anfangen? Auf der Suche nach den richtigen Worten fiel ihr Blick auf ein Foto, das auf seinem Schreibtisch unter einem kleinen Stapel hervorlugte. Zwei junge Männer, Polizisten in Uniform, die Daumen in den Gürtelschnallen.
„Sind Sie das auf dem Foto?“
Er folgte ihrem Blick.
„Nein.“
Er schob es in den Stapel zurück.
„Die ersten fünfzehn Minuten Beratung sind kostenlos, danach rechne ich im Dreißig-Minuten-Takt ab. Worum geht es?“
Toni verstand den Hinweis: Brehm war nicht an Small Talk interessiert.
„Es ist kompliziert …“
Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück, nahm die Brille ab und kaute an einem Bügel herum.
„Komplizierte Fälle sind mein Spezialgebiet.“
Sie musste lächeln.
„Das klingt wie Detektivjargon.“
„Worum es auch immer geht – unabhängig, ob der Auftrag zustande kommt oder nicht –, es bleibt alles unter uns.“
Sie nickte, ihre Hände fingen leicht an zu zittern.
Er sah sie erwartungsvoll an. Irgendwie hatte sie sich das einfacher vorgestellt. War es wirklich die richtige Idee, einen Privatdetektiv miteinzubeziehen? Aber was sollte sie sonst tun? Sich selbst belügen, alles wäre nur ein Missverständnis und Felix würde in Kürze wieder zu Hause auf sie warten, mit seinen Gnocchi mit Thunfischsauce, das Einzige, was er richtig gut kochen konnte? Und in der Zwischenzeit, wie wollte sie da für ihre Großmutter die Seniorenresidenz in Baden bezahlen? Geschweige denn ihre eigenen Kosten decken?
Der Detektiv räusperte sich. Ein dezenter Hinweis, dass die Uhr tickte. Fünf, vier, drei, zwei, eins – los.
Toni wollte gerade ansetzen, da war ein lautes Miauen zu hören. Es kam aus dem Gang vor der Tür. Gefolgt von einem Kratzen. Brehm sah sie unbeirrt an. Das Miauen wurde ein Jammern. Schmerzvoll und durchdringend.
„Da war eine Katze, ich hab sie beim Reingehen gesehen“, sagte Toni und deutete zur Tür. Brehm seufzte, er hob die Hand, als wollte er abwinken, doch ein neues Wehklagen drang von draußen herein.
„Entschuldigen Sie mich bitte kurz.“
Er stand angestrengt auf, so wie jemand, der sehr, sehr müde ist und ebenfalls nächtelang nicht geschlafen hatte. Schwerfällig schlurfte er zur Tür. Als hätte er Gewichte an den Beinen. Toni konnte sich nicht vorstellen, dass Brehm eine Verfolgung auch nur fünf Meter schaffen würde. Aber wahrscheinlich arbeiteten Detektive nicht alleine, und er war nur für die Büroangelegenheiten zuständig. Das hoffte sie zumindest.
Vor der Tür saß die Katze von vorhin und sah mit erwartungsvollem Blick zu Brehm hoch.
„Es tut mir leid, ich hab nichts für dich“, flüsterte er mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Genervtheit. „Morgen. Versprochen.“
Die Katze miaute. Es klang wie ein Protest.
„Ich weiß. Vielleicht findest du eine Maus.“
Sie miaute noch lauter. Toni holte die halb volle Packung Chips aus der Tasche, stand auf und ging zu den beiden.
„Hier. Vielleicht mag sie was davon? Ist zwar nicht gesund, aber ich hatte mal eine Katze, die war ganz wild drauf.“
Brehms Blick auf die Chips wirkte so sehnsüchtig wie der von Lena, wenn sie diesen neuen Superman-Darsteller sah. Jetzt wo sie neben ihm stand, wirkte er wie ein Riese.
Er nickte, griff in die Packung, beugte sich runter und wollte ein Stück vom Kartoffelchip abbrechen. Doch die Katze stürzte sich sofort darauf, als hätte sie tagelang gehungert.
„Ist das Ihre?“, fragte Toni.
„Nein, ich geb ihm nur manchmal was.“
„Ihm? Hat er einen Namen?“
Brehm sah sie überrascht an.
„Kater.“
„Kater?“ Toni lächelte. „Wie in ‚Frühstück bei Tiffany‘?“ Das war der Lieblingsfilm ihrer Großmutter. Dutzende Male hatten sie ihn gemeinsam gesehen, Toni konnte ganze Szenen auswendig. Vielleicht war sie hier doch an der richtigen Adresse.
Brehm aber verzog nur den Mund, ohne zu antworten, gab ihr die Packung zurück und schloss die Tür. Genauso müde schlurfte er zurück zum Schreibtisch, und auch Toni nahm wieder Platz. Wusste er gar nicht, was „Frühstück bei Tiffany“ war? Oder war das nur wieder ein Hinweis, dass sie sich beeilen sollte?
„Wo waren wir gerade?“, fragte er.
„Mein Freund ist verschwunden, Felix Meier.“
Sie hatte es schnell hinter sich gebracht, wie ein Pflaster, das man herunterreißt. Brehm schien nicht sonderlich überrascht. Wahrscheinlich hörte er solche Geschichten öfter.
„Wann?“
„Vor einem Monat. Wir wohnen seit fast einem Jahr zusammen. Am Morgen hab ich mich von ihm verabschiedet, und als ich wieder nach Hause gekommen bin, war er weg.“
„Was genau meinen Sie mit verschwunden?“
„Er ist weggegangen und nicht mehr wiedergekommen.“
„Ein Unfall oder dergleichen ist ausgeschlossen?“
Sie nickte, versuchte, nicht an die Nachricht auf dem Küchentisch zu denken, die sie nicht verstanden hatte. Es tut mir leid, hatte er geschrieben, nichts weiter. Als hätte er nur vergessen, Milch zu kaufen oder den Müll runterzubringen. Sie hatte zwei Tiefkühlpizzen in den Ofen geschoben, eine Flasche Weißwein eingekühlt, war duschen gegangen. Erst als sie in ihrem Bademantel auf der Couch saß und er noch immer nicht da war, rief sie ihn an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ihr wurde mulmig, wenn sie daran dachte, ihr Puls beschleunigte sich.
„Er hat seine Sachen mitgenommen und …“ – Ihr Kinn zitterte. Sie würde nicht wieder weinen, auf keinen Fall. – „… und er hat meine Bankomatkarte mitgenommen. Alles abgehoben. Auch alle Schmuckstücke meiner Großmutter, die ich für sie aufbewahre, sind weg. Und er hat den Safe leergeräumt.“
Es hörte sich noch immer an wie ein Fehler. Als würden diese Worte und Felix gar nicht zusammenpassen.
„Wo befindet sich der Safe?“
„Zu Hause. Er ist in der Wohnung meiner Großmutter, sie hat ihn wegen der Wirtschaftskrise vor ein paar Jahren in die Wand einbauen lassen. Sie dachte, das Geld wäre sicherer in den eigenen vier Wänden.“
Brehm machte sich Notizen.
„Welche Summe?“
„Alles zusammen etwa dreihundertachtzigtausend Euro.“ Sie sah das deutliche Zucken in Brehms Gesicht. Gleich würde er sie fragen, ob sie allen Ernstes diese Summe bei sich zu Hause aufbewahrt hatte.
„Wie viel der Schmuck wert ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, es muss viel sein“, sagte sie rasch. Der ist eine Wertanlage, hatte Oma immer gesagt. Und darauf bestanden, den Schmuck bei Toni zu lassen, statt ihn in die noble Seniorenresidenz in Baden bei Wien mitzunehmen. Die Toni bald nicht mehr zahlen konnte. Aber davon wusste Oma natürlich nichts. Toni spürte, wie ihre Augen sich mit Tränen füllen wollten, und kniff sich in die Zeigefingerkuppe, um nicht zu heulen.
„Haben Sie und Ihre Großmutter Anzeige erstattet?“
„Nein. Wir wohnen nicht mehr zusammen. Sie ist vor zwei Jahren ausgezogen.“
„Wegen Ihrem Freund?“
„Was? Nein, nein, den gab es damals noch gar nicht. Die Wohnung ist im vierten Stock ohne Lift, und es wurde ihr zu beschwerlich.“
Das war nur die halbe Wahrheit. Sie hätten genauso gut gemeinsam umziehen können. Doch Oma brauchte nach einem Sturz immer mehr Hilfe und wollte weder Toni ein Klotz am Bein sein noch eine Pflegerin anstellen, die sie herumkutschierte. „Wie sieht das denn aus, wenn mich dann so eine Matrone zu meinen Rendezvous geleitet?“, hatte sie gesagt, sich ihre weißen hochgesteckten Haare zurechtgezupft, den perlmuttfarbenen Lippenstift nachgezogen und ihr kehliges Lachen ausgestoßen. „Nein, da suche ich mir lieber gleich ein hübsches Plätzchen mit ein paar anständigen Witwern.“
Es war alles geplant: Toni sollte ihr aus den Ersparnissen monatlich eine Art Taschengeld überweisen, für Friseur, Kosmetikerin, Bücher – Oma verschlang Krimis geradezu – und Konditorei- und Casinobesuche. Außerdem zahlte sie die Miete der Wohneinheit in der Residenz. Auf keinen Fall wollte Oma dem Heim die Finanzen offenlegen. – „Das kennt man doch, dann krallen die sich alles, und wir sehen keinen Cent mehr.“
Es gab nur noch sie beide, und so war es ihr wichtig, ihre Enkelin gut versorgt zu wissen. „Meine liebe Toni, du bist ein junges Vogerl und sollst fliegen und dich nicht um mich alten Adler kümmern“, hatte sie bei ihrem Auszug gesagt. Sie hatten beide geheult.
Zu Beginn war es Toni schwergefallen. Sie liebte ihre Großmutter, und obwohl sie in den ersten zwei Tagen das Gefühl der Freiheit genoss, folgte eine dunkle, einsame Phase. Doch ihrer Großmutter schien es in der Seniorenresidenz wirklich zu gefallen. Sie blühte auf. Und das half Toni loszulassen. Nach den Startschwierigkeiten war sie geflogen. Freunde, Partys, Schauspielschule, die große Liebe. Und dann diese Bruchlandung. Ja, es war die richtige Entscheidung gewesen hierherzukommen.
„Was macht er beruflich?“, fragte Brehm.
„Homepages. Layouts, die man dann kaufen kann.“
Felix war mit seinem MacBook verwachsen gewesen, als wäre es seine dritte Hand.
„Und haben Sie das alles bei der Polizei gemeldet?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich wollte nur eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber der Beamte meinte, es hat in diesem …“, sie machte Gänsefüßchen in die Luft, „… Ich-hole-nur-mal-Zigaretten-Fall wenig Sinn.“
„Warum haben Sie nichts von dem Diebstahl gesagt?“
Toni zuckte mit den Achseln. Nicht, weil sie es dem Detektiv nicht sagen wollte. Sondern sie zweifelte daran, dass er es verstehen würde.
Brehm hob eine Augenbraue, schürzte die Lippen, als würde er auf eine Erklärung warten. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und verschränkte die Finger.
„Sie hoffen, dass sich alles als Missverständnis rausstellt? Oder Ihr Freund sich in Schwierigkeiten befindet, und deshalb wollen Sie ihm nicht noch mehr Ärger bereiten?“
Sie senkte den Blick – überrascht, wie sehr er ins Schwarze getroffen hatte.
„Auch wenn ich ihn anzeige, was sollte das bringen? Die Polizei hat sicher Wichtigeres zu tun, als ihn zu suchen.“ Sie merkte selbst, wie wenig überzeugend es klang.
Natürlich war das eine Ausrede. Aber es ging nicht nur um Felix. Erstattete sie Anzeige, würde ihre Großmutter davon erfahren. Und die Residenz. Toni wollte sich nicht ausmalen, wie die Leitung auf finanzielle Nöte reagieren würde. Und ihre Großmutter spielte dort mit Freundinnen Canasta und Schnapsen, sie war die „Grande Dame“ mit mehreren Verehrern, die sie zum Tanzen und in den Park zum Flanieren ausführten.
Toni war zu ihrer Oma gekommen, da war sie gerade mal vier Jahre alt gewesen. Sie war nicht nur bei ihr aufgewachsen, sondern ihre Oma hatte sich um Toni gekümmert, als wäre sie ihre eigene Tochter.
„Und Sie wollen nun, dass ich Herrn …“
„Felix Meier.“
„Dass ich ihn finde und dabei das übliche amtliche Prozedere übergangen wird, damit Sie ohne viel Aufhebens Geld und Schmuck wiederbekommen.“
Sie zuckte zurück, verknotete ihre Finger ineinander. Das klang so einfach.
„Und ich will wissen, warum“, sagte Toni.
Brehm setzte an, um etwas zu erwidern, doch ein lautes Grummeln erfüllte plötzlich den Raum. Wie ein kleiner Bär, der sich aus einer der Schreibtischschubladen meldete und befreit werden wollte. War das der Kater? Hatte er sich hereingeschlichen? Brehm sah sie etwas verspannt an.
„Eine Ahnung, wo Herr Meier sich aufhalten könnte?“, fragte er rasch.
„Nein, aber ich glaube nicht, dass er sehr weit weg ist.“
„Weil …?“
Sie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. „Sei nicht so naiv“, hatte Lena gesagt, „nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass er einfach so abgehauen ist.“
Der kleine Bär meldete sich erneut.
„War das wieder der Kater?“
„Pardon.“ Brehm hielt sich den Bauch, es sah aus, als wollte er ihn einziehen. „Das … ich bin auf Diät.“
Darum also sein Blick auf die Chips. Sie nahm die Packung wieder aus der Tasche, dazu noch einen Marsriegel und ein Päckchen Erdnüsse und hielt dem Detektiv die Snacks entgehen.
„Ich hab immer was dabei, suchen Sie sich was aus.“
Sein Bauch grummelte wieder, er schien zu zögern.
„Oder wollen Sie lieber die?“ Toni holte Schokorosinen hervor. Brehm hob die Augenbrauen. „Ich müsste auch noch irgendwo Pistazien haben“, sagte sie.
Er sah sie fragend an. Oder war das ein Lächeln, das er unterdrückte? Sie würde sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie immer einen beachtlichen Vorrat mit sich herumschleppte. „Wo isst du das alles hin?“, war eine Frage, die sie seit ihrer Kindheit kannte und schon nicht mehr hören konnte.
Fast glaubte sie, er würde etwas annehmen, doch dann schüttelte er den Kopf.
„Danke, nein. Ich benötige noch einige Informationen, aber wenn Sie möchten, nehme ich Ihren Auftrag an. Und, ach ja, es gibt nur Fixpreise, kein Erfolgshonorar.“
Er sagte es so, als hätte sie etwas gewonnen, kramte in einer Schublade und reichte ihr eine mehrseitige Vertragsvereinbarung.
„Wie lange dauert das normalerweise?“, fragte sie.
„Kann ich noch nicht sagen.“ Brehm senkte seine Stimme, ein leiser Seufzer folgte. „Ich muss Sie vorwarnen, das kann emotional sehr belastend werden …“
Sie hörte ihm gar nicht mehr zu, als sie die Honorarauflistung sah. Das war zu viel Geld. Viel zu viel. Er schien es an ihrem Blick zu bemerken.
„Ich verstehe, dass Sie im Moment in einer finanziellen Notlage sind. Wenn Sie möchten, legen wir eine Pauschale fest“, sagte er etwas sanfter. „Was halten Sie von zweitausendfünfhundert Euro, Steuer extra? Sollte ich unter der Stundenanzahl bleiben, die diese Summe rechtfertigen würde, rechnen wir stundenweise ab. Ist es darüber, gilt die Pauschale.“
Sie schob ihm den Vertrag zurück. Lena hatte gesagt, er sei günstiger als die anderen. Was auch stimmte. Aber sie hätte sich seine Preisliste vorher selbst ansehen sollen.
„Ich habe im Moment nicht so viel Geld zur Verfügung. Aber wenn Sie Felix gefunden haben, dann …“
Er schüttelte den Kopf, noch ehe sie den Satz beendet hatte, und verschränkte die Finger über seinem Bauch, der wie auf Kommando wieder grummelte.
„Es tut mir leid, Ihnen das zu sagen, aber Sie müssen davon ausgehen, dass er Ihr Geld nicht mehr hat. Wieso kommen Sie eigentlich erst jetzt?“
„Wie bitte?“
„Ihr Freund ist vor einem Monat verschwunden, haben Sie gesagt. Warum erst jetzt?“
„Ich habe selbst versucht, ihn zu finden, aber –“, begann sie, doch in diesem Moment klopfte es an der Tür.
2
Edgar Brehm war mehr als genervt über die Unterbrechung. Es ging ihm miserabel. Und seine Alarmglocken schrillten bei diesem Fall. Da saß diese junge Frau mit ihren kurzen schwarzen Haaren und den riesigen grünen Augen und sah ihn gebrochen und gleichzeitig hoffnungsvoll an.
Als hätte er eine Lösung für ihr Problem. Er kannte solche Fälle, es waren häufig Frauen, die nicht wahrhaben wollten, was ihnen angetan worden war. Die nach einer Erklärung suchten, weil es einfach nicht sein konnte, dass sie sich so getäuscht hatten. Es brach ihm jedes Mal das Herz, wenn er so jemanden in seinem Büro vor sich sitzen hatte, während er den abgeklärten Detektiv gab.
Was sollte diese junge Frau von einem Mann, der keine Skrupel hatte, seiner Freundin das Geld und den Schmuck ihrer Großmutter zu stehlen, erwarten? Sie wirkte sympathisch, nicht dumm. Vielleicht etwas naiv, nein, gutgläubig. Aber sie war noch so jung, meine Güte, das war er auch einmal gewesen. Er sollte es ihr offen sagen: Wenn ihr Freund kein vollkommener Idiot war, dann hatte er sein Vorgehen höchstwahrscheinlich seit Langem geplant. Außerdem bezweifelte Edgar, dass sich der Schuft nicht schon früher unbemerkt aus dem Safe bedient hatte. Ein Safe. Wieso hatte sie das Geld nicht gleich unter dem Bett versteckt?
Toni ließ ihn nicht aus den Augen, ihr verängstigtes Lächeln machte ihn nervös. So sehr er ihr auch helfen wollte, er konnte es einfach nicht.
Dieser schäbige Freund hatte garantiert keinen Cent mehr von dem Geld, nach einem Monat, Herrgott. Vielleicht gab es noch eine reelle Chance, den Schmuck wiederzubekommen.
Und dennoch, sie hatte einfach nicht das, was Edgar im Moment am dringendsten brauchte: Geld.
Und überhaupt, wie sollte Edgar es anstellen, diesen Freund zu finden? Er konnte niemanden mehr engagieren, sein miserabler Gesundheitszustand kam jetzt auch noch dazu und ganz generell – hatte er nicht schon genug Probleme?
„Herein“, sagte er, doch nichts passierte. Wahrscheinlich der pickelige Fahrradbote, der immer Kopfhörer trug und wegen der Musik in seinen Ohren so schrie. Welche Klage, Anzeige, Geldforderung darf es denn heute sein? In den letzten paar Tagen musste sich viel Neues angehäuft haben.
Edgar stand vom Schreibtisch auf und ging zur Tür.
Doch statt des Boten stand da eine bildhübsche blond gelockte Frau mit glänzenden roten und verdächtig vollen Lippen, einer Stupsnase, prallen Wangen und Wimpern so dicht wie Fächer. Sie schaute ihn an, fast ängstlich. Er schätzte sie auf Ende dreißig, eindeutig untergewichtig. Bis auf die Oberweite, die wie ein Balkon herausragte. Obwohl Edgar sich nicht sonderlich für Mode interessierte, erkannte sogar er die Chanel-Logos auf ihrer schwarzen Handtasche und der funkelnden Gürtelschnalle. Dazu dieser Hauch von einem dünnen Mantel, dessen durchscheinend schwarzer Stoff mit lauter kleinen Cs aus Samt bedruckt war.
Für Edgar wirkte ihre Aufmachung wie ein Schaufenster in ihren Kontostand. Und der schien mehr als erfreulich zu sein.
„Ist hier das Detektivbüro?“, fragte sie leise.
Er nickte.
„Darf ich reinkommen?“
„Haben wir einen Termin?“
Dafür, dass er eine potenzielle Kundin vor sich hatte, klang Edgar nicht besonders freundlich. Sein Magen knurrte so laut, dass er selbst erschrak. So, das war’s, genug. Diese idiotische Diät, auf die man ihn im Krankenhaus gesetzt hatte, würde er noch heute beenden.
„Nein, tut mir leid“, flüsterte sie. „Ich dachte, vielleicht könnten Sie mich dazwischenschieben? Ich kann auch warten. Es ist dringend.“
Sie strich sich eine Locke hinters Ohr. Edgar sah den goldenen Ehering und einen Ring mit einem Brillanten von der Größe einer Murmel. Die Frau zog ihre Hand zurück, als sie seinen Blick bemerkte. Rasch senkte sie den Kopf und zog an ihrem Mantel, als müsse sie ihn richten. Ihr schüchternes Auftreten und ihr Bemühen, diese Verlegenheit zu überwinden, wirkten wie das genaue Gegenteil ihrer Aufmachung. War das gespielt oder echt? Edgar konnte es nicht sagen. Normalerweise war er gut darin, so etwas zu erkennen. Irgendwas in seiner Brust rumpelte. Das kam nicht vom Hunger.
Toni hatte ihn vorhin schon bei der Suche unterbrochen. Er musste jetzt endlich diesen Spray, den man ihm für den Notfall mitgegeben hatte, finden.
„Einen Moment bitte.“
Er schloss die Tür und wandte sich wieder der jungen Frau zu.
„Also, wie gesagt, Frau Lorenz, mein Angebot steht: zweitausendfünfhundert Euro.“
Die Enttäuschung in Tonis Blick war fast nicht auszuhalten. Brehms Herz rumpelte wieder, er musste sich setzen. Kaum nahm er Platz, stand sie auf, lehnte sich über den Tisch und reichte ihm die Hand. Ihr Händedruck war erstaunlich kräftig, ihr Mund zuckte, als würde sie noch etwas sagen wollen, aber es folgten keine Worte.
Nachdem Toni gegangen war, wühlte Edgar rasch durch die Papiere auf seinem Schreibtisch. Der Spray war nicht da. Aber er hatte ihn doch mitgenommen? Oder nicht? Machte jetzt nicht nur sein Kreislauf schlapp, sondern auch sein Hirn?
Er hatte keine Wahl, darum musste er sich später kümmern. Er öffnete die Tür und bat die Blonde einzutreten. Mit ihr wehte eine Duftwolke herein wie eine gezuckerte Blumenwiese. Sie schien – im Gegensatz zur jungen Frau vorhin – weder von den antiken Möbeln noch von den Papierstapeln Notiz zu nehmen.
Im Gegenteil, sie suchte sich Platz in der Mitte des Raums, stellte sich ein wenig aufrechter hin, ein Bein vor dem anderen, eine Hand an der Hüfte. Als wäre sie auf einem roten Teppich und die Blitzlichter der Fotografen würden jeden Moment losgehen. Kurt wäre begeistert von ihr gewesen. Er hatte sich mit Mode ausgekannt und manchmal beim Anblick eines Kleids ganz verzückt irgendwelche Designernamen ausgerufen. Edgar erkannte oft an den Reaktionen der Klienten, dass sie dachten, Kurt wäre homosexuell. Hinterher hatten die beiden sich immer darüber amüsiert, denn es war genau umgekehrt: Kurt war seit dreißig Jahren verheiratet. Und Edgar war vor mehr als zwanzig Jahren nach einem Eklat von der Polizei gekündigt worden. Als Draufgabe hatten sie seine Homosexualität auch noch dafür benutzt, ihm eine angebliche Affäre mit einem Tatverdächtigen unterzuschieben.
Nach seiner Berufserfahrung als Detektiv tippte Edgar bei der Chanel-Frau auf einen untreuen Ehemann. Ihrer Aufmachung nach vielleicht jemand in der Öffentlichkeit, was erklären würde, warum sie ihn ausgewählt hatte und nicht eine der renommierten Detekteien in der Innenstadt.
„Was kann ich für Sie tun, Frau …?“
Sie beendete seine Frage nicht. Er bot ihr einen Platz an, doch Chanel wollte lieber in ihrer Pose stehen bleiben. Sie zog ein Kuvert aus der Handtasche.
„Sie genießen in der Branche meines Mannes einen sehr guten Ruf.“
Sie sagte es so, als müsste er wissen, was damit gemeint war.
„Welche Branche?“
„Die Filmbranche.“
Er tat, als wäre ihm damit alles klar: „Ach, ja.“
Obwohl er natürlich wusste, dass sie nicht ihn meinte. Sie meinte Kurt.
„Darum werde ich auch ganz offen mit Ihnen reden. Bitte werfen Sie einen Blick in das Kuvert und sagen Sie mir, ob das reicht. Für Ihre Arbeit, Ihre absolute Diskretion und auch dafür, dass Sie …“, sie schlug die Augen nieder, „… dass Sie auf eine offizielle Rechnung verzichten.“
Würde seine Detektei florieren, wäre das ein gekonnter Schachzug der Konkurrenz, ihn dranzukriegen. Doch da der letzte geglückte Auftrag so viele Monate zurücklag, nickte Edgar nur. Schon als sie ihm das Kuvert gab, spürte er das Bündel darin. Er sah hinein. Lauter grüne Scheine, das mussten um die zehntausend Euro sein.
„Es reicht“, sagte er heiser.
Die Frau nickte und nahm nun doch Platz. Erst jetzt bemerkte Edgar die roten Flecken auf ihrem Hals. Eine Allergie? Stress? Eine Krankheit?
„Es geht um meinen Mann, Alexander Steiner.“
Sie sah ihn an, als erwartete sie eine Reaktion. Edgar hatte keine Ahnung, wer das sein sollte, aber er nickte und schrieb sich den Namen auf.
„Aha.“
„Ich bin aber nicht wegen des Unglücks vor zwei Tagen gekommen … also, na ja, indirekt.“
Er wusste nicht, wovon sie sprach. Die letzten Nachrichten hatte er gesehen, bevor er ins Krankenhaus eingeliefert worden war. – „Keine Aufregungen, Herr Brehm. Mit einer hypertensiven Entgleisung samt Thoraxschmerzen ist nicht zu spaßen. Sie haben riesiges Glück gehabt.“ Das war der Fachausdruck für diese Explosion seines Blutdrucks. Das Gute war, er hatte keinen Herzinfarkt, wie er im ersten Moment gedacht hatte. Trotzdem war Edgar sich nicht sicher, ob er von Glück sprechen würde. Es stimmte, es grenzte an ein Wunder, dass er unverletzt geblieben war. Bei dem Aufprall hatte er sich bereits wegen der Schmerzen in der Brust so gekrümmt, dass der Airbag ihn wie einen Ball in den Sitz gedrückt hatte. Keine Verletzungen, aber sein Auto war Schrott, und er hatte nicht genug Geld, um die Reparatur zu bezahlen. Dass sein Körper aber so viel Aufmerksamkeit verlangte, daran wollte er lieber nicht denken. Sein Arzt hingegen sagte, dass der sich gegen die Arbeitszeiten und momentanen „Herausforderungen“ wehrte: „Wenn Sie so wollen, dann verstehen Sie es als eine Warnung, die Ihnen Ihr Körper schickt. Und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Warnungen nicht ernst genommen werden.“ Aber für Edgar reihte sich sein Körper nur in eine Vielzahl von Problemen ein, die er nicht unter Kontrolle hatte.
„Tut mir leid, ich war im Ausland und bin gestern erst zurückgekommen“, log er und deutete auf seinen Schreibtisch. – „Also, Sie müssen kürzertreten. So wenig Stress wie möglich. Frische Luft. Ausreichend Bewegung und Diät. Und ganz wichtig: Entspannung. Nehmen Sie sich ein paar Tage frei.“ Der Arzt hatte nur mit dem Kopf geschüttelt, als Edgar daraufhin zu lachen begonnen hatte.
„Ich konnte mich noch mit nichts anderem beschäftigen als dem hier“, erklärte er.
Chanel sah ihn durchdringend an.
„Wir hatten eine Gartenparty. Ein Mann hat sich als Kellner ausgegeben und – es gab ein Unglück.“ Sie deutete in die Luft, als würde sie ein durchsichtiges Paket hochhalten. „Eine der Nebelleisten hat ihn am Kopf getroffen.“
„Nebelleisten?“
„Wir haben ein Nebelsystem, zur Luftkühlung. Fünf Nebelleisten, jede davon mit drei Düsen. Sie sind über der Terrasse befestigt und versprühen kühlen Wasserdampf.“
„Ich verstehe“, sagte er, obwohl er keine Ahnung hatte, wie so etwas aussah. Aber darum konnte er sich später noch kümmern.
„Eine dieser Leisten hat sich aus der Halterung gelöst“, fuhr sie fort. „Sie hat den Mann sehr unglücklich am Kopf getroffen, worauf er in den Pool gestürzt und ertrunken ist. Es war in der Nacht, niemand hat es bemerkt. Ein Unfall.“ Sie schluckte. „Ich habe ihn am nächsten Morgen gefunden.“ Sie senkte ihren Blick, er fiel auf den Aschenbecher auf Edgars Schreibtisch. „Oh, darf man bei Ihnen rauchen?“
Er sollte Kurts Aschenbecher nicht so herumstehen lassen. Es war erstaunlich, wie oft er diese Frage im letzten Jahr bereits gestellt bekommen hatte. Und er hatte im Prinzip auch gar nichts dagegen, wenn sich jemand in seinem Büro eine Zigarette ansteckte. Aber dann müsste er den Aschenbecher freigeben und damit auch die Belohnungs-Zigarette, die Kurt sich vor ihrem letzten gemeinsamen Auftrag bereitgelegt hatte. Wurde Edgar gefragt, bemühte er sich um ein Lächeln, sagte halbherzig, dass der Aschenbecher nur herumstand, weil er aufgehört hatte. Was nicht stimmte. Er hatte nie geraucht. Falls auch seine neue Klientin fragen sollte, würde er ihr sagen, dass ihm die Zigarette im Aschenbecher ein Gefühl von Erfolg gab. Doch sie fragte nicht. Sie seufzte tief. Noch mehr rote Flecken am Hals. Also doch Stress. Kein Wunder. Angesichts seiner finanziellen Lage und der Tatsache, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis er hier sowieso alles dichtmachen musste, nickte er.
„Natürlich, rauchen Sie.“
Mit ihren perfekt manikürten Fingern fischte sie eine Packung mit schlanken Zigaretten aus der Tasche und zündete sich eine mit einem eleganten goldenen Feuerzeug an. Nach dem ersten Zug blies sie den Rauch aus, als würde sie etwas vor sich wegpusten wollen.
„Was meinen Sie damit, er hat sich als Kellner ausgegeben?“, fragte Edgar nach.
„Er war kein Angestellter der Cateringfirma.“ Sie hielt mit der Zigarette vor dem Mund inne. „Die Polizei ist noch immer damit beschäftigt, seine Identität festzustellen. Und … ich befürchte, also … ich möchte, dass Sie klären, ob er etwas damit zu tun hat.“
Sie legte die Zigarette im Aschenbecher ab, griff wieder in ihre Tasche und nahm ein großes orangefarbenes Kuvert heraus. Es zitterte in ihrer Hand.
„Ich möchte vorbereitet sein. Falls es so ist. Das kam vor zwei Wochen. Jemand hat es in unseren Briefkasten gesteckt. Keine Anschrift, kein Absender. Seit dem Unfall ist viel Polizei bei uns im Haus. Wir werden befragt und … Ich muss wissen, wer das geschrieben hat, bevor es die Polizei rausfindet. Ob er deshalb auf der Party war. Verstehen Sie?“
Sie zog hastig an der Zigarette.
„Sie meinen, dass dieser Todesfall kein Unfall war?“





























