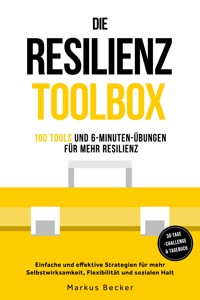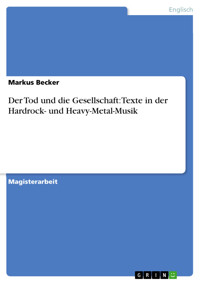Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Erkunden Sie lange vergessene Plätze und Orte, an denen Unglaubliches geschah. Welches Geheimnis verbirgt der alte Bunker am Wannsee? Von welchem Wunder erzählt das Kasernen-Theater im Wald? Woran forscht der alte Professor? Gibt es wirklich ein UFO am Ufer der Spree? Lesen Sie von Täuschern und Tierquälern. Lassen Sie sich vom Charme des alten Berlins einfangen. Erfahren Sie vom Schicksal meines Großvaters Paul Becker, dem Kapellmeister, dem die Liebe zur verbotenen Swing-Musik zum Verhängnis wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Becker
Lost Place Stories
13 gruselige und satirische Kurzgeschichten von verlassenen Orten in Berlin und Brandenburg
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Vorwort
2. Der Präparator
3. Die Kinder von Heckeshorn
4. Die Ladenstraße Onkel-Toms-Hütte
5. Der Täuscher
6. Rendezvous Unter den Linden
7. Unser Mikrowellenherd
8. Leichen im Keller - Das Institut für Anatomie
9. Der Gipfel
10. Iwan Kiew in Vogelsang
11. Das Theater im Wald
12. Käse und Frieden
13. Das UFO an der Spree
14. Die Abhörstation auf dem Teufelsberg
Impressum neobooks
1. Vorwort
Liebe*r Leser*in,
begleiten Sie mich zu verlassenen, unheimlichen Orten: Ein riesiges ehemaliges Kasernengelände in Brandenburg, ein verfallenes Forschungs-Institut, eine Abhörstation aus dem Kalten Krieg und ein furchterregender Bunker am Wannsee haben mir ihre Geschichten erzählt.
Erleben Sie die phantastische Spannung dieser in Vergessenheit geratenen Orte und erleben Sie die Spannung hautnah beim Betreten verbotener Gebäude und Gelände.
Gibt es wirklich ein UFO am Ufer der Spree oder war die Erscheinung nur Einbildung?
„Rendezvous unter den Linden“ ist die mit Leben gefüllte Hommage an meine Heimatstadt Berlin, in der unvorhergesehene Dinge geschehen.
„Käse und Frieden“ ist die persönlichste Geschichte: ich erzähle vom Schicksal meines Großvaters Paul Becker. Der Opa, der mir nur aus Erzählungen und von schwarz-weißen Fotos aus dem Familienalbum bekannt ist, wird zur Hauptfigur seiner farbenfrohen und von Musik begleiteten Geschichte, eingebettet in die tragischen Ereignisse seiner Zeit.
„Der Präparator“ und „Der Täuscher“ sind grausame Phantasien des Alltags in der Stadt.
Die beiden Kurzgeschichten „Unsere Mikrowelle“ und „Der Gipfel“ hatte ich bereits in den 90erJahren in einer Senioren-Zeitschrift veröffentlichen dürfen. Ich habe sie in meine erste Geschichtensammlung, die Ihnen hier vorliegt, mit aufgenommen.
Die Grusel-Ampel verrät in drei Stufen den Schauer-Faktor jeder Erzählung:
lesen sie die grausamen Geschichten nicht, wenn sie zu Albträumen neigen.
Die gruseligen Erzählungen zeigen, welcher dunkle Kern in unseren Seelen schlummert und welche bösen Energien er freisetzt.
Die satirischen Kurzgeschichten erzählen Anekdoten, die, mit ein wenig Phantasie, so passiert sein könnten. Oder sind sie wirklich so geschehen?
Lassen Sie sich überraschen! Ich bin gespannt auf Ihre Anmerkungen und Kritik
und wünsche Ihnen gruselige Unterhaltung!
Ihr
Markus Becker
Für meine Familie und meine Freunde.
Danke für die Hilfe bei der Erschaffung dieses Buches.
2. Der Präparator
„Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz.“
um 550 v. Chr., Aisop, griechischer Sklave auf Samos
„Fass es lieber nicht an, es wird dich beißen!“
Der Junge wich erschrocken einen Schritt zurück.
Hatte sich der Kiefer des Krokodils bewegt? Wenigstens ein Stück?
Nein, nur Einbildung. Der Vater und der Präparator lachten. Alle Tiere in dem kleinen Ladengeschäft waren unbeweglich und tot. Wenn auch auf wundersame Weise wie im Augenblick eingefroren und damit zum ewigen Leben verurteilt.
Der Junge war fasziniert. Wie echt sie aussahen: der Fuchs mit seinem wachen Blick, der Schäferhund, der aus seiner Hundehütte schaute und die zusammengerollte Katze, die aussah, als ob sie schlief. Die vielen Vögel oben auf den Regalen sahen auch sehr lebendig aus. Einige im Flug, andere auf einem Ast sitzend.
Die Anatomie stimmte. Die Posen auch. Einige wirkten etwas staubig wie der Wiedehopf ganz oben unter der Raumdecke. Viele der Tiere hatten leuchtende Augen, die den Betrachter zu beobachten schienen, egal wo man sich gerade in dem Ausstellungsraum befand.
Wenn der Vater mal keine Zeit hatte, ging der Junge alleine zu dem kleinen Geschäft des Präparators in der Nähe einer großen Einkaufsstraße und lugte durch die Scheibe.
Der ganze Laden war mit ausgestopften Tieren vollgestellt. Gruselig sahen die Tiere aus, besonders die, die nah am Fenster standen und ihn mit ihren Glasaugen zu fixieren schienen.
Der Braunbär war ein Meisterstück und sah sehr realistisch aus. Seine ausgefahrenen Krallen waren scharf wie Messer und die Pose, in der er verewigt worden war, war die des Jägers: aufgerichtet und groß, kräftig und unbesiegbar mit weit aufgerissenem Maul.
Wie machte das der Präparator bloß? Wo waren eigentlich die Nähte der ausgestopften Tiere versteckt? Wo waren ihre Organe und das gesamte Innenleben verblieben? Womit wurden die hohlen Körper aufgefüllt, damit sie so plastisch aussahen?
So viele Fragen, die der Präparator bei den zahlreichen Besuchen des Jungen freundlich beantwortete. Jedenfalls die meisten.
Der Ladeninhaber freute sich über den Besuch des aufmerksamen und interessierten Jungen, auch wenn er noch kein Tier gekauft hatte oder in Auftrag gegeben hatte.
Die Gesellschaft des Jungen war ihm angenehm und er zeigte ihm hier und da auch ein paar Tricks seines Handwerks:
Wie man das Fell von verunglückten Tieren reparieren konnte an Stellen, die durch Blut verunreinigt oder durch Einschüsse durchlöchert worden waren. Wie man kaschierte, reinigte, nähte, desinfizierte und ausstopfte. Aus toten Tieren wurden lebensechte Präparate.
Auf dem Heimweg begegnete der Junge auf der Straße oft Katzen und Hunden aus der Nachbarschaft. Dann ging er in die Hocke und streckte ihnen die Hand entgegen, damit sie daran schnuppern konnten. Dieses Verhalten hatte er mal in einem Tierfilm gesehen. Meistens kamen die Haustiere dann so nah heran, dass er sie streicheln konnte.
Es war auch schon mal eine wildlebende Katze dabei, eine Freigängerin, die ausgebüxt war. In seiner Jackentasche hatte er ein wenig Futter dabei. So manchem Tier durfte er das Leckerli direkt ins Mäulchen stecken. Wenige sogar am Bauch kraulen, nachdem sie sich auf den Rücken gelegt hatten. Die Tiere mochten den Jungen. Manchmal folgten sie ihm sogar ein Stück seines Weges.
Er mochte die Tiere auch. Sehr sogar. Er wollte gerne ein Haustier haben. Die Eltern waren auf den Wunsch des Sohnes nicht eingegangen, sie wollten kein Tier in der Wohnung haben und befürchteten, dass es zu viel Lärm und Dreck machen würde oder er sich nicht ausreichend um ein Tier kümmern würde. Irgendwann fand sich der Junge damit ab, dass ihm sein Traum vom eigenen Haustier nicht erfüllt werden sollte.
Draußen gab es ja genug Tiere.
Die Dame im Tierfutterladen war sehr freundlich, Sie beriet den Jungen ausführlich, was Hunde und Katzen gerne fressen. Sie hatte Geduld, der Junge stand schon lange in ihrem Laden.
„Nur Trockenfutter und nichts Frisches geht gar nicht!“, sagte sie. „Und stark gesalzenes Fertigfutter auch nicht. Geben sie ihrem Liebling besser von den Innereien, dem Rind-Schwein-Mix und dem frischen Gemüse-Fleisch-Mix, er wird es ihnen danken und agil und gesund bleiben. Kostet etwas mehr aber erspart am Ende die dicke Rechnung beim Tierarzt.“
Sie war eine erfahrene Verkäuferin.
„Was für eine Rasse haben sie denn?“ fragte die Verkäuferin den Jungen. „Ähh, also, es ist ein Golden Retriever!“ stammelte der Junge. Er hatte gar keinen Hund. Aber er hatte schon viele Hunderassen gesehen und einige auch streicheln dürfen. Außerdem wusste er, wo sich viele Hunde aufhielten.
Er kaufte verschiedene Sorten Nahrung und verabschiedete sich freundlich.
Am Hundeauslaufplatz am Stadtrand sah er die verschiedensten Rassen und beobachtete ihr Verhalten. Und ihre Fressgewohnheiten. Manche wurden für ein Kunststück belohnt von Frauchen oder Herrchen.
Wenn der Junge einen Beutel mit frischem Fleisch aus dem Fachgeschäft dabeihatte, kamen einige Hunde sogar zum Zaun gerannt. Interessant. Sie scheinen das Futter weit zu riechen, durch den Beutel und sogar gegen den Wind. Wenn die Hundebesitzer ihn komisch anschauten, dann lächelte er verlegen und sagte: „Hab nur frische Leberwurst für meine Oma in der Tasche!“ und ging weiter.
Es war ein schöner warmer Sommerabend. Nach Einbruch der Dunkelheit schlenderte er unauffällig gekleidet durch die Straßen, die er vorher schon mit dem Wagen abgefahren war. Die meisten Hundebesitzer waren mit der letzten Gassi-Runde schon fertig.
Hier und da ein Passant, aber nichts Auffälliges. Er ging zielstrebig auf einen großen handgeschrieben Zettel an einem Baum zu, riss ihn ab und legte ihn in die Mappe in seiner Tasche. In der nächsten Querstraße noch ein Zettel. Fast schon ein Poster. Diesmal hochauflösend und in Farbe gedruckt. Ratsch, abgerissen, in die Tasche gelegt.
So durchquerte er das ganze Viertel, Straße für Straße.
Xara, Luna, Bommel, Angus, Emma, Bella, Timon… Alle wurden sie vermisst, ob Hund oder Katze. Er hatte ihre Suchmeldungen und Steckbriefe einkassiert, die schriftlichen Hilferufe ihrer Frauchen und Herrchen. Die Tiere wurden darin genauestens beschrieben: hellbraunes Fell mit dunklem Fleck auf der Stirn oder lahmt etwas, folgt gerne Menschen, ist schüchtern etc.
Manchmal wurden sogar hohe Belohnungen ausgelobt.
„Sollen die Leute doch besser auf ihre Lieblinge aufpassen!“, dachte er.
Bis um Mitternacht war er fertig mit dem Abreißen und Einsammeln der Zettel und Poster. In der Folgenacht machte er wieder einen Beutezug, nur in einem anderen Viertel der Stadt.
Das alte Flughafengelände war schon seit Jahren verlassen. Es wurde nicht mehr benötigt, seit der neue Flughafen in Betrieb genommen worden war. Das war schon viele Jahre her.
Die Start- und Landebahnen sahen noch gut erhalten aus, der alte Tower sah aus wie ein kleiner Leuchtturm und stand bedeutungslos neben dem flachen Gebäude: die Luftaufsichtsbaracke war der Witterung ausgesetzt gewesen und ziemlich zerfallen. Die Hundezwinger vor dem Gebäude waren leer, ihre Gittertüren offen und das gesamte Gelände war von modernen Wandalen heimgesucht worden. Dann waren die Sprayer gekommen und hatten ihre Kunstwerke an den feuchten Wänden hinterlassen. So hatte der bröckelnde graue Putz wenigstens wieder etwas Farbe bekommen.
Schräge Tags und böse Graffiti-Gesichter zierten die Fassade des Hauptgebäudes.
Er erreichte das Gelände in der Dämmerung. Hier kannte er sich hier gut aus. Zügig betrat er das Gebäude, ging herunter in den Keller, schaute sich um: niemand war seit seinem letzten Besuch hier gewesen. Glücklicherweise hatte er bei seinem ersten Besuch einen Schlüssel gefunden.
Dieser passte genau in das Schloss der Kellertür. Er schloss auf und legte die Gegenstände ab, die er mühsam ins Gebäude geschleppt hatte. Mehrmals musste er vom Auto bis hier laufen. Auf dem Gelände wollte er aber nicht parken, es war ihm zu riskant, falls doch ein Neugieriger in der Nähe war, z.B. Spaziergänger. Er schwitzte und atmete tief.
Im Schutz der Dunkelheit wuchtete er die großen Zwinger ins Gebäude. Den Krach und das Echo, als er sie die Treppe heruntergleiten ließ und sie auf dem Kellerboden aufschlugen, hörte zum Glück niemand. Die robusten Käfige hatten keinen Transportschaden bekommen.
Dann machte er sich an die Arbeit und türmte die Gegenstände auf. Die großen, breiten Hundezwinger bildeten die untere Reihe. Er kletterte auf den alten Tritt der im Keller herumgestanden hatte, um alles bis zur Decke zu verstauen, was er mitgebracht hatte. Verschwitzt, aber glücklich betrachtete er sein Werk. Perfekt!
50 Zwinger und Käfige, Vogel-Bauern und Kästen, nach der Größe sortiert, standen hier übereinander getürmt an der rechten Wand. An die linke Wand klebte er die Steckbriefe und Suchposter, die er in dieder Woche eingesammelt hatte. Einige waren doppelt oder dreifach bereits vorhanden.
Er überklebte die alten Steckbriefe mit den neuen. Sie zierten meist die gleichen schlecht erkennbaren Fotos von vermissten Vierbeinern und Vögeln, auf einem war sogar ein schwarzer Achtbeiner abgebildet: eine Vogelspinne wurde gesucht, nachdem sie im Garten entlaufen war.
Manche Tierbesitzer oder besser Ex-Besitzer hatten offenbar im Wochenrhythmus neue Poster an Bäume und Laternen, an Schwarze Bretter in den Einkaufsstraßen und Supermärkten geklebt, wenn die alten, aus welchem Grund auch immer, entfernt worden waren.
Natürlich hatte er sauber Buch geführt, wann er die Suchmeldungen das erste Mal mitgenommen hatte und wann das zweite und dritte Mal.
Einige hingen schon seit Monaten hier im Keller des Flughafengebäudes und waren etwas feucht geworden an der rauen unverputzten Wand, manche waren noch ganz frisch. Die Daten, an denen er sie eingesammelt hatte, notierte er mit großer Schrift auf dem obersten Poster.
Dann machte er sich aus dem Staub.
Die Straße am Park war nicht besonders belebt. Holperpflaster, eine etwas schiefe und schmale Fahrbahn. Wenige Ausflügler parkten ihre Wagen hier, um im Stadtpark spazieren zu gehen. Fahrradfahrer mieden diese Straße, sicher, weil sie sehr holprig war. Die Wohngebäude auf der anderen Seite hatten die Balkone zur Sonnenseite, nicht zur Straßenseite. An den Fenstern war selten jemand zu sehen. Die letzten Lichter gingen aus, es war schon spät.
Hier stellte er sein Auto ab. Seinen unauffälligen Kombi mit ungetönten Scheiben, er hatte nichts zu verbergen. Den feinen Geruch aus dem Kofferraum nahm kein Mensch war, der hier spazieren ging, dafür war der leicht modrige Geruch vom nahegelegen Ententeich zu stark.
Die hintere Seitenscheibe war ein wenig heruntergelassen. Im Kofferraum stand ein offener Eimer mit feinstem frischen Fleisch. Eine kleine Portion nahm er heraus und ging zum Uferweg am See. Ganz unauffällig hatte er den Klumpen Fleisch dort fallen gelassen.
Er setzte sich ins Auto und wartete. Ein kleiner Jack Russell Terrier kam nach einiger Zeit vorbei und näherte sich dem Klumpen Futter. Das Tier hatte ein ungepflegtes Fell und sah etwas abgemagert aus. Der Hund schnupperte an dem Klumpen und wartete nicht lange: er verschlang das Fleisch geradezu in wenigen Sekunden.
Er aus dem Wagen und nahm die kleine Tüte mit dem Spezialfutter mit, als er sich langsam dem Hund näherte. Darin war der gekochte Pansen, frisch und wohlriechend, jedenfalls für die Hundenase, für ihn stank das Zeug einfach eklig.
Der Russel reagierte, denn der kleine Haufen Futter hatte ihn offensichtlich noch nicht gesättigt.
Als er ihm den Beutel hinhielt, machte der Hund Männchen. Zu fressen bekam er davon noch nicht. Dann lief der Russell wieder ein Stück zurück, er kannte den Fremden Menschen nicht.
Der Hunger siegte über die Scheu, als der Hund im Kofferraum seine Belohnung bekam und das Fleisch aus dem Beutel fressen durfte. Um sich herum vergaß er alles. Auch, als sich der Kofferraumtür schloss. Für den warmen Pansen hätte er sein Leben gegeben.
Der Wagen setzte sich in Bewegung in Richtung Flugplatz.
Wieder überprüfte er, ob jemand auf dem Gelände zu erkennen war oder ein Auto vor dem Zaun parkte: negativ!
Er betrat den dunklen Raum im Keller des verlassenen Flughafens und sperrte er den kleinen Hund, der ängstlich winselte, in einen von der Größe passenden Käfig. Nummer 27.
An der Wand hing das dazugehörige Suchplakat: „Jacky. Entlaufen vor zwei Wochen in einem südwestlichen Bezirk der Stadt.“
Bingo! dachte er. „Na warte, wenn Du vier Wochen hier gehaust hast, wirst Du noch sehr viel dünner sein als heute. Pansen gibt es ab heute jedenfalls nicht mehr, du armseliger Köter.
Deine Besitzer werden Dich nicht wiedererkennen, aber umso glücklicher sein, dich wiederzusehen.
Das Futter stelle ich ihnen in Rechnung, das kannst Du glauben. Dafür, dass sie so unachtsam waren und du ausreißen konntest. Von nun an ist Schluss mit dem Luxus-Freßchen…Nun gibt es die Keller-Diät. Gar nichts mehr! Und nach drei Tagen nur so viel Dosenfraß von der billigsten Sorte, dass du nicht krepierst.“
Vier Wochen später.
Jacky winselte nur noch leise und war sehr schwach geworden. Er konnte kaum noch aufrecht stehen im Käfig Nr. 27, ohne immer wieder hinzufallen. Sein Fell sah matt und ungepflegt aus, weil er sich nicht mehr putzen konnte oder wollte, überall kahle Stellen von der Mangelernährung. Sein Maul sah auch nicht gesund aus, viele Zähne waren dunkel geworden oder fehlten.
Die blutige Zange lag noch auf dem kleinen Tisch neben Jackys Käfig. Zwei gezogene Zähne lagen daneben in einem schwarzen Fleck aus getrocknetem Blut. Der Präparator hatte dem armen Hund ohne Betäubung zwei Zähne gezogen. „So siehst du überzeugender aus, du frecher Ausreißer!“ Hatte der Präparator zu dem schwachen Geschöpf gesagt, als er ihn qualvoll behandelt hatte.
Jackys Augen waren trüb und traurig. In den Nachbarkäfigen lagen ähnlich armselige Gestalten, die einst lebensfrohe, gesunde Haustiere gewesen waren und vor Angst zitterten und winselten, froren und hungerten. Der Präparator hatte sie zu mit seiner grausamen Spezialbehandlung zu Jammergeschöpfen erniedrigt.
Er war in Position gegangen und hatte seinen Wagen weit weg geparkt. Er zückte sein Mobiltelefon, seine Rufnummer unterdrückte er.
„Hallo, Meier hier, habe ihren Steckbrief gesehen, mir ist ein Jack Russell zugelaufen. Ist das vielleicht ihrer?“
Eine Stimme am anderen Ende fragte: „Wo sind sie? Wir vermissen unseren Hund, er ist ein Russell, wo können wir ihn abholen.?“
„Bin in der Nähe, war auf dem Heimweg, da lief mir der Hund zu. Ich komme vorbei. Vielleicht ist es ihrer! Welche Adresse?“
Es war immer dasselbe: erst der Schock, wenn man vom Verbleib des geliebten Tieres hörte. Dann Tränen der Rührung, weil es dem Tod geradeso von der Schippe gehopst war und man so froh war, es zurückzubekommen. Egal in welchem Zustand. Dann die Dankbarkeit gegenüber dem Finder. Dem Retter geradezu. Und dann gab es eine Belohnung für den Präparator.
Er überreichte den Jack Russell Terrier, in eine Decke gewickelt, seinem Frauchen. Das Tier regte sich kaum, fiepte aber hörbar glücklich. Sein Frauchen musste weinen und ihr Mann nahm ihr das Fellbündel ab, damit sie sich erst einmal fassen konnte.
Der Präparator erwähnte beiläufig, dass er das beste Futter gekauft hatte, damit das arme Tier wieder zu Kräften kommen konnte. Dann gab es etwas mehr Kohle. Bargeld schienen die Leute genug im Haus zu haben, sie waren nicht knauserig bei der Entlohnung. Und dann das Finale:
„Ich hätte ihnen ihren Liebling schon gerne früher gebracht, aber ich musste erst mal nach so einer Suchmeldung Ausschau halten. Drei Tage habe ich versucht, ihn aufzupäppeln.“ Im Internet hatten sie nicht den Verlust inseriert, oder?“
„Nein, das hatten wir vergessen. Nur die Steckbriefe haben wir mehrmals in der Gegend ausgehängt. Jemand schien die entfernt zu haben, da haben wir neue hingehängt.“ sagte die zierliche Frau.
Der Mann verschwand kurz und kam wieder zur Tür: Danke, vielen, vielen Dank, hier sind 800 €, reichen die für ihre Unkosten?“
„Das ist ja fast zu viel, ich weiß gar nicht… Danke sehr!“
Ein falsches Lächeln und schon war der Präparator verschwunden. Dieses Mal hatte es sich gelohnt.
Zurück blieb ein glückliches, zu Tränen gerührtes Paar mit ihrem geretteten Vierbeiner, der kaum wiederzuerkennen war nach Wochen der Pein und Folter.
Fütterungszeit.
Der Präparator betrat den großen dunklen Raum. Er hatte einen guten Tag gehabt und bei seiner freundlichen Verkäuferin im Tierfuttergeschäft eingekauft. Als das Notlicht im Keller angeknipst wurde, hörte das Schnurren und Schnarchen auf. Für einen Moment. Dann schnatterte, miaute, bellte es aus allen Ecken und aus allen Käfigen im Raum.
Der Geruch von frischem Futter machte sich breit. Jeder wollte ein leckeres Fresschen abhaben.
Es wurde an den Gitterstäben geknabbert, am Boden gescharrt und hin- und her gerannt in den kleinen Käfigen und Zwingern.
Der Futtereimer war randvoll mit Rinder- Schweine- Lamm-Mix mit Knorpeln und teilweise mit Gemüse. Obenauf lag eine große Portion gekochter Pansen, noch brühwarm. Dem Präparator wurde ein wenig übel. Was für ihn unangenehm stank war für die meisten Tiere der Duft eines Festmahls. Die großen Hunde bekamen eine riesige Portion Pansen und Mix, die Katzen Hühnerherzen und Gehacktes.
Die Vegetarier erhielten aus dem kleinen Eimer Salat und kleingeschnittenes Gemüse.
Die Kaninchen knabberten genüsslich an den Gurkenscheiben und den Salatblättern, auch wenn einige schon etwas welk waren. Wer weiß, wann es wieder etwas zu fressen gibt?
Der Präparator stand vor dem Stall von Gretel.
Auf dem Schild an ihrem Käfig standen ihr Name, ihre Nummer und ihr Funddatum. Die Schildkröte war der Exot hier. Die einzige ihrer Art. Sie lag im Terrarium, es war auch das einzige hier.
„Was gebe ich Dir denn zu fressen? Du bist doch bestimmt Vegetarier. Hier hast du was!“ Er warf ihr ein paar Blätter Rucola in das Terrarium. Den mochte sie nicht besonders, weil er so bitter war, aber besser als nichts. Also fraß sie den Salat brav auf.
Früher hatte sie einen Gefährten gehabt, Hänsel, aber dieser war schon vor einem Jahr tödlich verunglückt. Schildkröten können sehr lange leben. Es sei denn, man beaufsichtigt sie nicht, wenn sie in einem Freigehege leben, und sei es nur im eigenen Garten. So war es bei Hänsel geschehen. An den warmen Sommertagen hielt er sich mit Gretel meist draußen auf der Wiese auf. Ihre Besitzerin, ein kleines Mädchen, lag auf einem Sonnenstuhl im Schatten.
Bis der Habicht die Panzertiere eines Tages bemerkte und Kreise über ihnen zog. Hänsel hatte ihn nicht einmal bemerkt. Gretel schon. Sie konnte sich in dem kleinen Schuppen verstecken, als der Vogel zum Sinkflug ansetzte. Warnen konnte sie ihren Artgenossen nicht mehr, alles ging zu schnell.
Der Habicht hatte sich im Sturzflug auf Hänsel gestürzt. Auch wenn Hänsel sich in seinem Panzer Schutz suchte und Beine und Kopf so sehr einzog, wie es nur ging: es war zu spät. Der Raubvogel hatte alle Körperteile, die mit seinem Schnabel zu erreichen waren, aus Hänsels Panzer gepickt.
Die Besitzerin, die kleine Sarah, wurde von den Geräuschen des Kampfes wach und schrie, so laut sie konnte. Helfen konnte dem armen Hänsel niemand mehr. Nur der leergefressene Panzer drehte sich auf dem runden Gartentisch wie ein Brummkreisel.
Gretel war schockiert und konnte sich nicht mal bewegen vor Angst. Nun war sie allein.
„Gretel! Gretel? Wo bist Du?“ Sarah schrie sich die Seele aus dem Leib. Gretel hörte sie nicht.
Der Verkehr um sie herum war zu laut. Dafür schmeckte ihr der Löwenzahn auf der kleinen Wiese gut, jedenfalls um Längen besser als der halb welke Salat aus der Plastiktüte, den ihr die kleine Sarah in den Käfig geworfen hatte. Wie war sie bei ihrer Geschwindigkeit hierher gelangt?
Sie muss wahnsinnig viel Glück gehabt haben, nicht überfahren worden zu sein. Hundepipi am Löwenzahn störte sie nicht, war auch kaum welches an den Blättern, die sie kaute. Es war kein Hund in Sicht, die Wiese der Mittelinsel gehörte ihr allein.
„Schlurps..“ schon hatte Gretel einen Regenwurm eingesaugt. Lecker! Viel besser als das langweilige Futter zuhause. Hier bleibe ich! Der schwarze Schatten am Himmel kam näher. War es eine Krähe oder ein Rabe? Während der Vogel zum Sturzflug ansetzte, zog Gretel Arme, Beine und Kopf in ihren Panzer ein. Sie erinnerte sich an das Schicksal ihres Artgenossen Hänsel. Der Schnabel des Jägers prallte vom Schildkrötenpanzer ab und der Vogel krächzte vor Schmerz.
Als er nicht mehr zu hören war, fuhr Gretel Glieder und Kopf wieder aus und marschierte langsam weiter über die Wiese auf dem Mittelstreifen der Straße, auf zum nächsten Leckerbissen. Sie hatte aus Hänsels Schicksal gelernt, war schnell und klug geworden. Aber nicht klug genug.
Ein weiterer Schatten bedeckte das Tier, dass mit dem Fressen beschäftigt war. Der Präparator griff den Panzer mit seiner Hand in Sekundenschnelle, er wusste, dass Gretel nicht fliehen konnte. Behutsam steckte er sie in seinen Beutel und ging zum Wagen.
Er wusste, dass die Schildkröte schon vor Monaten entlaufen war. Er hatte ihre Suchnachricht längst im Keller des Flughafengebäudes an die Kellerwand geheftet und auf diesen Augenblick gewartet. Nun hatte er Gretel in seiner Gewalt.
Spät abends ein Anruf bei Familie Franke: „Guten Abend, Meier hier, vermissen sie eine Schildkröte? Habe eine gefunden im Park an der großen Wiese. Die sieht aus wie ihre Gretel.
Was? Ja, bin in der Nähe, wenn es ihnen nicht zu spät ist, komme ich…wie bitte, sie haben bereits eine neue Schildkröte gekauft für ihr Kind? Es soll die alte nicht zurückbekommen, weil sie bereits eine Neue hat? Schön.“ Aufgelegt.
So eine Frechheit, wie schnell manche Tierbesitzer Ersatz gefunden haben. Keine Belohnung.
Was mache ich nun mit Dir? Schildkrötensuppe? Der Präparator lachte verschmitzt. Gretel sah und hörte es nicht vor lauter Angst in dem dicken Stoffbeutel. Sie war wie versteinert.
Später wurde sie in einem Terrarium in einem fast dunklem Raum wach. Kein Salat, kein Fressen zu sehen, nicht mal eine Schale Wasser. Wo bin ich? Es roch modrig und war kalt hier. Nun wurde es finster in dem feuchten Raum. Gretel hatte wieder Angst. Hinzu kam immer stärker werdender Hunger, mit jedem Tag, der verging.
„Hallo, Meier hier, ich glaube, ich habe ihre Katze gefunden, ist es so eine dreifarbige mit schwarzer Nase? Habe ihre Suchanzeige gelesen.“
Stille am anderen Ende. Dann ein Jauchzen: Eine Frauenstimme: „Ja, unsere Minka, sie ist schon so lange weg, wo können wir sie abholen?“
Ich war im Außendienst, bin hier in Waldbach, kann gerne vorbeikommen, wenn es ihnen jetzt nicht zu spät ist.“
„Ja, bitte, wir haben unsere Minka so vermisst. Geht es ihr gut? Fehlt ihr etwas?“
„Nein, eigentlich nicht, nur der Schwanz. Sie hat bestimmt lange draußen gelebt. Vielleicht ein Revierkampf mit anderen Katzen? Weiß nicht. Ist aber gut verheilt, der Stummel. Sie ist mir fast vor den Wagen gerannt, wissen sie. Habe ihre Wunde verbunden, ihr etwas zu trinken gegeben und sie auf eine Decke gelegt im Wagen. Ich komme vorbei. Wo wohnen sie?“
„Das ist ja schrecklich.“ Unüberhörbare Tränen auf der anderen Seite der Leitung, dann ganz leise: „In der Dorfstraße 4. Bei Urban.“
„Bis gleich.“
Der Präparator wartete ein paar Minuten. Sein Wagen stand schon fast in Sichtweite der Urbans.
Noch ein wenig das Fell gegen den Strich gestreichelt und es mit dem Wasser aus der Seltersflasche angefeuchtet. Etwas Dreck aus einer Tüte auf dem Fell verteilt und schon ging es los:
Mit in die Decke eingewickelter Minka stand er vor der Tür der Urbans. Klingeln. Hastige Schritte im Haus. Die Tür ging auf. Das Ehepaar Urban stand vor ihm.
„Bitte nicht so laut, die Kleine schläft schon, sie soll das Tier in diesem Zustand nicht sehen. Danke, dass sie gekommen sind.“ „Keine Ursache, war in der Gegend, muss aber jetzt heim. Hier ihre Katze. Das arme Tier sah so schlecht aus. Habe sie auch noch etwas gefüttert, aber sie wollte kaum etwas fressen. Kein Wunder, sie steht noch unter Schock. Hier!“ Er reichte der Frau das Bündel Tier samt Decke.
„Ach herrjeh, die arme.“ Seufzte die Frau.
Warten Sie, Herr…?“ „Meier!“
Frau Urban nestelte in ihrem Portmonee. Hier sind 300 € Finderlohn und noch 200 für ihre Unkosten und vielen herzlichen Dank!“ „Oh das wäre nicht nötig gewesen, ich helfe doch, wo ich kann. Danke sehr. Einen schönen Abend noch und Entschuldigung für die späte Störung“
„Keine Ursache. Vielen Dank und leben sie wohl!“
Herr Urban war in der Küche verschwunden, und hatte das Gespräch von dort gelauscht.
„Seltsam, vor zwei Wochen hatte der gleiche Herr Meier seinen Schwiegereltern ihren Hund Jacky zurückgebracht. Heute bringt er uns unsere Minka. Und wieso hatte das Tier frisches Blut am Fell?
War ihr der Schwanz gerade erst abgefallen? Oder hatte gar jemand nachgeholfen?“
Schon war der falsche Herr Meier im Wagen verschwunden. Er hatte so geparkt, dass man sein Nummernschild nicht lesen konnte und erst nach dem Losfahren das Licht eingeschaltet.
Lief doch gut, dachte er, hätte auch noch zwei Wochen länger warten können mit der Übergabe der Katze, dann hätte ich bestimmt tausend Euro Finderlohn bekommen. Aber vielleicht wäre sie an der nicht fachgerecht versorgten Wunde gestorben. Ist schließlich kein Pappenstiel, so eine Amputation. Das Geschäft mit Mitleid und Angst lief. Bald würde er sich einen neuen Wagen kaufen können mit allen Extras.
Er bemerkte den Mann nicht, der im Dunkeln die Straße betrat und auf ein Motorrad stieg.
Mit sicherem Abstand folgte ihm das Motorrad. Die letzten Meter schaltete der Fahrer das Licht der Maschine aus, dann den Motor. Er ließ die Maschine bis kurz hinter den Wagen des Präparators ausrollen. Dieser war schon auf dem Flughafengelände verschwunden.
Nach einer halben Stunde kam er zurück und stieg in das Auto. Er wollte noch einmal in seine Wohnung fahren und mehr Futter für seine Gefangenen holen.
Er schien es eilig zu haben, denn er raste den Waldweg entlang. Der Mann hatte sich und sein Motorrad im Gebüsch versteckt. Als das Auto nicht mehr zu hören war, betrat er das Gelände.
Am liebsten hätte er den Fremden, der sich Meier nannte, gleich vor Ort gestellt, ihn vor Zorn niedergeschlagen oder die Polizei geholt, aber versuchte, sich zu beherrschen.
Nun war er neugierig geworden, was sich dort auf dem Gelände verbarg.
Leise und unbemerkt schlich sich Herr Urban, der Motorradfahrer, der Familienvater und Besitzer der armen misshandelten Katze Minka in das alte Flughafengebäude.
Er sah die Treppe zum Keller, die Kellertür stand offen. Er ging hinein.
Der Lichtkegel der kleinen Taschenlampe traf auf eine Wand. Eine feuchte, riesige Wand.
Da hingen Sie: die Lieblinge, die von ihren Besitzern vermisst wurden.
Aber es waren nicht Trophäen aus Tierkadavern oder abgezogenen Fellen, wie der Mann vermutet hatte, sondern Steckbriefe: Suchmeldungen aus Papier.
Fast fünfzig kleine Poster und Vermisstenanzeigen, handgefertigt oder aus dem Heimdrucker und mit Fotos in schwarzweiß und Farbe geschmückt. Die gesamte Wand war mit Steckbriefen tapeziert worden. „Wer macht so etwas? Was soll dieser Spuk?“ Fragen, die unbeantwortet blieben im feuchten Keller.
Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Vögel usw., gesucht mit Fotos und Kontaktdaten. Teilweise hoher Finderlohn wurde versprochen. Getigerte Hauskatzen, Glückskatzen, Rassekatzen, treue Haustiere und Heimbewacher, langjährige Freunde auf vier Pfoten. Nagetiere, sogar eine Schildkröte. Aber ihr Poster war durchgestrichen worden mit einem dicken Kreuz.
Der Mann hatte nicht viel Zeit. Er betrachtete nur wenige der armen verloren gegangenen Schicksale und ihm fiel Schnippi auf, der kleine Dackel und Yucca, der Siam-Kater.
Eine Klagewand: Tiere ohne Heim, Besitzer in Sorge und Trauer.
Ein Wimmern erschreckte den Mann: im Dunkeln, auf der anderen Seite der Wand, regte sich etwas. Ein Scharren, ein Winseln: er leuchtete in die andere Richtung des Raumes und erblickte Käfige, die übereinander getürmt waren. Große, wie Zwinger, auf dem Boden und darüber Kleine aller Art. Vogel-Bauern und Kleintierkäfige, sogar ein Terrarium.
Er traute seinen Augen nicht: dies war eine Höhle des Terrors, ein Gefängnis. Wenn nicht sogar ein Folterkeller.
Die Käfige trugen Nummern. Diese stimmten zumeist mit den Postern auf der gegenüberliegenden Wand überein.
Schön sauber durchnummeriert von oben links bis unten rechts. 1 bis 48.
Die meisten waren leer oder Herr Urban konnte nicht erkennen, ob sich ein Lebewesen hinter den Gitterstäben befand oder nur Futterreste, Stroh, Schmutz und Fäkalien.
Ein unerträglicher Gestank erreichte seine Nase.
Aus einem Käfig starrte ihn eine weiße Katze an. Mit nur einem Auge. Das andere fehlte, eine unsaubere Naht aus schwarzem Garn verdeckte die Augenhöhle. Wessen Werk war das? Oder hatte sich die Straßenkatze die Verletzung im Kampf mit ihren Artgenossen zugezogen?
Das Tier miaute ununterbrochen. Zwei Zwergkaninchen saßen im Käfig daneben. Es war kaum Heu oder Futter zu sehen auf dem schmutzigen Käfigboden. Überall Hasenknödel und keine frische Nahrung in Sicht, nur welke Blätter von Löwenzahn. Das eine Kaninchen sah nicht gut aus, sein rechtes Ohr war beinahe vollständig von seinem Mitbewohner abgefressen worden. Der große Re-triever im Käfig unten rechts zeigte keine Regung mehr. Schlief er? War er gar verhungert? Eine Schildkröte lag in dem einzigen Terrarium, das viel zu klein war. Die vielen Katzen und Hunde scharrten, wenn sie die Kraft dafür noch hatten oder jammerten und winselten. Noch nie hatte Herr Urban einen so erbärmlichen Anblick ertragen müssen, wie hier in diesem Keller. Er musste sich stark zusammenreißen, um nicht lauthals loszuschreien vor Wut und Trauer und Hilflosigkeit.
Er öffnete viele der Käfige, aber die meisten Insassen regten sich nicht. Als er oben in der Baracke ein Geräusch hörte, versteckte er sich in der Ecke hinter dem letzten Zwinger. Es war eng hier und er berührte die feuchte Kellerwand. Seine Hand war bedeckt von schlierigem Schleim. Er wischte sie an seiner Hose ab. Er stieß mit dem Fuß gegen einen Gegenstand. Ein langes Werkzeug lag dort am Boden. Er nahm es auf und wartete.
Schritte. Jemand kam die Treppe in schnellem Tempo herunter. Jemand, der sich hier auskannte.
„Der vermeintliche Herr Meier?“ dachte Herr Urban, der lautlos in der dunklen Ecke kauerte, das Werkzeug fest in der Hand haltend.
Ein Lichtkegel erreichte den dunklen Kellerraum, ein fröhliches Pfeifen war zu hören, kam näher.
„Na ihr kleinen Monster, Papi ist wieder da“ Nun ist Fütterungszeit!“ Der Präparator lachte. Dann hörte er einen Laut hinter aus der Ecke neben den Käfigen. Was war das?
Er hatte keine Zeit, nachzufragen. Ein hastiger Schritt und die Gestalt aus dem Dunkeln hatte ihn erreicht.
Die Garotte zog sich fest um den Hals des Präparators.
Der Atem stockte. Er versuchte, den Metallring mit den Händen abzuwehren. War das das Ende? Würde der sich immer fester zuziehende Ring ihm die Luft abschnüren bis zum qualvollen Ersticken oder, wenn er sich noch weiter zusammenzog, den Kopf vom Hals schneiden?
Die Luft kam wieder, Erleichterung. Aber der Schmerz wurde stärker. Das Blut am Hals fühlte sich warm an. Es durchtränkte das eh schon durchgeschwitzte Hemd. Er sank zu Boden, sein Bezwinger ließ nicht nach. Wortlos, ohne Gnade. Ein Standgericht aus Verbitterung, Abscheu und Rachegelüsten. Der Unbekannte schubste den Präparator zu dem großen Zwinger, dessen Tür offenstand.
„Kriech da rein!“ Der Präparator winselte: “Nein. Ich kann ihnen alles erklären! Wer sind sie?“ „Rein da!“ Auf den Knien betrat der Präparator sein Verließ. Die Tür bekam einen Tritt und fiel ins Schloss. „Hilfe, lassen sie mich raus, ich gebe ihnen viel Geld, in meiner Jackentasche sind…“ Der Mann hörte ihn nicht, er war verschwunden. Oben fiel eine Tür zu. War er weg und hatte den Präparator allein gelassen?
Im Dunkeln sah der Präparator ein Augenpaar. Die müden Augen von Bernie, dem Labrador, den er so sehr gequält hatte in den letzten Tagen und Wochen. 5 kg hatte der Hund an Gewicht verloren.
Der Geruch des frischen Menschenblutes verbreitete sich schnell. Bernies Nase war geschwächt, aber hatte den Peiniger schon gewittert. Aus dem Dunkeln krochen zwei weitere Hunde in Richtung der Tür. Diese war verschlossen. Auch zwei ausgehungerte Katzen erschienen im fahlen Licht der provisorischen Deckenlampe. Luna und Moritz. Fauchen, Kreischen, ein Schrei. Sie konnten durch die Gitterstäbe in den großen Zwinger klettern. Katzen, die wochenlang gehungert haben, sind zwar nicht die schnellsten, aber passen durch jede noch so enge Zwischenraum.
Der Präparator fasste sich an die Kehle. Ein brauner Fell-Berg warf sich auf ihn, zwei kleine geschickte Jäger bissen in seine Arme. Die Rache der misshandelten Tiere kannte keine Gnade. Oder waren sie nur hungrig? Fleisch mitsamt Fetzen der Kleidung wurden herausgerissen und heruntergeschlungen, der Präparator schlug um sich, zwecklos. Immer mehr Tiere entwichen ihren Käfigen, deren Türen weit offenstanden und versammelten sich in dem großen Zwinger, der in der untersten Reihe auf dem Kellerboden stand.
Wer Einhundert Jahre ohne große Probleme überlebt hat, muss nicht immer als erster am Ziel sein: Gretel. Die brave Schildkröte, bahnte sich ihren Weg aus dem Dunkeln bis zum zuckenden und sich windenden Opfer. Als der menschliche Kadaver endlich leblos am Boden lag, krabbelte das Panzertier gemächlich auf dem blutüberströmten Körper entlang. Hier und da wurde noch gefressen. Ausgehungerte Kreaturen fraßen gründlich Knochen und Sehnen blank, kauten auf Knorpeln und Weichteilen.
Caspar, der seit Monaten vermisste Perserkater, hatte sich nicht zurecht machen können für das Festmahl.
Gewöhnlich putzte er sich und kämmte sein Fell mit seiner Zunge, doch dafür war er heute zu schwach. Fressen ging gerade noch mit den verbliebenen Zähnen, die ihm der Präparator nicht ausgerissen hatte. Das Fleisch des Peinigers schmeckte besser als das bisschen Trockenfutter, das er vor einer Woche das letzte Mal bekommen hatte.“ Schnurr!“ Welch ein Genuss. Nach der Mahlzeit leckte sich der Kater das Fell.
Gretel war bis zum Kopf des Peinigers gekrochen und machte sich an die Delikatesse: sie steuerte ein Auge des Präparators an, welch Festmahl nach all dem Hunger der letzten Tage. Sie lutschte es aus der Augenhöhle. Schmeckte fast wie ein Regenwurm, vor allem der widerspenstige Sehnerv, der das Auge nur noch lose hielt. Vegetarisches Menü? Damit lasse ich mich heute nicht abspeisen, dachte Gretel.
Das Schmatzen und Kauen der hungrigen Tiere waren die letzten Geräusche im Raum, die der Präparator hörte. Das abgenagte Skelett des gewissenlosen Tierpeinigers lag entstellt auf dem feuchten Kellerboden. Nicht einmal die Kellerasseln, die aus allen Ecken gekrochen kamen, hatten noch genug Fleisch an den kahlen Knochen gefunden, um davon satt zu werden. Herr Urban hatte sein Haus erreicht und wieder bei seiner Familie. Seine Frau und die Kinder sahen traurig aus. Sie bemerkten die Rückkehr des Vaters kaum. Sie saßen auf dem Sofa im Wohnzimmer und streichelten die apathisch wirkende und schwanzlose Minka, die noch immer in die Decke gewickelt dalag.
Es schien, als zeigte sich trotz ihres Schmerzes ein kleines Lächeln in dem hübschen Katzengesicht.
„Quäle nie ein Tier zum Spaß, sonst frisst es dich auf wie Aas.“ Der Autor
3. Die Kinder von Heckeshorn
Wolfgang
beeilte sich, er wollte nicht zu spät kommen. Er schlüpfte in seine graue Uniform, setzte seine Mütze auf und nahm seine Koppel, band sie in Höhe der Hüfte um seine Uniformjacke, zog den Riemen durch die breite Schnalle und eilte durch das Treppenhaus ins Freie. Ein prüfender Blick nach unten: seine Stiefel waren geputzt, sahen aus wie neu. Sollten sie auch, wenn man ganz vorne stehen wollte und jeder sie sehen konnte.
Was für ein Glück, dachte Wolfgang. Seine dunkle Uniform war tadellos.
Viele Abteilungen hatten bereits auf dem großen mittleren Freigelände Aufstellung genommen. Es waren Männer und Frauen der neuen Reichsluftschutzschule, die heute eingeweiht werden sollte.
Aufgrund seiner Größe, denn er war ja noch ein Kind von 10 Jahren, durfte Wolfgang in der ersten Reihe der Luftschutzhelfer stehen.
Es war eine Ehre für ihn, denn es gab noch nicht viele Kinder in dieser „volksertüchtigenden“ Funktion. Rechts neben ihm stand sein Vater bereits in Reih und Glied mit den anderen Helfern, links die Funktionäre der Partei in ihren braunen Anzügen, rechts in schwarzen Uniformen mit Schirmmützen die Bezirks- und Ortsgruppenführer des RLB, des Reichsluftschutzbundes.
Die meisten schauten mit strengem und erwartungsvollem Blick nach rechts, von wo sie den Ehrengast erwarteten. Nur einer der Männer in der ersten Reihe überprüfte nochmal den Glanz seiner Stiefel und schaute auf den Boden. Hoffentlich hatte der Fotograf noch nicht Stellung bezogen und Aufnahmen gemacht.
Alles sollte perfekt und einheitlich sein bei dieser Feier der besonderen Art: neben der Einweihung der Schule sollten die neuen Fahnen des RLB geweiht werden. Eine große Ehre in einem neuen Staat, in dem es von Fahnen und Uniformen wimmelte.
Sogar das Wetter spielte mit, es waren knapp 20 Grad bei leichter Bewölkung ohne Regen an diesem Dienstag, den 23. Mai 1939 in Berlin-Wannsee.
Sechs Jahre bestand die „Bewegung“ nun schon, fast genauso lange hatte der Bau der Anlage der Reichsluftschutzschule auf dem leicht erhöhten Gelände am Großen Wannsee gedauert. Schließlich waren die Neubauten auf dem fast 500.000 qm großen Gelände pünktlich fertig geworden. Es hatte Druck von oberster Stelle gegeben bzgl. der Fertigstellung. Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe hatte so seine Methoden, munkelte man.
Das Areal umfasste ein Schulungsgebäude mit Eingangshalle, Hörsälen, Verwaltungsgebäuden, einem Wohlfahrtsgebäude, Unterkunftshäusern für die Mannschaften sowie Versorgungsgebäuden, Garagen und Schuppen. Alles in allem eine Kameradschaftssiedlung aus Reihen- und Siedlungshäuschen mit runden Wegen, mitten in den Wald und die Natur gebaut.
Wolfgang war noch rechtzeitig erschienen, der prominente Gast war noch nirgends zu sehen. Sein Vater schaute etwas grimmig und seine Mimik verriet: „Mach hin, Junge!“ Die Reihe öffnete sich ein wenig, Wolfgang nahm seinen Platz neben seinem Vater ein und stand stramm und unbeweglich wie alle.
Er sah die vielen verschiedenen Uniformen und bewunderte die Ordnung und Präzision der Versammlung. In einem Block rechts von ihm sah er die Frauen in schwatzen Röcken mit weißen Blusen, Sekretärinnen aus den 17 Landesgruppen des RLB und aus dieser neuen Ausbildungs-Zentrale, wenn man diese Dienststelle so nennen möchte. Die modischen Frisuren hochgesteckt oder zum Dutt geknotet. Viele mit Parteiabzeichen-Nadeln, aber die konnte Wolfgang von dieser Entfernung nicht ausmachen.
Daneben und dahinter Ausbildungsleiter, Stabsführer und Landesgruppenführer.
Hinter den Wartenden und all den Leitern und Getreuen thronte der vor kurzem fertiggestellte Koloss aus Stahl und Beton. 25m hoch und massiv gebaut.
Was wäre eine Luftschutzschule ohne ein Bunker-Bauwerk dieser Größenordnung für den Verteidigungsfall. Auf diesem Gelände sollten Luftschutzwarte aus dem ganzen Reich geschult werden für den einen bevorstehenden Krieg. Im Frühling 1939 schien dieser noch weit entfernt zu sein, aber er würde beginnen, noch in diesem Sommer und eines Tages in das Reich zurückkehren und ein Bombenkrieg von grausamen Ausmaß sein.
In Heckeshorn wurde die Defensive gestärkt, es wurde geradezu wissenschaftlich an ihr gearbeitet in der „Akademie für Selbstschutz“.
Der Bunker sollte verschont bleiben von Bombentreffern, war er doch weit von der Stadtmitte und den Ministerien und anderen wichtigen Orten wie der Reichskanzlei gelegen. Aber der Krieg würde auch hierherkommen.
Einige Jungs aus der Nachbarschaft waren zum Arbeitsdienst verpflichtet worden. Einer von ihnen, Martin, freute sich über seine Aufgabe: er sollte den Aufmarschplatz sowie das mittlere Freigelände von Unrat befreien, es sauber halten. Ein Eimer stand hinter einer Hauswand, an ihr lehnte eine Schippe mit einem Handfeger.
Martin hatte schon Papier und ein paar Kippen der Wachmannschaft eingesammelt und in seinem Eimer verstaut. Ansonsten machte der Platz einen tadellosen Eindruck. Für den Fall einer Verschmutzung würde Martin herbeieilen und Verschmutzungen beseitigen.
Nun ging auch ein Ehrensturm der Standarte Horst Wessel vor dem Hauptgebäude in Stellung. Die Männer in langen Mänteln und mit Stahlhelm schulterten ihre Karabiner 98.
Einige Gruppenführer, die an diesem Standort ihren neuen Arbeitsplatz bezogen haben, durften ihre Kinder mitbringen an diesem wichtigen Tag. Sie schauten aus den Fenstern im Obergeschoss, die Fensterrahmen waren mit Girlanden aus Blumenschmuck verziert, einige schwenkten kleine Hakenkreuzfahnen, als wäre es Führers Geburtstag.
Es sollte aber kein Führer erscheinen, sondern einer seiner treuesten Verbündeten und ein gefeierter Kriegsheld des Großen Weltkrieges.
Noch bevor die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hatte, ging plötzlich ein Raunen durch die Menge. Dann verstummten alle, nahmen Haltung an, den Blick geradeaus gerichtet. Der Reichsminister und Generalfeldmarschall erschien mit einigem Gefolge aus Generälen und Oberkommandierenden. Er nahm seine Position vor dem Hauptgebäude ein.
Standartenführer hielten die neuen Fahnen des Reichsluftschutzbundes: sie zierten ein silberner Gardestern mit schwarzem Hakenkreuz auf rotem Tuch. Der Minister berührte die Fahnen und weihte sie, wie er es schon hunderte Male an anderen Orten getan hatte.
Generalmajor Wede strahlte unter seiner Uniformmütze wie ein Oberprimaner, der eine Eins bekommen hatte. Er war der verantwortliche Kommandeur der Reichsluftschutzschule, die soeben eingeweiht worden war. Alles verlief nach Plan, ohne Zwischenfälle. Fünf Jahre harter Arbeit von der Planung bis zur Fertigstellung lagen hinter ihm und seiner Mannschaft. Sein Chef stand neben ihm: der neue Präsident des RLB und General der Flakartillerie von Schröder, nun seit etwas über einen Monat im Amt. Auf diese neue Besetzung würde sich der Minister verlassen könne, hoffte er.
Die Einweihungsfeier kam zu ihrem Ende, der Minister schien noch weitere Termine zu haben an diesem Dienstag. Begleitet von zwei Generälen schritt er über das Gelände, schaute sich die nagelneuen Häuser an, deren rote Backsteine und spitze Torbögen der neuen Architektur entsprachen.
Das Ensemble mit der Toreinfahrt und den Seitengebäuden war majestätisch. Eine eigene Bushaltestelle war vor dem Tor eingerichtet worden mit einem großen Wendekreis: hier war Endstation! Oder der Beginn einer Fahrt in die Dienststellen.
Proteste der Anwohner der Villensiedlung wegen Lärm und Gestank in der Frühe häuften sich. Die Omnibusfahrer hupten oft lange, um die Mannschaften für die Fahrt zusammenzutrommeln. Die Beschwerden wurden von der neuen Leitung abgeschmettert: Nachbarrechte müssten hinter den Betrieben der Volksertüchtigung zurückstecken.
Als der Generalfeldmarschall an einem Nebengebäude vorbeikam,
vor dem eben noch Dutzende Uniformierte in Reih und Glied gestanden hatten,
hörte er ein Lachen am Fenster im Obergeschoß. Ein kleiner Junge in grauer Kleidung lächelte und warf etwas aus dem Fenster. Direkt in Richtung des Generalfeldmarschalls.
Dieser wunderte sich, erblickte dann einen Papierflieger, der sich ihm näherte.
Das kleine Flugzeug machte eine Schleife in der Luft und landete vor den Stiefeln des Generalfeldmarschalls. Martin, der mit der Reinhaltung des Geländes beauftragt worden war, eilte herbei und nahm den Flieger vom Boden auf. Er versteckte ihn hinter seinem Rücken und sagte: „Entschuldigung, Herr Minister.“
Dieser lächelte und sprach: „Zeig mal her, was du da hast!“
Martin gab ihm den Papierflieger. Der Minister beäugte das Spielzeug von allen Seiten und lachte. Die Generäle, die dem Minister begleiteten, schmunzelten.
Das Papierflugzeug war am Heck mit deutschen Kreuzen bemalt worden. Mit dem Bleistift hatte jemand „Fokker“ auf die Tragflächen geschrieben.
Der Minister blickte nach oben zum Fenster, wo nur ein blonder Haarschopf zu sehen war. Er sprach zu dem Kind, das vermeintlich den Flieger geworfen hatte:
„Na sieh mal einer an! Das ist ja allerhand! Wenn du mal Flieger bei der Luftwaffe werden möchtest, gib deinem Jungscharführer Bescheid, dann kommst du zu uns. Das passende Flugzeug hast du ja schon.“
Er gab den Papierflieger Martin zurück. Dieser lief rot an im Gesicht.
Sichtlich erheitert ging der Minister mit seinen Generälen weiter, später stieg er in seinen Wagen und verließ das Gelände der Reichsluftschutzschule am Wannsee. Martin betrat das Haus, ging in die obere Etage und sah den Jungen, der so frech gewesen war. Er grinste auch noch schelmisch, als er Martin sah.
Dieser sprach: „Du spinnst wohl, den Minister mit deinem Müll zu beschmeissen!“ Der andere Junge, der zwei Jahre jünger war als Martin, grinste nur weiter und schwieg. „Wenn du nochmal so etwas machst, sage ich es deinem Vater. Ich weiß, dass er Luftschutzwart hier in der Siedlung ist.
Er wird dir den Hintern versohlen.“ Er trat ganz nah an den Jungen heran, dessen Namen er wusste. Auch seine Uniform mit der Koppel machte ihm keine Angst. Der Bengel war einen halben Kopf kleiner als Martin und er würde ihm eine klatschen, wenn er es für richtig hielt. Aber er hielt inne. Der Jüngere schien Respekt vor ihm zu haben, sein Grinsen wich einem ernsten Gesichtsausdruck. Er trat einen Schritt zurück.
Martin bemerkte etwas in seinen Augen. Es war, als hätten sich die Pupillen des Jungen für einen Moment rot gefärbt. Vielleicht hatte sich auch nur das Tageslicht in seinen Augen gespiegelt. Die beiden Jungs schauten sich einen Moment an, dann ging Martin wieder hinaus auf den Vorplatz, er wollte noch einmal nach dem Rechten sehen.
Der Platz war sauber, die Festveranstaltung war zu Ende gegangen. Martins Vater stand vor dem Bunker und sprach mit einem Kameraden von der RLS, den er von seiner Ausbildung kannte.
Die beiden Männer schauten sich die monumentale Fassade des Bunkers an. Funktionaler konnte ein Gebäude nicht aussehen: ein Betonklotz ohne Fenster, haushoch und hässlich. Aber die beiden Betrachter lobten dieses kolossale Bauwerk und waren stolz darauf.
Martin trat zu seinem Vater, dieser gab ihm einen milden Klaps auf den Hinterkopf und sagte: „Da bist du ja, du Lausbub! Los, ab nach Hause, Mutter wartet auf dich, sie hat Nieren gekocht, vielleicht gibt es auch ein Stück Speck dazu. Und heb mir eine Portion auf!“
Der Junge trat den Heimweg an, während der Vater sich mit seinem Kameraden nun über die technischen Daten und Besonderheiten des Hochbunkers unterhielt.
Werner
erblickte die raketenartigen Gebäude, die zum Himmel ragten. Wehrmachtsangehörige rannten wild durcheinander, einige trugen Kisten und Taschen, andere hatten vor Eile ihre Helme vergessen. Rufe und Kommandos ertönten aus allen Richtungen. Es herrschte Aufbruch-Stimmung.
Die Bunker waren fast neu und sollten schon dem Feind übergeben werden? Schutzräume, die wie Raketen aussahen, standen in Wünsdorf neben Betonklötzen, die wie Wohnhäuser getarnt waren. Mannschaftswagen fuhren vor, versuchten, soweit es ging, eine geschlossene Formation zu bilden, standen aber kreuz und quer verteilt auf dem ganzen Gelände des Hauptquartiers der Wehrmacht.
Der Kommandeur war aufgeregt aus seinem Haus getreten und fuchtelte mit den Armen.
„Hier her!“ rief er einem Fahrer zu. Die Mannschaften hatten Aufstellung genommen, versuchten, einen freien LKW zu erwischen, um nicht zurückbleiben zu müssen.
Der Russe, hatte Werner gehört, stehe schon lange die Ufer der Oder überquert und hatte bereits Fürstenwalde eingenommen. Artillerie beschoss bereits den Stadtrand Berlins, wenn nicht schon das Zentrum. Es war das letzte Kriegsjahr, aber das wusste niemand mit Sicherheit.
Noch in weiter Ferne, aber deutlich hörbar, summten die Stalinorgeln und zerstörten alles in ihrer Reichweite. Es geht nach Berlin, wusste Werner. Als Angehöriger einer Fernmeldeeinheit wusste er, dass das OKW/OKH diesen Standort endgültig aufgab und nach Berlin flüchtete. Man wollte in einem ganz neuen Bunker am Wannsee ein neues Hauptquartier einrichten, noch weit vom Feind entfernt.
Der Befahl zum Abrücken war gegeben. Die Mannschaftswagen rollten schon los, Werner hatte alles bei sich, was ihm geblieben war: seine Tasche, seine Maschinenpistole, seinen zu großen Stahlhelm und einige Magazine mit Munition am Gürtel. Verpflegung und Wasserflaschen gab es im LKW, jeder bediente sich. Noch reichten die Vorräte für alle.
Zwölf Mann saßen dicht beieinander, jeweils sechs sich gegenübersitzend auf den Holzbänken. Die Fahrt war beschwerlich, die Bänke unbequem. Überleben war nun wichtiger.
Bald erreichte der erste Konvoi die Stadtgrenze Berlins, es ging weiter nach Westen, bis nach unendlich langer Fahrtzeit der Wannsee zu sehen war. Wie friedlich er von der Brücke aussah, sogar das Strandbad war im Frühnebel zu erkennen.
Es war April. Zu kalt zum Baden. Hatte auch keiner Zeit für. Vergangen waren die schönen Tage in einer friedlichen Zeit, in der man den Strand und die Sonne genoss und mit langen gestreiften Badehosen in den Wannsee sprang. Heute ging es nur ums Überleben.
Straße am Wannsee. Villengegend. Wunderschöne Häuser mit Türmen und Erkern, Landhäuser, Stadtvillen, alle herrschaftlich mit großen Wiesen und Grundstücken. Alte Bäume zur Straßenseite, hier und da Boote zur Wasserseite. Dann am Heckeshorn: der riesige Bunker ragte über die Baumwipfel.