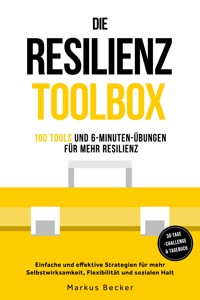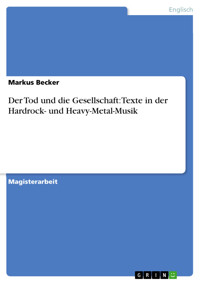Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mentoren-Media-Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Vertrauen in die Infrastruktur in Deutschland hat seit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021 stark abgenommen. Zwischenzeitlich hat sich aber auch nicht viel verändert: Auf kommunaler Ebene steht Überforderung an der Tagesordnung – thematisch wie finanziell. Die Konsequenzen sehen wir jeden Tag: kaputte Straßen und Brücken, sanierungsbedürftige Anlagen, Investitionsstau und vieles mehr. Ändern wir nichts daran, sind neue Katastrophen unabwendbar. Infrastrukturexperte Markus Becker hat die Flutkatastrophe im Ahrtal selbst als Familienvater sowie Mitglied des Kristenstabs erlebt. Zusammen mit dem Wachstumsexperten Guido Quelle zeigt er anhand der Ahrtalkatastrophe auf, was (Ober-)Bürgermeister, Landräte und Führungskräfte in Kommunalverwaltungen und kommunalen Betriebe, aber auch in privaten Infrastrukturunternehmen tun können, um eine widerstandsfähige Infrastruktur zu fördern und aufzubauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Becker und Guido Quelle
Und dann fällt der Strom aus …
Erkenntnisse für Bürgermeister und Landräte aus der Flutkatastrophe im Ahrtal
Mentoren-Media-Verlag
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage
© 2024 Mentoren-Media-Verlag,
Königsberger Str. 16, 55218 Ingelheim am Rhein
Lektorat: Deniz S. Özdemir, Mainz
Korrektorat: Marie Schumacher, Leipzig
Umschlaggestaltung: Stephan Maria Glöckner, Dernau
Umschlagsfoto: Dominik Ketz, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Satz und Layout: Deniz S. Özdemir, Mainz
Abbildungen: Dominik Ketz, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Grafiken: Stephan Maria Glöckner, Dernau
Autorenfotos: Dominik Ketz, Bad Neuenahr-Ahrweiler (Markus Becker), Silvia Kriens, Dortmund (Guido Quelle)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
eISBN: 978-3-98641-117-6
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Sämtliche Inhalte in diesem Buch entsprechen nicht automatisch der Meinung und Ansicht des Mentoren-Media-Verlages.
www.mentoren-verlag.de
»Die Autoren entwerfen eine Vision für den Aufbau und Erhalt einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Infrastruktur. Ein wichtiges Buch: nah an den Problemen, den Lösungen und den Menschen, ohne die es nicht geht.«
Dr.-Ing. Oliver Buchholz, Experte für Starkregen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 – Die Katastrophe: Wenn du nichts hörst, bedeutet es nicht, dass alles in Ordnung ist
Mittwoch, 14. Juli 2021
Donnerstag, 15. Juli 2021
Freitag, 16. Juli 2021
Samstag, 17. Juli 2021
Sonntag, 18. Juli 2021
Fünf Fragen an Hermann-Josef Pelgrim
Kapitel 2 – Die Phasen danach: Das Beständigste ist ein Provisorium
Hochemotionale Wochen: Die Blaulichtphase
Schnell und ungenau, aber wirksam: Die Provisoriumphase
Träge und langsam: Die Wiederaufbauphase
Fünf Fragen an Jan Deuster
Kapitel 3 – Infrastruktur ist selbstverständlich – und die Erde ist eine Scheibe
Strom
Trinkwasser
Abwasser
Brücken
Abfall und Entsorgung
Straßen
Wärme
Fünf Fragen an Guido Orthen
Kapitel 4 – Wir brauchen neue Formen der Zusammenarbeit
Fünf Fragen an Jürgen Schwarzmann
Systemimmanente Hürden
Fünf Fragen an Martin Schell und Alfred Sebastian
Die lokalen Experten – ein unterschätztes Gut
Was kann wo konkret getan werden?
Fünf Fragen an Steffen Liehr
Kapitel 5 – Was Landräte und Bürgermeister tun können
Fünf Fragen an Marco Mohr
Die Verantwortung der kommunalen Spitze
Klug kommunal vernetzen
Zeitgemäß führen
Wirksam kommunizieren
Vertrauen stärken
Mitarbeiter gewinnen und halten
Sich selbst führen
Fünf Fragen an Udo Adriany
Kapitel 6 – Eine Vision
Fünf Fragen an Sofia Lunnebach
Schlusswort und Danksagung
Vorwort
Als wir (Markus und Guido) im Jahr 2017 unser erstes gemeinsames Buch Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel entwarfen und verfassten, wollten wir die Welt der Infrastruktur, die Welt des Tiefbaus, ein wenig stärker würdigen und herausarbeiten, dass die unsichtbare Infrastruktur, das unterirdische Vermögen, mindestens ebenso wichtig ist wie das sichtbare Immobilienvermögen, und zwar die Gebäude, die diese Infrastruktur nutzen. Man könnte auch sagen, dass das unterirdische Vermögen noch wichtiger ist als das oberirdische, denn ohne Infrastruktur läuft nichts, ohne unterirdische Infrastruktur können Gebäude nicht in Betrieb genommen werden.
Die »Baggerschaufel«, wie wir unser Buch nennen, sollte auch verdeutlichen, dass es eine neue Form der Zusammenarbeit in Infrastrukturprojekten geben muss. So haben wir an vielen Beispielen deutlich gemacht, welche – teilweise kleinen – Akzente zu setzen sind, damit Infrastrukturprojekte in einer neuen Form der Zusammenarbeit der Akteure reibungsärmer, ressourcenschonender und vorwiegend schneller, gründlicher und nachhaltiger erfolgen können als bisher. Das gemeinsame Schreiben von Markus als Infrastrukturexperte und Guido als Wachstumsexperte eröffnete ein besonderes Spannungsfeld, sodass wir sowohl aus der tiefen Praxiseinsicht des Infrastrukturexperten, der hunderte und aberhunderte Beispiele in Form von Projekten erlebt hat, in Kombination mit der Sicht des Wachstumsexperten, der seit über 30 Jahren mit vielen hundert Unternehmen zusammengearbeitet und Veränderungen herbeigeführt hat, eine Symbiose schaffen konnten, die vermutlich einzigartig war.
Die »Baggerschaufel« hat seinerzeit in der Fachwelt Erhebliches ausgelöst und erfährt noch heute rege Resonanz. Obwohl die in der »Baggerschaufel« enthaltenen Beispiele sämtlich anonymisiert waren, haben sich dennoch viele Akteure in jenen Beispielen wiedergefunden – unabhängig davon, ob sie nun tatsächlich die angesprochenen Personen waren oder nicht. Somit ist ein grundlegendes Werk für die Branche des Tiefbaus entstanden. Insbesondere bekommt Markus als Fachexperte immer wieder Lob und Feedback. Von vielen Lesern erhält er dabei eine hohe Wertschätzung, wird häufig auf das Buch angesprochen und ist seither als Vortragsredner und Experte bundesweit sehr gefragt, wobei er oftmals auch Vorträge zur »Baggerschaufel« hält.
Die Reichweite der Anfragen und Gespräche erstreckt sich dabei von der lokalen Ebene, von den lokalen Experten, bis hin zu Landes- und Bundesministerien. Dies hat sicher auch dazu geführt, dass Markus im Sommer 2022 als Infrastrukturexperte gebeten wurde, im Bauausschuss des Deutschen Bundestages seine Sicht der Dinge nach der Flutkatastrophe an der Ahr zu schildern und Wege in die Zukunft aufzuweisen. Das Video ist auf YouTube zu sehen: Markus’ wesentliche Erkenntnis darin ist, dass es eine zentrale Koordinationsstelle vor Ort geben muss, die Entscheidungsbefugnis hat.
Auch das nachträglich produzierte Hörbuch zur »Baggerschaufel« hat viele Freunde gewonnen. Insgesamt wurden wir bestätigt, dass Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel ein Buch ist, aus dem selbst gestandene Profis noch erheblichen Wert schöpfen können.
Nun mag man sich fragen, warum wir beide in unserem Vorwort dieses Buches über ein Buch, das schon vor einigen Jahren entstanden ist, schreiben. Ganz einfach: Wir ahnten damals natürlich nicht, dass vier Jahre später in dramatischer Weise deutlich werden würde, wie wichtig Infrastruktur tatsächlich ist. 2017 schrieben wir noch aus der komfortablen Situation der vermeintlich immerwährenden infrastrukturellen Weiterentwicklung. Wir schrieben dieses Buch zwar unter hinreichender eigener Auslastung, aber doch im »Normalbetrieb«. Heute ist alles anders.
Bereits seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, hat Markus immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, besser für Starkregenereignisse gerüstet zu sein. Meistens waren die Anwesenden in solchen Gesprächen und bei derartigen Vorträgen oder Workshops seiner Auffassung und nickten eifrig. Das Problem: Es blieb bei der Erkenntnis, dass Markus wohl richtig liege. Aber nur diejenigen, die tatsächlich strategisch dachten, haben auch Projekte umgesetzt, um besser gegen Starkregenereignisse gewappnet zu sein. Viele andere haben – aus ganz unterschiedlichen Gründen – gedacht, dass sie dieses Thema besser noch verschieben, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, weil andere Dinge wichtiger erschienen, man den Euro nur einmal ausgeben kann, der Haushalt gut aussehen muss und so weiter.
Was dann im Sommer 2021 geschah, war »eigentlich« ein immenses Starkregenereignis. Ausgewachsen hat es sich aber zu einer massiven Flutkatastrophe. Guido Orthen, Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, hat es in der bereits genannten Sitzung des Bauausschusses des Deutschen Bundestages am 6. Juli 2022 auf den Punkt gebracht: »Ich glaube, es ist wichtig, weiter dafür zu sensibilisieren, dass wir kein Hochwasser hatten, sondern eine Flutkatastrophe.«1 Diese Einordnung ist genau richtig. Ab dem 14. Juli 2021 war nämlich im Ahrtal und auch in einigen Regionen in NRW nichts mehr normal, alles war anders, alles war dramatisch.
Das grundsätzliche Problem: Es war nicht nur alles anders, es ist immer noch alles anders, auch jetzt, einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir dieses Buch veröffentlichen. Wir werden darauf in den einzelnen Kapiteln dieses Buches eingehen. Die vielleicht größte Gefahr, die wir sehen, ist, dass wir erleben müssen, wie ein Arrangement um Provisorien herum zu entstehen scheint. Wenn aber der Zustand des Provisoriums zum Normalzustand erhoben wird, ist niemandem gedient. Wenn die Flutkatastrophe für irgendetwas gut gewesen sein soll – und wir sind sehr zurückhaltend mit dieser Formulierung, denn in Tat und Wahrheit ist erst einmal gar nichts Gutes daran –, dann dafür, dass die Bedeutung, der Wert der unterirdischen Infrastruktur, der Wert dessen, was wir nicht sehen, dessen Existenz und Funktionsfähigkeit wir aber als normal voraussetzen, weiter erhöht wird. Es bedarf massiver Investitionen in Infrastruktur, nicht nur im Ahrtal, damit wir in Deutschland – und in der Welt – weiter sicher versorgt werden und auch die Entsorgung funktioniert.
Wie bereits die »Baggerschaufel« ist auch das vorliegende Buch ein Ratgeberbuch. Dieses Mal haben wir den Fokus insbesondere auf Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gelegt. Sie sind es nämlich, die letztlich entscheiden, welche Wertschätzung die Infrastruktur in ihrem Landkreis oder ihrer Kommune erfährt. Nein, sie sind nicht die Detailentscheider, aber sie sollen und müssen sich mit den infrastrukturellen Gegebenheiten ihrer Gemeinde oder ihres Kreises – stärker – auseinandersetzen, wenn sie die Zukunftsfähigkeit sicherstellen wollen.
Eine weitere Zielgruppe, die hohen Nutzen aus diesem Buch ziehen wird, sind Büroleiter, Amtsleiter und Fach- sowie Führungskräfte in den Infrastrukturunternehmen kommunaler oder privatwirtschaftlicher Natur. Auch sie werden hier aufschlussreiche Erkenntnisse, Ansätze und Handlungsfelder finden. Aber auch interessierte Bürger, die Infrastruktur üblicherweise nur dann wahrnehmen, wenn sie gerade mit einer Bau- oder Renovierungsmaßnahme befasst sind oder wenn die Infrastruktur einmal nicht wie gewohnt funktioniert, finden hier Ansatzpunkte, sich selbst besser zu rüsten und vieles wesentlich besser zu verstehen.
Infrastruktur ist weitaus überwiegend ein Gut der öffentlichen Hand und unterliegt damit demokratischen Prinzipien und Prozessen. Die Demokratie ist unserer Auffassung nach die beste Staatsform, auch wenn sie sich mit technischen Lösungen und Infrastruktur mitunter ein wenig schwertut – die »NIMBY (not in my backyard, nicht in meiner Nachbarschaft)-Haltung« lässt grüßen. Umso wichtiger ist bei Infrastrukturstrategien und deren Realisierung ein langer Atem.
Wir freuen uns sehr, wenn dieses Buch dazu beiträgt, die Infrastruktur in Deutschland sicherer zu machen, zukunftsfester zu machen, präsenter zu machen. Geschieht dies durch dieses Buch ein wenig, hat auch unser zweites gemeinsames Buch seinen Zweck erreicht.
Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dortmund, im Sommer 2023
Noch ein Nachsatz, ein persönliches Wort von Markus:
Ich möchte mich auf diesem Wege und mit diesem Buch, dem zweiten Infrastrukturbuch, das Guido und ich verfasst haben, bei allen Mitarbeitern meines Unternehmens, allen Infrastrukturakteuren und technischen Führungskräften sowie allen weiteren Unterstützern, die sich bis heute nachdrücklich und nachhaltig für den Wiederaufbau im Ahrtal einsetzen, ausdrücklich und besonders herzlich bedanken.
Ihr und Euer Markus Becker
Hinweis:
Immer dann, wenn in diesem Buch über tatsächlich erlebte Situationen berichtet wird, spricht Markus, es sei denn, es wird gesondert darauf hingewiesen. Der besseren Lesbarkeit halber machen wir dies nicht an jeder Stelle erneut kenntlich. Außerdem wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in diesem Buch bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form (das generische Maskulinum) verwendet. Sämtliche Angaben beziehen sich jedoch selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter.
Die Katastrophe: Wenn du nichts hörst, bedeutet es nicht, dass alles in Ordnung ist
Die ersten Tage der Flutkatastrophe im Ahrtal, erlebt und erinnert von Markus Becker.
Mittwoch, 14. Juli 2021
Es war ein ganz normaler Mittwoch. Wir hatten an diesem Tag in unserem Büro ein Thema zu diskutieren und zu reflektieren, das mit Starkregen zusammenhing, denn bereits am 19. Juni 2021 hatte es ein Starkregenereignis bei uns gegeben. An jenem Tag regnete es binnen 24 Stunden 40 Millimeter pro Quadratmeter; dies entspricht also 40 Litern pro Quadratmeter. Diese enorme Regenmenge hatte in meinem Wohnort, Heimersheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, bereits zu katastrophenähnlichen Zuständen geführt. Das gesamte Hochwasser kam aus dem Außengebiet und war in drei Wellen auf uns zugeflossen. Unsere Nachbarn, meine Familie und ich hatten also begonnen, unsere Keller auszupumpen, nur um damit nach der nächsten Welle noch einmal anzufangen und das Ganze ein drittes Mal vorzunehmen.
In meinem Umfeld waren etwa zweihundert Einsatzkräfte aus der sogenannten »Blaulichtfamilie« im Einsatz, um größere Schäden des Ereignisses abzuwenden. Das Siedlungswasserwirtschaftsteam aus meinem Ingenieurbüro und ich saßen im Büro, um dieses Ereignis von vor knapp einem Monat auszuwerten, die Reparatur-, Sanierungs- und Zukunftsprojekte, die dort nun nötig waren, zu ordnen und unseren Wissensstand abzugleichen.
So ganz normal war aber dieser 14. Juli auch nicht, denn uns wurden durch die Wetterdienste bereits erneut erhebliche Regenmengen angekündigt. Wir schauten uns diese Prognosen sehr sorgfältig und mit Respekt an und stellten fest, dass für Maastricht bereits 100 Millimeter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden angekündigt waren. Wir trauten unseren Augen nicht, denn wir stellten uns vor, was es bedeuten würde, wenn diese enorme Menge tatsächlich auf uns zukäme. 40 Liter pro Quadratmeter hatten am 19. Juni fast an die Belastungsgrenze – und teilweise darüber hinaus – geführt und nun sollten es 100 Liter pro Quadratmeter werden? Das würde möglicherweise zu einer echten Katastrophe führen.
Zunächst nahmen wir diese Werte zur Kenntnis, aber entwickelten noch keine Aktivitäten. Maastricht war weit weg und schließlich wussten wir bisher nicht, ob diese Regenmengen auch für uns zutreffen würden, denn die Vorhersage galt ja zunächst nur für die Niederlande. Aus den Vorhersagen und Regenmengen der Vortage war uns sehr wohl bewusst, dass Starkregentage auf uns zukommen würden, aber die Dimension war unklar. Wir hatten nur Maastricht als Referenzpunkt. Im Laufe des Mittwochabends wurde dann immer klarer, dass uns erhebliche Regenmengen betreffen und auch erreichen würden.
Es entwickelte sich zunehmend eine hektische Betriebsamkeit im gesamten Ahrtal, Menschen reagierten völlig unterschiedlich auf die Wetterprognosen. Zum Teil wurden weiterhin Warnungen ausgesprochen und verbreitet, zum Teil wurden Feuerwehren in Einsatzbereitschaft versetzt, zum Teil wurde privates Hab und Gut provisorisch gesichert, aber es gab keine Struktur der Aktivitäten. Einhundert Liter pro Quadratmeter? Das konnte man sich kaum vorstellen. Während der eine sagte: »Na ja, bei mir war das Hochwasser noch nie. Ich lege wie immer Sandsäcke aus«, sagten andere wiederum: »Nun, wir wohnen hier direkt an der Ahr. Wenn das Wasser in der Form kommt, haben wir ein echtes Problem. Bringen wir lieber die Familie nebst Haustieren in Sicherheit«.
Wir hatten eben diese Vorgeschichte, keine vier Wochen vorher. Der 19. Juni hatte uns bereits praktisch und auch emotional massiv zugesetzt und so waren wir alle in irgendeiner Hinsicht sensibilisiert. Was später passieren würde, konnte sich aber niemand von uns vorstellen. Ich persönlich rechnete mit einer Auswirkung wie am 19. Juni, weswegen ich mein Nachtquartier auf der mittleren Etage meines Hauses eingerichtet hatte und um circa 23 Uhr an jenem Mittwoch die Nachricht auf Twitter las, dass die Kreisverwaltung darum bat, im 50-Meter-Bereich um die Ahr alles zu räumen. Ich dachte: »Na ja, wir sind hier 500 Meter weit entfernt, da wird schon nichts passieren.« Ich nahm an, dass die Region rund um die Ahr in jenem 50-Meter-Umkreis geräumt werden würde – heute weiß ich, dass dies zu dem Zeitpunkt schon vollkommen unmöglich geworden war. Die massiven Wassermassen hatten das Land längst überschwemmt.
Donnerstag, 15. Juli 2021
Kurz nach Mitternacht: Stromausfall. Es war still und es war dunkel. Ich fand eine Taschenlampe und auch mein Smartphone half bei der Beleuchtung. Es war nichts zu hören, außer das Rauschen – das Rauschen der Ahr. Wir wussten, dass nun in Kürze Blaulichter die nächtliche Dunkelheit durchbrechen würden und wir wussten auch, dass wir Sirenen hören würden. Tatsächlich aber erfolgte nichts. Es gab kein Blaulicht. Es gab keine Sirenen. Es gab keine Feuerwehrleute, die zum Kellerauspumpen kamen.
Es war zwischen zwei und vier Uhr morgens, als die Welle der Ahr bei uns durchrauschte und wir dachten, es sei alles – soweit möglich – in Ordnung und erforderliche Maßnahmen würden bereits erfolgen. In Wahrheit aber blieben das Blaulicht und die Sirenen nur deswegen aus, weil es schon keine Brücken mehr gab. Über 60 Brücken waren zu dem Zeitpunkt bereits zerstört. Wir wussten nicht, dass die Brücken immer wieder zu einem Aufstau der Ahr geführt hatten, das Wasser damit in die Breite brachten, sodass das ganze Tal ausgefüllt war, die Ahr über die Ränder der Brücken trat, um dann auf die nächste Brücke zuzuschießen.
Gegen drei oder vier Uhr morgens hörte ich viele Schreie aus der Nachbarschaft: »Das Wasser kommt, das Wasser kommt!« Ich zog mich an und rannte auf die Straße. Es dämmerte bereits. Und obwohl wir 500 Meter von der Ahr entfernt wohnen und auch mein Büro in dem Gebäudekomplex ist, obwohl sich eine große Bundesstraße mit einem hohen Mauerwerk zwischen uns und der Ahr befindet, kam bei meiner Nachbarschaft das Wasser an. Die Feuerwehr, die seit Mittwochnachmittag im Einsatz war, ergriff weitere Maßnahmen. Die Blaulichtphase startete.
Der Pegel stieg und stieg. Selbst bei uns, in unserem alten Bauernhaus, stieg das Wasser im Keller, obwohl wir eine Rückschlagklappe haben. Es waren zwar nur zehn bis 20 Zentimeter Wasser im Keller, aber dies verdeutlicht, zu welch reißendem Strom das beschauliche Flüsschen Ahr geworden war.
Abbildung 1.1: Brückenbauwerk über der L83, Stadtteil Bad Neuenahr
In dieser Nacht vom 14. auf den 15. Juli wurden wir komplett abgeschlossen von allem. Wir hatten keinen Strom mehr, wir hatten daher auch keine Internetverbindung mehr, kein Fernsehen mehr, wir hatten kein Radio mehr. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch kein Transistorradio, das mit Batterien betrieben werden konnte. Inzwischen habe ich zehn davon, für den Fall der Fälle.
Wir konnten das Ausmaß der Katastrophe überhaupt nicht abschätzen. Wir konnten nur Sichtbeurteilungen vornehmen: »Wir haben Wasser im Keller, der Nachbar hat auch Wasser im Keller.« Punkt. Wir konnten auch mit dem Rad ein wenig hin- und herfahren, aber unser Radius war begrenzt, weil überall Wasser war. Wir hatten überhaupt keinen Überblick über das Ausmaß des Schadens.
Am frühen Morgen des 15. Juli besuchte ich meinen Onkel, um zu schauen, ob alles in Ordnung war. Auch meine Tante versorgte ich. Die ersten externen Helfer, die über die Autobahnabfahrt Sinzig eintrafen, sperrten zunächst die Region weiträumig ab. Es wurde deutlich, dass die Feuerwehr kein Gesamtbild der Lage hatte, so wie wir auch kein Gesamtbild der Lage hatten. Die Kommunikation war extrem eingeschränkt. Kein Telefon, keine Internetverbindung, kein Fernsehen – man lebte nur vom Hörensagen. Austausch und vermeintlicher Erkenntnisgewinn waren immer nur dann möglich, wenn man sich mit anderen traf. Was wir heute in unserer komfortablen Welt als selbstverständlich ansehen, nämlich sich mittels unterschiedlicher Medien zu informieren und sich per Telefon oder Nachrichtendiensten auszutauschen, ist nicht selbstverständlich, das erfuhren wir an jenen Tagen hautnah.
Manche sagten: »Na ja, mein Handyakku hält ja noch eine Weile und ich habe auch noch Powerbanks zu Hause«, aber was hilft dir das, wenn die Funkstrecke nicht aufrechterhalten werden kann, weil die Stromversorgung der für den Mobilfunk erforderlichen Antennen- und Vermittlungsanlagen nicht mehr funktioniert? Selbst das beste und reichweitenstärkste Handy mit vollem Akku ist somit wertlos.
Mit den meisten Informationen versorgte uns der Radiosender SWR4, der jede halbe Stunde Lokalnachrichten sendet und uns damit als Hauptinformationsquelle diente. Mit Batterieradios konnten wir diese Nachrichten verfolgen.
Uns wurde immer bewusster, dass dies kein normales Starkregenereignis oder eine ausgewachsene Hochwassersituation war. Uns wurde klar, dass dies eine Flutkatastrophe ungeheuren Ausmaßes war. Der erste Tag dieser Katastrophe, der Donnerstag, war bestimmt von der Eigenversorgung. Wir mussten uns erst mal um uns und unsere Familien kümmern. Erste Stimmen sprachen von Evakuierungen und Todesopfern. Ich konnte das anfangs noch nicht glauben.
Der Bürgermeister unserer Stadt, Guido Orthen, rief mich an und sagte, dass Statiker benötigt würden, um das Ausmaß der Schäden an den Brücken zu bewerten. Ich kontaktierte meinen Bruder, der ein Büro für Statik betreibt. Thomas fuhr entlang aller Brücken und berichtete von dem Ausmaß der Zerstörung. Es gab keinen Bahnhof mehr, es gab keine Bundesstraße mehr und neun von elf Brücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren zerstört. Immer wieder sickerten Nachrichten von vermeintlichen Todesfällen durch. Hielten wir es erst für Wichtigtuerei und ein Ergebnis von »stiller Post«, mussten wir diese Nachrichten inzwischen ernst nehmen. Die Zahlen wurden konkreter und es war die Rede von 700 vermissten Personen und 30 Todesfällen. Wir wurden regelrecht überschüttet von Einzelschicksalen. Jeder hatte irgendeine traumatische Erfahrung.
Unser Bürobetrieb startet üblicherweise gegen sieben oder halb acht Uhr morgens. Einige Mitarbeiter erschienen auch zur Arbeit, aber natürlich bei Weitem nicht alle. Ich konnte nicht einmal alle Mitarbeiter erreichen, aus genannten Gründen. Wir waren in einem Zustand höchsten Improvisationserfordernisses und höchster Unsicherheit.
Immer und immer wieder erreichten uns nun Nachrichten über weitere Vermisste und Todesopfer. Es war bestürzend und wir alle wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten, denn es waren ja Bekannte, Verwandte, Nachbarn, um die es sich handelte. Das war alles nicht anonym in den Nachrichten, das war hier bei uns vor der Haustür. Eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes. Noch heute sind wir im Ahrtal traumatisiert von all diesen Einzelschicksalen, auch wenn wir uns schnell ins Handeln geflüchtet haben. Wir haben vieles nur verdrängt und bisher nicht verarbeitet. Kürzlich traf ich einen Berufskollegen aus einem anderen Ingenieurbüro und ich fragte ihn, warum er wieder rauche. Die Antwort: »Weißt du, Markus, wenn du einmal mit deinem Auto in der Flut weggeschwommen bist, dann ist das mit dem Rauchen das kleinere Problem.«
Am Donnerstag hatte der Pegel seinen Höchststand, das Wasser ging danach binnen zwei bis drei Tagen deutlich zurück.
Freitag, 16. Juli 2021
Wir mussten uns unbedingt organisatorisch innerhalb der Familie neu aufstellen: Wie wollten wir mit der 91-jährigen Tante umgehen? Wer kümmerte sich um den Keller? Meine Versuche, mit einem Floß zur Tante zu fahren, um sie zu evakuieren, waren misslungen. Also brachte ich ihr zuerst Kleidung und Essen von meiner Mutter, damit sie versorgt war. Später würde sie von Kindern, Schwiegerkindern und Helfern aus dem Haus gebracht werden, in das sie bis heute, fast zwei Jahre nach der Katastrophe, noch nicht zurückkann. Meine Tante ist heute 93 Jahre alt und in einer Wohnung bei ihren Kindern untergekommen. Immerhin.
Schritt für Schritt organisierten wir uns, ebenso wie unsere Freunde und Nachbarn dies taten. Im Wesentlichen kümmerten wir uns darum, die Keller in den nicht so stark betroffenen Häusern leer zu pumpen und Schlamm zu räumen. Natürlich hatten wir immer noch keinen Strom, kein Wasser, kein Abwasser, kein Telefon. Wir hatten nichts. Wir hatten keine Infrastruktur. Morgens saßen wir mit einer Tasse Kaffee am Gasgrill, auf dem wir Toastbrot zubereiteten. Viele meiner Mitarbeiter hatte ich zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht sprechen können. Ich wusste nicht, ob es ihnen gut ging, ob sie lediglich von der Kommunikationsinfrastruktur abgeschnitten waren oder ob ihnen etwas zugestoßen war. Diese Sorge war schier unerträglich.
Bürgermeister Orthen rief erneut bei mir an: »Kannst du kommen? Wenn ja, bring Karten mit. Wir haben hier einen Krisenstab eingerichtet und müssen schnell handlungsfähig werden.« Ich fuhr zum Krisenstab, der in der Feuerwache tagte und fand alle Anwesenden, 30 oder 40 Personen, unter Schock und unter extremer Belastung. Natürlich, mir ging es ja genauso. Es wurde im Krisenstab zunächst ohne Plan und ohne Karten gearbeitet. Es gab keine Tagesordnung, es gab keine Struktur. Alles war auf Improvisation ausgelegt.
Je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr weitete sich das Problem von der städtischen Ebene über den gesamten Landkreis und schließlich auf das gesamte Land aus. Alle forderten lokale Experten an, alle wollten genaue Wissensstände erzielen, alle wollten sicherlich Gutes bewirken, aber alle waren überfordert. Wie sollten nun Prioritäten gesetzt werden? Ich versuchte, eine Struktur zu erkennen, um die Arbeit wirksamer gestalten zu können.
Samstag, 17. Juli 2021
Die Improvisation ging weiter. Ich brachte meine Eltern aus dem Tal zu meiner Schwester nach Koblenz. Meine Schwester berichtete aus dem Fernsehen, das wir ja nicht hatten, welche Zustände bei uns herrschten und ich war noch geschockter als zuvor, sah ich nun das gesamte Ausmaß der Katastrophe.
An jenem Samstag ereigneten sich bei uns zu allem Überfluss auch noch zwei Massenpaniken, denn es war verlautbart worden, dass die Steinbachtalsperre in Heimerzheim, also in Nordrhein-Westfalen, gefährdet sei und einzustürzen drohe. Viele der traumatisierten und von Panik ergriffenen Nachbarn hatten statt »Heimerzheim« mit »z« »Heimersheim«, also unseren Ort, mit »s« verstanden. Also wurde schnell ausgerufen: »Heimersheim ist in Gefahr, die Talsperre bricht ein, wir müssen uns dringend in Sicherheit bringen!«
Fast der ganze Ort stand wegen dieser Fehlinformation in den Hängen des Ahrtals und es war für mich erschreckend zu sehen, wie so eine Massenpanik abläuft. Menschen standen auf den Straßen, versuchten in die Hanglagen zu kommen, Autos fuhren so schnell wie möglich, es war gruselig. Ich selbst konnte auch meine Nachbarn nicht beruhigen, obwohl ich erkannt hatte, dass, selbst wenn die Steinbachtalsperre gefährdet sei, uns keine Gefahr drohte. Alles war hochemotional. Auch ich selbst war in meiner eigenen Blase und immerzu damit beschäftigt, einigermaßen nach Prioritäten zu handeln.
Wir hatten auch keine fachliche Expertise vor Ort, denn weder der Leiter des Bauamtes noch der Leiter des Abwasserwerks waren vor Ort, alle waren ja selbst betroffen. Insofern verfügten wir auch nicht über eine technische Leitung seitens der Verwaltung. Führungskräfte, die zuständig gewesen wären, waren ebenfalls selbst von der Katastrophe betroffen. Verständlich, wer weiß, wie es ihnen und ihren Familien erging. Für die Bewältigung der Situation war dies natürlich misslich, denn es war ja nicht so, dass wir in Bezug auf Expertise aus dem Vollen hätten schöpfen können. Die Menschen, die sich nun buchstäblich um ihre eigene Existenz kümmern mussten, fehlten in der Katastrophenbewältigung.
Ich hatte immer noch keinen Kontakt zu vielen Mitarbeitern. Obwohl wir am Wohnhaus und am Bürohaus nur minimale Schäden zu verzeichnen hatten, machte ich mir zunehmend Sorgen. Den ersten Kontakt zu meinem Geschäftsführungskollegen Torsten Ohlert sollte ich erst am Samstagabend haben. Er musste auf einen Berg fahren, um über Funknetzempfang zu verfügen. Das Ausmaß, in dem er betroffen war, würde ich erst eine Woche nach der Katastrophe richtig verstehen. Torstens Haus stand einen Meter im Wasser, das Haus seiner Eltern war bis zur Höhe von drei Metern überflutet. Auch zu weiteren Kolleginnen und Kollegen bekam ich erst Schritt für Schritt Kontakt und um jeden, der sich wohlbehalten meldete, war ich dankbar.
Es stellte sich langsam eine Dauerstresssituation ein und ich war froh darum, dass ich in Stresssituationen stets eher ruhiger werde und nicht in die Gesamtaufregung einstimme. Zwar kostete mich dies erhebliche Energie, es half mir aber, die Übersicht zu bewahren und wenigstens in beschränktem Maße einigermaßen strukturiert vorzugehen.
Was mir fachlich am meisten zu denken gab, war, dass die technischen Führungskräfte überall fehlten. Ich rief auch meine Stammkunden an, um sie um Hilfe zu bitten. Niemand versagte mir diese Hilfe. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Andernach, Jan Deuster, brach seinen Urlaub in Frankreich ab, der Werkleiter von RheinHunsrück Wasser, Steffen Liehr, war ebenfalls froh, dass er sehr konkret helfen konnte. Meine Stammkunden unterstützten uns ebenfalls, indem sie teilweise von mir vergebene Aufgaben übernahmen. Alle zeigten Verständnis dafür, dass die laufenden Projekte – derer wir reichlich hatten – erst einmal pausieren mussten, damit wir uns wieder neu aufstellen konnten. Typisch für die ersten Tage nach der Flut war auch, dass mangels Kommunikationsmöglichkeiten und angesichts der Überforderung der Anlaufstellen oder in Unkenntnis solcher Anlaufstellen viele Hilfsangebote gar nicht zu uns durchdrangen.
Sonntag, 18. Juli 2021
Wir organisierten die Krisenstabsarbeit neu. Fünf Kernthemen identifizierten wir:
Welche Brücken können wir auf welche Weise nutzen? Dies war zunächst die entscheidende Frage, um überhaupt ein Lagebild zu erhalten. Die Brücke an der Kloster-Prüm-Straße in Heimersheim war für alle befahrbar und geöffnet. Die Piusbrücke in Bachem wurde als zentrale Brücke für die Hilfskräfte beschränkt geöffnet. Für die Bürger war daneben die Ahrtal-Brücke der A61 von eminenter Bedeutung.
Abbildung 1.2: Brücke am Ahrtor, Stadtteil Ahrweiler
Wo gibt es Strom? Diese Frage war auch zentral für die Lokalisierung des Krisenzentrums, das auf der nördlichen Ahrseite in der Heerstraße, in der Feuerwehrwache, entstand und auch deshalb seinen Platz dort erhielt, weil hier Strom und Wasser relativ schnell wieder verfügbar gemacht werden konnte. Es lag außerhalb des Überflutungsbereiches und konnte auch gut über den Autobahnzubringer angefahren werden.
Die drei weiteren Fragen waren: Wo gibt es Wasser? Wie ist die Abwassersituation? Wo läuft gerade die Müllsituation aus dem Ruder?
Wärme war glücklicherweise im Hochsommer von untergeordneter Bedeutung, auch Gas war uns damit zunächst nicht so wichtig. Strom und Wasser, das waren die wirklich wichtigen infrastrukturellen Elemente, die wir sehr zügig wieder brauchten. Dafür aber brauchten wir Experten. Einer dieser Experten ist Dieter Becker, der Wassermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.