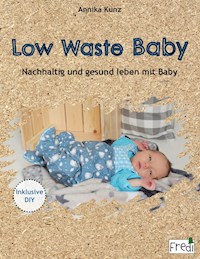
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wegwerfwindeln, Feuchttücher und Co. Wie schaffe ich es, Müll zu reduzieren? Wie trenne ich ihn richtig und wie fördere ich das Recycling? Babyausstattung und Spielsachen Was brauche ich wirklich und wie kann ich die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen berücksichtigen? Babykost Gesunde Ernährung und gesunder Planet? Als junge Familie gesund und ökologisch zu leben und dafür bezahlbare und einfache Lösungen zu finden, erscheint herausfordernd. Aber es ist gar nicht so schwer! Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit führt zu kreativen Ideen und macht richtig viel Spaß! In diesem Buch erhältst Du Informationen, Tipps und Do-it-yourself-Anleitungen, die Dich dabei unterstützen, mit wenig Aufwand sowohl Deinem Kind als auch der Umwelt etwas Gutes zu tun.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Einleitung
Nachhaltigkeit
Umwelt
Wirtschaft
Gesellschaft
Kreislaufwirtschaft
Abfalltrennung und Recycling
Restmüll
Biomüll
Kunststoffverpackungen
Altpapier
Glas
Getränkekartons
Aluminium
Sammlung von Elektroaltgeräten
Altkleider
Altholz
Rohstoffkreislauf von Babyprodukten
Windeln
Feuchttücher
Windelvlies
Babypflegeprodukte
Kleidung
Waschmittel
Möbel
Babykost
Stillen
Ernährung und Nachhaltigkeit
Klassifizierung von Lebensmitteln und Siegeln
Konventionell und biologisch/ökologischerzeugte Nahrungsmittel
Sonstige
True Costs
Planetary Health Diet
Vegetarisch oder vegan für das Baby?
Tipps für mehr Nachhaltigkeit in der Küche
Vermehrt regional
und saisonal essen
Weniger Fisch
und Fleisch essen
Verpackungen sparen
Weniger Lebensmittelabfälle
Gut lagern
Rezepte für regionale und saisonale Babykost
Grundrezepte
Babybrei für die kalte Jahreszeit
Babybrei für die warme Jahreszeit
Babybrei und Fingerfood für das ganze Jahr
Wickeln und Pflege
Stoffwindeln
Stoffwindelüberhosen
Windeleinlagen
Saugmaterialien
Windelsysteme
Feuchttücher selber machen
Wet Bags/Nasstaschen
Trockentücher
Selbstgemachte Wundschutzcreme
Reinigung und Hautpflege
Babyausstattung
Gebraucht kaufen oder leihen
An Wiederverwendung denken
Neutrale Farben
Langlebige Kleidung
Babybreizubereitung
Breigläschen und -schalen
Beschaffenheit von Spielsachen
Wickelauflage und -bezug
Mehrfachzweck bedenken
Wo das Baby schläft
Das Reisebett als Allrounder
Eine Allzweckwaffe namens Hochstuhl
Babyzimmermöbel müssen nicht nur für Babys sein
Der Wickelplatz
Das Baby baden
Nutzen, was schon da ist
Babyrasseln
Durchsichtige Boxen
Babylätzchen aus alten Mulltüchern
Vorwort
„Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen.“
(Indianische Weisheit)
Wer ein Baby erwartet, steht vor einem Berg an Anschaffungen und muss oft abwägen, was das Kind wirklich braucht.
Welche Qualität wird benötigt?
Wie viel braucht man davon?
Worin können sich Schadstoffe befinden?
Ist teuer besser?
Wie geht man mit beschränktem Budget um?
Muss es immer das Beste sein?
Auch mit älter werdenden Kindern hören diese Fragestellungen nicht auf. Es steht immer im Raum: Was ist gut für mein Kind?
Immer mehr Eltern möchten nachhaltiger leben und fragen sich, was neben dem Kind auch der Umwelt gut tut. Das gleichzeitige Wohlergehen von Kind und Planet ist dabei kein Widerspruch, sondern gehört zusammen:
» Jede Anschaffung für die Babyausstattung besteht aus Rohstoffen, die beim Schöpfen, beim Verarbeiten, beim Transport, evtl. bei der Nutzung und später bei der Entsorgung Treibhausgase freisetzen. Je mehr gekauft wird, desto mehr CO2-Äquivalente werden emittiert.
» Mit jedem Babybrei können Eltern Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der Bauern, den Treibhausgasausstoß, den Boden- und Gewässerschutz, die Artenvielfalt und die Tierhaltung nehmen.
» Durch jedes weggeworfene Einwegprodukt, wie bspw. eine Windel oder ein Feuchttuch, entsteht Müll und die eingesetzten Ressourcen werden dem Kreislauf entzogen.
Vieles, was wir als Eltern tun, hat direkte Auswirkungen auf unser Kind. Nicht zu vergessen sind zudem die indirekten Konsequenzen unseres Handelns. Alle nicht-nachwachsenden Rohstoffe, die wir verbrauchen, stehen unseren Kindern später nicht mehr zur Verfügung. Und mit jeder Treibhausgasemission erwärmen wir die Erde, auf der unsere Kinder zu Hause sind.
Wir können nicht leben, ohne Ressourcen zu konsumieren. Wir können es aber durch täglich neue Entscheidungen schaffen, nur so viel vom Planeten zu verbrauchen, wie uns zusteht, sodass es unsere Kinder auch in Zukunft gut haben werden und sie dieselbe schöne Erde vorfinden, wie wir sie heute kennen.
Einleitung
Mit dem Pariser Abkommen aus dem Jahr 2010 haben sich die Vertragsparteien darauf festgelegt, die Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2050 um 80 bis 95 % gegenüber den Emissionen des Jahres 1990 zu reduzieren. Die teilnehmenden Staaten möchten dadurch eine annähernde Treibhausgasneutralität erreichen und so die Erderwärmung und den Klimawandel entschleunigen.
Dieses Ziel erscheint sehr ambitioniert, wenn man sich vor Augen führt, dass dafür, den Angaben des Umweltbundesamts (UBA) gemäß, der Treibhausgasausstoß pro Person in Deutschland von aktuell ca. 8 Tonnen CO2Äquivalente auf weniger als eine Tonne CO2Äquivalente sinken müsste.
Welche Bereiche tragen zur CO2-Emission von Privathaushalten bei (siehe Abbildung)?
CO2-Gehalt des privaten Konsums
Quelle: Umweltbundesamt, eigene Darstellung. Bildmaterial von Pixabay: Pexels, S.Hermann & F. Richter, Free-Photos, Gerd Altmann, Hans Braxmeier.
„Sonstige Konsumgüter“ umfassen z. B. Textilien, Möbel, Papier oder Hygieneprodukte. Zu den „Dienstleistungen“ zählen bspw. Gesundheits- oder Finanzdienstleistungen.
Der höchste CO2-Ausstoß entsteht im Bereich „Wohnen“, da viele Gebäude mit fossilen Brennstoffen geheizt werden und/ oder Haushalte Strom aus nicht-erneuerbaren Energiequellen nutzen. Die „Mobilität“ verursacht auch viele Treibhausgasemissionen, u. a. weil die meisten Autos und LKWs mit fossilen Rohstoffen angetrieben werden und viele elektrisch betriebene Verkehrsteilnehmer ihre Energie ebenfalls aus nicht-nachwachsenden Rohstoffen beziehen. Die CO2-Äquivalente beim Thema „Ernährung“ setzen sich z. B. aus dem Methanausstoß von Rindern und der Lachgasemission von Böden zusammen. Darüber hinaus ist es sehr energieintensiv, Düngemittel herzustellen und Gewächshäuser zu beheizen.
Die Bedarfsfelder „Wohnen“, „Mobilität“ und „Ernährung“ erzeugen das meiste CO2. Um die gesamte CO2-Menge deutlich zu reduzieren, ist es also am wirkungsvollsten, die drei genannten Bereiche zuerst in Angriff zu nehmen.
Die Emission von Treibhausgasen und der Verbrauch von Ressourcen sind eng miteinander verbunden. Die Umwelt nimmt Emissionen auf und bindet sie. Der Wald ist bspw. ein guter CO₂-Speicher. Wer mit Holz heizt, setzt dieses wieder frei. Und derjenige, der mit Öl heizt, stößt das darin gebundene CO₂ aus. Der Unterschied zwischen Holz und Öl besteht darin, dass Holz nachwächst und Öl für immer aus dem Umweltkreislauf verschwindet.
Bei der Entnahme von Rohstoffen, der Verarbeitung und beim Transport von Gütern fällt CO₂ an. Außerdem verbrauchen Entsorgung und Recycling Energie und produzieren entsprechende Mengen an CO₂.
Treibhausgasfreisetzung und Konsum gehen Hand in Hand.
Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen Energie und Ressourcen effizienter verwendet werden. Das Problem hierbei ist jedoch der sogenannte „Rebound“-Effekt: Wenn etwas effizienter oder sparsamer ist, wird es öfter genutzt. Das neue Auto wird z. B. häufiger genutzt, weil es weniger Sprit benötigt. Die neue Geschirrspülmaschine läuft öfter, da sie sparsamer ist etc. Die Effizienzgewinne werden leider häufig durch den Rebound-Effekt geschmälert oder sogar aufgehoben.
Wir werden es also nicht vermeiden können, weniger zu konsumieren und schonender mit Ressourcen umzugehen; das bedeutet, nachhaltiger zu leben.
Es ist aber wichtig, dass ein nachhaltigeres Leben nicht Verzicht bedeutet, sondern Spaß macht und sich gut in den Alltag integrieren lässt.
Es gibt keine bessere Motivation für ein nachhaltigeres Leben als Kinder. Die jetzige Generation, das heißt WIR, legen den Grundstein für ihre Zukunft. Mit mehr Rücksicht auf die planetaren Grenzen kann die Erderwärmung verlangsamt und die Artenvielfalt bewahrt werden. Dadurch würden gesundes Trinkwasser und ausreichende Nahrungsmittel sichergestellt sowie Lebensraum erhalten werden – für unsere Kinder.
In diesem Buch erfährst Du mehr darüber, wie Du mit viel Freude und wenig Aufwand Deinen Alltag mit Baby nachhaltig und gesund gestalten kannst.
Nachhaltigkeit
Was bedeutet „Nachhaltigkeit“ eigentlich?
Nachhaltigkeit ist die gleichzeitige und gleichwertige Berücksichtigung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.
Was bedeutet das genau?
Umwelt
Schutz des Waldes: Durch Rodung wird CO2 freigesetzt, welches die Erderwärmung beschleunigt. Gleichzeitig verringert sich Verdunstungsfläche, was sich auf den Niederschlag auswirkt. Weltweit werden Wälder, auch Regenwälder, teils illegal gerodet, um darauf z. B. Flächen für die Tierhaltung, bzw. für das dafür benötigte Futter, und Plantagen für Palmöl zu schaffen.
Artenvielfalt erhalten: Mit einem ausgedehnten Landbau in Monokultur verringert sich die Artenvielfalt, insbesondere die der Insekten. Diese werden aber benötigt, um Blüten zu bestäuben und dadurch Nahrungsmittel zu produzieren sowie um Schädlinge zu essen. Ein ausgewogenes Ökosystem von Flora und Fauna schützt vor Schädlingsbefall und Krankheiten und erfordert einen geringeren oder gar keinen Einsatz von Chemie.
Boden- und Gewässerschutz: Der Einsatz von Pestiziden/Herbiziden und zu viel Dünger belastet den Boden und das Grundwasser. Zusätzlich fallen bei der Produktion von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln CO2-Äquivalente an. Auf den Feldern erzeugt zu viel Dünger Lachgas, das die Erde noch stärker erhitzt als CO2.
Rohstoffkreislauf erhalten: Nicht-nachwachsende Rohstoffe sind endlich und können nur einmal verbraucht werden. Bei Produkten aus fossilen Rohstoffen, wie bspw. bei auf Basis von Erdöl oder Erdgas gewonnenen Einwegartikeln, steht die Dauer der Herstellung (tausende bis Millionen Jahre) nicht im Verhältnis zur Nutzungsdauer. Ein Erzeugnis aus fossilem Material sollte also mindestens mehrmals benutzt oder zu einem großen Teil recycelt werden können, damit sich die Herstellung aus umwelttechnischer Sicht lohnt.
Ein Kunststoff auf petrochemischer Basis (bestehend aus Erdgas- oder Erdölkomponenten) hat nicht nur eine tausendjährige Entstehungszeit, sondern häufig auch eine sehr lange, Jahrhunderte dauernde, Abbauzeit. Er zerfällt in sehr kleine Partikel, Mikroplastik genannt, und reichert sich im Boden und in den Gewässern und schlussendlich in Lebensmitteln an.
Da fossile Energieträger sehr viel CO2 speichern, stößt deren Nutzung entsprechend sehr viel davon aus. Den Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) zufolge machten die CO2-Emissionen aus dem Bereich „Energie“ im Jahr 2013 97 % des gesamten CO2-Fußabdrucks Deutschlands aus. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch lag damals bei unter einem Drittel. Gleichzeitig heizten über drei Viertel der Haushalte mit Gas oder Öl. Die Verwendung fossiler Energiequellen trägt demnach einen sehr großen Anteil zum Klimawandel bei.
Nachwachsende Rohstoffe sind oft teurer als nicht-nachwachsende Ressourcen: Holzspielzeug ist in der Regel teurer als Plastikspielzeug, Polyester günstiger als Baumwolle usw. Der Umwelt- und Klimaschutz kostet Geld. Das kann sich jedoch nicht jeder leisten; zumindest nicht, ohne Prioritäten zu setzen. Das eigene begrenzte Budget sinnvoll einzusetzen, ist die zentrale Fragestellung, wenn man Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander verknüpfen möchte.
Wirtschaft
Mehrweg statt Einweg: Mehrwegprodukte sind in der Anschaffung zunächst teurer als Einwegartikel, allerdings lohnen sie sich in der Regel finanziell auf Dauer und schonen Ressourcen. Stoffwindeln z. B. erscheinen zu Beginn teuer, aber sie rechnen sich, je länger sie benutzt werden.
Nachhaltigkeit nachhaltig angehen:
» Es existieren sehr viele Arbeitsplätze in Branchen, die heute als umweltbelastend eingestuft werden. Die Beschäftigten müssen zunächst neue Arbeitsstellen finden, bevor ein Wandel erfolgen kann. In einem ersten Schritt braucht es dafür bessere und umweltfreundlichere Lösungen auf dem Markt sowie Verbraucher, die diese nachfragen. Dann können neue Arbeitsplätze geschaffen und ein für die Gesellschaft und die Wirtschaft schonender Prozess hin zu einer dauerhaften Veränderung angestoßen werden.
» Eine sofortige Entsorgung aller sich bereits im Haushalt befindlichen Einweg- und Plastikprodukte ist weder sinnvoll noch nachhaltig (es sei denn, es werden Schadstoffe darin vermutet), denn die Rohstoffe wurden schon verbraucht. Es würde abrupt sehr viel Müll anfallen und viele neue Ersatzanschaffungen benötigten eine Menge an Ressourcen für die Herstellung und den Transport etc. Altes zuerst aufzubrauchen bevor Neues angeschafft wird, ist nachhaltiger.
Soziale Unternehmen fördern: Durch eine Konsumentscheidung Unternehmen zu unterstützen, die fair mit ihren Angestellten umgehen und auf deren Gesundheit achten, fördert das Wohlergehen der Mitarbeiter und deren Familien und verringert u. a. die Ausgaben der Solidargemeinschaft für das Gesundheitssystem.
Bei regionalen Unternehmen kaufen: Hierzulande erzeugte Waren sind aufgrund des höheren Lohnniveaus in der Regel teurer als vergleichbare importierte Güter aus bspw. Fernost. Allerdings werden durch einen Einkauf heimischer Produkte die Umweltfolgekosten für den Transport gespart sowie Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und erhalten, wovon jeder selbst profitiert. Arbeitsplätze in der Region zu fördern, ist auch ein Bestandteil des Themenfeldes „Gesellschaft“.
Gesellschaft
Fair handeln: Fair gehandelte Produkte zu kaufen, erhöht den Lebensstandard in ärmeren Ländern und sorgt z. B. dafür, dass die Bauern nicht, bzw. nicht ungeschützt, gefährlichen Pestiziden ausgesetzt werden. Außerdem ermöglicht es ihnen ein ausreichendes Einkommen, sodass zum Beispiel deren Kinder zur Schule gehen können.
Nicht auf Kosten anderer leben: Nachhaltig zu leben bedeutet des Weiteren, nicht nur vor Ort Rücksicht auf Mensch und Natur zu nehmen, sondern auf der ganzen Welt.
CO2-Fußabdruck:Laut des UBA entsteht nur etwas mehr als die Hälfte der CO2-Menge, die bei der Herstellung der hier konsumierten Produkte anfällt, in Deutschland. Der Rest, also knapp die andere Hälfte, wird im Ausland verursacht. Durch den Güterimport führt Deutschland demnach CO2-Emissionen ein, oder anders gesagt: Ein Teil des CO2, das hier in Deutschland verbraucht wird, fällt belastend, bspw. in Form von Umweltgiften, im Ausland an.
Flächenfußabdruck:Alle Landflächen, die für die Erzeugung einer Ware benötigt werden, werden im Flächenfußabdruck zusammengefasst. Dem UBA zufolge liegt etwa die Hälfte des von Bundesbürgern beanspruchten Ackerlands (z. B. für Lebensmittel und Fasern) sowie zwei Drittel der verbrauchten Waldflächen (z. B. für Möbel oder Papier) im Ausland. Im Jahr 2010 war der Waldfußabdruck fast dreimal so groß wie die gesamte Waldfläche Deutschlands. Die Fläche Deutschlands reicht also nicht aus, um alle hier verbrauchten Produkte zu erzeugen.
Wasserfußabdruck:Die Wassermenge, die dafür verwendet wird, alle in Deutschland konsumierten Güter herzustellen, nennt man Wasserfußabdruck. Hierein zählt u. a. das Wasser, das für die Bewässerung von Plantagen verwendet wird, oder der Wasserbedarf von Tieren. Gemäß des UBA verbraucht ein privater Haushalt in der Bundesrepublik pro Person 121 Liter Wasser pro Tag. Der gesamte Wasserfußabdruck, also inklusive der Menge an indirekt verbrauchtem Wasser, liegt hingegen bei 7.700 Litern. Davon sind im Jahr 2011 zwei Drittel im Ausland angefallen. Deutschland importiert demnach große Mengen an Wasser. Werden Produkte aus wasserarmen Gegenden eingeführt, trägt die Bundesrepublik somit zur Wasserknappheit in diesen Regionen bei, weil sie das Wasser von dort verbraucht und den Einheimischen entzieht.
Fakt ist, dass hierzulande zu viel konsumiert wird. Bei dem jetzigen Lebensstil reicht, dem Bundeszentrum für Ernährung (BzfE) gemäß, eine Erde nicht aus. Es werden zwei davon benötigt.
Ressourcen sind begrenzt und wenn Einer über seinen Bedürfnissen lebt, bleibt einem Anderen zu wenig. Nachhaltig und fair zu handeln bedeutet, dass nicht zu Lasten anderer auf dieser Welt gelebt werden sollte. Und es heißt auch, dass wir heute nicht auf Kosten unserer Kinder leben sollten. Aktuell verbrauchen wir ihre Rohstoffe mit.
Es ist nicht leicht, den Lebensstandard zurückzuschrauben. Und das muss auch gar nicht sein. Mit mehr Wissen und bewussten Entscheidungen kann es gelingen, rohstoffschonender zu leben und Spaß daran zu haben. Ein erster Schritt hierzu ist es, Kreisläufe zu erhalten.
Kreislaufwirtschaft
Geschlossene Stoffkreisläufe schonen Ressourcen, da durch die Wiederverwendung von Materialien Primärrohstoffe gespart und Emissionen, die bei der Neuproduktion entstehen, vermieden werden.
Es gibt eine Faustregel, die fünf „R“ der Nachhaltigkeit:
Reuse (Wiederverwenden): Kann ich das nochmal verwenden?
Refuse (Ablehnen): Brauche ich das wirklich?
Reduce (Reduzieren): Kann ich bspw. eine Strecke zu Fuß statt mit dem Auto zurücklegen?
Rethink (Umdenken): Was kann ich ändern?
Recycle (Müllverwertung): Was kann gut aufbereitet werden?
Materialrecycling ist ein Teil der Müllverwertung. Noch besser ist es natürlich, Abfälle zu vermeiden, indem Gegenstände wiederverwendet werden, denn nicht alles, was entsorgt wird, kann recycelt oder anderweitig genutzt werden.





























