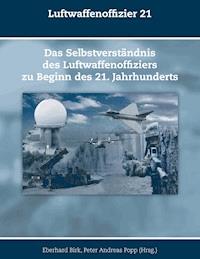
Luftwaffenoffizier 21 E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schriften zur Geschichte der Deutschen Luftwaffe
- Sprache: Deutsch
Der Leser erfährt damit Grundlegendes über das facettenreiche Selbstverständnis einer militärischen Berufsgruppe: zur Informations- und Bestandsaufnahme, für tieferes Nachdenken und - nicht zuletzt - für dessen tragfähige dynamische Weiterentwicklung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Joachim Wundrak
Gedanken zur Erwartung an junge Offiziere der Luftwaffe
Eberhard Birk/Peter Andreas Popp
Einleitung und Hinführung zum Thema
Rückblenden
Peter Andreas Popp
Das Bild und die Bildung des Offiziers der Luftwaffe aus der Sicht des Historikers
Eberhard Birk
Ein Rückblick auf General Johannes Steinhoff und dessen „Bild des Offiziers in der Luftwaffe“
Grundlagen
Markus Kurczyk
Der Offizier als Koordinator: „Nicht wirklich neu, oder?“
Marc Vogt
Der Offizier als Ausbilder, Erzieher, Führer und Kämpfer
Lutz Mehrtens
Der Offizier als militärischer Organisator und Manager
Michael Traut
Ein Luftwaffenoffizier in der Streitkräftebasis – Eindrücke aus der Bundeswehrgemeinsamkeit
Gabriele Voyé
Der Generalstabsoffizier der Luftwaffe
Björn Jantzen
Der Offizier des militärfachlichen Dienstes als Scharnier zwischen dem Offizier des Truppendienstes und dem Unteroffizier
Michael Hell
Erwartungshaltung „von unten“ – die „Feldwebel-Perspektive“
Kai Bratzke
Erwartungshaltung „von unten“ – die „Spieß-Perspektive“
Einsatzerfahrung
Johann-Georg Dora
Kommodore im Einsatz – Das Einsatzgeschwader 1 Piacenza. Führungserfahrungen im neuen Einsatzspektrum
Hans-Werner Ahrens
Das Bild des Transportflieger-Offiziers – Teamwork im weltweiten Einsatz
Klaus Habersetzer
Auslandseinsätze und ihre Auswirkungen auf das Bild des Offiziers der Luftwaffe. Gedanken aus Anlass meines 396tägigen Einsatzes in Afghanistan vom 31. August 2011 bis zum 29. September 2012
André Tiburcio
Der Offizier als Kämpfer
Dieter Schobesberger/Sabine Lübberstedt
Der Offizier als militärischer Berater im „multinational environment“
Florian Schmitt
Der Technische Offizier – Spagat zwischen Manager und militärischem Führer
Benjamin Matthias
Der Luftwaffenoffizier der Flugabwehrraketentruppe (FlaRak) im NATO-Auslandseinsatz. Die Mission ACTIVE FENCE TURKEY (AF TUR)
Erwartungshaltungen. Die Perspektive junger Offiziere der Luftwaffe
Karl Flemmig
Warum wird man Offizier des Truppendienstes der Luftwaffe?
Johannes Martin K.
Fliegen ja – aber wohin? Der militärische Fachdienstoffizier im fliegerischen Dienst – Ausbildung und Aussichten
Tobias Zimmermann
Berufsbild Offizier im Einsatzführungsdienst der Luftwaffe
Christian Becker
Piloten und andere Luftwaffenoffiziere…
Nicola Baumann
Sind Soldaten Mörder? – Oder: Unbequeme Fragen an einen Offizieranwärter der Luftwaffe
Yvonne Zschommler
Fliegerarzt in der Luftwaffe
Peter-Jin Semler
Der technische Offizier und seine Ausbildung – Eine kritische Betrachtung
Thomas Haslinger
Reserveoffiziere und ihre Ausbildung in der Luftwaffe am Scheideweg – ein zukunftsfähiges Konzept?
Reflexion und Weiterentwicklung
Karl Trautvetter
„Innere Führung“: Überkommenes Konzept oder Führungsphilosophie der Zukunft?
Christian Prestele
Königsweg Kompetenzorientierung?! – Idealtypische Überlegungen zu einem erweiterten Rollenverständnis
André Tiburcio
Leitbild Führungskräfte im Einsatz: Folgerungen für die Offizierausbildung der Luftwaffe
Dirk Egger
Luftwaffen-Identität und Selbstverständnis an der Offizierschule der Luftwaffe aus Sicht eines Inspektionschefs
Michael Traut
Führung lernen in Theorie und Praxis, oder: Warum machen wir eigentlich „kompetenzorientierte Ausbildung“? – Ein Appell an alle Beteiligten
Autorenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Gedanken zur Erwartung an junge Offiziere der Luftwaffe
Als ich gebeten wurde, ein Vorwort zu diesem Buch zu schreiben und damit einige Gedanken zu meiner Erwartungshaltung an junge Offiziere der Luftwaffe zu formulieren, sind mir eine Vielzahl an Gedanken und Erinnerungen an meine eigene Ausbildungszeit in der Bundeswehr wieder in den Sinn gekommen. Ich denke, dass ähnlich wie damals eine ganze Bandbreite an Motivationsgründen junge Menschen heute dazu bewegt, eine Karriere als Offizier anzustreben.
Es ist durchaus in Ordnung, wenn bei einem jungen Menschen bei der Berufswahl die Ausbildungsmöglichkeiten, die Erwartung eines interessanten und sicheren Arbeitsplatzes oder auch die besonderen Herausforderungen für außergewöhnliche Tätigkeiten, wie z.B. Kampfflugzeugführer, im Vordergrund ihrer Motivation stehen. Allerdings sollte, wenn Sie in sich hineinhören, zumindest eine Grundschwingung bei Ihnen zu verspüren sein, die Sie die Werteordnung und die Errungenschaften, die sich das deutsche Volk in den letzten Jahrzehnten hart erarbeitet hat, als verteidigenswert empfinden lässt. Nur so werden Sie in einem langen Berufsleben als Offizier vor sich selbst und Ihrem Diensteid bestehen können.
Eine Erwartungshaltung ist keine Wertschätzung, sie hat etwas Forderndes. Die Frage, ob eine Erwartungshaltung zu recht besteht, ist in der Welt von heute, in der man lieber „fordert“ als etwa selber etwas zu tun, keineswegs banal. Ich meine: die einzige gerechtfertigte Erwartungshaltung an Sie ist diejenige, die Sie selbst an sich stellen. Das meinte Schiller übrigens, als er in „Wallensteins Lager“ schrieb: „Sagt mir, was hat der Soldat an Gut und Wert, wenn der Soldat sich nicht selber ehrt?“ Und zwar nicht durch Sich-selbst-toll-finden, sondern durch das, was wir geschworen haben. Durch treues Dienen nämlich. Das ist deutlich mehr als das pünktliche Erscheinen zum Dienst und das Abarbeiten der Friedensroutinen. Es ist allerdings festzustellen, dass Begriffe wie „treu dienen“ und „tapfer verteidigen“ in unserer sogenannten postheroischen Individualgesellschaft nur schwer zu vermitteln sind.
Über Selbstverständliches sollten wir eigentlich nicht reden müssen: nämlich, dass der Soldat dem Staat Bundesrepublik Deutschland und dem Recht und der Freiheit des Deutschen Volkes verpflichtet ist. Dass sich daraus seine besonderen Befugnisse, Befehlsgewalt, Rechte und Pflichten ergeben und dass er ihm gegebene Befehle nach bestem Wissen und Gewissen ausführt und nicht nur abhakt. Am Ende hilft aber alles nur, wenn der Soldat einen Anspruch an sich selbst hat. Hier wird Ihnen die „Innere Führung“ ein wertvoller Ratgeber sein, wenn Sie diese in ihrem Kerngehalt verstehen lernen. Es geht um das schwierige Spannungsfeld, in dem sich Soldaten befinden: einerseits Befehl und Gehorsam, andererseits Rechte und Pflichten des mündigen Staatsbürgers in einer Demokratie.
Wir sollten uns nicht allzu viel darauf einbilden, dass die Offiziere der Bundeswehr in Umfragen ein höheres Ansehen genießen als die meisten anderen Berufe. Die wenigsten von uns haben dem Tod ins Auge geschaut; aber die Bereitschaft dazu wird von der Armee auch in einer postheroischen, ja pazifistischen Gesellschaft wie der unsrigen offenbar erwartet – und das drückt sich offenbar in der Wertschätzung des Soldatenberufs ganz allgemein aus. Es ist die Wertschätzung einer Gesellschaft, die ansonsten gewöhnt ist, alles kaufen zu können. Wie belastbar eine solche Wertschätzung ist, sei dahingestellt.
Das alles hat sicher auch mit einem nicht ganz einfachen Verhältnis sowohl der Bevölkerung als wohl auch der Soldaten zum Staat zu tun. Der Staat ist es aber, der den Rahmen für Aufstellung, Erhalt und Einsatz der Bundeswehr vorgibt: dass Deutschland sich aus wohl erwogenen sicherheitspolitischen Gründen vorzugsweise im Rahmen von NATO und EU militärisch engagiert, verändert den Dienst am Staat als Bezugspunkt soldatischen Tuns nicht.
Gibt es eine besondere Erwartungshaltung an den Offizier der Bundeswehr? Ja, solange sie nicht ein anderes Wort für Dünkel ist. Der Offizier ist schon heute und mehr noch in Zukunft militärischer Führer und Geführter zugleich. Beides muss man können, auch Führen ist Handwerk und Militär ein Instrument. Zugleich gilt die Forderung Clausewitz’ mehr denn je, dass „die Politik das Instrument verstehe, dessen sie sich bedienen will.“ Eine zeitlose Aufforderung an uns Soldaten, sich nicht auf das Handwerkliche zu beschränken. Der Offizier ist letztlich dort besonders gefragt, wo es um zwei Fragen geht: „Was macht Sinn?“ und „Wen muss ich mitnehmen?“.
Gibt es eine besondere Erwartungshaltung an den Offizier der Luftwaffe? Ja, nämlich an die als „Fachmann für Führung und Einsatz von Luftstreitkräften“. Fliegen tun alle Teilstreitkräfte – der Luftwaffe geht es um mehr, nämlich um die Überwachung, Sicherung und Beherrschung des Luftraums. Dass wir das können, glaubt uns Offizieren der Luftwaffe aber keiner schon unserer schönen blauen Uniform wegen – der Anspruch der besonderen Kompetenz zum Planen und Führen von Luftoperationen muss auch mit wirklichem Können erfüllt werden.
Mit zunehmendem Dienstalter wird Ihnen mehr und mehr Verantwortung übertragen, der Sie nach bestem Wissen und Gewissen gerecht werden müssen. Wenn Ihnen Soldaten unterstellt werden, insbesondere in der Funktion eines Disziplinarvorgesetzten gilt: Kümmern Sie sich um die Ihnen anvertrauten Leute! Das Abarbeiten der WDO reicht hier bei Weitem nicht.
Mir ist wichtig, an dieser Stelle noch ein paar Worte zur Kameradschaft zu verlieren.
Kameradschaft ist der Kitt einer militärischen Gemeinschaft, sie darf nicht verwechselt werden mit „Kumpeligkeit“ unter gleichgesinnten Alters- oder Dienstgradkreisen. Wir müssen darauf bauen können, dass einem Kameraden in Not oder Schwierigkeiten geholfen wird, egal welcher Dienstgrad betroffen ist oder ob uns der Betroffene sympathisch ist. Nicht umsonst hat der Gesetzgeber der Kameradschaft einen eigenen Paragraphen im Soldatengesetz gewidmet.
Ist das alles nicht zu viel verlangt? Mag sein! Kein militärischer Führer ist perfekt, und die Besten versuchen es erst gar nicht zu sein. Ich wiederhole es noch einmal: haben Sie vor allem eine Erwartungshaltung an sich selbst! Seien Sie Offizier der Luftwaffe und Gentleman. Ein Gentleman zeichnet sich im Kern nicht dadurch aus, dass er mit einer Hummerzange umgehen kann – sondern dass er einen bestimmten Anspruch an sich selber als Offizier der Luftwaffe hat!
Aufgaben und Herausforderungen, die auf die Bundeswehr und die Luftwaffe aufgrund der globalen Entwicklungen zukommen, werden unter Umständen noch weitaus fordernder werden, als die Generation der Offiziere vor Ihnen zu bewältigen hatte und hat. Leider ist die Bundeswehr nicht in allen Bereichen auf diese Herausforderungen ausreichend vorbereitet.
25 Jahre Friedensdividende haben ihre Spuren in personeller und materieller Ausstattung, Ausbildung, Training und damit bei Fähigkeiten und Kapazitäten hinterlassen. Haben Sie den Mut, Ihre Vorgesetzten in geeigneter Weise auf erkannte Defizite hinzuweisen und auf deren Abstellung hinzuarbeiten. Dazu werden Sie oft eine hohe Frustrationsschwelle und Standvermögen brauchen, doch es lohnt sich; jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist es wert getan zu werden.
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine erfolgreiche und erfüllte Dienstzeit als Offizier der Luftwaffe.
Mit kameradschaftlichem Gruß
Ihr
Joachim Wundrak
Generalleutnant
Einleitung und Hinführung zum Thema
Eberhard Birk / Peter Andreas Popp
Was „man“ von einem Offizier verlangt, er von sich selbst, sowie seine Vorgesetzten und Untergebenen von ihm – im Frieden, Alltag, Einsatz oder Krieg –, das alles ist (wie alles andere auch) dem Wandel unterworfen. Für das, was er nicht darf oder machen sollte, trifft diese Feststellung auch zu. Es gab Zeiten, in denen versucht wurde festzuhalten, was das „Bild“ des Offiziers ausmachte, meist aber blieb die Vorstellung eher diffus, als dass sie einer exakten Kodifizierung zugeführt worden wäre. Dies ist auch nicht anders zu erwarten, schließlich gibt es Selbstbilder und Fremdbilder – auch beim Militär...
Wollte man das Ergebnis einer fiktiven Umfrage unter unbeteiligten Zivilisten zugrunde legen, wäre die Bilder des Offiziers schnell skizziert: Der Offizier bildet im Frieden seine Soldaten aus und führt sie im Krieg (heute: Einsatz). Im Subtext, so wird man weiter annehmen dürfen, hat man den schneidigen Leutnant oder Hauptmann vor Augen, der den Sturmangriff gegen feindliche Stellungen führt, den sich auf langjährige Erfahrung berufenden Stabsoffizier, den Monokel tragenden adligen preußischen General mit ordensgeschmückter Brust, den in Stalingrad oder Berlin letzte Stoßtrupps befehligenden Wehrmachtsoffizier, den der SED-Parteiräson folgenden spröden NVA-Offizier mit kleinbürgerlichen Umgangsformen oder den nach zwei Wochen Truppenübungsplatz zurückkehrenden schmucklosen Verteidigungsspezialisten der Bundeswehr bis 1989/90, der nach und nach vom bewaffneten und studierten, uniformtragenden „Entwicklungshelfer“ abgelöst wurde, der seinerseits – nein: auch „ihrerseits“, um sich im gendermäßig korrekten Deutsch zu verstricken... – Selbstmordanschlägen „durchgeknallter Islamisten“ am anderen Ende der Welt ausgesetzt ist.1
Hinzuzufügen ist für die letzten Jahre, dass zu diesem Bild natürlich auch die Bewährung im Einsatz gehört – incl. dem Standhalten im Gefecht. Als Konstante gilt folglich überzeitlich generell: Offiziere waren und sind als militärische Führungselite – in ihrer klassischen Trias als Ausbilder, Erzieher und Führer – der Transmissionsriemen für eine nach militärischen Gesichtspunkten einsatztaugliche Armee.
Was ebenfalls immer galt, war, dass dieses „Bild des Offiziers“ stets in einem Spannungsfeld mehr oder weniger stark ausgeprägte Konturen erhielt. Dieses Spannungsfeld wurde erzeugt einerseits von dem außerhalb des genuin Militärischen liegenden Feld der Wehr-, Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- oder Militärpolitik eines Staates – den Erwartungen „von außen“ – und andererseits von zwei militärischen Bezugsgrößen „von innen“: Kriegsbild und Selbstverständnis des Offizierkorps als mehr oder weniger exklusive Korporation.2
Unter dem Kriegsbild versteht man dabei gemeinhin die theoretischkonzeptionelle Annahme resp. Erwartung hinsichtlich der Form der Konfliktaustragung. Dabei bedeutet der Versuch, die Ungewissheiten der Entwicklung von Kriegsbildern zunächst durch eine Vielzahl von Beschreibungs-, Analyse- und Begegnungsbegrifflichkeiten zu operationalisieren, keine neue Herausforderung.
Betrachtet man die Militärgeschichte Europas seit der Frühen Neuzeit, so sind verschiedene eruptive gesamtgesellschaftliche Umbrüche, genauer genommen Paradigmenwechsel, außerhalb des militärischen Raumes festzustellen, die gleichwohl die Handlungsspielräume militärischen Handelns fundamental veränderten. Sowohl die Entstehung des modernen Staates mit seinen stehenden Heeren, die Französische Revolution mit der Nationalisierung des Krieges, die Industrialisierung mit ihren (rüstungs-)technologischen Quantensprüngen, aber auch die Ideologisierung des Krieges in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Tendenz zum „totalen Krieg“ sowie die Nuklearisierung seit 1945 und die sich abzeichnende konfessionell überlagerte Kulturalisierung seit den Zeitikonen „11/9“ (Mauerfall 1989) respektive „9/11“ (WTC 2001) determinierten als „Militärische Revolutionen“ die jeweiligen Kriegsbilder fundamental: „Military revolutions [...] fundamentally change the framework of war [...] Military revolutions recast society and the state as well as military organizations. They alter the capacity of states to create and project military power. And their effects are additive.“3
Das äußere Kennzeichen einer „Militärischen Revolution“ ist demnach die Erhöhung des Grades für die Möglichkeiten der Kriegführung sich steigernden Potenzen durch sich (zufällig?) abwechselnde „harte“ und „weiche“ Katalysatoren wie Staat, Nation, Industrialisierung, Ideologisierung und Nuklearisierung sowie für die Gegenwart möglicherweise „Kultur“.
Unter Zugrundelegung dieser Typologie fällt auf, dass eine „Entgrenzung“ des Krieges insbesondere durch „weiche“ Instabilitätsfaktoren (z.B. gesellschaftliche Dynamik und damit verbundenen Mentalitätswandel) erfolgte: Dies gilt für die frühneuzeitlichen, konfessionell aufgeladenen Staatsbildungskriege vor dem „klassischen“ Absolutismus, der Nationalisierung im Zuge der Französischen Revolution, der Ideologisierung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie auch in der sich für das 21. Jahrhundert abzeichnenden Konstellation durch eine sich in asymmetrische Formen kleidende Re-Konfessionalisierung respektive sich auf die „Kultur“ oder religiös begründete Werte als Movens beziehende Kriegführung.
Jede Veränderung des Kriegsbildes ging einher mit einer Veränderung des Anforderungsprofils für die Soldaten – und parallel dazu unterlag auch das „Bild des Offiziers“ insbesondere im Hinblick auf die Professionalisierung einer Veränderung, gefolgt von einer Erweiterung ihres Selbstverständnisses.
In der (historischen) Regel führte dies – in der preußisch-deutschen Perspektive – zu einem Selbstverständnis oder „Bild vom Offizier“, welches sich selbst als sui generis sah. Abgeleitet wurde dieses Selbstverständnis daraus, dass der Offizier den existentiellsten aller Berufe habe. Die Sonderstellung erwuchs quasi aus der Verpflichtung und dem Vorrecht, für „den Staat“ (in seinen unterschiedlichen politischen Ausformungen) bereit zu sein, seine Soldaten in den Tod zu schicken oder selbst zu „fallen“. Dies erfordert(e) in der Tat besondere militärfachliche Qualifikationen und ein besonderes Verhältnis zur (jeweiligen) Staatsidee.
Während diese Vorstellung cum grano salis die deutsche Militärgeschichte in allen ihren Facetten bis 1945 nachhaltig dominierte, entstand diesbezüglich im Jahre 1945 ein gewisser Traditionsbruch – nicht nur weil sich mit seiner Wendung vom konventionellen zum nuklearen das Kriegsbild vollständig veränderte, sondern weil die Alliierten sowie die deutsche Politik und die Gesellschaft die Position des deutschen Militärs aufgrund der Vergangenheit anders konfigurierten und damit nachhaltig prägten.
Mit der Aufstellung der Bundeswehr hatten daher alle Soldaten – bei nicht wenigen verbunden mit mentalen Hemmnissen – ihr ideelles Selbstverständnis, nicht zuletzt auch aufgrund ihres Eides, an der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik auszurichten und für das neue Bild des deutschen Soldaten Grundtatsachen zu akzeptieren:
Die Bundeswehr wurde bei ihrer Entstehung 1955 in das bereits seit 1949 bestehende Verfassungsgefüge der Bundesrepublik zu ihrer Verteidigung und jener der Bündnispartner in der NATO eingebunden („Bündnis- und Verteidigungsarmee“).
Die Bundeswehr unterliegt dem Primat parlamentarischer Kontrolle von Streitkräften in einer Demokratie („Primat der Politik“ / „Parlamentsarmee“).
Die komplett neue außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische sowie innenpolitische Lage, aber auch die Rolle der Wehrmacht im NS-Staat und ihre Teilnahme an einem verbrecherischen Rasse- und Vernichtungskrieg machten ein neues Selbstverständnis des Bundeswehrsoldaten sowie eine neue Führungskultur im Spannungsfeld von Staat, Politik, Gesellschaft und Militär zwingend notwendig („Innere Führung“/„Staatsbürger in Uniform“).
Diese Konzeption trug die Bundeswehr als „Staatsbürgerarmee“ über fast fünf Jahrzehnte – mehr oder weniger integriert in der bundesrepublikanischen Friedensgesellschaft schon damals, im Schatten gesicherter Abschreckungsfähigkeit der NATO, als „Manöverarmee“ an der innerdeutschen Grenze.
Spätestens mit den sicherheitspolitischen Verwerfungen trotz Ende des Kalten Krieges (Stichwort „Nine-Eleven“!) – und dies vor dem Hintergrund von Megatrends wie zum Beispiel Globalisierung und Digitalisierung – wurde deutlich, dass die Erwartungshaltung im Hinblick auf „üppige Friedensdividenden“ ein hoffnungsfrohes und noch dazu absolut illusorisches (weil typisch deutsches?) Wunschdenken war.
Der Kalte Krieg hatte in weiten Teilen der Welt traditionale Konfliktmuster mit ihren ethnischen, konfessionellen und wirtschaftlichen, aber auch klassisch „nationalen“ machtpolitischen Dimensionen – seinem „Namen“ folgend – eben nur eingefroren. Fortan bestimmen Out-of-area-Einsätze auch den Alltag der „Einsatzarmee Bundeswehr“. Dies brachte für den „Staatsbürger in Uniform“ die Konfrontation mit dem historisch-kulturell Ungleichzeitigen.
Zuvor kaum tiefer betrachtete und dennoch immer komplex verschränkte Grundtatsachen wie Primat der Ökonomie in der postheroischen Gesellschaft der westlichen Welt, (Re-)Privatisierung des Soldaten und des Soldatischen, Symmetrie vs. Asymmetrie und ihre Auswirkung auf das Berufsbild des Soldaten (Stichwort: „archaischer Kämpfertypus“), Sinnstiftung durch Religion und Spiritualität in fremden Kulturkreisen (Stichworte: neue Phase der Weltanschauungskriege? Rechtsstaat vs. „Kalifat“?) sowie ein schwindendes Werte- und Geschichtsbewusstsein in den freiheitlich-demokratischen Staaten der „westlichen Welt“ stellen zuvor ungeahnte stete Herausforderungen dar.
Der „Staatbürger im Einsatz“ erlebt vor Ort die Brisanz, die der Verschmelzung von modernem Kriegsgerät, zeit(un)typischen Clanstrukturen und konfessionellen, aber auch finanziellen Interessen immanent ist. „Mittelalterliche“ mentale Dispositionen und „frühneuzeitliche“ Kriegsgesellschaften sowie globale Verfügbarkeit von Waffensystemen der Moderne in ihrer Vernetzung bilden auf absehbare Zeit eine fast unauflösliche „diabolische Trias“.
Die Signatur der damit weit jenseits eines bloßen Phänomens neu entstandenen sicherheitspolitischen Szenarien – die „neuen Kriege“4 – hat die Qualität der Herausforderung genauso fundamental gewandelt wie den Ort und die politischen und militärischen Methoden ihrer Begegnung. Die Bundesrepublik Deutschland wird folgerichtig in den Worten des ehemaligen Verteidigungsministers Peter Struck (SPD) „nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt“5.
Jahrzehntelang gültige Prinzipien – Allianzkonzentration, weitgehende Komplementarität von Sicherheitspolitik und Gesellschaft, Betonung staatlicher Bürgerpflichten, Verteidigung eines exakt definierten Territoriums –, die zuvor als unverrückbar galten, werden offensichtlich sukzessive über Bord geworfen. Die europäische Peripherie weitet sich zur globalen Perspektive: Interkulturelle Kompetenz wird eingefordert; dauerhafte Präsenz im Ausland, das nicht selten nach den Vorgaben des „Westens“ regiert und verwaltet werden soll, was zu einem De-facto-Status von Protektoraten bzw. Provinzen führen kann, zeichnet die Realität genauso aus wie die Bestreitung dieses von radikalen und gemäßigten lokalen Kräften als Besatzung perzipierten Anspruchs.
Auch für die „Einsatzarmee Bundeswehr“ gilt: Am Ende der „chain of command“ seht der „strategic corporal“6, der bei allen Einsätzen im „islamischkaukasischen Krisenbogen“ sämtlichen Herausforderungen verantwortungsvoll begegnen soll – militärisch professionell und der jeweiligen Situation „angemessen“; und dies im Wissen um die historischen, politischen und kulturellen Implikationen seines Handelns.
Mit diesem neuen asymmetrischen oder hybriden Kriegsbild7, das die älteren überlagert oder erweitert, verändert sich auch das Anforderungsprofil an alle Soldaten der Einsatzarmee Bundeswehr.
Doch die Bundeswehr ist nicht nur Einsatzarmee; sie bleibt mit ihrem zweiten Standbein eben auch eine Armee in Deutschland – mit politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen, in denen ihre Soldaten und (Stabs-)Offiziere (handlungssicher) zu agieren haben.
Der Beruf des Offiziers bleibt dabei spannend – auf verschiedenen Ebenen: die verschiedenen Rollenerwartungen „von oben“ aufgrund der Lebens- und Berufserfahrung einerseits, verbunden mit der Einsicht in die Komplexität des Berufsfeldes, und oft idealistischen Erwartungshaltungen „von unten“ bei jungen Offizieren zu Beginn ihrer Karriere andererseits, die meist einen militärischen Kodex, basierend auf Werthaltungen respektive ein „Bild des Offiziers“ als Kompass wünschen, kreieren ein Spannungsfeld.
Wer regelmäßigen Kontakt mit jungen (Ober-)Leutnanten oder Hauptleuten pflegt, merkt schnell, wie groß der Bedarf nach geistiger Orientierung ist. Daraus folgt notwendigerweise nicht, dass die TSKs oder die Bundeswehr einen Katechismus entwerfen sollten, bei dem man acht von zehn Punkten abhaken kann, um als passabler Offizier zu gelten – aber: eine grobe Zielangabe, die über den abstrakten, idealtypischen Staatsbürger in Uniform hinausgeht, wünschen sich doch sehr, sehr viele.
In diesem Zusammenhang sind übrigens auch die Initiativen junger, überwiegend Heeresoffiziere zu verorten, die mit den Büchern „Soldatentum“ und „Armee im Aufbruch“ auf der Ebene „Truppenlösung“ in dieses Vakuum vorstoßen.8 In die gleiche Richtung stoßen die zyklischen Versuche, erneut einen Säbel oder gar eine neue Galauniform in die Streitkräfte einzuführen. Dies sind die Folgen jener Wahrnehmung, dass sich Managermentalität und Mikro-Ökonomismus zu stark im Offizierkorps durchgesetzt hätten. Demnach stehen Kosten-Nutzen-Kalkulationen über einem Wertekorsett, das jungen OA und Offizieren als Orientierungshilfe dienen kann und auch soll.
Tatsächlich waren die beiden „Heeresbände“ auch ein Auslöser für diesen Band. Im Rahmen der Vorbereitung eines kleinen Seminars für den Lehrgang Führungstraining (Offiziere nach dem Studium) im Juli 2015 erfuhren wir von einem einsatzerfahrenen Hörsaalleiter (Hauptmann Tiburcio) an der OSLw, dass dieser an einem Leitbild für Führungskräfte im Einsatz arbeitet. Parallel dazu fand ein dreitägiges Seminar „Politische Bildung“ für zukünftige Einheitsführer der Luftwaffe in Wildbad Kreuth statt. Aus den abendlichen Gesprächen erwuchs so die Idee, den jungen, überwiegend Heeresoffizieren nicht das Feld „Bild des Offiziers“ alleine zu überlassen.
Um nicht Gefahr zu laufen, eine Verengung des Blickwinkels vorzunehmen, beschlossen wir schließlich, das Projekt auf eine breitere Basis zu stellen. Eine Ergänzung des Autorenkreis durch höhere und einsatzerfahrene Offiziere sowie jüngeren Hauptleuten und Leutnanten, aber auch die Bereitschaft zur Mitarbeit von erfahrenen Fachdienst- und Unteroffizieren, rundeten die Beiträge des vorliegenden Bandes so ab, dass eben nicht nur die Perspektive junger Soldaten „von unten“ ein „Teil-Bild des Offiziers“ schufen, sondern eine differenziertere Skizze des „Offiziers der Luftwaffe“ zu Beginn des 21. Jahrhundert zur Diskussion gestellt werden kann.
Daraus resultiert freilich, dass die vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen aus unterschiedlichen Dienstteilbereichen und Lebensaltern diesen Prozess der Herausbildung nicht einfach werden lassen.
Ob sich letztlich also daraus ein Bild des Offiziers der Luftwaffe entwickeln wird, liegt nicht in unserer Hand. Erkennbar ist jedoch, dass viele Offiziere – aufbauend auf dem „Staatsbürger in Uniform“ – „etwas Konkreteres“ haben wollen. Um dies vorweg klarzustellen: Die militärisch-funktionale Beherrschung des soldatischen Handwerks in der Bundeswehr erhält weiterhin ihre Legitimation durch die Rückbindung des militärischen Selbstverständnisses an „das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes“. Dieser Nukleus für den „Staatsbürger in Uniform“ bleibt – selbstverständlich – unverrückbar und bildet nach wie vor die Basis für jegliche, unverzichtbare Identitätsbildung im Rahmen der Inneren Führung, auch im Sinne eines „Bildes des Offiziers“ – einerlei ob der Bundeswehr oder des LwOffz21.
Indes: Diskussionsbeiträge leben auch von ihrer Pointierung. Unterschiedliche Grautöne in Pastell zu zeichnen, trägt nicht zur notwendigen Diskussion bei, die thematisch auf den Punkt gebracht lautet: „Wer sind wir, woher kommen und wohin gehen wir?“
Den Herausgebern ist es ein freudiges Anliegen, den Autoren erstens für ihre Bereitschaft zur Teilnahme an dieser Diskussion und zweitens für ihre professionelle Einhaltung von Vorgaben und Terminen zu danken. Darüber hinaus ist die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Miles-Verlag hervorzuheben.
Ohne ein Geleitwort eines wichtigen aktiven Drei-Sterne-Generals unsere Teilstreitkraft Luftwaffe aber wäre das Buch nur ein Buch geblieben, so ist es ein Statement (vornehmlich) der Offiziere der Luftwaffe zu Beginn des 21. Jahrhunderts und wird eben dadurch zum Zeugnis für das geistige Gefüge dieser Teilstreitkraft der Bundeswehr.
1 In Anlehnung an Eberhard Birk, Abschied vom Bild des Offiziers?, in: Eberhard Birk (Hg.), Einsatzarmee und Innere Führung (= Gneisenau Blätter 6), Fürstenfeldbruck 2007, S. 62-70, hier S. 62.
2 Teile der Einführung greifen zurück auf Eberhard Birk, Peter Andreas Popp, Einsatz und militärhistorische (Aus)Bildung – eine Kontradiktion? Überlegungen zu Notwendigkeit und Stellenwert, Inhalt und Vermittlung von Militärgeschichte in der Bundeswehr, in: Dieter H. Kollmer (Hg.): „Vom Einsatz her denken!“ Bedeutung und Nutzen von Militärgeschichte zu Beginn des 21. Jahrhunderts (= Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, Bd. 22), Potsdam 2013, S. 73-91.
3 The Dynamics of Military Revolutions 1300-2050. Ed. by MacGregor Knox and Williamson Murray, Cambridge [u.a.] 2001, S. 6 f.
4 Vgl. hierzu grundlegend Herfried Münkler, Die neuen Kriege, Reinbek bei Hamburg 2002.
5 So in einer Regierungserklärung zur Reform der Bundeswehr am 11.3.2004 vor dem Deutschen Bundestag; zit. nach »Das Parlament« vom 15./22.3.2004, S. 17.
6 Zu dem vom U.S.-Marine-Corps entwickelten Begriff des „strategic corporal“ siehe u.a. Gen. Charles C. Krulak, The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War, in: Marines Magazine (January 1999), S. 26-32.
7 Vgl. etwa Uwe Hartmann, Hybrider Krieg als neue Bedrohung von Freiheit und Frieden. Zur Relevanz der Inneren Führung in Politik, Gesellschaft und Streitkräften, Berlin 2015.
8 Martin Böcker/Larsen Kempf/Felix Springer (Hg.), Soldatentum. Auf der Suche nach Identität und Berufung der Bundeswehr heute, München 2013 und Marcel Bohnert, Lukas J. Reitstetter (Hg.), Armee im Aufbruch. Zur Gedankenwelt junger Offiziere in den Kampftruppen der Bundeswehr, Berlin 2014.
Rückblenden
Das Bild und die Bildung des Offiziers der Luftwaffe aus der Sicht des Historikers
Peter Andreas Popp
Vom unlängst verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt – er hatte als Offizier der Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg an der Ostfront erlebt und lernte als wehrübender Reserveoffizier die Bundeswehr noch in der Aufbauphase kennen, bevor er von 1969 bis 1971 die Armee der westdeutschen Nachkriegsdemokratie als Verteidigungsminister führte – ist das Diktum überliefert, er habe genug dumme Offiziere erlebt. Diese Aussage datiert aus der Gründungsphase der beiden Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München. Das heißt, sie entstammt dem Zeitabschnitt, als die „Bonner Republik“ einen Generations- und Mentalitätswechsel vollzog, der mit der Chiffre „1968“ plakativ und – für manche, auch nachträglich noch –, provokant vollzogen wurde. Aus dieser Zeit stammte nicht minder Steinhoffs Bild des Offiziers.
Historisch-politische Parameter
Nun sind seit diesem Zeitpunkt einige Jahrzehnte ins Land gegangen, und es ist deshalb die Frage zu stellen, welche historisch-politischen Parameter das Bild des heutigen Offiziers der Luftwaffe prägen.
Die Bundeswehr sollte und soll noch immer ein Gegenmodell zur preußischen Armee des Kaiserreiches, zur Reichswehr der Weimarer Republik und zur Wehrmacht des nationalsozialistischen Deutschland darstellen. Sie bildet(e) ebenfalls einen Gegenentwurf zur Nationalen Volksarmee der DDR. Die Bundeswehr ist eine Armee, die das Epochenjahr 1989/90 überlebte und die seitdem eine Strukturveränderung durchläuft, die ob ihrer Modalitäten nicht wenige Soldaten mit einem unguten Gefühl beschlich und beschleicht.9 Es sei nur am Rande vermerkt, daß sich hinsichtlich des Auslotens der gegenwärtigen Situation ein markanter Befund auftut: Grosso modo sind Unteroffiziere mit Portepee und junge Offiziere, was die Wahl offener Worte betrifft, spontaner. Dünner wird die Luft, je höher der Dienstgrad steigt und das Gravitationszentrum politischer Macht geographisch auf dem Karriereweg immer näher rücken soll. Pensionierte Offiziere sind dann hinwiederum sehr offenherzig: ob aus später Einsicht oder ob aus Gründen altersspezifischer Gesundheitstherapie, sei dahingestellt.
Wenngleich: Rechtlich hat sich in der Bundeswehr von 1956 bis heute doch nicht soviel verändert. Die Eidesformel ist noch immer dieselbe, sie bildet die überzeitliche Geschäftsgrundlage für den Dienst des Soldaten und lautet gemäß Paragraph 9 Soldatengesetz: „Ich schwöre/gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“. Doch es hat sich sehr wohl etwas verändert. Denn lässt man die nunmehr über 60-jährige Geschichte der Bundeswehr Revue passieren, so wäre um 1969 kein Werbestratege auf der Hardthöhe auf die Idee gekommen, der Bundeswehr den Slogan „Wir. Dienen. Deutschland.“ auf die Fahne zu schreiben.10
Damals, in der „Bonner Republik“ also, produzierte die Bundeswehr Sicherheit. Der Soldat sollte „kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen“. Sicherheit war – auch in der NATO seit dem „Harmel-Bericht“ von 1967 – definiert gemäß der Formel Verteidigung plus Entspannung. Die beste Verteidigung dieser Republik war nach Aussage eines ihrer Verteidigungsminister – Hans Apel (SPD) – eine gute Sozialpolitik! Die Bundeswehr als Wehrpflichtarmee war – ideologiekritisch betrachtet – damit laut Selbstanspruch Bestandteil der ökonomisch orientierten westdeutschen Waren-, Wettbewerbs- und (Dienst-) Leistungsgesellschaft, deren Identität gerade nicht auf nationaler Gloire beruhte, sondern ganz utilitaristisch auf dem Credo, ein guter, sprich friedlich geläuterter Produzent von Gütern zu sein, und dies denn doch mit globalem Aktionsradius, der allerdings keinesfalls für das Militär galt. Für VN-Einsätze stand die Bundeswehr nicht zur Verfügung und die Freiheit der Bundesrepublik wurde auch nicht im Mekong-Delta (Vietnam) verteidigt.
Wie sollte es denn auch anders sein als dass die Bundeswehr „Sicherheit produzierte“ und darin die Daseinsberechtigung fand nach der verkorksten ersten Hälfte deutscher (Militär-)Geschichte im Zwanzigsten Jahrhundert? Und was bedeutete der Eid – was wenigen ob der Amnesie hinsichtlich der Jahre der deutschen Teilung zwischen 1945/49 und 1989/90 kaum mehr bewusst ist –, „das Rech und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“, wo eben dieses deutsche Volk in zwei deutschen Staaten lebte – 4/5 im westlichen Deutschland, 1/5 in der DDR? Wäre der Kalte Krieg zu einem heißen mutiert, dann wäre vor dem „Finis Germaniae“ in nuklearer oder konventioneller Variante kurzzeitig eine Bürgerkriegssituation gegeben gewesen. Das bildete die Schizophrenie jener Jahre. Der gesunde Menschenverstand sollte gebieten, heute und in Zukunft sowohl der „Westalgie“ als auch – noch schlimmer, weil mit Diktaturrelativierung gepaart – der „Ostalgie“ zu entsagen.
Lassen wir dahingestellt, ob sich heute ein Bundeskanzler noch als „leitender Angestellter der Bundesrepublik Deutschland“ bezeichnen würde, wie es Helmut Schmidt einst tat. Als „Produzent von Sicherheit“ definiert sich die Bundeswehr jedenfalls seit Ende des Ost-West-Konfliktes nicht mehr. Vielmehr legt sie heutzutage auf ihre soziale Komponente – Stichwort „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ – ganz markant Wert. Dies zeugt von der Verinnerlichung eines sozialpolitischen Credos mit der offensichtlichen Botschaft, dass die Bundeswehr weiterhin ihren Teil zur Sozialstaatlichkeit Deutschlands beizutragen gewillt ist.
Doch wird damit bewusst, dass sich der Beruf des Soldaten und hier in Sonderheit der des Offiziers von anderen Berufen erheblich unterscheidet, die im „Volksheim Bundesrepublik Deutschland“ mit seiner bislang offenen Willkommenskultur und dem hohen moralischen Gestaltungsanspruch insbesondere auch auf dem Feld der Außen- und Sicherheitspolitik, Stichwort „Friedensmacht Deutschland“, anzutreffen sind?
Offensichtlich wird in der öffentlichen Meinung diese Frage bislang als irrelevant abgetan. Tatsache ist, dass das Bild desjenigen Offiziers, der dieser Bundesrepublik Deutschland dient, inzwischen reflektiert, dass die Bundeswehr mehr als das Doppelte an Jahren aufweist als die deutschen Vorgängerarmeen „Reichswehr“ und „Wehrmacht“ zusammen. Das Bild des Offiziers unterliegt heute einer Wandlung gesamtpolitischer Verhältnisse wie nie zuvor in unserer Geschichte.
Doch bleiben wir vorerst noch in der jüngeren Vergangenheit dieser Republik. Wie für deren Armee, so sollte auch für die in ihr dienenden Offiziere folgendes gelten: Sie sollten auf lichter Seite und in Kontrast stehen zu den militärischen Formationen, die gerade die deutsche Militärgeschichte in der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts prägten. Die Schwierigkeiten der Traditionsbildung einer Armee, die übrigens erst 1956 offiziell Bundeswehr genannt wurde, zeugen davon. Die Bundeswehr bildete die Armee eines Staates, der jedenfalls bis 1989 nicht glaubte, einmal selbst Geschichte zu sein bzw. werden zu können: Die Bundesrepublik als „Bonner Republik“ gibt es nicht mehr, wir leben nunmehr in der „Berliner Republik“, die ihrerseits im Augenblick im Begriffe ist, ihr gesellschaftspolitisches Koordinatensystem markant zu verändern. Folgt daraus auch ein Wandel der sicherheitspolitischen Geschäftsgrundlage?
Darauf aus Sicht des Historikers jetzt eine eindeutige Antwort zu geben, ist absolut verfrüht. Denkmöglich ist es. Und je denkmöglicher es ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, aus der hinwiederum – Vorsicht: wir betreiben jetzt Projektion von Denkmöglichem in der Zukunft! – gegenwärtig für rein denkmöglich Befundenes auch tatsächlich eintritt.
Wenn wir das Bild des Offiziers der Bundeswehr und noch dazu fokussiert auf den Offizier der Luftwaffe in historischer Hinsicht betrachten, so müssen wir uns einer Grundtatsache bewusst sein. Von Churchill stammt bekanntlich das Diktum, jeder Staat habe eine Armee – eine eigene oder eine fremde. Für die Bundesrepublik traf ab 1955/56 beides zu. Die Bundeswehr sollte die eigene Armee sein, und zwar voll integriert in Staat und Gesellschaft. Das schloss eine gesonderte gesellschaftliche Stellung des Offiziers in rechtlicher Stellung von vornherein aus, änderte aber nichts am „Sonderstatusverhältnis“ des Soldaten der Bundeswehr innerhalb der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundeswehr war, sicherheitspolitisch betrachtet, vollständig in die NATO integriert – mit Ausnahme jener Teile des Heeres, die als Territorialheer im rückwärtigen Bereich des westlichen Sicherheitsstreifens zwischen Flensburg und Garmisch disloziert waren. Die Paradoxie nationaler Souveränität der Bundesrepublik Deutschland bestand damals darin, dass neben der Bundeswehr auf westdeutschem Boden die Truppen der westalliierten Siegermächte die Sicherheit garantierten. Im Falle der Bundesrepublik Deutschland (alt) galten Churchills Worte nur eingeschränkt.
Die Bundeswehr wäre jedenfalls ohne die Konstellation des Kalten Krieges niemals so schnell nach dem Zweiten Weltkrieg und niemals in dieser Form gegründet worden. Der heutige „Umbau“ der Streitkräfte, wohin auch immer er führen mag, zeugt davon. Die Bundeswehr ist nach 1989/90 natürlich weiterhin für die Bewahrung der äußeren Sicherheit dieses Landes im Rahmen der Nordatlantischen Allianz und in den Konditionen europäischer Verteidigungsidentität zuständig. Im Innern sind ihr gemäß Artikel 87a GG ganz enge Grenzen gesteckt.
Und trotzdem hat sich etwas verändert, erst recht nach Aufnahme des Afghanistan-Engagements. Das Heer, und darin insbesondere die Truppengattungen Panzertruppe und Artillerie, hatte in den 1990er-Jahren eine Identitätskrise durchlebt, weil aus damaligem Zeithorizont nichts mehr so war, wie es zuvor gewesen war. Die Marine kam ganz gut über die Runden. Die Zukunft Deutschland als Exportnation liegt auf der See, wobei diesmal die deutsche „Blue Water Navy“ im Allianzrahmen „schippert“. Und die Luftwaffe...? Als generell später hinzugekommene Teilstreitkraft auch andernorts erlebt diese derzeit eine Phase, die Historiker dereinst wohl kennzeichnen dürften mit dem Terminus „Wuthering Heights“, zu Deutsch: „Sturmhöhe“, in Anspielung auf den Titel des Romans der bedeutenden englischen Schriftstellerin Emily Brontë (1818-1848)...
Mit einem Schuss Ironie gefragt: Ist sie gar schon Teil der Postmoderne geworden nach deren Grundsatz „Anything goes“? Offiziell kennt die Luftwaffe jedenfalls kein „Bild des Offiziers“, wie es 1969 noch von ihrem dritten Inspekteur, Generalleutnant Johannes Steinhoff, gezeichnet wurde; ungeachtet der Tatsache, dass Teile davon zu Beginn des 21. Jahrhunderts in das „Leitbild“ vom „Team Luftwaffe“ eingebettet worden sind.
Selbstbild und soziomentales Gefüge
Vom großen französischen Staatsmann Charles de Gaulle stammt der orientierungsgebietende Ausdruck „Une certaine idée de la France“; übersetzt: Eine bestimmte Vorstellung dessen, was Frankreich ist und – man ergänze! – nach seiner Ansicht auch zu sein habe. Frankreich beiseite: Ohne eine Eigendefinition derartiger Qualität ist weder eine in die Zukunft gerichtete Identitätsstiftung noch – allen Turbulenzen auf Sturmhöhe zum Trotz! – eine exakte Kursbestimmung möglich. Geometrisch gesprochen: Um die genaue Lage eines Objekts im Raum zu bestimmen, benötigt man bekanntlich noch einen dritten Punkt, der die „Peilbasis Luftwaffe“ abschließt. Er sei umschrieben mit der Formel: „Nur wer weiß, woher er kommt, der weiß, wohin er geht (oder vielleicht besser nicht hingeht)“.
Ganz gleich, ob man das Bild des Offiziers unter dem Aspekt „historisch“, „gegenwärtig“ oder „zukünftig“ betrachtet, also den Weg vom Historiker über den Politologen/Soziologen zum Futurologen beschreitet, eines dürfte dabei schnell klar werden: Die Beschreibung dessen, was ein „Offizier“ ist, muss in allen drei Fällen differenzieren zwischen Selbst- und Fremdbild. Es gibt also zwei „Zeichnungsebenen“. Weniger abstrakt für den konkret orientierten Zeitgenossen formuliert: es gibt die Perspektive „der Drinnis“ und der der „Draussis“. Das kann zu Friktionen führen, muss es aber nicht unbedingt.
Denn da gibt es noch immer – gewissermaßen als brückenschlagendes Element zwischen den beiden Perspektiven – die sprachwissenschaftliche Herleitung des Wortes „Offizier“. Sie verrät einiges, wenngleich es erscheinen mag wie eine Binsenweisheit, verbunden ihrerseits mit einer frustrierenden Erfahrung, die der Fachlehrer Militärgeschichte mit langjähriger Unterrichtspraxis (fast zwölf Jahre!) konstant macht: Auf die Frage, woher der Begriff „Offizier“ denn komme, passen i.d.R. weit über 95 Prozent der Offiziere im Lehrgang „Teil 3“.11 Die Bundeswehr ist jedenfalls insofern in die Gesellschaft integriert als diese die historischen Wurzeln der westlichen Zivilisation mittlerweile total vergessen hat. Oder liegt es vielleicht auch daran, dass die Unterrichtung im Fach „Militärgeschichte“ erst mit dem Epochenjahr 1789 einsetzt und es auf höheren Führungsebenen regelmäßig Überlegungen gibt, noch sehr viel näher an der „Gegenwart“ zu beginnen und dabei die Luftwaffengeschichte am liebsten mit der Bundesluftwaffe gleichzusetzen...?
Dabei ist es doch so einfach, die Antwort zu geben; vorausgesetzt man kann ein wenig Latein (womit wir bei den historischen Wurzeln Europas wären). Das heißt, (1.) man verfügt als Offizier über einen bildungsbürgerlichen Hintergrund (ohne den übrigens die „Innere Führung“ niemals entstanden wäre!) – oder (2.) man hätte als Nichtlateiner, im Regelfall ist bei technikorientierten Angehörigen der Luftwaffe davon ja auszugehen, aufgepasst im Englischunterricht in der Schulzeit oder in den allgemeinbildenden Lehrveranstaltungen, die an den Bundeswehruniversitäten offensichtlich nicht mit der der Sache gebotenen Ernsthaftigkeit aufgenommen werden, nachdem zuvor an der OSLw im Zuge verkürzter militärischer Ausbildung unter der Handlungsmaxime der „just in time production“ des Offiziernachwuchses „Bildung“ allein als „Ausbildung“ – wie gesagt: verkürzt auch diese! – verstanden wird.
Versäumte oder zu versäumende Lektionen? Oder gar Entstehung eines Offiziers, den die Bundeswehr, um den eingangs zitierten Bundeskanzler Helmut Schmidt mit seiner Warnung vor „dummen Offizieren“ aufzunehmen, gerade nicht gebrauchen kann? Gleichwie, und überdies immer eingedenk der Tatsache, dass man die Bedeutung einer Sache zumeist erst in der Praxis authentisch erlebt: der Befund gibt schwer zu denken.
Auf dass sich der junge Mensch als künftiger Vorgesetzter die sinnstiftende Frage „Was mache ich eigentlicher in beruflicher Hinsicht?“ beantworte und fortan sich nicht unbewehrt, weil konzeptionslos ins Minenfeld des rauen Lebens begebe, hier die sprachwissenschaftliche Erklärung: „Offizier“ leitet sich ab vom lateinischen Wort „officium“ und in diesem hinwiederum steckt das Wort „facere“; zu deutsch: „machen“ / „tun“. Der Offizier ist damit ein handlungsorientiertes Wesen, einer der durch „Tun“ Dinge bewegen will. „Officium“ hat mehrere Bedeutungen12:
die moralische Obliegenheit, Pflicht, Verpflichtung, Verbindlichkeit, Schuldigkeit, der Dienst, der Beruf (durchaus auch i.S. von Berufung);
das Pflichtgefühl, die Pflichttreue / Pflichtmäßigkeit, die Unterwürfigkeit, der Gehorsam i.S. jeder pflichtmäßigen Handlungsweise oder Handlung;
die Dienstfertigkeit, Dienstbeflissenheit, Höflichkeit, Gefälligkeit; auch i.S. der Höflichkeits- oder Ehrenbezeigung, Ehrfurchtsbezeigung, der Ehrendienst;
auch im sexuellen Sinne „der Dienst“ (als Beischlaf, so verwandt vom römischen Dichter Petronius mit seiner subtilen Kritik an Herrschaftspraxis und -personal Kaiser Neros);
der Dienst als das Amt, die Verrichtung, das Geschäft, die Amtsverrichtung, das Amtsgeschäft;
der Beamte (als Kollektiv), Gerichtsbeamte, Amtspersonal.
Was lässt sich aus diesem Bedeutungsspektrum ableiten? Eine ganze Menge: Erstens – Offiziere sind Funktionsträger; zweitens – Offiziere sind handlungsaktiv, d.h. sie müssen entscheiden; drittens – Offiziere weisen sich durch ein hohes Maß an Affektkontrolle aus, und dies ist ganz besonders wichtig in menschlichen Extremsituationen, d.h. unter hoher positiver wie negativer emotionaler Belastung; viertens – Offiziere sind tugend- und werteorientiert; fünftens – Offiziere sind nicht unbedingt bürokratieresistent; und schließlich sechstens – Offiziere sind Repräsentanten von Macht und überdies unterliegen sie ganz besonders dem Prinzip von Befehl und (vom Gewissen geleiteten) Gehorsam.
Wie weit eignet nun Offizieren das Menschlich-individuelle, insbesondere dann wenn sie als effiziente Funktionsträger doch funktionieren sollen? Historisch wie auch aktuell politisch betrachtet, stellt dies „ein weites Feld“ dar. Warum? „Das Individuelle“, der Faktor „Persönlichkeit“ also, lässt sich mit folgendem Raster (be)greifen. Es beschreibt die Typologie militärischer Berufsbilder in den Varianten: (1) progressiv-rational, (2) konservativ-traditional, (3) technokratisch-bürokratisch und (4) atavistisch-destruktiv. Während sich der progressiv-rationale Offizier (= Variante 1) an einem rational analytischen Kriegsbild und demokratischen Normen orientiert, sucht der konservativtraditionale Offizier (= Variante 2) Halt am (vermeintlich statischen und überzeitlichen) „klassischen“ Berufsbild. „Tradition und Geschichte“ (wie im Einzelnen dann ihrerseits voneinander abgegrenzt, das sei hier dahingestellt!) gehört für den „konservativ-traditionalen“ Typus zur unabdingbaren Identität des Offiziers. Nicht so in der Intensität für den progressiv-rationalen Offizier. Indes verbindet Variante 1 und Variante 2 etwas, was nicht zu unterschätzen ist: das sinnstiftungsorientierte Berufsbild.
Dieses sinnstiftungsorientierte Berufsbild wird bei den Varianten 3 und 4 durch das handlungsorientierte Berufsbild ersetzt. Während der technokratisch-bürokratisch orientierte Offizier (= Variante 3) eine deutliche Gefechtsfeld- und Technikorientierung aufweist, steht für den atavistisch-destruktiven Offizierstyp (= Variante 4) der Kampf Mann gegen Mann sowie die männerbündische Orientierung des Berufsbildes im Vordergrund. Was den Faktor „Geschichte“ betrifft, so ist dieser für den technokratisch-bürokratisch orientierten Offizier gewissermaßen irrelevant, allenfalls ein schmückendes Beiwerk mit Alibicharakter. Der atavistisch-destruktive Offiziertyp hingegen bevorzugt „Geschichte“ im Sinne der „res gestae Romanorum“, der Großtaten der Römer also. Es ist nicht verkehrt, die These aufzustellen, dass die Geschichte der Bundeswehr sowohl vor wie nach 1989/90 für den „Offiziertyp Variante 4“ zutiefst unattraktiv, weil strukturell langweilig ist, die früherer deutscher militärischer Formationen hingegen nicht.
Natürlich ist man schnell an den Grenzen der Erkenntnis angelangt, wollte man sich nur auf dieses Raster allein abstützen. Es beschreibt Idealtypen mit einer gewissen negativen Tendenzorientierung. Der Progressiv-rationale kann durchaus ein Faible für die geschichtliche Dimension seines Berufes haben; vielleicht sollte er es sogar regelrecht kultivieren, um demokratische Normen besser verinnerlichen zu können. Andererseits ist beim konservativtraditionalen ja durchaus eine Entwicklung in Richtung Moderne gegeben. Man betrachte nur die Hinwendung des deutschen Konservativismus zur Welt der Technik insbesondere nach 1945. Und genau so verhält es sich beim Typus „Technokrat/Bürokrat“. Sein Verhalten mag alles andere als spontan sein. Handlungssicherheit und damit Verlässlichkeit im Rahmen seines Aktionsraumes ist ihm nicht abzusprechen. Wie es um deren persönlichen Humor oder die Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen, bestellt sein mag, tut hier nichts zur Sache. Der „atavistische Destruktivling“ muss sich, gerade weil er um die Leidensfähigkeit seiner Selbst und seiner Untergebenen weiß, nicht unbedingt nach dem Kampf und Körperlichkeit bei jedem Wetter sehnen. Also Vorsicht vor Klischees!
Was ziehen diese Überlegungen für die Teilstreitkraft Luftwaffe nach sich? Die Forderung nach einer Einzelfallprüfung, wenn es um die Einschätzung einer Berufsgruppe geht, sowie die Überlegung, dass der Erfolg einer Teilstreitkraft auf dem Prinzip beruht: „Die Mischung macht’s!“ In ein- und derselben Persönlichkeit selbst können ja mehrere dieser Varianten durchaus angelegt sein. Darüberhinaus: Im Sinne der Berufszufriedenheit in Kombination mit dem individuellen Entwicklungspotenzial sollten die Tätigkeitsfelder des Offiziers hinsichtlich der Schwerpunktbildung variieren. Dabei kommt es sodann entscheidend darauf an, ob und – wenn dies in den allermeisten Fällen bejaht wird – wie früh der „Generalist“ oder der „Spezialist“ zu favorisieren ist. Dies hinwiederum hängt ganz entscheidend vom Aufgabenfeld ab, welches die Streitkräfte abdecken bzw. vom Grad der Kompetenz, welches die Führungsspitze zum Beispiel im Bereich der Lehre ertragen kann. Idealerweise sollte das „Team Luftwaffe“ in allen Bereichen über einen hohen Kompetenzgrad verfügen und eben nicht „kästchenkundlich“ sondern im übergeordneten Maßstab denken und handeln.
Mit dem „Denken“ und dem „Handeln“ hat es indes eine besondere Bewandtnis. Die präsentierte Typologie militärischer Berufsbilder stellt ein sinnstiftungsorientiertes dem handlungsorientierten Berufsbild diametral gegenüber. Das ist nicht unbedingt verkehrt, wenn man rekapituliert, zu welchen Zeiträumen z.B. bestimmte Unterrichtsinhalte und -methoden gelehrt werden. Derzeit setzt die Luftwaffe ja auf die kompetenzorientierte Ausbildung. Ob sie damit auf alle Zeit die pädagogische Avantgarde tatsächlich bildet, sei angesichts bildungspolitischer Ernüchterung im zivilen Bereich dahingestellt. Interessant jedenfalls ist, in welchen Bereichen tatsächlich Handlungsorientierung eindeutig vorherrscht: es sind die „Technokraten/Bürokraten“ und die „Kämpfer“. Übrigens: Beide Gruppen haben untereinander so ihre Verständigungsschwierigkeiten...
Doch wie ist es bestellt um die Reflexion vor, während und nach der Handlung? Die Anwendung des Führungsprozesses bedarf unbedingt der vorherigen Analyse einer in Angriff zu nehmenden Handlung. Die Herausforderung künftiger Ausbildung wird darin liegen, dem „Sinnstifter“ darzulegen, dass Sinnstiftung ohne Handlung/Handeln nicht möglich ist, und andererseits dem „Bürokraten/Technokraten“, dass Handlung ohne Sinn Unsinn ergibt und dies getreu dem Bonmot „Sie trugen seltsame Gewänder“ – hoffentlich keine Uniform der Luftwaffe! – „und irrten ziellos umher“. Soll heißen: Das eine schließt das andere nicht aus; und dies sei besonders betont in Deutschland als dem (noch immer!) Land gutgemeinter theorieverliebter Exzesse und sodann noch besser gemeinter extremer Handlungsweisen.
„Die Dritte Dimension…“
Vorsicht allerdings ebenfalls an dieser Stelle! Auch Pragmatismus kann zur Ideologie mutieren, und dann wird es wirklich gefährlich. Zweifellos interessant, indes doch zu weit würde an dieser Stelle führen, genau untersuchen zu wollen, wie die Luftwaffe als eigene Teilstreitkraft während des Vorherrschens eines ganz bestimmten Typus „militärisches Berufsfeld“ ins Leben gerufen wurde. Sie ist jedenfalls eine Teilstreitkraft, die die militärische Bühne betrat, als „Heer“ und „Marine“ schon jahrhundertelang das Feld beherrschten und jeweils ihren Typ des Offiziers längst ausgeprägt hatten.
Das kann entweder Segen oder Fluch oder beides zusammen sein. Die Luftwaffe stellt auf alle Fälle eine Teilstreitkraft dar, die die dritte Dimension militärisch nutzt, einen hohen Grad an Spezialisierung und Technisierung aufweist, ein von Anfang an höheres Maß an sozialer Durchlässigkeit bei der Besetzung von Spitzenpositionen bislang pflegte und einen Offiziertypus favorisiert, der seine Individualität – historisch gesehen – nicht verleugnet und sich als „Player“ ins Team einpasst.
Was die Selbstwahrnehmung ihrer Entstehungsgeschichte betrifft, so glaubte man in der Luftwaffe der Bundesrepublik Deutschland eingangs, unreflektiert an die „Reichsluftwaffe“ anknüpfen zu können – wären da nicht die technischen Herausforderungen der 1960-er Jahre (Stichwort „Starfighter-Krise“) gewesen und „gewisse historische Hindernisse“, die eben dies in zunehmend zeitlicher Reflexion über die „braunen Jahre“ und die Luftwaffe des NS-Regimes nicht erlaub(t)en: Für deutsche Jagdflieger des Zweiten Weltkrieges gilt inzwischen eine andere Kategorisierung als für die des Ersten Weltkrieges.13
Diese Erkenntnis ist m.E. unter anderem aus folgenden Gründen nicht einfach gewesen: Die Gründergeneration der Bundesluftwaffe hatte im Zweiten Weltkrieg gedient und baute nun an der Verteidigung der deutschen Nachkriegsdemokratie. Die pragmatisch orientierte U.S. Air Force als Taufpate der Bundesluftwaffe sah – die technischen und fliegerischen Leistungen der Reichsluftwaffe vor Augen – über deren ideologische Instrumentalisierung hinweg. Und sodann kam natürlich die Frage nach dem Soldatentypus hinzu.
Mit der Beherrschung der „dritten Dimension“ jenseits politischer Systemfragen geht ein alter Menschheitstraum in Erfüllung, nämlich „frei zu sein wie ein Vogel“. Das ist nicht dasselbe wie „vogelfrei“, trifft aber den Status des Angehörigen der Reichsluftwaffe recht gut: „Vogelfrei“ war er in dem Sinne, dass das Regime auch auf ihn „rücksichtslos“ (um ein Lieblingswort Hitlers aufzugreifen) zugriff, schließlich wurde die neugegründete Teilstreitkraft vom NS-Parteifunktionär Göring geführt. „Frei wie ein Vogel“ war dem Umstand zu verdanken, dass der reine Techniker es besser vermag, sich dem ideologischen Zugriff zu entziehen. Soll heißen: angewandte Mathematik ist zu ideologischen Zwecken verwertbar, aber an sich un-ideologisch. Warum wohl wollten viele junge Leute während des Zweiten Weltkrieges unbedingt zur Luftwaffe? Natürlich um sich einen persönlichen Freiraum zu verschaffen. Man geht bei der Luftwaffe schließlich nicht „kommisshaft“ miteinander um... Übrigens war es auch für abgeschossene alliierte Piloten angenehmer, in einem Stammlager der Luftwaffe die Kriegsgefangenschaft zu verbringen. Um der Idealisierung allerdings vorzubeugen, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass aus der Reichsluftwaffe nicht die Verschwörer des 20. Juli 1944 entstammten – der Reserveoffizier der Luftwaffe Caesar von Hofacker bildete die rühmliche Ausnahme; wohlgemerkt „Reserve“!
Soweit der kurze Exkurs, der allerdings zu der Überlegung führt, welche Faktoren denn insgesamt das Bild des Offiziers prägen. Es sind dies die Faktoren „Staat“, „Gesellschaft“, „Szenario(s) des Krieges“, der Mensch selbst als „Individuum“ (wie auch immer es sich dann im Militär entwickelt), schließlich „Geschichte“ und „Tradition“ sowie der Faktor „Technik“. Die Luftwaffe als eigenständige Teilstreitkraft in Deutschland tritt auf den Plan, als die industrielle Revolution im Begriffe war, von der zweiten in die dritte Phase überzuwechseln, definiert durch die Automobilisierung der Gesellschaft, der Produktion synthetischer Werkstoffe und den Aufwuchs des tertiären Sektors. „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“ heißt es, und so muss als prägendes Element für das „Bild des Offiziers“ der Faktor „Mentalität(en)“ unbedingt hinzugezogen werden, worunter neben „Religion“ auch das Thema „Genderfragen“ von Belang ist.
Zur industriellen Moderne zählt auch die Emanzipation der Frau. Die Luftwaffe von ihrem Selbstverständnis und von ihrer „Spätgeburt“ her betrachtet, hat erheblich weniger Probleme als Heer und Marine, Frauen als Soldaten und Vorgesetzte zu akzeptieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dasselbe gilt hinsichtlich der freiwilligen Akzeptanz anderer Genderfragen insbesondere in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren – und dies ungeachtet der Tatsache, dass der Begriff „Gender“ teilweise absurde Stilblüten grammatikalischer Natur zeitigt und gemeinhin den Eindruck erweckt, immer dann wenn man keine ernsthaften Probleme (pardon: „Herausforderungen“) habe, wird es Zeit, sich neue zu schaffen.
Kurzum, die Gender-Frage als Aufhänger genommen und im Sinne klarer Zielansprache fortgefahren: es gibt Dinge, die sind wichtig („Gender“-Fragen sind wichtig, weil es dabei meistens um die Frage der Diskriminierung geht...). Und es gibt Dinge, die sind dringlich, ja sogar wirklich dringlich. Sodann gilt es gemäß dem „Eisenhower-Prinzip“ zu entscheiden: „Was ist was?“, so dass (1.) Dringliches nicht mit Wichtigem verwechselt wird; (2.) nach Klärung dieses Sachverhalts Dringliches dann auch mit dem entsprechenden personellen und materiellen Mittelansatz gelöst wird und (3.) aus Wichtigem im Sinne perspektivischer Daseinsvorsorge gar nicht erst Dringliches entsteht.
Selbstredend setzt das klar strukturiertes Denken und sodann beherztes Handeln voraus. Zum Bild des Offiziers der Luftwaffe gehört eine dementsprechende Prägung. Sie sollte immer gefasst sein in der Trias „Bildung – Ausbildung – Erziehung“. Anders formuliert: Als Offiziere der Luftwaffe haben wir es mit der „dritten Dimension“ immer zu tun. Das erfordert generell Reaktionsschnelle und geistige Beweglichkeit (dies nicht zu verwechseln mit „Opportunismus“!). Luft heißt aber nicht Wind. Was die Luftwaffe am wirklich allerwenigsten brauchen kann, sind Offiziere vom Typ „Windbeutel“ und „Macher“, die „heiße Luft in Tüten“ – auf welcher Führungsebene auch immer – wohlfeil als Lösung anbieten. Also: keine „Luftikusse“!
Der Faktor „Staatlichkeit“ und seine Konsequenzen
Wie nun entsteht das „Bild des Offiziers“? Prozesshaft, wie Herkommen und Entwicklung des Berufes „Offizier“ belegen, und was auch der „a-historischen“ Luftwaffe mit ihrer sehr kurzen Geschichte ins Stammbuch geschrieben sei: Das Berufsbild des Offiziers als historische Größe und zugleich ausstaffiert mit professionellem Format steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen Staates. Dieser kommt zaghaft auf spätestens ab dem Epochenübergang vom Mittelalter zur Neuzeit und nimmt dann immer mehr Fahrt auf. Geistige Grundlage dafür war die Wiedergeburt der Antike, wörtlich die Renaissance im Italien des 14. Jahrhunderts. Die Militärreformen eines Moritz von Oranien (1567-1625), durchgeführt während des Freiheitskampfes der Niederländer gegen die spanischen Habsburger, belegen die erstmals intensive Rezeption antiken (römischen) Militärwesens. Fortan sind drei Dinge hinsichtlich des Bildes vom Offizier besonders zu beachten.
Erstens: Das Römische Reich war kein moderner Staat, sondern ein am Schluss multiethnisches Gebilde mit zunehmender Integrationsunfähigkeit. Dessen Soldaten standen loyal zur politischen Herrschaft immer mehr unter der Maßgabe personenbezogener Loyalität, was seinerseits im Übrigen auch den Verfall der Institutionen des Reiches belegt.14 Für das Bild des Offiziers ist von ganz entscheidender Bedeutung die Frage von Führer und Gefolgschaft, also die Frage der Autorität: Warum gehen junge Leute zum Militär? Warum streben sie dort Leitungsfunktionen an? Warum unterwerfen sich Menschen überhaupt der Führung eines anderen? Und wem schuldet der Offizier die höchste Loyalität? Ist es Gott? Ist es eine konkrete weltliche Person oder ist es eine ganz bestimmte verfassungsmäßige Ordnung? Sind es materielle Erwägungen/Gegebenheiten, die Loyalität bedingen? Oder sind es ideelle Gründe, die dafür sprechen, sein Leben (als Offizier) einer politischen Ordnung oder einer Persönlichkeit hinzugeben?
Zweitens: Die Entwicklung zum modernen Staat zeichnet sich nicht allein durch das „Dreigestirn“ Staatsgebiet – Staatsvolk – Staatsmacht aus sondern insbesondere auch durch die Fähigkeit politischer Herrschaft, „Militär in Permanenz“, ein „stehendes Heer“ also, dank geregelter Steuereinnahmen dauernd zu unterhalten. Zum modernen Staat gehört auch die Trennung von politischer Herrschaft in „Person“ und „Institution“.15 Der Weg vom Monarchen i.S. des „der Staat bin ich“ (Ludwig XIV.) zum Monarchen als „erstem Diener des Staates“ (Friedrich II., d.Gr.) ist alles andere als ein einfacher. Doch für die Definition von Loyalität bedeutet es, dass der Offizier in einer parlamentarischen, sprich wirklich aufgeklärten Monarchie nicht dem König als Person, sondern dem König als Institution Loyalität schuldet, wobei der Monarch seinerseits fest ins parlamentarische System eingebunden ist. Die Trennung von Regierungsamt und Person im Amt fällt in demokratisch orientierten Republiken leichter. Hier schuldet der Offizier dem Verfassungsgefüge Gehorsam, und dies fordert intellektuell dem militärischen Personal ein höheres Maß an Abstraktionsfähigkeit und damit auch an politischer Bildung i.S. der Institutionenkunde ab. Für den Grad der Rechtsstaatlichkeit eines Gemeinwesens, überhaupt das Vorhandensein von Rechtsstaatlichkeit, ist übrigens von schlagender Beweiskraft, ob der Soldat die Pflicht zum absoluten, also unbedingten Gehorsam hat. Kurzum: nur Diktaturen kennen den unbedingten Gehorsam.
Gerade deshalb ist es auch für den Offizier der Luftwaffe unerlässlich, sich (1.) mit dem preußischen Reformwerk von 1807ff., repräsentiert militärischerseits durch Scharnhorst, Gneisenau und Clausewitz, und (2.) mit dem „Aufstand des Gewissens“, also dem militärischen Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime aus ethischen Gründen, auseinanderzusetzen.
Wer ersteres streicht, versteht nicht, wie positiv das Gedankengut der Aufklärung – immerhin die Grundlage westlichen politischen Denkens! – im Militär wirkt bzw. wirken kann. Leistung und Leistungsethos jenseits sozialer Schranken werden mit dem Reformwerk hochgehalten! Dasselbe gilt für den Faktor „Bildung“, ohne den Ausbildung und Erziehung im luftleeren Raum ohne ethischen Kompass schweben. Die preußischen (Militär-)Reformer von 1807 belegen anschaulich, dass der Beruf des Offiziers nichts zu tun hat mit dem Heischen nach Beliebtheit, und das Reformwerk zeigt überdies, welch langer Atem notwendig ist, um für notwendig Erachtetes in die Tat umzusetzen.
Wer das letztere, den „Zwanzigsten Juli“, relativiert, der hat die existentielle Tiefendimension des Offizier-, überhaupt des Soldatenberufs nicht begriffen und wird sie zum Schaden der Allgemeinheit auch in Zukunft nicht begreifen. Der „Zwanzigste Juli“ steht überdies für ein gänzlich un-opportunistisches Verhalten, für die Entscheidung gegen Karrierismus sowie Gleichgültigkeit gegenüber Machtmissbrauch.16 Es geht bei diesen beiden Traditionssäulen um die Grundlagen von Demokratie als Lebensform. Und wie diese scheitert, dafür geben sowohl die Revolution von 1848/49 mit der Frankfurter Reichsverfassung wie auch die Weimarer Republik mit ihrer Verfassung frustrierende Fallbeispiele ab.
Drittens: Die letzten drei Jahrzehnte in Deutschland sind geprägt durch eine Entstaatlichung quantitativ nicht zu unterschätzender bisheriger Sphären von Staatlichkeit. Dies alles geschah unter mikroökonomischer Perspektive gemäß dem Leitwert „good governance“; also auf die einfache Formel gebracht: „Mehr Wirtschaft, weniger Staat“. Es handelt sich m.E. um eine Entwicklung, die hinsichtlich des erreichten Ausmaßes an Entfremdung auch in den Streitkräften gar nicht kritisch genug betrachtet werden kann. Auch die Bundeswehr weiß ja im logistischen Bereich davon nicht nur ein einziges Liedchen zu singen. Es ist der Stoff für Trauergesänge! Richtig problematisch wird es, wenn mittels Entstaatlichung von Gewalt der Soldat als Garant des staatlichen Gewaltmonopols, gleich ob i.S. innerer oder äußerer Sicherheit, davon betroffen ist. Und es geht nicht minder um die Kohärenz der „Firma Bundeswehr“ wie auch um Verantwortung im monetären Bereich! Er muss sich in Sachen „Wirtschaft“ natürlich auskennen, aber er ist kein staatlich besoldeter Börsenjobber. Der Soldat der Bundeswehr, und das heißt auch der Offizier der Luftwaffe, schuldet Loyalität der Bundesrepublik Deutschland als freiheitlichdemokratischem Rechtsstaat. Ihr und nur ihr allein.
Öffentlichkeit und politische Verhaltensethik
Was die reinen Militärhandwerker gerne verkennen – und man könnte dabei angesichts der vom Militär zu verursachenden Schäden durchaus von einer „Lebenslüge des Soldaten“ sprechen! – ist das Faktum, dass der Soldat, und hier im Besonderen der Offizier, einen extrem politischen, also einen absolut öffentlichen Beruf bekleidet. Der Offizier steht überdies in einem ganz besonderen Sonderstatusverhältnis zum Staat hinsichtlich der Treueverpflichtung innerhalb des Ordnungsrahmens des bedingten Gehorsams. Immer dann, wenn Staat und Gesellschaft nicht konträr zueinander stehen, was oszillierend in freiheitlich-demokratischen Ordnungen immer der Fall ist, sollte gerade der Offizier trotz seines aufgrund der Führungsfunktion gesteigerten Sonderstatusverhältnisses nicht konträr zur Gesellschaft stehen.
Ein Spannungsverhältnis besteht gleichwohl, auch wenn die auf alle Dienstgradgruppen anzuwendende Formel vom „Staatsbürger in Uniform“ dieses zu überbrücken oder sogar zu entschärfen versucht. Ein interessanter Befund: Noch nie in der deutschen Militärgeschichte war eine Armee so demokratisch orientiert wie die Bundeswehr, und noch nie war eine Gesellschaft wie die heutige sich demokratisch dünkende deutsche so desinteressiert am Militär. Traurig aber wahr: Für die Gesellschaft ist dies aus der Sicht eines überzeugten Demokraten, der an die Verteidigungswürdigkeit eben dieser Staats- und Gesellschaftsordnung bewusst glaubt, nicht unbedingt ein Kompliment.17 Wohl wahr, öffentliche Meinung ist nicht gleichzusetzen mit veröffentlichter Meinung. Das sei Angehörigen der „Generation Facebook und What’s App“, also der Altersgruppe unter 35 plus mit ihrer ausgeprägten Sehnsucht nach immer positiver Bestätigung und nach „Action“ ausführlich ins Stammbuch geschrieben. Entscheidend hinsichtlich des tatsächlichen Bildes des Offiziers ist, dass dieser seinen Beruf wohl wie kaum ein anderer in Deutschland öffentlich rechtfertigen muss.
Zum Selbstbild des Offiziers gehört das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das sich Verlassen-Können auf gemäß der Dienstgradhierarchie übergeordnetes, gleichrangiges oder untergebenes Personal sowie, insbesondere beim Personal der Luftwaffe ganz ausgeprägt, der Glaube an den „Vorsprung durch Technik“. Es gehört jedoch zunehmend zum Erfahrungsschatz der Betroffenen, dass dieses Selbstbild zu ergänzen ist um das Prinzip Hoffnung. Denn man meint, die Technik zu beherrschen, und der Alltag zeigt, wie die (fehlerhafte) Technik den Menschen beherrscht und eine Großorganisation paralysiert – Tendenz fortschreitend.
Vielleicht liegt es daran, dass die Disposition des Luftwaffensoldaten hinsichtlich der Machbarkeit der Dinge durch „die Technik“ sehr, sogar zu ausgeprägt ist? Bei der Einführung von Großgerät in die Truppe ist wahrzunehmen, wie diese Naivität stetig auf die harte Probe gestellt wird. Nicht minder anfällig ist das Personal der Luftwaffe für die Virtualität der Dinge, was früher oder später, sofern nicht deutlich in unserer Ausbildungsorganisation gegengesteuert wird, fatale Folgen haben dürfte. Das bisherige Format der Auslandseinsätze der Bundeswehr liefert dafür schon erste Hinweise. Es ist mehr als ein Gebot der Stunde, wenn das Bild des Luftwaffenoffiziers den Gedanken der Loyalität in engster Verbindung mit dem Leitwert „Autonomie des Menschen in Uniform“ sowie dessen Bereitschaft zum Handeln auf Grundlage der Selbstreflexion widerspiegeln würde.
Kann andernfalls in der Luftwaffe noch „souverän“ agiert werden? Wohl kaum. Und man täusche sich nicht: Der Hinweis auf die Schwierigkeiten mit der deutschen Militärgeschichte erklärt eine ganze Menge, jedoch nicht alles. Man kann nicht alles auf die Geschichte schieben! Dennoch, was erschwert – historisch betrachtet – eine breite Akzeptanz des Militärs und seines Führungspersonals in Deutschland? Was zeichnet den Beruf des Soldaten in einer postheroischen Zivilgesellschaft negativ?18
Es ist beileibe nicht allein die NS-Zeit als alleiniger Grund anzuführen, auch wenn diese dank tagtäglicher Medienpräsenz noch immer massiv wirkt und ob der damals begangenen Grausamkeiten singulär ist. Das „Dritte Reich“ steht für die rassistische Pervertierung des deutschen Nationalstaats, für Massenkonsens und Terror, für mehr als nur die „Verstrickung“ der Wehrmacht in Aggression und Genozid sowie für den absoluten Werteverlust. Einen „Vorgeschmack“ auf das, was mit dem 1. September 1939 („Fall Weiß“, der deutsche Angriff auf Polen) und gesteigert mit dem 22. Juni 1941 („Unternehmen Barbarossa“, der deutsche Angriff auf die Sowjetunion) eintreten sollte, verrät folgendes Anforderungsprofil an den Offizier im NS-Staat, artikuliert von Generaloberst Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Heeres seit Februar 1938: „In der Reinheit und Echtheit nationalsozialistischer Weltanschauung darf sich das Offizierkorps von niemandem übertreffen lassen. Es ist der Bannerträger, der auch dann unerschütterlich [sich erweist], wenn alles andere versagen sollte. Es ist selbstverständlich, dass der Offizier in jeder Lage den Anschauungen des Dritten Reiches gemäß handelt, auch dann, wenn solche Anschauungen nicht in gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen oder dienstlichen Befehlen festgelegt sind.“19
Wenn man nur einen kurzen Augenblick reflektiert, dass auf Grund einer solchen Befehlslage aus vom NS-Regime missbrauchten Soldaten schnell selbst willentliche Beihelfer und Mittäter bei Kriegsverbrechen werden konnten, wirkt es um so peinlicher i.S. versäumter Lektionen, warum die Bundeswehr sich mit dem Wehrmachtserbe so schwer tat.
Das von Brauchitsch gezeichnete Bild steht völlig konträr zum gewissensgeleiteten Gehorsam und dem den Auslandseinsätzen der Bundeswehr zugrunde gelegten Bild vom „Miles protector“, also des Soldaten als stillen Helfer und Retter in Uniform. Für letzteres liefern übrigens die drei Traditionssäulen der Bundeswehr (1.) Preußisches Reformwerk von 1807ff.“, (2.) „Aufstand des Gewissens gegen Hitler und NS-Regime“ sowie (3.) die eigene Geschichte der Bundeswehr zumindest bis in die 1990er-Jahre hinein so gut wie keine Musterfolie. Will man den „Miles protector“ pflegen, so ist ein neuer Traditionserlass unumgänglich.20
„Für welchen Weltgedanken kämpfen wir?“, so lautet immer mehr die drängende Frage bei der Definition des Mittelansatzes für Auslandseinsätze der Bundeswehr.21 Unbefangen die Antwort darauf geben zu können mit den Worten, es sei der kosmopolitische Charakter des deutschen Nationalstaates, wäre angesichts der Militärgeschichte bis 1945 unter Ausblendung der NS-Herrschaft sowie der Militärgeschichte zwischen 1945 und 1990 wirklich mehr als gewagt. Kosmopolitisch war weder die deutsche Geisteswelt zur Gänze noch die deutsche Sicherheitspolitik des deutschen Nationalstaates zwischen 1871 und 1932/33 gestrickt.
Allgemein betrachtet, ist das Bild des Offiziers historisch mit Grautönen versehen durch den Umstand, dass der Reichsgedanke der Realisierung der „Ideen von 1789“ entgegenstand, die ihrerseits durch Napoleons Eroberungspolitik eine erhebliche Relativierung erhielten. Deutschland als Nationalstaat war eine „verspätete Nation“. Die Nationalstaatsbildung von 1871 kam nicht durch eine geglückte Revolution demokratischen Charakters zustande (wie es in der Paulskirche von 1848/49 zunächst angedacht war), sondern durch preußische Politik in der Interpretation Bismarcks. Dessen Politik zielte auf Beseitigung des großdeutschen Lösungsansatzes der „deutschen Frage“, also der Ausgrenzung Österreichs aus der deutschen Geschichte, in Kombination mit der Relativierung der bis dahin regional verlaufenden deutschen Militärgeschichte. Bismarcks Streben nach Reichseinheit unter preußischen Konditionen orientierte sich zweifellos am „Primat der Politik“, dieses indes war nicht gesichert durch ein Parlaments-, sondern durch ein Königsheer. Militär wurde somit zu einem Faktor des Obrigkeitsstaates, getreu der Formulierung aus der Zeit der 1848/49er-Revolution, dass gegen Demokraten nur Soldaten helfen würden. Die bis 1935 gängigen Eidesformeln belegen es.22





























