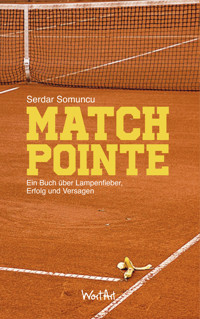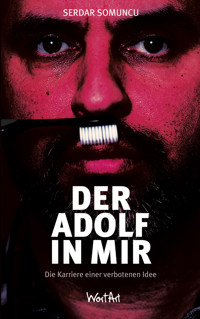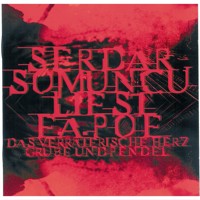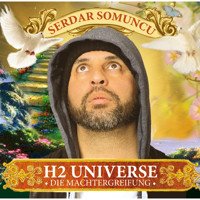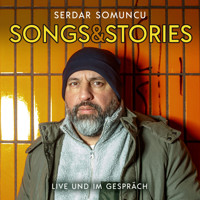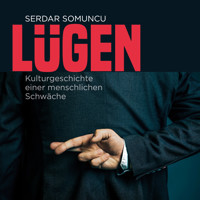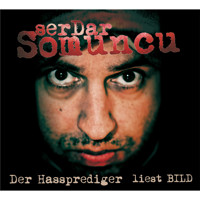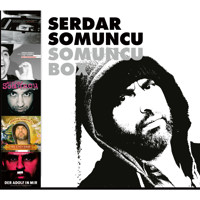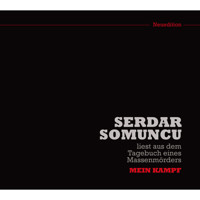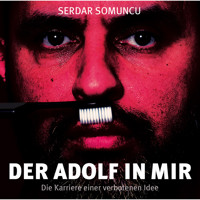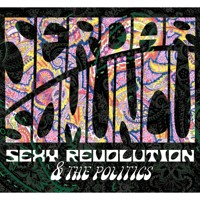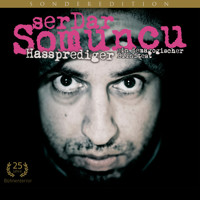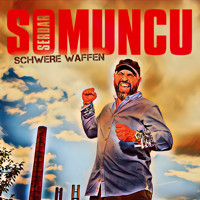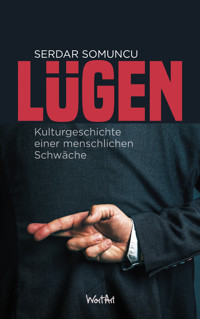
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WortArt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit Menschengedenken wird gelogen - aus Neid, Habgier, Rache, Not, Liebe, Angst und Wut. Aber wie entsteht die Schwäche des Lügens in uns und wie nutzen wir sie für unsere Ziele? Serdar Somuncu deckt anhand vieler Beispiele schonungslos und offen auf, was hinter den Lügen steckt und was sie für uns und unsere Gesellschaft bedeuten, wobei die Wahrheit in jeder Lüge gar nicht allzu weit entfernt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Buch widme ich allen lügenden Menschen.
Inhalt
Cover
Titelseite
Widmung
Inhalt
Vorwort
ABSCHNITT I
Ursprung, Formen, Beispiele
Formen der Lüge
Lügen und Wahrheit in der Natur
Die Lüge in Religion, Philosophie, Literatur und Sport
Ideologische Lügen – Diktaturen, Nationalsozialismus
Berühmte Lügner in der Literatur
Lügen im Sport
Kriminalfall
Politische Lügen – Lügen als Verkaufsstrategie
ABSCHNITT II
Gesellschaftliche Lügen – das unbekannte Gegenüber
Corona und die Wahrheit
Chronik der Pandemie
Im Würgegriff der Lügen zwischen Verschwörung und Verantwortung
Der unheimliche Machtmissbrauch der Presse
Der Groll der Abtrünnigen
Nein, ich habe nicht mitgemacht!
Ukraine-Krieg
Micky Maus trifft Adolf Hitler – Tucker Carlson interviewt Wladimir Putin
Das Märchen von der Unmöglichkeit des Friedens
Es sind auch unsere Toten
AfD – Nazis im Tarngewand
Björn Höcke – der unfreie Radikale
Ausländerkriminalität
Der Gaza-Konflikt
Lügen aus Rache
Gerüchte und Lügen über mich
Meine Lügen
Wohin führt das Lügen?
Identitätsfragen
Schlusswort
Impressum
Vorwort
Das Kind schüttelt den Kopf und bestreitet, heimlich genascht zu haben, der Pubertierende isst ein Pfefferminzbonbon, damit man seinen verräterischen Mundgeruch nach Zigaretten nicht riecht, der Ehemann betrügt seine Frau, Politiker belügen ihre Wähler, und selbst Tiere verstellen sich durch Mimikry, um leichter an Beute zu kommen.
Warum lügen wir? Wann lügen wir und wie lügen wir? Für die Psychoanalytikerin Anna Freud ist bereits die Geburt die erste Begegnung mit der Lüge, wird doch das Neugeborene mit dem Verlassen des mütterlichen Körpers der unwiderruflichen Tatsache ausgesetzt, dass eine Existenz im Bauch der Mutter nicht ewig währen wird und der Mensch irgendwann sich selbst überlassen bleibt. Diese Lüge ist also bereits die Hypothek des Lebens, die wir mit uns tragen, sobald wir auf die Welt kommen. Schon in dem Moment, in dem wir das Licht der Welt erblicken, lernen wir, eine weitere Wahrheit zu verdrängen, die uns unser Leben lang begleiten wird. Nämlich die Erkenntnis, dass wir eines Tages sterben werden. Eine unumstößliche und grausame Wahrheit, die nur dadurch zu ertragen ist, dass wir uns einbilden, dass das Leben unendlich sei. Eine Lüge, die uns davor bewahrt, an der Angst vor dem Tod zu verzweifeln.
Sobald wir Menschen anfangen, die ersten Sätze zu sprechen, fangen wir an, zu lügen. Durchschnittlich lügen Erwachsene 25-mal am Tag. Es scheint, als sei uns die Gabe, die Unwahrheit zu sagen, vom lieben Gott in die Wiege gelegt worden, um uns von der Sehnsucht zu befreien, so akzeptiert zu werden, wie wir wirklich sein wollen. Wir lügen aus Angst vor Kritik oder Strafe, aus Unsicherheit oder Scham oder aus Höflichkeit, um andere nicht zu verletzen. Es gibt Notlügen, Selbstbetrug und Ausreden, zwanghafte Lügner und Zwecklügner, Betrüger und Verleumder. Aber ist die Lüge nur eine menschliche Schwäche? Oder ist sie vielleicht eine Fähigkeit, die uns Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet? Ist sie manchmal sogar eine Stärke, oder ist sie eine schlechte Angewohnheit, die im klaren Gegensatz zur Moral steht? Widerspricht die Lüge tatsächlich der Wahrheit, oder ergänzt und erweitert sie diese sogar in manchen Fällen? Wo ist der Unterschied zwischen einer blühenden Fantasie und einer fehlgesteuerten Wahrnehmung?
Wenn wir lügen, bauen wir uns einen Ausweg aus der drohenden Geißel der Schuld, die in unserer Echtheit lauert. Wir nehmen unser Schicksal in die eigene Hand, gestalten eine neue Wirklichkeit, und gleichzeitig treten wir das Vertrauen in unsere Redlichkeit mit Füßen, wenn wir in Kauf nehmen, mit etwas verwechselt zu werden, was wir eigentlich gar nicht sind. Warum also gehen wir diesen Weg, und gibt es vielleicht sogar einen plausiblen Grund, dem Lügen eine Chance zu geben, indem man es versteht und annimmt, als eine menschliche Fähigkeit, die nicht aus der Unfähigkeit entsteht, die Wahrheit sagen zu können, sondern aus dem Anspruch, mit heiler Haut davonzukommen? Schon im Alten Testament steht, dass der Mensch nicht lügen soll, und dennoch sind wir Menschen immer wieder uns selbst ausgeliefert, wenn wir aus Angst vor Strafe und Schuld den scheinbar leichteren Weg gehen, obwohl wir wissen, dass er uns manchmal sogar direkt ins Verderben führt. Wir bauen uns in unserem Inneren eine Scheinwelt, in der wir die Bestimmer sind über das, was wir für unsere Wahrheit halten. Wenn nur wir selbst wissen, was die Wahrheit ist, indem wir sie dem anderen vorenthalten, sind wir selbstbestimmt und frei zu entscheiden, wie weit wir das Risiko eingehen, in unserem Kern erkannt und vielleicht sogar entblößt zu werden. Ist die Realität vor allem unsere subjektive Wahrnehmung und damit, aus anderer Perspektive betrachtet, auch eine Lüge? Und kann sogar der Rausch als Lüge des Gehirns an die Sinne verstanden werden?
Ist die Wahrheit immer die bessere Alternative? Wer will schon hören, dass er hässlich ist, wer will sagen, wie alt er wirklich ist, wie viel er in Wirklichkeit verdient, ob er Schulden hat, wovon er träumt und welche Schuldgefühle sein Handeln lenken. Ist es nicht auch eine Form der Lüge, wenn wir der Selbstoptimierung unserer Körper nachgehen, um anderen zu gefallen und gesellschaftlichen Normen zu entsprechen? Sind wir im sicheren Versteck der Lüge oft nicht viel näher an uns selbst als in der nüchternen Wahrheit? Auf diese Fragen möchte ich versuchen, in diesem Buch Antworten zu finden. Dabei betrachte ich nicht nur den Umgang unserer Gesellschaft mit Lügen, sondern auch die Entwicklung unseres Umgangs mit der Unwahrheit in Religion, Philosophie, Literatur, Sport, Politik und mir selbst.
ABSCHNITT I
Ursprung, Formen, Beispiele
»Die Sprache ist wie Raum und Zeit eine dem menschlichen Geist notwendige Anschauungsform, die uns die unsrer Fassungskraft fort und fort sich entziehenden Objekte dadurch näher bringt, daß sie sie bricht und zerbricht.«
Christian Friedrich Hebbel
Im Sturm der Worte
Ich spreche, also bin ich. Ich spreche, aber lüge ich auch? So einfach könnte man beginnen. Im Gegensatz zu anderen Lebewesen verfügen wir Menschen über eine besondere Fähigkeit: Wir können sprechen. Und mit jedem neuen Wort, das wir lernen, sind wir mehr dazu in der Lage, uns auszudrücken und unserer inneren Welt eine äußere Form zu geben. Sprache dient zur Verständigung. Wir können Sätze bilden und unsere Bedürfnisse, unsere Ängste und Sorgen, aber auch unsere Fantasien in Worte fassen. Wir können ganze Romane schreiben und Reden halten, wir können argumentieren und lamentieren, und wir können sogar Gedichte schreiben, in denen wir auf romantische Art und Weise Liebeserklärungen machen oder unsere Leidenschaft und Verzweiflung zum Ausdruck bringen.
Gerade in den sich verändernden politischen, technologischen und gesellschaftlichen Kontexten unserer heutigen Zeit ist die Bedeutung des Umgangs mit unserer Sprache größer denn je. Sprache ist nicht mehr nur Mittel zum Austausch von Informationen, sondern sie ist auch Zeichen einer Haltung, und nur wer mit ihr richtig umzugehen vermag, ist über jeglichen Verdacht erhaben, ein Wortverdreher, Rassist, Sexist oder gar Rabulist zu sein. Aber wer bestimmt über richtig und falsch? Welche Instanzen gibt es, die darüber wachen und entscheiden? Und wie können wir unser Verständnis von Sprache und deren Wirkung erneuern und an die Umstände der Zeit anpassen? Denn Sprache ist manchmal auch böse. Sie birgt Missverständnisse. Sie dient nicht nur zur freundlichen Kommunikation. Sprache ist ein variables Werkzeug, das Intelligenz erfordert. Sie ist die Waffe des Intellekts, sie kann ironisch und zynisch sein, sie kann barbarisch klingen und oft auch hetzen. Sprache kann ein Konglomerat aus allem sein, und wenn sie eindeutig ist, wirkt sie oft bedrohlich, obwohl die Eindeutigkeit nicht immer als Gefahr gesehen werden muss. Sie kann auch beleidigen und kränken. Sie kann aggressiv sein und verführend, sie kann motivieren und desillusionieren. Sprache ist die Übersetzung unserer sozialen Kompetenz. Und sowohl uns selbst als auch den anderen gegenüber vermittelt Sprache, wie wir denken und fühlen.
Wenn wir heute über unseren Umgang mit komplexen Meinungen und Ansichten sprechen, verschwenden und verlieren wir uns oft in hastigen Interpretationen des Unmittelbaren. Statt Absichten zu hinterfragen und zu verstehen, berufen wir uns dabei auf die konkrete Ebene unserer Empfindung und selten sehen wir, welche abstrakte Idee hinter der Aussage des anderen steht. Es scheint paradox: Je mehr sich unsere Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln, desto eingeschränkter scheinen wir in unserem Verständnis zu werden. Manchmal überhöhen und missverstehen wir Sprache sogar absichtlich, um sie unserer eigenen Moral anzupassen und sie wiederum zu einem Werkzeug unserer Auffassung von richtig und falsch zu missbrauchen. So ist es mittlerweile der affektive Habitus einer Nomenklatur von Besserwissenden, den alleinigen Anspruch auf die Deutungshoheit vielschichtiger Ausdrucksformen und Begrifflichkeit zu erheben, sie passend zu reduzieren und für eigennützige Kampagnen zu gebrauchen, die weder der Verständigung und dem Austausch noch der Aufklärung dienen, sondern lediglich kurzzeitig die soziale Selbstbestätigung innerhalb der eigenen Blase vorantreiben. Oft ist dabei die marktschreierische Antwort auf das Gegenüber eine viel entblößendere Darstellung der eigenen Intoleranz als der Schaden, den das angeblich Missverständliche an der Toleranz anrichten kann. Aus der vermeintlichen Beleidigung wird eine kalkulierte und gekränkte Unfähigkeit, sich auf das scheinbar durchschaute Gegenüber einzulassen, und sie mündet in ihrer trotzigen Reaktion, noch häufiger in persönlicher Diffamierung und Drohgebärden. Die daraus entstehende, verständnisstarre Empörung basiert meistens auf der Vervielfältigung oberflächlicher Kriterien und der Reduzierung auf neuralgische Einzelpunkte, sodass am Ende keinem der Beteiligten mehr klar ist, worin der eigentliche Mehrwert solcher selbstbefruchtenden Diskurse liegen soll. Indem die Bedeutung von Begriffen und Wörtern so auf ein Mindestmaß an Verständnis trifft, sorgt sie auch dafür, dass die Analyse der Inhalte an der Reproduktion der erwartbaren Klischees von Zuordnung und Fehlinterpretation scheitert.
Sprache wird zum kontaminierten Träger von Lügen und vagen Behauptungen und die berechenbare Reaktion darauf nichts anderes als ein Empören über die Orientierungslosigkeit der eigenen Auffassungsgabe. Das ist mehr als tragisch und in jedem antiken Drama besser besprochen als in der heutigen öffentlichen Realität. Es ist der Offenbarungseid einer unaufgeschlossenen Gesellschaft von Meinungsmachern, die freiwillig in den Abgründen ihrer eigenen Denkmuster gefangen bleibt, solange sie die Rage ihrer Resonanz in Sturheit absorbieren kann. Eine zum Neospießertum mutierte Spartenempfindlichkeit, die in ihrer inflationären Erscheinung an ihrer eigenen Unglaubwürdigkeit erstickt, je mehr sie sich potenziert. Und so entsteht aus dem bewussten Missverstehen eine Art Leugnung des Ursprünglichen, und eine Armada von Missverstandenen macht sich auf, um das Gesagte an das zu Denkende anzupassen und es somit seiner schlechten Absichten zu entblättern und dem Maßstab der eigenen Ideologie zu unterwerfen. Ein perpetuum pugna1, bei dem erst, wenn auch der letzte seinen literarischen Senf dazugegeben und sein altkluges Bäuerchen gemacht hat, der Spuk vorbei ist, und der nächste Hash- zum Hetztag werden kann.
Was aber können wir auf die Vielschichtigkeit der Sprache angewiesenen, modernen Menschen dagegen tun, dass wir in einem Zeitalter der absichtlich in Kauf genommenen Missverständnisse leben? Müssen wir wieder lernen, gelassener zu sein, oder müssen wir um die Deutung unserer Aussagen in den offensiven Widerstand gegen die Vermarkter ihrer eigenen Images von Political Correctness und künstlicher Echauffage treten? Oder müssen wir sogar gemeinsam lernen, wieder egaler zu sein? Denn egal bedeutet gleich und nicht gleichgültig. Erst, wenn wir zusammen lernen, wieder ein Mindestmaß an Gelassenheit zu entwickeln, und akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt, erst, wenn wir unterscheiden können, was bedrohlich daran ist, dass nicht alles, was von unseren kollektiven Normen abweicht, abwegig für unsere gemeinsamen Ideale ist, können wir auch unseren aufklärerischen Geist zielgerecht gegen die richten, die uns mit ihren Formulierungen in ihre ideologischen Fänge verwickeln. Solange wir dies nicht können, bleiben wir uns selbst ausgeliefert und bewegen mit unserer Aufregung nichts weiter als die große Kugel der eigennützigen Ambiguität, die am Ende niemandem etwas bringt, außer denen, die uns in ihrer Debattentauglichkeit schon längst am rechten Rand überholt haben. Den wahren Demagogen und Lügnern, die unsere soziale Integrität anzweifeln und unsere demokratische Konstitution angreifen, wenn sie glauben, die einzige Wahrheit für sich gepachtet zu haben.
Anmerkung zum Kapitel
1 Lat. ewiger Kampf, bei dem es um nichts geht
Evolution der Sprache
Sprache ist auch ein universelles Mittel der Auseinandersetzung zwischen Innenwelt und Außenwelt. Ein Werkzeug für unseren Verstand und zugleich ein Gewand für unsere Gefühle und gelegentlich sogar für unsere Moral oder unser Gewissen. Und je mehr wir lernen, zu sprechen, je mehr wir in der Lage sind, zu formulieren, desto verworrener wird das Konstrukt der Kommunikation und desto komplexer wird es, sich selbst herauszufiltern aus dem, was man sein will, und dem, was man wirklich ist, wenn man sich in Worte fasst und den Dingen eine Form gibt, die sie vielleicht gar nicht haben und derer es in vielen Fällen gar nicht bedarf. Denn die meisten Gefühle, die wir erleben, sind anders als die Beschreibungen, die wir dafür haben. Gefühle sind oft nicht eindeutig. Sie sind zusammengesetzt aus vielen Nuancen, aus Erfahrungen und Eindrücken. Sie können wechseln und unterschiedlich stark sein, und nicht immer sind Gefühle beherrschbar, schon gar nicht sind sie eindeutig zu definieren durch Begriffe und Beschreibungen. So bleibt die Sprache also nur ein Hilfsmittel auf dem Weg zum wahren Ich.
Der Kern unserer Existenz und die Basis unserer Empfindungen beruhen indessen auf Übertragungen und Verständigung, die jenseits des Konkreten liegt. Wenn wir als Kind lernen, der Mutter zu sagen, dass wir Hunger haben oder unser Zahn schmerzt, sehen wir in der Reaktion der Mutter eine Reflexion unserer Bedürfnisse. Wir wollen satt werden oder den Schmerz betäuben. Wir wollen, dass der andere uns versteht und sich um uns kümmert. Indem wir dazu in der Lage sind, uns auszudrücken, kommen wir schneller an unser Ziel. Wenn wir nur schreien oder weinen, weiß die Mutter nicht wirklich, was wir damit meinen, und oft gibt sie uns die Flasche, obwohl sie eigentlich merken müsste, dass es der Zahn ist, der uns den Verdruss bereitet. Dadurch, dass wir sagen können, was wir wollen, erreichen wir schneller und genauer unser Ziel. Sprache macht das Leben oft genauer, aber genauso oft auch komplizierter. Schon, wenn das Kind nicht mehr weiß, ob es Hunger auf ein Butterbrot hat oder einfach nur naschen will, gerät es in einen Zwiespalt. Und wenn ihm schließlich vom vielen Essen schlecht wird, hat es ein undefinierbares Gefühl aus schlechtem Gewissen und Bauchschmerzen, dem es sprachlich nur schwer einen Ausdruck verleihen kann. Es liegt dem Kind förmlich wie ein Kloß im Magen, dass es übertrieben hat und eigentlich lieber die Aufmerksamkeit der Mutter erreichen wollte, als wirklich seinen Hunger zu stillen. Aber es hat eben noch nicht gelernt, sich so auszudrücken, dass die Mutter nicht nur versteht, was es sagt, sondern auch erahnt, was dahintersteckt.
Das ist der Anfang unserer Geschichte. Der Moment, in dem wir als Kinder lernen, dass Sprache nicht nur dazu da ist, etwas zu sagen, was man will, sondern dass es auch bedeuten kann, dass man nur etwas sagt, damit der andere weiß, was man nicht will, oder das, was man will, in andere Worte fasst, um durch das Erkennen der dahinterliegenden Absicht eine tiefere Ebene von Geborgenheit und Verständnis zu erzeugen. Es ist der erste Schritt zu einer Erkenntnis, die einem sagt, dass es manchmal besser ist, nicht die Wahrheit zu sagen, und dass man oft schneller an sein Ziel kommt, wenn man etwas behauptet, was nicht ist, um damit entscheiden zu können, welche der angebotenen Alternativen zur Lösung des Problems man annimmt. Während Sprache zur Definition der ureigenen Bedürfnisse dienen soll, stellt die Lüge die Selbstbestimmung in der Befriedigung der Bedürfnisse dar und ermöglicht es dem Lügner, selbst zu entscheiden, welchen Weg er gehen will und welche der angebotenen Möglichkeiten für ihn die richtige ist.
Aus Wahrheit wird Lüge
Wann aber beginnt sich die Wahrheit zu verändern, wann beginnen wir unsere eigenen Wahrheiten zu schaffen? Gibt es wiederkehrende Motive, die uns dazu bringen, die Wahrheit zu verdrängen? Angst, Unsicherheit oder Egoismus? Wer definiert überhaupt, was Wahrheit ist? Hat nicht jeder Mensch auch das Recht, seine eigene Wahrheit zu schaffen und sie zu behalten, oder liegt in dem Anspruch einer objektiven Wahrheit auch so etwas wie Solidarität und Altruismus?
Muss man also die Wahrheit sagen, wenn man selbst nicht angelogen werden will, und kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass man angelogen wird, wenn man anderen nicht die Wahrheit sagt?
Und wie ist es mit den uneindeutigen Wahrheiten? Den Ansichtssachen und den Deutungen? Ist die Abweichung von der Norm der wahrgenommenen Realität schon eine Lüge? Macht man sich etwas vor, wenn man die Dinge anders sieht als der Rest der Menschheit und sie vor allem anders interpretiert? Und wer bestimmt das Diktat der übergeordneten Wahrheiten? Die Gesellschaft, die Familie, der Glaube oder schlicht und einfach das Gesetz?
Kehren wir also noch einmal zum Anfang des Gedankens zurück und versuchen wir dem Ursprung des Lügens auf die Spur zu kommen. In der Verdrehung der Wahrheit liegt vor allem ein meist selbstbezogener Zweck. Der Lügner will sich und seine Mitmenschen auch vor der Wahrheit schützen, indem er seine eigenen Wahrheiten schafft. Er baut sich eine Scheinrealität auf, in der nur seine Gesetze und Vorstellungen gelten, unabhängig davon, ob sie mit den Gesetzen und Vorstellungen der anderen übereinstimmen. Lügen ist nicht nur ein natürliches Schutzbedürfnis auf der Schwelle zum Egoismus, es ist vor allem eine kreative Lösung für die nicht zu bewältigende Schwere der Schuld, die auf einem lastet, wenn man wirklich zu dem steht, was man eigentlich will oder ist.
Lügen ist auch eine Verlagerung der Verantwortung, die man für sich und sein Handeln hat. Man verändert die Konstellation der Realität und damit auch der Schuld, die man dafür tragen könnte, Dinge zu tun oder zu denken, die nicht mit dem des Gegenübers konform sein könnten, und verlegt die Aufklärung auf einen späteren Zeitpunkt, an dem die Enttarnung der Lüge zu einer geminderten Schuld führt, die vom eigentlichen Motiv des Lügens sogar ablenkt und bestenfalls einen Ersatz schafft.
Lügen ist also nicht nur die bewusste Umkehrung von Realität in eigene Fiktion, Lügen ist auch ein Vertrauensvorschuss, den man sich nimmt, ohne dafür eine Bürgschaft zu geben. Man nimmt ihn sich, ohne zu fragen, und man tut etwas, ohne in Kauf zu nehmen, dass es nichts bewirkt.
Aber Lügen ist nicht immer verwerflich und schon gar nicht ungewöhnlich. Schon die Götter der griechischen Mythologie bewunderten die Verschlagenheit und Lügenkunst des Odysseus, der es immer wieder schaffte, durch seine Finten die Gottheiten zu Narren zu machen. Im Gegensatz zum redlichen Achilles, dem schlicht die Fertig-keiten zur kreativen Umwandlung der Realität fehlten, beherrschte Odysseus die Kunst des Lügens wie kein anderer und verschaffte sich dadurch sogar den nötigen Respekt der Götter. So ist das Lügen, abgesehen von der christlichen Verteuflung als Untugend, auch eine bewundernswerte Eigenschaft gewesen, für das es ein Übermaß an kreativer Energie und weniger Hinterhältigkeit braucht.
Im Gegensatz zu den Werten und Moralvorstellungen der christlichen Kultur galt das Lügen in der Antike so auch als List und Widerstand gegen die Unterdrückung durch übermächtige Gegner und scheinbar unüberwindbare Gefahr. Das trojanische Pferd, welches nichts anderes ist als eine holzgewordene Lüge, stellt bezeichnend dar, wie aus der Verachtung für jemanden, der die Wahrheit verklärt, manipuliert oder gar leugnet, eine Bewunderung für sein Geschick werden kann. Odysseus’ List ist zugleich Beweis für seine Tugend, den Mut und die Durchsetzungskraft gegen jegliche Widrigkeit des Schicksals. Während seine Widersacher an der Unfähigkeit scheitern, zu durchschauen, dass in der Verlockung auch eine Täuschung liegt, vermag der tapfere Odysseus seine Gegner durch immer wieder neue Ideen in den Wahnsinn und schließlich in den Untergang zu treiben.
Wenn wir also von der Lüge als verwerfliche Eigenschaft sprechen, übersehen wir allzu oft, dass die Lüge auch durchaus positive Funktionen haben kann und sowohl für den, der sie anwendet, als auch für den, der sie annimmt, eine harmlose Verdrehung der Tatsachen sein kann, die ihm größeren Ärger erspart. Denn oft ist die Wahrheit schmerzhafter als ihr Ideal. Oft schickt es sich sogar gerade in den Kulturen, welche die Lüge als Unzulänglichkeit und Schwäche brandmarken, viel weniger, dem Gegenüber die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, als ihn durch eine Lüge zu schonen. Lügen zu können, erfordert Kreativität, und kreativ zu sein, bedeutet, einen Zugang zu seiner »blühenden« Fantasie zu haben. Ohne Moral und Anstand die Unwahrheit sagen zu können, bedeutet auch, bei sich zu bleiben und seine Ideale zu verfolgen, sich nicht irritieren oder beeinflussen zu lassen und letztendlich den Mut zu haben, sich gegen die Vorstellungen und Macht der anderen durchsetzen zu können.
Lügen bedeutet also in gewisser Weise auch, sich unabhängig zu machen von den Maßen der gesellschaftlichen und kulturellen Normen. Es bedeutet, einen eigenen Weg zu suchen und zu finden, wie man mit den Gegebenheiten des Lebens umgehen kann, ohne sich davon zermürben zu lassen oder den Mut zu verlieren. Aber wie und wann entsteht diese Eigenschaft und weshalb entwickelt sie sich bei dem einen in die richtige Richtung und wird bei dem anderen zu einer lästigen Angewohnheit, bei manchen sogar zu professioneller Taktik und nicht selten auch zu einer Krankheit, von der man sich nur therapeutisch heilen lassen kann? Gehen wir dafür also noch einmal zurück in die Kindheit und betrachten anhand einiger Beispiele, wie das Phänomen des Lügens entsteht und wie es sich im Verlauf der Jahre weiterentwickelt, bis es bei manchem zu einer ausgefeilten Technik wird und bei manch anderem zu einer durchschaubaren Masche.
Kinderlügen
Es gibt eine wunderbare Fernsehwerbung, in der kleine Kinder vor einem Überraschungsei aus Schokolade sitzen und von einer erwachsenen Person angewiesen werden, die Süßigkeit nicht anzurühren, solange niemand im Zimmer ist. Wenn sie es schaffen, durchzuhalten, wird ihnen ein zweites Ei versprochen. Daraufhin verlässt die erwachsene Person das Zimmer und die Zuschauer können beobachten, wie das Kind mit sich hadert und letztendlich entscheidet, ob es der Versuchung erliegt, die Schokolade zu essen, oder die Qual erträgt, auf die Anweisungen des Erwachsenen zu hören.
In dieser Kopie des in den 60er Jahren durch den amerikanischen Wissenschaftler Walter Mischel erfundenen Marshmallow-Tests geht es vor allem um Selbstkontrolle. Jene Kinder, welche sich unter Kontrolle haben, scheinen gewappneter für das Leben, sagt man. Sie könnten später besser mit Kritik und Frustration umgehen, hätten ein besseres Selbstwertgefühl, führten stabilere Beziehungen und würden bessere Bildungsabschlüsse erreichen. Die Ergebnisse des Experiments, das in den 60er Jahren in einer Kita der Stanford-Universität in Kalifornien erstmals durchgeführt wurde, verhalfen dessen Erfinder Walter Mischel zu Weltruhm: Er wurde zu einem der bekanntesten Psychologen des 20. Jahrhunderts.
Der Marshmallow-Test misst das Vermögen, auf eine Belohnung zu warten, wenn diese mit der Zeit größer wird. Etwas, das auf Deutsch sperrig Belohnungsaufschub genannt wird. Zugleich zeigt es aber eindrucksvoll neben berechtigter Kritik an der Nachweisbarkeit und Anwendbarkeit der Ergebnisse des Tests, dass Lügen zu den Strategien von Kindern gehört, die am häufigsten und wirksamsten eingesetzt werden, um einem Entscheidungsdilemma zu entgehen. In vielen kleinen Momenten des Experiments kann man die Entstehung der Lüge beobachten, die zunächst nur eine Ausrede ist, sich aber schon in dem Moment, in dem die Lust über die Vernunft zu siegen scheint, sichtbar wird. Die Kinder erkennen die Herausforderung und zugleich sehen sie sich einer schwerwiegenden Entscheidung ausgesetzt, für die sie allerdings schon längst die Richtung eingeschlagen haben. Denn Schokolade, das weiß jedes Kind, isst man gern, und dafür bestraft zu werden, dass man etwas gerne tut, ist eigentlich ungerecht und mindestens irrational. Es macht also keinen Sinn, auf das zu hören, was einem der Erwachsene sagt, es sei denn, man fürchtet die darauffolgende Strafe und das einsetzende schlechte Gewissen, sobald man den Bann gebrochen und die Schwelle zum Verbotenen überschritten hat.
Was also passiert in unserem Gehirn, wenn wir in diesen Zwiespalt geraten, und wie lösen wir Erwachsene in ähnlichen Situationen die Nöte, in die wir geraten, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen der Diskrepanz aus dem, was wir wollen, und dem, was wir dürfen? Um zu lügen, muss man also mindestens auch einen Anreiz oder eine Belohnung haben. Es gibt natürlich auch notorische Lügner, denen es einfach Spaß macht, die Mitmenschen an der Nase herumzuführen, oder Menschen, die es nicht anders können, weil sie es so gelernt und erfahren haben. Und alle Warnungen, von »Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht«bis »Lügen haben kurze Beine«, bringen nichts gegen die Erfahrung, die man macht, wenn man einmal sein Ziel erreicht, ohne dass man dafür das Risiko eingehen muss, zu sich und seinen wahren Anliegen stehen zu müssen. Man kann sich durch die geschickte Verdrehung der Tatsachen ein ideales Szenario schaffen, in dem die Dinge so arrangiert sind, wie sie sein müssen, damit alles funktioniert. Und wenn man dafür seine Mitmenschen manipulieren muss, dass sie wie Möbelstücke als Teil einer inneren Welt ihre zugewiesenen Positionen haben, ist man nicht nur der Architekt seiner eigenen Realität, man gibt sich so auch die Möglichkeit der Veränderung und der Beeinflussung seiner Umgebung.
Untersuchungen von Neurowissenschaftlern haben ergeben, dass wir Menschen im Schnitt 25-mal am Tag lügen.Lügen gehört zu unserem Alltag. Im Grunde genommen stehen wir mit jedem Satz, den wir von uns geben, vor der Wahl, ob wir damit etwas preisgeben oder geheim halten wollen. Es ist auch unser gutes Recht, Dinge zu verschweigen oder sie so umzuformulieren, dass sie nicht mehr den Tatsachen entsprechen. Die Lüge ist also eine bewusste Umkehr der Wahrheit. Aber was passiert im Kopf, wenn wir lügen? Welche Areale unseres Gehirns werden dabei aktiviert, und ist es eine außergewöhnliche Leistung, die nur wir Menschen vollbringen können, wenn wir lügen? Man kann sich also folgende Reaktionen des Kindes auf die Frage des Erwachsenen vorstellen: »Hast du von der Schokolade genascht?« »Nein.« Das wäre eine glatte Lüge. »Nein, aber ich musste das Ei öffnen, weil ich sonst nicht an die Überraschung gekommen wäre« ist eine Ausrede gepaart mit einer Lüge. »Ja, denn ich habe es nicht ausgehalten und war neugierig« wäre die nackte Wahrheit. Ein Erwachsener würde vielleicht noch folgende Antworten geben: »Ja, weil es auch nicht leicht ist, sich zurückzuhalten, vor allem wenn man Schokolade mag.« Das ist eine Rechtfertigung und zugleich ein Eingeständnis der Schuld. »Ja, aber es war auch nicht die Rede davon, dass ich es nicht darf, wenn ich kein zweites Ei will« ist eine rhetorische Finte, die das Argument des Betrugs auflöst.
Es ist also vor allem eine Denkleistung, zu lügen und diese in einen Kontext zu stellen, in dem sie ihre Wirkung entfalten kann. Das Kind will mit der Lüge vor allem Strafe vermeiden, dafür, dass es seiner Neugier und seiner Lust auf die Schokolade folgt. Der Erwachsene hingegen will mit seiner als Argumentation getarnten Lüge vor allem sich und sein Verhalten relativieren und in einen zu rechtfertigenden Kontext stellen, der ihn hilflos und ausgeliefert erscheinen lässt. Das Gehirn muss also mehrere Areale aktivieren, um die Wahrheit auszublenden. Und je weiter entwickelt das Gehirn ist, desto mehr Möglichkeiten hat es, zu entscheiden, in welcher Konstellation und Intensität es den Weg der Lüge einschlägt, um damit sein Gegenüber zu täuschen, zu beschwichtigen oder schlicht abzuwehren. Jemand, der lügt, muss sich nicht nur eine neue Geschichte ausdenken, er muss auch die Wahrheit unterdrücken. Und nicht nur die Wahrheit der anderen gilt es zu verdrängen, sondern auch seine eigene. Am besten, indem man an seine eigene Lüge glaubt und sie innerlich zur Wahrheit erklärt. Diese Form der Selbstlüge scheint besonders ausgereift zu sein, da sie nicht nur die Wahrheit als Gegenstück zur Lüge erkennt, sondern sie vielmehr zu einem Teil einer neuen Wahrheit werden lässt, in der die Lüge ihr ebenbürtig ist.
Die Verklärung der Realität kann also neben der egoistischen Absicht, sich daraus einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, auch durchaus etwas Soziales haben. So gibt es zahlreiche Gründe, warum wir lügen, beispielsweise auch, um unsere Umwelt nicht zu beleidigen oder die Realität positiv zu verfälschen. Eine Zwecklüge kann den Vorteil haben, dass sie den anderen zwar auf einen Irrweg leitet, ihm aber gleichzeitig ein Bild einer Ordnung vermittelt, die der Lügende für ihn inszeniert. Und dafür bedarf es einer beträchtlichen Anstrengung, die das Gehirn in unterschiedlichen Arealen vollzieht. Während zum Beispiel die Wahrnehmung und Einordnung der einfachen Realität über die Sinne in den Rezeptoren des Großhirns übertragen und dort verarbeitet werden, bleibt die Interpretation der zunächst subjektiven Wahrheit in den Arealen der äußeren Hirnrinde, die auch für die Bewertung und Einordnung der Eindrücke zuständig ist. Für die perfekte Lüge muss also der Transport von der einen Hirnhälfte zur anderen vonstattengehen, ohne dass es dabei einen Datenstau oder gar eine Störung der Gedankenströme gibt. Beim Lügen muss man schnell sein und umdenken können. Oder einfacher gesagt, um die Wahrheit zu verändern und sie zu einer neuen Wahrheit zu machen, muss man sich nicht nur in sich, sondern auch in andere hineinversetzen können. Die Wahrheit muss dabei aktiv unterdrückt werden. Lügen ist Aufwand für das Gehirn. Sie sind ein hochkomplexes Gebilde, das sich zusammensetzt aus Eindrücken, deren Verarbeitung, der Beurteilung des eigenen Handelns und der Abwägung der Reaktion, die schließlich darin mündet, dass man eine Entscheidung trifft, den Weg zu gehen, der abweicht von der rationalen Norm, des Üblichen. Und so ist es auch nicht einfach, Lügen zu entlarven, denn der Komplexität, der veränderten Realität kann man nur eine ebenso komplexe Struktur der Aufdeckung entgegensetzen, die innerhalb des bestehenden Systems zu dessen Auflösung sorgen kann. Lügen zu entlarven ist daher genauso komplex wie das Lügen an sich. Selbst der Lügendetektor hat damit Schwierigkeiten. Hirnscanner stellen zwar Veränderung der elektrischen Spannung fest, wenn Menschen lügen, dennoch kann man nicht sicher erkennen, wann Menschen lügen. Vor allem kann man nichts darüber sagen, warum sie lügen. Im Grunde genommen kann man sich diesen im wahrsten Sinne des Wortes »Prozess« des Denkens und Lügens auch wie ein inneres Gerichtsverfahren des Gehirns in Verhandlung mit Eindrücken und Emotionen vorstellen, bei dem das angeklagte Ich die Wahl hat, die Wahrheit zu sagen, und dafür in Kauf nehmen muss, bestraft zu werden, oder so geschickt zu lügen, dass es den Richter von seiner Unschuld überzeugen kann und der Strafe entgeht. Wir alle haben unsere inneren Richter und wir sind auch Angeklagte und Anwälte unserer selbst. Und wenn wir uns schuldig machen, dann stehen wir ihnen Rede und Antwort. Wir suchen uns aber auch fremde Anwälte für unser Verhalten und stehen nicht selten auch vor fremden Staatsanwälten, die uns für unser Verhalten anklagen. Dabei geht es auch darum, ob wir den Mut haben, uns zu unseren Taten, Handlungen und Ideen zu bekennen, oder ob wir Ausdauer und Überzeugungskraft genug besitzen, sie zu leugnen. Sowohl der eine als auch der andere Weg erfordern eine enorme Leistung unseres Gehirns. Denn abgesehen davon, dass wir das Geschick und das Talent brauchen, unsere Tarnung zu organisieren und aufrechtzuerhalten, müssen wir auch gegen die inneren Widerstände kämpfen, die uns die Moral der Gesellschaft eingepflanzt haben.
»Lüge (= L.) [engl. lie, deception, fabrication], absichtliche wahrheitswidrige Darstellung, die gegeben wird, als ob es eine wahrheitsgemäße Darstellung wäre, und ohne das Einverständnis des Berichtsempfängers zum Getäuschtwerden. Ihre Formen sind: Falschbekundung und Verschweigen. Die psychol. Forschung befasst sich mit den Vorgängen beim Lügen und mit den Möglichkeiten, aufgrund von Ausdruckserscheinungen und von unwillkürlichen körperlichen Begleiterscheinungen das Lügen zu erkennen (…).«
Dorsch, Lexikon der Psychologie
Neuronale Strukturen – das lügende Gehirn
Betrachten wir noch einmal näher, was genau in unserem Gehirn geschieht, wenn wir lügen, und welche neurophysikalischen Abläufe dabei ablaufen. Hierzu schreibt der Philosoph und Autor Florian Rötzler in seinem Telepolis-Artikel Das lügende Gehirn vom 30. September 2005:
»In Zeiten der großen Terrorangst und des allseitigen Verdachts scheinen Neurowissenschaftler Gefallen daran zu finden, durch den Schädel der Menschen schauen zu wollen, um deren geheime Absichten ans Tageslicht zu bringen oder die Wahrheit hinter ihren Aussagen zu finden. Seitdem es die Möglichkeiten von Hirnscans gibt, wird der Kontinent Gehirn mit mehr oder weniger guten Experimenten vermessen. Besonders die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), die nahezu in Echtzeit und mit einer Auflösung von einem Kubikmillimeter neuronale Aktivität anhand der Veränderungen des Sauerstoffgehalts im Blut misst, muss für die Suche nach neuen Lügen- oder Wahrheitsdetektoren herhalten. Abgesehen davon, ob bildgebende Verfahren wie die fMRT tatsächlich das wiedergeben, was sie angeblich tun, gibt es verschiedene Ansätze, wie sich mit neuen Lügendetektoren nachweisen lassen soll, ob eine Person die Wahrheit sagt. Da gibt es einfache Methoden, physiologische Daten wie den Hautwiderstand zu messen, aber eben auch Versprechungen, über den direkten Einblick in das Gehirn eine täuschungssichere, lernresistente Kenntnis zu gewinnen. Seit Jahren schon versucht der Neurowissenschaftler Lawrence Farwell seine ›brain fingerprinting‹ genannte EEG-Technik an den Mann zu bringen. Im Gegensatz zur aufwändigen fMRI, bei der die Personen ruhig im Scanner liegen müssen, werden hier mit einem Stirnband, an dem Sensoren angebracht sind, die Gehirnwellen einer Person erfasst. Zeigt man dieser Bilder beispielsweise von einem Tatort, so ließe sich an den Reaktionen feststellen, ob die Person diesen kennt. Beim Wiederkennen käme es zu unwillkürlichen, nicht beeinflussbaren Reaktionen, die sich in spezifischen Gehirnwellen in Form von P300-Reaktionen – MERMER (memory and encoding related multifaceted electroencephalographic response) genannt – niederschlagen. Dem Einsatz der fMRI-Technik liegt die Annahme zugrunde, dass Lügen für das Gehirn ein aufwändigerer Prozess ist, als die Wahrheit zu sagen. Daher würde sich in bestimmten Arealen beim Lügen eine erhöhte neuronale Aktivität zeigen. Die Annahme, dass das Gehirn gewissermaßen auf Wahrheit voreingestellt sei, ist dabei sicher ein wenig vereinfachend. Bei einem Experiment mit fMRI wollen Neurowissenschaftler der University of Pennsylvania nun eine Methode entwickelt haben, um Lügen aufgrund der obigen Annahme von wahren Aussagen gar mit einer Trefferquote von 99 Prozent unterscheiden zu können. Neurowissenschaftler der Medical University of South Carolina (MUSC), die auch mit dem Polygraph Institute des Pentagon zusammenarbeiten, stellen nun in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Biological Psychiatry (›Detecting Deception Using Functional MRI‹) ein Verfahren mit der fMRI-Technik vor, dessen Genauigkeit bei 90 Prozent liegen soll. Die Studie wurde hauptsächlich von der Firma Cephos finanziert, die bereits nächstes Jahr die Technik auf dem Markt anbieten will. Die Forscher F. Andrew Kozel und Mark S. George haben für ihre Studie mit 61 gesunden Versuchspersonen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren gearbeitet und damit die angeblich bislang größte fMRI-Untersuchung in diesem Kontext durchgeführt. Es sei zudem die erste Studie, bei der die aktivierten Areale bei Individuen gemessen wurden und nicht über eine Auswertung der Gesamtgruppe. Für den Test führten die Versuchspersonen zunächst einen Scheindiebstahl in einem Raum unter Beobachtung durch. Sie sollten aus einer Schublade einen Ring oder eine Uhr ›stehlen‹ und das erbeutete Objekt dann in einem Schrank zusammen mit ihren Sachen einsperren. Im fMRI-Scanner wurden dann Fragen auf einem Bildschirm ausgegeben, die die Versuchspersonen mit Ja oder Nein mittels Drückens eines Knopfes beantworten sollten. Fragen, die den Ring oder die Uhr betrafen, sollten sie mit einer Lüge beantworten, die übrigen Fragen wahrheitsgemäß. Ihnen wurde eine Belohnung von 50 Dollar versprochen, wenn die Versuchsleiter nicht entdecken, dass sie beim Beantworten der Fragen im Scanner gelogen haben. Bei 30 Personen wurde geprüft, welche Areale beim lügnerischen oder wahrheitsgemäßen Beantworten eine erhöhte Aktivität zeigten. Das war normalerweise der Fall in insgesamt fünf Arealen, die mit dem Treffen von Entscheidungen, mit Angst und mit Impulskontrolle zu tun haben. Ein erhöhter Sauerstoffgehalt zeigte sich auch im Blut in den Regionen, die man Multitasking verbindet. Mit der zweiten Gruppe von 31 Personen wurde eine Blindstudie durchgeführt, d.h., die Wissenschaftler erhielten von den Personen nur die fMRI-Ergebnisse und sollten daraus aufgrund der zuvor gewonnenen Erkenntnisse ableiten, welche Person gelogen hat und ob dies beim Ring oder bei der Uhr geschehen war. Mit einer Erfolgsquote von 90 Prozent konnten sie das gestohlene Objekt bei den Personen dieser Gruppe identifizieren. Allerdings benutzten nicht alle Versuchspersonen die fünf identifizierten Areale, so dass es auch andere Aktivierungsmuster geben muss, die die Forscher nicht erkannt haben. Einige der Versuchspersonen versuchten auch, die Erkennung auszutricksen, indem sie beispielsweise bei wahrheitsgemäßen Aussagen die Atmung beschleunigten oder die Antwort verzögerten. Angeblich hatte dies aber keinen Einfluss auf das Ergebnis. Ausgangspunkt der Studie war ebenfalls, dass Lügen ein komplexerer Prozess ist als die Äußerung von Wahrheit, da Lügen die Unterdrückung der Wahrheit sei, man dabei eine kohärente Falschaussage kommunizieren, ein Wissen um den Kontext der Lüge haben und ein dem Angelogenen glaubwürdiges Verhalten vorspielen müsse. Andererseits sagen die Forscher selbst, dass Lügen allgegenwärtig sei und gesellschaftliches Verhalten ohne Lüge nicht funktionieren würde. Nicht lügen zu können, sei ein Zeichen von Neuropathologie. Immerhin stellen die Wissenschaftler heraus, dass ihr Versuch nicht unter realen Bedingungen stattgefunden hat. Für die Versuchspersonen gab es trotz Gewinnerwartung kaum etwas zu verlieren. Sie wurden nicht in den Test gezwungen, antworteten brav und blieben ruhig im Scanner liegen. Überdies war die Auswahl der Versuchspersonen – gesunde Angehörige der Universität – nicht repräsentativ. Möglicherweise reagieren Kriminelle oder Menschen, die gewohnheitsmäßig lügen, anders. Und ein weiterer wichtiger Punkt sei es, so die Forscher offenbar bedauernd am Ende ihres Artikels: ›Diese Technik kann nicht den Geist einer Person ›lesen‹.‹«
Was genau passiert in unserem Gehirn, wenn wir lügen? Kann man messen, ob jemand lügt oder ihn sogar der Lüge überführen? Diese Frage, die vor allem auch die Kriminalforscher beschäftigt, ist seit Jahrzehnten Grundlage zahlreicher Forschungen, die versuchen, dem Lügen wissenschaftlich auf den Grund zu gehen.
Zu diesem Zweck ist zunächst einmal von Bedeutung, wie die formale Definition der Lüge lautet. Es ist schwierig, nachzuweisen, wie Lügen im Gehirn des Menschen funktionieren. Zwar sind einzelne Hirnareale von Lügen betroffen und werden aktiviert, wenn ein Mensch die Unwahrheit sagt, genauso ist es aber auch möglich, dass Menschen absichtlich täuschen oder schlicht und einfach gewöhnt sind, die Unwahrheit zu sagen. Fest steht dabei, dass die Hirnforschung in Bezug auf die physikalische Evidenz zwar seit langer Zeit daran forscht, die neuronalen Prozesse des Lügens zu verstehen, aber gleichzeitig bisher noch kein Patenrezept dazu gefunden wurde. So ist auch der Einsatz von Lügendetektoren (Polygraphen) bis zum heutigen Tage umstritten, schließlich kann durch die reine Aufzeichnung bestimmter Energieflüsse und Bewegungen kaum festgestellt werden, ob der Proband lügt oder nicht. So könnte genauso gut ein Zehenwackeln während der Befragung dafür sorgen, dass bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden und man davon ausgehen könnte, dass es sich dabei um eine Lüge handelt.