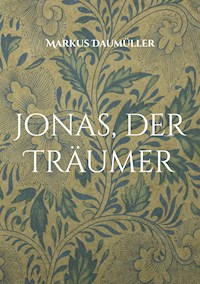Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Markus Daumüller, Privatdozent für Geschichtsdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Dr. paed., Diplom-Pädagoge, seit 22 Jahren Realschullehrer, unterricht, lehrt und lebt in Heidelberg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Spaß statt Denken
Systemzwerge statt Persönlichkeiten
Ohnmacht statt Gestaltung
Zersplitterung statt dem „Ganzen“
Hysterie statt Gelassenheit (Missverständnisse a,b,c,d)
„Das Recht auf garantierten Erfolg macht Bildung gerechter“
„Lehrpersonen sind ‚Manager‘ der Pädagogikfirma“
„Chancengerechtigkeit ist ein Maß für ‚Lernen‘ und ‚Studieren‘“
„Die Idee der ‚Kompetenzen‘ heilt Bildungskrankheiten“
Objekte statt Reflexionen
Rechte statt Leistung
Geld statt Werte
Doktrinen statt Erfahrung
Lasst die Schulen in Ruhe!
Anmerkungen
Alle Pädagogen haben eine geheime Neigung zumMenschen-Machen.
Hartmut von Hentig1
Vorwort
Gabriele Eckart nannte ihr Buch über das Leben im Havelländischen Obstanbaugebiet, in dem sie Protokolle aus der DDR sammelte: „So sehe ick die Sache“.2 Im Bildungsbereich existieren solche Bücher nicht. Alle halten den Mund und leiden schweigend unter dem Problem unserer Schulen: Deren Problem besteht nicht darin, dass in ihnen ein „veraltetes Lernen“ stattfindet. Sondern dass sie um jeden Preis modern sein wollen. Sie begreifen ihre „altmodische Andersartigkeit“, die einem beim Einatmen von gebohnerten Flurdielen begegnet, nicht als Chance, die Wirrnisse des Lebens aus einem geschützten Bereich heraus nüchtern analysieren zu können, sondern laufen mit gesellschaftlichen Fehlentwicklungen einfach mit. In dieser Streitschrift werden erziehungs- und bildungsphilosophische Aspekte mit einem breiten Spektrum an beruflichen Erfahrungen als Lehrer und in der Lehrerausbildung verbunden. Sie soll nicht irgendwelchen Leuten oder Meinungswellen gerecht werden, sondern unbeschriebene systemische Mechanismen in unseren Bildungsanstalten, die früher einmal „Schulen“ hießen und nicht „Lernwerkstätten“, einer bislang vom veröffentlichten Diskurs und den dort verbreiteten pädagogischen Schlagworten („längeres gemeinsames Lernen“, „Individualisierung“ usw.) getäuschten Öffentlichkeit zugänglich machen. Durch dieses Nachdenken über Bildungsmechanismen und Bildungswirklichkeit in unseren Schulen ist mit der vorliegenden Streitschrift eine kritische Theorie über Schulentwicklungen entstanden. Mit ihr wird offen gelegt, wie sich Entwicklungsprozesse im Bildungsbereich von ihren Akteuren lösen und verselbstständigen, bis die Ohnmacht, zu der am Ende alle verdammt sind, als Modernität inszeniert und als Erfolg verkauft wird.
1. Spaß statt Denken
In vielen Schulen geht es heute nicht mehr darum, über eine Frage nachzudenken, z.B. inwiefern das Sarrazin-Buch und die Debatte darüber Demokratie ausdrücken oder gefährden.3 Sondern darum, dass das gemeinsame Paddeln auf dem heimischen Fluss im „Ruder-Projekt“ Spaß macht. Und „Spaß“ bedeutet das Gegenteil von Selbstdisziplin und Ausdauer, von der gedanklichen Beschäftigung mit einer Fragestellung oder einem Problem. Der Unterschied dieser beiden Lernkulturen liegt in der exzentrischen Positionalität. H. Plessner hat den Begriff in der philosophischen Anthropologie verwendet und W. Rotthaus greift darauf in seiner systemischen Erziehungswissenschaft zurück.4Exzentrische Positionalität heißt: Der bildende Kern von „Lernen“ liegt in der Selbstbeobachtung des Lernenden. Wo Hartmut von Hentig die Aufgabe eines Pädagogen darin sieht, Lernende mit dem Problemhaften, dem Unklaren, dem der Erklärung Bedürftigen zu konfrontieren, weil die dadurch entstehende gedankliche Dissonanz Bewusstseins und Kognitionsentwicklungen anstößt und die Ein nahme exzentrischer Positionalität ermöglicht, hat die Sozialpädagogisierung von Schule heute Dimensionen erreicht, die diese auch als Freizeitclub durchgehen lassen würden. „Denken lernen“, meinte bereits Nietzsche, sei nicht mehr gefragt: „… man hat auf unsern Schulen keinen Begriff mehr davon.“5 Der Humboldt‘sche Bildungsbegriff ist tot. An seiner Stelle grassiert Befindlichkeitspädagogik, die von Lehrkräften, die sich nicht mehr als Bildungsexperten, sondern als Sozialpädagogen verstehen, als Bildung verkauft wird. Dass die Schule ein Reparaturbetrieb der Gesellschaft sein soll, ist auch das Ergebnis einer falschen Bildungspolitik: Verkehrs-, Friedens-, Medien-, Umwelterziehung, Gewalt- und Suchtprävention – es gibt fast nichts, was den Schulen nicht aufgetragen wird. Niemand aber hat die Lehrer gezwungen, diese Aufträge zu ihrem beruflichen Selbstverständnis zu machen und die Intellektualität von Lernen einer Freizeitmentalität zu opfern. Oft genug führt die gut gemeinte „menschliche Bildung“ der Sozialpädagogen-Lehrer zu einer inhumanen Lernkultur. Denn das – sicher notwendige, aber für das Orientieren in unserer komplexen Welt nicht hinreichende – „soziale Lernen“ führt nicht automatisch zu einer Verbesserung des Denkniveaus oder einer Generierung kluger Köpfe, die wir alle ziemlich dringend brauchen. Der Mensch ist ein sinnverwiesenes Lebewesen, das seinen Weltbezug neu konstruiert, wenn es zu neuen Erkenntnissen gekommen ist. Wer diesen Begriff von Humanität seiner Reflexion über das Lernen in unseren Schulen zu Grunde legt, muss zu dem Ergebnis kommen, dass die kognitive Unterforderung unserer Kinder im Unterricht eine zutiefst inhumane Angelegenheit darstellt, obwohl die so unterrichtenden Lehrkräfte Humanität auf ihre Fahnen schreiben.
In der öffentlichen Wahrnehmung gelten Schulen mit einer solchen Lernkultur als modern, flankiert durch Erkenntnisse der Hirnforschung. Diese besagen, dass Kinder mit „Freude“ besser lernen6 oder dass die Funktion der „Spiegelneuronen“ darauf verweise, wie wichtig es sei, Empathiefähigkeit auszubilden.7 Dass alle anderen Lernformen, in denen nicht die Freude, sondern anstrengende historische, politische, literarische Erkenntnispro zesse im Vordergrund stehen, gegen die Natur von Kindern (von Menschen) durchgesetzt werden müssten, schwingt bei der Inanspruchnahme psychologischer Forschungsergebnisse im Unterton immer mit. Diese Erkenntnisse bestätigen das beliebte Postulat von Lehrkräften, deren eigenen Prüfungsergebnisse eher unterdurchschnittlich ausfielen: Dass sie nämlich Kinder und keine Fächer unterrichten würden, und dass Noten nichts darüber aussagen, ob man ein „guter“ Pädagoge sei. Die Logik dieses Arguments will hingegen nicht einleuchten: Wer sich für sein Fach nicht begeistert, kann auch Kinder nicht gut unterrichten. Ein „guter“ Pädagoge „…denkt nicht in erster Linie an die Kinder, sondern mit den Kindern an die Sache.“8 Es geht ja – wie gesagt – nicht um die Vermittlung toten Wissens, sondern um die Auseinandersetzung mit einem fachlichen Problem. Und wer intellektuell nicht brennt, kann sich den Schülern auch nicht mitteilen. Wie soll eine Lehrkraft, die die Denksystematik ihres Fachs nicht verinnerlicht hat oder sogar als zu theoretisch ablehnt, Lernarrangements in den Unterricht einbringen, in denen eine sprachlich prüfbare Kognitionsentwick lung der Schüler stattfindet? Die Planung eines prozessorientierten Lernens im Fachunterricht ist nicht zu leisten, wenn die Lehrkraft vor allem pädagogischen Prämissen folgt. Eine Kontrastierung von Persönlichkeitsbildung (bzw. sozialer Kompetenz) und Fachbildung ist aber ebenfalls nicht nachvollziehbar: Persönlichkeit bildet sich in der gedanklichen Auseinandersetzung mit einem fachlichen Problem. Ohne Fachlichkeit bildet sich nur Performanz. Ohne Vertiefung eines fachlichen Problems bleibt das Verstehen sprachlos. Wo Schulen zu Bedürfnisanstalten der Gesellschaft mutieren und sich Lehrkräfte dann als Sozialpädagogen verstehen, gerät ihr Bildungsauftrag in Gefahr. Die Politik hat den Bildungsgedanken aufgegeben, weil sie Lehrkräfte fallen lässt, die Bildung gegen die Schule durchsetzen, denn das ruft das den Unmut der Anstrengungslosen hervor. Das Wichtigste im Unterricht an öffentlichen Schulen ist nicht der Bildungsauftrag, den ich so verstehe, dass Schüler ihre intellektuellen Grenzen ausweiten. Das wichtigste ist, dass Lehrkräfte keinen Ärger mit Eltern haben, die das alles bei jeder Gelegenheit für „zu schwierig“ halten. Das wichtigste ist, dass „Ruhe“ zwischen den Betroffenen der Schule herrscht, ganz egal, ob Ruhe Einverständnis oder Nichtkommunikation bedeutet. Lehrer, die ihre Schüler intellektuell fordern, sind aber unbequem und stören diese Ruhe. Sie sind keine Papageien, die einer Schlagwortpädagogik hinterherlaufen. Sie sind keine Menschen, die „Lernen lernen“ oder „länger gemeinsam lernen“ in den öffentlichen Raum katapultieren, sondern selbst über die Sinnhaftigkeit ihres Handelns nachdenken. Dazu gehört einerseits, offizielle Vorgaben kritisch zu betrachten und andererseits, an die Stelle der „Vermittlung“ von Stoff oder Denkfiguren den Diskurs über offene Fragen, Dilemmata, Probleme zu setzen. Eigentlich sollten solche Lehrkräfte den Sozialpädagogen-Kollegen und den Eltern gefallen, weil jeder Diskurs direkt an der individuellen Wahrnehmung der Schüler ansetzt. Stattdessen steht die Angst vor Überforderung und die Vermeidung von Elternbeschwerden im Mittelpunkt. Die Angst vor Überforderung wird synonym mit Schülerorientierung übersetzt, die intellektuelle Herausforderung mit „Hineinpressen von Schülern in Fachlichkeit“. Wir lernen: Schülerorientierung („Pädagogisierung von Lernen“) ja, weil sie gut fürs Image ist, Subjektorientierung („Herausforderndes Denken“) nein, weil sich dann die Eltern beschweren. So konditioniert eine Allianz aus Schulverwaltung, die „Ruhe“ in den Schulen haben will, Eltern, die die Überforderung ihrer Kinder vermeiden möchten und Sozialpädagogen-Lehrern, die ihren beruflichen Erfolg an die „Schülerorientierung“ ihres Unterrichts koppeln, die Sozialisation von Junglehrern. Diese lernen an allen Ecken und Enden des Systems, was einen „guten“ Lehrer ausmacht: Er ist warmherzig, aber etwas beschränkt. Kinderliebe bedeutet, Schüler auf keinen Fall zu überfordern. Diesen bringt er bei, wie man „Lernen lernt“, anstatt ihnen Erlebnisse zu ermöglichen beim gemeinsamen Nachdenken über ein Problem. Die deutsche Gesellschaft formt die Lehrpersonen, über die sie dann genüsslich in Feuilletons und Leserbriefen herzieht, wenn die „Kinderquäler“ bereits vom Pausenhof gejagt wurden. Reflexion der eigenen Rolle in diesem Kreislauf: Fehlanzeige. Was ist das theoretische Fundament eines solchen Schulsystems? Theodor Adornos Idee vom dialektischen Denken kann es nicht sein, denn Diskursivität bedeutet in diesem System Überforderung, weil keine lernbaren Ergebnisse entstehen, sondern nur mögliche Denkansätze.9 Immanuel Kants Idee vom Mut, selbst zu denken ist es ebenfalls nicht, weil „Denken“ mit „verkopftem Lernen“ gleichgesetzt wird.10 Dieses soll zugunsten des „Sozialen Lernens“ und des „individualisierten Lernens“ zurückgefahren werden, worin sich ein kruder Zivilisationsbegriff Bahn bricht. Reicht „Teamfähigkeit“ als theoretische Grundlage eines Schulsystems aus? Welcher Wert wird dann Genialen, Kreativen und Menschen mit Ecken und Kanten zugebilligt, die man früher einmal „Persönlichkeiten“ nannte?
Unbemerkt blieb bis heute, dass in den Schulen aus Bildung Schulbildung gemacht wurde11, und dass Schulbildung immer mehr zu einem Teil der Berufsbildung verkommt. In Wirklichkeit geht es in den Schulen nicht mehr um Bildung. Sondern um Ausbildungsreife: In „Kompetenzanalysen“, „Be rufsorientierung“ und „Anwendungsorientierung“, die das fachliche Lernen immer mehr aus dem Zeitbudget der Unterrichtsstunden verdrängen, findet diese Entwicklung ihren Ausdruck. Schulen sind zu Lehrwerkstätten der Betriebe mutiert, in deren Arbeitswelt „Teamfähigkeit“ noch immer als Schlüsselbegriff der „soft skills“ glänzt. Zitiert sei hier lediglich der Ausspruch des deutschen Textilunternehmers Klaus Steilmann (1929-2009): „Dauerhafter Erfolg ist nur im Team möglich.“12 Die Hochglanzbroschüren der industriellen Arbeitgeber tun dazu ihr Übriges. Es ist unbekannt, ob Gottlieb Daimler, Bill Gates oder Steve Jobs Teamplayer waren, als sie ihre Erfindungen machten. Sicher ist allerdings, dass sie genial wurden, weil sie ihre Neugierde gegen Konventionen durchsetzten, und dass sie eine Ahnung von ihrer Materie hatten. Keiner wird gezwungen, ein Lehrer zu werden, heißt es bei Eduard Spranger: Aber wer Klavierlehrer werden will, sollte auf dem Klavier spielen können.13
Dass der Unterricht heutzutage in vielen Fällen nur noch ein „creative meeting“ ist, also die Extraver sion und das Sammeln von Meinungen und Befindlichkeiten, führt uns zu einem ganz entscheidenden Punkt: Eigentlich sollte es in der Schule darum gehen, dass aus Menschen denkende Menschen werden. Und keine Funktionäre. Im Funktionieren sieht die Philosophin Hannah Arendt eine Perversion von Handeln, weil dieses von niemandem mehr verantwortet wird. Ihren Beobachtungen zufolge war Adolf Eichmann, der „Architekt des Holocaust“, ein neuer Typus von Täter. Es war keine Spur von Bösartigkeit an ihm, sondern völlige Gleichgültigkeit gegenüber den Folgen seines Tuns.14 Die exzentrische Positionalität als Kern von Bildung hat mit der gesellschaftlichen Verantwortung des Einzelnen mehr zu tun als die Teamfähigkeit. Exzentrische Positionalität bedingt eine selbstreferentielle Ausrichtung von Lernen. Lernsubjekte werden darin zum Referenzobjekt ihres Lernens. Die Teamfähigkeit hingegen dient der Verbesserung der Außenwirkung des eigenen Verhaltens. Ermöglichen, dass der Mensch zum Menschen wird oder erzwingen, dass der Mensch einem Verhaltenskonzept der Wirtschaft dienen lernt – das ist die Frage, die sich im Nachdenken über Bildung an der Schule stellt. Dass „Teamfähigkeit“ - ein Werbebegriff für angebliche Humanität in ökonomischen Prozessen - inzwischen zu einem so populären Wert schulischer Bildung geworden ist und vor allem von sozialdemokratischen Lehrkräften im Kampf der Schulkonzepte propagiert wird, befremdet umso mehr, je mehr sie als „humaner“ Wert verkauft wird, wo sie in Wahrheit nur Fremdbestimmung und Zwang bedeutet. George Bernard Shaw sagte einmal: „Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht Euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben!“15 Teamfähigkeit ist für Freigeister wie Gefängnis. Wollen wir die „Macher“ unserer Zukunft wirklich in Gefängnissen der Bildung einsperren und an die Tür „Chancengleichheit für alle“ schreiben?
Immer weniger ist es die Bildung von Menschen, um die Schulen sich kümmern. An ihre Stelle ist früher die Schulbildung getreten. Heute sind es nur noch der Zweck und die Frage nach Nützlichkeit. Wozu brauchen wir „Potenzterme“? Zugegeben, dieses Thema erscheint sinnlos, genauso wie alle anderen Themen, die nach dem Dreisatz behandelt wurden. Sieht man aber genauer hin, kann man sagen: Um Muster in Zusammenhängen erkennen zu lernen. Um erkennen zu lernen, welche Vorgehensweisen in bestimmten Situationen angemessen oder unangemessen sind. Man sieht: Es geht gar nicht ums Rechnen, sondern um die Ausbildung von Orientierungs- und Urteilsfähigkeit in der Wahrnehmung. Es ist, als bewege man sich in einem Labyrinth, in dem man Wege wiedererkennt. Kein Mensch braucht Potenzterme in seinem Leben. Fähigkeiten der Wahrnehmung, die sich in der Beschäftigung mit ihnen entwickeln, sind aber hilfreich. Ebenso ist es mit der Interpretation von Zeitungskommentaren oder Zeitzeugenberichten. Wo geht es um Fakten, wo um Interessen? Wie kann man den Anschein von Logik und den Beginn von Lesermanipulation auseinanderhalten? Dieser Selbstbeobachtung der eigenen Wahrnehmungstätigkeit und des eigenen Erlebens wohnt inne, was wir „Mündigkeit“ nennen. Die dieser fachlichen Auseinandersetzung immanente Herausbildung von Mündigkeit ist von dem Postulat der „Anwendungsorientierung“ abgelöst wor den, die inflationär mit dem Projektbegriff geschmückt wird: Ein Fest planen, die Gewinne eines Betriebs („Kuchenverkauf“) sozialverträglich optimieren, Kostüme und Zelte basteln, um die Ressourcen schonende Lebensweise der Indianer kennen zu lernen. Abgesehen davon, dass John Dewey, der den Projektbegriff pädagogisch prägte, sich angesichts dieser unterhaltsamen Beschäftigungen im Grabe umdrehen würde, wird schnell klar, dass fachliche Denksysteme in diesem Lernen keine Rolle mehr spielen.16 Stattdessen geht es um das Gelingen einer lebensnahen Aufgabenbearbeitung, die der Öffentlichkeit aggressiv mit drei Argumenten als „bessere“ Pädagogik verkauft wird: Sie sei näher an der Lebenswirklichkeit der Menschen, sie sei humaner und schülerorientierter, weil sie vom lebendigen Handeln und nicht vom toten Inhalt ausgehe, und sie sei nachhaltiger, weil die Kinder dabei zusammenarbeiten, füreinander Verantwortung übernehmen und somit sozial lernen.
Weil diese Logik als klar erscheint, wird sie leicht für wahr gehalten. Aber Klarheit und Wahrheit sind keine Synonyme. Eine Wahrheit ist, dass die Kinder in diesen Lernformen zu Marionetten einer als tugendhaft etikettierten Gesellschaftsvision ihrer Lehrer werden. Die Emotionen, Wahrnehmungen und Erlebnisse, die sie dabei machen, sind alle gewollt. Ein solcher Lernraum ist moralisch perforiert. Statt einer disziplinierten gedanklichen Arbeit in der umgreifenden Substanz bleibt leere Pflichterfüllung: Ist die Präsentation des Wissens, mit dem ich mich beschäftigt habe, schon erledigt? Was passiert, wenn einer auf den Tisch haut und sagt: „Am meisten verkaufen wir, wenn wir eine Werbung haben, die die Kunden einlullt! Unsere Arbeitsplätze sind dann am sichersten, wenn wir eine Illusion über unser Produkt verkaufen, auch wenn dieses qualitativ schlecht ist!“ Ist er dann ein böser Mensch, ein Egoist? Dem Basteln und Aufgabenbearbeiten der neuen Jakobiner wohnt das Bild des sozial verantwortlichen Menschen inne. Wie praktisch ist es, dass dieser Tugendterror hinter dem Spaß verblasst, den das Basteln (von Kostümen, von römischen Krapp-Bögen oder Limesanlagen) bringt. Im Spaß bleibt unbemerkt, dass das ergebnisoffene fachliche Reflektieren über die Bedeutung eines historischen Geschehens der Wertverpflichtung einer bereits feststehenden Erkenntnis geopfert wird. Beispiel: Wer das Schloss von Versailles bastelt, bekommt beim Basteln einen Eindruck davon, wie unglaublich ungerecht der Absolutismus gewesen sein muss: Ein Mensch, soviel Reichtum. Viele Menschen, soviel Armut. Weil Macht und Ungerechtigkeit an der Verteilung von Geld und Reichtum festgemacht werden, findet ein Nachdenken über Vor- und Nachteile des Absolutismus gar nicht mehr statt. Dieser bleibt als ein bösartiges, weil ungerechtes System im Gedächtnis kleben. Es existiert kein Einerseits – Andererseits. Einerseits: Konnten einheitliche Regelungen die Willkür der Adligen gegenüber den Bauern verringern? Konnten die Manufakturen der Beginn einer modernen Wirtschaftsform sein? Andererseits: Kann sich ein einzelner Mensch in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens auskennen und gute Entscheidungen treffen? Ist diese Form des Regierens, sobald man Fachleute wie Colbert benötigt, nicht eine Illusion von Macht? War der Absolutismus demnach Fortschritt oder Rückschritt gegenüber dem Mittelalter? Nach welchen Kriterien beurteilen wir das? Und dann einerseitsandererseits: Woran macht sich „Macht“ eigentlich fest? An Reichtum? An Befehlsstrukturen? An Zeremonien und öffentlichen Rollen? An Zukunftsentscheidungen? An Intelligenz?
Sowohl Diskurse über den Stellenwert des Absolutismus als auch Reflexionen der Phänomenologie von Macht sind im „Basteln“ obsolet, weil die Erkenntnis, der das Basteln dient, vorher bereits formuliert wurde. Es geht also nicht mehr darum, dass sich Mündigkeit im Diskutieren über die Bedeutung eines historischen Geschehens entwickeln kann, sondern um die Frage, wie man jemandem Toleranz, Solidarität und Empathie beibringt. Die Tugend als lehrbares Objekt. Kann man jemandem Selbstständigkeit und soziale Verantwortung beibringen? Das Lernen wird dadurch zu einer Spielwiese, auf der wir Schülern ein wenig Auslauf gewähren. Soll das die moderne, die „humanere“, die „schülerorientierte“ Bildung sein? Es ist grotesk, wenn die Vertreter „offener Lernformen“ behaupten, hier fände ein weniger künstliches, ein menschlicheres, ein lebensnahes Lernen statt, wo doch nur die geplante Aktivität an die Stelle des Denkens getreten ist. „An die Stelle des Hineinwachsens in ein substanzielles Ganzes“, so Karl Jaspers, „tritt bloßes Lernen von Dingen, die nützlich sein können.“17 Aktionismus statt Erkenntnis – das kann nicht ernsthaft die Zukunft unserer Schulen sein. Bildung muss auch zweckfreies Nachdenken über die Bedeutung von Sachverhalten sein dürfen. Nicht ohne Grund hat Wolfgang Klafki, der Fachmann für Didaktik, die Hauptaufgabe einer Lehrperson darin gesehen, zuerst für sich selbst, dann mit ihren Schülerinnen und Schülern, aus einem Bildungsinhalt einen Bildungsgehalt herauszuarbeiten.18 Diese Freiheit des Denkens ist für das Niveau schulischer Bildung wichtiger als Ruder-AGs oder Bastelaktivitäten. Sie lebt von Lehrpersonen, die intelligent sind, Freude am Durchdenken eines Sachverhalts haben, mit ihren Schülern in die Tiefe gehen wollen und deshalb verschiedene Sichtweisen zulassen. Solche Lehrpersonen - und jetzt benutze ich das zum „Schimpfwort“ an Schulen mutierte Wort doch – leben Intellektualität vor und mit ihren Schülern. „Lernbegleiter“, die gar nicht mehr präsent sind, entfachen keinen Denkhype in ihren Lerngruppen. Ohne eine Atmosphäre der Intellektualität sind sie nur noch Animateure eines aktionistischen Minimalismus. Dieser Einwand hat nichts damit zu tun, dass Schülern hier nichts zugetraut würde. Im Gegenteil: Wir alle möchten am Ende der Schule Mitbürger haben, die selbstständig über etwas nachdenken, und nicht solche, die Sachverhalte und Inhalte selbstständig adaptieren. Dazu wären Wikipedia, Google und Schulbücher da, aber nicht der Unterricht. An einem Beispiel soll dieser Unterschied deutlich werden: Im ersten Fall sollen die Schüler Informationen über Kriege und Terrorismus sammeln und dann ihre Meinung dazu aufschreiben. Herauskommen kann dabei nur, dass Kriege und Terrorismus schrecklich und unmenschlich sind. Ein moralischer Auftrag entsteht: „Wir müssen alles tun, um das zu vermeiden.“ Im zweiten Fall stehen Fragen im Mittelpunkt, auf die es keine eindeutigen Antworten gibt: Was ist „Terrorismus“, was macht einen „Terroristen“ aus? Wie werden aus ganz normalen, westlich lebenden Menschen wie den Jungs in Liverpool Terroristen? Kann man diesen Prozess beschreiben? Hier greifen Standarderklärungen